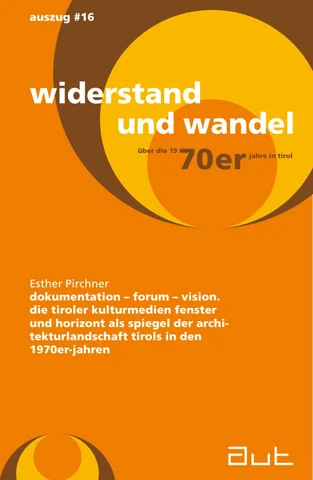auszug #16
widerstand und wandel 70er über die 19
Esther Pirchner dokumentation – forum – vision. die tiroler kulturmedien fenster und horizont als spiegel der archi tekturlandschaft tirols in den 1970er-jahren
jahre in tirol
impressum Herausgeber: aut. architektur und tirol (www.aut.cc) Konzept: Arno Ritter Redaktion: Arno Ritter, Claudia Wedekind Lektorat: Esther Pirchner Gestaltung und Satz: Claudia Wedekind Grafisches Konzept und Covergestaltung: Walter Bohatsch, Wien Gedruckt auf Magno Volume 115 g Gesetzt in Frutiger Lithografie und Druck: Alpina Druck, Innsbruck Buchbindung: Koller & Kunesch, Lamprechtshausen © 2020 aut. architektur und tirol, Innsbruck © der Textbeiträge bei den Autorinnen und Autoren © der Abbildungen bei den jeweiligen Rechteinhabern Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. ISBN 978-3-9502621-7-9
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Esther Pirchner dokumentation – forum – vision. die tiroler kulturmedien fenster und horizont als spiegel der architekturlandschaft tirols in den 1970er-jahren
Architektur als Kultursparte, die neben Literatur, Musik, bildender oder darstellender Kunst die gleiche Aufmerksamkeit verdient, war bis Ende der 1960er-Jahre in Tiroler Printmedien nur wenig präsent. Erst um 1970 sorgten zwei regelmäßig erscheinende Publikationen dafür, dass Architekten, Baukunst, aber auch Raumplanung, Städtebau sowie aktuelle gesellschaftliche und soziale Aspekte der Architektur einem breiten Publikum nähergebracht bzw. zur Diskussion gestellt wurden: Zum einen war dies das von 1967 bis 2001 im Halbjahresrhythmus erscheinende „Fenster – Tiroler Kulturzeitschrift“, das vom Landesrat für Kultur Fritz Prior gegründet wurde, zum anderen der „Horizont – kulturpolitische Blätter zur Tiroler Tageszeitung“, der von 1972 bis 1981 alle zwei Monate der Tiroler Tageszeitung beilag. Mit unterschiedlicher Ausrichtung, jeweils anderen Schwerpunkten und auch einem anderen Leserkreis rückten sie das Bauen und Planen in den Fokus. Während das Fenster, das als rund hundertseitige Broschüre im farbigen Einband erschien, sich an eine kulturaffine und wohl auch (humanistisch) gebildete Leserschaft richtete, wendete sich der Horizont als 16-seitige großformatige Zeitungsbeilage zur auflagenstärksten Tageszeitung Tirols an ein größeres Publikum und behandelte dementsprechend weiter gefasste Themenkreise. kultur als persönliches anliegen Welche Themen in dem jeweiligen Medium ausgewählt und wie sie bearbeitet wurden, zeigt die starke Prägung durch den Chefredakteur bzw. die Chefredakteurin. Für das Fenster, die Kulturzeitschrift des Landes, zeichnete Wolfgang Pfaundler (1924 – 2015) verantwortlich, eine der schillerndsten und zwiespältigsten Persönlichkeiten des Tiroler Kultur geschehens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: im Zweiten Weltkrieg Widerstandskämpfer, in den 1960er-Jahren – je nach politischem Lager und Sichtweise – Südtiroler „Aktivist“ oder verurteilter „Terrorist“, Volkskundler und Fachautor zur Tiroler Geschichte, Fotograf, Herausgeber des „Tiroler Jungbürgerbuchs“, enger Freund von Paul Flora, Manès Sperber und vielen anderen Kulturschaffenden. Den Ruf, der ihm in den 1970er-Jahren vorauseilte, umriss Felix Mitterer in seinem Nachruf auf Pfaundler 2015: „Die ‚graue Eminenz‘ von Tirol sei er, hieß es, der ‚Kulturpapst‘, man komme nicht an ihm vorbei, wolle man was werden.“1 Dass er „völlig freie Hand hatte“ und von den jeweiligen Kulturlandesräten – erst Fritz Prior, dann Fritz Astl – vor jeder inhaltlichen
140 141
Künstler und Grafiker gestalteten für den Horizont Titelseiten zum jeweiligen Schwerpunktthema: „Das verflixte Hochhaus“ von Karl Pfeifle (Horizont 18 / 1974, S. 1).
Einflussnahme geschützt gewesen sei, betonte Pfaundler noch in seinen kurzen Abschiedsworten in der letzten – der siebzigsten – Ausgabe des Fenster. Auch für den Horizont holte der Herausgeber der Tiroler Tages zeitung, Josef Moser, zunächst Pfaundler ins Boot, der sich jedoch nach drei Ausgaben wieder zurückzog. Ab der vierten Ausgabe lag die re daktionelle und inhaltliche Leitung des Blattes in den Händen der jungen Kulturjournalistin Krista Hauser (*1941), studierte Germanistin und ab 1967 Mitarbeiterin der Tiroler Tageszeitung. Obwohl dem Herausgeber direkt unterstellt, konnte sie „ihre“ Publikation ebenfalls frei gestalten. Hauser war eine der ersten JournalistInnen einer Tageszeitung in Öster reich, die sich des Architekturthemas umfassend annahm. Die Tiroler Tageszeitung zählte laut Hauser selbst zu den ersten Printmedien, die im Alltag „Architektur genauso gefördert [haben] wie alles andere“2. 57 Ausgaben lang – neben ihrer redaktionellen Arbeit in der Tiroler Tageszeitung – positionierte sie den Horizont als „junge, frische Beilage“, gab Themen vor, lud AutorInnen und KünstlerInnen zum Schreiben ein und schuf ein Forum für inhaltliche Auseinandersetzung und Kontroverse. Wie sehr das Medium mit ihrer Person verknüpft war, zeigte sich, als Hauser 1981 zum ORF nach Wien wechselte. Mit ihrem Abgang wurde auch der Horizont eingestellt. in einer zeit von aufschwung und aufbruch Beide Publikationen, Horizont und Fenster, waren Kinder ihrer Ent stehungszeit. Tirol um 1970 war dominiert von politischem, gesellschaft lichem und religiösem Konservativismus, das Land erlebte vor allem aufgrund der erheblichen Zuwächse im Tourismus seit den 1950er-Jahren einen ungewöhnlich starken wirtschaftlichen Aufschwung. Damit im Zusammenhang stand eine rege Bautätigkeit: Bauten für den Tourismus und Privathäuser, Kraftwerke und Verkehrswege entstanden in den Städten und ihrem Einzugsbereich wie in den entlegensten, aber touristisch attraktivsten Winkeln des Landes. Allzu oft war ein baulicher Wildwuchs im Dienste wirtschaftlicher Interessen die Folge, dem kaum Einhalt geboten wurde. Zugleich herrschte gerade in kulturellen Belangen eine spürbare Aufbruchsstimmung, die von jungen Künstlerpersönlichkeiten, Veranstal terInnen und Kulturinteressierten getragen wurde. Konservative Politik und die uneingeschränkte Hinwendung zum Tourismus wurden zu nehmend infrage gestellt, andere Lebens- und gesellschaftliche Entwürfe zumindest diskutiert. Sogar innerhalb der Kirche fand eine vorsichtige Öffnung statt: Das zeigte sich einerseits in der Jugendarbeit von Sigmund Kripp in der Innsbrucker MK und dem Jugendseelsorger Meinrad Schumacher im Jugendheim Wilten-West (siehe dazu den Beitrag von Andrea Sommerauer in diesem Band). Andererseits beauftragte die
Diözese Architekten wie Josef Lackner und Horst Parson damit, zeit gemäße Kirchen zu bauen, die auch in ihrer räumlichen Gestaltung der Hinwendung der Institution Kirche zu den Gläubigen entsprechen sollten (siehe unten). In diesem Feld zwischen Bewahren und Neugestaltung positionierte sich das Fenster sowohl als Vermittler aktueller künstlerischer Strömungen – ohne jedoch die etablierten Positionen auszusparen – als auch als dokumentarisches Medium für das historische Tirol und für althergebrachtes Brauchtum. Im Horizont lag der Schwerpunkt auf der Auseinandersetzung mit der aktuellen Kultur und Gesellschaft, aber auch hier gehörte – vor allem in der Reihe „Der Geschichtsdetektiv“ – ein Blick in die (ferne) Vergangenheit des Landes dazu.
142 143
architektur, eine soziale frage Dass auf Architektur, Raumplanung und Stadtplanung und ihre so ziale Bedeutung im Horizont besonderes Augenmerk gelegt wurde, erklärt Krista Hauser im Interview mit der herausragenden Bedeutung der Architektur für die Gesellschaft: „Architektur ist viel wichtiger als Theater und Konzerte, auch in eine Ausstellung muss man nicht gehen, aber jeder Mensch muss eigentlich in einer Stadt und er muss in einer Wohnung leben. Das ist das Entscheidende, warum Architektur für mich [die] wichtigste [Kunst] ist.“ Dabei ging es Hauser weniger um das einzelne architektonische Werk als vielmehr um die großen Zusammenhänge. Ihr Bewusstsein für soziale Fragen, das ihrer Einschätzung von Architektur zugrunde liegt, fand in der Themenwahl und -aufbereitung des Horizont seinen Niederschlag. Nach dem weitgehend unkontrollierten Wachstum der Städte und der Tourismusorte in Tirol seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs standen in den 1970er-Jahren Zersiedelung, raumgreifender Straßenbau, Hoch hausentwicklungen und „Jodler“-Architektur in Tirol immer stärker in der Kritik. Möglichkeiten, diese Entwicklung aufzuhalten oder ihr neue Richtlinien entgegenzusetzen, sahen viele in einer konsequenten Stadt planung und überregionalen Raumordnung. Nachzulesen ist dies in mehreren Schwerpunktausgaben des Horizont, die vor allem in der ersten Hälfte der 1970er-Jahre Land, Architektur und Bauwesen behandelten: „Architektur im Erholungsraum“ (Horizont 5 / 1972), „Gefahren und Chancen der Verstädterung im Alpenraum“ (Horizont 8 / 1973), „Soziale Architektur“ (Horizont 11 / 1973), „Das verflixte Hochhaus“ (Horizont 18 / 1974), „Stadtplanung heute: Kosmetik für Bausünden“ (Horizont 26 / 1976) und „Was man in Innsbruck retten muss“ (Horizont 41 / 1978).
rechte Seite: Drei „ästhetische Versuche, offen zur Selbstfindung des einzelnen, jenseits von Systemen“, von Helmut Grimmer (1940 – 75) präsentierte der Horizont in Ausgabe 4 / 1972.
Im Horizont war viel Platz, um sich dem jeweiligen Thema aus v erschiedenen Blickwinkeln anzunähern. Dazu gestalteten Künstler und Grafiker ein farbiges Titelblatt, die Editorials steuerte mehrere Jahre hindurch der Philosoph Manfred Schlapp bei. Als AutorInnen lud Krista Hauser nicht nur JournalistInnen, HistorikerInnen und SoziologInnen ein, sondern auch Architekten wie Josef Lackner, Friedrich Achleitner, Othmar Barth, Horst Parson und Roland Rainer. Sie kommentierten die Entwicklungen in Tirol und zogen Vergleiche mit Vorarlberg, der Schweiz und Südtirol. Friedrich Achleitner stellte etwa den missglückten Tourismusbauten in Tirol die zeitgenössische Architektur von Othmar Barth in Südtirol und tradi tionelle Bauwerke in einem Schweizer Bergdorf gegenüber. Othmar Barth schrieb 1973 – ein Jahr nachdem die Provinz Bozen aufgrund des Auto nomiestatuts die Wohnbauagenden übertragen bekommen hatte – über die Urbanisierung Südtirols in vergangenen Jahrzehnten. Horst Parson konstatierte einen Mangel an Sinnlichkeit in der Architektur seiner Zeit, Roland Rainer wertete den Hochhauswohnbau als Fiasko und Irrweg.
144 145
die architekten-umfrage im fenster Die Frage danach, was Architektur in Tirol bedeutet, stellte als Medium jedoch zuerst das Fenster. In der allerersten Ausgabe von 1967 präsentierte es eine Umfrage zum Thema mit fünf Fragen zur Qualität der Archi tektur in Tirol, den künstlerischen Ansprüchen der Bauherren, zur bau lichen Zukunft des Landes und zu konkreten Problemen bei der Ausübung des Berufs. Von allen 82 Mitgliedern der Ingenieurkammer für Tirol und Vorarlberg mit Geschäftssitz in Tirol, die das Fenster kontaktiert hatte, antworteten 42, darunter damals junge Baukünstler wie Josef Lackner und Horst Parson und international etablierte wie Clemens Holzmeister und Franz Baumann. Architekten, die am Tourismusstandort Tirol weiter bauten, steuerten ebenso Antworten bei wie solche, die einzelnen Bauten, der „Tiroler Dorfansicht [und dem] Tiroler Landschaftsbild“ ein zeitgenössisches, baukünstlerisch wertvolles Gesicht verleihen wollten. Neben den vom Fenster kontaktierten Mitgliedern der Kammer meldeten sich auch zahlreiche Studierende und Kammeranwärter zu Wort, die den Fragebogen kopiert und weitergereicht hatten, unter ihnen Dieter Mathoi, Bernhard Leitner, Richard Gratl und Michael Prachensky. Das Fenster druckte alle eingelangten Antworten, abgesehen von einer kurzen Einleitung Pfaundlers zur Umfrage, unkommentiert und un gekürzt ab – eine Momentaufnahme der überwiegend kritischen Beur teilung von Baukultur und (kaum vorhandenem) künstlerischem Anspruch
rechte Seite: Zu den Bauten von Gunter Wratzfeld schrieb der Vorarlberger Autor Elmar Vogt im Horizont 9 / 1973: „Architektur ist kein Fach für Träumer, sondern für Denker. Mit und aus Tradition gilt es, mit den Mitteln der Gegenwart der Zeit voraus zu sein.“
der Bauherren. Beklagt wurden Konservativismus, geringe Wertschätzung, unkontrollierte Ausbreitung der Siedlungen, Pfusch und mangelnde Zusammenarbeit der Bauherren mit Architekten. Verbesserungsvorschläge umfassten die Erhaltung der landwirtschaftlichen Flächen, die Durch führung von mehr Wettbewerben mit Fachjurys und eine Raumplanung durch Experten – Forderungen, die zum Teil bis heute bestehen. Trotz der Ausführlichkeit, mit der die Umfrage im Fenster 1 / 1967 behandelt wurde, ist zu bezweifeln, dass sie eine weiterführende all gemeine Diskussion auslöste oder auch nur eine umfassende Kontroverse innerhalb der Leserschaft des Fenster. Das Medium veröffentlichte keine Auswertung der Umfrage und die zwischen 1967 und 1969 publizierten Reaktionen beleuchteten nur einzelne Aspekte oder wirkten mit wenigen
146 147
Die enge Verbindung von Tiroler Tradition und zeitgenössischer Kunst im Fenster wurde auch in Wolfgang Pfaundlers Fotografien wie jener der Pfarrkirche in Völs von Josef Lackner sichtbar (das Fenster 5 / 1969, S. 367).
Ausnahmen beliebig gewählt: Als Erstes erschienen Karikaturen von Bernhard Leitner (das Fenster 2 / 1967), dann ein „Minimalprogramm, um das Inntal in letzter Stunde vor der Verhäuselung und Verschandelung zu retten“ des US-amerikanischen Universitätsprofessors für Industrial Ad ministration Alfred Timm (das Fenster 3 / 1968). Architekturkritiker Friedrich Achleitner rief die „Ungenützte Tradition der Tiroler Moderne“ in Erin nerung (das Fenster 3 / 1968), die Bauausschussmitglieder des Innsbrucker Gemeinderats Rudolf Brix (SPÖ) und Wilhelm Steidl (ÖVP) nahmen Stellung (das Fenster 3 / 1968) und der Ordinarius für „Baukunst und Entwerfen“ an der Technischen Hochschule Graz, Ferdinand Schuster, steuerte einen Vortrag zu „Architektur und Landwirtschaft“ bei (das Fenster 5 / 1969). Schließlich stand die Umfrage selbst in der Kritik: Der Münchner Soziologe Karolus Heil („Die unschuldigen Architekten“, das Fenster 4 / 1968) be mängelte unter anderem, dass einzelne Fragen von Architekt en gar nicht beantwortet werden könnten und andere auch von anderen Berufs gruppen hätten beantwortet werden müssen. Nach dem Abdruck einer letzten „scharfen Kritik“ (Fenster 6 / 1969) von Paulhans Peters, Chef redakteur der Fachzeitschrift für Architektur Baumeister, die sich gegen Ferdinand Schusters Beitrag und dessen Bebilderung mit Josef Lackners Kirche in Völs richtete, fand keine weitere Auseinandersetzung mit der Umfrage innerhalb des Mediums mehr statt. Demgegenüber nahm die Vorstellung einzelner (Groß-)Bauten, von prägenden Persönlichkeiten und nicht zuletzt von Konzepten, Zukunftsvisionen und Utopien für Innsbruck und Tirol weiterhin breiten Raum ein. dokumentarische aufarbeitung Sowohl Fenster als auch Horizont begleiteten und kommentieren in den 1970er-Jahren das aktuelle Baugeschehen. Die Bandbreite reichte von der Kletterskulptur für Kinder bis zur Autobahn, angesichts der Erschei nungsweise alle zwei (Horizont) bzw. sechs Monate (das Fenster) konnten jedoch nur einzelne Bauwerke hervorgehoben und keine lückenlose Doku mentation geleistet werden. Eine kurze Fotoserie der Werke eines bildenden Künstlers oder Architekten bzw. Architekturbüros veröffentlichte der Horizont jeweils auf Seite 7, darunter die Tonarchitektur von Bernhard Leitner (Horizont 1 / 1972), drei Entwürfe von Helmut Grimmer (Horizont 4 / 1972), Inneneinrichtungen von Egon Rainer (Horizont 7 / 1973), Grafiken von Max Peintner (Horizont 8 / 1973), Bauten „ohne Satteldach“ von Gunter Wratzfeld (Horizont 9 / 1973) sowie die Kirche zum hl. Canisius und die Auferstehungskirche Neu-Rum von Horst Parson (Horizont 10 / 1973 und 40 / 1978). „Beiträge zu einer humanen Architektur“ des Schweizer Büros Guhl Lechner Philipp (Horizont 17 / 1974), Zeichnungen von Arno Heinz (Horizont 50 / 1979), Bauten von Günther Norer (Horizont 58 / 1981) und Modelle von Studenten der Innsbrucker Architekturfakultät (Horizont 60 / 1981) ergänzten die Reihe.
Einer der wenigen Bildungsbauten, die im Fenster vorgestellt wurden, war die Volksschule in Vomp von Günther Norer mit Margarethe Sentobe (das Fenster 16 / 1975, S. 1626).
148 149
Carl Pruscha plante die Bauten für eine ganze Region in Nepal, unter anderem das Institut für Nepals Entwicklungsplanung bei Kirtipur (das Fenster 16 / 1975, S. 1610).
rechte Seite: Der Horizont widmete die Seite 7 der Vorstellung von Kunst- und Bauwerken wie der Kirche zum hl. Petrus Canisius in Innsbruck von Horst Parson (Horizont 10 / 1973, S. 7).
Der Bau von Kirchen und Schulen war in den 1960er- und 1970er- Jahren in Tirol so bestimmend wie sonst selten: siebzig Hauptschulen, 24 Volksschulen und 21 mittlere und höhere Schulen entstanden bis 1975 (das Fenster 16 / 1975). Bei den Kirchen sind jene von Horst Parson und Josef Lackner anzuführen, darunter jene in Neu-Arzl, die bei der
150 151
Auf 55 Seiten stellte das Fenster das neu eröffnete ORF Landes studio Tirol von Gustav Peichl 1972 mit mehreren Plänen vor (das Fenster 11 / 1972, S. 986).
Architekten-Umfrage des Fenster am häufigsten als Beispiel für gute Ar chitektur genannt wurde. Als gelungene Bildungsbauten galten die Schule der Ursulinen von Josef Lackner, das Schigymnasium Stams von Othmar Barth, die Volksschule in Vomp von Günther Norer und Margarethe Sentobe, das Schulzentrum in Wörgl von Viktor Hufnagl sowie die Haupt schule in St. Johann von Team A Graz. Allerdings wurden nur wenige dieser Bauwerke in Horizont und Fenster publiziert – möglicherweise fanden sie auf den Kulturseiten der Tiroler Tageszeitung ihren Platz. Mehr Beachtung erhielten kleine, baukünstlerisch interessante Privat bauten, Bauwerke, die zu einzelnen Großereignissen wie den Olympischen Spielen errichtet wurden, und singuläre Erscheinungen in der Tiroler Baulandschaft. Mit den Bauten im Dienste des Sports im Allgemeinen und zu den Olympischen Spielen 1976 im Besonderen setzten sich Jörg Streli und Josef Lackner im Horizont 25 / 1976 kritisch auseinander. Streli ortete im Zusammenhang mit der „Landschaft als Sportarena“ „enorme Boden spekulationen“, „eine Reihe von Umweltproblemen, die sich gerade in hochalpinen Regionen besonders kraß auswirken“ und eine „erschrecken de Störung und Verschandelung“ der hochalpinen Regionen durch bauliche Eingriffe. Lackner beschrieb die Bauten des Olympischen Dorfs als „Allerweltsarchitektur“ auf „ausgetretenen Pfaden“, sah an Lift anlagen die „Almluft durchs Gebälk“ wehen, lobte aber auch technische Finesse und gestalterischen Wagemut, die die Standseilbahn in der Axamer Lizum auszeichneten. Als außergewöhnliches Bauwerk wurde das ORF Landesstudio Tirol zur Eröffnung 1972 präsentiert: Das Fenster räumte Bau und Institution 55 Seiten und damit knapp die Hälfte seiner elften Ausgabe für eine Darstellung ein – einschließlich der Baupläne und einer Beschreibung der Architektur von Gustav Peichl. Als Sonderfälle Tiroler Architekturschaffens wurden schließlich zwei Großprojekte in anderen Erdteilen ausführlich besprochen: Carl Pruschas Konzept für die Revitalisierung und Neubesiedelung des nepalesischen Katmandu-Tals, das er als UNO- bzw. UNESCO-Berater der nepalesischen Regierung umsetzen konnte (das Fenster 16 / 1975), sowie Heinz Planatschers Entwurf für das Paradise Valley Development in Südafrika, einer neuen Stadt für 15.000 weiße EinwohnerInnen (das Fenster 18 / 1976). ich, architekt Doch nicht nur einzelne Projekte erhielten im Fenster und Horizont große Aufmerksamkeit, auch die Architekten selbst wurden detailreich porträtiert. Zu einer der herausragenden Qualitäten des Fenster gehörte, dass in jeder Ausgabe zunächst ein Tiroler Kunstschaffender, ab Ausgabe 20 / 1977 zwei in ihren eigenen Worten und mit Bildern ihrer Werke vor gestellt wurden. In der Reihe unter dem Titel „Das Tiroler Porträt“ wurden
152
Interviews mit Künstlern, vereinzelt auch Künstlerinnen, im lediglich sprachlich geglätteten Originalton wiedergegeben. Seltener schrieb Wolfgang Pfaundler über einen Künstler oder beauftragte andere Auto rInnen damit. Die umfangreichen Ich-Erzählungen waren nicht nur für die Zeit ihres Erscheinens präzise Bestandsaufnahmen der jeweiligen künstlerischen Positionen und Biografien, sie zählen auch bei manchen der damals Porträtierten bis heute zu den umfangreichsten authentischen Quellen. Neben Literaten, bildenden Künstlern und Komponisten fanden sich etliche Architekten und Künstlerarchitekten im „Tiroler Porträt“. Pfaundler legte den Schwerpunkt dabei zwar auf junge Kunstschaffende, ließ aber auch renommierte Architekten und Ingenieure zu Wort kommen, die auf eine lange Karriere zurückblicken konnten. Gleich die erste Persönlichkeit aus dem Bauwesen, die im Fenster porträtiert wurde, zählte zu dieser zweiten Gruppe: 1970 interviewte Pfaundler den Ingenieur Karl Innerebner zu dessen 100. Geburtstag. Als Erbauer von Kraftwerken und Seilbahnen, Bergbahnen und Straßen zählte er zu jenen, die das Gesicht Tirols entscheidend geprägt und wesentliche Voraussetzungen für den Wandel zum Tourismusland geschaffen hatten. Der zweite, nur wenig jüngere Grandseigneur der Tiroler Bauund Architekturszene war Clemens Holzmeister, der zum 90. Geburtstag ein „Tiroler Porträt“ im Fenster erhielt (das Fenster 18 / 1976). Ansonsten wählte Pfaundler überwiegend junge, aber bereits arrivierte Architekten und Architektenkünstler aus: Die ausgebildeten Architekten Walter Pichler und Max Peintner wurden als bildende Künstler vorgestellt (das Fenster 11 / 1972 und 13 / 1972), Bernhard Leitner konnte sich und seine Entwürfe von Ton-Architektur für die Olympischen Spiele in München 1972 sowohl im Fenster 9 / 1971 als auch im Horizont 1 / 1972 präsentieren. Drei ausübende Architekten aus Tirol interviewte Wolfgang Pfaundler Ende der 1970er-Jahre: Othmar Barth (das Fenster 20 / 1977), Josef Lackner (das Fenster 22 / 1978) und Johann Georg Gsteu (das Fenster 23 / 1978). Illustriert wurden die Ich-Erzählungen mit aktuellen Werken bzw. bei Lackner, dessen Bauten in früheren Ausgaben des Fenster schon mehrfach dokumentiert waren, mit Modellen jener Projekte, die (noch) nicht umgesetzt worden waren. konzepte, visionen, utopien Im Horizont fanden sich ebenfalls Porträts von und Interviews mit einzelnen Architekten, darunter ein Gespräch mit Josef Lackner in der Reihe „Interview mit den Kulturgewaltigen“ (Horizont 18 / 1974) und ein Porträt von Heinz Tesar unter dem Titel „Architektur: Abschied vom linke Seite: Heinz Gamel, Arno Heinz und Peter Thurner analysierten 1976 im Horizont „Innsbrucks Stadtgestalt“ und illustrierten ihren Beitrag mit Karikaturen der Maria-Theresien-Straße als Naturidyll, Verkehrsknotenpunkt oder Neubauviertel (Horizont 29 / 1976, S. 8).
154
Experiment“ (Horizont 20 / 1975). Zudem banden beide Medien – der Horizont mehr noch als das Fenster – Architekten als Autoren ein und boten ihnen so eine Plattform, Ideen zu entwickeln und diese mit einem breiten Publikum zu teilen. Etliche nützten diese Möglichkeit, um in die Diskussion um eine notwendige Veränderung im Land ihre Konzepte, Visionen oder gar Utopien für Innsbruck und Tirol einzubringen. Während sich manche auf die zeitgemäße Gestaltung einzelner Wohnungen beschränkten wie Robert B. Hartwig mit seinem Konzept des „Flexiblen Wohnens“ (Horizont 4 / 1972), entwarfen andere städte- und raumplanerische Konstrukte, die einen ganzen Katalog an Neuerungen umfassten. Dazu gehörte die Abschlussarbeit, die die Architekten Manfred Pirchner und Wolfgang Neururer 1971 / 72 an der Akademie der Bildenden Künste in München eingereicht hatten und im Fenster vorstellten (das Fenster 14 / 1974). Unter dem Titel „Strukturanalyse und Stadtentwicklungs plan Innsbruck“ gingen sie von einer Gliederung der Stadt in drei Bezirke aus und von sozialen, planerischen und baulichen Maßnahmen, die Innsbruck (wieder) zu einer „Stadt mit hohem Lebenswert“ machen sollten. Josef Lackner entwarf etwa zur selben Zeit als Reaktion auf die negativen Auswirkungen des Straßenbaus in Tirol die Vision einer „zweiten Generation der Autobahn“, die großteils unterirdisch oder zwischen Dämmen verlaufen und von Elektroautos befahren werden sollte (Horizont 16 / 1974). Eineinhalb Jahre zuvor hatte er bereits unter dem Titel „Mit einem Hauch von Utopie: Umschau im Land im Gebirg“ im Horizont zum Thema „Gefahren und Chancen der Verstädterung im Alpenraum“ (Horizont 8 / 1973) eine ideale Zukunft Nordtirols skizziert. 1976 erschien ebenfalls im Horizont ein Beitrag von Heinz Gamel, Arno Heinz und Peter Thurner zu „Innsbrucks Stadtgestalt“, in dem sie Topografie, Wachstum der Stadt, Anlage der Straßen u. a. analysierten und die Stadt neu dachten (Horizont 29 / 1976). Alle diese Beiträge befassten sich mit dem ernüchternden Status quo und enthielten Verbesserungsvorschläge für die Zukunft. Manches davon liest sich auch heute noch utopisch, etwa Josef Lackners Vorschlag einer Rückführung der Talböden in Landwirtschaftsflächen – ab gesehen von historischen, schützenswerten Häuserensembles, die wie Inseln im Grünen liegen sollten – und eines Umzugs der EinwohnerInnen in „Kompaktstädte“ an den Hängen der Martinswand und in den Tal schlüssen. Anderes klingt seltsam vertraut: Lackner plädierte für eine Verlegung des Fernverkehrs unter die Erde, während Wolfgang Neururer und Manfred Pirchner vorschlugen, in allen Stadtteilen die Grünflächen zu vergrößern, Wohnraum zu schaffen, Gesamtschulen einzuführen linke Seite: Nach der Ölpreiskrise sollten Städte energiesparend geplant werden. Arno Heinz präsentierte im Horizont 1974 ein „städtebauliches System von morgen“ von Robert B. Hartwig (Horizont 13 / 1974, S. 12).
und den öffentlichen Verkehr zu stärken. Arno Heinz beschäftigte sich aufgrund der Ölpreiskrise 1973 mit Möglichkeiten zur Energieeinsparung im Bauwesen und zur Nutzung alternativer Energien (Horizont 13 / 1974). Gemeinsam mit Heinz Gamel und Peter Thurner kam er darüber hinaus zu dem Schluss, dass „der Architekt wieder seine Rolle als Formgeber im städtischen Raum spielen und nicht nur Organisator der Produktion einer baulichen Quantität sein“ solle.
156 157
medien mit strahlkraft? Ob aber utopisch oder vertraut – alle diese Zukunftsvisionen sind eng mit der Zeit und dem Ort ihrer Entstehung verknüpft. In den aus gehenden 1960er- und den 1970er-Jahren mehrten sich in Tirol – unter anderem ausgelöst durch die Ölpreiskrise – die Zweifel am unbegrenzten Wirtschaftswachstum, einem mit Nachdruck betriebenen Infrastruktur ausbau und einer kaum regulierten Bautätigkeit. Horizont und Fenster positionierten sich in diesem Umfeld als Medien der Dokumentation, der Diskussion und der Entwicklung von Gegenentwürfen. Sie widmeten sich in den 1970er-Jahren kulturellen und sozialen Themen in einer Aus führlichkeit, wie sie in Tiroler Printmedien der 2010er-Jahre nicht mehr vorhanden war. Sie trugen so auch sicherlich dazu bei, dass Lösungen für die bestehenden Probleme gesucht und – etwa in der Raum- und Verkehrs planung oder bei der Ausschreibung von Wettbewerben – auch teilweise umgesetzt wurden. Wie groß ihre Bedeutung für derartige Veränderungen allerdings war und wie vieles davon auch ohne die mediale Präsenz rea lisiert worden wäre, lässt sich aus heutiger Sicht nur mehr schwer messen. Dass Themen wie fehlender Wohnraum, die Belastungen durch Fern- und Nahverkehr und eine nicht ausreichende Einbindung von ArchitektInnen in die Gestaltung von Stadtraum und Landschaft heute ähnlich heftig diskutiert werden wie in den 1970er-Jahren, zeigt jedenfalls die Grenzen dessen auf, was Kulturmedien wie Horizont und Fenster leisten können. 1
Felix Mitterer, Zum Ableben von Wolfgang Pfaundler, LiLit – Die Literaturplattform für Tirol 7 / 2015, https://literaturtirol.at/lilit/72015-2/zeitblende/felixmitterer-zum-ableben-von-wolfgang-pfaundler (1. 11. 2018). 2 Alle Zitate zum Horizont stammen aus einem Interview mit Krista Hauser, das Arno Ritter und Esther Pirchner am 11. 10. 2018 geführt haben.
sie möchten weiterlesen?
Die anlässlich der Ausstellung
widerstand und wandel. über die 1970er-jahre in tirol erschienene Publikation kann auf unserer Web-Site unter www.aut.cc bestellt werden. Sonderpreis: 19,70 Euro zuzüglich Versandspesen (6,- Österreich, 12,- Europa) Danke für Ihre Unterstützung!
bildnachweis Archiv AEP S. 40 | Wilhelm Albrecht S. 353, S. 354, S. 356 – 357, S. 359 – 362 | aus: ar chitektur aktuell 37 / 1973 S. 224 | aus: Architektur und Fremdenverkehr, 1974 S. 276 | Architekturzentrum Wien, Sammlung S. 87, S. 91, S. 177 (Foto Margherita Spiluttini), S. 178, S. 197, S. 199 (Foto Christof Lackner), S. 213 – 215, S. 323 | Atelier Classic S. 330 | Archiv aut S. 125 – 126, S. 130, S. 148, S. 216, S. 218 | aus: bauforum S. 138 (81 / 1980), S. 312 (23 / 1971), S. 324 (14 / 1969) | aus: Baugeschehen in Tirol 1964 – 1976, 1977 S. 187, S. 210, S. 225, S. 274 – 275, S. 331 | aus: BMZ – Offizielles Organ der Baumusterzentrale S. 279 (3 / 1968), S. 314 (1 / 1967), S. 318 (1 / 1968) | BrennerArchiv Innsbruck – Vorlass Mitterer S. 118 | aus: Broschüre für die „Luxus Terrassen hausanlage Höhenstraße“ der BOE, o. J. S. 168 | Canadian Centre for Architecture (Gift of May Cutler) S. 171 | Archiv COR S. 316 – 317 | aus: das Fenster S. 146 (5 / 1969), S. 150 (11 / 1972) | Digatone S. 63 – 64, S. 67 | Sammlung Albrecht Dornauer S. 55, S. 288 | Andreas Egger S. 200 – 201 | Thomas Eisl S. 93 | aus: Endbericht – XII. Olympi sche Winterspiele Innsbruck 1976, 1976 S. 288 | aus: Festschrift zur offiziellen Über gabe und kirchlichen Weihe, Sprengelhauptschule St. Johann in Tirol, 1980 S. 225 | FI Archiv für Baukunst der Universität Innsbruck S. 119, S. 197 – 198, S. 229 – 231, S. 233, S. 238, S. 241, S. 244 – 245, S. 248 – 249, S. 282 | FRAC Orleans S. 157 – 158 | frischauf-bild S. 160 – 161, S. 164 – 165, S. 169, S. 277 | Archiv Galerie Krinzinger S. 104 – 105, S. 108 | Siegbert Haas S. 179 | Karl Heinz S. 206, S. 207 | aus: Norbert Heltschl. Bauten und Projekte, 2002 S. 197 | Nachlass Ernst Hiesmayr S. 132 | Sepp Hofer S. 69 | aus: Horizont. Kulturpolitische Blätter der Tiroler Tageszeitung S. 140 (18 / 1974), S. 143 (4 / 1972), S. 145 (9 / 1973), S. 149 (10 / 1973), S. 152 (29 / 1976), S. 154 (13 / 1974) | Hertha Hurnaus S. 162 | Sammlung Waltraud Indrist S. 284, S. 290 | Sammlung Peter Jordan S. 259 – 260, S. 269 – 270, S. 364 | aus: Kasiwai. Ein Bildband des Kennedy-Hauses in Innsbruck, 1970 S. 31 | Franz Kiener S. 220 – 222 | Wolfgang Kritzinger S. 263 | Christof Lackner S. 226 | Bernhard Leitner S. 76 – 80 | Christian Mariacher S. 14 – 22 | Albert Mayr S. 82, S. 84 – 85 | Wolfgang Mitterer S. 97 | Thomas Moser S. 268, S. 271 | Helmut Ohnmacht S. 345, S. 370 | Stefan Oláh S. 208 | Archiv ORF Landesstudio Tirol S. 343 | Ortner & Ortner S. 129 | Archiv Max Peintner S. 281 | Charly Pfeifle S. 304 – 309 | Wolfgang Pöschl S. 262 | Peter P. Pontiller S. 191, S. 193 – 194 | aus: Pooletin, 3 / 4, 1977 S. 107 | aus: Pressemappe des Bauzentrums Innsbruck, 1971 S. 322 | aus: Prospekt „i-bau 1973“ S. 334 | Carl Pruscha S. 148 | Nachlass Egon Rainer S. 328 – 329 | Kurt Rumplmayr S. 261 – 262 | Sammlung Wolfgang Salcher S. 219, S. 226 | Elisabeth Schimana S. 89 | Hanno Schlögl S. 184, S. 186 | Sammlung Hubertus Schuhmacher S. 57 | aus: Schulbau in Österreich, 1996 S. 224 | Sammlung Meinrad Schumacher S. 30 | Sammlung Elisabeth Senn S. 255 – 257 | aus: Sozialer Wohnbau in Tirol. Historischer Überblick und Gegenwart, 1987 S. 136, S. 196 | Stadt archiv Innsbruck S. 24, S. 68, S. 71, S. 285, S. 325 | aus: Stadtentwicklung Innsbruck. Tendenzen und Perspektiven, 1978 S. 127 | Subkulturarchiv Innsbruck S. 33, S. 34, S. 37, S. 47 – 49, S. 58 – 62, S. 66, S. 70 | Archiv Taxispalais Kunsthalle Tirol S. 100, S. 102 | tirol kliniken S. 283 | Tiroler Landesmuseen / Zeughaus S. 330 | Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum S. 109, S. 112, S. 300 (Grafische Sammlung, Inv. Nr. 20Jh / C / 59), S. 302 (Grafische Sammlung, Inv. Nr. 20Jh / P / 118) | aus: Tiroler Nachrichten, 159 / 1968 S. 320 | aus: Tiroler Tageszeitung, 108 / 1973 S. 336 | aus: Tirols Gewerbliche Wirtschaft, 20 / 1970 S. 327 | aus: TRANSPARENT. Manuskripte für Architektur, Theorie, Kritik, Polemik, Umraum, 8 / 9, 1970 S. 294, S. 299 | Trash Rock Archives S. 52 | Archiv TU Graz, Sammlung Dreibholz S. 190 | Dieter Tuscher S. 131 | UniCredit Bank Austria AG, Historisches Wertpapierarchiv S. 246 | Universitätsarchiv Innsbruck S. 234 | Universi tätsarchiv Innsbruck – Nachlass A. Pittracher S. 251 | aus: Der Volksbote, 19 / 1973 S. 332 | Günter Richard Wett S. 339 – 340, S. 341, S. 344, S. 346 – 351, S. 366 – 369, S. 371 – 491 | Wien Museum, Karl Schwanzer Archiv (Foto Sigrid Neubert) S. 128 | aus: Wohnanlage Mariahilfpark Innsbruck (WE), 1970 S. 166, S. 167 | aus: Wohnen Morgen Burgenland, 1971 S. 180 – 185, S. 188 | Nachlass Arthur Zelger S. 286 | Siegfried Zenz S. 121, S. 122 Trotz intensiver Bemühungen konnten nicht alle Inhaber von Textrechten ausfindig gemacht werden. Für entsprechende Hinweise sind die Herausgeber dankbar. Sollten Urheberrechte verletzt worden sein, werden diese nach Anmeldung berechtigter Ansprüche abgegolten.