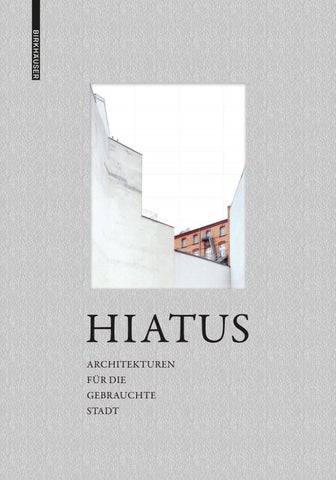HIATUS.indb 2
11.08.17 11:07
HIATUS ARCHITEKTUREN FÜR DIE GEBRAUCHTE STADT
Herausgeber Ute Frank Verena Lindenmayer Patrick Loewenberg Carla Rocneanu
Birkhäuser Basel
HIATUS.indb 3
11.08.17 11:07
HIATUS.indb 4
11.08.17 11:07
HIATUS.indb 5
11.08.17 11:07
HIATUS.indb 6
11.08.17 11:07
INHALT
I. EINLEITUNG 11
HIATUS ALS RAUMCHARAKTER Ute Frank
23
„MINIMAE PARTES“, MENSCHLICHE VIELFALT: STÄDTEBAU AUS DEN KLEINSTEN VERÄNDERUNGEN Werner Oechslin
33
DOPPELTER RAUM Jean-Philippe Vassal im Gespräch mit Ute Frank II. TRANSFORMATION
43
URBANE IMPULSE. EIN LABORBERICHT Ute Frank
59
ZWEI VERWAISTE INSELN Mark Lee
65
HAUS DES KINDES Helmut Geisert
77
HAUS AM CHECKPOINT CHARLIE Matthias Sauerbruch im Gespräch mit Ute Frank
87
TAGEBUCH EINER BEGEGNUNG. DIE NIEDERLÄNDISCHE BOTSCHAFT IN BERLIN Luis Játiva begleitet von einem Fotoessay von Kalouna Toulakoun III. DIVERSITÄT
95
AUTHENTIZITÄT, RITUAL, AURA Jörg H. Gleiter
99
RIESIGE ABLAGERUNGEN Adrian Streich
7
HIATUS.indb 7
11.08.17 11:07
107 INFRASTRUKTURELLE HÄUSER
Mathias Müller und Daniel Niggli
117
DAS DOPPELTE BERLIN Regula Lüscher und Ingo Malter im Gespräch mit Ute Frank und Verena Lindenmayer
125 TIMMERHUIS IN ROTTERDAM
Philippe Braun im Gespräch mit Verena Lindenmayer IV. OFFENE GESTALT
135 KAPAZITÄT
Patrick Loewenberg
145 DER OFFENE RAUM
Karsten Schubert
155 ROBUSTHEIT
Carolin Stapenhorst
165 ESSENTIELLE ARCHITEKTUR
André Kempe im Gespräch mit Ute Frank und Patrick Loewenberg
173 CHOREOGRAFIERENDER KIRCHENRAUM.
ST. JUDAS THADDÄUS IN KARLSRUHE-NEUREUT Ulrich Pantle
179 OFFENHEIT.
DIMENSIONEN EINER MEHRDEUTIGEN A RCHITEKTONISCHEN QUALITÄT Angelika Jäkel
187 DIE PERMANENZ DER DINGE
Éric Lapierre
195 SANAA-GEBÄUDE AUF DER ZECHE ZOLLVEREIN
Fotoessay von Christoph Rokitta begleitet durch einen Text von Nadine Brüggebors
209 LOB DER GEBÄUDEMASCHINEN
Stéphanie Bru und Alexandre Theriot (Bruther)
8
HIATUS.indb 8
11.08.17 11:07
V. SYNERGIE UND INTERAKTION 213 SYNERGETISCHE PROGRAMMIERUNG
Carla Rocneanu
223 RECHT AUF DEN GEBRAUCH DER STADT.
ZUR NORMATIVITÄT DES STÄDTISCHEN Christopher Dell
239 GEMEINSAM HÄUSLICH.
ÜBERLEGUNGEN ZUM KOLLEKTIVEN OHNEN UND DEM GROSSEN HAUS MIT W V IELEN ZIMMERN Stephen Bates
247 KOMMUNIKATIVER RAUM.
ARBEITSPLATZ DER ZUKUNFT Sevil Peach und Gary Turnbull
259 BARBICAN ESTATE IN LONDON
Fotoessay von Gilbert McCarragher und Paul Ellis begleitet durch einen Text von Alison Morris
273 POSTKARTEN AUS LONDON.
FOTOGRAFISCHE ERKUNDUNG IN DREI VARIATIONEN Max Kahlen
281 KOBUTO
Peter Behrbohm
293 AUTOREN
Die Originalfassungen der fremdsprachlichen Beiträge können unter www.birkhauser.com abgerufen werden.
9
HIATUS.indb 9
11.08.17 11:07
I. EINLEITUNG
HIATUS.indb 10
11.08.17 11:07
HIATUS ALS RAUMCHARAKTER Ute Frank
Alle europäischen Metropolen sind heute mit vergleichbaren Pro blemen konfrontiert: Der Bedarf nach innerstädtischen Nachver dichtungen steigt, und er geht einher mit einem wachsenden Bedarf an notwendigen Stadtreparaturen. Überall stellen sich Fragen der typologischen, stadt- und sozialräumlichen Integration neuer bau licher Strukturen in die gebrauchte Stadt. Aktuell wirken die ökolo gischen und ökonomischen Folgenabschätzungen aus der Stadt- und Siedlungsplanung als Motor von Verstädterung nach innen. Die Ent wicklung ist allerdings weitgehend ungeregelt, begleitende Planung ist die Ausnahme. Es fehlen systematische Ansätze zu einer Neuinter pretation der vorhandenen städtebaulichen Grundmuster. Auch auf der Gebäudeebene stehen grundsätzliche Standards zur Disposition, wenn es um Nachhaltigkeit von städtischen Typologien und der In teraktion zwischen der Stadt und dem Haus geht. Städtische Verdichtungsszenarien sind ihrer Natur nach von mor phologischen und sozialräumlichen Divergenzen geprägt und las sen sich kaum formalisieren. Die fortschreitende Innenverdichtung lenkt aus dieser Perspektive des Naturwüchsigen und des nicht Plan baren die Aufmerksamkeit wieder auf die qualitativen Aspekte des städtischen Raums. Sie führt den Blick zurück in die Geschichte und erlaubt zugleich Entwürfe in die Zukunft. Sie bringt uns auch einer aktualisierten Bestimmung von Urbanität näher, die gegenwärtig kaum Thema von wissenschaftlichen Betrachtungen ist. Urbanität ist heute nur mehr eine unscharfe Beschreibung von verloren gegan genen Lebensqualitäten, welche der europäischen Stadt zugeschrie ben werden. Die Autoren begreifen aus diesen Überlegungen heraus die gebrauchte Stadt als Quelle für ein Gestaltpotenzial im städtischen Raum, das noch wenig erkundet ist. Es betrifft einen Gestaltwandel, der informeller Natur ist und eingebettet in urbane Veränderungs prozesse. Sie kommen aus dem Alltäglichen und sind oft nur noch als Spuren oder Fehlstellen wahrnehmbar. Sie ergänzen das materielle um ein immaterielles Erbe und wirken als ästhetische Impulsgeber. Qualitative Verdichtung eröffnet Räume und schafft Potenziale für deren Aneignung, so lautet eine zentrale These im Buch.
Abb. 1 Gordon Matta-Clark, Conical Intersect (detail), 1975, Abrisshaus am Plateau Beaubourg, Freimachung für den Neubau des Centre Georges Pompidou, aus: Mary Jane Jacob (Hg.): Gordon Matta-Clark: A Retrospective. Museum of Contemporary Art, Chicago 1985, S. 88 © ARS/VG Bild-Kunst, Bonn 2017
11
HIATUS.indb 11
11.08.17 11:07
Synergie und Interaktion
Abb. 11 Jannis Kounellis, Ohne Titel, 1980, Düsseldorf © Dorothee Fischer
Verdichtungsprojekte in der Stadt erzeugen Konflikte auf der Ebene der Stadtökologie, der Stadttechnik und auf der sozialen Ebene zwischen den diversen Nutzern des städtischen Raums. Neue öko logische, soziale und kulturelle Infrastrukturen werden benötigt. Die Weiternutzung und zeitgenössische Umprogrammierung von bereits geformten und damit oft mehrfach kulturell codierten städ tischen Strukturen kann ein wirksames Initial sein für einen erfolg reichen Stadtumbau, für die Qualifizierung und Reurbanisierung von vernachlässigten städtischen Räumen. Heutige Nachhaltigkeits strategien bewerten kultivierte und urbanisierte Räume mit ihren bereits bearbeiteten Flächen und gebauten Infrastrukturen als wert volle Ressourcen für ein Wachstum von innen. Auch über die so zialen Infrastrukturen muss neu nachgedacht werden, ebenso über die räumlichen Folgen der heutigen Tendenz zur Totalisierung der Arbeitswelt. Neuartige städtische Häuser entstehen durch die struk turelle Diversität aus Nutzungsüberlagerungen oder durch die Ver netzung von öffentlichen, privaten und mehrwertigen, synergetisch nutzbaren Zonen im Gebäude. Sie sind Offerten für Aneignungen des städtischen Raums. Im hochpreisigen Londoner Stadtzentrum stehen mikroskopisch kleine Interventionen der Verdichtung dem Barbican Center als ei nem Makro-Modell der 1970er Jahre gegenüber. Beide sind radikale Umsetzungen von Strategien der Stadt im Haus. An ihnen lassen sich in zwei Richtungen die Größenordnungen ausloten, welche mit hy brid angelegten Hauskonzepten möglich sind. Ein überraschend interaktives Potenzial können auch Megastruk turen aus der Zeit der autogerechten Stadt anbieten, sie überdauern in den verdichteten Stadträumen wie innerstädtische Monumente der Peripherie. An ihren Rändern finden sich oft übriggebliebene oder unscharf zugewiesene Räume, die einer informellen Aneignung durch wechselnde Benutzer bis heute offen stehen. In Zeiten der G lobalisierung, der digitalen Vernetzung und einer gemeinsamen europäischen Politik ist der Städtevergleich aufschluss reich. In Paris, London und Zürich, in Rotterdam, Basel und Dun kerque gibt es einzelne Projekte, die über ihren eigenen Kontext hinaus unser f orschendes Interesse verdienen. An ganz unterschied lichen europäischen Beispielen wird im Buch aufgezeigt, wie Kon zepte der Verdichtung abseits der klassischen Typenlehre erfolgreich operieren. Von einem gegenseitigen Erfahrungsaustausch zu diesen strukturellen Erneuerungen dürften alle Interessensträger profitie ren. Jenseits der Kenntnis und der Berücksichtigung der bis heute entwickelten Typologien und Standards geht es beim Weiterbauen in den Städten aber immer auch um die Aktualisierung historisch g ewachsener Räume und Bilder. Verdichtungsprojekte entwickeln an vielen Orten Gegenpositionen zu einer drohenden Nivellierung
20
HIATUS.indb 20
11.08.17 11:07
der sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten der Architektur, die un ter dem Einfluss internationaler Standards verloren gehen. Im Län dervergleich zeigen sich nicht zuletzt deutliche Unterschiede im jeweiligen kulturellen Selbstverständnis. Sie manifestieren sich mit dem Grad der Offenheit und gesellschaftlichen Akzeptanz gegen über typologischen Innovationen, die den gesellschaftlichen Wandel notwendigerweise begleiten. Die Struktur der einzelnen Kapitel spiegelt die Überlagerung der räumlichen und der thematischen Perspektiven. Der Perspektiv wechsel erlaubt dem Leser den Einstieg auf verschiedenen Ebenen der Reflexion, Interpretation und Präsentation des vorgestellten Materials. Die Herausgeber danken allen im Impressum genannten Einrich tungen und Sponsoren für die freundliche finanzielle Unterstüt zung. Vor allem danken sie den Autoren dieses Buches für ihre Beiträge, die für das spezifische Format dieses Buches verfasst wur den. Sie s tellen jeweils Aspekte aus dem eigenen Werk vor oder sind Ergebnisse langjähriger Forschungsarbeiten zu den einzelnen Schwerpunktthemen.
Abb. 12 Olaf Metzel, Atelier München, 1995 Fotograf: Martin Starl © VG Bild-Kunst, Bonn 2017
21
HIATUS.indb 21
11.08.17 11:07
22
HIATUS.indb 22
11.08.17 11:07
„MINIMAE PARTES“, MENSCHLICHE VIELFALT: STÄDTEBAU AUS DEN KLEINSTEN VERÄNDERUNGEN Werner Oechslin
I. Haus/Stadt – Stadt/Haus. „Aedificia hominum esse causa constituta in promptu est.“ Leonbattista Alberti, De Re Aedificatoria (1452). „Alle Fortschritte in der Cultur, wodurch der Mensch seine Schule macht, haben das Ziel, diese erworbenen Kenntnisse und Geschick lichkeiten zum Gebrauch für die Welt anzuwenden; aber der wich tigste Gegenstand in derselben, auf den er jene verwenden kann, ist der Mensch: weil er sein eigener letzter Zweck ist.“ Immanuel Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht abgefaßt, 1798. „elle [=la maison] est un objet qui intéresse en nous la bête et la tête“. Le Corbusier, Une maison – un palais [1928]. Wir sind es eher gewohnt, Städtebau mit der großen Geste zu verbin den, als ihn in den kleinen Winkeln eines Quartiers aufzusuchen. Bilder wie das der Hand Le Corbusiers über dem Modell seiner ‚Ville radieuse‘ haben sich eingeprägt.1 Es illustrierte durch die unbedingte Forderung des Ersatzes des Alten durch das Neue: „Une nouvelle ville remplace une ancienne ville“.2 Es war das Gebot der Moderne, erklärtermaßen eine Doktrin; und Le Corbusiers unmittelbar nach folgendes Hohe Lied auf die historischen Denkmäler ändert nichts an dieser Forderung, so wohlklingend dies auch formuliert sein mag: „Ce sont les hauts lieux de la pensée. C’est la nourriture efficace.“3 Das Lob fand sich nur mehr in der kleingedruckten Bildlegende. Was da gegen zählte war der große Schrei nach totaler Zerstörung des Alten zugunsten des Neuen. Dasselbe betrifft die Erfolgsgeschichte des hippodamischen Ras ters. Er hat sich der Stadtidee überall dort bemächtigt, wo Städte neu gegründet, und natürlich nicht, wo sie langsam gewachsen sind. Die Anmaßung Hippodamos’, von einer architektonischen Ordnung auf die ideale Staatsform zu schließen, hat schon Henry Wotton 1624 – im Rückgriff auf Aristoteles – kritisiert.4 Sollte ein Zusammenhang zwischen Stadt- und Gesellschaftsform konstruiert werden, böte sich allenfalls der umgekehrte Weg an; man suche für eine Gesellschafts form eine passende Stadtform.
Abb. 1, links ‚DARK SPOTS IN THE CITY OF LIGHT‘; moderne Propaganda gegen slums – und Klein teiligkeit der Stadt aus: José Luis Sert: Can our cities survive? Cambridge 1942 Abb. 2, oben Immanuel Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht abgefaßt. Königberg 1798, Titel
1 Vgl. Le Corbusier: La Ville Radieuse. Élements d’une Doctrine d’Urbanisme pour l’Équipement de la Civilisation Machiniste. Boulogne, o. J., S. 135. 2 Ebd. 3 Ebd., S. 139. 4 Vgl. Werner Oechslin: „‚Tractable Materials‘. Der Architekt zwischen ‚grid‘ und ‚ragion di stato‘“, in: Early Modern Urbanism and the Grid. Town Planning in the Low Countries in International Context. Exchange in Theory and Practice 1550– 1800, hrsg. von Piet Lombaerde und Charles van der Heuvel. Turnhout 2011. S. 1–25: S. 1.
23
HIATUS.indb 23
11.08.17 11:07
II. TRANSFORMATION
HIATUS.indb 42
11.08.17 11:08
URBANE IMPULSE. EIN LABORBERICHT Ute Frank
Am Fachgebiet für Baukonstruktion und Entwerfen der Technischen Universität Berlin wurden über mehrere Jahre die Lehre und die Forschung in den studentischen Entwurfsstudios zu Lehrforschungsprojekten zusammengeführt.1 Hintergrund der Projektidee war, dass die veränderten Bedingungen der Architekturproduktion neue didaktische Ziele für die Lehre setzen. Der Markt, für den wir heute ausbilden, ist global, das heißt diversifiziert, beweglich und intransparent. Wie kann eine zeitgenössische Architekturlehre darauf reagieren, wohin entwickelt sich eine zukünftige Logik der Form? Was wäre, wenn wir unsere Konstruktionsregeln in der Zukunft abhängig von den technologischen und handwerklichen Möglichkeiten vor Ort jeweils neu aufstellen müssten, oder wenn die technischen Infrastrukturen die Gestalt des Gebäudes aktiver als bisher beeinflussen würden? Wenn die Disziplin in immer schnelleren Durchläufen Themen aus den Nachbardisziplinen oder sogar transdisziplinäre Inhalte in ihr Vokabular aufnehmen müsste? In der Architekturproduktion wird es zukünftig immer mehr um exemplarische Methoden der Projektentwicklung gehen und um Fragen der generellen Übertragbarkeit solcher Methoden von Projekt zu Projekt – das ist eine nahe liegende Prognose. Die fortlaufende Anpassung und Neuprogrammierung der Entwurfs- und Bauaufgaben begleitet schon heute die Projektenwicklung von der Konzeptionsphase bis in die Realisierung. Die Programmierung des Projekts und seiner Teilaspekte wird über das Zusammentragen von Daten hinaus weiter an Bedeutung gewinnen und auch eine zunehmend aktive Rolle im Gestaltungsprozess spielen. In der Interpretation und Bearbeitung von Entwurfsaufgaben geht es neben dem Finden, Setzen und Ersetzen von Formen immer mehr um das Erforschen von alternativen Lösungsmodellen für komplexe Aufgabenstellungen und von möglichen Konstruktionsregeln dafür. Die klassische Unterteilung der Lehre in die Vermittlung der wissenschaftlich systematischen Grundlagen einerseits und das Einüben von Entwurfskompetenz und Methodenwissen in der praktischen Projektarbeit andererseits scheint weniger denn je ein brauchbares didaktisches Modell zu sein, denn das Basisrepertoire wird immer schneller von der Praxis aufgebraucht. Die Lehre muss sich entsprechend mit neuen Methoden von Wissensgenerierung und mit recherchegeleiteten Entwurfs- und Planungsprozessen befassen. Dass die erfolgreiche Vermittlung der Grundlagen nur in der praktischen Vernetzung mit der Entwurfslehre möglich ist – dieser didaktische
1 Die Projekte waren möglich dank der Arbeit der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Fachgebiet: Raimund Binder, Helga Blocksdorf, Andrea Böhm, Luis Játiva, Verena Lindenmayer, Patrick Loewenberg, Marius Mensing, Carla Rocneanu, Marika Schmidt, Anca Timofticiuc.
43
HIATUS.indb 43
11.08.17 11:08
LAGEPLÄNE
44
HIATUS.indb 44
11.08.17 11:08
Ansatz ist nicht neu. Er wird aber in den aktuellen Denkmodellen des research by design verstärkt auf entwicklungsfähige neue Lehr methoden hin untersucht.2 Typen und Systeme Die Beziehungen zwischen den einzelnen Elementen von Entwurfsaufgaben sind grundsätzlich flüchtig und unscharf. Der Umgang mit dieser Grunddisposition begünstigt die Entwicklung und Anwendung produktiver Analyseverfahren in den entwurfsbasierten Dis ziplinen. Das Ausgangsmaterial nicht nur analytisch zu isolieren, sondern insbesondere auch seine Grundparadoxien hinsichtlich möglicher Wirkungsweisen und Verbindungen zu beobachten, ist ein erster Schritt in einem analytischen und zugleich synthetisierenden Entwurfsverfahren. Es gleicht einer Versuchsanordnung im Labor, die es erlaubt, im nächsten Schritt die isolierten Gegenstände zu alternativen und bewertbaren Szenarien zu verarbeiten. Solche Versuche gehen methodisch in die Richtung eines Entwerfens in qualifizierenden Analyseschritten, wie es von O. M. Ungers als Lehr methode propagiert wurde: „[E]s bedeutet einen Prozess des Denkens in qualitativen Werten in der Richtung, dass Analyse und Synthese alternieren, so natürlich wie das Einatmen und Ausatmen, wie Goethe es ausgedrückt hat.“3 Den Entwurfsprozess als ein Wissen erzeugendes Forschungsmedium zu begreifen – diesen Denkansatz hat O. M. Ungers während seiner Lehr- und Forschungstätigkeit an der Berliner TU verfolgt. In seiner Lehre wurde ein neuer Umgang mit dem Basismaterial des architektonischen Entwerfens praktiziert. Daran lässt sich gerade heute wieder anknüpfen, wenn es um die Verbindung von Forschung und Lehre geht. Ungers Grundlehre arbeitet einerseits mit der klassischen Typenlehre, andererseits aber auch mit der radikalen Umwertung von Typen. Das Lehrprogramm gliedert sich in Vorlesungen und studentische Entwurfsprojekte mit genau konstruierten Aufgabenstellungen für die studentischen Entwürfe. In den Vorlesungen geht es um die Vermittlung des typologischen Repertoires. Den Aufgabenstellungen dagegen liegt ein freier Umgang, ja eine Abwendung vom Typus als eine strategische Entwurfsvorgabe zu Grunde. Um die Studierenden zu gedanklicher Offenheit im Umgang mit den Grundlagen anzuregen, wird die Entwurfsaufgabe von einem Virus infiltriert, welcher die typologischen Standards auflöst. Unter dem Begriff des Systems wird ein Werkzeug eingeführt, das den Entwurfsprozess zugleich aktiviert und steuert.4 Das System steht als etwas Ordnendes einmal für das Eine, dann auch für das Gegenteil. Es wechselt seine Stellung im Spiel und diffundiert durch diverse Bedeutungsebenen hindurch. Unter dem Systembegriff wird dem Programm eine Komponente zur Seite gestellt, die im Ent-
Abb. 1 bis 12, von links nach rechts, und von oben nach unten Freiraum Sommer 2014 © Daniel Flügge, Lukas Hofmann, Valeria Shchipitsyna © Matthias Ackstaller, Flavia-Ioana Biianu, Hannah Geißler, Jan Schories © Alexander Brauer, Arian Freund, Marin Roche Wahlverwandschaften Winter 2014/15 © Elisabeth von Hausen, Aaron Lang, Luisa Overath, Selina Schlez © Michael Hauser, Benjamin Rusch, Kolja Schulte, Kristof Schlüßler © Laurie Andraschko, Korbinian Vitus Huber, Sina Jansen Traumfabrik Sommer 2015 © Ömer Acar, Johannes Hackethal, Ruven Rotzinger, Annelene Stielau © Giulia Heder, Laura Lampe, David Ortner, Julia Ruggiero © Ammon Budde, Carolin Friedrich, Kristof Schlüßler Schattenboxen Winter 2015/16 © Simon Finzel, Johannes Koch, Jakob Köchert, Nicola Nadebor © Chiara De Maio, Miriam Möser, Aaron Reck, Maximialian Semmelrock © Sebastian Georgescu, Robert Stahlschmidt, Lisa Wegmershausen
2 Ute Frank et al. (Hg.): EKLAT. Entwerfen und Konstruieren in Lehre, Anwendung und Theorie. Universitätsverlag der TU Berlin 2011. 3 Oswald Mathias Ungers: Morphologie. City Metaphors. Köln 1982. 4 „Zwei grundsätzliche Lösungen sind möglich: Lösung A – mit einem System, das mit einem würfelbildenden System identisch ist, Lösung B – mit einem System, das dem würfelbildenden System fremd ist.“ Oswald Mathias Ungers: „Wochenaufgabe Nr. 1, 1964“, Wiederabdruck in: archplus 179, 2006.
45
HIATUS.indb 45
11.08.17 11:08
58
HIATUS.indb 58
11.08.17 11:09
ZWEI VERWAISTE INSELN Mark Lee
Inseln und Abgrenzungen Neuerdings befassen sich einige theoretische Studien mit dem Abbau von Grenzen. Es gibt jedoch auch gegenteilige Bestrebungen, in denen gerade die Suche nach Schranken und das ausdrückliche Abstecken von Grenzen Vorrang haben. Einerseits hat der Schwung zum Abbau von Grenzen aus einem Wunsch nach Verbundenheit, Unbestimmtheit oder Vielfalt anscheinend nachgelassen. Andererseits hat die Zunahme von privatisierten, starren Raumprogrammen wie etwa Gated Communities, gesonderten Wirtschaftszonen oder Steueroasen ein erneutes Interesse an klar getrennten Formen des Zusammenschlusses und ihrer Auswirkung auf die Städte ausgelöst. Als Folge befindet sich im gegenwärtigen Architekturdiskurs die Erforschung von Insel- und Archipelverbänden und deren Potential als generative Modelle der zeitgenössischen Stadt im Aufschwung. Solche inselartigen Monokulturen werden nun nicht mehr als Bruch innerhalb des integrativen Denkstils der Globalisierung empfunden; sie bilden vielmehr die Gelegenheit, durch die präzise Demarkation von Schranken und Grenzen alternative Formen der Konnektivität zu erproben. Da sich Insel- und Archipel-Verbände durch feste, undurchdringliche Grenzen und nur wenige Kontrollpunkte kennzeichnen, also räumliche Super-Barrieren sind, entsteht eine Welt der Fragmentierung, in der Deutlichkeit über Unschärfe, Isolation über Vereinigung und Sesshaftigkeit über Nomadismus triumphieren. Abb.1, linke Seite Titelbild aus: Berliner Brandwände, Veröffent lichungen zur Architektur, bearb. von Arthur Laskus, Ulrike Pampe, Jürgen Sawade, hrsg. von der TU Berlin, Lehrstuhl für Entwerfen VI, o. Prof. Dipl.-Ing. O. M. Ungers, Heft Nr. 27 © O.M. Ungers/UAA Abb. 2 O. M. Ungers’ Green Archipelago @ Mark Lee
59
HIATUS.indb 59
11.08.17 11:09
Zwei Inseln in Berlin Versteht man Berlins siebenhundertjährige Geschichte als eine Ablagerung von Inselverbänden unterschiedlichen Grades und unterschiedlicher Effizienz, führen gewisse Modelle, die zu einer bestimmten Zeit auf die spezifischen sozialpolitischen Umstände reagierten, oft ein Eigenleben, lösen sich von ihrem ursprünglichen Zusammenhang und werden zu globalen Modellen. Zwei spekulative Modelle von Archipel-Verbänden – die Ballung von segregierten, dichten Programmen – stechen als weitsichtige Beispiele zur Erforschung des Verhältnisses zwischen Insel-Verbänden und großstädtischen Kräften heraus. Beim ersten Modell handelt es sich um Oswald Mathias Ungers’ ‚Berlin das grüne Stadtarchipel‘ von 1977, bei dem das Schwinden der Bevölkerung als Ausgangslage für ein zukünftiges Modell für die befriedete Stadt dient.1 Das zweite ist John Hejduks ‚Victims‘-Projekt von 1984, bei dem anthropomorphe Bauten innerhalb eines mit Mauern abgeriegelten Lagers unterwegs sind. Obwohl sie sich in Maßstab und Absicht unterscheiden, bestehen beide Modelle aus isolierten, dichten und definierten Artefakten, die von verbleibenden und nicht-programmierten, klar umgrenzten Räumen umgeben sind. Beide sind paradigmatische Modelle für die Stadt; beide verlassen sich für ihre Wirkung auf die Distanz zwischen den Inseln; beide Abb. 3 Figure ground of ‘Berlin as Green Archipelago’ @ Mark Lee
1 Oswald Mathias Ungers: Die Stadt in der Stadt. Berlin das grüne Stadtarchipel. Ein stadträumliches Planungskonzept für die zukünftige Entwicklung Berlins, Köln 1977.
60
HIATUS.indb 60
11.08.17 11:09
sind Modelle kleinerer Inseln innerhalb einer größeren Insel. Besinnt man sich jedoch auf Gilles Deleuzes Unterscheidung zwischen kontinentalen und ozeanischen Inseln, sieht man den Unterschied, denn das eine Modell ist das erstere und das andere das letztere. Auch wenn beide anscheinend eine isolationistische Stellung einnehmen, stiftet jede durch die Einführung von harten Grenzen neue Formen der Konnektivität. Berlin als grüner Archipel O. M. Ungers entwickelte im Jahre 1977 mit einer Gruppe von rchitekten ein urbanes Projekt für die Stadt West-Berlin mit dem A Titel ‚Berlin das grüne Stadtarchipel‘. Es bestand aus fast sechzig isolierten, schwimmenden urbanen Inseln auf dem Ozean von offenen, von der Berliner Mauer umringten Räumen. Geprägt vom gewaltigen räumlichen Widerspruch zwischen den dicht verwobenen städtischen Enklaven und der ausgedehnten, vom zerstörerischen Krieg verursachten Leere, befasste sich die Stadt West-Berlin in einer Zeit der urbanen Krise und der schwindenden Bevölkerung mit ihrer Zukunft. Für Ungers war es klar, dass das Stadtzentrum nicht mehr durch den konventionellen Ansatz der Wiederherstellung erhalten werden könnte und dass als Antwort Abb. 4 Redistributed figure ground of ‘Berlin as Green Archipelago’ @ Mark Lee
61
HIATUS.indb 61
11.08.17 11:09
86
HIATUS.indb 86
11.08.17 11:09
TAGEBUCH EINER BEGEGNUNG. DIE NIEDERLÄNDISCHE BOTSCHAFT IN BERLIN Luis Játiva, begleitet von einem Fotoessay von Kalouna Toulakoun
Auf dem Weg: Eine kurze Geschichte Februar 2017. Wie ein am Ufer der Spree gestrandeter Eisberg erscheint der Kubus aus Aluminium und Glas. Vor der texturierten Fassade der Wohnungs- und Technikgebäude glänzt die Niederländische Botschaft aus der Ferne – wechselweise beruhigend transparent und geheimnisvoll reflektierend. Der Bau von OMA hat mehr als zehn Jahre nach der Eröffnung seine Anziehungskraft offensichtlich nicht verloren und man freut sich, das Innere besichtigen zu dürfen – besonders an einem Berliner Wintertag, dessen grauer Himmel so gut zur kalten Fassade der Botschaft passt. Nähert man sich dem Gebäude und schaut etwas genauer hin, entdeckt man am Fuß des Glaskubus einen merkwürdigen Bau. Es handelt sich um einen kleinen, weißen Schuppen, fast schon ein Schrebergartenhäuschen – allerdings nicht für Hobbygärtner, sondern für den Sicherheitsdienst. Man sieht auch überall Poller, die wie kleine Soldaten das Gebäude umkreisen. War das schon immer so? Als eines der berühmtesten Gebäude von OMA und insgesamt der 1990er-Jahre wurde die Botschaft so oft fotografiert und publiziert, dass man erstaunt ist, Dinge zu entdecken, die auf den Fotografien so nicht zu sehen sind.1 Die Niederländer hatten sich nach der Zerstörung ihrer alten Berliner Botschaft im Zweiten Weltkrieg von dem ursprünglichen Grundstück getrennt, mit der Verlegung der Hauptstadt 1990 von Bonn nach Berlin musste also ein neues erworben werden. Man entschied sich für ein Baufeld an der Ecke Klosterstraße und Rolandufer, direkt an der Spree. Die prominente Lage, nicht weit von der im 17. Jahrhundert von niederländischen Ingenieuren angelegten Friedrichsgracht, sollte der Botschaft ein in Berlin einzigartiges holländisches Flair verleihen. Kurz danach wurde durch die Niederlande ein Wettbewerb organisiert, das Architekturbüro OMA erhielt schließlich den Auftrag.
Abb. 1, links © Kalouna Toulakoun 1 Der Entwurf wurde mit dem Architekturpreis Berlin 2003 und mit dem European Union Prize for Contemporary Architecture / Mies van der Rohe Award 2005 ausgezeichnet.
87
HIATUS.indb 87
11.08.17 11:09
Es gibt gute Gründe, warum die Niederländische Botschaft von OMA so berühmt geworden ist. Die innenräumliche Komplexität des Glaskubus, die sich über elf Ebenen meisterhaft entfaltet, war einer der Aspekte, die damals Aufsehen erregten. Konfrontiert mit einem scheinbar unlösbaren Problem – die Setzung eines repräsentativen Solitärs innerhalb eines Berliner Stadtblocks – gelang OMA ein einzigartiger Beitrag zur Stadtverdichtung.2 Die Lösung des Rätsels war die Kombination eines schlanken Anbaus an die Brandwände für Installationstechnik und Dienstwohnungen mit einem Glaskubus für Konsulat und Botschaft auf der freien Außenecke des Grundstücks. Beide Volumina wurden durch Fußgängerbrücken miteinander verbunden und auf einem Sockel platziert. Er nimmt zwischen den beiden Körpern die Form einer Rampe an, die sich von der Klosterstraße im EG bis zur einem zum Fluss hin offenen Stadtbalkon oder Empfangshof im 1. OG entwickelt. Diese Rampe ist auch der Antritt des bekannten Trajekts, des 200 Meter langen Wegs, der sich von der Straße durch das ganze Gebäude windet und auf dem Dach endet. Als innere Straße, Frischluftkanal3, improvisierter Gesprächsraum, Balkon zur Stadt oder Schaufenster für die Spaziergänger übernimmt dieser Weg zur gleichen Zeit mehrere Funktionen. Hier soll es uns um seinen Charakter als halböffentlicher Weg gehen, der seit der Entstehung der Botschaft nach vorheriger Absprache begangen werden darf. Er verdankt sich dem großen Anspruch der Botschaft, sich der Stadt nicht nur optisch mit ihrer transparenten Fassade, sondern auch physisch zu öffnen und mit den Bürgern in direkten Kontakt zu treten. Diese Chance möchten wir mit unserem heutigen Besuch wahrnehmen. Am Eingang: Mehrdeutige Leere Steht man heute vor dem Haupteingang des Gebäudes auf der Klosterstraße, spürt man ungelöste Konflikte. Die kleine Hütte des Sicherheitsdienstes ist ein klarer Hinweis darauf. Die Rampe zum Hof bildet eine einladende Geste, die ins Innere des Grundstücks lockt. Diese Geste wird umso klarer im Vergleich zu dem danebenliegenden, besonders niedrigen und schmalen Eingang für die Mitarbeiter. Andererseits ahnt man, dass man diese Rampe nicht betreten darf. Kein Verbotssignal, sondern eine kleine Videokamera auf der Fassade des Wohngebäudes und vor allem die Präsenz des Sicherheitsdienstes im Hintergrund deuten darauf hin. Als Pufferzone zwischen Wohnungen und Fluss schafft dieser Zwischenraum zwar einen freien Blick für die Bewohner des Seitenflügels und ein attraktives Nest für den spektakulär auskragenden, mit dunkler Verglasung ausgestatten Besprechungsraum des Botschafters: Die sogenannte Skybox ist, trotz der Privatheit ihrer Nutzung, provokant am exponiertesten Ort des Komplexes eingehängt.
88
HIATUS.indb 88
11.08.17 11:09
Erste Schritte: Sehen und gesehen werden Der Weg ins Gebäude führt eingeladene Besucher über den Umweg einer Sicherheitsschleuse auf das Trajekt im 1. OG. Früher wäre man direkt von der Straße über den Haupteingang bis zum 1. OG emporgestiegen, wo sich ein Personenscanner befand. Dieser Umweg ist, wie das weiße Häuschen des Sicherheitsdiensts, die Folge von notwendigen Umbauten, die vorgenommen wurden, um die Sicherheit der Botschaft zu erhöhen. Der Charakter des ursprünglich als leeres Foyer konzipierten, heutzutage aber gemütlich möblierten Empfangsraums im 1. OG hat sich dadurch verändert. Er dient viel mehr als Treffpunkt, fast als Wohnzimmer. Geht man von hier ein paar Stufen nach unten, findet man den öffentlichsten Raum des Komplexes: Einen großen Konferenzraum mit gewaltigen Fenstern zum Fluss. Der Saal beeindruckt umso mehr, als sich sein Volumen bis in die oberen Geschosse zieht und so unerwartete Blickverbindungen ermöglicht. Von hier aus erblickt man das Häuschen des Sicherheitsdiensts wieder, welches die großen Fensterflächen des Saals beobachtet. Der weiße Schuppen, der wie bei vielen anderen Botschaften in Berlin und anderswo am Eingang des Gebäudes nachträglich installiert wurde, ist ein klares Signal für die neuen, erhöhten Sicherheitsstandards, die seit den Terroranschlägen auf amerikanische Botschaften 1998 überall bei solchen repräsentativen Gebäuden gelten.4 Das kleine Gebäude des Sicherheitsdienstes steht im Fall der Niederländischen Botschaft auf der Wiese zwischen Fluss und Haupteingang, nah an der äußersten Ecke des Kubus und dadurch besonders gut sichtbar. Mit seiner einfachen Form, abstrakten weißen Oberfläche und winzigen Dimension wirkt es fast surrealistisch: Der improvisierte Zwerg aus Metall und Plastik beobachtet Tag und Nacht den im Vergleich gigantischen Glaskubus.
Abb. 3 und 4, oben © Kalouna Toulakoun Abb. 2, links Trajekt (Abwicklung) © OMA Abb. 5, unten © Kalouna Toulakoun
2 Eine geschlossene Blockrandbebauung mit einer Höhe von maximal 27 Metern und einem Anteil Wohnfläche musste gemäß dem Planwerk Innenstadt, Fassung Mai 1999, geleistet werden, vgl. François Chaslin, Candida Höfer: The Dutch Embassy in Berlin by OMA / Rem Koolhaas. Rotterdam 2004, S. 35. 3 Das mit einem Überdruck geplante Trajekt dient als Zuluftkanal. Die frisch gefilterte Luft kommt vom Dach des Technikgebäudes, wo sie erwärmt oder gekühlt und bis zum Trajekt geführt wird. Von dort wird die Luft durch den Boden des Trajekts in die Büros weitergeleitet. Die Abluft wird entlang der Doppelfassade aus Glas und Aluminium wieder nach oben zum Technikraum geführt. 4 Am 7. August 1998 wurden die Botschaften der Vereinigten Staaten in Daressalam und Nairobi gleichzeitig mit Autobomben attackiert. 224 Menschen starben bei diesen Anschlägen von al-Qaida.
89
HIATUS.indb 89
11.08.17 11:09
Weiter nach oben: Einladende Gesten Man verlässt das Foyer und folgt dem Trajekt weiter nach oben auf einer für deutsche Standards ungewöhnlich steilen Treppe – ein Hinweis auf die niederländische Bautradition –, gefolgt von einer merkwürdigen Rampe, die effekthascherisch über die Straße auskragt. Alle Wände und Böden sind hier aus Glas, sodass man zur gleichen Zeit ungestörte Blicke auf den Fluss, die Straße und die Büroräume genießen kann. Diese vielversprechende Offenheit, so konsequent inszeniert, konzentriert sich jedoch auf diesen Bereich des Trajekts. Die Arbeitsräume werden nach oben hin privater und das Trajekt entsprechend geschlossener – als ob die glatte Oberfläche der allgegenwärtigen Metallplatten den Blick der Besucher systematisch nach außen leiten wollte. Man macht auch gerne mit, denn die bekannte Sichtachse zum Fernsehturm oder die malerischen Blicke zum Fluss sind verführerisch. An einer Stelle sieht man ein paar steinförmige Hocker in der
Abb. 6 © Kalouna Toulakoun
90
HIATUS.indb 90
11.08.17 11:10
Mitte des Trajekts. Sie wurden geschickt platziert, um den Raum visuell mit dem ähnlich möblierten Vorgarten am Ufer zu verbinden. Noch eine Drehung und das Innere wird wieder sichtbar: Zuerst kommt die Glaskiste eines kleinen, etwas zu exponierten Sportraums, danach die Kantine. Ein Topf steht merkwürdig auf einer Seite der Treppe zwischen beiden Räumen: Auch ein subtiler Hinweis auf irgendwelche obskuren architektonischen Merkmale? Nicht wirklich. Die Mitarbeiter haben die Zimmerpflanze strategisch platziert, um einen drohenden Kopfstoß zu vermeiden. Weiter in der Kantine. Hier wird das Trajekt zur Treppe auf die Dachterrasse, wo sich der Weg in den freien Himmel hinein auflöst. Die Treppe wird aber wegen unerwünschter Störungen des kontrollierten Gebäudeklimas, besonders jetzt im Winter, selten benutzt. Keine Klimax also für die heutige Besichtigung, man muss sich mit den schönen Blicken aus der Kantine zufrieden geben. Schließlich wird man effizient durch einen im Kern des Gebäudes positionierten Aufzug zum Eingang zurückgebracht.
Abb. 7 © Kalouna Toulakoun
Abb. 8 © Kalouna Toulakoun
91
HIATUS.indb 91
11.08.17 11:10
wird als Ganzes etwas Unfertiges, Ergänzungsbedürftiges […]. In S. Ivo ist die Konvexität noch bescheiden, je mehr sie aber zunimmt, umso stärker wird der Eindruck, daß der Innenraum ein zufälliger Ausschnitt aus dem unendlichen Weltraum ist, der ungestört hin durchflutet.“17 Bei seinem Umbau der Prager Burg, dem Symbol für die verhasste Fremdherrschaft der Donaumonarchie, in den Amtssitz des ersten Präsidenten der tschechischen Republik, Tomás G. Masaryk, verbin det Josef Plecnik Burg und Stadt durch zahlreiche minimale Ein griffe, ohne die Burg oder Teile von ihr zu schleifen. Auch die mit mehreren Bastionen versehene Befestigungsmauer bleibt erhalten, erfährt aber an einigen Stellen geringe Modifikationen, die sie als ein freies Objekt im Raum erscheinen lassen, oder es wird der Ausblick oder Durchblick dies- oder jenseits ihrer Lage inszeniert. Immer ist das Ziel, den Burgbereich nicht als ein umschlossenes, geschütztes Innen gegenüber der umgebenden, äußeren Stadt zu interpretieren, sondern die Räume des Burgareals wie der Stadt als gleichberechtigt erscheinen zu lassen. Innen und Außen sind nicht mehr absolut, son dern werden abhängig von Standort und Blickwinkel als relativ auf einander bezogen erfahren.
Abb. 7 Josef Plecnik, Umbau der Prager Burg, 1920–34, Portal zum Alpinum, Ansicht von oben aus: Josip Plečnik – Architekt Pražského hradu, Prag 1996, S. 198 © Archív Pražského Hradu.
17 Paul Frankl: Entwicklungsphasen der neueren Baukunst. Leipzig/Berlin 1914, S. 72 f.
152
HIATUS.indb 152
11.08.17 11:12
Mit dem Portal zum Alpinum (einem von Plecnik angelegten Teil der außerhalb des Wallgartens gelegenen Unteren Gärten) kehrt Plecnik die Verhältnisse des Innen und Außen um (Abb. 7). Plecnik verformt die Umfassungsmauer der Burg so, dass von dem eigentlich innen liegenden, von der Stadt umfassten Raum des Wallgartens aus gesehen ein in seiner Grundstruktur an die Propyläen auf der Akro polis erinnerndes Bauwerk erscheint, bezüglich dessen man sich au ßen befindet. Von den eigentlich außerhalb des Burgareals liegenden Unteren Gärten aus gesehen öffnet sich dagegen in der abweisenden Burgmauer ein Raum, der dem gesamten stadtseitig gelegenen Areal entlang der Burgmauer innenräumliche Qualität verleiht. Man be findet sich nun hier nicht mehr außerhalb der Burg, sondern inner halb der Stadt, im Wallgarten dagegen nicht mehr innerhalb der Burganlage, sondern außerhalb der Stadt – die primär wahrgenom menen Relationen haben sich verkehrt. Die Verknüpfung konvexer Wandgestaltung mit einer ausgespro chenen Weite erzeugt in Ivar Tengboms Saal seines Konzerthau ses in Stockholm den Eindruck eines außenliegenden Stadtplatzes (Abb. 8). Unterstützt wird diese Lesart durch typische Fassaden elemente, Geschossigkeit andeutende Fenster sowie den Abschluss der eigentlich raumumschließenden Wände durch ein deutlich arti kuliertes Gesims, durch welches die eigentliche Kante der hell illu minierten Decke verunklärt wird und der Eindruck eines freien Himmels entsteht. Der Besucher scheint sich nicht in einem abge schlossenen Raum zu befinden, sondern in einem offenen Raum zwi schen Häusern. Man kann sich vorstellen, dass in diesem Raum ein Konzertbesuch nicht nur in sich gekehrter Genuss, sondern auch ge sellschaftliches Ereignis war. Daher haben wohl nicht allein akusti sche Gründe zum kompletten Umbau des heute nicht mehr existie renden Raums geführt. Das Mittelschiff des Bautyps der Basilika kann in ähnlicher Weise als städtischer Außenraum interpretiert werden (Abb. 9). Unter stützt durch eine entsprechende Wandgliederung mit Pfeilervor lagen, Gesimsen und Fenstereinfassungen, die der dem Mittelschiff zugewandten Wandfläche Fassadencharakter verleiht und verstärkt durch das bei den frühchristlichen Basiliken ursprünglich offene Dachtragwerk, erscheint das Mittelschiff als außen liegender Straßen raum, gesäumt von im Erdgeschoss Arkaden oder Kolonnaden ent haltenden Häusern, deren im oberen Wandteil angeordnete Fenster dem Blick ihrer Bewohner in den Straßenraum zu dienen scheinen und nicht mehr als Verbindung des Mittelschiffs nach außen gelesen werden. Die Richtung von innen nach außen kehrt sich um. Wurde bei Weinbrenners Langer Straße in Karlsruhe der städtische Raum zum Innenraum, so bewirken die vom Mittelschiff aus als Arkaden erscheinenden Seitenschiffe bei der Basilika das Gegenteil, nämlich der Innenraum des Mittelschiffs erscheint als außen liegende Straße. Aus dem Nebeneinander von zwar unterschiedlich gewichteten, in
Abb. 8 Ivar Tengbom, Konzerthaus Stockholm, 1924–26, Ansicht Konzertsaal, aus: Anders Bergström: Arkitekten Ivar T engbom. Stockholm 2001, S. 202 © C. G. Rosenberg, 1926, Arkitekturmuseet Stockholm
153
HIATUS.indb 153
11.08.17 11:12
ihrer grundsätzlichen Machart jedoch gleichen Räumen ist ein Inein ander eines umfassenden, stadtähnlichen Raums und von diesem umfasster, hausähnlicher Räume geworden. Hans Sedlmayr und Lothar Kitschelt weisen darauf hin, dass die frühchristliche Basilika tatsächlich als ein „Abbild“ des himmlischen Jerusalem in den Formen einer spätantiken Stadt gesehen wurde.18 Berücksichtigt man neben der durch die historische Untersuchung gestützten Lesart des Mittelschiffs als Straßenraum auch die zweite in der Innen-Außen-Ambivalenz hervortretende Erscheinungsweise des Mittelschiffs als eines schützenden und bergenden Innenraums (was die frühchristliche Basilika für die Gläubigen eben auch dar stellte), erkennt man die tiefe Sinnbedeutung offener Räume: Zwei sich eigentlich ausschließende Raumvorstellungen, in diesem Fall Raum als Geborgenheit und Schutz bietend und Raum zur aktiven Entfaltung in der Art eines Handlungs- und Wirkungsfelds, gehen eine Verbindung ein, ja werden als zwei Seiten einer Einheit lesbar. Die architektonische Tätigkeit scheint mit dem Ziehen von Grenzen und dem Aufrichten von Wänden zunächst den ursprüng lich unspezifischen, offenen Raum in einzelne umschlossene Raum einheiten zu zergliedern, die dann spezifischen Nutzungen und Bedeutungen zugeführt werden. In dem Text ‚Der offene Raum‘ sollte aufgezeigt werden, dass entgegen einer solchen Annahme durch das Umschließen von Wänden Raum auch erschlossen werden kann und dann geöffnet wird für nicht vorhersehbare, sich verändernde An eignungen. Allein die architektonische Form vermag es dabei, offene Räume zu schaffen, in denen Innen und Außen, Öffentlich und Privat, Individuum und Kollektiv weder negiert noch voneinander getrennt werden, sondern in lebendigem Dialog zueinander stehen.
Abb. 9 Santa Sabina all’Aventino, Rom, um 422–432 © Domenico Anderson aus: Franz Xaver Zimmermann: Die Kirchen Roms. München 1935, Abb. 25
18 Vgl. Lothar Kitschelt: Die frühchristliche Basi lika als Darstellung des himmlischen Jerusalem. München 1938 sowie Hans Sedlmayr: Architektur als abbildende Kunst. Wien 1948.
154
HIATUS.indb 154
11.08.17 11:12
ROBUSTHEIT Carolin Stapenhorst
Über den Begriff der Robustheit Mit Robustheit ist hier nicht die konstruktive Festigkeit und Dau erhaftigkeit – im Sinne der Vitruvianischen firmitas – gemeint. Die Robustheit, die im Weiteren über eine Sammlung von Beobachtun gen definiert werden soll, bezeichnet vielmehr eine Qualität, die zur Dauerhaftigkeit befähigt. Der Aspekt der Festigkeit ist zwar durch aus in der Robustheit enthalten, aber wenn wir über Architekturen und Stadtgefüge nachdenken, die im Kontext schneller und oft tief greifender Transformationsprozesse entstehen oder bestehen, er scheint vor allem die Fähigkeit relevant, Veränderungen standzuhal ten. In diesem Sinne geht es um Widerstandsfähigkeit: Welches sind die fragilen und stabilen Bestandteile, was bleibt bestehen und was wird überformt? Es geht aber auch um die Anpassungsfähigkeit: Was befähigt Architekturen und Stadtgefüge dazu, flexibel genutzt und neu programmiert zu werden? So sind es die scheinbar konträren Qualitäten des Widerstands und der Anpassung, die in ihrer Kom bination Robustheit ermöglichen. Und im Spannungsfeld dieser Qualitäten kann die Frage gestellt werden: Was hält ein Gefüge aus? Um ein Narrativ der Robustheit zu erzeugen, werden im Folgenden Transformationen auf den Maßstabsebenen Stadt und Gebäude be schrieben, die nicht vorsichtiger und bestandsschonender Natur sind und nur in wenigen Fällen organisch wirken. Die ausgewählten Veränderungsprozesse sind spontaner, pragmatischer oder sogar g ewaltvoller Natur, aber dank der Robustheit der transformierten Gefüge sind gut nutzbare und gestalterisch qualitätvolle Ergebnisse entstanden oder erhalten geblieben. Permanenz und Polyvalente Formen In ‚Die Architektur der Stadt‘ beschreibt Aldo Rossi die Permanenz1 als Eigenschaft einzelner Bauten, die durch ihre Kontinuität prägend für das gesamte städtische Gefüge sind.2 Für Rossi erhalten diese Ge bäude Beständigkeit, weil sie als Monumentalbauten den Schutz der
1 Vgl. Aldo Rossi: Die Architektur der Stadt. Düsseldorf 1973, S. 35 ff. Italienische Erstausgabe: L’Architettura della Città. Padua 1966. 2 Er verweist in seiner Definition auf die Theo rien von Marcel Poète und Pierre Lavedan, die in den 1930er-Jahren erschienen.
155
HIATUS.indb 155
11.08.17 11:12
3 Vgl. ebd., S. 40. 4 Vgl. ebd., S. 75. 5 Ebd., S. 44 ff. 6 Er nennt hierzu unter anderem den Palazzo della Ragione in Padua und das Kolosseum in Rom. Vgl. ebd. S. 43 und S. 75. 7 Vittorio Magnago Lampugnani verweist eben falls auf diese Parallelität wie auch darauf, dass Rossi und Hertzberger sich in diesem Zusammen hang derselben Beispiele bedienen: die Amphithe ater von Arles und Lucca, auf die wir auch hier noch weiter zurückgreifen werden. Vittorio Mag nago Lampugnani: „Die Erfindung der Erinnerung. Die Abenteuer der typologischen Stadt in Italien 1966–1997“, in: Bauten und Orte als Träger von Erinnerung. Die Erinnerungsdebatte und die Denk malpflege, hrsg. von Hans R. Meier und Marion Wohlleben. Zürich 2000. 8 Vgl. Arnulf Lüchinger: Strukturalismus in Ar chitektur und Städtebau. Stuttgart 1980, S. 54. 9 Vgl. ebd. 10 Ebd. S. 56. 11 Vgl. Martin Steinmann: Forme forte. Ecrits/ Schriften 1972–2002. Basel 2003, S. 15. 12 Ebd., S. 197.
Unantastbarkeit eines Kunstwerks genießen. Die Permanenz be zeichnet die materielle Beständigkeit einer Gestalt, die gerade im Kontrast mit einer sich ständig verändernden Stadt zu einem mit im materiellen Qualitäten aufgeladenen Bedeutungsträger wird.3 Rossi erkennt die Permanenz allerdings nicht nur in einzelnen öffentlichen Gebäuden, sondern insbesondere in den Orientierungen der Stra ßenzüge, der Parzellierung und allgemein den Achsen städtischer Entwicklung. Diese durch zum Teil längst überholte geschichtliche Faktoren konditionierten Fixpunkte wirken durch ihre Dauerhaftig keit beinahe wie unabänderliche topografische Gegebenheiten.4 Wichtig erscheint, dass Rossi die Permanenz nicht uneingeschränkt positiv belegt, sondern von „deplacierten […] einbalsamierten“ Be standteilen spricht, wenn sie den dynamischen Veränderungspro zessen der Stadt entgegenstehen.5 Als positives Beispiel fungieren dagegen die permanenten Elemente, die in der Lage sind, neue Funk tionen aufzunehmen und so an den dynamischen Prozessen mitzu wirken. Für Rossi können so die Großformen monumentaler Bauten wirken, die – obwohl ursprünglich mit einer spezifischen Form für eine spezifische Funktion entwickelt – unter dem Druck der Trans formationsprozesse die Spezifität der Form bewahren, aber sich mit neuen Funktionen zu füllen vermögen.6 Die Permanenz der Form bei wechselnder Funktion wird bereits vor dem Erscheinen der ‚Architektur der Stadt‘ in den frühen 1960er- Jahren von Hermann Hertzberger beschrieben.7 Sein strukturalisti scher Ansatz sieht in der „polyvalenten Form“ den Raum für persön liche Interpretationen und individuelle funktionale Aneignungen auf verschiedenen Maßstabsebenen – von den Räumen einer Wohnung bis zu den Gebäuden der Stadt.8 Er bezeichnet die so definierten Ele mente teils als „Prototypen“, die die individuellen Interpretationen kollektiver Strukturen möglich machen,9 oder aber als „Archeformen […] Da diese assoziativ sind für eine Vielzahl von Bedeutungen, kön nen sie ein Programm nicht nur aufnehmen, sondern auch auslösen. Form und Programm lösen sich wechselseitig aus“.10 Eine tenden ziell hänomenologische Sicht auf die polyvalente Form wird von Martin Steinmann entwickelt, der auch von „leeren Zeichen“ spricht, die nicht mit versteckten Bedeutungen aufgeladen und deshalb deu tungsoffen sind.11 Diese Idee von Zeichen und Dingen, die unmittel bar erfahrbar sind, entwickelt er unter dem Begriff der „starken Form“ weiter: „Es muss Formen […] geben, die unabhängig sind von der Er fahrung des einzelnen: Formen, die ihren Sinn in Beziehung zu grundlegenden Gesetzen der Wahrnehmung finden“.12 Mit Verweis auf Le Corbusiers Enthusiasmus für die amerikanischen Getreide silos definiert Steinmann die „starke Form“ als eine einfache Form, wobei er den Begriff der Einfachheit in der weiteren Beschreibung mithilfe der Wahrnehmungstheorien von Rudolf Arnheim wieder re lativiert: „Wenn wir den Bereich von einfachen Formen verlassen, so bezieht sich die Einfachheit nicht auf eine Form, sondern auf eine
156
HIATUS.indb 156
11.08.17 11:12
Struktur. Deswegen beschreibt Arnheim das Wahrnehmen von Form als das Erfassen ihrer strukturellen Merkmale“.13 In der folgenden Auswahl von Beobachtungen und Beispielen werden wir immer wieder auf sie stoßen: verschiedene Formen von Permanenz durch Robustheit, die sowohl struktureller wie auch for maler Natur ist. Wir werden sehen, wie wichtig der Zusammenhang zwischen Netzen der Erschließung und ankoppelbaren Funktionen ist; wir werden beobachten, wie polyvalente Formen neu program miert werden und starke Formen überdauern. Strukturelle Robustheit | Stadt Das Bild einer Stadt wie auch ihr Funktionieren ist fest verankert in ihrem Grundriss. Neben den topografischen Merkmalen sind die Körnung der Parzellierung und die Linienführung des Erschlie ßungsnetzes die Faktoren, die ihren Zustand prägen und ihre zu künftige Entwicklung tiefgreifend konditionieren. Die strukturelle Robustheit einer Stadt – verankert in diesen Merkmalen – spielt die entscheidende Rolle in der positiven Bewältigung der ständig statt findenden urbanen Transformationsprozesse. Eines der erfolgreichsten Modelle von Erschließungsnetzen in der globalen Stadtbaugeschichte ist das hippodamische System, das für die Neugründung, die Erweiterung und den Wiederaufbau von städ tischen Strukturen geeignet ist.14 Ein eindrückliches Beispiel für die Belastbarkeit dieses Systems unter hohem Transformationsdruck ist in Europa die Stadt Turin. Die bis heute erhaltene und deutlich ab lesbare Kernzelle Turins ist das hochdichte Quadrilatero Romano, das bis zu Beginn des 17. Jahrhunderts befestigt und verstärkt durch eine vorgelagerte Zitadelle die Stadt bildete. Als Hauptstadt des Her zogtums Savoyen wurde die Fläche Turins ab 1620 bis 1714 in drei Schritten auf insgesamt 180 Hektar verdreifacht.15 Die Erweiterung führte die rechtwinklige Rasterstruktur des Quadrilatero fort, aller dings wurde es weniger engmaschig und mit einigen Variationen in den Blocktiefen ausgeführt. Die zu den wichtigen Straßen gelegenen Fassaden der Häuserblöcke wurden durch verbindende Kolonnaden vereinheitlicht, zudem wurden an verschiedenen Stellen Blöcke unbebaut gelassen und als Stadtplätze gestaltet. Im zweiten der Er weiterungsschritte wurde die mittelalterliche Burg auf der heutigen Piazza Castello freigestellt. Eine weitere Permanenz, die die Regel mäßigkeit der Rasterstruktur unterbricht, ist die diagonal verlau fende Via Po, die einem alten Straßenverlauf folgend Piazza Castello mit einer der Brücken über den Po verbindet. Später wurden weitere diagonale Achsen in das System eingeschnitten, die auf die im Umland gelegenen Schlösser (Rivoli, Stupinigi) ausgerichtet waren. Nach dem Verzicht auf die Befestigungsanlagen hat sich Turin bis heute auf der ebenen, westlichen Seite des Pos zu großen Teilen dem
13 Ebd., S. 191. 14 Eine umfassende Sammlung zu Städten des Quadratrastertyps findet sich in: Hans-Eckhard Lindemann: Stadt im Quadrat. Geschichte und Gegenwart einer einprägsamen Stadtgestalt. Braun schweig 1999. 15 Vgl. Leonardo Benevolo: Die Geschichte der Stadt. Frankfurt 1975, S. 741.
157
HIATUS.indb 157
11.08.17 11:12
Abb. 1 Stadterweiterungen von Turin Zeichnung von Philipp Runggaldier (basierend auf den Betrachtungen Leonardo Benevolos zu Turin) © Werkzeugkulturen, RWTH Aachen
Abb. 2 Ringstrasse in Wien Zeichnung von Philipp Runggaldier © Werkzeugkulturen, RWTH Aachen
16 Vgl. Elisabeth Springer: Geschichte und Kul turleben der Wiener Ringstraße, Wiesbaden 1979. 17 Dass diese Entwicklung nicht immer der städ tischen Verdichtung dient, sondern zu grüner In frastruktur und Naherholungsraum wird, zeigen diverse Beispiele wie Münster oder B remen.
Quadratraster folgend erweitert. Das Ergebnis dieses stringenten und dadurch organisch wirkenden Wachstums ist eine dichte, ein heitliche und einprägsame Stadtstruktur, deren strikte Geometrie mit den später hinzugekommenen Stadtteilen am östlichen Ufer des Pos, deren Struktur ganz der hügeligen Topografie folgt, eindrucks voll kontrastiert (Abb. 1). Nicht die organische Erweiterung eines Erschließungssystems, sondern seine Konstituierung durch die radikale Umprogrammie rung eines obsolet gewordenen Stadtbausteins, erfolgt durch die Schleifung der Befestigungsanlagen in europäischen Städten. Inwie weit dadurch eine strukturelle Robustheit erzeugt wird, lässt sich kurz an einer der maßgeblichen Überformungsoperationen dieser Art beschreiben: der Ringstraße in Wien. Ab dem späten 18. Jahrhundert galten die Wiener Befestigungs anlagen als veraltet und bereits 1770 wurde von Kaiser Joseph II. die Anlage eines baumgesäumten Wegenetzes innerhalb des bis zu 450 Meter breiten, den Wallanlagen vorgelagerten und nicht bebau baren Glacis angeordnet. In der Folge entwickelt sich dieser Bereich zu einer beliebten Naherholungszone mit diversen Park-Infrastruk turen. Bedingt durch die Eingemeindung der Vorstädte 1850 und den Wachstumsdruck aus dem mittelalterlichen Zentrum heraus wurden die Wallanlagen als Hindernis der Entwicklung empfunden, worauf hin Kaiser Franz Josef I. im Dezember 1857 in einem Brief an die Be völkerung die Auflassung der Umwallung proklamierte und den Bau eines Boulevards forderte. Das anschließende Wettbewerbsverfah ren definierte die Planung der Ringstraße flankiert von repräsentati ven Gebäuden.16 Auffallend ist, dass die Absicht, die Freiflächen des Glacis dicht zu überbauen, nicht unumstritten war. Während der Staat durch den Verkauf der frei werdenden Grundstücke die di versen Repräsentationsbauten entlang der Ringstraße finanzieren konnte, profitierte die Stadt Wien finanziell nicht von dieser Ope ration und konnte dem Staat lediglich den Bau des Rathauses abrin gen. In dieser Konstellation verwiesen Vertreter der Stadt verstärkt auf den Wert des Glacis als Freifläche, konnten allerdings lediglich eine Serie von Stadtgärten als Freiflächen bewahren. Strategisch wirksam war in dieser Situation die Positionierung der Votivkirche, deren Grundsteinlegung bereits 1856 innerhalb der vorher als nicht überbaubar ausgewiesenen Zone eine Tatsache schuf, die der späte ren Verdichtung vorausging. Das Beispiel Wien zeigt mit besonderer Klarheit einen bemer kenswerten Mechanismus, der im Zusammenhang mit stadtnahen oder innerstädtischen militärischen Infrastrukturen – in diesem Fall den Wallanlagen – entsteht: gerade weil diese Infrastrukturen als übergeordnete, maßstäblich und funktional andersartige Fremd körper konzipiert wurden, stellen sie in der späteren Um- und Nach nutzung eine wertvolle Ressource für die dynamische Stadtentwick lung dar (Abb. 2).17
158
HIATUS.indb 158
11.08.17 11:12
Strukturelle Robustheit | Architektur Ebenso wie auf der Maßstabsebene Stadt lässt sich auf der Maßstabs ebene von Gebäuden feststellen, dass ihre strukturelle Robustheit unmittelbar mit der funktionalen und räumlichen Qualität ihrer Erschließungssysteme zusammenhängt. Als ein besonders klares Beispiel dafür kann der mittelalterliche Kreuzgang dienen.18 Das Architekturelement des Kreuzgangs ist Kernstück einer klaustralen Anlage, in der er sowohl als Verteiler wie auch als eigener Funktions raum dient.19 Viollet-le-Duc beschreibt in seinem ‚Dictionnaire‘ den Kreuzgang als eine Galerie von Laufgängen, die den von den Wän den der Klosterbauten umschlossenen Binnenraum auf allen vier Sei ten umläuft.20 Es handelt sich also um ein autonomes Architekturele ment mit eigenem Dach und eigener Fassade zu einem Innenhof, dessen Größe und Proportion – fast immer rechteckig, häufig qua dratisch – von den vier anschließenden Hauptgebäuden des Konvents definiert werden.21 Als Durchgangsraum eines Klosters verbindet der Kreuzgang die Kirche, Kapitelsaal, Refektorium und Dormitorium, gleichzeitig dient er aber auch für alltägliche Tätigkeiten wie das Wäschewaschen und Haareschneiden sowie für liturgische Aktivitä ten. Er ist ein hochfrequentierter, multifunktionaler Raum, der die räumliche Entsprechung des stark rhythmisierten, von zeitlich ge ordneten Ritualen geprägten Klosterlebens ist.22 Die strukturelle Robustheit des Kreuzgangs erlaubt es, dass er als Element mehrfach eingesetzt wird, um größere Anlagen zu organi sieren, und bedingt die besonders große Anpassungsfähigkeit, die Klosteranlagen in der Umnutzung aufweisen. Als funktionales und räumlich qualitätvolles System verbindet der Kreuzgang räumliche Einheiten verschiedener Dimension von der Zelle bis zum Groß raum und bildet so ein Gesamtgefüge von Räumen, das sich schon immer gut zu anderen – säkularen, öffentlichen – Nutzungen um programmieren ließ und lässt (Abb. 3). Die modularen Systeme des Industriebaus können ebenfalls in der Logik verteilender Systeme betrachtet werden, lediglich das hier nicht Personen, sondern Lasten und Stränge des technischen Aus baus innerhalb sich wiederholender Strukturen verteilt werden. Wir wissen durch die Umnutzungen von Industriebauten zu Wohn- und Kulturfunktionen, dass die modularen Systeme nicht nur der kons truktiven Effizienz der Vorfertigung entsprechen, sondern tatsäch lich flexibel bespielbar sind. Konzeptionell gleichen sie großen Re galen, in die man im Laufe der Zeit unterschiedliche Funktionen einräumen kann. Die Logik dieser modularen Strukturen ist als Er folgsmodell soweit akzeptiert, dass sie inzwischen auch in Neubau ten des Wohnens und Arbeitens eingesetzt werden. Die Tatsache, dass sich modulare Industriebauten zu qualität vollen Wohnräumen umnutzen lassen, hat aber nicht allein mit der flexiblen Aufteilbarkeit der Räume im Grundriss zu tun. Viel mehr
Abb. 3 Kreuzgang von Sankt Gallen Ausschnitt aus dem Sankt Galler Klosterplan © Stiftsbibliothek Sankt Gallen
18 Die verschiedenen Theorien zur Evolution des Kreuzgangs als eigenes Element können hier nicht bewertet werden. Wichtig ist aber, dass diverse die ser Theorien (zum Beispiel die Atriums- oder Villen theorie) beschreiben, wie in der Umnutzung oder der Neuinterpretation vorausgehender Bautypen ein starkes Erschließungselement konserviert oder transferiert werden kann. 19 Vgl. Rolf Legler: Der Kreuzgang. Bautypus des Mittelalters. Frankfurt 1989. Die Publikation Leg lers betrachtet das Sonderelement des Kreuzgangs isoliert vor dem Hintergrund der restlichen klös terlichen Anlage. 20 Vgl. Eugène Viollet-le-Duc: Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle. Paris 1868. Hier aus: Viollet-le-Duc: Dicti onnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, 1854–1868, tome 3.djvu/437; https://fr.wikisource.org/ (12. Februar 2017). 21 Vgl. Rolf Legler: Der Kreuzgang. Bautypus des Mittelalters. Frankfurt 1989, S. 245. Legler betont, dass nur die in dieser Autonomie ausg ebildeten Kreuzgänge unter die „Echten Kreuzgänge“ fallen, die in den frühen Typen noch eigenständiger aus gebildet waren, weil sie als Holzkonstruktionen vor Steinbauten gesetzt wurden. 22 Vgl. Peter K. Klein. Der mittelalterliche Kreuz gang. Architektur, Funktion und Programm. Re gensburg 2004, S. 9 ff.
159
HIATUS.indb 159
11.08.17 11:12
194
HIATUS.indb 194
11.08.17 11:12
SANAA-GEBÄUDE AUF DER ZECHE ZOLLVEREIN Fotoessay von Christoph Rokitta begleitet durch einen Text von Nadine Brüggebors
In seinem fotografischen Projekt über das Gebäude der Folkwang Universität der Künste, welches 2005 vom japanischen Architektur büro SANAA fertiggestellt wurde, folgt der Architekturfotograf und Architekt Christoph Rokitta einer stringent systematischen Me thode. Die Fotografien sind als Paare konzipiert, die orthogonal zu einander aufgenommen wurden. Die Betrachterstandpunkte liegen jeweils auf den zentralen Achsen gedachter Raumzonen, die sich zwischen den Erschließungskernen der jeweiligen Geschosse auf spannen. Rokitta setzt dieses fotografische Konzept konsequent und unabhängig von Geschosshöhe, Fenstersituation und vorgefundener Möblierung um. Eine allansichtige Dokumentation des Gebäudes ist nicht Ziel der konzeptuellen Anlage. Gleichwohl lassen sich die architektonischen Charakteristika an den aufgenommenen Details ablesen, die durch ihre reduzierte Formsprache Pars pro Toto für das Gesamtensemble stehen können. Die asymmetrische Anordnung der Fenster erlaubt die Folgerung, dass die innere Aufteilung der Geschosse nicht von außen ersichtlich wird. Der Ausblick auf Zechengelände, Wohnhäu ser und umgebende Natur ermöglicht dem Betrachter sowohl eine Verortung innerhalb der Gebäudeetagen als auch im Stadtraum. Die formale Strenge der Architektur wird durch die farbliche Reduktion der in Grautönen monochrom gehaltenen Materialien wie Aluminium, Glas und Beton verstärkt und ist Basis für ein brei tes Spektrum vielfältiger Nutzungsmöglichkeiten. Reduktion und Offenheit bilden eine Parallele zwischen dem architektonischen und dem fotografischen Konzept: Wie die Architekten dem Nutzer eine hohe Offenheit in der Aneignung des Gebäudes bieten, so überführt der Fotograf dieses Konzept ins Visuelle, indem er dem Betrachter Raum lässt für die eigene Imagination nicht ins Bild genommener oder (noch) nicht installierter Einrichtungen.
Ausschnitt aus einem Fotoessay von Christioph Rokitta Alle Fotografien © Christioph Rokitta
195
HIATUS.indb 195
11.08.17 11:12
198
HIATUS.indb 198
11.08.17 11:12
199
HIATUS.indb 199
11.08.17 11:12
202
HIATUS.indb 202
11.08.17 11:12
203
HIATUS.indb 203
11.08.17 11:12
V. SYNERGIE UND INTERAKTION
HIATUS.indb 212
11.08.17 11:12
SYNERGETISCHE PROGRAMMIERUNG Carla Rocneanu
Betrachtet man historische vernakuläre Architekturen, so zeigen sich oft charakteristische synergetische Strukturen und Prinzipien. Diese scheinen durch den Gebrauch und die Weiterentwicklung von unzähligen Nutzergenerationen auf ihre Essenz reduziert wor den zu sein. Am Beispiel Schwarzwaldhaus lässt sich – losgelöst vom Kontext Stadt – nachvollziehen, wie stetige Optimierungen ein hybrides Ge bäudekonzept entstehen ließen, das seinen Funktionen und Nutzern ein ideales Umfeld bietet (Abb. 1). Nutzungen sind so angeordnet, dass sie sich gegenseitig ergänzen und begünstigen. Bauelemente sind zwar auf ihr Wesentliches beschränkt, aber dennoch voller klu ger Leistungsfähigkeit. Nun lässt sich dieses Prinzip eines perfek tionierten Mikrokosmos nicht ohne Weiteres auf den komplexen und vielfältigen Makrokosmos heutiger Großstädte übertragen. Und doch kann man einige Ansätze ableiten, die Lösungen für die Wei terentwicklung zeitgenössischer Stadtmodelle liefern können. Längst lassen sich Lebens- und Arbeitsmodelle nicht mehr in we nigen Kategorien klassifizieren und somit auch kein Grundrezept Stadt mit allgemeinem Geltungsanspruch finden. Mit fortschreiten der Globalisierung und Technologisierung, sowie dem daraus resul tierenden digitalen Vernetzungspotenzial zwischen Individuen und Systemen, erhöht sich die Komplexität unserer Gesellschaftsstruktur und unseres Alltags. Es entstehen divergierende Milieus. Dieses Mehr an Dynamik und Vielschichtigkeit findet keine adäquate Ent sprechung in der gegenwärtig produzierten, vorrangig entmischten und rationalisierten Stadt. Laut Georg Simmel ist „die psychologi sche Grundlage, auf der der Typus großstädtischer Individualitäten sich erhebt, […] die Steigerung des Nervenlebens, die aus dem ra schen Wechsel äußerer Eindrücke hervorgeht. Der Mensch ist ein Unterschiedswesen, d. h. sein Bewusstsein wird durch den Unter schied des augenblicklichen Eindrucks gegen den vorhergehenden angeregt.“1 Die Bestrebungen, zu einer gemischten Stadt zurückzukehren, sind seit Langem auf der Agenda von Stadtplanern und Behörden und mit der Charta von Leipzig europäischer Konsens. Bei der Um
Abb. 1 Ulrich Schnitzler: Schwarzwaldhäuser von gestern für die Landwirtschaft von morgen. Theiss Verlag, Stuttgart, 1989 © Schillinger Verlag, Freiburg
1 Georg Simmel: Die Großstädte und das Geistes leben. Berlin 1984, S. 192.
213
HIATUS.indb 213
11.08.17 11:12
Abb. 2 Zeitschriftencover Zodiac 19, 1969 © Umberto Riva
setzung verlässt man sich jedoch zu sehr auf eine oberflächliche Pro-Forma-Mischung aus unspezifischen Komponenten ohne Be zugnahme auf den jeweiligen Kontext. Der Fokus liegt weiterhin auf einem störungsfreien Wohnen, dem zur Belebung – einer meist gleichförmigen Rezeptur folgend – Dienstleistung, Gastronomie und Kultur zur Seite gestellt werden. Eine räumliche Verzahnung der Nutzungen findet selten statt. Schnittflächen zwischen Bereichen unterschiedlichen Gebrauchs werden weiterhin mehr als Grenzen denn als Räume mit Potenzial für Synergie und Interaktion definiert. Eine Rückbesinnung auf hybride Gebäudetypologien mit syner getischen Nutzungsmischungen ist notwendig, um Nährboden für reale – und eben nicht digitale – soziale Interaktion zu schaffen. Synergetische Programme können Impulsgeber sein, um die gebaute Umwelt wieder in Einklang mit Gesellschaft und Ökonomie zu brin gen. Ein Aspekt darf aber nicht außer Acht gelassen werden: Die ak tive Annahme, Nutzung und mitunter Weiterentwicklung dieses Angebots obliegt den Nutzern selbst. „We expect too much of new buildings, and too little of ourselves“, hat Jane Jacobs in diesem Zusammenhang einst gemahnt.2 Die Anlage zu Partizipation und Adaptionsfähigkeit muss also auf der Gebäudeebene ebenso wie auf der Ebene der Stadt gewährleistet sein, um die erforderliche Vielfalt von Nutzungs- und Raumangeboten generieren zu können. Städte haben laut Jacobs „the capability of providing something for every body, only because, and only when, they are created by everybody.“3 Synergiebegriffe
2 Jane Jacobs: The Death and Life of Great Ame rican Cities. New York 1961, S. 334. 3 Ebd., S. 238. 4 „Das was aus Bestandteilen so zusammengesetzt ist, dass es ein einheitliches Ganzes bildet, nicht nach Art eines Haufens, sondern wie eine Silbe, das ist offenbar mehr als bloß die Summe seiner Bestandteile.“ Aristoteles: Metaphysik. Jena 1907, S. 129. 5 Richard Buckminster Fuller, Edgar J. Apple white: Synergetics. Explorations in the Geometry of Thinking. New York/London 1975, S. 3.
Aristoteles sinngemäß viel zitierter Satz, dass das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist, wird häufig als Definition von Synergie ge braucht.4 Obschon in gewissem Maße aus dem Sinnzusammenhang seiner Metaphysik Vll gerissen verdeutlicht er, dass die Interaktion zwischen den Elementen etwas Anderes entstehen lassen kann. Im Bezug auf Architektur, Struktur und Konstruktion erkennt Richard Buckminster Fuller: „Synergy means behavior of whole systems un predicted by the behavior of their parts […].“5 (Abb. 2) Ein Mehrwert generiert sich durch das Zusammenwirken der Systembestandteile, seien es Lebewesen, Kräfte oder Dinge. Trotz der mittlerweile inflationären Verwendung des Begriffs Sy nergie, vor allem in Bezug auf ökonomische Strategien, scheint er für die Beschreibung des Potenzials von sich gegenseitig ergänzenden, beeinflussenden oder bereichernden Nutzungen für Architektur, Raum und Programm passend. Betrachtet man diesbezüglich den übergeordneten Begriff der Synergie, so lassen sich unterschiedliche Synergieprinzipien erkennen, welche in anderen Wissenschafts disziplinen längst aufgezeigt wurden. Der Philosoph George Henry Lewes definierte 1875 den Unterschied zwischen resultierenden und
214
HIATUS.indb 214
11.08.17 11:12
emergenten synergetischen Wirkungszusammenhängen.6 Lewes zu folge bringen homogene, geschlossene Systeme durch die Vorherseh barkeit des Kräftespiels ihrer gleichartigen Elemente resultierende Zusammenhänge hervor. Heterogene, offene Systeme beinhalten durch die nicht vorhersehbare Kooperation ihrer ungleichen Ele mente die Anlage zu Emergenz.7 Diese Definition lässt sich durchaus auf das Gebiet der Archi tektur übertragen. So sind resultierende Synergieeffekte beispiels weise durch trennscharfe zeitliche oder programmatische Abfolgen im Gebrauch von Gebäuden zu erzielen – sie basieren auf einem additiven Prinzip. Emergente Synergien entstehen hingegen, sobald heterogene Nutzergruppen, Nutzungen oder Raumprogramme in direkten Austausch miteinander treten und in diesem Zuge etwas Anderes entsteht: Soziale, performative oder räumliche Phänomene, die in den ursprünglichen Elementeigenschaften der jeweils zugrun deliegenden Systeme weder enthalten noch durch deren Interaktion vorhersehbar waren – ein übersummatives Prinzip. Trotz der Unterschiedlichkeit resultierender und emergenter Sy nergien basieren beide Begriffe auf dem Vorhandensein von Schnitt stellen und Interaktion zwischen den Elementen. Im architektoni schen Kontext wird jedoch deutlich, dass Nutzungen oder Räume ohne erkennbare Schnittstellen und Interaktion ebenfalls Synergien hervorbringen können. Diesem Umstand soll die Einführung eines dritten Begriffs Rechnung tragen: Parallele Synergie. Im Folgenden werden die drei bereits erwähnten Synergiebe griffe – parallele, resultierende und emergente Synergie – hinsichtlich ihrer Bedeutung für Architektur und Raum untersucht und ihr ar chitektonisches Potenzial anhand von Beispielen veranschaulicht. Jeder dieser Begriffe generiert eigene Entwurfsstrategien, ihre Unter scheidung ist daher bewusst nicht qualitativer Natur. Parallele Synergie Sind zwei oder mehr – meist wesensfremde – Nutzungen so an geordnet, dass sie zwar indirekt einen Nutzen voneinander ziehen, hierfür jedoch keine aktivierbaren Schnittstellen benötigen, kann man von paralleler Synergie sprechen: Eine synergetische Koexistenz ohne Erfordernis einer gemeinsamen, übergeordneten Systemidentität. Die architektonische Strategie für die Genese paralleler Synergie liegt im Ausnutzen morphologischer und struktureller Eigenschaften von Gebäuden oder Systemen, etwa zugunsten eines städtebaulichen, energetischen oder ökologischen Mehrwerts. In Berlin hat sich eine Typologie etabliert, welche das Prinzip pa ralleler Synergie eindrücklich veranschaulicht: Aufgestockte Hoch bunker. Als erster seiner Art wurde der durch Karl Bonatz erbaute Schutzbau in der Reinhardtstraße für eine private Kunstsammlung
6 Vgl. George Henry Lewes: Problems of Life and Mind (First Series), Vol. 2. London 1875, S. 412. „Every resultant is either a sum or a difference of the co-operant forces; their sum, when their directions are the same – their difference, when their directions are contrary. Further, every result ant is clearly traceable in its components, because these are homogeneous and commensurable. It is otherwise with emergents, when, instead of adding measurable motion to measurable motion, or things of one kind to other individuals of their kind, there is a co-operation of things of unlike kinds. The emergent is unlike its components insofar as these are incommensurable, and it cannot be reduced to their sum or their difference.“ 7 Vgl. Tatjana Petzer in: Synergie. Kultur- und Wissensgeschichte einer Denkfigur. Paderborn 2016. S. 13.
215
HIATUS.indb 215
11.08.17 11:12
258
HIATUS.indb 258
11.08.17 11:13
BARBICAN ESTATE IN LONDON Fotoessay von Gilbert McCarragher und Paul Ellis begleitet durch einen Text von Alison Morris
„Hier sprechen die Steine, und ich verstehe ihre stumme Sprache.“1 Heinrich Heine Als Kind schien mir das Barbican ein verbotenes und magisches Gelände zu sein. Ich liebte es nicht instinktiv – ist es doch manch mal schwer, Dinge zu lieben, die man nicht ganz versteht. Wie es Kindern eben eigen ist, bevor Chronologien relevant oder lesbar wer den, nahm ich an, dass es immer schon dagewesen war. Erst viel spä ter wurde mir bewusst, dass sich seine und meine prägenden Jahre fast zur Gänze überschnitten: Der Bau begann, als meine Mutter mit mir schwanger war, die Wohnungen wurden um meinen zehnten Geburtstag herum fertig gestellt und das Arts Centre wurde eröffnet, als ich sechzehn Jahre alt war. In mancherlei Hinsicht begegnete ich bei meinen ersten Besuchen dem Märchenparadigma, dessen Inneres jedoch nach außen gekehrt war. Anstelle einer Burg, die von einer Dornenhecke umgeben war, fand ich eine Reihe von offenbar undurchdringlichen architekto nischen Hecken, die liebliche Gärten umschlossen. Aber ich konnte die Gärten nicht sofort sehen, nur die kultivierte Feindseligkeit der nicht intuitiven Schwellen spüren. Mit seinen Schießscharten, burgar tigen Mauern und den tollkühn neu ausgerichteten Turmfragmen ten schien es mir, als wäre eine makellose Festung auseinander ge schnitten und wären ihre Teile wieder zusammengesetzt worden, um ein neues Arkadien zu schaffen, das ich noch verstehen lernen musste: Es war das architektonische Äquivalent, Pflugschare aus Schwertern zu schmieden.
Alle Fotografien © Gilbert McCarragher und Paul Ellis 1 Brief „An Eduard von Schenk. Livorno, den 27. August 1828.“, aus: Heinrich Heines Autobio grafie: Nach seinen Werken, Briefen und Gesprä chen von Heinrich Heine, Gustav Karpeles. Ham burg 2014, S. 239.
259
HIATUS.indb 259
11.08.17 11:13
262
HIATUS.indb 262
11.08.17 11:14
263
HIATUS.indb 263
11.08.17 11:14
266
HIATUS.indb 266
11.08.17 11:14
267
HIATUS.indb 267
11.08.17 11:15
268
HIATUS.indb 268
11.08.17 11:15
269
HIATUS.indb 269
11.08.17 11:15
Vernakuläre Urbanität Die neue vernakuläre Urbanität legt die gebrauchte Stadt gleichzei tig frei und tilgt sie, reflektiert ihre eigene Geschichte und projiziert sie in die Zukunft. Viele verschiedene Narrative kommen in e inem Balanceakt aus Alt und Neu zusammen. Obwohl die vorangehend präsentierten drei Fallstudien nicht unterschiedlicher sein könnten, teilen sie doch eine gemeinsame Sprache. Sie bieten neue Interpre tationen der Stadt an, indem sie die städtischen Leerstellen neu be setzen. Vom Innenraum heraus entwickelt suchen die Projekte nach der einfachsten Formensprache, um sich im Kontext der Stadt zu po sitionieren und gleichzeitig einen neuartigen Raum zu schaffen. Sie machen Bereiche des Extremen bewohnbar, wo Vorstellungen von Raum und Bewohnbarkeit hinterfragt und Einschränkungen zu Möglichkeiten werden. Aus dem Englischen von Florian Strob
POSTKARTE 5: Zwillingsstudios
280
HIATUS.indb 280
11.08.17 11:15
KOBUTO Peter Behrbohm
Alles dreht sich. Hinter den langen Fensterbändern fliegt die Stadt vorüber. Von irgendwoher sprühen Funken und dann der Knall. Be stuckte Fassaden tanzen von der Bewegung verzerrt Ringelreihe. Überall wirbeln Motorenteile. Fragmente von Blech und Beton – und dazwischen bekritzeltes Papier, wild zerstoben in DIN A4. Noch im mer mit beiden Händen das lose Lenkrad umklammernd, gleitet der Fahrer durchs Bild. Ein älterer Herr mit kleiner runder Brille und dunkelblauem Rollkragen. Eben duckt er sich weg vor einem rosa la ckierten Pleuel, der ihn beinahe erwischt hätte. Fasziniert blickt er dem Metallteil hinterher. „Viel besser!“, ruft er.1 „Viel besser! End lich vollkommen in seine Bestandteile zerlegt, das Auto!“ Unterdes sen kollidiert der Scheibenwischer wild gestikulierend mit dem Er satzrad und beide machen sich in entgegengesetzte Richtungen davon. „Montiert bewegt es sich, aber zerlegt begeistert es mich!“ Der metallicblau lackierte Motorblock durchbricht eine Häuser wand und hinterlässt ein großes Loch in den Ziegelsteinen, die Fas sade schaukelt bedrohlich. Ein junger Mann, gebannt in das Okular einer großen Filmkamera schauend, trudelt mit der an ihn gegurte ten Rücksitzbank um den gemeinsamen Schwerpunkt und ver schwindet langsam in einer großen Staubwolke. Zwei Altbauten hat es wohl erwischt. Wie Spielklötze liegen sie nun auf der Seite. Ge rade klettern die ersten Bewohner aus den Fenstern und beginnen noch unsicheren Schrittes auf der Fassade herumzulaufen. Wie durch ein Wunder ist niemandem etwas passiert. Ein paar Personen treiben noch hilflos im Raum. Einer strampelt mit den Beinen und bläst mit aller Kraft in sein Saxophon. Ein anderer klammert sich an die große Planrolle, als wäre sie ein Rettungsboot. Darauf heißt es mit dicken Strichen: „Kobuto“.2 Dabei hatte alles so harmlos begonnen. Berlin-Lichterfelde Süd, ein Tag im Frühling, dreizehn Minuten vor neun. Gebüsch sprießt aus dem Zaun, der den wilden Garten zur Straße hin zu umschließen versucht. Zwischen Gestrüpp und Laub versteckt sich ein Gebäude, nicht besonders groß, aber dafür umso höher. Seitlich an dem drei stöckigen Hochhaus ist eine blaue Tür, auf den Klingelschildern steht nichts, nichts, Studio und Wohnung. Vor der Tür warten zwei junge Männer, einer von ihnen hat eine Kamera geschultert. Der Bei fahrer blickt auf seine Uhr, dann zum Kameramann. „Zu früh!“,
Abb. 1 Trommelbremse, Gaspedal, Grafiken nach dem Fischer Body Service Manual © Kobuto
1 Der episodenhafte Text basiert auf dem Dreh buch von KOBUTO – allem voran der geplanten Fahrt auf der nicht realisierten Stadtautobahn, die eine Grundidee des Films war, mit den Mitteln des Dokumentarfilms aber nicht umgesetzt werden konnte. Auch viele der oft absurden Geschichten fanden nur zum Teil Eingang in den Film. Die im Text erscheinenden Dialoge sind den zahlreichen Interviews mit Johannes Uhl entnommen, zum Teil tauchen sie auch im Film auf. 2 Obwohl das Projekt Neues Kreuzberger Zentrum oder später Zentrum Kreuzberg – Kreuzberg Merkezi getauft wurde, entdeckten wir auf den ver gilbten Planrollen im Keller des Architekten das Wort KOBUTO, mit dem er das Projekt am KOtt BUsser TOr betitelt hatte. KOBUTO klingt nach einem exotischen Ort in weiter Ferne und wurde schnell zum Titel für unser Projekt, das von diesem Ort erzählt, den in Berlin jeder kennt und den es zugleich doch gar nicht gibt.
281
HIATUS.indb 281
11.08.17 11:15
Abb. 2 Filmplakat © Kobuto
murmelt der verlegen, wartet und drückt dennoch auf alle Knöpfe. Als nichts passiert noch einmal. „Ich kaufe nichts!“, ruft da jemand. Es plätschert und die beiden legen ihre Köpfe in den Nacken. Vom Dach winkt der Fahrer. Die weißen Haare des älteren Herrn sind so klatschnass, als wäre er gerade aus dem Schwimmbad gestiegen. Er schmunzelt. „Das Wasser ist toll hier oben! Das sollten Sie auch mal probieren. Ich bin gleich da!“ Als die Tür sich öffnet, fällt der Blick in den Flur wie in ein Kanonenrohr. Heraus schießt der ältere Herr und deutet neben sich. „Nehmen sie die Pläne und Mappen mit?“ Schon fällt die Tür ins Schloss, voll bepackt haben die beiden Mühe ihm zu folgen. Er steuert über die Straße, auf das Nachbargebäude zu. Wie selbstverständlich geht es hinab in dessen Keller, sie durch queren mehrere lange Gänge und auf einmal stehen die drei in einer großen Garage. Einige der Fahrzeuge sind mit Tüchern abgedeckt, andere etwas verstaubt und wieder andere funkeln wie frisch poliert. Der Fahrer ist etwas außer Atem. „Hier ruhen die Tiere!“, raunt er dann, als würde er sie nicht aufwecken wollen. „Wie Blechkörper in Bademänteln.“ Er wandelt durch die Reihen, streicht dem einen über das Verdeck und klopft dem anderen auf die Haube – dann bleibt er vor einem vollkommen verstaubten Straßenkreuzer stehen. „Neh men wir den hier, oder? Er ist so alt wie das Haus!“ Cadillac Sedan Deville steht in geschwungenen Chrombuchstaben auf dem Kotflü gel. „1974! Oder nein, 1976!“, murmelt der Fahrer. „So ein Haus – das ist ja nie fertig. Und in diesem Fall … fing alles gerade erst an.“ Firing Order – 1 – 5 – 6 – 3 – 4 – 2 – 7 – 8 3
3 Die auf Englisch eingestreute Firing Order ist ein retroaktives Manifest. Dem großen Motor in den Mund gelegt und von den Autoren als Regeln aufgestellt, die dem Projekt hätten zugrunde liegen können – gegen die Erwartung und doch entspre chend der Zündreihenfolge des Cadillac V8 geord net. Johannes Uhl selbst hat nie ein Manifest verfasst, obwohl er seine Blätter gern auf dem Ar chizoom Sofa ausbreitet und scharfe Sätze formu liert. An diese Stelle tritt bei ihm die Handzeich nung.
Wie ein Keil steckt es in der Stadt. 295 Wohnungen, 90 Gewerbe einheiten, 11 Etagen. Das abgeknickte Hochhausband schlängelt sich ums Kottbusser Tor, schneidet durch Straßen, durch Blöcke. Ihm vorgelagert und mit ihm verbunden einige flachere Bauten. Alles hüpft und wogt gewaltig. Die alten Straßenzüge reichen so dicht an das Haus heran, dass man sie mit ausgestrecktem Arm fast berühren möchte. Hier hat die Stadt einen Sprung. Es passt nicht hierher und dennoch ist es nicht wegzudenken. Von einigen Seiten ist das Haus eine Wand, fast fensterlos. Von anderen besteht es nur aus Balkonen und Satellitenschüsseln, wie gestapelte Cabrios mit he runtergefahrenem Verdeck. „Schauen Sie!“, mit ausladender Geste wischt der Fahrer über die Dächer, die vor ihnen ausgebreitet liegen. „Wie über die alte Stadt ein neuer Maßstab drüber kriecht. Es ist ja nicht ein Haus. – Es ist ein Getier, das grapscht, herumfingert, sich aufrichtet, etwas fallen lässt, sich überbrückt – über die Straßen und auch über die Autobahn hinweg!“ Oben auf dem Dach steht der Cadillac. Hinter seinem Lenkrad wild gestikulierend der Fahrer. Beifahrer und Kameramann lauschen gespannt und folgen mit ihren Augen seinen Handbewegungen. Gerahmt wird das lange Haus von
282
HIATUS.indb 282
11.08.17 11:16
der Windschutzscheibe. Ein paar Schwalben sind zu hören, ansons ten ist es fast still, nur der Motor läuft. „Dieses Getier sollte eigent lich der Rücken sein für verschiedene Nester, und die Nester habe ich verstanden als Bühnen, auf denen man sich einrichten kann.“ Er macht eine umarmende Geste. „Und diese halbmondförmige Sichel stärkt diesen Charakter. Denn egal wo man ist, man ist immer in ei nem Gebilde, das einen umrahmt. Man sieht nicht fünf Balkons, man sieht immer hundert unterschiedliche Balkons und immer wie der fallen einige so richtig deutlich als Nester bespielt heraus.“ Er deutet auf den seitlichen Abschluss des langen Hauses. „Ganz schrecklich, das Gebäude hier abzuschneiden!“ Mit der Hand weist er in die Ferne. „Der Gedanke war, dass die Bebauung nicht hier mit dem Projekt endet, sondern als Typus sich fortsetzt und als Typus sich auch eine höhere Randbebauung im Hintergrund fortsetzt.“
Abb. 3 Kobuto, Filmstills 00:35:18 © Kobuto
1 The machine is fueled by oppositions –
find your opponent or let him find you
Als die Ampel auf Rot springt, muss der Fahrer auf die Klötze gehen. Durch die Frontscheibe sieht man ein Haus, das fast so aussieht wie ein Baum. „Da hätte ich beinahe Schülers Bierpinsel gefällt“, ruft er belustigt und schaut zum Beifahrer. „Sagt Ihnen der Name was?“ – „Ralf Schüler, der mit seiner Frau das ICC gebaut hat?“ – „Genau der! Wir haben zusammen studiert, an der TU Berlin. Schüler rief mich eines Tages an und meinte, er hätte zwei Walzen gesehen. Wunderschöne Dampfwalzen von Krauss Maffei aus dem Jahr 1924.“ Die Ampel springt auf Grün. „Da sieht man alles – da ist alles ables bar. Man schaut sie an und versteht sofort, wie die Bewegung entsteht.“ Von hinten hupt es. „Also habe ich Schüler gesagt, ich nehme auch eine und er hat die Lieferung per Eisenbahn und Kran organisiert. Und irgendwann schwebte dann wie ein Raumschiff eine Dampfwalze in meinen Vorgarten. Sie hat genau die Maße des Cadillacs. 5,20 m × 1,83 m.“ Der Beifahrer guckt etwas ungläubig. „Was hatten Sie damit vor?“ – „Ich sag’s mal so. Wenn sie die Stadtautobahn nicht fertig be kommen hätten …“, senkt er die Stimme in geheimnistuerischer Geste, „hätten wir die Route damit eben alleine geglättet.“ Beide lachen. Der Wagen gleitet über den Autobahnzubringer Steglitz. Von weither kommt ein langes Gebäude auf sie zu geschlängelt, reißt das Maul auf und verschluckt sie mitsamt der Fahrbahn. „Jetzt sind wir in der Schlange“, flüstert der Fahrer, dann ist Stille im Dunkel.
Abb. 4 Kobuto, Filmstill 00:05:20 © Kobuto
5 Don’t resolve conflicts – give them space and shape
Eine große blaue Mappe liegt auf der Heckklappe, Fahrer und Bei fahrer stehen davor, der Kameramann filmt aus der Hüfte, während
283
HIATUS.indb 283
11.08.17 11:16