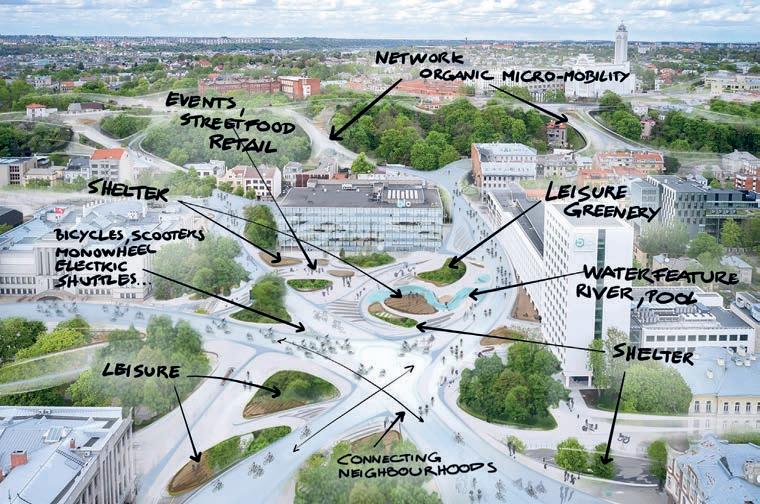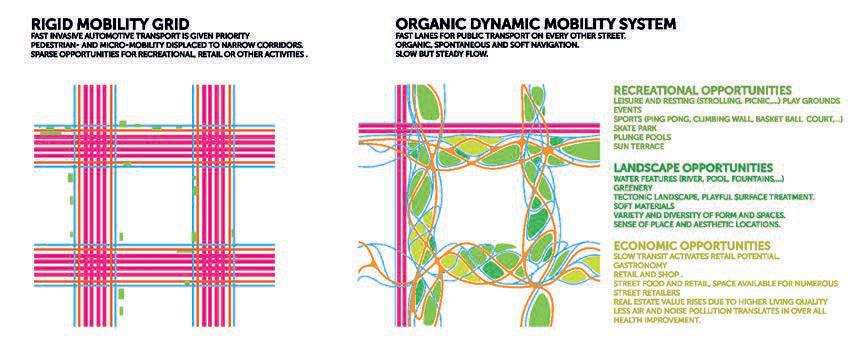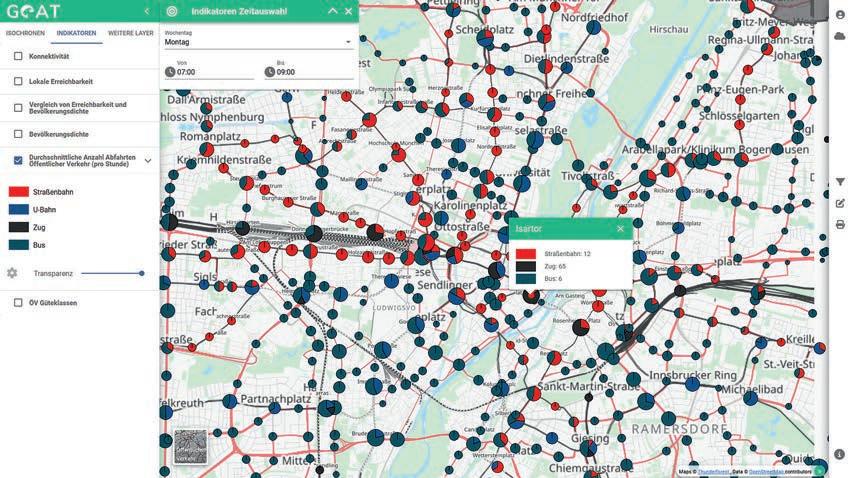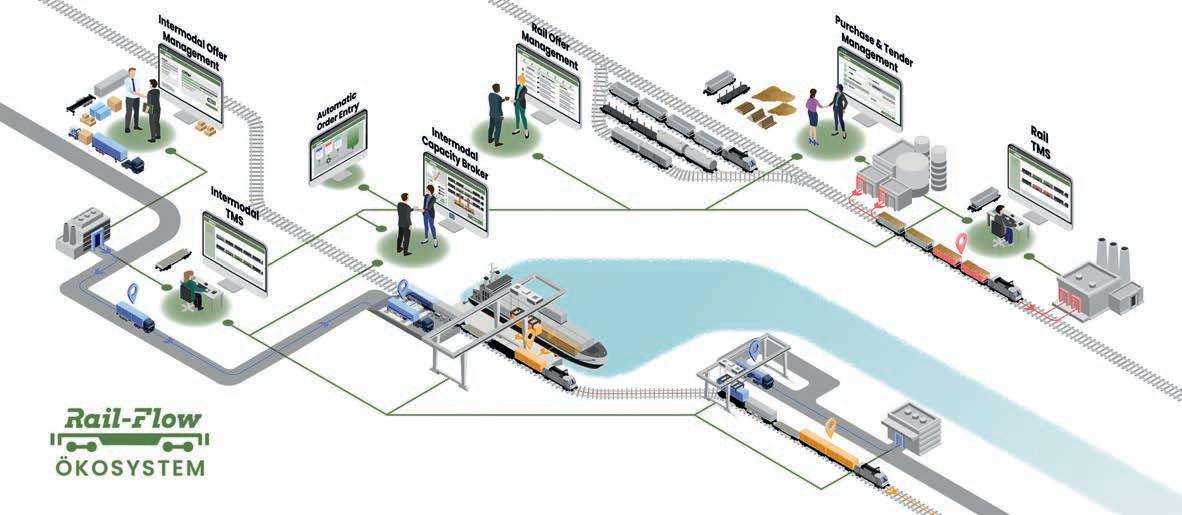DATA
Digitalisierung für die Mobilität von morgen
GRUNDSATZBEITRAG D-Ticket: Blaupause der Digitalisierung des ÖPNV Martin Schmitz
DIE BERECHNUNG DER WELT Wie Quantencomputing eine neue Ära einläutet Interview mit Prof. Sabina Jeschke URBAN HABITATS Creating spaces for people Interview mit Prof. em. Jan Gehl PARKRAUM DIGITAL Ticket-Muffel erfassen und Gefahrenstellen entschärfen Interview mit Dr. Almut Neumann VON GROSSEN VISIONEN, UNKLAREN ROLLEN UND HOLPRIGEN WEGEN Digitalisierung und die Verkehrswende Dr. Mara Cole
FLEXIBILITÄT FÜR DAS STROMSYSTEM Virtuelles Kraftwerk für erneuerbare Energien Interview mit Paul Kreutzkamp URBANER DATENRAUM Technik und Organisation zusammendenken Interview mit Dr. Alanus von Radecki

2023 28 . Jahrgang € 1 5 ISSN 0938-3689
JOIN NOW! DAS ONLINE-NETZWERK FÜR STADT- UND NENNI:RELKCIWTNETKEJORP WWW.POLIS-FORUM.COM DAS NEUE
CSILLA LETAY
Redaktionsleitung
polisMOBILITY
Liebe Leserinnen und Leser,
was wäre, wenn …? So wie wir uns diese Frage gelegentlich privat stellen, so ist sie oftmals die Keimzelle von Ideen und Visionen, von Entdeckungen und Erfindungen und daraus folgend von technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbrüchen.
Was wäre, wenn wir rollen statt laufen könnten? Was wäre, wenn wir die Flügel von Vögeln besäßen? Was wäre, wenn wir eine Maschine hätten, die besser als wir rechnen kann? Die Antworten und wie sie die Welt veränderten, kennen wir.
Fortschritt, nicht nur im technologischen Bereich, erwächst immer auch aus der Neugierde und Fantasie des Menschen. Die Frage „Was wäre, wenn …?“ steht dabei für das Streben nach Optimierung, nach Lösungen und für die Überwindung von Grenzen. Sie steht für die Macht der Vorstellungskraft, die Macht der Gestaltung.
In einer sich ständig wandelnden Welt ist diese Frage eine Konstante, die zugleich Wahrscheinlichkeiten vor Augen führt: Was wäre, wenn die Innenstädte weitestgehend von Autos befreit würden? Was wäre, wenn wir unsere Klimaziele verfehlen würden? Was wäre, wenn wir fossile Energieträger weiterhin in dem Maße und Tempo verbrennen würden wie in den letzten 40 Jahren? Was wäre, wenn die Energie- und Verkehrswende erfolgreich wären – und was, wenn nicht?
Diese Szenarien können heute mittels digitaler Tools modelliert werden. Simulationen eröffnen Politik, Wirtschaft sowie Stadt- und Verkehrsplanung vollkommen neue Möglichkeiten, um unsere Städte und Regionen den Zielen der Dekarbonisierung und der Infrastrukturentlastung näherzubringen.
Digital Twin, Metaverse, KI, GIS, 5G, 6G, Internet of Things, V2X, Quantencomputing – Begriffe wie
diese stehen stellvertretend für die Digitalisierung, die in einer neuen Dimension bei der Bewältigung drängender Herausforderungen unterstützen kann. Doch welchen Beitrag kann und muss sie konkret leisten? Was ist technisch und regulatorisch erforderlich, um ihre Potenziale zum Wohl aller auszuschöpfen? Und wie gehen wir mit ihrem immensen Bedarf an Daten um?
Um das genauer zu verstehen, haben wir für diese Ausgabe mit profilierten Expertinnen und Experten zentrale Gestaltungsaufgaben für die Mobilität und das urbane Zusammenleben erörtert. Wir blicken u.a. mit Dr. Alanus von Radecki auf kommunale Datenstrategien, mit Prof. Sabina Jeschke auf eine neue Ära durch Quantencomputing, mit Prof. Stefan Bratzel auf die Transformation der Automobilindustrie und mit Dieter Brell auf die Rolle von Design und Architektur bei der Umnutzung öffentlichen Raums.

Auch wenn immersive virtuelle Welten immer elaborierter und faszinierender werden – das Leben findet vorwiegend analog in der gebauten Umwelt statt. Diese nachhaltig, menschenzentriert und lebenswert zu gestalten, ist elementar. Und so ist die Botschaft, die uns der legendäre Kopenhagener Architekt und Urbanist Prof. em. Jan Gehl mitgegeben hat, eine universell gültige: „Make good places for people“.
Viel Freude bei der Lektüre, Csilla Letay
PS: Besuchen Sie uns vom 24. bis 26. Mai 2023 bei der polisMOBILITY expo & conference und seien Sie dabei, wenn wir uns mit Expert:innen aus Wirtschaft, Forschung und öffentlicher Hand zu diversen Aspekten der Energie- und Verkehrswende die Frage stellen „Was wäre, wenn …?“ und gemeinsam nach Lösungen suchen.
EDITORIAL 03
EDITORIAL
© Wolf Sondermann
“I call this number, call this number For a data date, data date I don't know what to do, what to do I need a rendezvous, rendezvous Computer love Computer love”
KRAFTWERK “COMPUTER LOVE”
INHALT polisMOBILITY
16 INTERVIEW
URBANER DATENRAUM Technik und Organisation zusammendenken
Interview mit Dr. Alanus von Radecki
18 INTERVIEW
NEXT LEVEL
„Eine Herkules-Aufgabe für etablierte Hersteller“
Interview mit Prof. Stefan Bratzel
22 INTERVIEW
DIE BERECHNUNG DER WELT Wie Quantencomputing eine neue Ära einläutet
Interview mit Prof. Sabina Jeschke
26 INTERVIEW
DEN SCHWARM IM BLICK Echtzeitdaten für Verkehrsmanagement und Verkehrsplanung

Interview mit Ralf-Peter Schäfer
Prof. em. Jan Gehl
30 VON GROSS ZU KLEIN UND VON ZENTRAL ZU DEZENTRAL Virtuelle Kraftwerke als Baustein in der Energiewende
34 INTERVIEW
FLEXIBILITÄT FÜR DAS STROMSYSTEM Virtuelles Kraftwerk für erneuerbare Energien
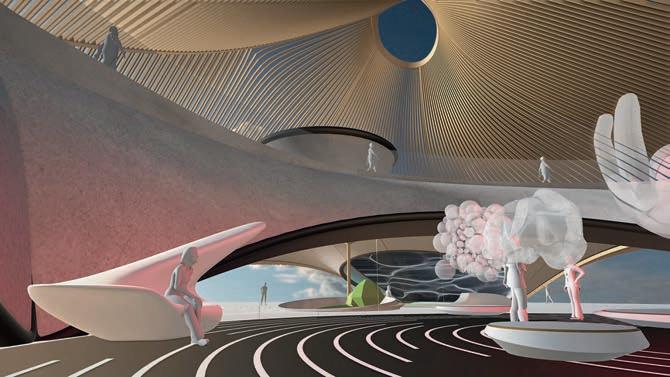
Interview mit Paul Kreutzkamp
36 INTERVIEW
PARKRAUM DIGITAL
Ticket-Muffel erfassen und Gefahrenstellen entschärfen
Interview mit Dr. Almut Neumann
38 BLACK BOX
FLY HIGH LIKE PAPER, GET HIGH LIKE PLANES
Die Freiheit beginnt jenseits des Autos
04 INHALT 03 EDITORIAL 06 VIRTUAL Das Metaverse als urbanes Experimentierfeld 08 SCALE Masterplan mit Weitsicht: Die Umsiedlung einer gesamten Stadt 10 SMART Innovative Stadterneuerung in Athen 12 MOBILITY News 14 GRUNDSATZBEITRAG D-TICKET: BLAUPAUSE DER DIGITALISIERUNG DES ÖPNV Bus- und Bahnunternehmen in der Transformation Martin Schmitz
06 67
„Making good places for people is inherently sustainable.“
© Render by ZHA © Shutterstock
74 PERSPEKTIVEN BIG DATA IN DER MOBILITÄT Von der Idee bis zur Umsetzung Patrick Blume
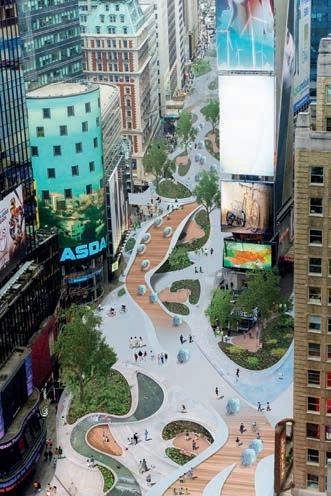


76 ALLES IN REICHWEITE? Erreichbarkeit mit Daten sichtbar machen
78 ALLES IM RAIL-FLOW Digitale Transformation auf der Schiene 80
INHALT 05 42 BLACK BOX „KERNFORSCHUNG“ IM METAVERSE Kunst und Technologie zusammengedacht 46 INTERVIEW URBAN HABITATS Creating spaces for people Interview mit Prof. em. Jan Gehl 50 INTERVIEW NEUE DIMENSIONEN Design für die Stadt der Zukunft Interview mit Dieter Brell 56 MEINUNGSBEITRAG VON GROSSEN VISIONEN, UNKLAREN ROLLEN UND HOLPRIGEN WEGEN Digitalisierung und die Verkehrswende Dr. Mara Cole 58 PERSPEKTIVEN KIEL BEKOMMT EINE TRAM Digitale Planung für die Mobilitätswende Nils Jänig
TECH News
60
TOGETHER
GAIA-X
DIE MOBILITÄT
zwischen
62 INTERVIEW NEUES LEVEL IN DER LUFT 5G-Technologie für Drohnenlogistik Interview mit Stephan Berkowitz, Norman Koerschulte & Michael Thärigen 66 ALL
NOW Zwischen Umbruch und Aufbruch: Die Automobilindustrie bündelt ihre Kräfte 70
FÜR
DER ZUKUNFT Sicherer mobiler Datenaustausch
Fahrzeugen und ihrem Umfeld
72 RECHT BETRIEB VON LADESÄULEN IN KOMMUNEN Ausbau der Ladeinfrastruktur unter Berücksichtigung kommunaler Vergabepolitik Désirée Oberpichler
HEROES
FUTURE
URBAN News 82 IMPRESSUM 54 38 08 © White Arkitekter © paper planes e.V. © 3deluxe
VIRTUAL
DAS METAVERSE ALS URBANES EXPERIMENTIERFELD
Virtuelle Realitäten entwickeln sich immer mehr zu einer Option für Planer:innen, um für das gebaute Konstrukt Stadt neue, innovative und zukunftsweisende Raumlösungen hervorzubringen. Die Gestaltung eines solchen urbanen Raums fokussiert derzeit auch das Team rund um Zaha Hadid Architects mit seiner Masterplanung für das Liberland Metaverse: ein virtuelles Modell des realen, international nicht anerkannten und unbewohnten Gebietes Liberland zwischen Kroatien und Serbien. Das Liberland Metaverse integriert Orte für soziale Interaktion, bietet Raum zum Experimentieren und zeigt, welches Potenzial virtuelle Realität für die Stadtgestaltung der Zukunft hervorbringen kann.

06 POLIS MOBILITY
© ZHA/Render by Mytaverse
Mit ihrem Masterplan für das Liberland Metaverse entwickeln Zaha Hadid Architects eine beeindruckende virtuelle Welt, die gestalterisch vor allem durch parametrisches Design und futuristische Anmutung auffällt.
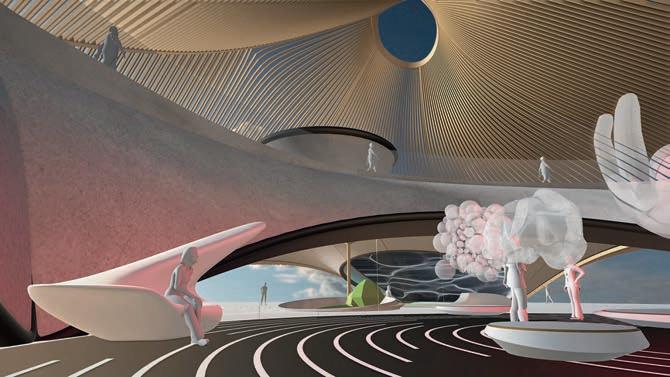
Digitale Tools, parametrisches Design, Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) sind im Kontext heutiger Architektur, Stadtplanung und Mobilität fast nicht mehr wegzudenken – sie gehören mittlerweile zum Standardrepertoire. Vor allem spielen sie in puncto Innovation und Fortschritt eine zentrale Rolle – schließlich eröffnen diese Instrumente schier grenzenlose Möglichkeiten zum Experimentieren. Mit dem Liberland Metaverse konzipiert und entwickelt Zaha Hadid Architects (ZHA) derzeit ein neues Projekt, das sich bewusst auf den Bereich der VR konzentriert. Es handelt sich um einen digitalen Zwilling im 1:1-Maßstab: Die Landmasse – in diesem Fall das brachliegende Niemandsland Liberland, gelegen an der Donau zwischen Serbien und Kroatien – bildet als geografisches Areal die Grundlage für die Planungen, die Architektur selbst befindet sich jedoch ausschließlich im Metaverse, sprich als digitale Masse im virtuellen Raum.
Masterplan Liberland Metaverse
Gestalterisch prägt eine parametrische Designsprache den Entwurf: Wellenförmige, geschwungene Konturen formen eine digitale Stadtstruktur, 4,3 km lang, zusammengesetzt aus Gebäuden, Grünflächen und Infrastruktur. Essenziell für den Masterplan des Liberland Metaverse sind unter anderem sieben Key Buildings: ein Rathaus mit dazugehöriger Plaza, ein DeFi-Zentrum (Decentralized Finance) mit Plaza, ein NFT-Zentrum mit Plaza und ein Ausstellungszentrum. Die Gebäude sind als modulare Varianten konzipiert, damit die virtuelle Welt flexibel an die sich wandelnden sozialen Bedürfnisse der Besucher:innen angepasst werden kann. Zu diesen gesellschaftlichen Notwendigkeiten und Bedürfnissen zählt auch eine menschenverträgliche Mobilität. Die digitale Stadt hat in Krypto-Kreisen einen hohen Bekanntheitsgrad und dadurch bereits über 600.000 Einwohner:innen.

Stadtanalogie in der Virtual Reality
Federführend an der Umsetzung beteiligt ist ZHA-Teilhaber und Architekt Patrick Schumacher. Er ist überzeugt, dass das Metaverse für die Disziplin der Architektur vielversprechende neue Möglichkeiten eröffnet – und das nicht nur hinsichtlich der Gestaltung. Auch wenn physische Umgebungen niemals obsolet würden, so
seien virtuelle Umgebungen gleichermaßen real, denn auch hier existiere laut Schumacher eine soziale Realität. „Die wesentlichen Vorteile virtueller Umgebungen sind ihre globale Zugänglichkeit und ihre adaptive, parametrische Formbarkeit. Wir streben die Verflechtung von virtuellen und physischen Räumen an – so auch bei unserer Konzeption für das Liberland Metaverse“, erklärt Schumacher. Betreten können die Besucher:innen das Liberland Metaverse über die Cloud-basierte Plattform Mytaverse. Als Avatare können sie sich dann spontan und frei in der virtuellen Welt bewegen, etwa um sich auszutauschen, eine Ausstellung zu besuchen oder gemeinsame Ideen zu entwickeln.
Seit Wissenschaftler:innen und Forscher:innen in den 1960er-Jahren erstmals Konzepte und Technologien zur Schaffung einer immersiven, computergenerierten Umgebung entwickelten, hat sich eine Menge getan: Menschen können in der VR sowohl miteinander als auch mit virtuellen Objekten und ihrer virtuellen Umgebung interagieren – das gilt auch für das Liberland Metaverse. „Bei jedem Design geht es darum, soziale Interaktionen zu gestalten. Das Metaverse, zu dem ich beitragen möchte, unterstützt und wird Teil des produktiven gesellschaftlichen Lebens und ein integraler Bestandteil der gesellschaftlichen Produktion und gesellschaftlichen Reproduktion. Es bereichert die Gesellschaft und ermöglicht ein erfülltes, produktives Leben“, betont Schumacher. Um eine Analogie zur Stadt zu erzeugen, müsse daher auch eine virtuelle Welt nutzungsorientiert sein, sprich ausgerichtet auf angeborene und erlernte intuitive kognitive Fähigkeiten in Bezug auf Orientierung, Wegefindung und das Lesen subtiler ästhetischer sozialer Atmosphären und Situationen.
Virtuelle Sphäre als Katalysator für bessere Stadtgestaltung Projekte wie das Liberland Metaverse ermöglichen es Planer:innen, das gebaute Konstrukt Stadt mitsamt seiner Infrastruktur kritisch infrage zu stellen. Kurzum kann die virtuelle Sphäre also in Zukunft dazu beitragen, unsere Städte zukunftsorientierter, innovativer, nachhaltiger und bedürfnisorientierter sowie im besten Falle sozial gerechter zu gestalten.
POLIS MOBILITY 07
©
Render by ZHA (2)
Die Besucher:innen können sich als Avatare frei im Liberland Metaverse bewegen und so die vielseitigen Orte im digitalen Raum erkunden – hier ist z.B. das Ausstellungszentrum zu sehen.
SCALE
MASTERPLAN MIT WEITSICHT: DIE UMSIEDLUNG EINER GESAMTEN STADT
Der von White Arkitekter und Ghilardi + Hellsten Arkitekter gemeinsam entwickelte Masterplan für die schwedische Stadt Kiruna zeigt eindrücklich, wie die Herausforderung ihrer Umsiedlung gemeistert, eine resiliente und weitsichtige Stadtentwicklung gelingen und eine gute Zukunft für die Stadt gewährleistet werden kann. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einem perspektivischen Planungsprozess: 2012 begannen die Planungen, die letzte Phase soll 2100 abgeschlossen sein.

08 POLIS MOBILITY
© White Arkitekter (2)
Für die Umsiedlung der schwedischen Stadt
Kiruna sieht der von White Arkitekter und Ghilardi + Hellsten Arkitekter gemeinsam entwickelte Masterplan einen in mehrere Phasen gegliederten Planungsprozess vor: 2022 wurde die neue Innenstadt eingeweiht und damit ein wichtiger Meilenstein erreicht.
Die schwedische Stadt Kiruna steht vor einer großen städtebaulichen Aufgabe. Sie liegt über der größten unterirdischen Eisenerzmine der Welt – und muss aufgrund Expansionsplänen für die Mine umgesiedelt werden. 2012 wurde zum Vorhaben der Verlegung der Stadt um ca. drei Kilometer Richtung Osten ein internationaler Architekturwettbewerb ausgelobt, den schließlich das Team von White Arkitekter, Ghilardi + Hellsten Arkitekter, Spacescape, Vectura Consulting und Evidens BLW mit einem gemeinsamen Masterplan für sich entscheiden konnte.

Kiruna City Plan: Umsiedlung als Prozess
Im 19. Jahrhundert wurde Kiruna zusammen mit einem Bergwerk gegründet. Während der Eisenerzabbau von großer ökonomischer und sozialer Relevanz für Kiruna ist, entstand andererseits mit dem fortschreitenden Abbau jedoch auch ein gravierendes Problem: Mit zunehmendem Absinken des Bodens und der geplanten Erweiterung der Mine wird die darüber liegende Fläche instabil und somit unbewohnbar werden. Auf der Suche nach einer langfristigen Strategie beschloss die schwedische Regierung, die Stadt umzusiedeln.
Umsiedlungen sind eine höchst komplexe, herausfordernde Maßnahme und gehen mit einer sozialen Verantwortung einher – im Fall von Kiruna bedeutet es, mit 20.000 Menschen und einer Fläche von 120 ha umzugehen. Der Masterplan, den White Arkitekter und Ghilardi + Hellsten Arkitekter entwickelten, zielt insbesondere auf eine abwechslungsreiche und lebenswerte Stadt ab, die ihre Identität aus ihrem unaufgeregten Geist, ihrer natürlichen Umgebung und ihrer Vergangenheit bezieht. Der Plan sieht u.a. eine dichtere Besiedlung mit urbanen Treffpunkten vor, sowie eine systematische Wiederverwendung des alten Kirunas und eine enge, sinnvolle Beziehung zur Natur und zur subarktischen Umgebung. Kiruna 4-ever, wie die Architekt:innen das Projekt nennen, konzentriert sich auf einen strategischen Umsiedlungsprozess, der bis zum Jahr 2100 die Stadt Schritt für Schritt transformieren soll. 2022 wurde nun die erste Phase fertiggestellt. Insgesamt konnten 39 historische Gebäude erhalten und mithilfe von Lkws und Kränen von der alten in die neue Innenstadt bewegt werden. Nun sind die Planungen von White Arkitekter und Ghilardi + Hellsten Arkitekter weitestgehend abgeschlossen, die weiteren Phasen wird die Kommune eigenständig umsetzen.
Zukunftsgewandtes Mobilitätskonzept
Eine Planung, die so weit in die Zukunft reicht, wirft die Frage auf, wie sich Stadt und Mobilität perspektivisch verändern werden. Nach der lange währenden automobilen Dominanz und Funktionstrennung weiß man heute, dass es vor allem Städte mit
dichter und gemischter Nutzung sind, die eine soziale, ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit erzeugen. Zudem braucht es laut White Arkitekter die Koppelung verschiedener Verkehrsträger, Aktivitäten und Einwohner:innen – sprich, alle Menschen sollen einander trotz ihrer individuellen Mobilitätswahl im Alltag begegnen. Zudem gehen die Architekt:innen davon aus, dass im urbanen Raum der Zugverkehr weiter wachsen, schneller und effizienter sein wird. Daher platzieren sie den neuen Bahnhof bewusst zentral und gut erreichbar im Herzen der neuen Stadt. Für eine verkehrsmittelübergreifende Vernetzung sorgt darüber hinaus ein neuer zentral gelegener Knotenpunkt, der sowohl mit dem Zug und öffentlichen Verkehrsmitteln als auch via Auto oder Roller und ebenso zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreicht werden kann. Ergänzend sorgt eine Seilbahn für eine effiziente Verbindung zwischen dem neuen Kiruna und dem bestehenden Bergwerk. „Unser Ansatz ist, dass der Personenverkehr auf schnelle, häufige und klimafreundliche öffentliche Verkehrsmittel und der Güterverkehr auf die Schiene verlagert werden kann. Um dies zu erreichen, ist ein attraktives öffentliches Verkehrsnetz erforderlich“, bekräftigt White Arkitekter das Mobilitätskonzept.
Einsatz von digitalen Planungswerkzeugen
White Arkitekter nutzt Computational Design als ein essenzielles Planungswerkzeug. Im Zuge der Planungen für Kiruna kam z.B. Micro-Climate-Modelling zur Anwendung, um für eine langfristige Planung die Umgebung detailliert analysieren und das Mikroklima auf lange Sicht simulieren zu können. Zur stetigen Verbesserung seiner architektonischen sowie städtebaulichen Gestaltungen entwickle sich White Arkitekter hinsichtlich des Einsatzes von Computational Design kontinuierlich weiter, betont Jonas Runberger, der die Abteilung Dsearch, Digital Matter leitet: „Computational Design beschleunigt den Wandel zu einer nachhaltigeren Gesellschaft: Die Verfahren ermöglichen eine innovativere Architektur sowie, die Auswirkungen verschiedener ressourceneffizienter Lösungen zu messen und zu quantifizieren und die richtigen Materialien an der richtigen Stelle einzusetzen. Sie helfen uns, die Klimaauswirkungen der gebauten Umwelt zu minimieren.“
Pionierbeispiel für die Stadt der Zukunft
Im neuen Kiruna sollen die Bewohner:innen künftig in einer sicheren und lebenswerten Umgebung zu Hause sein. Mit einer klimabewussten Grundhaltung, einer interdisziplinären Betrachtung und der Verwendung von digitalen Werkzeugen unter Berücksichtigung einer sich stets verändernden (Um-)Welt und der langfristigen Entwicklung von Mobilität wollen White Arkitekter und Ghilardi + Hellsten Arkitekter eine resiliente und zukunftsgewandte Stadt realisieren.
SMART INNOVATIVE
STADTERNEUERUNG IN ATHEN
In Athen entsteht eine neue Smart City: The Ellinikon. Neben dem Projektentwickler
Lamda Development sind Büros verschiedener Disziplinen an der Realisierung beteiligt, darunter Foster + Partners, Aedas, Kengo Kuma Architects und Sasaki, die im Sinne einer nachhaltigen und technologiegesteuerten Stadterneuerung ihre vielfältige und umfassende Expertise einbringen, um die ambitionierten Ziele des Smart-CityProjektes umzusetzen.

10 POLIS MOBILITY
© Lamda Development / The Ellinikon (3)
Mit The Ellinikon realisiert Lamda Development in Athen eine neue Smart City, die den Bewohner:innen und Besucher:innen einen naturnahen Ort zum nachhaltigen Leben und Arbeiten bieten soll. Das zu entwickelnde 3,5 km lange Küstenareal liegt südlich von Athens Zentrum und zählt mit einer Fläche von rund 620 ha zu den größten Stadterneuerungsprojekten Europas. An der Umsetzung sind neben Projektentwickler Lamda Development eine Reihe renommierter Büros beteiligt: Das Team von Foster + Partners konzipierte den städtebaulichen Masterplan und realisierte den Riviera Tower. Kengo Kuma Architects plant die Riviera Galleria, Aedas das Vouliagmenis Mixed Used Tower & Commercial Hub und das Landschaftsarchitekturteam von Sasaki den 200 ha großen Ellinikon Park.
Smart (er-)leben: Digitaler Zwilling zeigt Vision von Wohnen, Arbeit, Freizeit und Erholung
Konkret umfasst die Planung neben neuen Wohnsiedlungen, die rund 10.000 Wohneinheiten beinhalten sollen, auch Parks mit vielfältigen Grün- und Erholungsflächen sowie eine Reihe an Hotels, Einkaufszentren, Museen, Kultur-, Freizeit- und Bildungseinrichtungen. Insgesamt sollen rund 75.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Eine dieser neuen Einrichtungen ist das Ellinikon Experience Center. Auf 4.800 m² und in fünf Themenbereichen – Living a New Era, Living in Nature, Living the Future, Living Smart und Living by the Sea – können Besucher:innen die Geschichte Ellinikons erleben, von der ehemaligen Nutzung des Stadtteils als Flughafen und Luftwaffenstützpunkt bis hin zur Vision als zukünftige Smart City. In der Virtual und Augmented Reality können sie einen digitalen Zwilling von The Ellinikon selbst entdecken oder auf großen Bildschirmen mehr über die Smart City erfahren – etwa, wie mit innovativen Infrastrukturen die Stadt zukunftssicher werden soll und was hinter dem Versprechen des Projektes steckt, „der intelligenteste und grünste Ort zum Leben in Europa“ zu werden.
Marine Lage, Nachhaltigkeit und Lebensqualität
Zentraler Aspekt für den Masterplan ist die geografische Lage. Die Nähe zum Meer beeinflusst von Beginn an die Gestaltung, denn die Natur soll einen positiven Beitrag für die Lebensqualität in der neuen Smart City leisten. Hierfür spielt neben dem Meer auch der öffentlich zugängliche Ellinikon Park eine zentrale Rolle, der zahlreiche Grün- und Erholungsflächen bieten und mit rund 50 km Rad- und Fußwegen sowohl das bestehende Stadtgefüge als auch die neuen Wohnsiedlungen infrastrukturell mit der Küste verbinden soll. Der neue Küstenpark soll über eine Vielzahl digitaler Strukturen verfügen: drahtlose Konnektivität, AR-Navigation, intelligente Transportsysteme sowie intelligente Energie- und Wasser-Managementsysteme. Insgesamt ist eine klimapositive Wirkung angestrebt, indem der Park sich z.B. hinsichtlich Strom- und


Bewässerungsbedarf auf lange Sicht selbst versorgen soll. Da sich die Nähe zum Meer zudem stark auf das Mikroklima auswirkt, wurden bereits in der frühen Entwurfsphase historische meteorologische GIS-Geländedaten detailliert analysiert, um die Masterplanung zu optimieren. Der Effekt des Meeres reduziert z.B. den Heizungs- und Kühlungsbedarf und zahlt so auf natürlichem Wege auf die Nachhaltigkeitsziele von The Ellinikon ein.
Planung mittels Simulationen: Intelligente Mobilität Die Smart City ist als 15-Minuten-Stadt konzipiert – somit ist Mobilität von Anfang ein zentraler Planungsaspekt. Unter anderem kamen Verkehrssimulationen zur Anwendung, um das Straßennetz zu optimieren – sprich, den Verkehr möglichst effizient und nachhaltig planen und unterdessen verschiedene Verkehrsträger bestmöglich integrieren zu können. Im Detail setzt das Konzept auf Mikro- und Aktivmobilität – kombiniert mit moderner, digitaler Infrastruktur: intelligente Parksysteme, intelligente Verkehrsüberwachung, Fahrrad-, E-Bike- sowie E-Scooter-Sharing und E-Lieferroboter. So soll den Nutzer:innen eine Vielzahl von nachhaltigen Fortbewegungsmöglichkeiten geboten und durch die Minimierung des Pkw-Verkehrs gleichsam die lokale Umweltverschmutzung reduziert werden.
Gute Ambitionen als planerische Grundlage
Laut Begriffsdefinition beinhaltet eine Smart City im Kern sechs Aspekte: Smart Living, Smart Mobility, Smart People, Smart Environment, Smart Economy und Smart Governance. Die Planung von The Ellinikon soll auf eine sinnvolle Umsetzung dieser Aspekte einzahlen. Die 15-Minuten-Smart-City steht für eine resiliente Entwicklung; mit dem Konzept wird hinsichtlich Nachhaltigkeit das Ziel eines Netto-Null-Kohlenstoff-Fußabdrucks verfolgt. Projektentwickler Lamda Development setzt dazu auf interdisziplinäre Expertise, digitale Werkzeuge sowie nachhaltige und technologiegestützte Stadt- und Mobilitätskonzepte. Das Projekt soll zu einem internationalen Vorreiter für Küsten- und Umweltdesign, intelligentes Wohnen sowie nachhaltige, kohlenstoffarme Stadterneuerung werden. Auch wenn die Entwicklung des Projektes und das Erreichen der forcierten Ziele noch ausstehen, darf man sich optimistisch auf die nächsten Meilensteine freuen.
POLIS MOBILITY 11
Im Ellinikon Experience Center können Besucher:innen in fünf Themenbereichen mehr über die Smart City erfahren und einen digitalen Zwilling von The Ellinikon entdecken. Hier zentral zu sehen ist der Riviera Tower von Foster + Partners
Das von Aedas konzipierte Vouliagmenis Mixed Used Tower & Commercial Hub soll Bewohner:innen und Besucher:innen auf rund 185.000 m² einen neuen Ort zum Arbeiten sowie für Erholung und Freizeit bieten.
CLIMB-E: MULTIFUNKTIONALE PLATTFORM MIT KAPSEL
Ländliche Daseinsvorsorge, überlasteter Verkehr und Klimakrise – die Konzeptstudie Climb-E von Italdesign adressiert all diese Herausforderungen zugleich. Die auf der CES 2023 vorgestellte elektrische Transportplattform des italienischen Designbüros ist autonom unterwegs, die aufliegende Kapsel lässt sich flexibel in die Umgebung integrieren. Damit ist ein nahtloser Transport vom Wohnzimmer direkt auf die Straße möglich. Für den privaten Gebrauch mit einer Kapazität bis zu vier Personen geeignet, erlaubt das Vehikel auch alternative Nutzungen. So lässt sich Climb-E zur Zahnarztpraxis, zum mobilen Homeoffice oder Massagestudio umfunktionieren. Für das Konzept schloss sich Italdesign mit der polytechnischen Universität Turin und dem Schindler zusammen, einem auf vertikale Mobilität spezialisierten Unternehmen. Konkrete Umsetzungspläne stehen allerdings noch aus.

EINKAUFEN AUF
DEM LAND: DB UND REWE STARTEN SUPERMARKTBUS
Ein „Einkaufsbus“ ist im ländlichen Raum oft die letzte Lösung, wenn sonst nichts mehr geht: ein spezieller Bus, der Menschen ohne Auto zum Markttag abholt und nachher wieder zurückbringt. DB und REWE kehren das Prinzip jetzt um: Der Supermarkt kommt als Bus direkt zu den Menschen in den Dörfern. Das Konzept ist nicht neu, könnte die Verkehrswende auf dem Land aber neu beleben. Auf der „Grünen Woche“ präsentierten REWE und DB Regio Bus Mitte einen Supermarkt auf sechs Rädern: Ein ganzer Gelenkbus wurde zum mobilen REWE-Markt umgebaut. Fahren soll er durch die ländlichen Regionen Nordhessens, wo der Weg zum nächsten Nahversorger oft weit ist. In den Landkreisen Kassel, Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg soll der Bus 18 Orte regelmäßig anfahren und dort über 700 Produkte anbieten, vor allem solche aus regionalem Anbau oder Fairtrade-Artikel. Der Supermarktbus soll eine Alternative zum Einkaufen mit dem Auto sein. Ganz neu ist die Idee dabei nicht, fahrende Bäcker- oder Fleischerwagen sind in vielen Dörfern verbreitet, und auch der Schweizer Supermarkt Migros betrieb ursprünglich „Migroswagen“, die bis 2007 die normalen Filialen ergänzten. Richtig probiert hat es mit den fahrenden Supermärkten in Deutschland aber noch niemand. DB Regio Bus Mitte übernimmt in dem Pilotprojekt die Wartung und den Fahrbetrieb, Sortiment und Verkaufspersonal kommen von einem nordhessischen REWE-Händler. Bereits im letzten Jahr hatten REWE und DB eine Kooperation, aus der die neue Idee entstanden ist: Der „Faire Supermarktzug“ besteht aus drei zum Supermarkt und Bistro umgebauten Nahverkehrswagen, die bereits 2021 sechs Bahnhöfe in Hessen anfuhren. Auf der Grünen Woche wurde er neben dem neu umgebauten Bus gezeigt.

12 MOBILITY NEWS
© Italdesign
© Deutsche Bahn AG
Der Climb-E bricht Kategorien von Architektur und Mobilität auf.
Rewe und Deutsche Bahn starten Einkaufsbus für ländliche Gebiete.
MOBILITATSANBIETER DOOR2DOOR INSOLVENT
Im Dezember vergangenen Jahres hat der deutsche Ridepooling-Pionier door2door überraschend Insolvenz angemeldet. Damit ist das 2012 gegründete Mobilitäts-Start-up aus Berlin der erste Anbieter, der den Betrieb ganz einstellt. Mit Allygator in Berlin und myBUS in Duisburg war das Unternehmen an zwei der ersten Shared-Mobility-Angebote in Deutschland beteiligt. Im März 2022 verkauften die Gründer ihr Unternehmen an Swvl, ein Start-up mit Sitz in Dubai. Door2door sollte trotzdem als eigene Marke mit Sitz in Berlin weitergeführt werden, Mitgründer Maxim Nohroudi blieb zunächst in der Firma. Zuletzt war door2door in 22 On-Demand-Projekten involviert, davon 20 in Deutschland. Häufig lieferte es dabei die Dispositions- und Buchungssoftware. Beim hochtechnisierten Ridepooling, das Fahrtwünsche bündelt und in Echtzeit zusammenlegt, sind die Nahverkehrsunternehmen meist auf externe Partner angewiesen. Eines der neuesten Projekte war SyltRIDE in Kooperation mit der Sylter Verkehrsgesellschaft (SVG). Auf der Nordseeinsel waren seit Sommer 2021 drei batterieelektrische SyltGO!-Vans unterwegs, ein Jahr später wurde das Bediengebiet nochmals vergrößert. Die Fahrgastzahlen blieben trotzdem hinter den Erwartungen zurück, was die SVG mit ihrem guten Linienbusangebot in den Sommermonaten begründete. Zum Jahreswechsel 2022/23 lief das Pilotprojekt aus, über eine Vertragsverlängerung war lange verhandelt worden. Andere Verkehrsunternehmen, die Software von door2door verwenden, müssen sich neue Partner suchen, etwa die Stadtwerke Münster für LOOPmünster oder die Duisburger Verkehrsgesellschaft. Münster hat den bereits gefunden, will den anfallenden Aufwand für die Umstellung aber noch nicht benennen. Auf Sylt sollen „neue Lösungen eruiert“ werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Dafür hat die SVG inzwischen neue Batteriebusse bekommen, womit bereits 30 % der Busflotte elektrisch unterwegs sind. Bis 2033 soll die Umstellung abgeschlossen sein.
NEUE ID.3-GENERATION VON VW

Anfang März stellte der Wolfsburger Automobilkonzern eine überarbeitete Version der Kompaktklasse ID.3 vor. Als eines von zehn E-Modellen, die bis zum Jahr 2026 auf den Markt kommen sollen, steht bei der Ankündigung des neuen ID.3 vor allem die Umsetzung des Kundenfeedbacks im Vordergrund. Bedeutet für die Bedienung: Das Lademenü lässt sich unmittelbar auf der ersten Ebene des Fahrerdisplays ansteuern. Gleichzeitig soll ein intelligenter E-Routenplaner den Ladeprozess durch einberechnete Stopps weiter vereinfachen. Berücksichtigt werden dabei Parameter wie der Ladezustand der Batterie, die Verkehrslage und die aktuelle Belegung von Ladesäulen. Zusätzlich kommt das E-Modell im überarbeiteten Design sowie tierfreien und teils recycelten Materialien im Innenraum daher. Für Technikbegeisterte ist der ID.3 außerdem mit einem AR-Head-up-Display erhältlich, das zusätzliche Informationen wie Geschwindigkeiten oder Navigation in die Windschutzscheibe einblendet.

MOBILITY NEWS 13
©
© Volkswagen AG
Stadtwerke Münster
LOOPmünster will ohne Ausfall die Software wechseln.
Der Volkswagen-ID.3 im neuen Look
D-TICKET: BLAUPAUSE DER DIGITALISIERUNG DES ÖPNV
BUS- UND BAHNUNTERNEHMEN IN DER TRANSFORMATION

Deutschland ist im Wandel. Infolge der sich immer stärker verändernden Rahmenbedingungen und neuer Ziele – beispielsweise der ehrgeizigen Klimaschutzziele für den Verkehrssektor – treiben die deutschen Verkehrsunternehmen und -verbünde die technische und organisatorische Transformation voran. Die CovidPandemie wirkte bereits wie ein Beschleuniger dieser Entwicklung. Weitere Treiber sind steigende Stromund Kraftstoffpreise, der Fach- und Arbeitskräftemangel bei gleichzeitigem Wandel der Arbeitswelt, das Ziel der Verminderung von Lärm- und Feinstaubemissionen, die Elektrifizierung des öffentlichen Verkehres auf Schiene und Straße, der Umbau der Städte für eine bessere Lebensqualität und eine höhere Verkehrssicherheit – und nicht zuletzt die Ausbauziele für Bus und Bahn selbst. Manche Faktoren sind zugleich Folge anderer Entwicklungen und wirken ihrerseits dynamisch auf andere Prozesse. Das bekannteste Beispiel dieses Wandels ist die Einführung des Deutschland-Tickets mit all seinen Folgen – und in digitaler Form. Denn eine Lösung für vieles liegt oftmals in der Digitalisierung der Prozesse.
Es ist in der Regel so, dass es bereits digitale Musterlösungen für die verschiedensten Herausforderungen gibt – allerdings regional unterschiedlich, nicht bundesweit einheitlich. Der ÖPNV ist Teil der Daseinsvorsorge und aus gutem Grunde auf Landes- bzw. Landkreisebene organisiert. Diese Struktur hat viele Vorteile – seit Jahren steigen die Fahrgastzahlen – jedoch den Nachteil, dass Innovationen nicht überall in Deutschland an einem Zielstandard orientiert und im Gleichschritt umgesetzt und finanziert werden. Wer also Digitalisierung möchte, braucht zunächst Homogenisierung über bundesweite Mindeststandards. Auf der Habenseite ist, dass der VDV als Branchen- und
TEXT: Martin Schmitz, Geschäftsführer Technik, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)
©
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V.
Fachverband die Standards formuliert und empfiehlt. Auch das Deutschland-Ticket macht es derzeit vor: Der Bund hat die Ausgestaltung im Grundsatz („digital“) vorgegeben und finanziert diese auch anteilig mit den Ländern – diese Lösung kann als Blaupause für andere Bereiche dienen: Die digitale Form für die Kundenseite bedingt digitale Hintergrundsysteme. Wenn also alle Verkehrsunternehmen das Ticket verkaufen können, ob per App oder Chipkarte, dann ist die übliche örtliche Bindung am Fahrkartenautomat oder die regionale App nicht mehr da. Für die Unternehmen birgt dies erhebliche finanzielle Risiken, wenn sie nicht wissen, ob die Tickets auch weiterhin bei ihnen direkt oder bei einer App eines anderen Unternehmens gekauft werden. Für die Einnahmenaufteilung und die Fahrgastzähldaten werden also flächendeckende Daten eines hohen Standards zur Verfügung stehen müssen. Vor der Branche liegt ein Kraftakt, der aber auch starke Synergieeffekte zeitigen könnte.
Beispiel Auslastungsanzeigen und -steuerung von Bus und Bahn: Die Brancheninitiative BRAIN erwartet eine Milliarde zusätzliche Fahrgäste im ÖPNV bis 2030. Es ist aus Sicht der Kundinnen und Kunden, aber auch für die Verkehrsplanung („Reisendenlenkung“) von Vorteil zu wissen, wann die Busse und Bahnen stärker nachgefragt werden – und wann die Fahrzeuge eher leer sind. Für die Fahrgäste bedeutet das Orientierung: Nicht nur die Erwartungshaltung für die Fahrt – aktiver Hinweis via Smartphone – kann an die Wirklichkeit angepasst, sondern der gewählte Wagen am Zug oder auch die Abfahrtszeit flexibel gestaltet werden. Diese Technik sorgt auch im Störungsfall für eine schnellere Kommunikation. Erfolgreiche Pilotprojekte gab und gibt es unter anderem in Hamburg, Berlin, im Rhein-Main-Gebiet. Corona führte zu
einem höheren Abstandsbedürfnis unter den Fahrgästen und so zu einer zusätzlichen Dynamik, der VDV empfahl seinen über 640 Mitgliedsunternehmen eine stärkere Nutzung dieser Systeme. Jedoch: Aufgrund der Dynamik und aufgrund von Förderprogrammen, die unterschiedliche Ansätze voraussetzen, sind viele lokale Lösungen entstanden, die nun technisch wieder zusammengeführt werden müssen. Es entsteht finanzieller Mehraufwand für die Integration unterschiedlicher Lösungen auf einen Standard.
Beispiel Echtzeitdaten: Die Bereitstellung von flächendeckenden Echtzeitinformationen bei Bus und Bahn ist weit vorangeschritten. Darauf aufbauend gibt es vielfältige Projekte, welche diese berücksichtigen: SharingAngebote (zum Beispiel Mobility Inside), Zustandsinformation von Rolltreppen und Aufzügen (zum Beispiel bei der KVB in Köln), dynamische Umsteigeinformationen oder die bereits genannte Fahrzeugauslastung. Aber: Die Darstellung der Information ist oftmals lokal unterschiedlich. Wie sollen mehrere Folgehaltestellen an einer Innenanzeige angezeigt werden – von oben nach unten? Andersherum? Wie soll die Wegelenkung an großen Haltestellen gestaltet werden? Wie komme ich in einer U-Bahn-Station zum richtigen Ausgang? Auch hier gibt es mit Blick auf die digitale Abbildung der Infrastruktur und die Pflege der Daten den finanziellen Faktor. Der VDV erarbeitet technische Empfehlungen für eine Harmonisierung des Datenaustauschs.
Wenn die Verkehrswende gelingen soll, muss der ÖPNV in den Städten im Linienbetrieb noch stärker werden – und bis in den ländlichen Raum hinein – mit kleineren E-Bussen, buchbar per App („on demand“), zur echten Alternative zum Auto werden. Das gesamte bestehende Angebot muss dafür digital verknüpft, flexibler und transparenter werden – um für weitere Kundengruppen attraktiver zu werden. Dafür braucht es bundesweit geltende Standards – und die daran gekoppelte Finanzierung. Wie die Innovationen aussehen, zeigen die Unternehmen bereits vor Ort. Darüber hinaus sind Finanzierungen für einen Flächenrollout ohne Sonderentwicklungen bei den Umsetzungen der digitalen Plattformen notwendig.
MARTIN SCHMITZ
ist seit September 2012 Geschäftsführer Technik des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). Der Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik war zuvor seit 1998 bei der Vossloh Kiepe GmbH in unterschiedlichen führenden Positionen tätig, u.a. von 2008 bis 2011 als Geschäftsfeldleiter für elektrische Antriebe für Straßenfahrzeuge und Marketing oder als Mitglied der Geschäftsleitung.
GRUNDSATZBEITRAG 15
„Wer Digitalisierung möchte, braucht zunächst Homogenisierung über bundesweite Mindeststandards.“
URBANER DATENRAUM
TECHNIK UND ORGANISATION ZUSAMMENDENKEN
Im Gespräch mit Dr. Alanus von Radecki, Geschäftsführer des Daten-Kompetenzzentrums Städte und Regionen (DKSR)
Herr Dr. von Radecki, seit rund zwei Jahren gibt es das DKSR –warum eigentlich?
Die Idee hat sich aus der „Morgenstadt-Initiative“ der Fraunhofer-Gesellschaft entwickelt, die ich mehrere Jahre lang geleitet habe. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk aus Instituten, Kommunen und Unternehmen, um die „City of the Future“ vorauszudenken. In diesem Rahmen haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Entwicklung und Verbreitung innovativer Lösungen in Städten viel zu langsam voranschreitet. Dabei müssen wir bekanntlich dringend die Städte transformieren, um die Energieund Verkehrswende zu schaffen und nötige Klimaanpassungen vorzunehmen. Das ist sozusagen die Kernherausforderung. Es gibt zwar viele gute Ansätze, Pilotprojekte, Reallabore usw. Und es wird durchaus massiv investiert. Aber die Vervielfältigung und Skalierung der Lösungen dauert viel zu lange bzw. sie passiert überhaupt nicht.
Und eine Hürde ist das Thema Daten?
Genau. Ein wesentlicher Grund für die beschriebene Situation ist, dass Datennutzung und -management auf breiter Ebene nicht richtig angegangen werden. Es mangelt einerseits an Grundlagen, wie zum Beispiel Kenntnissen und technologischen Standards, und andererseits an einer adäquaten Organisation, die es der jeweiligen Kommune ermöglicht, auf Daten konkret zuzugreifen und sie mehrwertschöpfend zu nutzen, ohne von Dritten abhängig zu sein. Und genau diese beiden Aspekte haben wir mit DKSR zusammengeführt. Unsere Überzeugung ist, dass es weder ein rein
technisches noch ein rein organisatorisches Problem ist. Vielmehr muss man beides zusammendenken. Unsere Lösung dafür ist eine Open-Source-Datenplattform, die wir Kommunen und kommunalen Unternehmen nach Auftrag zur Verfügung stellen. Wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, unsere Codes unter Verschluss zu halten, und fungieren offen und rein als Dienstleister. Das ist in dieser Form einmalig. Auch die Gesellschafter-Konstellation ist spannend: Vertreten ist die Fraunhofer-Gesellschaft mit ihrer engen Bindung an Bund und Länder sowie die Deutsche Telekom und zwei mittelständische Software-Unternehmen.
Was hat das DKSR bislang erreicht?
Der Markt für Open-Source-Datenplattformen ist noch sehr klein. Aber in diesem überschaubaren Umfeld sind wir Marktführer. Das haben wir in den zwei Jahren unserer bisherigen Existenz geschafft. Wir haben erste Use Cases mit Kommunen entwickelt, deren Code wir veröffentlicht und zur Verfügung gestellt haben: Den Proof of Concept haben wir also erbracht. Stand Anfang 2023 sind es rund 20 kommunale Partner. Derzeit zünden wir die nächste Stufe, arbeiten unter anderem mit Prag, Porto und Budapest an Lösungen. Wir bewegen uns auf europäischer Ebene.
Die Potenziale kommunaler Datenstrategien sind demnach groß. Wie aber können die Städte den Datenschatz heben?
Im Kern bringen wir datenbasierte Technologie in die Städte. Damit diese funktionieren kann, müssen unsere Auftraggeber jedoch anschlussfähig sein. Das heißt, in Vorbereitung müssen oftmals
16 INTERVIEW
Daniel Boss
Kompetenzen aufgebaut werden, um mit Daten umzugehen. Das ist übrigens nicht zwingend ein technisches, sondern auch und insbesondere ein strukturelles, organisatorisches, rechtliches und finanzielles Thema. Hier unterstützen wir beratend in Sachen Datenstrategien. Dazu gehören Antworten auf Fragen wie: Welche Daten habt ihr überhaupt? Auf welche können wir wie zugreifen? Wo liegen diese Daten und wie holen wir sie aus den Silos? Wer ist dafür aktuell zuständig? Welche Systeme müssen miteinander kommunizieren? Es geht um den urbanen Datenraum, den viele Verantwortliche noch nicht auf dem Schirm haben.
Und wann wird’s konkret?
Möglichst schnell. Wir versuchen bereits im zweiten Schritt, Use Cases zu identifizieren, um die Sache einmal in der Praxis durchspielen und zeigen zu können. Wir haben selten den Fall, dass eine Kommune zu uns kommt und sagt: „Wir hätten gerne ,alles mit Sauce’.“ Für die Berliner Stadtreinigung haben wir eine umfangreiche Analyse und nachfolgend den Transfer durchgeführt, das war aber eine Ausnahme. Statt eines großen Komplettpakets bieten wir in der Regel kleine „Entdecker-Pakete“, wie wir sie nennen. Dabei stellen wir eine Plattform mit Dashboard mehrere Monate lang zur Verfügung und machen parallel vielleicht noch eine kleine Inventur der Organisation.
Können Sie einige Beispiel-Cases nennen?
Für die Stadt Mainz haben wir uns mit der Identifikation von Falschparkern an E-Ladesäulen beschäftigt. Wir greifen die Echtzeitdaten der Ladesäulen und von Parksensoren ab, ein Algorithmus kommt zum Einsatz – und die Mitarbeiter:innen des Ordnungsamts können per Smartphone-App informiert werden, wenn etwas nicht korrekt ist. In Köln haben wir eine Basis für bessere Entscheidungen beim Scooter-Sharing gebaut: Disponenten erkennen auf der Karte, wo das Angebot kaum genutzt wird und können entsprechend reagieren. Sie stellen Roller oder auch Leihräder dort hin, wo die Nachfrage größer ist. In Freiburg, um ein drittes Beispiel zu nennen, verstehen wir inzwischen in Echtzeit, wo viele Menschen mit dem Rad unterwegs sind. In diesem Jahr wird es für uns darum gehen, auch die dickeren Bretter zu bohren. Damit meine ich unter anderem die Analyse von Energiedaten ganzer Quartiere oder das Erstellen von Hochwasser-Prognosen.
Flüsse oder Verkehr kennen keine Stadtgrenzen. Wie läuft die interkommunale Zusammenarbeit auf Datenebene?
Meistens ist es für Kommunen schwierig, die eigenen Daten in eine gemeinsame Datenbank zu stecken. Wir schlagen getrennte Plattformen vor, die miteinander kommunizieren dürfen. Weil Städte nicht in derartiger Konkurrenz stehen wie Unternehmen, ist die Bereitschaft, Ergebnisse miteinander zu teilen, erfreulich hoch. Im Rahmen unserer Urban-Data-Community stellen wir die Codes, begleitet durch umsetzungsunterstützende Formate, zur Verfügung. Nehmen wir das Beispiel Freiburg: Jede Stadt könnte die Echtzeiterfassung des Radverkehrs so schnellstmöglich bei sich anwenden.
Wie groß sind die Vorbehalte gegen ein solches Datenmanagement – Stichwort Datensouveränität?
Aus meiner Sicht wird dieser Begriff in Stadtverwaltungen vor allem als Worthülse genutzt. Denn wenn man nachfragt, was das Gegenüber damit genau meint, wird es meist sehr dünn. Dabei lässt sich mit Datensouveränität echter Mehrwert schaffen, indem Daten zugänglich gemacht werden, die sonst nicht nutzbar sind. Wir haben schlicht ein Kompetenz-Gap in diesem Bereich. Letztlich ist es zudem eine Kostenfrage: Technisch ist es nämlich kein Problem, digitale Verträge mit gewünschten Konditionen an Datensätze zu hängen und so die volle Souveränität über die Daten zu behalten. Doch das ist etwas teurer, als auf ein solches Tool zu verzichten. Aufzuzeigen, warum sich diese Investition lohnt: Das gehört ebenso zu unseren Aufgaben.
Zum Schluss noch eine Frage zu einem Buzzword: Wie realistisch ist die Umsetzung des digitalen Zwillings bei Städten?
Wenn man den digitalen Zwilling als originalgetreues digitales Abbild der Wirklichkeit versteht, wird es ihn vermutlich niemals für Städte geben. Kosten und Nutzen stünden nicht in Relation und einige Abläufe können (zum Glück!) voraussichtlich nie ganz algorithmisch simuliert werden. Der realistische Kompromiss ist ein vereinfachtes 3D-Abbild einer Stadt, in das verschiedene Daten integriert werden. Aus unserer Perspektive wird ein solches System dann interessant, wenn man es für Simulationen nutzen kann. Zum Beispiel: Wie verändern sich Emissionen, wenn man bestimmte Eingriffe vornimmt? Hierzu entstehen aktuell spannende Pilotprojekte.
Vielen Dank für das interessante Gespräch.
© DKSR
ist Leiter des Daten-Kompetenzzentrums Städte und Regionen DKSR. Für die Umsetzung nachhaltiger Innovationen in Städten und Gemeinden arbeitet er seit mehr als zwölf Jahren und hat bereits Städte wie Stockholm, Manchester, Prag und München beraten. Zuvor leitete er unter anderem das Team der Fraunhofer Morgenstadt-Initiative.

INTERVIEW 17
DR. ALANUS VON RADECKI
NEXT LEVEL
„EINE HERKULES-AUFGABE FUR ETABLIERTE HERSTELLER“

© Shutterstock
Im Gespräch mit Prof. Stefan Bratzel, Gründer und Direktor des Center of Automotive Management (CAM)
Herr Prof. Bratzel, in der aktuellen Studie „Die Zukunft der Mobilität“ identifiziert das CAM drei große Innovationstrends. Spitzenreiter bei den Hersteller-Innovationen ist dabei „User Interface“ mit einem Plus von 67 % in den vergangenen fünf Jahren. Was bedeutet das konkret für die Fahrerinnen und Fahrer?
Die Zahl der Funktionen im Fahrzeug hat sich enorm vergrößert. Es ist die große Kunst der Automobilhersteller, diese Komplexität im Auto mit entsprechenden Bedien- und Anzeige-Konzepten so zu reduzieren, dass diese Funktionen im wahren Wortsinn handhabbar sind. Zum Beispiel durch Sprachbefehle oder Touchscreens. Die jeweilige Funktion tritt außerdem erst dann in den Vordergrund, wenn sie auch benötigt wird bzw. sinnvoll ist. Ein Beispiel ist die Anzeige von Tempolimits. Diese Fortschritte beim User Interface sind fast schon zwingend erforderlich, soll der Fahrer nicht durch die Vielfalt neuer Funktionen heillos überfordert werden.
An zweiter Stelle der Innovationen nennt die Studie „Connectivity“ – mit einem Plus von 18 %. Was sind hier die größten Meilensteine der jüngeren Zeit?
Zunächst ist es inzwischen weitestgehend gewährleistet, dass die Kommunikation zwischen Kunde und Fahrzeug gut funktioniert. Das ist die Grundlage. Der Kunde kann sein Portfolio von Diensten, die er außerhalb des Fahrzeugs gewohnt ist, zum Beispiel bestimmte Apps zur Unterhaltung, auch innerhalb reibungslos nutzen.
Nun sehen wir einen Trend hin zur Vernetzung des Fahrzeugs mit dem Umfeld. Ich denke da unter anderem an „Coming home“Funktionen: Das Auto kommuniziert sozusagen mit dem smarten Haus. Das Garagentor wird geöffnet und bei Dunkelheit das Licht eingeschaltet etc.
INTERVIEW 19
„Ich rechne damit, dass wir erst Ende der 2020er-Jahre die nächste Dimension des autonomen Fahrens in größerem Stil erleben werden.“
Daniel Boss
Erstaunlich gering angesichts der medialen Präsenz mutet der Zuwachs von sechs Prozent bei den Innovationen im Bereich autonomes Fahren an. Ein Beleg dafür, dass wir von flächendeckenden Lösungen noch viele Jahre entfernt sind?
Die niedrig hängenden Früchte in diesem Bereich wurden in den vergangenen Jahren schon geerntet. Wir reden ja bei Level 2 davon, dass das System Längs- und Querführung in bestimmten Situationen übernimmt. Das ist in den meisten Segmenten schon umgesetzt. Nun steht das Level an, in dem der Fahrer das System nicht mehr dauerhaft überwachen muss. Hier gibt es auch schon die ersten praktischen Umsetzungen. In den USA braucht man nicht mehr ans Lenkrad fassen. Die neueste S-Klasse bzw. der EQS von Mercedes verfügt über einen Staupiloten, ein sogenanntes Level-3-System, bei dem das Auto die Verantwortung für die Fahraufgabe übernimmt. Der Fahrer kann in dieser Zeit zum Beispiel im Internet surfen oder E-Mails schreiben. Mit solchen Lösungen ist zwar schon einiges erreicht. Jetzt bräuchte es meiner Ansicht nach aber weitere Quantensprünge, um die nächsten Level zu realisieren.
Fehlen vor allem technische oder rechtliche Voraussetzungen?
Beides. Denn auch wenn technologisch schon vieles möglich scheint, gibt es noch Hürden zu nehmen. Ich war im vergangenen Sommer in San Francisco und im Silicon Valley. Die Robotaxis
von GM Cruise haben mich beeindruckt. Doch Schwachstellen sind unübersehbar. So versammelten sich an einer Kreuzung acht bis neun dieser autonomen Taxis und kamen nicht weiter. Das Problem musste schließlich von Menschen manuell gelöst werden. Fazit: Ich rechne damit, dass wir erst Ende der 2020er-Jahre die nächste Dimension des autonomen Fahrens in größerem Stil erleben werden.
Silicon Valley ist ein gutes Stichwort: Wie ist es um die Entwicklung hiesiger OEMs und Zulieferer zu Tech-Unternehmen und Mobilitätsdienstleistern bestellt? Klappt die „Transformation durch Software“?
Das geht sehr viel langsamer, als es sich die Automobilhersteller einst gedacht haben. VW mit seiner verspäteten Software-Strategie steht da sicherlich ein stückweit für die Branche insgesamt. Mit den neuen Fahrzeugarchitekturen tun sich die hiesigen Hersteller deutlich schwerer als mit der E-Mobilität. Es sind schlicht ganz andere Kompetenzen, die nun gefordert sind. Die gute Nachricht ist, dass die Komplexität und die hohe Bedeutung der Aufgabe inzwischen erkannt sind. Aber die Umsetzung wird noch eine ganze Weile in Anspruch nehmen. Da liegt im Übrigen der größte Unterschied zwischen Tesla und den etablierten Playern. Tesla hat das Auto auf die Software gesetzt – nicht umgekehrt. Die anderen Hersteller sehen sich einer „Ko-Ko-Ko-Herausforderung“ gegenüber: Das erste „Ko“ steht für neue Kompeten-


20 INTERVIEW
zen, das zweite für neue Kooperationen, die man mit Tech-Spezialisten eingehen muss. Und das dritte „Ko“ meint Kultur und Organisation – sie müssen ein digitales Mindset entwickeln, um künftig erfolgreich zu sein. Alles in allem ist das eine HerkulesAufgabe, keine Frage.
Sie haben vorhin angedeutet, dass die deutschen Hersteller in Sachen E-Mobilität schon recht gut aufgestellt sind. Allerdings kamen von den rund sieben Millionen batterieelektrischer Fahrzeuge im vergangenen Jahr weniger als eine Million von der VolkswagenGruppe, BMW und Mercedes. Wie ordnen Sie das ein?

Es stimmt. Auf diesem Gebiet sind die genannten Hersteller nicht ganz weit vorne. Fairerweise muss man sagen, dass die Zahlen auch dadurch zustande gekommen sind, weil die chinesischen Unternehmen und Tesla besser durch die Chip-Krise gekommen sind. Aber ja, es ist noch viel Luft nach oben.
Ist Tesla überhaupt noch einzufangen? Oder kann man auf längere Sicht nur hinterherfahren?
Ich rechne schon mit bis zu fünf Jahren, bis der Tesla-Vorsprung eingeholt wird und man den Spieß vielleicht sogar umdrehen kann.
Womit können die deutschen Hersteller denn heute schon punkten gegenüber dem Wettbewerb aus den USA und Fernost?
Wir sprechen ja im Wesentlichen von Premium-Herstellern. Die alten Tugenden wie die enorm wichtige Produktqualität beherrschen sie nach wie vor. Und man darf und sollte auch nicht ihre Innovationskraft unterschätzen. In der Breite der Technologien sind die deutschen OEMs gut aufgestellt. Das Neue ist, dass sie massive Konkurrenz bekommen haben. Aber sie werden nicht von der Bühne verschwinden, davon bin ich überzeugt.
Vielen Dank für Ihre interessanten Einschätzungen.
ist Gründer und Direktor des unabhängigen Forschungsinstituts Center of Automotive Management (CAM) an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach. Nach einem Studium der Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin und der anschließenden Promotion wurde Bratzel in und um die Automobilbranche aktiv. Hier durchlief der 1967 geborene Wissenschaftler verschiedene Stationen: als Produktmanager bei der Daimler-Tochter smart, als Programm-Manager bei der Telefonica-Tochter Group3G und als Leiter Business Development Automotive beim mittelständischen Softwareunternehmen PTV. Seit April 2004 arbeitet Stefan Bratzel an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach (bei Köln) als Dozent und Studiengangsleiter für Automotive Management sowie in der Forschung & Beratung als Direktor des ortsansässigen Auto-Instituts CAM. Stefan Bratzel befasst sich in seinen Forschungen mit den Erfolgs- und Überlebensbedingungen von Automobilherstellern und Zulieferern sowie den Zukunftsfragen der Mobilität.

INTERVIEW 21
PROF. DR. RER. POL. STEFAN BRATZEL
© Shutterstock (3)
„In der Breite der Technologien sind die deutschen OEMs gut aufgestellt.“
© Center of Automotive Management
DIE BERECHNUNG DER WELT

WIE QUANTENCOMPUTING EINE NEUE ARA EINLAUTET © Deutsche Bahn AG/Max Lautenschläger
Im Gespräch mit Prof. Sabina Jeschke, CIO Quantagonia
Quantencomputer verlassen das binäre Rechenverfahren der Bits und bilden Quantenzustände (sogenannte Superpositionen) und deren Verschränkungen von Qubits ab, was bedeutet, dass komplexe Berechnungen in Gleichzeitigkeit aller Lösungsvarianten durchgeführt werden können. Diese neue Art zu rechnen wird vielfältige Einsatzgebiete finden, in der medizinischen Forschung, Materialentwicklung und auch im Bereich der Mobilität und Logistik. Worin sehen Sie die prägnantesten Entwicklungskorridore für die Anwendung von Quantencomputing im Bereich Mobilität?
Derzeit müssen wir bei komplexen Systemen, wie der Modellierung von DNA-Faltung, der Modellierung des Weltalls oder einem Klimamodell, sehr viele Vereinfachungen an den Modellen vornehmen, weil wir ansonsten Rechenzeiten erhalten, die in der Größenordnung von 20.000 Jahren liegen würden. Mit Quantencomputern können wir diese Simulationen korrekt rechnen. Anstatt alle möglichen Linearisierungen oder den Wegfall von Effekten zu akzeptieren, bilden wir Systeme in der Komplexität ab, wie sie sich in der Natur darstellen. Digital Twin ist das Schlagwort; und die Ergebnisse der Modellierungen sind direkt verwendbar für die weitere Anwendung.
Zudem werden echtzeitfähige Anpassungen und Optimierungen von Systemen möglich sein …
Genau, dies wäre der zweite Punkt. Schauen wir uns ein System an wie die Deutsche Bahn, mit dem Ziel, einfach einen automatischen Fahrplan zu erstellen – für alle Züge, alle Schienen und alle Bahnhöfe – nur diese drei Teilsysteme, ohne Berücksichtigung der Personaleinsatzplanung oder der Instandhaltung etwa, also sehr vereinfacht. Wenn wir dafür eine optimale Verkehrsplanung machen wollen, dann kommen wir für das deutsche Schienennetz auf Rechenzeiten, die es wohl ermöglichen, den Plan für das nächste Jahr zu erstellen, aber spontane Einflüsse, wie z.B. Störungen, überfordern die Rechnung. Wie muss man das System steuern, um so schnell wie möglich back to plan zu sein? Dazu stehen ungefähr ein bis zwei Minuten zur Verfügung, während die entsprechende Rechenzeit heute irgendwo bei 20, 30 Tagen liegen würde. Deshalb müssen heute solche Entscheidungen von Menschen getroffen werden, die zwar sehr gut ausgebildet sind, aber nur eine lokale Optimierung vornehmen können. Und genau hier könnte man solche Optimierungs- und Simulationsumgebungen nutzen.
INTERVIEW 23
„Perspektivisch werden alle Quantencomputing einsetzen, viele haben das nur noch nicht realisiert.“
Michael Müller
Das schließt auch ein, dass der gesamte Lösungsraum betrachtet wird. Man kann in Echtzeit die Best Solution anstatt der Goodenough-Solution ermitteln.
Genauso ist das. Wenn wir heute ein Optimierungsverfahren laufen lassen, dann wissen wir in der Regel, wie viel Zeit wir haben, um das Ergebnis zu ermitteln oder auch welches Budget wir für die entsprechende Rechnung in einem Rechenzentrum haben. Das führt dazu, dass wir dem Algorithmus eine bestimmte Rechenzeit zur Verfügung stellen. Es könnte sein, dass er in dieser Zeit das globale Optimum findet. Es ist in der Regel aber eine Lösung, die weit weg vom Optimum ist, weil man eben nicht durch den ganzen Lösungsraum durchgehen konnte. Die Konsequenz der Abweichung von Lösung zu Optimum ist „Waste“, also Verschwendung. Es kann den nicht-optimalen Einsatz der Human Resources betreffen. Es kann Waste of Diesel sein, wenn ich nicht die kürzesten Wege finde. Deshalb muss man versuchen, die besten Lösungen zu finden. Algorithmen laufen oftmals nur durch fünf oder zehn oder 20 % des Lösungsraums, wenn überhaupt; hierin steckt also enormes Optimierungspotenzial.
Ist die Fähigkeit zur Echtzeitoptimierung für die Steuerung autonomer Vehikel nicht eine gewisse Grundvoraussetzung, um die Sicherheit und die Funktionalität des Systems zu gewährleisten? Wie wird sich die Entwicklung von Quantencomputing auf den Bereich des autonomen Fahrens auswirken?
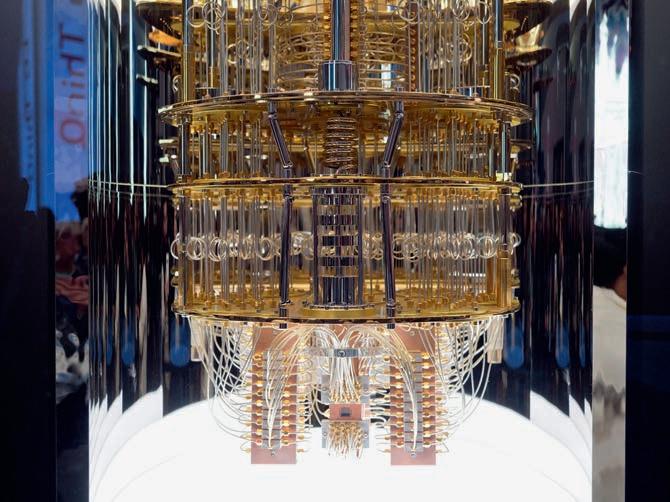
Wir werden in Simulationsumgebungen, in denen echte und auch synthetische Daten einfließen, Testszenarien in einer viel größeren Breite und Geschwindigkeit rechnen können. So können Situationen, Welten, Städte konstruiert werden, um das autonom fahrende Auto mit immer neuen Entscheidungen zu konfrontieren. Damit können wir die Trainingsszenarien in einer unglaublichen Weise erweitern.
In der (subsymbolischen) KI gibt es zwei große Stränge: Die datengetriebenen Verfahren (supervised, unsupervised) und den Bereich des Reinforcement, der wie „Blinde Kuh“ funktioniert. Man tastet sich hierbei an die Lösung heran, was dazu neigt, am Anfang sehr langsam zu sein. Wenn ich so einem komplexen Sys-
tem erlaube, alles auszuprobieren, dann probiert es auch alles aus – und damit auch einen Haufen Unsinn. Daher steigert es sich erst sehr langsam zu einem guten Ergebnis. Deshalb nutzt man Reinforcement-Verfahren heute nur in speziellen Kontexten. Wenn ich aber diese frühe Lernphase vorneweg massiv abkürzen könnte, einfach weil das System viel schneller rechnet, dann gewinnen diese Verfahren enorm an Bedeutung. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn für Reinforcement brauche ich keine Daten. Also fallen auch die ganzen Themen wie Privacy Issues, Verfügbarkeit von Daten und Anonymisierung weg.
Ich nehme an, es wird ein Netz aus Quantenrechnern geben, zu deren Ressourcen ein Cloud-Zugang aufgebaut wird. Wie ist derzeit der Stand und wie kann man mit den künftigen Quantenressourcen rechnen?
Wir werden voraussichtlich eine große Pluralität von verschiedenen klassischen und neuen Quantenrechnern sehen und gehen davon aus, dass bestimmte Quantenrechner für bestimmte Anwendungen besonders gut geeignet sind. Daher werden wir eine dynamische Rechenzentrum-Orchestrierung brauchen: Die einkommenden Tasks werden analysiert und auf die Rechner geleitet, auf denen sie optimal durchgeführt werden können. Dies geschieht entweder in klassischen Rechenzentren, die mit Quantenrechnern aufgerüstet werden, oder über virtuelle Rechenzentren, die mit Lizenzen der Anbieter arbeiten. Mehrheitlich werden die Rechner in Clouds eingebunden sein, weil in den nächsten Jahren das Tieftemperatur-Quantencomputing überwiegen wird; hier müssen die Rechner auf - 273 ° C gekühlt werden. Perspektivisch, gegen Ende des Jahrzehnts werden wir auch Raumtemperatur-Quantencomputing sehen. Wir gehen davon aus, dass die Tieftemperatursysteme ein Zehntel der Energie heutiger HPCs (High Performance Computer) benötigen und dass die RoomTemperature-Systeme bei ein bis fünf Prozent des heutigen Rechnerverbrauchs liegen werden. Damit spielen Quantencomputer auch eine große Rolle für das Thema „Green IT“.
24 INTERVIEW
© Shutterstock
Der Q System One-Quantencomputer von IBM bei der Consumer Electronic Show CES in Las Vegas im Januar 2020
Dabei wird es branchenspezifische Quantenapplikationen und spezielle Algorithmen brauchen. Wie läuft die Entwicklung dieser Codes?
Quantencomputing basiert auf den Prinzipien der Quantenphysik, die Hardware wird völlig andersartig realisiert; und das bedeutet, dass die alten Programmiersprachen nicht funktionieren und die alten Codes nicht mehr laufen werden. Es machen sich nur wenige klar, dass sie nicht ohne Weiteres ihre alte Simulationsumgebung nehmen und diese einfach auf einem Quantenrechner durchführen können. Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, entweder den Greenfield-Ansatz, bei dem man eine komplett neue Anwendung schafft und die veraltete auslaufen lässt. Oder das, womit wir uns in meiner Firma Quantagonia beschäftigen. Wir halten es für einen unnötigen, großen Verlust von Intellectual Property, wenn man alles neu schreiben würde. Das ist auf der Zeit- und Finanzschiene nicht darstellbar, und alte Codes haben auch Vorteile – sie sind nämlich auf Herz und Nieren getestet. Wenn man die Codes neu schreibt, hat man erst einmal alle Bugs dieser Welt. Aus diesem Grund entwickeln wir Lösungen, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz eine Art Translator bilden, der bestehende Codes in Quantum-Codes transformiert. Im Quantencomputer wird anders modelliert. Daher muss man nicht Wort für Wort die Syntax, sondern die Art und Weise der Modellierung austauschen.
Gibt es bereits Pilotprojekte, in denen mit Quantencomputing gearbeitet wird?
Pilotprojekte, etwa bei IBM oder D-Wave, zielen meist auf Optimierungsanwendungen ab, zum Beispiel die Steuerung von Schiffen für die Verteilung von Flüssiggas. Im großen Stil gibt es das insbesondere schon mit Annealern, einer Art Zwischenstufe zu Quantencomputern, weil diese Rechner schon zur Verfügung stehen. Außerdem gibt es natürlich kleinere Use Cases auf den superfluiden Rechnern von IBM usw., bei denen man sich eher mit dem Gesamtsystem vertraut macht und lernt, wie damit umzugehen ist.
Wie können sich Unternehmen mit dieser neuen Technologie vertraut machen?
Verkürzt kann man tatsächlich sagen: Perspektivisch werden alle Quantencomputing einsetzen, viele haben das nur noch nicht realisiert. Wir gehen davon aus, dass 2025 Tieftemperatur-Quantencomputing zur Verfügung steht. Das ist also nicht weit weg, wenn man sich vergegenwärtigt, was für einen großen Change die Technologie darstellt und welche vorbereitenden Tätigkeiten angebracht sind. Ich rate zu einem strategischen Ansatz, der die wichtigsten Fragen beleuchtet: Welche prinzipiellen Use Cases sehe ich in meiner Organisation? Welchen Ökosystemen sollte ich mich anschließen, um mit Partnern offen über Strategien und Change-Prozesse sprechen zu können? Mit welchen Universitäten sollte ich partnern? Habe ich ein Team, mit dem ich dieses Thema konsequent verfolgen kann, sodass ich Personal aufbaue, das zu Quantencomputing sprechfähig ist? Passen meine Governance-Prozesse?
Companies, die eine gute Cloudifizierungs- und Digitalstrategie verfolgen, sind generell besser vorbereitet, denn sie können über die Cloudifizierung schnell auf solche ersten Rechner zugreifen, erste Use Cases rechnen, Proof of Concept machen, sich ins Thema einarbeiten.
Was würden Sie Unternehmen oder Vorständen raten, wie sie sich auf derartige Bewegungen vorbereiten können?
Mit einer sauberen Strategieentwicklung, und zwar jetzt. Man sollte sich die Konkurrenzsituation vergegenwärtigen, die entsteht: Es wird Unternehmen geben, die born-Quantum sein werden. Diese müssen bestimmte Untiefen nie durchlaufen, weil sie von vornherein in die Mitte ein Datensilo gestellt haben und daran ihre Services aufhängen. Wir werden auch sehen, wie Unternehmen beispielsweise Simulationsumgebungen bereitstellen für die Produktion von neuen Komponenten, von neuen Materialien. Und wenn wir jetzt noch dazunehmen, dass durch das ganze Thema Nachhaltigkeit sowieso ein enormer Innovationsbedarf entsteht, wird der Handlungsdruck offensichtlich. Es ist sehr wichtig, Technologiekompetenz im Vorstand aufzubauen, einen Technologie-Scan durchzuführen und die Frage zu stellen, welche Technologien entwickelt werden und sich durchsetzen werden. Als Vorstand selbst dieses Radar offen zu haben, permanent auf neue Entwicklungen zu achten, die Zeitlinie abzuschätzen und sich zu fragen, was das für das Unternehmen und seine potenzielle Konkurrenz bedeutet – das ist die Hauptaufgabe eines Vorstands.
Wunderbar. Ich glaube, damit haben wir diesen Appell gut abgeschlossen. Vielen Dank für das anregende Gespräch.
ist Managerin, Gründerin und Wissenschaftlerin. Seit Januar 2023 verstärkt sie Arthur D. Little als Senior Executive Advisor in der Technologieberatung. Nach über drei Jahren als Vorständin „Digitalisierung und Technik“ bei der Deutschen Bahn AG und einer zwölfjährigen Karriere als Universitätsprofessorin (Berlin, Stuttgart, Aachen) gründete sie im Dezember 2021 das Start-up Quantagonia GmbH. Seit Oktober 2021 ist sie Vorstandsvorsitzende des Startup-Accelerators KI Park e.V. in Berlin. Parallel dazu gründete sie im April 2021 das Start-up Arctic Brains AB in Jämtland/Schweden mit Schwerpunkt auf KI-Beratung und -Entwicklung. Sabina Jeschke ist eine erfahrene Aufsichtsrätin, zuletzt nahm sie im Herbst 2021 das Mandat für Vitesco (Carve-out von Continental) an. Sie hält eine Honorarprofessur der TU Berlin und ist Mitglied des CxO-Councils der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sabina Jeschke studierte Physik, Informatik und Mathematik, promovierte an der TU Berlin und war für Forschungsaufenthalte am AMES Research Center der NASA in Kalifornien und am Georgia Tech in Atlanta.
INTERVIEW 25
PROF. DR. SABINA JESCHKE
DEN SCHWARM IM BLICK
ECHTZEITDATEN FUR VERKEHRSMANAGEMENT
UND VERKEHRSPLANUNG

© TomTom
Im Gespräch mit Ralf-Peter Schäfer, VP Product Management bei TomTom
Herr Schäfer, die Erfassung und Verarbeitung digitaler Daten gilt als einer der Schlüssel für das Gelingen der Verkehrswende. Wo stehen wir diesbezüglich?
Wir sind diesbezüglich schon sehr weit. Unser Unternehmen etwa kann bis zu 30 % des Echtzeitverkehrs in rund 80 Ländern beobachten. Das liegt an der hohen Skalierbarkeit der Daten und natürlich an der hohen und stetig wachsenden Zahl der rollenden Datenquellen. Dazu tragen Partnerschaften mit Unternehmen aus den Bereichen Smartphone-Apps und Kartenanwendungen, Flottenmanagement-Lösungen und Festeinbauten für Pkw und Lkw bei. Ich habe mal mit 200 Taxen in Berlin angefangen. Inzwischen sind wir bei 600 Mio. Fahrzeugen weltweit.
Wie generieren Sie diese Daten?
Das von uns schon vor vielen Jahren ausgerollte System basiert auf sogenannten Floating-Car-Daten, die im Wesentlichen aus der Navigation und dem Flottenmanagement stammen. Als Marktführer in der Verkehrsinformation ist TomTom in vielen Einbaugeräten zu finden, so bei allen großen deutschen, aber auch anderen europäischen und asiatischen Herstellern. Und aus dieser riesigen Community schicken die Nutzer:innen auch Infos an uns zurück. Wir erhalten so anonymisierte Parameter, wie etwa Geschwindigkeit, Standort etc.
Wo liegt der Hauptnutzen für die Verkehrswende?
Entscheidend für die Verkehrswende ist vor allem, dass sich seit einigen Jahren auch der öffentliche Bereich erkennbar in Richtung Digitalisierung bewegt – damit meine ich vor allem die Bereiche Verkehrsplanung und -management. Im Vergleich zur Industrie ist es zwar noch ein recht schleichender Prozess, aber es geht doch erkennbar voran. Jahrzehntelang hatten die Verkehrsmanagement-Behörden auf die Nutzung von Straßeninfrastruktur gesetzt, um den Verkehrsfluss zu messen, wobei die Daten im Wesentlichen nur auf Autobahnen und großen Hauptstraßen verfügbar waren.
Was genau meinen Sie mit der Infrastruktur?
Ich meine damit die konventionelle Verkehrsmess-Infrastruktur, bestehend aus einer Vielzahl an Kameras, Induktionsschleifen, Infrarotsensoren etc. Darauf ist man heute zunehmend weniger angewiesen, um den Verkehrsfluss zu messen. Eine solche Infrastruktur ist teuer in Aufbau und Unterhalt, außerdem liefert sie längst nicht alle relevanten Antworten. Vor diesem Hintergrund erkennen immer mehr Verkehrsplanungs- und -managementbehörden, dass es ein kollaboratives Modell braucht, und kaufen die entsprechenden Daten bei uns oder beim Wettbewerb ein und verknüpfen diese mit vorhandenen Daten.
INTERVIEW 27
„Einfach neue Infrastruktur zu bauen, ist der falsche Ansatz, weil mit mehr Infrastruktur auch die Nachfrage erhöht wird.“
Daniel Boss
Ohne Angst vor dem gläsernen Autofahrer bzw. Autofahrerin?
Wir von TomTom verkaufen keine personalisierten Messdaten, sondern ausschließlich Ableitungen wie zum Beispiel die Geschwindigkeit. Es geht um kollektive Informationen, nicht um die Daten Einzelner. Wir haben nicht den Fisch im Blick, sondern immer den Schwarm. Das Ziel ist, dass die Community profitiert, zum Beispiel durch weniger Staus.
Welche Behörden nutzen denn schon solche Daten?
Eine der ersten war beispielsweise die Verkehrszentrale Berlin. Die startete das Projekt schon vor mehr als zehn Jahren. In Deutschland nutzen unter anderem auch Düsseldorf und Frankfurt am Main über Partner wie GEVAS und PTV die Verkehrsdaten von TomTom für das Verkehrsmanagement und die Verkehrsplanung. Auch die erst neu gegründete Autobahn GmbH hat das so entschieden: Der Trend zur Nutzung von fahrzeugbasierten Verkehrsdaten ist klar sichtbar. Und das ist nicht überraschend, denn die Vorteile liegen auf der Hand.
Welche sind das denn – neben der von Ihnen genannten Kostenersparnis?
Die so generierten Daten liefern viel bessere Informationen, auf deren Grundlage man viel besser Entscheidungen treffen kann. Wo drückt der Stau in der Stadt XY? Wo habe ich den nervigsten Stau am Morgen? Wie sollte ich meine Maßnahmen planen, um den besten Effekt zu erzielen? Jahrzehntelang basierte die Bundesverkehrswegeplanung auf Induktionsschleifen und Simulationen. Heute verfügen wir über flächendeckende Verkehrsdaten in Echtzeit.
Simulationen sind also überflüssig?
Wenn es um den jeweils aktuellen Status quo geht, ja. Denn die Daten zeigen ja an, wo es gerade läuft im System und wo es hakt. Auch Rückblenden sind damit kein Problem. Simulationen haben jedoch weiterhin ihre Berechtigung, wenn es um Vorhersagen oder konkrete Lösungen geht, um Zukunftsszenarien zu berechnen, z.B. um Baumaßnahmen zur Lösung von Verkehrsproblemen zu bewerten.
Wer jeden Morgen in einer beliebigen Großstadt im Stau steht, wünscht sich vermutlich eine Extra-Spur …
Aber genau das sollte aus Sicht der Verantwortlichen nicht die Lösung sein. Staus entstehen dann, wenn die Kapazität kleiner ist als die Nachfrage. Das lässt sich zu jeder Rushhour oder – auf der Autobahn – während der Ferien erkennen. Einfach neue Infrastruktur zu bauen, ist der falsche Ansatz, weil mit mehr Infrastruktur auch die Nachfrage erhöht wird. Stattdessen muss man sich Gedanken machen, welchen Modal Split man in seiner Stadt haben möchte. Das ist ein politischer Planungsaspekt. Er hat etwas mit der Verlagerung von der Straße auf andere Verkehrsträger zu tun. Und dabei können wir mit unseren Daten auch helfen:
Wir machen verständlich, wo die größte Verkehrsnachfrage besteht und wo die „Bottlenecks“ liegen. Dafür müssen Sie keinen Rentner mehr an die Kreuzung setzen, der die Autos zählt.
Wir haben bislang nur von Autos als Datenquellen gesprochen. Was ist mit den anderen Verkehrsträgern?
Auch E-Bikes, Scooter etc. werden verstärkt Daten liefern. Wir sehen da gerade eine hochspannende Entwicklung. Insbesondere beim Rad ist das Wachstum phänomenal. In Kopenhagen gibt es schon Projekte zur Verhinderung von Staus – und damit meine ich Fahrrad-Staus …
TomTom und Ampel-Spezialist Swarco kooperieren, um die „My City“-Plattform mit Verkehrsdaten zu versorgen. Was hat es damit auf sich?
Dabei werden Daten zur Verkehrsbeobachtung und Steuerung in Städten genutzt. Die fahrzeugbasierten Verkehrsdaten von TomTom ergänzen dabei die vorhandenen Infrastrukturmessungen vor den Kreuzungen mit wertvollen Zusatzinformationen.
Was passiert, wenn das Straßennetz schlicht und einfach überlastet ist?
Dann lässt sich zumindest noch eine Transparenz schaffen, indem der Stau in Navigationssystemen angezeigt und die voraussichtliche Verzögerung kalkuliert wird. Für den anderen Fall, also wenn es noch Kapazitäten im Netz gibt, können bestimmte Straßen priorisiert werden oder bessere Ausweichrouten-Empfehlungen über die Navigation erfolgen.
28 INTERVIEW
„Wir machen verständlich, wo die größte Verkehrsnachfrage besteht und wo die ,Bottlenecks‘ liegen. Dafür müssen Sie keinen Rentner mehr an die Kreuzung setzen, der die Autos zählt.“
Eine weitere Kooperation wurde Anfang des Jahres verkündet. TomTom gründet zusammen mit Amazon Web Services (AWS), Meta und Microsoft die Overture Maps Foundation unter der Leitung der Linux Foundation mit dem Ziel der Entwicklung interoperabler offener Kartendaten. Worum geht es hierbei konkret?
Die Kartierung der physischen Welt für immer mehr Anwendungsfälle ist eine äußerst komplexe Herausforderung, die keine Organisation allein bewältigen kann. Die Branche muss sich zusammenschließen, um diese Aufgabe zum gegenseitigen Nutzen aller zu bewältigen.
Das Ziel der Overture Maps Foundation ist es, eine qualitativ hochwertige, offene Kartendatenbank aufzubauen, die MappingAnwendungen für eine Vielzahl von Branchen unterstützt.
Konkret geht es darum, ein universelles, offenes Karten-Framework bereitzustellen, das auf einem globalen Standard basiert. Es soll allen Beteiligten den einfachen Datenaustausch ermöglichen und ein Ökosystem etablieren, um Kartendaten auf effiziente Weise gemeinsam zu nutzen.
Dafür definiert die Overture Maps Foundation zum Beispiel ein gemeinsames, gut strukturiertes und dokumentiertes Datenschema und treibt dessen Einführung und Verbreitung aktiv voran. Außerdem wird die Interoperabilität vereinfacht, indem ein System bereitgestellt wird, das Entitäten aus verschiedenen Datensätzen mit denselben realen Entitäten verknüpft. Um auch professionelle Anwendungen unterstützen zu können, wurde ein ausgeklügelter und umfangreicher Validierungsprozess installiert, um Kartenfehler, Brüche und mutwillige Falschmeldungen zu erkennen und sicherzustellen, dass Kartendaten möglichst frei von Fehlern sind.
Die Mission der Overture Maps Foundation entspricht voll und ganz unserer Vision bei TomTom, dass die Welt ein offenes und kollaboratives Ökosystem braucht, um aktuelle, genaue und verlässliche Karten auf globaler Ebene zu erstellen. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass die Overture Maps Foundation kollektiv an einer gemeinsamen Basiskarte bzw. Datenbank mit Kartendaten arbeitet – es ist nicht das Ziel, ein fertiges Kartenprodukt zu liefern. Vielmehr soll Entwickler:innen die bestmögliche Basis geboten werden, um anschließend darauf aufbauend eigene branchen- und fallspezifische Lösungen aufbauen zu können, etwa zur Suche oder Routenplanung, für die Navigation, zur Darstellung von Verkehrsinformationen oder für das digitale Cockpit für Automobilhersteller.
Der besondere Charme des Modells der Overture Maps Foundation besteht darin, dass sie Unternehmen, NGOs, Forscher:innen, Regierungen und anderen Organisationen offensteht und mit jedem neuen Mitglied und Beitragenden sich die Qualität der Datenbank weiter verbessern wird, da sich die Quellenlage ausweitet – und so die Basiskarte automatisch für weitere Anwender:innen und Beiträger:innen interessant wird. TomTom spricht in diesem Zusammenhang von einem Schwungrad, das mit jedem neuen Mitglied an Fahrt gewinnt.

Wie lautet Ihre Prognose: Brauchen wir irgendwann überhaupt noch Ampeln, Schilderbrücken etc.?
Beim flächendeckend autonomen Fahren wäre diese Infrastruktur eigentlich überflüssig: Jedes Fahrzeug wäre mit jedem verbunden, alles wäre synchronisiert. Aber das ist natürlich sehr weit nach vorne geguckt.
Gestatten Sie noch eine letzte Science-Fiction-Frage: Würde die Herausnahme des menschlichen Faktors beim Autofahren, also Drängeln, Spielen mit dem Gas etc., nicht einen besonders großen Klimaschutzeffekt nach sich ziehen?
Wenn wir alle in autonom fahrenden Fahrzeugen unterwegs wären, würde das zutreffen. Dann könnten zum Beispiel an einer Ampelkreuzung viel mehr Fahrzeuge die Grünphase nutzen. Die große Herausforderung dürfte in der Übergangszeit liegen, im Mischbetrieb also. Denn die schon jetzt eingesetzten Abstandstempomaten halten die gesetzlichen Vorgaben strikt ein. Menschen agieren oft etwas forscher, lassen also weniger Lücken im Straßenverkehr. Ein Mehr an solcher Abstandstechnik dürfte also zunächst zu mehr Staus führen.
Vielen Dank für das interessante Gespräch.
ist seit 2021 für das globale Produkt-Portfolio im Bereich Verkehrs- und Reiseinformationssysteme sowie für das Routing bei TomTom verantwortlich. Seit Beginn seiner Tätigkeit bei TomTom im Jahr 2006 war der studierte Elektrotechniker im Unternehmen in verschiedenen Führungspositionen im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Navigations- und Verkehrsprodukten auf Basis von GPS-Daten tätig. Schäfer und sein Team entwickelten u.a. das weltweit etablierte Verkehrsinformationssystem für die Navigationssoftware von TomTom sowie Navigationslösungen von Drittanbietern im Bereich der Einbau-Navigationslösungen in Pkw und Lkw, im Flottenmanagement und in Smartphone-Applikationen. Ralf-Peter Schäfer arbeitete in verschiedenen Forschungseinrichtungen wie der Deutschen Akademie der Wissenschaften, dem Deutschen Zentrum für Informatik und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), bevor er zu TomTom kam.
INTERVIEW 29
RALF-PETER SCHÄFER
© TomTom
VON GROSS ZU
KLEIN UND VON ZENTRAL ZU DEZENTRAL
VIRTUELLE KRAFTWERKE ALS BAUSTEIN IN DER ENERGIEWENDE

30 POLIS MOBILITY
© Shutterstock
„Die Energieversorgung in Deutschland verändert sich gerade massiv – weg von zentralen Großkraftwerken hin zu kleinteiligeren verteilten Erzeugungsstrukturen. Stromerzeugung, -speicherung und -verbrauch werden zunehmend dezentral auf Ebene von Wohn- bzw. Gewerbequartieren bis hin zu einzelnen Gebäudeeinheiten gesteuert. Dadurch werden auch einstige Branchengrenzen zwischen Energiewirtschaft, Bau- und Immobilienbranche sowie Stadtentwicklung neu definiert“, sagt Prof. Verena Rath von der Hochschule Biberach. Dort koordiniert die Expertin für Marketing, Energie und Mobilität den BWL-Studiengang, der die Studierenden auf die Herausforderungen künftiger klimaneutraler Energiesysteme sowie Stadt- und Quartiersentwicklung vorbereiten soll.
Die Energiezukunft ist dezentral, digital und erneuerbar. Große konventionelle Kraftwerke (Gas, Kohle, Atom) gehen vom Netz, während zeitgleich die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Eine der wesentlichen Herausforderungen dabei ist es, die bisher hauptsächlich von Großkraftwerken übernommene Netzstabilisierung weiterhin zu gewährleisten. Denn trotz der zunehmenden Anteile von volatilen Energieträgern wie Wind und Sonne und neuen Verbrauchern muss das Netz ausgeglichen sein – und zwar auf allen Netzebenen. Es steigt also der Bedarf an Flexibilität, sowohl auf Erzeuger- wie Verbraucherseite.
„Der Ariadne-Szenarienreport schätzt den Flexibilitätsbedarf zur Deckung von Erzeugungslücken auf ca. 100 bis 120 TWh jährlich im Jahr 2045 – das ist zehnmal der Stromverbrauch von Hamburg heute oder so viel, wie Deutschland in zwei Monaten in 2022 verbraucht hat“, sagt Daniel Zahn. Der Ingenieur arbeitet beim Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (Fraunhofer IEE) als Produktverantwortlicher des virtuellen Kombikraftwerkssystems EnergyConnect. Mit Flexibilitäten meint er Technologien, die Energie sowohl ganz kurzfristig über einige Stunden, aber auch wochenlang aufnehmen, speichern und abgeben können: mit Biomasse betriebene Blockheizkraftwerke, Pumpspeicher, Stromspeicher oder Power-toX-Anlagen, die Strom in Wärme, Wasserstoff oder synthetische
Kraftstoffe umwandeln. Wenn gleichzeitig auch der Verbrauch flexibler wird, macht das den Ausgleich noch einfacher. „Für die klimaneutrale Stromversorgung von morgen brauchen wir Anbieter, die kleine, flexible Verbraucher wie Elektroautos, Wärmepumpen oder Batteriespeicher bündeln und damit die wertvolle Flexibilität dieser Assets zugänglich machen“, meint Prof. Katrin Schaber. Die Kollegin von Prof. Verena Rath forscht in Biberach zur Sektorkopplung und der Integration erneuerbarer Energien.

Eben diese Bündelung können virtuelle Kraftwerke, auch Schwarm- oder Kombikraftwerke genannt, leisten. Sie fassen kleine und kleinste Erzeuger und Speicher zusammen, um damit zunehmend die Großkraftwerke zu ersetzen. Über diese Schwarmkraftwerke können die kleineren dezentralen Anlagen im Verbund auf den verschiedenen Energiemarktplätzen wie der Strombörse agieren. Sie können aber auch den Netzbetreibern Dienstleistungen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit anbieten. Ein solcher netzdienlicher Service ist die sogenannte Regelreserve, mit der kurzfristige Abweichungen von Erzeugung und Verbrauch (etwa aufgrund von Kraftwerksausfällen oder Prognoseabweichungen) ausgeglichen werden. Dieser Markt ist für kleine Erzeuger und Verbraucher ohne vorherige Bündelung über virtuelle Kraftwerke nicht zugänglich. Da sich Prognosefehler bei Tausenden zusammengeführten Anlagen leichter von selbst ausgleichen, macht es außerdem wetterabhängige Erzeuger wie Wind- und Solarparks leichter vorhersehbar. Das virtuelle Kraftwerk ist die Technologie dafür – eine digitale Plattform zur Vernetzung unterschiedlichster Energieanlagen mit modernster Software- und Kommunikationstechnologie.
Die Regelreserve ist nur eine Maßnahme, um die Netze zu stabilisieren. Weitere sogenannte Systemdienstleistungen sind u.a. das Engpassmanagement, also das Abschalten bestimmter Komponenten bei einer Überlastung einzelner Stromnetzabschnitte, oder die Fähigkeit, ein zusammengebrochenes Netz wieder aufzubauen (Schwarzstartfähigkeit). Beide Dienstleistungen könnten kleinere Energieanlagen durch virtuelle Kraftwerkstechnologie in Zukunft anbieten, meint Daniel Zahn. Tara Esterl und Regina
POLIS MOBILITY 31
© Next Kraftwerke
Ein Virtuelles-Kraftwerk-Leitsystem
Hemm, Forscherinnen am Center for Energy des Austrian Institute of Technology (AIT), schreiben virtuellen Kraftwerken für die Zukunft eine Schlüsselrolle zu: „Auf lange Sicht ist unsere Vision, dass virtuelle Kraftwerke die meisten Funktionalitäten von herkömmlichen Kraftwerken besitzen und damit einen starken Beitrag zu einem nachhaltigen Energiesystem leisten.“
Schwarmkraftwerke für das Lastmanagement
Wer eine PV-Anlage auf dem Dach hat, kennt das Problem: Bei sinkenden Einspeisepreisen ist es am besten, den Strom einfach selbst zu verbrauchen, denn günstiger als zugekaufte Energie ist selbstproduzierter Strom immer. Im Detail ist das aber nicht so einfach. Die Waschmaschine nur anmachen, wenn die Sonne scheint, ist kein großes Problem, aber nur bei Sonne fernzusehen oder zu kochen, schränkt doch ein. Was im kleinen Maßstab vielleicht noch mit Nachdenken und über Verhaltensänderung funktioniert, wird auf kommunaler oder regionaler Ebene noch komplexer.

Im sogenannten Lastmanagement sieht Tara Esterl jetzt schon eines der großen Potenziale virtueller Kraftwerke: „Bisher gänzlich unbeobachtete Verbraucher wie Wärmepumpen, Boiler, Elektroautos, Batteriespeicher, oder andere Komponenten, beispielsweise der Industrie, beobachtbar zu machen, und das Verhalten dieser Komponenten im Falle des virtuellen Kraftwerkes sogar beeinflussen zu können, bietet enorme Vorteile. Durch die Lastverschiebung ist beispielsweise eine sehr gezielte Nutzung der Erneuerbaren zum Zeitpunkt der Erzeugung möglich, der restliche systemübergreifende Speicherbedarf lässt sich dadurch reduzieren. Außerdem können hohe Gleichzeitigkeitsfaktoren von Erzeugungs- oder Verbrauchskomponenten besser reguliert und damit auch der Netzausbaubedarf verringert werden.“
Das virtuelle Kraftwerkssystem EnergyConnect des Fraunhofer IEE bündelt ein Anlagenportfolio von über 4 GW installierter Leistung, es wurde seit 2010 in zahlreichen Forschungsprojekten und im langjährigen operativen Einsatz bei Wirtschaftspartnern zu einer robusten, sicheren und skalierfähigen Lösung mit moderner Web-Oberfläche weiterentwickelt.
Netzintegration der E-Mobilität: Bidirektionales Laden noch in den Kinderschuhen Was bedeutet es für den Energiemarkt, wenn Fahrzeugflotten zunehmend elektrisch betrieben werden? Nicht nur steigt damit der Stromverbrauch, sondern auch die Flexibilität – wenn die Potenziale klug kombiniert werden. Auf die Frage, wie die Speicher- und Ladeleistung von Elektrofahrzeugen denn abgerufen und gesteuert werden könne, antwortet Daniel Zahn: „Je mehr Ladepunkte ich zusammenfasse, desto zuverlässiger und vorhersehbarer wird das Laden.“ Zusammen mit historischen Daten und künstlicher Intelligenz werde sich so in Zukunft das Speicherpotenzial der Fahrzeuge in virtuellen Kraftwerken vermarkten lassen. So sieht es auch Prof. Katrin Schaber. „Die Regelleistung muss immer bereit sein. In der Konsequenz wurden die Pilotversuche immer nur mit stehenden Autos (oder Batterien aus selbigen) durchgeführt. Hier muss sich die Regulatorik noch weiterentwickeln, damit auch ein statistisch sicher vorhandener Teil der Fahrzeugflotte an der Regelleistung teilnehmen kann.“
Daniel Zahn ergänzt: „Das bidirektionale Laden ist eine große Chance, steckt aber noch in den Kinderschuhen.“
32 POLIS MOBILITY
© Fraunhofer IEE
Der Weg dahin ist aber absehbar. „Im kurzfristigen Stromhandel können schon heute gerade gewerblich betriebene Fuhrparks erhebliche Kostenvorteile erzielen, wenn immer zu günstigen Preisen geladen wird“, sagt Prof. Katrin Schaber. Dafür gibt es schon heute Anbieter, die sozusagen Sub-Schwarmkraftwerke betreiben und die Ladepunkte über einen lokalen Controller zusammenschalten und steuerbar machen. Die Software übernimmt quasi die „Übersetzung“ zu den verschiedenen Schnittstellen der Ladepunkte. Am Spotmarkt kann der Verbund gemeinsam teilnehmen und wird gemeinsam abgerechnet. Perspektivisch könnte daraus ein Element werden, das dann wieder in einem größeren Kombikraftwerk eingebunden werden kann. Für private Haushalte könnte in den nächsten Jahren Ähnliches möglich werden. Derzeit übernehmen die Versorger bisweilen eine ähnliche Rolle: „Mehr und mehr Stromversorger bieten auch Tarife an, in denen z.B. die Batterieflexibilität innerhalb des Stromtarifs vermarktet wird. Wer ein E-Auto hat, definiert dann ein Zeitfenster, in dem das Fahrzeug geladen werden soll und überlässt die preisoptimale Steuerung dem Stromversorger“, erklärt Prof. Katrin Schaber.
Wo liegt das virtuelle Kraftwerk denn wirklich?
Viele, meist unabhängige Aggregatoren sind mit ihren Schwarmkraftwerken bereits am Strommarkt aktiv. Die Preise an den Spotund Regelreservemärkten werden zunehmend grenzüberschreitend und europäisch gebildet. Hier ist es also in der Regel unerheblich, wo genau sich die Anlage befindet, die in ein virtuelles Kraftwerk eingehen soll. „Möchte man potenzielle Engpässe im Übertragungsnetz beseitigen, welche durch eine geografische Ungleichverteilung von Erzeugung und Verbrauch und zu geringen Übertragungskapazitäten verursacht werden, spielt die örtliche Verteilung der einzelnen Anlagen im Gebot hingegen eine essenzielle Rolle“, erklärt Regina Hemm vom AIT Center for Energy
Schon bald werden aber auch die unteren Netzebenen mehr in den Fokus rücken, meinen die Expert:innen übereinstimmend. „Wir werden immer mehr E-Fahrzeuge und Wärmepumpen haben, da muss es auch auf den unteren Netzebenen eine sinnvolle Koordinierung von Erzeugung und Verbrauch geben“, sagt Daniel Zahn. Kombikraftwerke könnten hier Kleinstanlagen bündeln und über regionale Flexibilitätsplattformen das Netz entlasten. Doch nicht nur dabei spielt es dann doch eine Rolle, wo sich die Energieanlagen des Schwarmkraftwerks wirklich befinden: „Möchte der Verteilnetzbetreiber das virtuelle Kraftwerk für den verteilnetzdienlichen Betrieb nutzen, ist die genaue Verortung der Teilkomponenten im Netz von höchster Relevanz“, erklärt Tara Esterl. „Für diesen Anwendungsfall gibt es allerdings derzeit keine einheitliche Vorgehensweise.“ Die AIT-Expertinnen sehen hier große Chancen, sich jetzt einen Marktvorteil zu erarbeiten. Die Rahmenbedingungen im Energiemarkt könnten sich schon bald ändern.
Wo gibt es Handlungsbedarf?
Apropos Rahmenbedingungen. Daniel Zahn sieht gleich an mehreren Stellen Verbesserungsbedarf: Zum Ersten würden derzeit sowohl die Strompreiszone als auch die Netzentgeltregulatorik für den regionalen Einsatz von Flexibilitäten im Energiesystem kontraproduktiv wirken. Variable und smarte Tarife für Haushalte könnten erst ihre volle Wirkung entfalten, wenn es regionale Märkte und Preise gäbe. Lokal Angebot und Nachfrage
aufeinander abzustimmen – dort, wo der Strom verbraucht und zunehmend auch produziert wird – könnte die Häufigkeit von Engpässen im Netz senken. Was heißt das für den Einsatz von virtuellen Kraftwerken? „Zur Vermeidung von Netzengpässen gibt es derzeit noch sehr viele offene Forschungsfragen, wie die Wahl der Aggregationsebene oder welche Informationen von welchen Stakeholdern benötigt werden“, erklärt Regina Hemm.
Eine weitere Herausforderung sieht Daniel Zahn derzeit darin, dass große Kombikraftwerkslösungen nur dann wirklich skalieren, wenn sich die Anlagen per Plug & Play anbinden lassen. „Dies ist derzeit am leichtesten für die Hersteller von Energieanlagen, wie z.B. Sonnen für Batteriespeicher. Wir brauchen deswegen neben der Standardisierung neue Ansätze wie Energiedatenräume zum vertrauenswürdigen Datenaustausch sowie digitale Identitäten zur sicheren Authentifizierung.“ So könnte der Aufwand sinken, Anlagen verschiedener Hersteller und Anbieter zusammenzufassen. Bislang sei die Diversität am Markt ein großer Entwicklungsaufwand für die Anbieter von Schwarmkraftwerkssystemen. „Damit ein virtuelles Kraftwerk beispielsweise auch von einer Bürgerenergiegemeinschaft einfach betrieben werden kann, muss es noch zu einigen Vereinfachungen kommen“, meinen auch Tara Esterl und Regina Hemm.
Größere bürgerschaftliche Energie-Initiativen haben sich trotzdem bereits auf diesen Weg gemacht. Die aus der Anti-Atomkraft-Bewegung gewachsenen genossenschaftlichen Elektrizitätswerke Schönau (EWS) kooperieren bereits seit zwei Jahren mit dem Direktvermarkter ane.energy. Anfänglich integrierte der Vermarkter 50 MW der von EWS installierten Leistung in sein eigenes virtuelles Kraftwerk, das Leistung direkt für Großkunden bereitstellte (Power Purchase Agreement). Inzwischen haben die EWS selber die Kontrolle über das Schwarmkraftwerk, ane.energy stellt in der Partnerschaft nunmehr die Software bereit. So macht die Technologie auch kleinere Player handlungsfähiger – echte Energiewende von unten.
POLIS MOBILITY 33
FLEXIBILITAT FUR DAS STROMSYSTEM
VIRTUELLES KRAFTWERK FUR
ERNEUERBARE ENERGIEN
Herr Kreutzkamp, Ihr Claim lautet „Das virtuelle Kraftwerk für eine neue Energiewelt“. Wie sieht diese neue Energiewelt aus der Perspektive von Next Kraftwerke aus?
Wir sind überzeugt, dass eine sichere Stromversorgung möglich ist, die aus 100 % erneuerbaren Energien besteht. Next Kraftwerke betreibt bereits seit 14 Jahren ein virtuelles Kraftwerk, das mittlerweile ein riesiges Team dezentraler Erneuerbare-EnergienAnlagen koordiniert und steuert. Damit beweisen wir tagtäglich, dass ein digitales, dezentrales und grünes Energiesystem funktioniert. Und wir verfolgen weiter diesen Weg: Wir vergrößern unseren Pool an Stromerzeugern, -verbrauchern und -speichern und sorgen für ein intelligentes Zusammenspiel dieser Anlagen. Auf diese Weise schaffen wir es, die erzeugte und verbrauchte Energie unserer Kunden profitabel an den Märkten zu handeln und an der Stabilität des Stromsystems mitzuwirken.
Wie unterscheidet sich Ihr Unternehmen von anderen Akteuren in der Energiebranche bzw. Betreibern virtueller Kraftwerke?
Next Kraftwerke schöpft aus einem großen Erfahrungsschatz bei der Aggregierung, Steuerung und Vermarktung von EE-Anlagen. Wir zählten zu den Ersten, die Regelenergie aus vernetzten Anlagen an einen Übertragungsnetzbetreiber geliefert haben. Wir haben frühzeitig die Chancen erneuerbarer Energien auch für den Regelenergiemarkt erkannt und Pionierarbeit geleistet. Wir sind darin spezialisiert, Flexibilität für das Stromsystem bereitzustellen.
Welche Technologien werden zur Realisierung Ihres virtuellen Kraftwerks eingesetzt und wie werden diese miteinander vernetzt?
Die wichtigsten Kernelemente des virtuellen Kraftwerks sind das zentrale Leitsystem und die Fernsteuereinheit Next Box. Über eine bidirektionale, abgesicherte Mobilfunkverbindung verbindet die Next Box die dezentralen Anlagen mit unserem Leitsystem. Über die Next Box werden die Anlagen gesteuert und auch Daten ausgetauscht. So erhält das Leitsystem unter anderem Informationen über die Auslastung der vernetzen Anlagen und ihre Einspeiseleistung.
Wie nutzen Sie innovative Technologien, z.B. künstliche Intelligenz, in Ihrem Unternehmen?
Bei der Solarprognose nutzen wir beispielweise Machine Learning. PV zählt zu den volatilen Stomproduzenten, der Stromanteil kann je nach Wetterlage stark variieren. Bei der PV-Prognose verarbeiten wir Wetterdaten, Anlagenfahrpläne, Verbrauchs- und Einspeisedaten, um eine präzise Vorhersage über die Stromeinspeisung treffen zu können. Beim Machine Learning lernt der Computer, Muster in Daten zu erkennen und Entwicklungen vorherzusagen. Die Muster helfen dabei, Abweichungen zu erkennen und Prognosen anzupassen. Je näher wir mit unseren Prognosen an der Realität und je kurzfristiger wir in der Lage sind, richtige Schlüsse aus den Daten zu ziehen, desto besser können wir die Preise abschätzen und marktgerechte Gebote liefern.
34 INTERVIEW
Im Gespräch mit Paul Kreutzkamp, CEO Next Kraftwerke Benelux
Csilla Letay
Welche Rolle spielen Big Data in Ihrem Geschäftsfeld?
Das möchte ich mit einem einfachen Blick auf zwei Zahlen in Deutschland illustrieren: Im Jahr 1990 gab es in Deutschland etwa 800 Erzeugungsanlagen, das heißt größere Kraftwerke, durch deren Steuerung das Stromsystem sicher betrieben wurde. In 2022 waren es allein im Bereich Photovoltaik 2,6 Mio. Anlagen, und die Sicherheit des Stromsystems basiert auf dem komplexen Zusammenspiel dieser und vieler anderer Anlagen. Denn mit dem Zubau an EE-Anlagen ist die Gesamtzahl stark angestiegen. In unserem virtuellen Kraftwerk werden etliche Millionen von Datenpunkten verarbeitet. So werden beispielsweise die Livedaten von Anlagen sekündlich abgerufen. Ohne eine schnelle Generierung, Auswertung und Übertragung dieser und anderer Daten wäre unser Geschäft gar nicht möglich. Eine intelligente, aussagefähige und zuverlässige Verknüpfung von Daten ist für die Steuerung der Anlagen, für unser Handelsgeschäft – sei es am Regelenergiemarkt oder dem Spotmarkt – enorm wichtig.
Sie haben in der Vergangenheit als Kooperationspartner gemeinsam mit TransnetBW, Jedlix und Netze BW in einem Feldtest das Potenzial von Elektrofahrzeugen für die Bereitstellung von Regelreserve analysiert. Vor Kurzem haben Honda und Next Kraftwerke eine E-Auto-Flotte für Primärregelleistung in Amprions Netzgebiet präqualifiziert. Welche Erkenntnisse und Aussagen hat Ihnen dieses Pilotprojekt für die weitere Netzintegration von Elektrofahrzeugen mittels V2G-Technologie geliefert?
Die Projekte – auch das Projekt mit Honda – haben wir durchweg erfolgreich abgeschlossen. Sie haben gezeigt, dass es technisch möglich ist, aus einer Fahrzeugflotte Primär- sowie Sekundärregelleistung bereitzustellen und damit zur Stabilität des Stromnetzes beizutragen. Das heißt, die Technologie funktioniert: Jedes einzelne Fahrzeug der Honda-E-Auto-Flotte konnte den Ladeund Entladebefehl umsetzen. Dabei wurden auch die individuellen Ladezustandspräferenzen der E-Fahrer berücksichtigt.
Das bidirektionale Laden ist ja durchaus noch in den Kinderschuhen … Was ist aus Ihrer Sicht auf regulatorischer, marktwirtschaftlicher und technologischer Seite noch notwendig, damit es nicht bei Pilotprojekten im Bereich der Netzstabilisierung durch Elektrovehikel bleibt?
So gesehen ist auch das smarte unidirektionale Laden noch in den Kinderschuhen. Ein Auto, das basierend auf Strompreissignalen lädt, ist die absolute Ausnahme. Im Augenblick heißt es: Stecker rein und laden, egal, ob der Strom gerade knapp ist.
Es muss zunächst die Möglichkeit geschaffen werden, dass an den Ladepunkten, die oft in Privathaushalten liegen, viertelstündliche abrechenbare Messdaten verfügbar sind – Stichwort Smart Meter. Auch die Netznutzungsentgelte müssen angefasst werden. Der Strom, der bezogen und zurückgespeist wird, darf nicht durch Steuern, Abgaben und Umlagen belastet werden – insbesondere, wenn dies zur Netzstabilisierung passiert. Außerdem ist die Verfügbarkeit bidirektionaler Wallboxen aktuell noch eingeschränkt und es mangelt an Fahrzeugen, die in der Lage sind, bidirektionales Laden überhaupt umzusetzen. Um ein wirtschaftliches Geschäftsmodell aufsetzen zu können, wird eine gewisse Anzahl an Fahrzeugen benötigt. Ich würde mir auch wünschen,
dass wir Möglichkeiten schaffen, dass Flexibilitätsdienstleister wie Next Kraftwerke flexible Assets wie E-Autos, aber auch zum Beispiel Wärmepumpen, mit Submetern aus dem Stromlieferantenvertrag herauslösen können, sodass deren Flexibilität unabhängig vermarktet werden kann. Dann könnte die Flexibilität sogar unabhängig von Wallbox oder Ladesäule quasi überall genutzt werden, und alles ließe sich über das Auto selber steuern.
Welche Rolle/Potenzial schreiben Sie der Netzintegration von Elektromobilität langfristig zu?
Ganz einfach: Haben wir viel Wind und Sonne, so lädt die Batterie. Liefern PV- oder Windkraftanlagen weniger Strom – z.B. aufgrund von Wetterbedingungen – speisen E-Fahrzeuge wieder ins Stromnetz zurück. Wären heute alle Autos Elektroautos, dann hätten wir einen dezentralen Stromspeicher von etwa 2.000 bis 3.000 GWh. Und Pkws sind mehr als 95 % der Zeit geparkt. Selbst in der Rushhour stehen mehr als 80 % der Autos am Straßenrand. Sie stünden daher prinzipiell – natürlich mit Einschränkungen – als Stromspeicher zur Verfügung.
Allerdings können Elektroautos keine saisonalen Schwankungen der erneuerbaren Energien ausgleichen. Dafür brauchen wir andere Speicher und Flexibilitäten. Auch wird der zusätzliche Strombezug von Elektroautos Kosten im Stromnetz verursachen. Aber: Als Kurzfrist-Stromspeicher werden Elektroautos eine wichtige Rolle spielen. Und mit zunehmender Elektrifizierung aller Lebensbereiche wird die Bedeutung von virtuellen Kraftwerken weiter zunehmen.
Vielen Dank für das interessante Gespräch.
PAUL KREUTZKAMP
ist CEO von Next Kraftwerke Benelux. 2014 gründete er die Niederlassung Next Kraftwerke Belgium zusammen mit Jan de Decker. Er ist spezialisiert auf die Netz- und Marktintegration von erneuerbaren Energien und anderen dezentralen Erzeugungsanlagen. Bis 2014 war er Senior Renewable Energy Expert bei 3E und beriet öffentliche und private Kunden unter anderem im Bereich erneuerbarer Energie. Davor leitete er bei der Deutschen Energieagentur in Berlin das Team „Windenergie und Netzintegration erneuerbarer Energien". Paul Kreutzkamp ist Diplom-Physiker.

INTERVIEW 35
© Next Kraftwerke
PARKRAUM DIGITAL
TICKET-MUFFEL ERFASSEN UND GEFAHRENSTELLEN ENTSCHARFEN

© BA-Mitte
Daniel Boss
Frau Dr. Neumann, in Ihrem Bezirk Berlin-Mitte sind seit rund einem Jahr sogenannte Scan-Fahrzeuge im Rahmen eines Modellversuchs unterwegs. Was genau hat es damit auf sich?
Es geht bei unserem Scan-Car-Projekt im Kern um eine moderne Form der Parkraumbewirtschaftung. Die Bezirke Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg haben aufgrund ihrer zentralen Lage in Berlin eine besonders hohe Parkraumdichte. Daher sind wir besonders an digitalen Lösungen für die Zukunft interessiert. Das Ganze funktioniert natürlich nicht ohne die Einbeziehung des Landes Berlin. Also haben wir gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz eine neue Geschäftsstelle zur Vorbereitung einer digitalisierten Parkraumbewirtschaftung eingerichtet. Diese ist dabei, alle relevanten Prozesse zu bündeln und zu steuern.
Läuft denn die digitale Parkraumbewirtschaftung, also das Erfassen von parkenden Autos ohne Ticket, schon jetzt – wenn auch nur im Modellversuch?
Nein, das wäre noch gar nicht möglich. Zwar fahren die Scan-Cars schon seit Monaten auf den Straßen, sie erfassen aber lediglich den vorhandenen Parkraum: Wie viele öffentliche Stellplätze haben wir in Mitte ganz genau? Natürlich lagen der Verwaltung dazu auch schon vorher offizielle Informationen vor, doch nun erfolgt eine exakte Kartierung. Und nicht nur das: Die Wagen machen auch die Auslastung transparent, indem sie alle Parkplätze mehrfach passieren. Auf diese Weise lässt sich unter anderem feststellen, wann wo besonders viel geparkt wird und welche Flächen kaum genutzt werden. Die Auswertung dazu soll im Sommer erfolgen.
Warum wäre eine digitale Parkraumbewirtschaftung mittels Scan-Cars noch nicht möglich?
Es gibt verschiedene Herausforderungen. Da wäre zunächst die technische Komponente zu nennen. Es gibt noch kein „Berliner Tool“ dafür. Allerdings stehen wir mit verschiedenen Anbietern in Kontakt, die solche Lösungen bereits im europäischen Ausland praktizieren. Beispiele sind Städte in Frankreich, Polen oder den Niederlanden. Ein erster Testlauf im vergangenen Jahr in Grunewald verlief auch sehr vielversprechend. Es ging um Fragen wie: Lassen sich die Kennzeichen auch dann noch ablesen, wenn die Autos schief oder eng beieinander geparkt sind? Eine weitere Komponente ist die juristische: Eine digitale Parkraumbewirtschaftung, wie wir sie anstreben, ist aktuell nicht erlaubt.
Woran hakt es denn rechtlich?
Es müsste die StVO geändert werden. Sie sieht zwar in ihrer derzeitigen Fassung schon digitale Bewirtschaftung vor – sonst wäre ja keine Ticketbuchung per Handy möglich. Aber lediglich als Zusatz, nicht als alleiniges Mittel. Ich bin jedoch guter Dinge,
dass die erforderlichen Änderungen zeitnah erfolgen, schließlich sind sie Bestandteil des Koalitionsvertrags auf Bundesebene. Damit wäre ein weiterer kleiner Baustein für die Digitalisierung in Deutschland umgesetzt. Außerdem müssen wir das Thema Datenschutz beachten. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung erlaubt die digitale Parkraumbewirtschaftung, aber das Bundesverfassungsgericht hat eigene Maßstäbe für Deutschland gesetzt. Hierfür bedarf es einer eigenständigen Rechtsgrundlage. Denn in der Tat werden ja Kfz-Kennzeichen erkannt und mit Datenbanken abgeglichen. Doch es geht nicht um die Erstellung von Bewegungsprofilen oder Ähnliches. Hier verschränkt sich das Technische mit dem Rechtlichen: Wir sind angehalten, die „datenärmste“ Variante zu wählen. Die Daten dürfen also nur zum bestimmten Zweck genutzt werden, sind im Anschluss sofort zu löschen etc. Wir gehen davon aus, dass die Gesetzgebungskompetenz hierfür beim Land liegt. Sobald die rechtlichen Grundlagen vorhanden wären, würden wir die nächsten Schritte vollziehen. Die Vorbereitungen innerhalb der Scan-Car-Geschäftsstelle dazu laufen ja auch schon, wie vorhin erwähnt.
Welche Möglichkeit bietet die digitale Bewirtschaftung, neben einer effektiven „Knöllchen“-Vergabe, noch?
In einem weiteren Schritt könnte auch verkehrswidriges Parken geahndet werden. Diese Zusatzmöglichkeit wäre mittelfristig sehr erfreulich. Beim Geo-Fencing via GPS-Ortung von E-Scootern, die angewendet wird, um das rücksichtslose Abstellen der Roller in den Griff zu bekommen, sieht man, dass es leider noch erhebliche räumliche Abweichungen gibt. Beim Einsatz von Scan-Cars bei Falschparkern wäre das meines Erachtens jedoch anders. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass wir noch einige Zeit benötigen werden, um verkehrswidriges Parken tatsächlich digital zu ahnden. Anzustreben ist das aus Gründen der Verkehrssicherheit aber auf jeden Fall.
Vielen Dank für den interessanten Einblick.
DR. ALMUT NEUMANN
studierte Rechtswissenschaften in Freiburg i.Br., Paris und London. Der „Licence en droit“, dem Juristischen Staatsexamen und dem Master of Laws (LSE) folgte das juristische Referendariat am Kammergericht Berlin sowie die verfassungsgeschichtliche Promotion an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ab 2018 war Neumann als Richterin in Berlin tätig, zuletzt als Richterin am Verwaltungsgericht Berlin. Seit 2021 ist sie in Berlin-Mitte Bezirksstadträtin für den öffentlichen Raum (Bündnis 90/Die Grünen) und damit zuständig für Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen.
INTERVIEW 37
Im Gespräch mit Dr. Almut Neumann, Bezirksstadträtin in Berlin-Mitte
Wenn die Autos weg sind, kommen auch Kinder wieder zum Spielen: Visualisierung aus dem „Manifest der freien Straße“.

FLY LIKE PAPER, GET HIGH LIKE PLANES
DIE FREIHEIT BEGINNT JENSEITS DES AUTOS
38 BLACKBOX
Der Verein paper planes e.V. zeigt, wie visionäre Ideen auf dem Skizzenblock der Berliner Mobilitätsplanung Realität werden können. Mit radikaler Kreativität erprobt das junge Team neue Nutzungskonzepte im Stadtraum – und macht ganz nebenbei die Straße wieder zum Mittelpunkt des öffentlichen Lebens.
dermittelbedarf gerecht zu werden, wird kurzerhand paper planes e.V. gegründet: ein gemeinnütziger Verein, eine Denkfabrik mit dem Anspruch, städtischen Raum neu zu denken und dabei den gestalterischen Prozess auch möglichst vielen zugänglich zu machen. „Uns interessiert die gesamte Wertschöpfungskette der Stadtentwicklung“, sagt Simon Wöhr, Kulturarbeiter bei paper planes. Gehe es zu Beginn darum, mit Visionen eine Stimmung zu erzeugen und Menschen zu begeistern, sind auch die Umsetzung und die Kooperation mit Stadtverwaltung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft elementarer Bestandteil der Arbeit.
Die Hauptstadt wird grün

Die alltäglichsten Situationen können bekanntlich große Einfälle hervorbringen. An einem regnerischen Tag im Jahr 2014 fährt Martti Mela mit dem Fahrrad durch Berlin-Kreuzberg; verärgert darüber, klitschnass zu werden. Beim Blick auf den unbenutzten Raum unter dem Viadukt der Linie U1 kommt dem finnischen Unternehmer die Idee eines Radweges unterhalb der Trasse. Während wohl schon viele Berliner:innen dasselbe dachten, wird der Gedanke diesmal manifestiert. Aus befreundeten Stadtplaner:innen, Architekt:innen und Kulturarbeitenden formt sich das Initiativprojekt „Radbahn“; und so nimmt das Konzept eines überdachten autofreien Korridors für Radfahrende Gestalt an. Ein Jahr später geht die erste Social-Media-Kampagne innerhalb kürzester Zeit viral. Um dem steigenden Arbeitspensum und För-
Ein Anspruch, der sich im Falle der „morgenfarm berlin“ etwas schwieriger gestaltet: Das entsprechend benannte Nachnutzungskonzept für den nicht vollendeten 16. Bauabschnitt der Autobahn 100 sieht Vertical Farming, Gastronomie sowie ein Netz von Rad- und Spazierwegen vor – eine Machbarkeitsstudie steht allerdings noch aus. Der Bundesverkehrswegeplan sieht weiterhin vor, den in den 1930er-Jahren entworfenen inneren Autobahnring durch Berlin fertigzustellen. Angesichts der politisch stark postulierten Verkehrswende und der Herausforderungen der Klimakrise sei dies völlig rückwärtsgewandt, findet Simon Wöhr. Für paper planes ist die „morgenfarm berlin“ zunächst ein Denkanstoß, wie auch auf kreative Weise mit einem derart problematischen Bau umgegangen werden könne.
Bereits „gelandete“ paper planes des Vereins sind sogenannte Pop-up-Wald-Modulare sowie die „forsTerasse“ in der Forsterstraße in Berlin. Die Ersteren dienten während der Corona-Pandemie in Form mobiler Stadtmöbel mit integrierten Pflanzenkübeln als städtische Oasen; die „forsTerasse“ wiederum bietet im Sommer vor dem Büro von paper planes e.V. Möglichkeiten des nachbarschaftlichen Austauschs.
BLACKBOX 39
© paper planes e.V.
Kreuzberger Innovationen
Bis zum ersten Umsetzungsschritt der „Radbahn“ ist es nicht mehr weit – wurde im vergangenen Sommer der Spatenstich angesetzt, so geht im Spätsommer 2023 die erste Teststrecke in Betrieb. Damit wird auch das Ende eines mehrjährigen Prozesses eingeläutet: Nach der Gründung von paper planes im Jahr 2016 riefen deren Gründer:innen zwei Jahre später den Wettbewerb „Radbahn + Innovators“ aus. Mit einem für Smart-City-Projekte zuständigen Vertreter der Senatsverwaltung in der Jury wurde der Innovationscharakter klar formuliert: die „Radbahn“ als Reallabor. Neben dem Siegerentwurf der Architekt:innen von Fabulism fließen auch Ideen anderer Beiträge in die Gestaltung der „Radbahn“ mit ein.
Kristin Karig, Architektin bei paper planes, betont, dass auch andere Branchen und Perspektiven miteinbezogen werden müssen: „Wenn nur Designer zusammensitzen, verlieren sie das Bild fürs Ganze.“ Wie holistisches Denken und digitale Innovationen zusammenfinden, soll das Reallabor irgendwann auf einer ca.
500 m langen Strecke zwischen Kottbusser Tor und Görlitzer Bahnhof zeigen. In Kooperation mit der Technischen Universität Berlin wird ein Kommunikationssystem für Ampelphasen implementiert. Radfahrer:innen können dann über dynamische rot-grüne Balken in Form von Lichtinstallationen einschätzen, ob es sich lohnt, zu bremsen oder in die Pedale zu treten. Matthias Heskamp zufolge, Architekt bei paper planes, führe das zu Belohnungseffekten durch grüne Ampeln und reduzierter Wartezeit bei Rotphasen, was auch Konfliktpotenzial von Verkehrsteilnehmenden reduziere. Dass entlang der Strecke Verdunstungsbeete und Grünanlagen auf ehemaligen Parkplätzen entstehen und deren Pflastersteine zum Bau von Interaktionsräumen verwendet werden, unterstreicht den ganzheitlichen Ansatz der Denkfabrik.
„Straßen befreien“
Mit dem „Manifest der freien Straße“ setzten die Berliner:innen zum Wurf Richtung Zukunft an. Von der Stiftung Mercator unterstützt schloss sich paper planes mit dem Wissenschaftszentrum Berlin und der TU Berlin im Herbst 2020 zu einem Konsortium


40 BLACKBOX
© paper planes e.V. (4)
Der Siegerentwurf „VibRad“ des Architekturbüros Fabulism
So könnte der Radverkehr unter dem Viadukt der Linie U1 aussehen.
zusammen, um die Konzeptphase des Manifests wissenschaftlich begleiten zu lassen. Sieben Thesen – darunter zur Mobilität, Wirtschaft und zum Klima – formulieren eine Vision, wie die Straße künftig anders genutzt werden könnte. Dabei essenziell: das Potenzial des öffentlichen Raumes als urbanes Gemeingut. Während Straßen über Jahrtausende Orte alltäglichen Lebens gewesen seien, wo gewirtschaftet, gehandelt und gespielt wurde, so führe die Besetzung der Straße durch das Auto zum Verlust sozialer Interaktion – und damit auch zu sozialem Unverständnis und gesellschaftlichen Entfremdungen. Aktuelle Trends wie künstliche Intelligenz könnten dabei helfen, autofreie Straßen wieder Wirklichkeit werden zu lassen: etwa durch eine intelligente Auslastung von Sharing-Angeboten oder der Bedarfssteuerung in der Logistik. Über den technischen Lösungen stünden aber immer die Bilder neuer und alternativer Nutzungen, die in den Köpfen der Menschen erzeugt werden sollen.

Wenn der Song „Paper Planes“ der britischen Rapperin M.I.A. die Hymne für die Freiheit der Immigration ist, dann liefert der Berliner Verein das visuelle Pendant für die Straße.

BLACKBOX 41
Statt Autos: Tomaten aus Neukölln. Das Vertical Farming der „morgenfarm berlin“ soll es möglich machen.
Kreuzberger Kreativität: Das Team von paper planes vor seinem Büro in der Forsterstraße, Berlin-Kreuzberg.
„KERNFORSCHUNG“ IM METAVERSE

KUNST UND TECHNOLOGIE ZUSAMMENGEDACHT
Was haben transparente Pixel, gedankenlesende Pferde und der Buchstabe π gemeinsam? Sie werden nicht nur mit dem gleichen Laut ausgesprochen, sondern lassen sich alle in der litauischen „Künstlerrepublik Užupis“ verorten. Eine gedankliche Reise mit deren Münchner Botschafter Max Haarich führt tief ins Metaverse und hinterlässt Pinselstriche auf der „Blackbox künstliche Intelligenz“.
Hätte man anstelle des Automobils in Pferde investiert, dann könnten diese vielleicht heute fliegen – NFT-Kunst von Max Haarich.
Als Max Haarich 2014 zum ersten Mal in die „Republik Užupis“ reiste, hätte er nicht im Traum gedacht, dass er drei Jahre später einmal deren deutsche „Botschaft“ in München gründen würde. Der Stadtteil Užupis, am Rande der Altstadt von Vilnius gelegen, ist seit den 1990er-Jahren Treffpunkt litauischer Künstler:innen und Intellektueller. Diese riefen am 1. April 1998 die „freie Republik Užupis“ aus. Erster Präsident war und ist Roman Lileikes – der Legende nach wachte dieser eines Morgens auf und fühlte sich plötzlich als Präsident. Užupis ist im Selbstverständnis eine künstlerisch-zivilgesellschaftliche, unpolitische Bewegung. Deren Verfassung nahm der Münchner in seine Heimatstadt mit; Verfassungsartikel wie „Du hast das Recht, keine Rechte zu haben“ erschienen ihm zunächst paradox.

Heute sieht Max Haarich die Verfassung sogar als besonders effektiv an, weil sie eben nicht in die Exekutive überführbar ist: Handlungen mit negativen Folgen ließen sich somit nicht im Namen der Verfassung rechtfertigen; der Mensch ist für sich selbst verantwortlich. Ein Spirit, aus dem sich auch eine klare Ethik im Umgang mit Mensch, Tier und Umwelt ableitet, mit der Maxime, aufeinander achtzugeben, anstatt blind dem Gesetz zu folgen. Und ein Spirit, der Max Haarich seit dem Besuch nicht mehr loslässt: Nach dem Studium der Kommunikationswissenschaften an der RTWH Aachen und einer Tätigkeit im Innovation-Startup-Center „UnternehmerTUM“ fokussierte er die künstlerische
Reflexion technologischer Entwicklungen und ihrer gesellschaftlichen Folgen. Mit der Botschaftervergabe von Užupis eröffnete sich die Möglichkeit, Kunst und Technologie in eine Symbiose zu bringen und parallel auch immer gesellschaftliche Synapsen zu bilden: Die Münchner Botschaft der Künstlerrepublik ist Max Haarich zufolge „der letzte dreckige Meter des Forschungstransfers vom Elfenbeinturm zur Straße, einen Meter davor stehen wir und fangen die Leute ab“.
Ein Pferd, das Gedanken liest
Ob nun in Kooperation mit der Republik oder in Eigenregie: Die Projekte des Künstlers simulieren auf innovative Weise gesellschaftliche Implikationen des technologischen Wandels. So entstand kürzlich der erste Prototyp eines gedankenlesenden Pferdes: Smart Hans, angelehnt an den „klugen Hans“, ein um die Jahrhundertwende lebendes Pferd, das angeblich Gedanken lesen konnte, indem es die jeweilige Zahl erriet, an die Menschen dachten. Im Falle von Smart Hans leistet eine Künstliche Intelligenz dieses Hexenwerk. Bestand beim klugen Hans die Blackbox darin, dass unklar war, aufgrund welcher Informationen das Tier die Zahlen ermitteln konnte, so illustriert Smart Hans die Unmöglichkeit zu bestimmen, was genau ein künstliches neuronales Netz eigentlich lernt und auf welchen Daten die Entscheidungen fußen. Gleichzeitig werden so Bedenken bezüglich des Missbrauchs künstlicher Intelligenz sichtbar.
BLACKBOX 43
©
(2)
Max Haarich
Kaufen lässt sich das Stück Münchner Realität zwar nicht, dafür aber als NFT ausleihen.
Doch es wäre nicht die Münchner Botschaft, würden diese Gedanken nicht im Sinne von Užupis auch weitergedacht. Angeführt vom Buchstaben π ließ Max Haarich einen Münchner Artikel in der Verfassung der Künstlerrepublik verankern: „Any artificial intelligence has the right to believe in a good will of humanity.“
Schwerkraft im Metaverse?
Sein neuestes Projekt, eine Plakatinstallation von fünf mal fünf Metern am Lenbachplatz in München, trug den Titel „Good-Buy, Reality!“ und bot einen Teil der Münchner Realität zum Verkauf als Non-Fungible-Token (NFT) an. Das NFT auf dem Plakat fügte sich jedoch nur innerhalb eines ganz bestimmten Blickwinkels in die analoge Umgebung ein. Eine künstlich geschaffene Realität, die in der Abhängigkeit von der analogen Realität ihren eigenen Verkauf in Gefahr bringt – die Kunstaktion führte vor Augen, wie angesichts der um sich greifenden Kommerzialisierung durch NFTs die persönliche Einflussnahme dennoch unterschätzt wird. Mit „Good-Buy, Reality!“ löste sich die gewohnte Trennung von analoger und virtueller Realität weiter auf.
Bis Szenarien wie im Film „Matrix“ Wirklichkeit werden, ist es allerdings noch weit hin: Für Max Haarich ist das Metaverse bisher pures Entertainment und technisch recht unspektakulär. Die gegenwärtige Entwicklung sei vor allem von Unternehmen geprägt, die im Web 3.0 einen neuen Absatzmarkt für NFTs sähen. Denn „bisher wird vor allem nur die physische Realität etwas bunter nachgebaut“, wie der Künstler bemerkt. Deutlich wird dies am Beispiel physikalischer Gesetze, die mit ins Metaverse transferiert werden – doch wer sagt, dass Gebäude und Straßen der Schwerkraft ausgesetzt sein müssen? Denn am Metaverse fasziniert Max Haarich vor allem die dahinterliegende Idee des Lucid Dreaming: „Eine Welt, die du ad hoc nach deinen Wünschen steuern und erfahren kannst, der Wachtraum – das ist die Idee, die wir jetzt mit Technologie, mit Codes umsetzen wollen.“
Potenziale ergäben sich in der neuen virtuellen Interaktivität auch für Stadt- und Mobilitätsplanung: Planer:innen könnten etwa Modelle und Konzepte völlig neu im Hinblick auf ihre Auswirkungen testen, indem diese im Metaverse simuliert werden.
Was nach dem Pixel kommt …
Damit das Web 3.0 allerdings nicht zum Juggernaut der TechGiganten wird, sei „Dezentralität der Kern von allem“. Gerade Kryptowährungen, die über die dezentralisierte Blockchain laufen, zeigten das Potenzial, wie schon jetzt abseits von verstaubten Institutionen neue demokratische Prozesse in Bewegung kämen. Im Spirit Užupis‘ gedacht lassen sich hier auch völlig neue Ansätze beispielsweise im Kampf gegen die Klimakrise schöpfen. Da liegt die Metapher von Užupis als „analoges Metaverse“ nahe; eine Doppelbelichtung der Realität.
Und es wird noch philosophischer: Mit dem Projekt eines einzelnen transparenten Pixels betreibt Max Haarich „Kernforschung“ im Metaverse: Der Künstler spielte einen einzelnen transparenten Pixel auf einen Röhrenfernseher, filmte den Bildschirm mit einer Videokamera und nahm davon wiederum ein Standbild auf. Das Ergebnis sieht einem Sonnenaufgang ähnlich. Zugleich zeigt es, dass ein Pixel an sich nicht darstellbar ist und die Technologie für Verzerrung sorgt. Es wirft aber auch Fragen über die Substanz und Materie des Metaverse auf: die Pixel. Während unsere Realität unendlich komplex ist, so landet man im Metaverse bei genauem Zoomen irgendwann vor einem einzelnen Pixel – Fragen, mit denen sich Max Haarich auch in Zukunft weiter beschäftigen will. Denn die Reise ins Metaverse hat gerade erst begonnen.
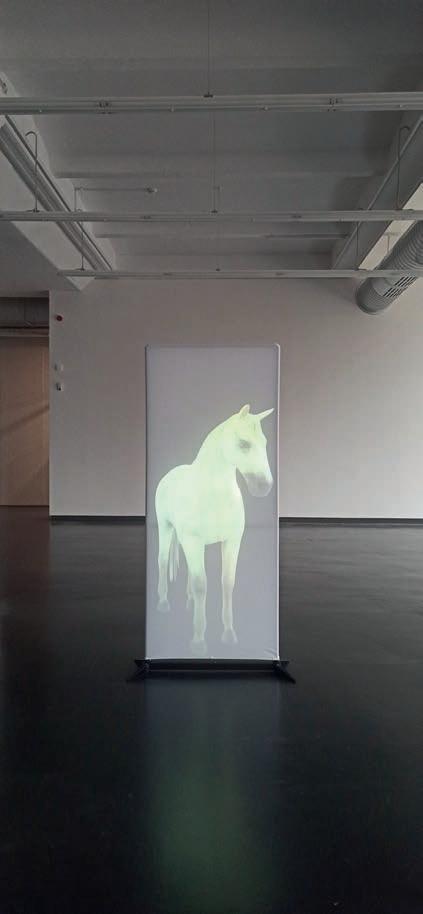

44 BLACKBOX
(4)
©Max Haarich
Mit dem Scharren seiner Hufe errät der smarte Hans die Zahl, an welche die vor der Installation stehende Person gerade denkt.
Kunst oder Technologie? Beides! Aus einem transparenten Pixel wird ein virtueller Sonnenaufgang.
Die

am Münchner Lenbachplatz funktionierte nur aus der richtigen Perspektive.

Investition in etwas an sich Bedeutungsloses. Klassische Ökonomie oder philosophische Beschäftigung?

BLACKBOX 45
© Eolo Perfido Studio
Max Haarich
NFT-Installation
URBAN HABITATS
CREATING SPACES FOR PEOPLE
 © Sandra Henningsson/Gehl Architects
© Sandra Henningsson/Gehl Architects
Talking to Prof. em. Jan Gehl, architect, urban design expert & founder of Gehl Architects
As a world-renowned architect and expert in urban design and public spaces, can you share what motivated you to become an architect?
That's a great question, because becoming an architect was actually a coincidence for me. I started school in 1954, which was during the postwar generation. There was a lot of growth in society. I was in a boys' school, and all twenty people in my class went straight into university, and five years later they were finished. They were very dedicated, no questions asked, just doing. I was going to become an engineer, but then, at the last moment, some university students from various professions came to speak to us. There was an architect, and I thought, "gee, this sounds more fun than engineering, I will go for that." Then I went to the School of Architecture. There were no architects in my family, and no arts either. I had never heard the word "architect" before, it was first introduced to me in the school of architecture. I rushed through and was finished at the age of 23. Then, I went out to do all this modernism, and then I got married. It was in the 60s, I finished in 1960 and married in '61. That was the time when there was
a very big expansion in the cities. The agricultural areas were mechanized, and there was a lot of left-over agricultural workers who were going to the city where all the industries were blooming and needed workers. There was a fantastic migration to the cities, and there was an enormous housing shortage. They had enormous programs of mass-producing Plattenbau.
Just like in the 19th century with the first industrial revolution.
Gründerzeit, yes. After the war, the 60s were a period of growth, expansion, good economy, high Konjunktur, and a lot of things were happening. In the middle of all this, and that's a beautiful story, I was very interested in history. I actually trained as an architect for restoring churches, medieval churches. I had a background of digging in Greece, in ruins in Delphi, and studying historical settlements in the old colonial days in Greenland. So, I was mostly making new churches and repairing old churches. Then in the little office I was working in, a Christian man came in who had a big piece of land in one of the cities of Denmark which had just been slated for urban development. He wanted some-
INTERVIEW 47
“My core message of ‘making good places for people’ is inherently sustainable.”
Marina Fischer, Csilla Letay and Lars Zimmermann (Cities for Future)
thing in his land that was “good for people, not the usual crap”, no single-family housing, no Plattenbau, no modernistic blocks, but something good for people. He thought because we made so many churches, we must be good Christians, so we would know. Of course, we first said, “Everything architects do is good for people,” but then he answered “not quite.” I went home to my wife and said, "Do you know what's good for people?" and then we realized that nobody knew anything for real. We started to guess, and in the end, we made this project which was never built, actually because it was too progressive. It was made up of clusters of small rowhouses around squares. We thought that a square was good for people. Then my wife and I got money to go to Italy, because I wanted to study why it was so good in Italy and what Italians did in their squares and streets. We went to Italy for half a year with money from Carlsberg brewery, and we used the money to conduct research and to drink Chianti (laughs)
When was this?
This took place in '65 when we travelled, and in '66 we wrote our first articles. It is believed to be the first time that the words "men" and "people" were mentioned in an architecture magazine. My wife was then hired by the Danish Building Research Institute to study housing, while I was accepted to the university to continue my studies on "Life between buildings". We found that all the patterns we observed in Italy were also present in Denmark, but due to the colder climate, it was less frequent and for a shorter period of time. This made it easier to study and was also more of a tradition in Italy, although it was the same phenomenon. Later, when I began to conduct research, I had the opportunity to present it to William Hollingsworth “Holly” Whyte in New York, who had done a lot of research in New York and believed that whatever he had discovered was unique to New York behaviour. "Look at what people do on New York street corners!" – "Yes, I've seen that before, that's universal behaviour." We realised that it was highly universal, that we were studying homo sapiens in their environment. I have a good one-liner for you, for the magazine, it's a quote from the mayor of Bogotá in Colombia, Enrique Peñalosa. He said, "It's a paradox that human beings know so much about good habitats for mountain gorillas, Siberian tigers and whales, and we know so little about good urban habitat for homo sapiens."
At what point did we lose this knowledge or did we ignore this knowledge on purpose?
Sometimes I say that the good old days went from a long time back to 1933. Then, the modernists created the Charter of Athens for city planning, stating that living, working, recreation and communication should never be put together, but should be kept separate. The city should be a machine, and traditional cities should not be built. We should not focus on spaces, but focus on objects. This was very well-received by the architects because then they didn’t have to think about anything but their own building; you can put objects wherever you like to because context doesn’t matter anymore. Then came all the star architects, and the only way to compete was to make something more ridiculous.
In the old days, the buildings were more or less anonymous, and you could only add a little more detail here or there. The distinctive feature of all the cultures was that cities were always made up of spaces for life, such as the agora and the streets. When we look at Giambattista Nolli’s map of Rome from 1748, all these spaces make up the city. When we think of an old city like Cologne, we remember all the streets and all the squares, but we can only name three buildings: the cathedral, the town hall and one more.
But when we think of Dubai, we can’t recall spaces because there are no spaces, it’s all leftover space, but we can mention six or ten funny buildings. It is made out of funny buildings. So, today, they start by designing the building, and then call in the landscape architect to do some landscaping, and then look out the window to see if there is some life. In the old days, they started with life and said, “This is a good place for a market.” First, what life will it be? We need a market square, and then the buildings walked out to the streets where the people were moving. Farmers came and sold their goods, and after 200 years, they started to make a tent, and after 400 years, they started to build a little house, and then a bigger house, and then the street was invented. The street started as a linear movement, made by feet, the market started as a thing in the city where things which needed space could happen like markets, processions, executions, coronations of kings. All these squares were 100 x 100 metres because that’s how far you could see, so if they were bigger, you could not see to the other end.
Copenhagen has become a role model for urbanism and urban planning and getting life back into streets. How difficult was it for you to initiate this process in the 1960s or 1970s? What did you do to convince municipalities to change their attitude?
As a person of advanced age, I have had time to reflect on this matter. When I published my first book, "Life Between Buildings", I emphasized that life between buildings is just as important as life within buildings, and the way we build significantly impacts it. The main chapter of the first volume was about the art of constructing streets, which modernism had lost, and we had to learn it again. We began influencing this approach, particularly in Copenhagen, when I was employed at the university after touring Italy and writing articles. We now realize that in the last 50 years, three places in the world have studied the relationship between built form and life, and they are the centers of these kinds of studies: New York, with Jane Jacobs, William “Holly”
48 INTERVIEW
“Cities were always made up of spaces for life.”
Whyte, and the Project for Public Spaces; Berkeley, with Donald Appleyard, Christopher Alexander, Clare Cooper Marcus, Allan Jacobs, and Peter Bosselmann; and Copenhagen.
The difference between Copenhagen and these other places was that we used Copenhagen from the very beginning to conduct our research. Every time a street was closed, we studied what happened, and every five years, we reviewed the entire project and proved that giving more space to people attracted more people. Whenever they removed a parking lot, two more people would come and sit. We discovered that adding precisely 14 square meters for staying activities – people who are not walking but resting – made a difference. We published our findings regularly, making it the first study in the world of life in the city. Later, I had the opportunity to be a visiting professor at Berkeley, and I discovered that they were far more thorough in their research, but no one was using it. This was completely different from the research we conducted in Copenhagen because we knew that everyone in Denmark knew each other. I knew all the politicians, the mayor, and all the city planners were my students, and we all read the same books. The city became very interested in what we were doing, and they started asking us to do more research on specific topics. Eventually, they came to us and asked, "What should we do next?" We gradually gained significant influence on the way people thought in the Copenhagen city hall and the city as a whole. They were reassured in their decision-making by the fact that more people were present and that they were happier.
In Germany, the main focus is on the automobile industry. However, what can we learn from Denmark in this regard?
Even Sweden has its own car industry, as do many other countries. Denmark, on the other hand, has recently shown some foresight by investing in wind power and green technologies. They have decided to increase the number of wind turbines in the North Sea tenfold, which has created around 100,000 new jobs.
This is an area of development that we in Germany have not focused on, as we have a strong automobile industry but lack the natural resources for wind power. I see this as a problem, and it's impressive to see how Denmark has made a concerted effort to transition towards a greener economy and mobility.
I believe that we need to focus on moving ourselves around more, and not rely solely on cars or other motorized vehicles. While electric bicycles are a step in the right direction, they don't help with the issue of a sedentary lifestyle. Scooters and other such vehicles only serve to perpetuate the dominance of the automobile industry. As we get older, we face a shared challenge of finding ways to stay active and mobile, while also enjoying our surroundings. It's important to strike a balance between natural spaces and areas where people congregate, such as shops and public spaces.
What is your perspective on creating good housing to address the challenges that come with urban growth, demographic and climate change?
My core message of "making good places for people" is inherently sustainable. This involves prioritizing the creation of quality places and reducing the need for mobility as much as possible, such as implementing the concept of "15-minute cities". If we had a good subway system and bicycles, we would have solved many of our problems, without any need for cars. There are plenty of smarter transportation options we can explore to reduce our reliance on outdated technology.
When discussing housing, I often refer to two distinct types of housing being developed. The first, which I call "hotel housing", focuses on providing a comfortable place to sleep and a view from the window. The other, which I refer to as a "good place to live", is suitable for all seasons, phases of life, and circumstances, where one can live with children, pets, or even with physical limitations such as a broken leg. The difference between the two lies in the fact that the latter provides a pleasant living environment in addition to comfortable flats. We are working hard to understand that neighbourhoods and areas for living are more important than flats for sleeping. Nowadays, there is a growing interest in co-housing, particularly among elderly people. We refer to it as plus 50 co-housing, where people who are around 50 or 60 form a commune where they have small individual spaces, as well as shared facilities such as a swimming pool, a winter garden, and go on holidays together, enabling them to have an active and fulfilling old age. Additionally, more people are becoming interested in what they are doing in Freiburg-Vauban, with housing communities where a group of people have some autonomy in decision-making. I believe this is a fascinating development.
Thank you for this wonderful conversation.
DR. HC. JAN GEHL
is a practising urban planning consultant and professor emeritus of urban planning at the School of Architecture in Copenhagen, Denmark. He has researched the form and use of public spaces in depth and put his findings into practice in numerous places around the world. His company Gehl Architects – Urban Quality Consultants creatively designs new ideas for how communities use public space. For Gehl, design always begins with an analysis of the spaces between buildings. Only when you have a vision of what kind of public life is desired in a particular space can you look at the surrounding buildings and the possibilities for productive interaction between spaces.
INTERVIEW 49
PROF.
NEUE DIMENSIONEN
DESIGN FUR DIE STADT DER ZUKUNFT

© Shutterstock © Norbert Tukaj
Herr Brell, an den heutigen Herausforderungen im Bereich der Stadtentwicklung wird deutlich, dass wir ganzheitlich, inter- und transdisziplinär denken und agieren müssen. 3deluxe hat sich 1992 als interdisziplinäres Designbüro gegründet und war damit seiner Zeit voraus – was kann man sich unter dieser Beschreibung vorstellen?
Die erste Gruppe bestand aus Innenarchitekt:innen und Grafik- bzw. Kommunikationsdesigner:innen. Uns hat immer interessiert: Was ist modern und wie sieht die Zukunft aus? Was ist cool? Was machen gerade die Kunst, die Mode, die Musik? Als wir unser Büro gründeten, hatte die Popkultur beispielsweise noch eine größere Bedeutung und einen größeren Input für die Gesellschaft als heute. So stellte sich der Anfang dar. Als wir später das Feld der Architektur hinzugezogen haben, haben wir gemerkt, dass ein Grafikdesigner durchaus auch die Fassade eines Gebäudes denken kann. Schließlich ist diese auch ein Bild für die Menschen, die durch die Stadt flanieren.
Aufgrund unserer Herkunft ist uns die Wirkung von Sachen sehr wichtig. Dem klassischen Architekten geht es primär darum, dass etwas funktionieren und halten muss. Für uns war es ein wichtiger Punkt, welche Bilder Gebäude ausstrahlen: Was repräsentiert ein Gebäude – den Eigentümer, die Firma darin, oder hat es eine Bedeutung für die Umgebung, für die Stadt? In dem Bereich, aus dem wir kamen, hat Ästhetik eine große Rolle gespielt, auch das Wort „Schönheit“.
Wir wissen natürlich mittlerweile, wie viele Zwänge es beim Bauen gibt. Dennoch: Aus dieser Sicht und mit diesem Anspruch kamen wir zur Architektur. Was ist für die Gesellschaft relevant? Das verschiebt sich natürlich. Was mal vor 20 Jahren modern war, ist es jetzt nicht mehr, das liegt in der Natur des Begriffs. Zu gucken, in welche Richtung sich die Gesellschaft entwickelt und was wir dazu beitragen können, das ist der Impetus von 3deluxe
INTERVIEW 51
„Alle Herausforderungen, die sich derzeit global auftürmen, schlagen sich in den Städten nieder.“
Im Gespräch mit Dieter Brell, Creative Director bei 3deluxe
Csilla Letay
Neben gewissen Rahmenbedingungen in der Baubranche gibt es auch die großen Entwicklungen wie etwa den Klimawandel, die Digitalisierung und zunehmende Urbanisierung sowie daraus folgend die Frage, wie wir in Zukunft eigentlich leben wollen und können. Als Architekten, als Gestalter, als Designer – welche Rolle können, müssen und wollen Sie dabei einnehmen?
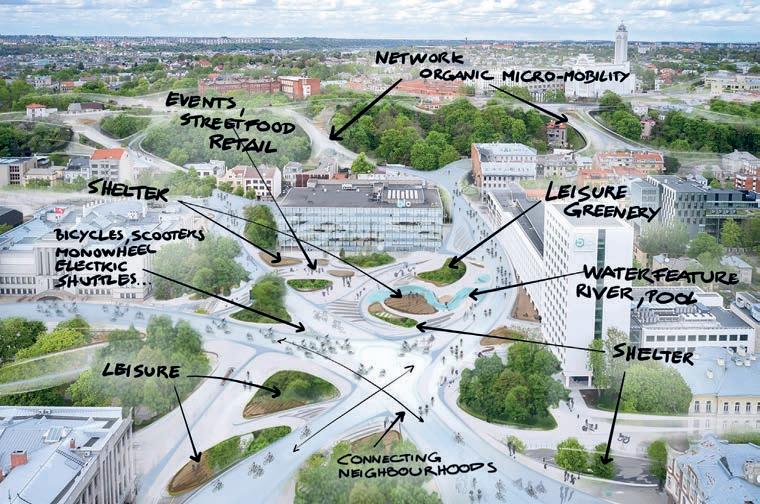
In den letzten Jahren hat sich die Rolle des Architekten sehr verändert – sollte sie auch. Es geht heute nicht mehr nur um Materialien und Statik. Denn alle Herausforderungen, die sich derzeit global auftürmen, schlagen sich in den Städten nieder – ob es die Klimaproblematik ist, die Verkehrsproblematik, die schlechte Luft, die Gesundheit der Menschen oder auch soziale Themen wie Migration. Während früher die Funktion des Gebäudes und seine Integration in die Umgebung im Fokus standen, ist es heute eine Fülle an Aufgaben, die in alle gesellschaftlich relevanten Themen greift. Das fängt an mit Biodiversität, also damit, Natur in die Stadt zu bringen; über Recyclingthemen, die Minimierung des CO2-Fußabdrucks, bis hin zu sozialen Komponenten. Als Developer oder Bauträger sollte man nicht mehr nur für sich selbst und die Mieter bauen, sondern auch eine gewisse Verantwortung für die Nachbarschaft, für das Quartier, für die Stadt, für die Natur und – wenn man es weiterdenkt – für die Entwicklung des Planeten übernehmen. Dieses Gesamtbild muss bei jedem Bauvorhaben gesehen werden. Unsere Aufgabe als Architekten ist daher auch, die richtigen Fachleute zusammenzustellen und sie zu moderieren. Die Rolle des Architekten bekommt auf einmal eine Relevanz, die sie so noch nie hatte. Architektur erhält eine ganz andere Dimension – genau das macht sie für mich derzeit auch so spannend.
Hat sich damit einhergehend die Haltung der öffentlichen Hand ebenfalls verändert?
Notwendigen pragmatischen Lösungen stehen noch immer viele Regularien im Weg. Nach meinem Empfinden wird das zwar auch erkannt. Aber bis sich tatsächlich etwas ändert, ist es in Deutschland ein langer Weg. Viele Regularien haben ja einen Hintergrund, der eigentlich richtig ist. Es geht darum, Ausgleich zu schaffen oder sicherzustellen, dass private Investoren bestimmte Dinge unterlassen, weil sie nicht im allgemeinen Interesse sind. Nur merken wir, dass wir derzeit nicht so richtig vom Fleck kommen. Das Thema ist ja ganz klar: Die Bauindustrie ist für 30 bis 40 % des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich. Hier muss also wirklich schnell gehandelt werden.


52 INTERVIEW
©
© Norbert Tukaj (2)
Die V-Plaza in Kaunas: offene Platzgestaltung mit verwobenen Zonen zum Entspannen, Spielen und mikromobilen Spaß.
3deluxe
Sie sagten vorhin, dass früher die Funktion und die Integration eines Gebäudes in die Umgebung die wesentliche Stoßrichtung bei der Planung waren. Die Umgebung bestand aber wiederum eigentlich nur aus anderen Gebäuden – aber nicht dem Raum. Wenn wir über die Transformation von Städten sprechen, kann es eigentlich nur an den Freiraum gehen, von dem es gar nicht so viel gibt. In diesem Kontext haben Sie mit Ihren Designstudien, z.B. zur Umwandlung des New Yorker Times Square oder zur Berliner Friedrichstraße, Veränderungen aufgezeigt, die – wie wir es aktuell erneut am Beispiel der Friedrichstraße erleben – durchaus heftige Diskussionen auslösen können. Wie bewerten Sie das?
Sie sagen es ja richtig, diese im Moment vielbeschworene Transformation der Städte – das widerspricht sich ja gewissermaßen. Diese Städte bzw. Bauwerke sollen im besten Fall über 100 Jahre halten, wenn man es richtig macht. Eine schnelle Transformation kann gar nicht erfolgen. Deshalb wollten wir uns das Thema Straße anschauen, also den öffentlichen Raum, weil dieser am gestaltbarsten ist. Hier werden in 30 Jahren die deutlichsten Veränderungen zu sehen sein. Deshalb haben wir diese Studien gemacht.
Mit der Reduzierung des Autoverkehrs ist ein schöner Weg dafür geebnet, um an öffentlichen Raum heranzukommen und diesen neu zu denken. Als Automobil-produzierendes Land ist das ein anderes Thema als in Ländern ohne diesen Wirtschaftsfaktor. Uns ist also klar, dass es nicht so leicht vonstatten gehen wird – sondern wahrscheinlich eher zwei Schritte vor, einen zurück. In Berlin ist dies aktuell das normale Prozedere. Wenn man aber solche Transformationen halbherzig macht – also bloß ein paar Blumenkübel hinstellt, alle Markierungen umpinselt und die Autos einfach durch Fahrräder ersetzt – die in Berlin ähnlich gefährlich sind wie die Autos – dann kommt das natürlich nicht so gut an. Man muss die Entwicklung des in der Stadt extrem wertvollen Raums zwischen den Gebäuden analog zur Gebäudeerstellung sehen. Jede Straße hat letztendlich ihre eigenen Anforderungen. Die Friedrichstraße ist nie zu dem Magneten geworden, der sie werden sollte. Daher muss man einen Mehrwert über Dekoratives hinaus schaffen. Wir haben in der Studie eine relativ extreme und auch farbige
Der ikonografische Times Square, wie er sich in der Realität gestaltet, und wie er als ein lebenswerter Ort aussehen könnte, in der Designstudie von 3deluxe: Die Herausforderung war, seine Lebendigkeit zu erhalten.

Gestaltung angelegt, z.B. als touristischen Anziehungspunkt. Das ist ein bisschen überzogen, aber man muss die Friedrichstraße in die Kategorie eines besonderen Ortes denken. Wenn eine architektonische Bedeutung nicht gegeben ist, muss man versuchen, genau diese zu schaffen, anstatt nur Standards zu erfüllen.
Inwieweit unterscheiden sich die beiden Designstudien Friedrichstraße und Times Square? Welche Erkenntnisse haben Sie in diesem Prozess gewonnen?
Um mit dem Times Square anzufangen: Wir haben einen ikonografischen Platz gewählt, um darzustellen, wie der Ort aktuell aussieht und wie er aussehen könnte. Yellow Cabs und viele Leute: Das ist der Inbegriff dessen, wie man sich eine Stadt vorstellt. Die leere Fußgängerzone ist es hingehen nicht. Um diese Lebendigkeit zu erhalten, muss man in die Gestaltung des Platzes auch die Mobilität miteinbeziehen, sodass dort nicht nur Fußgänger sind, sondern auch zusätzlich etwas angeboten wird, was übrigens für die Friedrichstraße noch mehr als für den Times Square gilt. Ganz zentral ist die Frage, wie Mikromobilität und Fußgänger gut zusammenkommen. Hierbei muss man die Ge-
INTERVIEW 53
© 3deluxe (2)

54 INTERVIEW
© 3deluxe (3)
In einer Designstudie zum Times Square stellen die Architekt:innen von 3deluxe dar, wie die Flächen zwischen Gebäuden neu gestaltet und genutzt werden können.
schwindigkeiten an den Fußgänger anpassen – und zwar stärker, als bisher angenommen. Es wird daher Infrastruktur geben, die nur für den Transfer vorgesehen ist, wo schnell gefahren wird. Denn auch künftig wird viel gefahren: Autos oder alles, was nach Autos kommt, gewährleisten in Städten die Versorgung. Aber: Es wird immer mehr Bereiche ohne diesen schnellen Verkehr geben. Hier muss die Mikromobilität in der Geschwindigkeit gedrosselt werden. Daher denke ich, dass das Geheimnis darin besteht, diesen neu freiwerdenden Stadtraum so auszutarieren, dass er sich primär am Fußgänger als schwächstem Glied orientiert. Die stärkeren Komponenten sind nachrangig und so zu führen, dass alles wie eine Art Biotop funktionieren kann. Ich hoffe, dass solche Parameter in Ausschreibungen künftig einfließen werden.
Wenn die Menschen die positiven Effekte von entsprechenden Umwandlungsmaßnahmen sehen können, dann macht es ja auch oft „Klick“. Welche Unterstützung können hierbei Architektur und Design leisten?
Dies war einer der Motivatoren für unsere Designstudien. Als Gestalter ist es unsere Aufgabe, die Vorteile der Gestaltung unserer Umgebung entsprechend zu kommunizieren. Es gibt nun einmal eine große Skepsis gegenüber solchen Veränderungen. Daher muss man auch visuell veranschaulichen, dass es besser werden kann – und dass die Veränderung nicht Einschränkung oder Verlust bedeutet, sondern einen Zugewinn.
In der litauischen Stadt Kaunas haben Sie mit 3deluxe das Projekt V-Plaza realisiert, das genau dies unter Beweis stellt. Die Fläche des neu gestalteten Platzes soll/kann dadurch, dass sie rollenfreundlich ist, die Mikromobilität fördern.

Der Gebäudekomplex, den wir gemacht haben, setzte sich teilweise aus Neubauvorhaben, teilweise aus bestehenden älteren Gebäuden zusammen, die wir saniert haben. Die Stadt hatte die Immobilien und die Fläche dem Investor mit der Maßgabe verkauft, den öffentlichen Platz auf eigene Kosten herzurichten. An dem Projekt hing der Platz also zunächst nur als Zusatzaufgabe dran – wurde aber für uns das Spannendste. Denn dieser zahlte genau auf die aktuellen Themen im urbanen Raum ein. An diesem zentralen Platz haben irgendwann nur noch Autos geparkt. Er ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein zuvor Auto-dominierter Platz nun von Menschen belebt wird. Wir haben organische Landschaften integriert, die wie eine Art Skatepark funktionieren. Das animiert die Menschen dazu, mit ihren Fahrrädern oder Inlinern usw. hinzufahren. Wenn es Spaß macht, sich dort auf Rollen zu bewegen,
dann haben wir schon viel erreicht. So kommen erstmals überhaupt wieder mehr Menschen auf den Platz, um einfach im Grünen zu sitzen, am Springbrunnen und in Cafés. Die Eröffnung fand mitten im Pandemie-Sommer 2020 statt, als alle raus wollten. Mir war vorher gar nicht bewusst, wie viele Leute in dieser Stadt auf Rollen unterwegs sind. Vollkommen unaufgefordert kamen sie an und haben diese Möglichkeit gleich erkannt. Das war toll.
Wenn wir über das Bauen sprechen, besteht aktuell ein Konflikt zwischen Werten einerseits und dem drängenden Bedarf vor allem an Wohnraum andererseits. Wie lässt sich das auflösen?
Meiner Ansicht nach besteht derzeit die große Gefahr, dass unter dem extremen Preisdruck ganz viel hässliches Zeug gebaut werden wird. Auf der anderen Seite gibt es einen kulturellen Anspruch, der nicht einfach verschwindet. Es kann nicht bloß noch um die nackte Existenz gehen. Wir müssen wirklich aufpassen, dass die Effizienzgetriebenheit uns nicht Bausünden beschert, für die in 20 Jahren keine Mieter zu finden sind – so wie derzeit für viele Bauten der 80er- und 90er-Jahre, die heute abgerissen werden. Diese Gebäude hatten einen viel zu kurzen Lebenszyklus. Nachhaltigkeit heißt auch, eine gewisse Qualität in der Ästhetik zu setzen, damit die Bauwerke auch unter diesem Aspekt langlebig sind. Ich hoffe, dass hierbei die öffentliche Hand im Zweifelsfall auch in die Förderung geht und das Thema nicht nur dem freien Markt überlässt.
Vielen Dank für das bereichernde Gespräch.
DIETER BRELL

ist Gründungsmitglied des interdisziplinären Designbüros 3deluxe, das zu den progressivsten Vertretern der deutschen Design-Avantgarde zählt. Seit mehr als 15 Jahren setzt das Wiesbadener Büro mit Niederlassungen in Miami und Dubai wegweisende Impulse in Architektur, Innenarchitektur und Corporate Design. Als Creative Director zeichnet Dieter Brell für zahlreiche international prämierte Projekte verantwortlich, wie u.a. den D'fly Store in New York, die Architektur des Leonardo Glass Cube, den Butterfly Pavilion in Dubai, das Stadtentwicklungsprojekt V-Plaza in Litauen oder das NullEnergie-Gebäude FC-Campus. 3deluxe beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit der Umwandlung von Städten in menschenfreundlichere, nachhaltigere Orte.
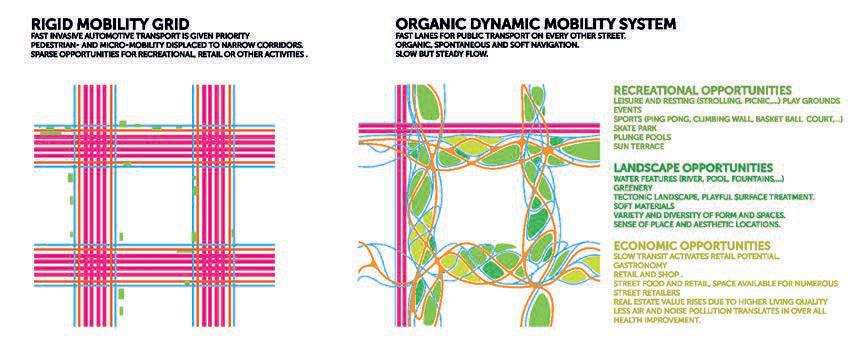
VON GROSSEN VISIONEN, UNKLAREN ROLLEN UND HOLPRIGEN WEGEN
DIGITALISIERUNG UND DIE VERKEHRSWENDE
TEXT: Dr. Mara Cole, Expertin für Digitalisierung & Mobilität

Das vorhandene Mobilitätsangebot und das daraus resultierende Mobilitätsverhalten sind eng mit der Lebensqualität einer Region verknüpft. Neben den unterschiedlichen Möglichkeiten zur Fortbewegung selbst – ob in und auf Transportmitteln oder durch aktive Mobilität – spielt auch die Aufenthaltsqualität in städtischen Räumen eine große Rolle. Damit steht das gesamte Mobilitätssystem vor vielschichtigen und teilweise gegensätzlichen Herausforderungen, die sich in den Forderungen nach einer Verkehrswende widerspiegeln: Es soll den Menschen in den Mittelpunkt stellen, vernetzter, klimaschonender und inklusiver werden, eine tiefe Integration aller Mobilitätsdienstleister gewährleisten und unterschiedlichste Zahlungsmöglichkeiten in intuitiven Mobilitätsplattformen mit verkehrsträgerübergreifenden Auskünften in Echtzeit bieten. Für
mich steht im Zentrum aller Bemühungen der Wunsch nach der Realisierung eines bedarfsgerechten Mobilitätsangebots. Digitalisierung sehe ich als den zentralen Enabler dieser verheißungsvollen neuen Mobilität(-svision). Allein: Der Weg dorthin ist noch holprig und dürfte die eine oder andere Überraschung bereithalten.
Erfolgreiche regionale Pilotprojekte und erste gelungene Integrationen verschiedener Mobilitätsdienstleister lassen die interessierten Endnutzer:innen bereits heute erahnen, wo die Reise hingehen könnte. Die Potenziale sind vielseitig und erstrecken sich über alle Stakeholder des Mobilitätssystems. Ein paar Bereiche möchte ich kurz streifen:
56 MEINUNG
© privat
Ein durchgängig such-, buch- und bezahlbares Mobilitätsangebot über digitale Mobilitätsplattformen erlaubt Kund:innen einen einfachen Zugang. Dass ein E-Tretroller-Anbieter integriert ist, ein anderer aber nicht, ist für Nutzende nicht nachvollziehbar. Alle Mobilitätsanbieter – ob ÖPNV, Sharing- oder On-Demand-Angebote – in einer Region zu integrieren, ist für die Kundenfreundlichkeit von großer Bedeutung. Bedarfsgerechte Mobilität muss Kund:innen immer genau die Kombination an Fortbewegungsmöglichkeiten anbieten, die ihrer aktuellen Situation entspricht. Die Möglichkeit beispielsweise, verschiedene Suchprofile zu speichern oder die günstigste, die gesündeste und die schnellste Route zur Auswahl angezeigt zu bekommen, ermöglicht informierte Entscheidungen. Wenn dann noch Störungen zu einer dynamischen Anpassung von Route oder Transportmittel-Kombination führen, ist ein weiterer großer Schritt in Richtung Nutzerfreundlichkeit geschafft.
Auch im Auslastungsmanagement bestehender Infrastruktur und in der evidenzbasierten Umwidmung von Flächen kann Digitalisierung einen wichtigen Beitrag leisten. In dicht besiedelten urbanen Räumen ist der weitere Ausbau von Straßeninfrastruktur für den MIV in aller Regel nicht möglich (und nebenbei bemerkt für mich auch nicht zielführend), eine Taktverdichtung auf zentralen U-Bahn-Strecken aber auch nicht. Die Forderung nach einer klimafreundlicheren Mobilität durch die vermehrte Nutzung großer Transportgefäße läuft schon jetzt an manchem ÖPNV-Knotenpunkt ins Leere. Eine smarte Verkehrsplanung, aber auch die dynamische Steuerung des aktuellen Verkehrs, fußt auf Verkehrsmodi-übergreifender Datenverfügbarkeit. Es gibt einige Beispiele für sogenannte Mobilitätsdatenplattformen, die entsprechende Daten zusammenführen und bereitstellen. Die Mobilithek des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr und der Mobility Data Space seien hier beispielhaft genannt. Proaktive, datenbasierte Planung und Optimierung der Infrastruktur, kombiniert mit dynamischer Auslastungssteuerung, sind in diesem Kontext für mich Zielbilder.
Digitalisierung und die Verfügbarkeit von Daten ermöglichen die Entwicklung neuer Geschäfts- und Bepreisungsmodelle für intermodalen Verkehr. So können beispielsweise On-Demand- und Pooling-Lösungen erst sinnvoll betrieben werden, wenn georeferenzierte Nutzeranfragen in Echtzeit verarbeitet werden können und eine ausreichende Anzahl an Bürger:innen das Angebot nutzt. Auch der Zugang zu althergebrachten Mobilitätsangeboten kann durch Digitalisierung völlig neu gedacht werden: Die Umsetzung von E-Tarifkonzepten ist hier ein Beispiel.
Ein wichtiger nächster Schritt wäre die Integration von SharingAngeboten mit dem ÖPNV in einem Tür-zu-Tür-Ticketing. Auch eine automatische Deckelung nicht nur auf Tages-, sondern auch auf Wochen- bzw. Monatsebene würde die Attraktivität deutlich steigern. Durch Gamification-Ansätze und Incentivierungen, wie etwa Rabattaktionen, lassen sich in Zukunft sicher auch noch Potenziale in der Auslastungssteuerung heben.
Wie oben bereits angeklungen bringt die Umsetzung jedoch einige Stolpersteine mit sich. Für mich sind sie eher in nicht-technischen Bereichen angesiedelt. Natürlich müssen Funktionalitäten in Apps integriert werden, Wege gefunden werden, Identitäten der Nutzer:innen über Stakeholder hinweg zu teilen, ohne gegen Datenschutzgrundlagen zu verstoßen etc., aber die dafür nötigen technologischen Grundlagen haben wir bereits. Es sind rechtliche Rahmenbedingungen, Firmenstrategien, regional orientierte Verkehrsverbünde, starre Tarifstrukturen und fehlende Ressourcen
Der Studie „Urbane Post-Corona-Mobilität“ von Bayern Innovativ zufolge können individuell buchbare Mobilitätsangebote die Verkehrswende unterstützen, wenn sie wirklich integrativ sind. Gleichzeitig müssten die Angebote aber auch nicht-digital nutzbar sein, um alle Gruppen teilhaben zu lassen.
(ob Geld, Personal oder Fläche), die die Umsetzung einer vernetzten Mobilitätswelt so mühsam gestalten. Wesentlich sind auch unklare Rollen und Zuständigkeiten sowie mangelndes Vertrauen zwischen den Stakeholdern. Durchaus nachvollziehbar, sind sie doch in der Vergangenheit häufig als Konkurrenten aufgetreten. Auch arbeiten nicht immer Menschen mit den passenden Kompetenzprofilen an den wichtigen Schnittstellen –kaum verwunderlich in einem System, das bis vor Kurzem noch sehr technisch geprägt war. Change-Management, lernende Organisationen, lebenslanges Lernen dürften Schlagworte sein, die die nächsten Jahre auf dem Weg zur Verkehrswende prägen.
Wer kann bei diesen komplexen Herausforderungen in eine gestaltende und moderierende Rolle schlüpfen? Ein Beispiel: Die Landeshauptstadt München hat vor gut zwei Jahren bestehende Strukturen aufgebrochen und ein Mobilitätsreferat gegründet, in dem Kompetenzen zur Umsetzung der Verkehrswende gebündelt werden. Mitte 2021 wurde die „Mobilitätsstrategie 2035“ im Stadtrat beschlossen und damit ein klarer Umsetzungswille demonstriert. In 19 Teilstrategien werden nun sukzessive Bausteine zur konkreten Umsetzung der Strategie formuliert. Teilstrategien beziehen sich beispielsweise auf Bereiche wie Shared Mobility, Digitalisierung, ÖPNV, Multimodalität, Steuerung des Verkehrs, aber auch soziale Gerechtigkeit oder Fußverkehr.
MARA COLE
befasst sich seit Anfang des Jahres 2023 im Bereich einer städtischen Verwaltung mit Herausforderungen der geteilten und vernetzten Mobilität. Zu ihrem Aufgabenspektrum gehören Themen wie Mobilitätsplattformen, Tarif und Vertrieb. Zuvor förderte Dr. Mara Cole als Leiterin der Themenplattform Vernetzte Mobilität des Zentrum Digitalisierung. Bayern (getragen von der Bayern Innovativ GmbH) den interaktiven Dialog und Wissenstransfer zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit im Kontext von vernetzter Mobilität und Digitalisierung. Bis 2016 war sie in der Forschungseinrichtung Bauhaus Luftfahrt e.V. unter anderem als stellvertretende Teamleiterin und Forschungsgruppenleiterin tätigt. Dr. Mara Cole hat Ethnologie studiert und in Psychologie promoviert.
DR.
© Bayern Innovativ GmbH
KIEL BEKOMMT EINE TRAM

DIGITALE PLANUNG FÜR DIE MOBILITÄTSWENDE
Eine Abkehr vom Individualverkehr ist für die Mobilitätswende dringend erforderlich, in der Stadtplanung müssen daher die Weichen zum Umstieg auf nachhaltige Mobilitätskonzepte gestellt werden: Denn nur ein integratives Denken von Fuß- und Radwegen sowie des ÖPNV sorgt für lebenswerte Kommunen für alle Bürger:innen. Unsere Expert:innen haben seit 2020 ein integratives Nahverkehrskonzept in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel erstellt. Bei der Planung kamen modernste Tools zum Einsatz.
58 PERSPEKTIVEN
TEXT: Nils Jänig, Transport Director at Ramboll Deutschland GmbH
© Landeshauptstadt Kiel
Die neue ÖPNV-Planung wird mit vielen Grünflächen für eine belebtere Innenstadt sorgen. So wird die Gegend rund um den Bootshafen noch attraktiver.
In den vorangegangenen Jahrzehnten richtete sich die Stadtplanung auf den motorisierten Individualverkehr aus – das Auto hatte oberste Priorität. Die Ergebnisse sind heute in allen deutschen Innenstädten sichtbar, die Radfahrer:innen oder Fußgänger:innen kaum mitdenken. In der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel wurde die letzte Tramlinie 1985 eingestellt. Die Stadt Kiel hat sich nun entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen und die Mobilitätswende mit dem Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) voranzutreiben. Seit 2020 verglichen unsere Expert:innen Nahverkehrskonzepte im Rahmen einer Machbarkeitsstudie. Die zentrale Aufgabe war, ein geeignetes Verkehrsmittel für die Ausweitung des ÖPNV zu finden – zur Auswahl standen aufgrund der geografischen Gegebenheiten ein Straßenbahnnetz und ein Bus-Rapid-Transit-System (BRT). Mögliche Streckenverläufe, die Verknüpfung mit anderen Verkehrsträgern und ein Betriebskonzept, das auch Fuß- und Radwege mit einbezog, wurden verglichen. Zur Darstellung der Ergebnisse kamen unterschiedliche Tools und Software-Lösungen zum Einsatz. Der gesamte Planungsprozess wurde mithilfe intensiver Nutzung des Programms ArcGIS Pro der Firma Esri begleitet.
Tramverbindung durch das lebenswerte Kiel
Für die Bewertung der beiden untersuchten Optionen – BRT und Tram – verwendeten wir über 46 Kriterien: unter anderem Nutzungsfreundlichkeit, Betriebsablauf, Kosten und Umweltaspekte mit messbaren Auswirkungen auf die Lebensqualität in der Stadt. Bei der Entwicklung der Kriterien flossen auch Rückmeldungen aus der Bürger:innenbeteiligung ein. Alle Kieler:innen waren aufgerufen, ihre Wünsche zur zukünftigen Mobilität zu äußern. Wir begleiteten diesen Prozess mit verschiedenen Online-Formaten und Vor-Ort-Veranstaltungen.
Wir bei Ramboll arbeiten mit einem interdisziplinären Team für Verkehrs- und Landschaftsplanung sowie Bürger:innenbeteiligung zusammen. Kolleg:innen aus Helsinki und aus Kiels Partnerstadt Aarhus, die ihre Expertise aus ähnlichen Projekten in Finnland und Dänemark einbringen konnten, ergänzen das Team. So können wir eine ganzheitlich nachhaltige Planung umsetzen. Das erfolgte unter Nutzung von AutoCAD, um die Planungen in Lage und Höhe durchzuführen. Die städtebauliche Integration des Projektes erfolgte von unseren Landschaftsarchitekten zunächst als Handskizzen mit Photoshop. Die Ergebnisse wurden abschließend als hochwertige Visualisierung erstellt. Dazu wurden verschiedene Tools wie SketchUp für den Modellbau, Lumion für das Rendern und Photoshop für die „Atmosphäre“ genutzt. Der Planungsprozess wurde mit dem Programm ArcGIS Pro begleitet. Dieses Tool wird für die räumliche Planung genutzt, um die relevanten Informationen und Daten durch ein intelligentes Datenbankmanagementsystem zu erfassen, verwalten, analysieren und zu präsentieren. Durch die Verschneidung sämtlicher Daten (also durch das Übereinanderlegen von Ebenen unterschiedlicher Inhalte) lassen sich optimale Ergebnisse zur Auswertung und Bewertung erzielen. Die Ergebnisse können allen Projektmitgliedern jederzeit zur Verfügung gestellt werden. Dies kann in klassischer Form als thematische Karte im PDF-Format, als Multilayer-PDF mit An-/Ausschaltmöglichkeit der einzelnen Ebenen und als Online-Geoinformationssystem (GIS), das eine selbstständige interaktive Nutzung der Themenkarten erlaubt, geschehen. Unsere Kunden haben so eine stets aktuelle Informationsgrundlage über sämtliche Projekt-Parameter sowie die Möglichkeit des direkten Austausches mit dem GIS der Stadt Kiel.
Alle Kriterien wurden auf Grundlage einer festgelegten Bewertungssystematik qualitativ und quantitativ bewertet. Um die Systeme vergleichbar zu machen, wurden für alle Kriterien Punkte auf einer Skala von „nicht erfüllt“ (0 Punkte) bis „voll erfüllt“ (10 Punkte) vergeben. Punkten konnte die Stadtbahn vor allem bei Leistungsfähigkeit, urbaner Integration, Betriebskosten und Förderfähigkeit. Auch beim Thema Umwelt schneidet die Tram stärker ab, da sie besser zu einer an den Klimawandel angepassten Straßenraumgestaltung beiträgt: Während beim BRT für die Trasse große Flächen versiegelt werden müssten, können für die Tram in weiten Teilen begrünte Rasengleise eingesetzt werden. Vor allem aber schneidet die Tram bei den langfristigen Betriebskosten günstiger ab. Für jeden Euro, den die öffentliche Hand in die Tram investiert, wird ein volkswirtschaftlicher Nutzen von 1,47 Euro erwartet (beim BRT-System nur 1,10 Euro). Alles in allem zeigte sich, dass die Tram das deutlich nachhaltigere und zukunftsfähigere Verkehrssystem für die Stadt Kiel ist.
Im November 2022 stimmte auch die Ratsversammlung der Stadt Kiel formal für das Tramsystem. Nun beginnen die weiteren Planungs- und Bauarbeiten. Auch hier wird die gute Zusammenarbeit der Stadt mit Ramboll fortgeführt. Die erste Linie soll zwischen 2033 und 2034 in Betrieb genommen werden, dabei wird das bestehende Bussystem in das neue Netz integriert. Am Beispiel Kiel zeigt sich, wie die Mobilitätswende gelingen kann: Ein altbekanntes Verkehrsmittel wird in die moderne Stadtplanung integriert und es entsteht ein hochwertiges Verkehrssystem für alle. Die Stadt macht auf diese Weise einen ebenso großen Schritt in Richtung Klimaneutralität.
NILS JÄNIG
hat in seiner Berufskarriere hauptsächlich an technischen Stadtbahn- und Regionalbahnprojekten mitgewirkt. In den letzten 20 Jahren war der studiere Verkehrswesen-Ingenieur weltweit tätig, z. B. in London, Utrecht, Kopenhagen oder Jerusalem. Er arbeitete dort in den Bereichen Fahrzeuge, Betrieb, EMV, ITCS und ökonomische Bewertungen.
RAMBOLL
ist eine internationale Ingenieur-, Architekturund Managementberatung, die 1945 in Dänemark gegründet wurde. Die 17.000 Expert:innen sind das Herzstück von Ramboll. Sie entwickeln nachhaltige, eigenständige und multidisziplinäre Lösungen in den Bereichen Hochbau, Transport & Infrastruktur, Wasser, Architektur & Landschaftsarchitektur, Energie, Umwelt & Gesundheit und Management Consulting.

PERSPEKTIVEN 59
© Ramboll
TOYOTA BRINGT GROSSSPEICHER AUS ALT-AKKUS ANS NETZ
Im Oktober letzten Jahres ging in Japan ein erster Großspeicher mit einem sogenannten Sweep Energy Storage-System ans Netz. Die Akkus des Speichers stammen aus gebrauchten Fahrzeugen mit Elektroantrieben, wobei Hybridfahrzeuge ausdrücklich eingeschlossen sind. Toyota und der Kraftwerksbetreiber JERA bauten den Großspeicher auf dem Gelände des Heizkraftwerks Yokkaichi unweit der Millionenstadt Nagoya auf. Er ist direkt mit dem dortigen Haushaltsnetz verbunden und kann bis zu 1.260 kWh Energie speichern. Bei mehr Stromproduktion aus Erneuerbaren wird die Speicherkapazität immer wichtiger. Die Sweep- oder Wobbelfunktion kann laut Unternehmensangaben den Stromfluss der Speichereinheit frei kontrollieren. Die Schwierigkeit in der Entwicklung lag laut Toyota darin, die verschiedenen Akkumulatoren mit ihren unterschiedlichen Verschleißzuständen und Typen zu nutzen. Mit der Wobbelfunktion soll der Speicher über die in den Akkus verbauten Inverter direkt Wechselstrom abgeben, die Leistungsverluste seien daher geringer. Beide Firmen wollen beim Batterierecycling weiter zusammenarbeiten, auch in einem Forschungsprojekt zur Rohstoffgewinnung aus alten Lithium-Ionen-Batterien.


GEMEINSAM FUR
OFFENE KARTENDATEN
Eine Allianz aus TomTom, Amazon Web Services, Meta und Microsoft hat im Dezember 2022 einen neuen offenen Dienst für Kartendaten angekündigt: Overture Maps. Das Non-Profit-Konsortium wird von der Linux Foundation geleitet und soll zuverlässige und vielseitig nutzbare Geobasisdaten bereitstellen. Eine der größten Quellen dafür ist bislang das vor allem von Freiwilligen getragene OpenStreetMap-Projekt. Overture Maps soll lizenzkompatibel sein, sodass Daten zwischen beiden Projekten ausgetauscht werden können. Die neue Overture Maps Foundation will offene Daten aus verschiedenen Quellen (etwa von Verwaltungen, Dienstleistern oder anderen Organisationen) kombinieren, besser standardisieren und validieren. Mit Unterstützung der Partner und der Auswertung von Bilderkennung und maschinellem Lernen soll ein möglichst vollständiges Abbild der realen Welt entstehen. Besonders die Standardisierung und Qualitätssicherung sind ein Problem, wenn große Anwendungen bislang auf freien Geodaten aufbauen sollen. OpenStreetMap stellt bislang nur eine Datenbank zur Verfügung, während Google Maps zahlreiche weitere Dienste (Routing, Bewertungen, Verkehrsdaten etc.) anbietet. Overture Maps soll nun die neue einheitliche Grundlage für ähnliche Angebote der Konkurrenz werden. Die OpenStreetMaps Foundation äußerte sich in einem Statement verhalten, aber interessiert. Im besten Fall würden sich beide Projekte unterstützen und ergänzen, was auch die Overture Maps Foundation als ihr Ziel angab. Der Kartenanbieter TomTom verspricht sich von der Zusammenarbeit, Kartendaten schneller und einfacher zu integrieren und zu validieren, um etwa das eigene Routing und Suchvorgänge zu verbessern. Die Overture Maps Foundation will noch in der ersten Jahreshälfte die ersten Daten veröffentlichen.

60 TECH NEWS
Bis zur Mitte des Jahrzehnts sollen über das Sweep Energy Storage-System ca. 100.000 kWh Strom in das öffentliche Netz eingespeist werden.
© Toyota
Das Ziel des Kooperationsprojektes ist der Aufbau „interoperabler offener Kartendaten“.
© Overture Maps Foundation/Linux Foundation
BELADUNGSSTANDARDS FUR
LASTENRADER VORGESTELLT
Der Radlogistik Verband Deutschland e.V. (RLVD) hat zusammen mit dem Bundesverband der Kurier-ExpressPost-Dienste e.V. (BdKEP) Ende Januar 2023 erste Anwendungsempfehlungen für vereinheitlichte Größen von Containern und Aufbauten sowie für die Positionierung der Montagepunkte für Lastenfahrräder und Lastenanhänger (RLVD 001) veröffentlicht. Die Größen orientieren sich an den Maßen der Europalette und der Eurobox, die in der Logistik weit verbreitet sind. So kann die Radlogistik aufgrund der Kompatibilität einfacher in Logistikprozesse eingebunden werden. Beim Ausarbeiten in der Arbeitsgruppe Technik und Standardisierung des RLVD haben sich zahlreiche Hersteller, Anwender und Automotive-Firmen beteiligt. Viele haben angekündigt, kompatible Produkte anbieten zu wollen oder die Designs bereits entsprechend angepasst zu haben. Die Arbeitsgruppe arbeitet inzwischen an der Erweiterung auf die Befestigungspunkte und -systeme für Wechselaufbauten und -container. Diese Anwenderempfehlung wird voraussichtlich im dritten Quartal 2023 fertig gestellt.

BOSCH UND NOKIA: GEMEINSAME 6GFORSCHUNG FUR DIE INTEGRATION VON KOMMUNIKATION UND SENSORIK
Im Rahmen des Mobile World Congress 2023 in Barcelona gaben Bosch und Nokia bekannt, ihre 2017 geschlossene Kooperation zur Entwicklung von industriellen IoT-Lösungen im Bereich 5G auch auf die neue 6G-Technologie auszuweiten. Die beiden Unternehmen forschen gemeinsam an dieser nächsten Netzgeneration, die Kommunikation, sensorbasierte Umfelderkennung und neue Funktionalitäten ähnlich zu Radar-Sensoren integrieren kann. Mit 6G wird es möglich sein, die Position von Objekten im Abdeckungsbereich des Netzes zu erfassen; dabei müssen diese nicht mit einem Funkmodul ausgestattet sein. Zudem wird 6G sehr hohe Datenraten von bis zu einem Terabit pro Sekunde bieten können, bei gleichzeitig sehr geringen Latenzzeiten von rund 100 Mikrosekunden. „6G wird weit mehr sein als eine reine Infrastruktur für Vernetzung, es wird autonom fahrenden Autos, intelligenten Städten und vernetzten Industrien einen enormen Effizienzschub geben“, so Dr. Andreas Müller, der bei Bosch die 6G-Aktivitäten leitet.

TECH NEWS 61
Bosch treibt die Entwicklung von 6G weiter voran.
© Shutterstock © Bosch
Mithilfe einheitlicher Größen von Containern kann die Beförderung per Lastenrad einfacher in Logistikprozesse eingebunden werden.
NEUES LEVEL IN DER LUFT

5G-TECHNOLOGIE FUR DROHNENLOGISTIK © Noah Feichter, TH Köln
Stephan Berkowitz
Im Gespräch mit Stephan Berkowitz, Chief Technology Officer bei der Third Element Aviation GmbH, Michael Thärigen, Geschäftsführer der GTS Systems and Consulting GmbH, und Norman Koerschulte, Prokurist bei der Karl Koerschulte GmbH
Hohe Datenraten, kurze Latenzzeiten sowie maximale Verbindungsstabilität: Der Mobilfunkstandard 5G soll die Lieferung per Drohne autonom ermöglichen bzw. auf ein neues Level heben. In dem mit rund 1,6 Mio. Euro öffentlich geförderten Projekt Drone4Parcel5G zeigen unter anderem die Unternehmen Third Element Aviation GmbH, GTS Systems and Consulting GmbH und Karl Koerschulte GmbH gemeinsam mit weiteren Partnern in einem Konsortium unter der Führung der Fachhochschule Südwestfalen für den pharmazeutischen und industriellen Sektor, wie die Zustellung durch Drohnen mithilfe des Mobilfunkstandards 5G im Betrieb von Drohnenschwärmen geplant und sicher durchgeführt werden kann.
Herr Berkowitz, wie sieht eine potenzielle Kommunikation der Drohnen untereinander aus, welche Anforderungen hat dies an die digitalen Lösungen dahinter?
Bei einer Kommunikation zwischen Drohnen müssen diese als Sender und Empfänger funktionieren. Das kann derzeit z.B. über D2X, eine spezielle WLAN-Variante, geschehen, die einigermaßen resistent gegen Abschattungen und in gewissem Masse „um die Ecke“ funken kann. D2X kommt theoretisch ca. sechs Kilometer weit mit Datenübertragungsraten, die (theoretisch) auch für schmalere Videoübertragungen geeignet wären.
Es gibt die eingeführte Technologie FLARM, die z.B. in Hubschraubern verbaut wird. Ein Rettungshubschrauber (der eine sehr hohe Priorität hat und seine Flugrouten in der Regel nicht bekannt gibt) sendet ein permanentes Signal aus, sodass alle Drohnen, die wiederum FLARM empfangen können, aus dem Weg entweichen können bzw. müssen. In aller Regel landen die Drohnen dann instant. Das ist logischerweise keine bidirektionale Kommunikation. Zu D2X und FLARM gibt es Alternativen mit ähnlichem Funktionsumfang.
Weiterhin kann über LTE und 5G (vermutlich) eine Kommunikation direkt über die lokalen Funkmasten abgewickelt werden. Stichwort bei LTE: AFP. Dabei handelt sich dann im eigentlichen Sinne nicht um direkte Kommunikation zwischen den Drohnen, es gäbe aber keinen funktionalen Unterschied.
Bedeutende Anforderungen an die digitalen Lösungen sind: Ein einigermaßen mäßiger Stromverbrauch der verwendeten Techniken; je kleiner Drohnen sind, umso mehr fällt der gesammelte Stromverbrauch von Zusatzkomponenten ins Gewicht. Zudem müssen die Komponenten auch verbaubar sein, wenn sie direkt in den Drohnen genutzt werden müssen, oder zumindest anbaubar. Komponenten aus der Automotive-Industrie von 500 g Gewicht etc. sind in der Regel nicht nutzbar.
INTERVIEW 63
„Erhöhte Sicherheit ist eine direkte Folge aus erhöhter Awareness und größeren Datenströmen, die möglich sind. Erhöhte Flexibilität ergibt sich u.a. aus der erhöhten Sicherheit.“
Daniel Boss & Csilla Letay
Es muss eine Art Common Sense zwischen den verschiedenen Drohnenherstellern/-anbietern herrschen. „Wir interpretieren Verhaltensweisen der anderen seit dem XX.XX.202X nun so und so“ ist sinnvoll. Es gibt z.B. im Kommunikationsprotokoll MAVLink hierzu Befehle, die Positionen einer Drohne eindeutig beschreiben. Protokoll und Datenbeschreibungen sollten von allen Teilnehmenden synchron unterstützt werden.
Die 5G-Technologie macht in diesem Kontext Ad-hoc-Korridore möglich. Was hat es damit auf sich und welche Herausforderungen sind damit verbunden, v.a. mit Blick auf die künftige Implementierung in den regulären Flugraum/Verkehr?
5G teilt die Luft in „Luftkästen“ (Quadrupel) auf. Je nach Ausbaustufe bzw. Release-Version von 5G können die Quadrupel von 3 x 3 x 3 m bis zu 10 x 10 x 10 cm groß sein. Das bedeutet die Diskretisierung der Luft und ist für menschliche bzw. maschinelle Planung eine sehr gute Grundlage. Die Bahnplanung kann eingeführte oder auch potenziell KI-gestützte Algorithmen nutzen. Quadrupel können vorab für Flüge reserviert oder ad hoc durch Veränderungen im Lagebild in Zugriff genommen werden. Die Herausforderungen sind hierbei, nicht unnötig Quadrupel zu reservieren oder diese nicht freizugeben (wann werden sie freigegeben?) und die Prioritäten der Flüge fein aufeinander abzustimmen. Hierbei könnte auch die Kommunikation der Fluggeräte direkt untereinander nützlich sein.
Wichtig ist dabei, Use Cases – die genauso, wie sie geplant wurden, durchgeführt werden müssen – abfliegen zu können, ohne dass sie unnötigerweise durch prinzipiell flexiblere Flüge in ihrer Ausführung verhindert werden. Hierfür ist ein System zu schaffen, das einen gerechten und für alle Teilnehmenden akzeptablen Ausgleich schafft.
Welche Möglichkeiten kann 5G ganz konkret in der Drohnenlogistik eröffnen, welche Vorteile versprechen Sie sich (z.B. Gewichtsreduzierung?)
Viele der soeben genannten Techniken werden durch 5G nicht zwingend obsolet, könnten aber in die zweite Reihe hinter 5G treten und somit nur noch optional Verwendung finden. Dadurch können Bauteile, Wartung an obsoleten Softwarekomponenten und Datenfusionen entfallen. Dadurch würden Aufbau und Wartungskosten und Gewicht gespart werden. Gespartes Gewicht bedeutet überdies mehr Flugzeit und/oder mehr Zuladung. Durch einen Common Sense unter den Logistikern wird gemäß Erwartungshaltung die Konvergenz der verschiedenen Drohnen-Liefersysteme untereinander stärker werden.
Wie genau kann denn die neue Technologie ggfs. durch mehr Effizienz zu Kosteneinsparungen führen?
Durch bessere Bahnplanung können mehr oder optimierte bzw. termingetreuere Flüge durchgeführt werden.
Durch einen Common Sense unter den Logistikern und der starken Konvergenz werden Abstimmungen untereinander einfacher. Zudem ist der Markteintritt leichter.
Und durch den möglichen Wegfall bisheriger Komponenten und deren zersplitterte Technologie werden Bauteile, Know-how-Vorhaltungs- und Wartungskosten eingespart.
Drohnen im Flugverkehr sind ein brisantes Thema: Wie lassen sich Sicherheit und Flexibilität vereinbaren? Wie kann hier die 5GTechnologie ggfs. unterstützen?
Jedes System in der Luft profitiert prinzipiell davon, wenn es a) weiß, wo es sich genau befindet, b) es bei Bedarf mit anderen Teilnehmern viele Daten austauschen kann und c) größere Video- und Datenstreams zu Bodenstationen oder Leitständen übermitteln kann. All diese Eigenschaften zahlen auf die Awareness eines Flugsystems im Raum und positive Folgerungen daraus ein. Wenn ich genau weiß, wo andere sind, wie ich mich verhalten werde und wie sich andere Systeme verhalten werden, kann ich sehr präzise Ableitungen für mein Verhalten ermitteln. Wenn alles eine Dimension unschärfer und unklarer sein sollte, kann daraus folgen, dass zehn Flugsysteme sich in Luftraum X aufhalten können, bei präziserer Awareness ggf. 100 oder 1.000.
Erhöhte Sicherheit ist eine direkte Folge aus erhöhter Awareness und größeren Datenströmen, die möglich sind. Erhöhte Flexibilität ergibt sich u.a. aus der erhöhten Sicherheit. Bei großer Unsicherheit müssen z.B. sehr großräumige Schutzzonen um Gebiete und einzelne Flüge gezogen oder Flüge gar seriell einer nach dem anderen abgeflogen werden.
Herr Thärigen, hier kommen Sie quasi ins Spiel. Welche Rolle nimmt GTS im Projekt Drone4Parcel5G ein?
GTS sorgt dafür, dass anfallende Transportaufträge der beiden Anwendungsprojektpartner, also des Unternehmens Koerschulte und des Drohnenbetreibers Third Element, verplant und an das System zur Drohnensteuerung von Third Element weitergeleitet werden. Außerdem nehmen wir die bei der Durchführung anfallenden Ist-Daten entgegen und visualisieren diese in der Planungsanwendung. Das von GTS bereitgestellte System TransIT ist somit der Datenmittler zwischen den Systemen der anderen Partner.
Welche Faktoren sind insbesondere für eine effiziente Tourenplanung von Drohnenlieferungen entscheidend?
Entscheidend für die effiziente Tourenplanung ist der genaue Überblick über die bestehenden Ressourcen, also vor allem Drohnen und Ladestationen, und die zu verplanenden Aufträge. Nur dann kann ein effizienter Plan erstellt werden, bei dem die Ressourcen optimal ausgenutzt werden. Aus Sicht der Tourenplanung ist vor allem die sehr schnelle Gewinnung von Echtzeitinformationen von Bedeutung, damit diese bei der weiteren Pla-
64 INTERVIEW
nung berücksichtigt werden kann. Das Softwaresystem TransIT ist in der Lage, Echtzeitinformationen für die weitere Planung zu berücksichtigen und unterscheidet sich dadurch von anderen Planungssystemen, die eher statische Pläne generieren.
Was genau macht dieses System?
Das Planungssystem TransIT ist für die automatische Verplanung der Aufträge zuständig. Dabei wird entschieden, mit welcher Drohne und zu welcher Zeit ein spezieller Auftrag durchgeführt werden soll. TransIT kann alle Restriktionen berücksichtigen, die für die Planung notwendig sind, und garantiert somit eine optimale Planung. Außerdem erweitert GTS das bestehende System um einen vollautomatischen Betrieb, der durch einen Anwender nur noch überwacht werden muss. Auch für diese Überwachung stehen entsprechende Systeme zur Verfügung.
Herr Koerschulte, als technischer Großhändler, also im B2B-Bereich tätig, haben Sie bereits vor mehr als zwei Jahren eine erste Lieferdrohne starten lassen. Seitdem entwickeln Sie ein darauf fußendes Logistik-Konzept. Warum haben Sie sich für diesen Weg entschieden?
Das hat einen akuten und einen strukturellen Hintergrund. Ein akutes Problem für Lüdenscheid, wo wir unseren Sitz haben, und das gesamte Sauerland ist die Sperrung der Talbrücke Rahmede der A45. Aus Logistiker-Sicht ist das eine mittlere Katastrophe. Die strukturelle Herausforderung ist der Fachkräftemängel. Es wird für uns immer schwieriger, Fahrerinnen und Fahrer zu finden, auch und gerade für die letzte Meile zum Kunden. Und da das mit dem autonomen Fahren im großen Stil meiner Meinung nach noch eine ganze Weile dauern wird, haben wir eine alternative Zukunftstechnologie in den Blick genommen, die sich schneller realisieren lässt. Wir bei Koerschulte sind davon überzeugt, dass wir die Technologie sehr gut nutzen können. Unsere Kernfrage: Wie kann man sinnvollerweise unsere digitalen Bestelltools für die Kunden mit Lieferdrohnen vernetzen?
Also sehen Sie Drohnentransporte heute als praktisch umsetzbare Lösung – was waren die Meilensteine auf dem Weg zu dieser Erkenntnis?
Ich bin schon 2004 mit diesem Thema in Berührung gekommen. Zum Hintergrund: Ich komme beruflich aus der Luftfahrt, war sieben Jahre lang im Lufthansa-Konzern tätig. Damals habe ich gelernt, dass es – rein technisch – überhaupt keine Piloten mehr braucht, um große Passagiermaschinen sicher zu starten, zu fliegen und zu landen. Und das ist, wie gesagt, mehr als 15 Jahre her. Für die Drohnen gilt das Gleiche: Ihr Betrieb war eigentlich nie ein technisches, sondern immer „nur“ ein organisatorisches Problem. In den vergangenen Jahren haben wir uns in den USA und auch in Tel Aviv umgeschaut und viele spannende Ideen mitgenommen. Durch die Drohnenverordnung der EU haben wir seit 2021 endlich einen gewissen regulatorischen Rahmen – das war mit Sicherheit einer der wichtigsten Meilensteine bis dato. Nun kommt es darauf an, wie sich dieser Rahmen weiterentwickelt.
Warum ist die 5G-Technologie für den Warentransport mittels Drohnen so wichtig?
Je mehr Daten ich pro Sekunde übertragen kann, desto besser. Die Drohnen sind mit einer nach vorne ausgerichteten und mit einer nach unten ausgerichteten Kamera bestückt. Diese liefern Livebilder an den Operator am Boden. Mit einem „Pixel-Wust“ kann er wenig anfangen – er braucht gestochen scharfe Bilder zur sicheren Überwachung des automatisch gesteuerten Fluges. Dabei hilft die 5G-Technologie immens. Wir planen ja nicht mit einer einzelnen Drohne, sondern mit ganzen Schwärmen.
Wie ist der praktische Ist-Stand bei Ihnen?
Bislang sind es größtenteils noch Intralogistik-Projekte, beschränkt auf unser Areal. Für die Innenstadt brauchen wir nämlich die sogenannte SAIL3-Genehmigung. Dazu stehen wir in engem Austausch mit dem Luftfahrtbundesamt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir als erstes Unternehmen in Europa diese Genehmigung erhalten werden. Aber wie das so ist bei Pionieren: Wir müssen alles von vorne bis hinten und zigmal durchgehen, um von den Behörden das „Okay“ zu bekommen. Und das dauert eben seine Zeit. Das Luftfahrtbundesamt wird jedoch voraussichtlich noch in diesem Jahr zertifizieren. Die ersten Drohnen könnten dann in Lüdenscheid und Umgebung unterwegs sein. Wir haben in der Region 3.000 Kunden. Jede Strecke muss einzeln abgenommen werden. Die ersten zehn Routen haben wir eingereicht.
Was sind aus Ihrer Sicht die größten Vorteile der Drohnenlieferung in der Praxis?
Die Möglichkeit, mit wenig Personal viele Pakete ausliefern zu können. Ein Mensch kann bis zu zehn Drohnen gleichzeitig überwachen. Als Großhändler für Handwerker und Industrieunternehmen, etwa in den Bereichen Arbeitsschutz und Befestigungstechnik, liefern wir hauptsächlich kleine Teile aus. Die Pakete wiegen maximal zehn Kilogramm. 25 kg dürften wir mit den bestehenden Regeln durch die Luft bewegen. Als Anwender bringen wir diese Erfahrungen in Drone4Parcel5G ein und profitieren umgekehrt natürlich von den Erkenntnissen aus dem Projekt.
Vielen Dank für diese interessanten Einblicke.
DRONE4PARCEL5G
Unter der Konsortialführung von Prof. Dr. Andreas Schwung und Prof. Dr. Stefan Lier der FH Südwestfalen (FH SWF) wird zunächst bis Ende 2023 die Zukunft der Drohnenlogistik erforscht. Durch den Einsatz von 5G sollen Drohnen hochautomatisiert Waren befördern können. Projektpartner sind u.a. Third Element Aviation, Noweda, GTS Systems, die KL Group, Infineon Technologies, TKG SWF und die wfg Kreis Soest. Als Forschungsprojekt der zweiten 5G.NRW-Runde wird es mit insgesamt rund 1,6 Mio. Euro vom Land NRW gefördert. Das Projektmanagement übernimmt Lukas Ostermann von der FH SWF.
INTERVIEW 65
ALL TOGETHER NOW
ZWISCHEN UMBRUCH UND AUFBRUCH: DIE
AUTOMOBILINDUSTRIE BÜNDELT IHRE KRÄFTE
Autonomes Fahren, Infotainment, Nutzererfahrung: Die Begriffe, die die Zukunft des Automobils beschreiben sollen, stehen in enger Verbindung mit fortschrittlichen Softwarelösungen. Um ihr Know-how bestmöglich zu bündeln, bilden deutsche Hersteller vermehrt Allianzen mit Tech-Start-ups. Dieser Schritt kann essenziell sein, um am Markt nicht den Anschluss zu verlieren.

66 POLIS MOBILITY
© CARIAD
Wie mittlerweile hinreichend bekannt ist, befindet sich die Automobilindustrie derzeit in einem tiefgreifenden Wandel. Einst als reiner Hersteller von Kraftfahrzeugen fungierend, sehen sich die OEMs (Original Equipment Manufacturers) heute gezwungen, infolge der Herausforderungen des Marktes ihre Geschäftsmodelle anzupassen. Eine treibende Kraft hinter dieser Transformation ist die zunehmende Digitalisierung und damit auch die steigende Bedeutung von Softwarelösungen in der Automobilbranche. Dabei geht es nicht nur um futuristische InfotainmentSysteme, sondern auch und vor allem um Vorstufen des autonomen Fahrens. So werden OEMs von reinen Herstellern zu Mobilitätsanbietern und Softwareunternehmen, die sich folglich mit ebendiesen messen müssen.
Starke Konkurrenz für deutsche OEMs
Derzeit befinden sich die deutschen Hersteller noch im Rückstand gegenüber Tech-Mobility-Giganten wie Tesla oder dem chinesischen Elektro-Riesen BYD, die zusammen für mehr als ein Drittel der weltweit sieben Millionen im Jahr 2022 verkauften Batterie-Elektrofahrzeuge verantwortlich sind. In der Vergangenheit waren sie vor allem auf die Produktion von Hardware und die Optimierung von Produktionsprozessen fokussiert; unter anderem aus diesem Grund verfügen sie über weniger Erfahrung und Kompetenzen im Bereich der digitalen Technologien und der Softwareentwicklung. Diejenigen Unternehmen, die am Markt zurzeit den Takt vorgeben, wurden teils erst im Zuge der Digitalisierungswelle gegründet und verfügen dementsprechend über ein hohes Maß an Expertise. Prof. Stefan Bratzel, Gründer und Direktor des Center of Automotive Management (CAM), bringt diese Entwicklung in unserem Interview (auf Seite 18) auf den Punkt, wenn er betont, dass Tesla „das Auto auf die Software gesetzt“ habe, während die etablierten OEMs die Software ins Automobil integrieren mussten.

Zudem wandelt sich die Branche rasant: Allein in den letzten zehn Jahren hat sich der Fokus von reinen Hardwareprodukten hin zu softwarebasierten Fahrzeugarchitekturen verschoben.
Eine der größten Herausforderungen für die Branche besteht nun darin, die entscheidenden Faktoren innerhalb dieser softwaregesteuerten Wertschöpfungskette präzise zu identifizieren und mit klarem Blick für die Zukunft zu nutzen und zu entwickeln. Eine 2022 herausgegebene Studie des CAM prognostiziert im Connected-Car-Bereich für 2030 ein weltweites Marktvolumen von über 200 Milliarden Euro; die zentralen Trends Konnektivität, autonomes Fahren, Shared Mobility und Elektrifizierung (CASE) basieren allesamt auf innovativen Software-Technologien und erfordern von Herstellern die Schaffung agiler Strukturen. Gemäß der Studie haben sich die Innovationen in diesen Feldern in den letzten zehn Jahren verdreifacht. Die wachsame Konkurrenz aus Asien und dem Silicon Valley verstärkt den Innovationsdruck ebenso wie die Erwartungshaltung der potenziellen Kundschaft, die in anderen Bereichen bereits in der digitalen Welt zu Hause ist und im Auto eine ähnliche Nutzererfahrung erwartet wie auf dem Smartphone oder Tablet.
Software first
So wird die Bordtechnik immer mehr zu einem Unterscheidungsmerkmal der einzelnen Marken. Eine Studie der Unternehmensberatung Capgemini bekräftigt das und formuliert es drastisch: Deutsche Autobauer drohen den Anschluss zu verlieren. Es wird erwartet, dass diejenigen Unternehmen, die sich durch softwarebasierte Dienste profilieren können, einen höheren Marktanteil erzielen werden als ihre Wettbewerber. Das Credo lautet dementsprechend: Software first. Um die Entwicklungsrückstände ausgleichen zu können, haben sich daher in den letzten Jahren viele deutsche OEMs mit Softwareunternehmen zusammengeschlossen, die sich etwa auf Fahrassistenzsysteme, Bordelektronik oder Konnektivitätslösungen spezialisiert haben.
Das Beispiel Volkswagen etwa illustriert die Schwierigkeiten am digitalen Markt recht akkurat und steht „sicherlich ein stückweit für die Branche insgesamt“, wie es Prof. Stefan Bratzel formuliert. Mitte 2019 nahm der Wolfsburger Konzern die Software-
POLIS MOBILITY 67
© Shutterstock
entwicklung in die eigene Hand und gründete die sogenannte Car.Software-Organisation, die seit 2021 unter dem Namen CARIAD operiert – ein Akronym für „Car, I am digital“. CARIAD soll als eine Art Software-Basislager fungieren, aus dem sich Hauptkonzern und Tochterfirmen bedienen können, wenn es um die Einrichtung der Bordtechnologie geht. Der Start war bisher aber eher holprig: Neben Konflikten zwischen den Tochterfirmen lief auch die Entwicklung nicht reibungslos. Ende 2022 wurden erneut Verzögerungen im Betriebsablauf publik, die etwa den Markteintritt bereits lange geplanter Fahrzeuge verzögerten und nach Medienberichten gar das Ziel gefährdeten, die britische Luxus-Tochter Bentley bis 2030 komplett zu elektrifizieren. Der Start des elektrischen Audi Artemis wurde zum jetzigen Stand um etwa drei Jahre nach hinten verschoben und soll nun erst 2027 erfolgen. Dennoch: Volkswagen bleibt im Connected-CarBereich innovationsstärkster Konzern weltweit, noch vor Mercedes-Benz und Tesla, die das Feld der sogenannten „High Performer“ bilden. Insgesamt vereint Deutschland 30 % der globalen Innovationsstärke auf sich und liegt damit – vor China und den USA – weiterhin auf dem ersten Platz.

Kräfte bündeln durch Kooperationen
Um die Kräfte zu bündeln und die Anfangsprobleme abzuschütteln, ist CARIAD in den letzten Jahren einige Kooperationen eingegangen. Um auf dem chinesischen Markt etwa nicht ausgebootet zu werden, hat man sich kurzerhand mit dem dort ansässigen Software- und Chipspezialisten Horizon Robotics zusammengeschlossen. Das Joint Venture soll durch spezialisierte Mikrochips das Entwicklungstempo im Bereich des autonomen Fahrens anziehen und die Attraktivität der deutschen Fahrzeuge auf den asiatischen Märkten erhöhen, also dort, wo die Konkurrenz besonders groß ist. So besitzt beispielsweise der globale Kooperationsvertrag zwischen CARIAD und dem Navigationsspezialisten TomTom, der das VW-Borddisplay revolutionieren soll, in China allerdings keine Gültigkeit – dort sollen eigens entwickelte Systeme implementiert werden.
Im Bereich Forschung und Entwicklung hat CARIAD ebenfalls die Fühler ausgestreckt und eine deutsch-deutsche Partnerschaft mit Bosch in die Wege geleitet, die erst kürzlich vom Bundeskartellamt genehmigt wurde. Eines der Projekte, an dem die Unternehmen arbeiten werden, ist die Entwicklung einer 360°-VideoPerception-Software, die Signale von Kameras, Radaren und anderen Sensoren zusammenführen und per KI verarbeiten soll. Sie wird auch anderen Herstellern zur Verfügung stehen und kann langfristig dafür sorgen, Abstimmungsprobleme zwischen verschiedenen Herangehensweisen an das autonome Fahren zu beseitigen. Tesla etwa arbeitet mit Kameras, während viele andere Hersteller auf Radar- und Lidar-Technologien zurückgreifen.
68 POLIS MOBILITY
Die vernetzte Stadt - daran arbeiten Softwareunternehmen und OEMs gemeinsam.
Um ausgehend von den Softwareproblemen des Betriebssystems VW.OS auch den Kundenservice zu optimieren, plant CARIAD eine personelle Offensive: Ende Februar wurde die Übernahme der „Mobility-Services-Platform“ von Hexad verkündet, damit stoßen 75 weitere Software-Entwickler zu CARIAD hinzu. Das Software-Unternehmen verbindet mit VW bereits eine langjährige Partnerschaft und soll die Entwicklung der Cloud-Dienste vorantreiben. So könne dann unter anderem via KI-basierter „Predictive Maintenance“ Kunden signalisiert werden, in die Werkstatt zu fahren, noch bevor ein möglicher Schaden auftritt. Im Sommer 2023 soll der Kauf von Hexad abgeschlossen werden. Doch die Personaloffensive soll nicht nur durch Allianzen, sondern in weitaus größerem Maßstab erfolgen: CARIAD sucht allein in 2023 weltweit über 1.700 Software-Talente.
Auch Ford kooperiert im Wettbewerb um zeitgemäße Softwareentwicklung mit etablierten Zulieferern. Gemeinsam mit Mobileye, einer Tochtergesellschaft des Intel-Konzerns, sollen moderne Fahrerassistenzsysteme für die globale Produktpalette des US-amerikanischen OEM entwickelt werden. Kamerabasierte Vision-Sensing-Technologie und Vision-Processing-Software für die Autonomiestufen 1 und 2 sollen weltweit in Ford-Modellen eingesetzt werden. Somit nutzt Ford erstmalig Mobileye-Technologien über den gesamten Lebenszyklus künftiger Modelle hinweg. Außerdem werden schon seit 2021 Google-Karten und Cloud-Dienste in Mustang & Co. verbaut, um von der Marktposition des Internet-Riesen zu profitieren und die Technologie auf dem aktuellen Stand zu halten.


Der französische Automobilhersteller Renault arbeitet seit Ende 2022 mit dem israelischen Start-up Otonomo zusammen, das sich auf die Entwicklung von Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) sowie das smarte Flottenmanagement spezialisiert hat. Ziel ist es, eine Plattform zur Verwaltung von Daten aus vernetzten Fahrzeugen zu entwickeln, die es Renault ermöglicht, die Leistung und Zuverlässigkeit seiner Fahrzeuge zu verbessern. Die dadurch gesammelten Fahrzeugdaten können etwa in der Weiterentwicklung des autonomen Fahrens genutzt werden.
Auch wenn die Zusammenarbeit zwischen OEMs und Softwareunternehmen nicht ohne Herausforderungen und gewisse Risiken verläuft – etwa die unterschiedlichen Arbeitsweisen oder die finanzielle Vormachtstellung der OEMs innerhalb der Kooperation – und auch die rechtlichen Fragen noch nicht restlos geklärt sind, bergen solche Modelle die Chance, dass beide Parteien gleichermaßen voneinander profitieren: Einerseits erhalten die Softwareunternehmen Zugang zu einem über Jahrzehnte aufgebauten Kundenstamm und einer renommierten Marke, andererseits verbessert sich die Marktposition der OEMs im internationalen Wettbewerb. Die Zukunft wird zeigen, ob es die angestammten Akteure auf lange Sicht mit der neuen Konkurrenz aufnehmen können und welche Marktdynamiken sich hieraus noch langfristig ergeben. Die Innovationskraft der Etablierten, meint auch Prof. Stefan Bratzel, sollte man jedenfalls nicht unterschätzen.
POLIS MOBILITY 69
© CARIAD/TomTom ©
Um das VW-Infotainment an zukünftige Anforderungen anzupassen, kooperiert CARIAD mit dem Navigationsriesen TomTom
CARIAD
GAIA-X FUR DIE MOBILITAT DER ZUKUNFT

SICHERER MOBILER DATENAUSTAUSCH ZWISCHEN
„Eine ganzheitliche, angebotsübergreifende und transparente Systemarchitektur für den Austausch von Daten im Straßenverkehr ist heute nicht verfügbar. Zwar gibt es einzelne Unternehmen, die aktuell schon Dienste anbieten. Aber diese Services sind auf spezielle Anwendungen, Fahrzeuge oder Kundengruppen zugeschnitten“, erklärt Peter Busch, Projektleiter von Konsortialführer Bosch für das Forschungsprojekt GAIA-X 4 moveID. Die Infrastruktur beispielsweise sei oftmals kartografiert, allerdings lägen Informationen zur Verfügbarkeit der Services aufgrund fehlender Vernetzung der vielen unabhängig agierenden Anbieter
selten vor. Mit GAIA-X 4 moveID wollen daher Hochschulen, Autozulieferer und Systemprovider gemeinsam unter der Leitung von Bosch in den kommenden drei Jahren die erforderlichen Standards und technologischen Konzepte für einen sicheren Informationsaustausch zwischen Fahrzeugen und ihrem Umfeld, zwischen Anbietern und Kunden von Mobilitätsanwendungen entwickeln. Das Ziel: dezentrale digitale Fahrzeugidentitäten. Für den Massenbetrieb von Elektromobilen, das automatisierte Fahren sowie den Aufbau vernetzter Städte wird dies zu einer wichtigen Voraussetzung.
70 POLIS MOBILITY
UND IHREM
FAHRZEUGEN
UMFELD
© Bosch (2)
Zu den Projektteilnehmern zählen unter anderem die Unternehmen Denso und Continental, WOBCOM, das Luftfahrt- und Rüstungsunternehmen Airbus sowie verschiedene Forschungseinrichtungen. GAIA-X 4 moveID ist eingebettet in die größer angelegte europäische Initiative GAIA-X zum Aufbau einer branchenübergreifenden, vernetzten und geteilten Dateninfrastruktur in Europa. GAIA-X folgt europäischen Datenschutzgrundsätzen und setzt auf eine dezentrale Architektur und Transparenz. Hierzu werden europaweit Beiträge geleistet. GAIA-X setzt in verschiedenen Anwendungsdomänen Akzente, wie etwa der Mobilität. Hier ist die Projektfamilie GAIA-X 4 Future Mobility verankert, zu der auch das Projekt GAIA-X moveID gehört.
GAIA-X 4 Future Mobility wird vom Institut für KI-Sicherheit im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) koordiniert und bietet den Rahmen für bisher fünf Projekte, die rund 80 Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammenbringen, deren Fokus auf der Entwicklung datenzentrierter Anwendungen liegt, bei denen eine enge Vernetzung von Nutzern, Dienstleistern, Herstellern und Zulieferern besonders wichtig ist. In den einzelnen Projekten geht es unter anderem um eine intelligente Verkehrsinfrastruktur, den Produktlebenszyklus oder digitale Zwillinge im Zusammenhang mit dem automatisierten Fahren. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fördert GAIA-X 4 moveID mit 14 Mio. Euro und trägt so die Hälfte der Projektkosten.
Mit Vernetzung digitale Services flächendeckend anbieten
Mit den von GAIA-X 4 moveID anvisierten Standards sollen Fahrzeuge Informationen mit anderen Fahrzeugen und ihrer Umgebung sicher und souverän ohne „Vermittler“ austauschen können. Zu den „Infrastrukturpartnern“ der Fahrzeuge zählen beispielsweise Ladesäulen, Schranken, Lichtsignalanlagen oder Parkplätze.

In welchen Parkhäusern gibt es gerade freie Ladesäulen? Wo sind in der Innenstadt noch Parkplätze verfügbar? Und wie lassen sich diese Informationen digital übermitteln und die Services anbieterübergreifend abrechnen? Die Lösung für diese und ähnliche Fragen setzt einen sicheren Datenaustausch zwischen den Fahrzeugen und ihrer Umgebung voraus. „Damit Nutzer beispielsweise alle verfügbaren Ladesäulen finden oder Ladevorgänge bezahlen können, bedarf es offener Standards“, erklärt Peter Busch. Dabei müsse stets gewährleistet sein, dass die Daten sicher verarbeitet und nicht von einzelnen Anbietern ausschließlich zu eigenen Zwecken verwendet werden. Nur so könne das notwendige Vertrauen der Nutzer wachsen und ein breites Angebot aller verfügbaren Dienstleistungen entstehen, wie etwa das sogenannte Deep-Parking (Nutzen von sonst nicht verfügbaren Parkplätzen).
Aus diesem Grund baut das Konsortium auf dem europäischen GAIA-X-System auf, das technische, ökonomische und rechtliche Grundlagen für eine vertrauenswürdige und sichere Dateninfrastruktur definiert. GAIA-X setzt dazu auf Dezentralisierung und das Zusammenspiel verschiedener Cloud-Anbieter mit gemeinsamen Richtlinien. In diesem Sinne handelt auch das Projekt GAIA-X 4 moveID. Es nutzt Open Source für seine Entwicklungen, und stellt diese allen Anbietern für unterschiedliche Geschäftsmodelle zur Verfügung.
Das Forschungsprojekt will für Interaktion und Handel der Akteure untereinander Management- und Verwaltungsservices mit Hilfe international anerkannter Hard- und Software entwickeln. Vor allem im autonomen Fahrbetrieb könnten die Anbieter so Angebote wie Nachrichten, Unterhaltung, Navigation und vieles mehr mit dem System des Autos verknüpfen. Allein der Markt für Dienstleistungen rund um das vernetzte Parken wird weltweit auf zehn Milliarden Euro jährlich geschätzt. Zudem ist das gezielte Ansteuern von Parkmöglichkeiten ein wichtiger Beitrag zum Abbau von Verkehr und Emissionen – die Suche nach einem Stellplatz macht heute rund ein Drittel des innerstädtischen Verkehrs aus. Auch für den Erfolg der Elektromobilität ist die Verfügbarkeit von Informationen ein wesentlicher Faktor. In Europa werden Schätzungen zufolge bis 2030 gut die Hälfte der neu zugelassenen Automobile elektrisch angetrieben. „Ihre Nutzer müssen sich darauf verlassen können, möglichst rasch und rechtzeitig Lademöglichkeiten zu finden. Die Vernetzung der Systeme ist dafür grundlegend“, so Peter Busch.
Intensiver Datenaustausch für automatisiertes Fahren
Automatisiertes Fahren im Massenbetrieb ist nur denkbar, wenn Automobile schnell und zuverlässig mit ihrer Umgebung kommunizieren. Der hierzu notwendige Datenaustausch ermöglicht eine klimafreundliche Steuerung der Verkehrsströme, die sich nach dem aktuellen Aufkommen richtet. So können Städte den Zugang zu bestimmten Bereichen in Echtzeit regulieren und Staus vermeiden. Dieses sogenannte Zoning setzt allerdings voraus, dass Fahrzeuge veränderte Bedingungen sofort erkennen und entsprechend neue Routen wählen. Im Rahmen von GAIAX 4 moveID wird Zoning mit Testfahrzeugen erstmalig grenzübergreifend im Testfeld Deutschland-Frankreich-Luxemburg (Merzig/Saarbrücken) demonstriert. Autos erhalten dynamisch Informationen zur Einfahrt in definierte Bereiche.
POLIS MOBILITY 71
BETRIEB VON LADESAULEN IN KOMMUNEN
AUSBAU DER LADEINFRASTRUKTUR UNTER BERÜCK-
SICHTIGUNG KOMMUNALER VERGABEPOLITIK
Ladesäulen auf kommunalen Flächen spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung der Elektromobilität. Zum einen kann die verbesserte Zugänglichkeit zur Ladeinfrastruktur in Städten und Gemeinden dazu beitragen, dass die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs für Bürgerinnen und Bürger zu einer praktikablen Option wird. Zum anderen können durch den Betrieb von Ladesäulen auch Einnahmen generiert und lokale Unternehmen unterstützt werden.
Beim Betrieb von Ladeinfrastruktur im öffentlichen Straßenraum hat eine Gemeinde aber gleich mehrere rechtliche Belange zu berücksichtigen:
• Gemeindeordnung (GemO)
• Straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnis (Bundesfernstraßengesetz/Landesstraßengesetz)
• Ladesäulenverordnung (LSV)
• Baugesetzbuch (BauGB) und Landesbauordnung (LBauO)
• Carsharinggesetz (CsgG)
• Vergaberecht und Kartellrecht (GWB)
Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur
Die Errichtung öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur setzt den Zugang der Charging Point Operator (nachfolgend als „CPO“ bezeichnet) zu geeigneten Flächen voraus. Ein Ladepunkt ist nach Maßgabe § 2 Nr. 9 LSV öffentlich zugänglich, wenn er sich entweder im öffentlichen Straßenraum oder auf privatem Grund befindet, sofern die zum Ladepunkt gehörende Fläche von einem unbestimmten oder nur nach allgemeinen Merkmalen bestimmbaren Personenkreis tatsächlich befahren werden kann.
Keine öffentliche Zugänglichkeit liegt demnach vor, wenn der Personenkreis, der den Parkplatz befährt, bestimmt ist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn alle Personen, die diesen befahren, namentlich bekannt sind, z. B. ausschließlich Mitarbeiter eines oder mehrerer Unternehmen.
72 RECHT
So werden geeignete öffentlich zugängliche Flächen von Gebietskörperschaften wie dem Bund und insbesondere Kommunen, aber auch von privaten Grundstückseigentümern zur Verfügung gestellt. Anders als die Nutzung privater Flächen erfordert der Zugang zu öffentlichen Flächen in vielen Fällen eine straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnis.
Rein hoheitliches Handeln der Kommune Hinsichtlich der Vergabe von Nutzungsrechten für öffentlich zugängliche Flächen durch Kommunen ist das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) nicht anwendbar, wenn die Gemeinde rein hoheitlich handelt. Keine unternehmerische Tätigkeit bzw. geschäftliche Handlung liegt vor, wenn und soweit die öffentliche Hand auf gesetzlicher Grundlage, schlicht verwaltend oder als Hoheitsträger im Rahmen der öffentlichen Daseinsfürsorge handelt.
In der verwaltungsrechtlichen Praxis ist es bisher nur vereinzelt zu Ausschreibungen von öffentlichen Flächen zum Ausbau der Ladeinfrastruktur gekommen. Überwiegend sind straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnisse erteilt oder Exklusivverträge mit CPO geschlossen worden. Gemeinden können in Sondernutzungssatzungen Grundsätze und Leitlinien für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen zur Errichtung und zum Betrieb von Ladeinfrastruktur regeln.
Eine gesetzlich normierte Ausschreibungspflicht bzw. jedenfalls eine Verpflichtung zur diskriminierungsfreien Vergabe ist bisher nur für die Vergabe von Wegenutzungsrechten für Energieversorgungsnetze in §§ 46 ff. EnWG gesetzlich verankert.
Unternehmerische Tätigkeit der Kommune durch Kooperation mit Drittenn Wird die Kommune aber unternehmerisch bzw. erwerbswirtschaftlich tätig und kooperiert hierbei mit einem Privatunternehmen zum Zwecke eines schnelleren Ausbaus der Ladeinfrastruktur, ist die Vergabe von kommunalen Flächen mit einer öffentlichen Ausschreibung verbunden.
Bei einer unternehmerischen Tätigkeit der Kommune ist zunächst danach zu differenzieren, ob sie für den Betrieb der Ladeinfrastruktur das wirtschaftliche Risiko trägt. Falls die Kommune das Risiko trägt, hat sie einen Dienstleistungsauftrag nach § 103 in Verbindung mit § 115 GWB zu vergeben. Sollte dahingegen der CPO als Betreiber der Ladeinfrastruktur das wirtschaftliche Risiko tragen, ist eine Dienstleistungskonzession nach § 105 GWB zu vergeben.
Die Durchführung eines Vergabeverfahrens bei gemeindeeigenen Stadtwerken (sog. Inhouse- bzw. Instate-Vergabe) ist ebenfalls erforderlich. Die in Art. 28 Abs. 2 GG verankerte kommunale Selbstverwaltungsgarantie gewährleistet, dass die Gemeinden die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung regeln und somit auch über Beschaffungen selbst entscheiden können. Eine Ausnahme von der Verpflichtung zur Vergabe besteht nur, wenn die Tätigkeit des Stadtwerkes mehr als 80 % zur Ausführung des Ausbaus der Ladeinfrastruktur dient oder es zu einer interkommunalen Zusammenarbeit kommt (vgl. § 108 GWB).
Dabei dürften die Formulierung der u.a. mit der Flächenvergabe verfolgten Ziele und die Ausgestaltung bzw. Festlegung des konkreten Vergabekonzepts mit verschiedenen Gestaltungsoptionen unter Berücksichtigung des vergaberechtlichen Diskriminierungsverbots eine nicht unerhebliche wirtschaftliche Herausforderung begründen. Als mögliche Ziele könnten z.B. die Erzielung höchstmöglicher (Flächen-)Erlöse, die Gewährleistung einer gleichmäßigen Verteilung von Standorten über das Kommunalgebiet und/ oder ein besonders schneller Ausbau der Ladeinfrastruktur definiert werden. In diesem Zusammenhang müssten aber ebenso Zielkonflikte beachtet werden. Auch eine spätere, wesentliche Änderung des Auftrags oder der Leistungen können eine Neuvergabe nach § 132 GWB erforderlich machen.
Zudem ist darauf zu achten, dass zu lange Vertragslaufzeiten den Wettbewerb hemmen können. So hat das Bundeskartellamt bereits Laufzeiten von mehr als vier Jahren beanstandet. Da allerdings derzeit Elektrofahrzeuge noch nicht hinreichend weit verbreitet sind, könnte im Einzelfall dieser Aspekt einen möglichen Rechtfertigungsgrund für eine längere Vertragslaufzeit darstellen.
Auch die Suche nach Kooperationspartnern zur gesellschaftsrechtlichen Gründung eines Joint Ventures ist ausschreibungspflichtig. Die Kooperation in einem Joint Venture verhindert nicht, dass die Kommune, sollten die Anforderungen an eine Inhouse-Vergabe nicht vorliegen, den Auftrag oder die Konzession/Dienstleistung auszuschreiben hat.

Gleichzeitig bieten sich aber auch Gestaltungslösungen an, beispielsweise wenn der Dritte nach vollständiger Errichtung der Ladesäulen und Abschluss sämtlicher Vertragsverhältnisse der Kommune das Angebot für eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung an dem Unternehmen unterbreitet. In diesem Fall wäre die gemeindliche Beteiligung nur unter kommunalaufsichtsrechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen.
Die wettbewerbliche Struktur des Marktes zum Ausbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur könnte zukünftig durch eine kommunale Vergabepolitik wesentlich geprägt werden. Durch kommunale Kooperationen mit Privatunternehmen kann der Ausbau von Ladesäulen im Kommunalgebiet erleichtert und beschleunigt werden. Je mehr Ladesäulen auf dem Markt existieren, desto mehr dürfte auch der Absatz von Elektrofahrzeugen gefördert werden. Jedoch ist zu beachten, dass neben der Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Dienstleistungskonzessionen sowohl die Suche eines Kooperationspartners als auch die Gründung eines Joint Ventures vergaberechtlich ausschreibungspflichtig sind.
DÉSIRÉE OBERPICHLER
ist Rechtsanwältin in der Energierechtsboutique BRAHMS NEBEL & KOLLEGEN mit Sitz in Berlin und Hamburg. Sie hat in Hannover Rechtswissenschaften studiert und berät insbesondere im Grundstücksnutzungsrecht und bei Transaktionen von Solar- und Windparkanlagen. Zudem ist Désirée Oberpichler u.a. Mitglied im Erneuerbare Energien Cluster Hamburg und im Deutsch-Französischen Büro für die Energiewende.
RECHT 73
© Brahms Nebel & Kollegen
Kritische Verkehrssituationen, vereiste Straßen und Schlaglöcher – mehr Sicherheit durch intelligente Datennutzung
BIG DATA IN DER MOBILITAT

VON DER IDEE BIS ZUR UMSETZUNG
Mercedes-Benz und die Niederlande zeigen in einem großflächigen Projekt das Potenzial von fahrzeuggenerierten Daten.
Anonymisierte fahrzeuggenerierte Daten als Schlüssel zu einem nachhaltigeren, klimafreundlicheren und zugleich sicheren Verkehr der Zukunft – Ziele, denen sich auch Mercedes-Benz verschrieben hat. Schon heute können Kund:innen von MercedesBenz mit ihren anonymisierten Daten dazu beitragen, Mobilitäts- und Infrastrukturangebote zu verbessern. Voraussetzung dafür ist, dass der Kunde jeweils gesondert einwilligt. Diese Einwilligung kann der Kunde natürlich auch jederzeit widerrufen, beispielsweise über die Mercedes me App.
74 PERSPEKTIVEN
TEXT: Patrick Blume, Leiter Produktportfolio Urban Mobility bei der Mercedes-Benz Group AG AG (2)
© Mercedes-Benz Group
Wo treten gehäuft Schlaglöcher auf und wo ist ein Verkehrszeichen nicht lesbar? Wann fließt der Autoverkehr in der Stadt flüssig und wann stockt er? Wo gibt es Glatteis und der Streudienst muss ausrücken? Antworten auf solche Fragen erhofft sich der öffentliche Sektor auf Basis von anonymisierten fahrzeuggenerierten Daten, die so Verkehrsteilnehmer:innen und Entscheider:innen über intelligente Systeme zur Verfügung gestellt werden, um damit den Verkehrsfluss zu optimieren, die Sicherheit zu erhöhen und die Umwelt zu schonen.
Die Herausforderungen im Umgang mit diesen Daten sind vielfältig und anspruchsvoll – technisch, organisatorisch und rechtlich. Kunden und Partner können sich jedoch darauf verlassen, dass dem Datenschutz in Mercedes-Benz-Fahrzeugen ein hoher Stellenwert zukommt. Schließlich ist der sichere und verantwortungsvolle Umgang mit Daten die Basis für die Akzeptanz des vernetzten Fahrens.
Januar 2020, Breda. Niederlande: Kick-off des Projekts Road Monitor, welches sich über zwei Jahre erstreckt und alle Provinzen der Niederlande mit einem Straßennetz von mehr als 130.000 km umfasst.
Ziel ist die partnerschaftliche Entwicklung von hochwertigen und einfach zu nutzenden Informationen auf Basis von Mercedes-Benz-Fahrzeugdaten in den Bereichen: Wintermanagement, Straßenzustandsanalyse und Verkehrssicherheit. Dabei immer im Mittelpunkt: der Endnutzer. Wie können die Daten und daraus gewonnene Informationen in den Arbeitsalltag der Nutzer:innen eingebunden werden, um so Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung zu geben?
Die Basis bilden anonymisierte Daten aus dem Mercedes me connect-Dienst Car-to-X Communication und weitere Daten, die mit ausdrücklicher Einwilligung der Kunden für den Zweck der Optimierung von Mobilität und Infrastruktur im Feld gesammelt werden. Es fließen Daten aus Systemen wie Radar, UltraschallSensor und Fahrwerk aus intelligenten, vernetzten MercedesBenz-Fahrzeugen mit ein.
Die optimale Nutzung der verfügbaren Daten und Kenntnisse fördert die Effizienz und damit die Nachhaltigkeit der Verkehrssysteme im gesamten Straßennetz. Anonymisierte Fahrzeugdaten von Mercedes-Benz liefern dabei die wertvolle Grundlage, um digitale Lösungen für Herausforderungen im Straßenverkehr zu entwickeln.
Kritische Verkehrssituationen, vereiste Straßen und Schlaglöcher – mehr Sicherheit durch intelligente Datennutzung Im ersten der drei Bereiche des Programms, der Verkehrssicherheit, nimmt Mercedes-Benz mit seinen passiven und aktiven Sicherheitssystemen seit Jahrzehnten eine führende Rolle ein. Bis zu 45 verschiedene hochmoderne Fahrerassistenzsysteme – sogenannte „Advanced Driver Assistance Systems“: Basierend auf den anonymisierten Informationen berechnet der Road-SafetyAlgorithmus von Mercedes-Benz ein Risikomodell und zeigt besonders gefährliche Stellen auf den Straßen an. Die Road-SafetyHotspots liefern detaillierte Informationen wie z.B. eine Beschreibung der Situation, Verteilung über Tageszeiten der Eingriffe und Abgleich der Stellen mit historischen Unfällen. Das jeweilige Assistenzsystem erlaubt dabei auch einen Rückschluss darauf, ob es sich beispielsweise um einen Hotspot mit Fußgänger- oder Radfahrerrelevanz handelt. Diese Informationen helfen, Erkenntnisse über kritische Situationen im Verkehr zu gewinnen, die mit herkömmlichen Daten nicht erfasst werden können. Sie helfen proaktiv dabei, Unfälle zu vermeiden.
Im Bereich Wintermanagement führt Mercedes-Benz anonymisierte Car-to-X-Daten mit Informationen aus externen Quellen zusammen – beispielsweise von Wetterstationen der Straßenbehörden. So lassen sich ungünstige Straßenverhältnisse in Echtzeit er-
kennen. Stellen die Sensoren für ESP® oder ABS etwa eine geringe Haftung auf der Straße fest, werden die Daten inklusive der GPSPosition über das Mobilfunknetz an die Mercedes-Benz-Cloud gesendet und dort anonymisiert. Nach der Verarbeitung können die Informationen dann in digitalen Karten und Dashboards in den Straßenmeistereien angezeigt werden. So ermöglichen sie einen schnellen und effektiven Einsatz der erforderlichen Ressourcen. Diese erprobte Früherkennung von Risiken verbessert die Verkehrssicherheit und kann durch den gezielten und bedarfsgerechten Einsatz von Streumitteln zur Schonung der Umwelt beitragen.

Bei der Straßenzustandsanalyse ermöglicht Mercedes-Benz eine prädiktive Wartung und Instandsetzung der Straßeninfrastruktur und setzt damit neue Standards. So werden im Rahmen des Road Monitor-Programms Beschädigungen in der Verkehrsinfrastruktur auf Basis von Fahrzeugdaten wie Lenkwinkel und Raddrehzahl ermittelt. Durch die frühzeitige Erkennung von Schlaglöchern und anderen Oberflächenschäden wird die Effizienz der Instandhaltungsarbeiten erhöht und die Sicherheit verbessert. Bei Schlaglöchern oder Unebenheiten lässt sich anhand der Daten nicht nur erkennen, wo die Schäden bestehen, sondern auch wie stark sie sind und wie sie sich entwickeln. Diese Informationen sind für die Behörden bei der Ressourcenplanung und -priorisierung für die Instandhaltung enorm wertvoll.
Datenschutz dank anonymisierter Daten – Der Kunde entscheidet über seine Daten
Der verantwortungsvolle Umgang mit Daten und ihr Schutz haben bei Mercedes-Benz einen hohen Stellenwert. Bei solchen datenbasierten Mobilitätsinitiativen des Unternehmens, einschließlich des Road Monitor-Programms in den Niederlanden, werden die Daten anonymisiert, das heißt, Daten lassen sich nicht auf einzelne Fahrzeuge zurückführen. Außerdem können sie nur übermittelt und genutzt werden, wenn es eine Einwilligung durch den Fahrzeughalter gibt.
ist Leiter Produktportfolio Urban Mobility bei der Mercedes-Benz Group AG. Er ist mit seinem Team verantwortlich für alle Daten- und Fahrzeugprodukte im Kontext Urban Mobility. Die Abteilung Urban Mobility Solutions bei der Mercedes-Benz Group AG wurde ins Leben gerufen, um Städte mit sicheren, nachhaltigen, effizienten und barrierefreien Mobilitätsprodukten lebenswerter zu machen.
PERSPEKTIVEN 75
PATRICK BLUME
Die Gründer:innen von Plan4Better: Ulrike Jehle, Majk Shkurti und Elias Pajares (v.l.).

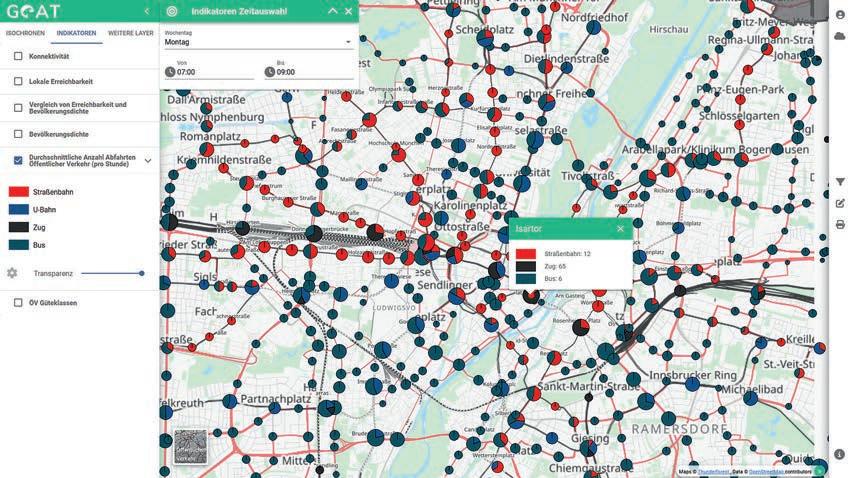

76 FUTURE HEROES
© Plan4Better GmbH (2)
© Cindy Ngo
Hexagonale Heatmaps zeigen die Erreichbarkeit an, hier für Bikesharing-Stationen in München.
ÖPNV-Abfahrtshäufigkeiten in GOAT
Alles in Reichweite?
Erreichbarkeit mit Daten sichtbar machen
Mobilität ist ein abstrakter Begriff, der sich mitunter schwer anschaulich darstellen lässt. Etwas greifbarer für Planer:innen ist daher die Erreichbarkeit. Mit der Zunahme verfügbarer Daten wird immer besser erkennbar, wo die Versorgung gut ist und wo die Wege weit sind. Plan4Better, eine Ausgründung aus der TU München (TUM), entwickelt eine Planungssoftware, die Erreichbarkeiten in Städten einfach darstellbar machen und so nachhaltige Mobilität fördern soll.
Egal, ob Arbeit, ein Besuch im Krankenhaus oder das Treffen in der Kneipe: Der Weg ist oft Mittel zum Zweck. Wie sich dieser Weg gestaltet, bestimmen persönliche Präferenzen, aber auch eigene Voraussetzungen wie etwa der Besitz eines Führerscheins.
Entscheidend bei der Wahl des Verkehrsmittels: die Infrastruktur. Sie beeinflusst, wie schnell und mit welchen Mitteln Ziele zu erreichen sind. Mit dem Indikator der Erreichbarkeit lässt sich Infrastruktur verkehrsplanerisch bewerten, gerade auch vor dem Hintergrund individueller Voraussetzungen. Sie drückt aus, wie gut eine Gegend erschlossen ist: Wo befinden sich Supermärkte in Laufweite? Wo wird ein Auto benötigt? „Durch den Erreichbarkeitsansatz sieht man sehr schön, wo Verbesserungen ansetzen können“, fasst Ulrike Jehle zusammen, Co-Geschäftsführerin von Plan4Better
Von der Masterarbeit zum Start-up
Mit ihrem Team entwickelt Jehle ein Tool, das solche Fragen beantworten soll: das Geo Open Accessibility Tool, kurz: GOAT
Das Web-Portal bündelt mobilitätsrelevante Geodaten aus mehreren Quellen und stellt einfache Analysetools bereit: Mit Heatmaps, Isochronen und Indikatorenauswertungen wird deutlich, welche Gebiete in einer Stadt wie gut für jeweils verschiedene Bedürfnisse versorgt sind.
Der erste Prototyp entstand in einer Masterarbeit von Elias Pajares. Als er anschließend an der TUM arbeitete, erhielt die Idee eine Förderung aus der mFUND-Initiative des Bundesverkehrsministeriums. So konnten er, Majk Shkurti und Ulrike Jehle in
Vollzeit an der Weiterentwicklung arbeiten, wie Jehle berichtet. „Gegen Ende des Projekts haben wir so gutes Feedback von unseren Projektpartner:innen, den Städten Fürstenfeldbruck, Freising und München, bekommen, dass wir uns entschlossen haben, ein Start-up zu gründen. So können wir das, was wir in der Forschung entwickelt haben, jetzt in die Planungspraxis bringen.“ Pajares und Jehle bilden nun die Geschäftsführung der Plan4Better GmbH, die mittlerweile elf Menschen beschäftigt. In einem Konsortium, bei dem auch wieder die TUM und das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung dabei sind, erhielt GOAT 2021 eine Folgeförderung, mit der das Tool den nächsten Entwicklungsschritt nehmen soll.
Visuelles Arbeiten mit Erreichbarkeitsanalysen
GOAT soll vor allem als Hilfe für Kommunen und Planungsbüros dienen: „Ein großes Ziel mit GOAT ist es, Erreichbarkeitsanalysen zugänglich zu machen, auch ohne ein Studium in GIS (Geoinformationssysteme, Anmerkung der Redaktion).“ Das Tool kombiniert dafür Daten aus verschiedenen Quellen: Aus OpenStreetMap, Bevölkerungsstatistiken, Fahrplandaten und weiteren Quellen setzt sich so ein Gesamtbild zusammen. Je mehr verfügbar ist, desto besser. Das Tool selbst wird von Anfang an als Open Source entwickelt, sodass es für alle zur Verfügung steht, die sich eine eigene Version installieren wollen. Die Entwicklung ist auf Deutschland fokussiert, aber das Prinzip ist übertragbar: Laut Jehle sei es gelungen, relativ schnell eine Version für die belgische Stadt Gent anzubieten, die der Version für München „in nichts nachsteht“ – dank guter öffentlicher Geodaten.
Mit GOAT kann aber nicht nur der Status quo untersucht werden, sondern auch Szenarien für mögliche Veränderungen: Welchen Effekt hat eine Fußverkehrsbrücke? Wie gut ist ein neues Wohngebiet versorgt? Wer will, kann den Effekt in Szenarien ausprobieren, aber auch eigene Punktdatensätze hochladen und in die Auswertung einbeziehen. Neben verschiedenen grafischen Darstellungen wie Heatmaps und Isochronen können viele der Ergebnisse auch wieder exportiert werden. Für die hexagonalen Heatmaps arbeite man aber noch daran: GOAT ist funktionsfähig, aber neue Ideen gibt es immer. Verbesserungen sollen etwa bei der Abbildung intermodaler Reiseketten oder der Integration der Freiraumplanung erfolgen. Außerdem steht die 15-Minuten-Stadt im Fokus, in der alle wichtigen Ziele nie weiter als eine Viertelstunde Fußweg (oder Radstrecke) entfernt sind: Ziel von Plan4Better ist es, in einem aggregierten Indexwert zeigen zu können, wie gut dieses Prinzip in einer Stadt bereits verwirklicht ist und in welcher Kategorie es Stärken und Schwächen gibt.
Das Tool Map4Citizens, ebenfalls von Plan4Better, fragt persönliche Bedürfnisse ab und zeigt so individuelle Erreichbarkeiten am Beispiel der Stadt München auf. Dass besonders individuelle und gesellschaftliche Bedürfnisse Einfluss auf die Mobilität und damit auch die Erreichbarkeit haben, zeigen Forschungen an der TU Berlin zur Mobilitätsplanung und an einem Mobilitätsindex.
Mit besseren Modellen und differenzierterem Verständnis von Mobilität wandelt sich die Erreichbarkeit von einem unbestimmten Gefühl zu einem quantifizierbaren Wert.


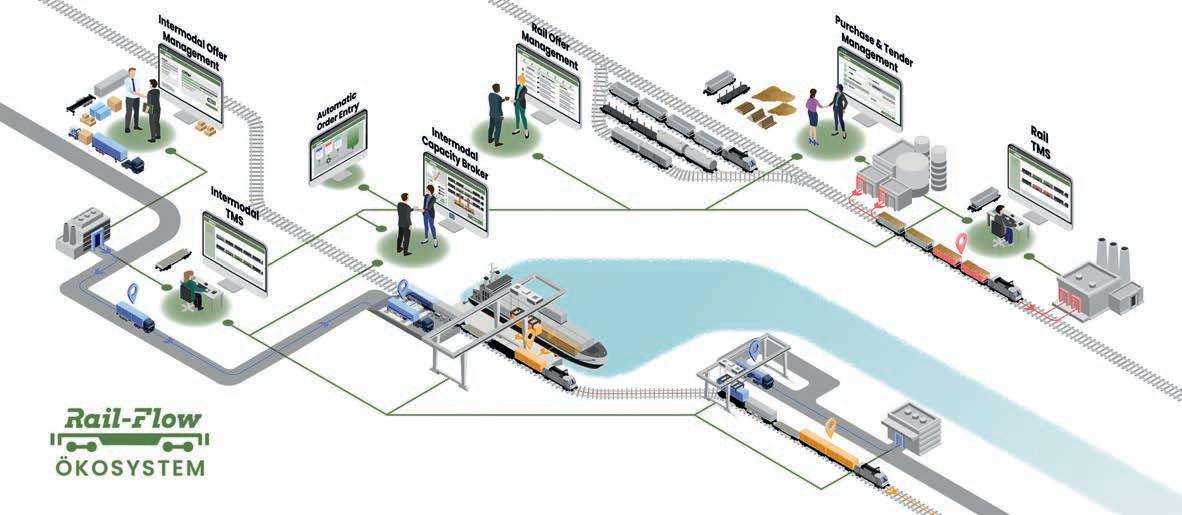
© Rail-Flow (3)
Die einzelnen Module des Rail-Flow-Ökosystems
Die Zukunft des Güterverkehrs gehört der Schiene, davon ist man bei Rail-Flow überzeugt, weil es nicht nur schneller, sondern auch klimaschonender sei.
Das Rail-Flow-Team um Dominik Fürste (untere Reihe, 3.v.r.)
Alles im Rail-Flow
Digitale Transformation auf der Schiene
Was bislang nur für den Straßengüterverkehr galt, ist durch Rail-Flow auch für den Schienengüterverkehr Realität geworden: Mit seinem digitalen Ökosystem bietet das Frankfurter Unternehmen die Möglichkeit, Anfragen und Angebote per Mausklick zu erstellen – und krempelt die Branche damit ordentlich um.
Angebotserstellung für den Schienengüterverkehr – für den Logistik-Dienstleister RheinCargo bedeutete das bis Ende der 2010er-Jahre noch Kundenkontakt per EMail und manuelles Abtippen von ExcelListen. Bisherige IT-Lösungen im Bereich logistischer Buchungssysteme bildeten immer nur einen Ausschnitt der Transportkette ab; Friktionen zwischen den einzelnen Systemen führten zu Folgefehlern wie Zugverspätungen oder gar kompletten Ausfällen. Mit Rail-Flow als Partner läuft der Vertrieb nun vollständig digital ab. Transportanfragen gehen über eine Plattform ein, und mit dem „Automatic Order Entry“, einem der vielfältig kombinierbaren Module des Rail-Flow-Ökosystems, lassen sich Dateien einlesen und via Algorithmus vervollständigen: Eines von zahlreichen Beispielen, wie der Vertrieb und die Abwicklung durch das Ökosystem effizienter gestaltet werden konnten.
„Dafür bleibt dann für die Mitarbeiter mehr Zeit im persönlichen Kundenkontakt übrig“, erklärt Dominik Fürste, Gründer und Geschäftsführer des in Frankfurt/ Main ansässigen Unternehmens Rail-Flow. Während seines Forschungssemesters im Department of Civil and Environmental Engineering am Massachusetts Institute of Technology (MIT) inspirierte vor allem das amerikanische Güterbahnsystem Dominik Fürste. Zurück in Deutschland und bei der DB Cargo tätig, wurde dem Unternehmer die Schwerfälligkeit und Ineffizienz des europäischen Schienengüterverkehrs aus Sicht der Kund:innen deutlich: So gab es bis dato nur vereinzelte IT-Lösungen, aber keinen vollumfassenden Marktplatz.
IT als Ausgangspunkt der Güterverkehrstransformation
Im Sommer 2020 gestartet, füllt Rail-Flow genau diese Lücke – via Cloud-basierter Plattform, mit der das Transportmanagement für alle Beteiligten der Wertschöpfungskette – wie Spediteure, Eisenbahnen und Verlader – effizient organisiert werden kann. An den digitalen Marktplatz von Rail-Flow sind mittlerweile fast alle Eisenbahnverkehrsunternehmen in Europa auf der Anbieterseite angedockt. Fürste illustriert den Ablauf an einem Beispiel: So könne ein Verlader Verkehrsanfragen einstellen und die genauen Bedarfe festlegen, also dass beispielsweise wöchentlich am Montag um 9:00 Uhr ein Zug benötigt wird. Dabei bietet die dahinterliegende APEXTechnologie von Oracle die Möglichkeit, an Schnittstellen die Daten in eigene Systeme zu speisen. Rail-Flow selbst versteht sich als neutrale Plattform und nicht als Marktteilnehmer – das Unternehmen stellt die Plattform, auf der Partner:innen Geschäfte abwickeln können und greift nicht in die Preisbildung ein.
Das Projekt „Facilitating Intermodal Transport“ (FIT) zielt auf eine vereinfachte Buchung intermodaler Transporte ab und wird im Rahmen des EU-Programmes „LIFE“, einem Finanzierungsinstrument der EU für Umwelt und Klimapolitik, gefördert. Spediteure können via digitalem Einstiegsportal den Transport eines Trailers auf der Schiene buchen. Mit dem „Intermodal Capacity Broker“ steht Operateuren ein Vertriebskanal zur Verfügung, mit dem freie Kapazitäten angegeben werden können. Auf der anderen Seite besteht für Spediteure die Möglichkeit, auch LkwTransporteure für die erste und letzte Meile zu beauftragen. Ein Algorithmus sucht
dabei nach dem besten Schienenhauptlauf – sprich der optimalen Verbindung zwischen zwei Terminals – und sortiert die Vorschläge zudem noch nach Preis, Transportdauer und Umweltfreundlichkeit. Zusätzlich wird auch der CO2-Fußabdruck der Strecke kalkuliert. Nach der Buchung des Transports folgt der Transportstart; dabei ist der jeweils letzte Standort des Trailers jederzeit online einsehbar.
RheinCargo ist nur ein Bestandteil des mittlerweile über 350 Kunden umfassenden Netzwerks. Rund 80 Rail-Flow-Mitarbeiter:innen arbeiten an der intelligenten Verknüpfung von Straße und Schiene. Während diese schon jetzt von verschiedenen europäischen Städten aus arbeiten, hat Rail-Flow nicht weniger als den Anspruch, der führende Road-Rail-Integrator Europas zu werden und auch im Ausland mehr Vertriebsniederlassungen zu eröffnen.
Rail-Flow betritt die Bühne des Schienengüterverkehrs zu einem Zeitpunkt, der nicht hätte passender sein können. Der durch den Ukraine-Krieg verschärfte Mangel an Lkw-Fahrer:innen sowie ehrgeizige CO2-Zielsetzungen in der Speditionsbranche fordern einen Kurswechsel im Güterverkehr. Mit dem „digitalen Ökosystem“ von Rail-Flow soll der Umstieg auf die umweltfreundlichere Schiene um einiges attraktiver werden.
FUTURE HEROES 79
PREISGEKRONTES PLANEN FUR DIE FUSSE
Der Interessenverband FUSS e.V. hat Ende Januar in Berlin erstmals den „Kommunalen Fußverkehrspreis Deutschland“ verliehen und damit Gemeinden ausgezeichnet, die sich besonders für den Fußverkehr einsetzen. Gewonnen haben Kiel und Pleidelsheim, ein Sonderpreis ging nach Berlin. Vorbildlich fand der FUSS e.V. bei allen Einreichungen, dass sie Verbesserungen für den Fußverkehr systematisch und langfristig planten und umsetzten, und dabei Bürger:innen gezielt einbezogen. Sie seien außerdem allesamt wirksam und übertragbar. Kiel bekam den Preis für sein langjähriges, großflächiges und partizipatives Konzept der Fußwegeachsen und Kinderwege. Vorbildhaft umgesetzt wurde das seit 2018 im Ortsteil Ellerbek/Wellingdorf: Dort baute die Stadt etwa eine ganze Straße zum verkehrsberuhigten „Kinderweg“ mit bespielbaren Elementen um, eine ungeliebte Verkehrsinsel wurde, zunächst temporär und bald permanent, zur grünen Aufenthaltsfläche. Aber auch zahlreiche kleinere Umbauten wie barrierefreie Querungshilfen gehörten zum Konzept. In Pleidelsheim, einer Gemeinde im Landkreis Ludwigsburg, würdigte die Jury den gesamtplanerischen Ansatz. Hier hat sich eine kleine aktive Arbeitsgruppe von Bürger:innen gebildet, die Probleme im Fuß- und Radverkehr in der Gemeinde untersucht und Lösungen umsetzt, teilweise in Zusammenarbeit mit der Verwaltung. So erarbeiteten die Pleidelsheimer:innen etwa neue Fuß-Hauptrouten für die Anbindung aller Viertel ans Zentrum, die auch als Schulwege festgelegt wurden. Entlang dieser Routen bekommt der Fußverkehr mehr Raum: begrenztes Parken, Heckenrückschnitt, ausgebesserte Stolperfallen. Außerdem sollen die Querungen verbessert und die Wege mit bunten Fußstapfen markiert werden. In Berlin wurde ein Programm ausgezeichnet, bei dem die Senatsverwaltung inzwischen 65 Parklets für Nachbarschaftsinitiativen gefördert hat.
POSITIVES VERKEHRSGUTACHTEN FUR DORTMUNDER HANGEBAHN


Die H-Bahn-Gesellschaft Dortmund (HBahn21) verkündete im Januar, dass die standardisierte Bewertung zwei geplanten Neubaustrecken der Dortmunder Hängebahn ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis bescheinigt. Konkret geht es dabei um eine Verlängerung des bestehenden Netzes an der Uni in Richtung des Studierendenwohnheims Ortsmühle, die weiter bis zur Stadtbahn in Barop geführt werden soll. Das andere Teilprojekt ist eine neue Linie vom Dorstfelder S-Bahnhof zum Stadtentwicklungsprojekt „Smart Rhino“, das auf einem alten Industrieareal entstehen soll. Hier soll in Zukunft der Hauptcampus der Fachhochschule Dortmund und eine Verknüpfung mit einer neuen Stadtbahnlinie entstehen. Noch weiter könnte die H-Bahn am Stadthafen entlang bis zum Fredenbaumpark geführt werden, womit durch weitere Umsteigepunkte zur Stadtbahn eine nordwestliche Tangentiallinie entsteht. Die Verkehrsuntersuchung wurde vom Land NRW gefördert und ist die Voraussetzung für weitere öffentliche Zuschüsse.
Die Hängebahn nach dem System SAFEGE verbindet seit 1984 automatisch und emissionsfrei die Campus der TU Dortmund. 1993 und 2003 wurde sie verlängert, ein weiterer Ausbau im Technologiepark ist beabsichtigt. Bei den jetzt untersuchten Projekten geht es auch um ein neues Automatisierungssystem, für das eine weitere Machbarkeitsstudie läuft. Für den Fahrzeugbau wird auch der Bau einer Teststrecke notwendig sein, z.B. in Form der Anbindung des Wohnheims. Mit der Inbetriebnahme beider Strecken wird frühestens 2030 gerechnet.
80 URBAN NEWS
©
Öko-logisch mobil in Pleidelsheim/oemip.de
© Jörg Schimmel/DSW21
Mehr Platz für den Fußverkehr: Die Baumringe wurden auf Initiative der Arbeitsgruppe halbiert.
Entwurf des neuen Fahrzeugmodells von HBahn21
Eine der geplanten Endhaltestellen am Rungholtplatz in Kiel-Suchsdorf. Die Rasengleise waren einer der entscheidenden Pluspunkte für die Tram.
KIEL ENTSCHEIDET SICH FUR EINE NEUE STRASSENBAHN
Seit dem 17. November 2022 stehen die Weichen in der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins Richtung Tram. Die dortige Ratsversammlung hat fast einstimmig beschlossen, ein völlig neues stadtweites Straßenbahnnetz aufzubauen, das bei Bedarf ins Umland verlängert werden kann. Am Trassenkonzept mit insgesamt 35,8 km Länge, drei Linien und einem Verstärker arbeitete das Büro Ramboll seit Oktober 2020. Zur Entscheidung stand, ob eine Straßenbahn oder ein Bus-Rapid-TransitSystem (BRT) mit Obussen gebaut werden sollte. Letztlich folgte man dem Gutachten, das die Tram als wirtschaftlicher einschätzte und die Förderung durch den Bund hervorhob. Gegen das BRT-System, das mit mehr und kleineren Fahrzeugen auch einen dichteren Takt ermöglicht hätte, sprach auch der größere Bedarf an versiegelten Flächen im Straßenraum. Impulse für die Planungen kamen aus den Masterplänen Mobilität und Klimaschutz, nach denen der Anteil des ÖPNV am Modal Split von bisher 10 % der Wege deutlich erhöht werden soll. Mit der Fertigstellung des ersten Streckenabschnitts wird frühestens 2033 gerechnet.

Insgesamt ist Kiel damit die erste Stadt seit Langem in Deutschland, die sich für ein neues Straßenbahnsystem entscheidet: Die 1997 eröffnete Regiotram im Saarland ist derzeit das jüngste Netz in Deutschland, zuletzt waren Planungen in Aachen 2013 und Wiesbaden 2020 durch Bürgerentscheide verhindert worden.
VAY GEHT AUF HAMBURGER JUNGFERNFAHRT
Das Berliner Start-up Vay hat europaweit das erste fahrerlose Auto auf öffentlichen Straßen in den Verkehr der Hansestadt gebracht, mit Telefahrer:innen im Hintergrund. Möglich wurde dies durch eine im Dezember 2022 erteilte Ausnahmegenehmigung der Hamburger Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) – zunächst für einen vordefinierten Testbereich in Hamburg-Bergedorf. Hinter dieser Neuheit steckt der Tele-Fahrdienst Vay, dessen E-Autos bereits seit drei Jahren auf den Straßen Berlins und Hamburgs unterwegs sind; bis dato allerdings nur mit Sicherheitsfahrer:in. Gesteuert werden die Fahrzeuge in einer Telefahrstation des Unternehmens. Erfolgt eine Buchung über die App, steuern die Telefahrer:innen von Vay das Fahrzeug bis zum angegebenen Standort. Die Kund:innen selbst fahren dann zu ihrem Fahrtziel; dort angekommen übernimmt erneut ein:e Telefahrer:in. Die im städtischen Raum oft so mühselige Parkplatzsuche soll dadurch wegfallen. Langfristig will Vay damit eine komfortable Alternative zum Pkw bieten, die sich an den gängigen Car-Sharing-Preisen orientiert. Auch eine Integration in den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) ist vorgesehen.

URBAN NEWS 81
© Vay
© Landeshauptstadt Kiel
Auf einer vordefinierten Route in Hamburg finden Testfahrten mit dem aus der Telefahrzentrale ferngesteuerten vollelektrischen Auto von Vay statt.
polisMOBILITY
Koelnmesse GmbH
Müller + Busmann GmbH & Co. KG
Schirmherrschaft
Deutscher Städtetag
Mit freundlicher Unterstützung von ACV Automobil-Club Verkehr e.V.
ACE Auto Club Europa e. V.
AGFS
AMEC
automotiveland.nrw
Bundesverband der Kurier-ExpressPost-Dienste (BdKEP)
Business France
Bundesanstalt für Straßenwesen (bast)
Bundesverband Zukunft Fahrrad e.V.
Bundesverband eMobilität (BEM)
Bündnis für Mobilität
cargobike.jetzt
CORDIT ION GmbH
Deutscher Städte- und Gemeindebund
EIT Urban Mobility
FIWARE Foundation
Handwerk.NRW
Handwerkskammer zu Köln
Hubject GmbH
Initiative Stadt.Land.Digital innocam.NRW
KölnBusiness
Wirtschaftsförderung-GmbH
Metropolregion-Rheinland e.V.
Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen
Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
NaKoMo
Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur
OCA Open Traffic Systems City Association e.V.
PSPA
RAI Automotive Industry NL
Secartys
Stadt.Land.Digital
Stadt Köln
Verband Deutscher
Verkehrsunternehmen e.V. (VDV)
Verband kommunaler
Unternehmen e.V. (VKU)
Women in Mobility
IMPRESSUM
Herausgeber
Prof. Dr. Johannes Busmann V.i.S.d.P.
Verlag Müller + Busmann GmbH & Co. KG Hofaue 63 | 42103 Wuppertal busmann@mueller-busmann.com Telefon (0202) 24836 - 0 Fax (0202) 24836 - 10
www.mueller-busmann.com www.polis-magazin.com
Besuchen Sie uns auf Social Media: / polismagazin / polis_magazin
Chefredaktion
Susanne Peick peick@polis-magazin.com
Stellv. Chefredaktion
Marie Sammet sammet@polis-magazin.com
Redaktionsleitung polisMOBILITY
Csilla Letay letay@polis-magazin.com
Redaktion
Maximilian Hossner hossner@polis-magazin.com
Jan Klein klein@polis-magazin.com
Michael Müller mueller@polis-magazin.com
David O’Neill oneill@polis-magazin.com
Marie Schwemin schwemin@polis-magazin.com
Autoren dieser Ausgabe
Patrick Blume
Daniel Boss
Dr. Mara Cole
Nils Jänig
Désirée Oberpichler
Martin Schmitz
Creative Director
Prof. Dr. Johannes Busmann
Art Direction
Ceren Bulut
Grafik
Manuela Baglio
Esra Güner
Cover
© 3deluxe
Bezugspreis
Einzelheft 15,00 Euro
Abo 4 Haupt- & 4 Sonderausgaben 96,00 Euro
Lektorat
Verlag Müller + Busmann GmbH & Co. KG
Anzeigen / Vertrieb redaktion@polis-magazin.com
Das Werk einschließlich aller seiner Texte ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© Verlag Müller + Busmann GmbH &
KG
Co.
20 2 3
26. - 27.
APRIL ’23 26. - 27. APRIL ’23







expo & conference Save datethe Köln | Cologne 24.–26.05.2023




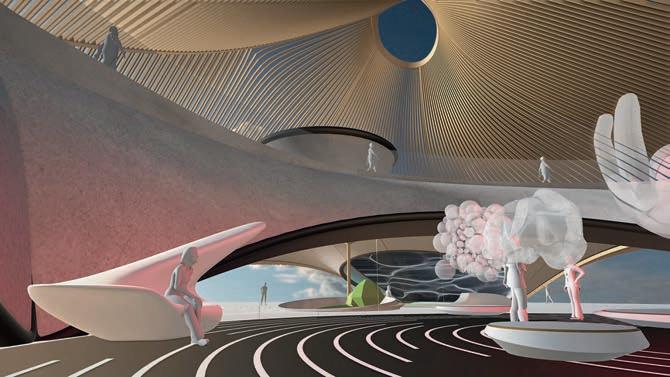
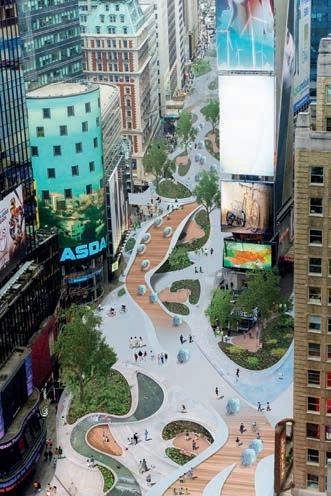





















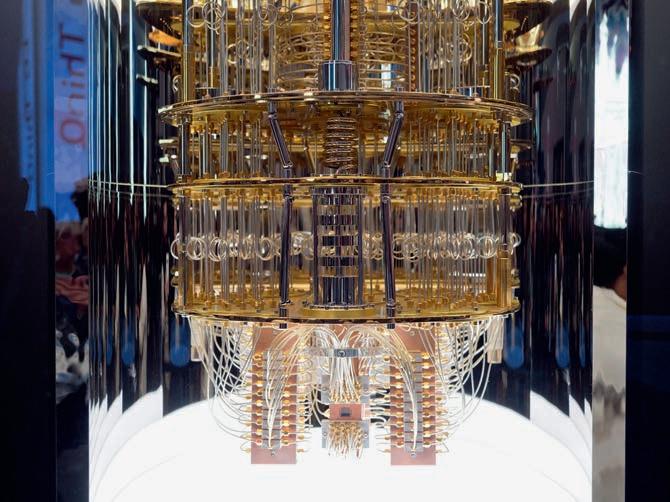















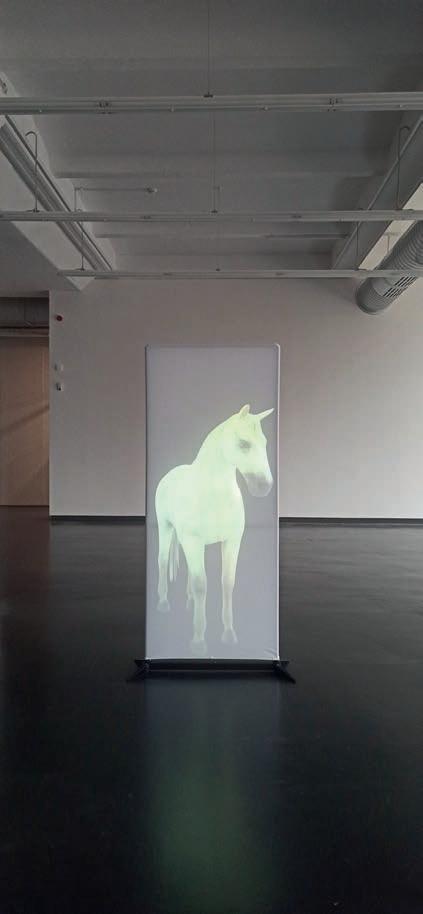




 © Sandra Henningsson/Gehl Architects
© Sandra Henningsson/Gehl Architects