TSANGARIS
Das Pizzicato Mysterium
für Streichorchester
Partitur








für Streichorchester
Partitur







(2015/2016) für Streichorchester
POD PETERS on demand
ALLE
LEIP ZI G L ONDO N NE W YOR K
Manos Tsangaris
DAS PIZZICATO MYSTERIUM für Streichorchester 2015/16
Kompositionsauftrag des Münchener Kammerorchesters
Künstlerischer Leiter Alexander Liebreich
Gefördert durch die Ernst von Siemens Musikstiftung
Dauer: ca. 15 Minuten
6.5.4.4.2 Schlagzeug (Pauken)
Zur Orchester-Erzählung:
Im Jahr 2012 berichtete mir ein Viola-Spieler in München ausführlich darüber, welche Schwierigkeiten, aber auch welche Geheimnisse das Tutti-Pizzicato-Unisono im Orchester normalerweise birgt. Ist es nicht etwas Außerordentliches, wenn so viele Geister sich in einem Ton treffen?
Die Grundfrage lautet, ob der Dirigent oder die Dirigentin hierbei von Nutzen oder hinderlich ist.
Denn den Ton überein bekommen müssen die Musiker ohnehin unter sich, als Gruppe. Wer hätte sich nicht schon gewundert über das zeitliche Intervall zwischen dem Abschlag eines Dirigenten und der verzögerten Reaktion des Orchesters?
Der Einsatz klebt eben nicht an der Spitze des Dirigierstabs, sondern ist der beinahe schon telepathischen Verbindung der Musizierenden untereinander geschuldet.
Aber auch unabhängig von den Legenden, die sich hier herum lagern, der Hör-Eindruck im Publikum ist, wenn das Tutti-Pizzicato gelingt, homogen, und das trotz der immensen Laufzeit-Verschiebungen des Schalls. Theoretisch müssten die Musiker, die weiter hinten sitzen, deutlich vor den anderen spielen, um die Laufzeit-Differenz auszugleichen. (15 m auf der Bühne ergeben schon ca. 50 Millisekunden - und die hört man!)
Wie macht so ein Klangkörper das? Wie verständigen sich alle untereinander?
It’s magic!
Synopse der äußeren Handlung: I
Das Orchester hat auf der Bühne Platz genommen und seine Instrumente gestimmt.
Kurzes Innehalten.
Der Dirigent betritt das Podium. Applaus.
Nach Erreichen der Dirigierposition dreht er sich kurz zum Publikum und deutet eine Verbeugung an. Dann richtet er sich wieder auf, bleibt überraschenderweise aber stehen in Richtung Publikum.
Er steht aufrecht, ruhig, wie ein Bekennender, der „Gesicht zeigt“, der für etwas einsteht
Erst nach einer Weile (Takt 8) dreht er sich zum Orchester um.
Ab Takt 21 dirigiert er dann.
Gegen Ende des ersten Satzes, während der doppelten Wiederholungen ab Takt 42, erhebt sich eine Musikerin oder ein Musiker aus der zweiten Violin-Gruppe reichlich unvermittelt, aber ganz ruhig, als wolle sie oder er unterbrechen, und bleibt in Richtung Auditorium stehen, schaut unverwandt ins Publikum, während die anderen nach und nach innerhalb der Wiederholungstake individuell aufhören zu spielen. Die Musik „läp-
pert hier aus“. Große Pause, während die/der Musiker/in immer noch wie entblößt zwischen den anderen stehenbleibt, die eventuell zu ihm hinschauen oder nicht.
Dann, nach der großen Pause, setzt diese/r Musiker/in wieder an mit einem halb geräuschhaften eigentümlich kratzenden Ton auf der G-Saite des Instruments.
Der Konzertmeister oder Konzertmeisterin beginnt erneut ab Takt 46 wieder ohne Einsatz des Dirigenten.
(Der seinerseits wartet einfach ruhig ab, was geschieht, ab Takt 55 setzt er dann wieder ein und übernimmt.)
Ab Takt 106 hören nach und nach wiederum alle Musiker_innen auf zu spielen (individuelles Timing!) und drehen ihr Gesicht schweigend in Richtung Publikum bis schließlich nur der Schlagzeuger allein übrigbleibt, der sich an die geheime Regel (aufzuhören) offensichtlich nicht halten will.
Nach einer Weile wird es dem Konzertmeister (der Konzertmeisterin) zu bunt, er (sie) erhebt sich, wendet sich dem Schlagzeug zu, wartet … Stopp.
Dann kann es weitergehen.
Neueinsatz durch den/die Konzertmeister/in bei Takt 117 zu Takt 118 tutti divisi (pultweise geordnet):
III
Hier übernimmt der Dirigent bei Takt 123 wieder die Leitung des Orchesters. Ab Takt 202 beginnt das Bühnenlicht zu „schwanken“, die linke und rechte Seite werden leicht, zunächst fast unmerklich gegeneinander verschoben in kleinen Diminuendi resp. Crescendi. Diese Schwankungen nehmen von Mal zu Mal zu.
Schließlich ein gemeinsames Cresendo der beiden (untereinander jetzt ausgeglichenen) Bühnenseiten, das in ein großes Diminuendo umschwenkt. Fade-out bis ins BLACK.
Koda: (IV)
Jede/r Musizierende/r bedient zwei kleine LED-Handlampen (LED-Taschenlampen).
1.
Taschenlampe in Richtung Publikum (niemanden direkt blenden!), individuell einschalten, nach ca. 6 Sekunden den Lichtstrahl „ ltern“, d.h. z. B. mit den Fingern modi zieren (etwas „abblenden“), dann die Richtung leicht ändern (ca. 15°) und nach ca. 3 Sekunden wieder ausschalten.
2.
Mit der LED-Taschenlampe (ON!) ein Pizzicato Glissando zwischen zwei Saiten ausführen (quasi bottleneck), individuell ein und nach ca. 6 Sekunden wieder aus.
3. Ins eigene Gesicht leuchten, abwarten, Richtung ändern (ins Off!) und aus.
4.
Der Dirigent, jetzt wieder in Richtung Publikum stehend, beleuchtet mit zwei LED-Handlampen sein Gesicht. Fermate (5.). BLACK.
Lichtfunktionen:
Wenn möglich, sollen ab Takt 202 die beiden Bühnenhälften (L und R) gegeneinander im Licht „gewogen“ werden, d.h. es gibt kleine dynamische Verschiebungen, zunächst nur als Irritation, als schwankte die Stromstärke, dann in etwas deutlicheren CrescendiDiminuendi, erst der beiden Bühnenhälften gegeneinander, dann parallel miteinander im leichten Fade-in, anschließende im langsamen und vollständigen Fade-out ins BLACK.
Falls keinerlei adäquate Licht-Technik vorhanden sein sollte, ist der Aufführung schon geholfen, wenn bei Takt 238 (Beginn der Koda) das Bühnen- und Saallicht einfach ausgeschaltet wird.
Im allergrößten Notfall bliebe das Licht einfach an, und nur Nr. 2 und Nr. 4 der Koda würden ausgeführt.
Text am Ende (der nur gedacht werden darf, aber niemals gesprochen wird!):
Der Dirigent, das ist der Stellvertreter des universalen Geistes, Agent, Mittler, Entscheider, Medium fürs Medium, bleibt stumm.
Den Dirigenten … …spielen immer die andern.
Vielleicht fühlt er sich heute nicht ganz wohl. Sieht blass aus. Sind seine Tempi etwas langsamer als sonst?
Den Dirigenten … …spielen immer die andern.
***
Das ist die Laus, die über seine Leber läuft.
Wieso denn die Leber?
Reizung, Paroxysmen, aufgespanntes Ich.
Oder: beschwingt und gut belichtet.
Den Dirigenten … …spielen immer die andern.
Zur Darstellungsweise:
Wenn jemand stehenbleibt (Dirigentin) oder aufsteht (Musikerin) oder sich umwendet und ins Publikum schaut, so ist dies immer so direkt und einfach wie möglich auszuführen.
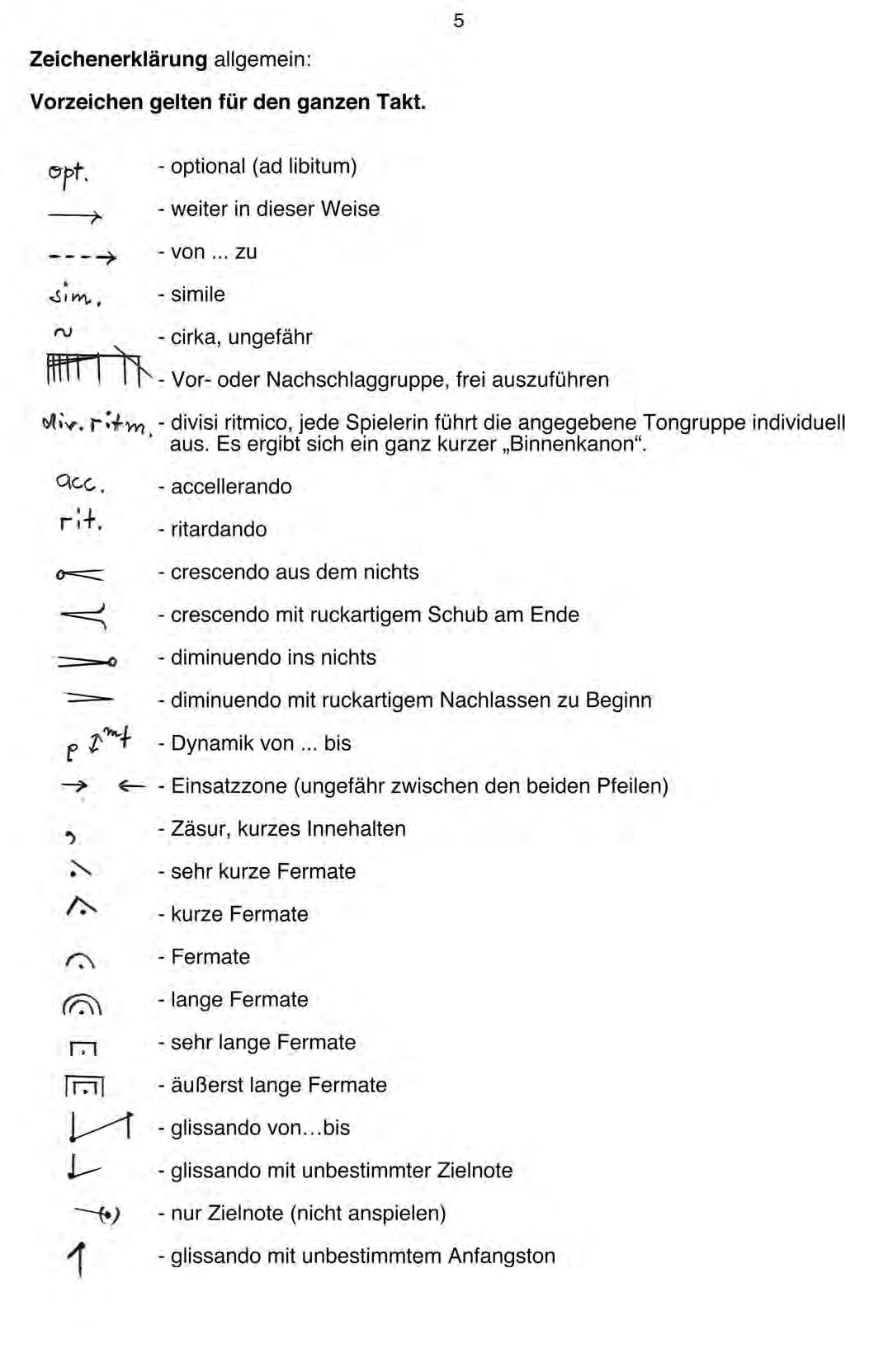
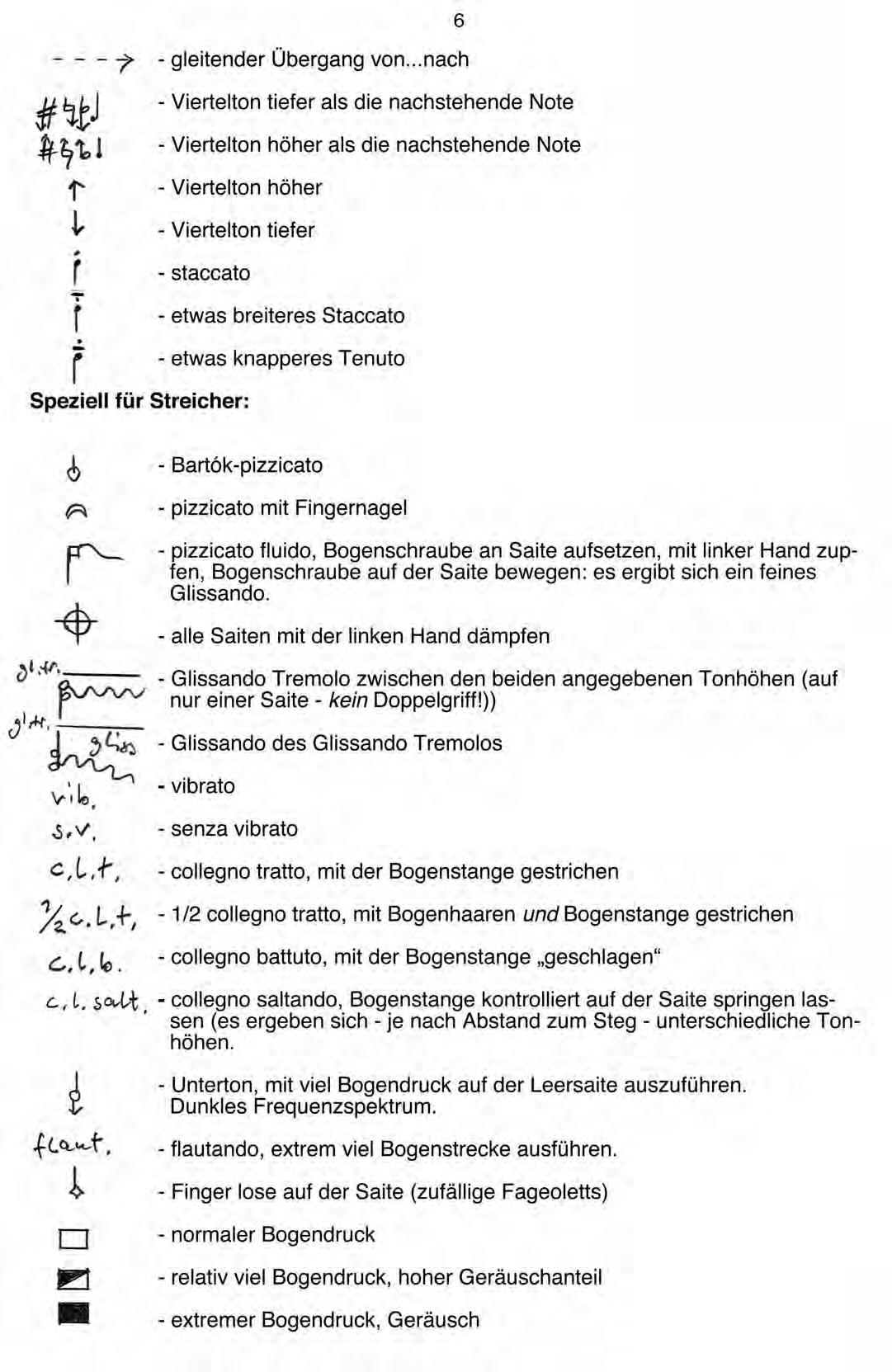

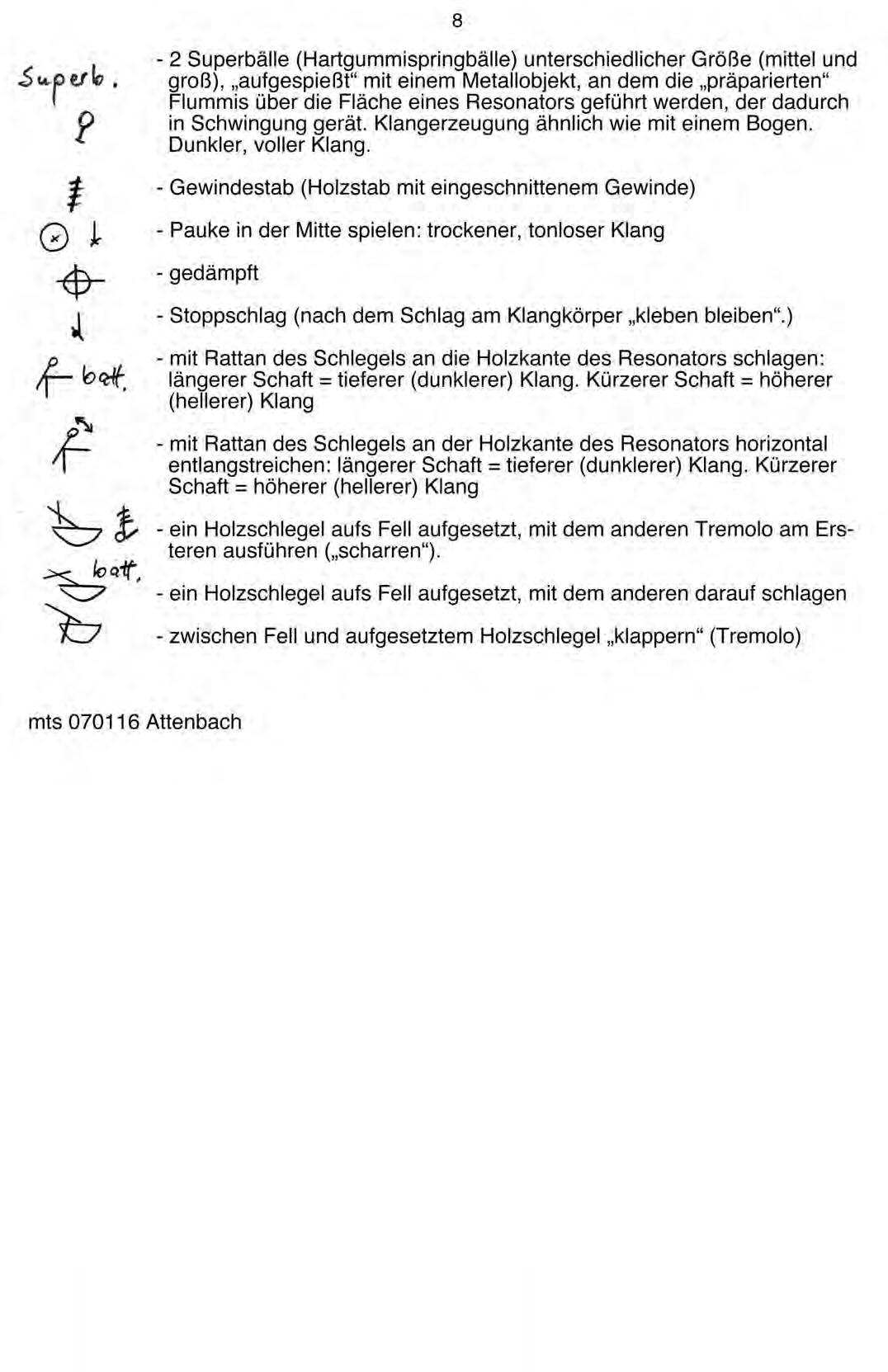






For more than 200 years, Edition Peters has been synonymous with excellence in classical music publishing. Established in 1800 with the keyboard works of J. S. Bach, by 1802 the company had acquired Beethoven’s First Symphony. In the years following, an active publishing policy enabled the company to expand its catalogue with new works by composers such as Brahms, Grieg and Liszt, followed in the twentieth century by Richard Strauss, Arnold Schoenberg and John Cage.
Today, with its offices in Leipzig, London and New York publishing the work of living composers from around the world, Edition Peters maintains its role as a champion of new music. At the same time, the company’s historic and educational catalogues continue to be developed with award-winning critical and pedagogical editions.
Seit über 200 Jahren steht die Edition Peters für höchste Qualität im Bereich klassischer Notenausgaben. Gegründet im Jahr 1800, begann der Verlag seine Tätigkeit mit der Herausgabe von Bachs Musik für Tasteninstrumente. Schon 1802 kamen die Rechte an Beethovens erster Sinfonie hinzu. In der Folgezeit wuchs der Katalog um neue Werke von Komponisten wie Brahms, Grieg und Liszt sowie – im 20. Jahrhundert –Richard Strauss, Arnold Schönberg und John Cage. Als Verleger zahlreicher zeitgenössischer Komponisten aus aller Welt ist die Edition Peters mit ihren Standorten Leipzig, London und New York auch weiterhin Anwalt neuer Musik. Zugleich wird das Verlagsprogramm im klassischen wie im pädagogischen Bereich kontinuierlich durch vielfach preisgekrönte Ausgaben erweitert.