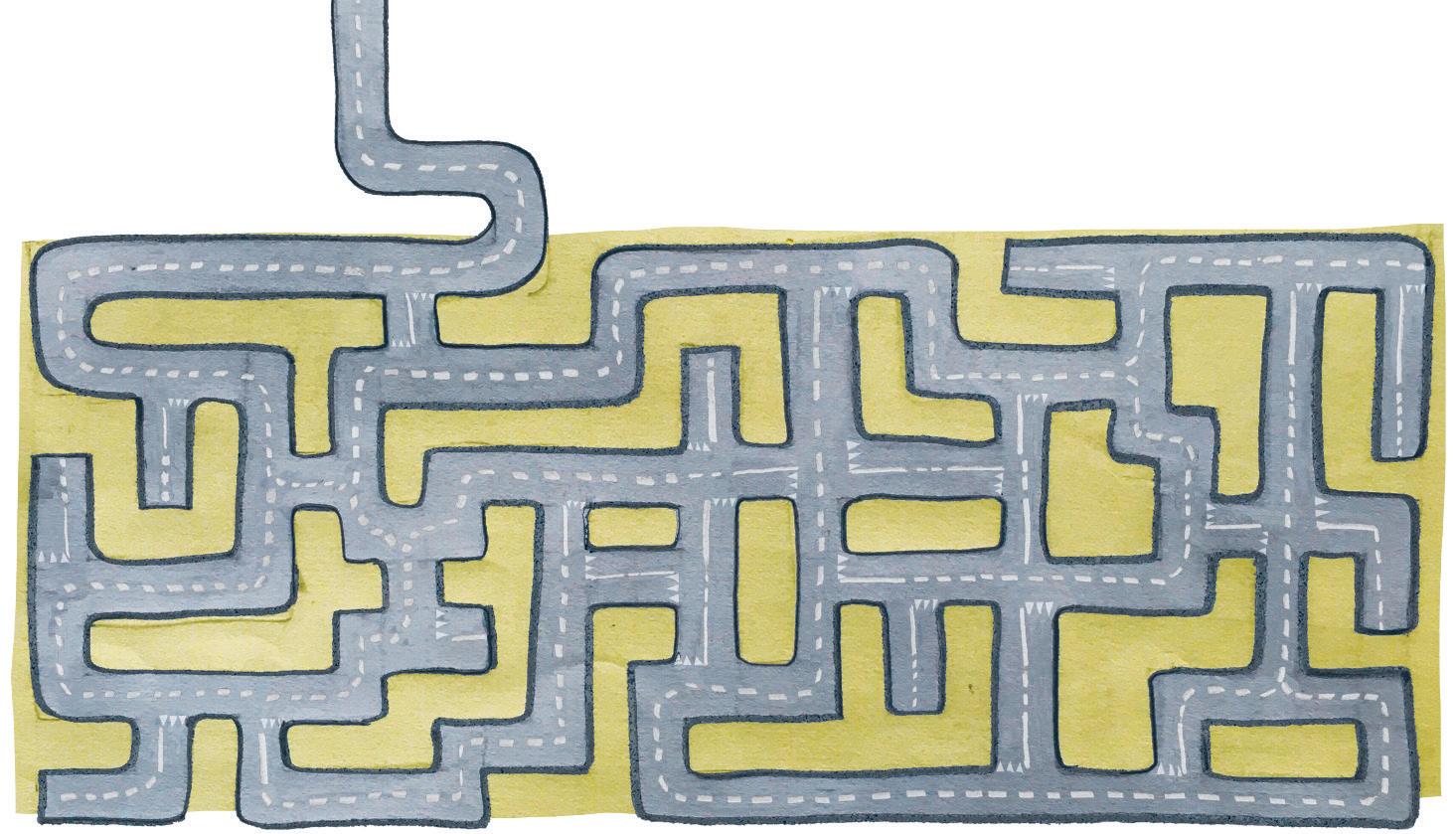
3 minute read
Vor Gericht
Unbezahlbar Die deutschen Tafeln fordern mehr Unterstützung durch die Politik, was die ehrenamtliche Arbeit be trifft. Im Moment liegt dieses Engagement bei den Tafeln bei rund zwanzig Millionen Stunden. Die Tafeln fordern nun kosten freie ÖV-Tickets für Ehrenamtliche. Darüber hinaus solle ehrenamtliches Engagement bei der Berechnung der Rente positiv ins Gewicht fallen. «Die Arbeit der Ehrenamtlichen ist für eine Gesellschaft unbezahlbar», sagt Jochen Brühl, Vorsitzender der Dachorganisation Tafel Deutschland. Würden die 60 000 Freiwilligen einen Mindestlohn erhalten, würde dies die Regierung 180 Millionen Euro kosten. Aktuell versorgen die Tafeln bundesweit 1,6 Millio nen Bedürftige.
ASPHALT, HANNOVER
Unangesehen
Neun von zehn Deutschen haben Angst davor, einmal im Alters heim leben zu müssen. Trotzdem werden immer mehr solche Einrichtungen gebaut. Gleichzeitig fehlt es an Pflegekräften. Mehr als 23000 Stellen sind in Deutschland nicht besetzt, rein rechnerisch kommen auf 100 offene Stellen 21 Bewerberinnen. Dabei liegt es nicht am Lohn. «Das Klischee vom schlecht bezahlten Job gilt für die Altenpflegerinnen und Altenpfleger schon lange nicht mehr», sagt Ina Schönwet ter-Cramer, Leiterin des KäteReichert-Heims im Nürnberger Stadtteil St. Johannis. Ihrer Ansicht nach geniesst der Pflegeberuf einfach zu wenig Ansehen. «Das muss sich dringend ändern.» Schon heute sind in Deutschland drei Millionen Menschen pflegebedürftig, rund eine Million lebt in Heimen.
STRASSENKREUZER, NÜRNBERG ILLUSTRATION: PRISKA WENGER
Vor Gericht Gugus! Dada!
Wenn er überhaupt Aussagen macht, nuschelt der Beschuldigte kaum verständlich vor sich hin. Er bestätigt, eine Bodenleger lehre angefangen und abgebrochen zu haben und dann auf Baustellen und im Service gejobbt zu haben. Jetzt arbeitet der 37-Jährige wieder als Bodenleger und wird vom Vater unterstützt. Ja, der Ex zahle er Kinderalimente, «manchmal». Nein, er wisse nicht, wie hoch seine Schulden sind.
Der vorsitzende Oberrichter verliest sein Strafregister. Seit 2006 ergingen zahlreiche Urteile in mehreren Kantonen. Wegen Diebstahl, Hehlerei, versuchter Nötigung, Schwarzarbeit, Unterlassung von Unterstützungspflichten und Strassenverkehrsdelikten. Heute geht es – zum sechsten Mal – um Fahren ohne Fahrausweis. Zwei Polizistinnen erwischten ihn, als er verbotenerweise links abbog. Sie fuhren ihm nach und beobachteten, wie der Mann auf der Fahrerseite ausstieg und ein Restaurant betrat. Der Beschuldigte bestreitet. Seine Freundin sei gefahren. Die Polizistinnen hätten ihn auf der Fahrerseite gesehen, weil sie ihr Handy im Auto vergessen hatte und er es holte. Sie hätten den Wagen kurz nicht gesehen, weil die Fahrt um die Ecke eines Gebäudes ging. Die Freundin bestätigte zunächst – widerrief aber und wurde wegen Irreführung der Rechtspflege verurteilt. Zu all dem will er nichts sagen. «Wirklich?», fragt der Richter. Schliesslich habe doch er Berufung eingelegt und einen Freispruch verlangt. Doch der Mann schweigt.
Dafür zieht sein Anwalt alle Register. Es sei ein «vergiftetes Verfahren». Die Behörden hätten gegen Treu und Glauben und die Unschuldsvermutung verstossen und des Beschuldigten Verfahrensrechte verletzt, als bei seiner Verhaftung kein Pflichtverteidiger bestellt wurde. Deshalb seien die Beweise nicht verwertbar. Und selbst wenn: Der Sachverhalt sei nicht zweifelsfrei erstellt. Er rekonstruiert den Ablauf gemäss Polizeirapport, inklusive Darstellung, wie weit man in zehn Sekunden gehen kann. Voilà: Es ist möglich, dass der Beschuldigte in der Zeit, als die Polizistinnen ihn nicht sahen, aus dem Auto stieg, zum Restaurant ging, umdrehte und das Handy holte.
Der Verteidiger versuche einen Alterna tivsachverhalt herbeizurechnen, sagt hingegen der Staatsanwalt. Fakt sei: Die Freundin habe zuerst ausgesagt, der Beschuldigte sei gefahren. Dann behauptete, sich geirrt zu haben, sie sei gefahren. Und änderte wieder ihren Standpunkt, als ihr Alkoholtest positiv war. Auch unterschlage der Verteidiger, dass die Polizistinnen den Beschuldigten auf sein Recht auf anwaltliche Vertretung hinwiesen – doch dieser verzichtet habe. Die Richter fragen sich, wie der Vertei diger darauf komme, dass die Polizei 28 km/h fuhr und dass sie dem Beschuldigten so gemütlich hinterhertuckerte: unwahrscheinlich. Die Version des Anwalts lasse auch ausser Acht, dass Anhalten, Motor abstellen, Sicherheitsgurte ablegen und Aussteigen dauert – in dieser Zeit hatten die Polizistinnen längst wieder Blickkontakt. Wegen der Vorstrafen setzt es eine relativ hohe Strafe von einem Jahr Gefängnis unbedingt. Denn, so der leicht verärgerte Oberrichter: «Solche Unbelehrbarkeit habe ich trotz langjähriger Gerichtspraxis noch selten erlebt.»










