

Nachhaltig Ausstellen –Ein Leitfaden für Museen
Nachhaltig Ausstellen –Ein Leitfaden für Museen
Gefördert vom
1 Gruß- und Vorworte S 6
2 Was ist eine nachhaltige Ausstellung? Einführung in den Leitfaden und die Wertungsmatrix S 10
3 Nachhaltigkeit in Ausstellungen S 13
4 Von A–Z: Umsetzung einer nachhaltigen Ausstellung
A Nachhaltige Konzeption: Die Initiierungsphase
1 Ziele in Ausstellungen
2 Themen- und Exponatauswahl
S. 17
S 18
S 19
3 Das Akteursmapping S 25
B Nachhaltige Planung: Die Planungsphase
S. 27
1 Grundprinzipien einer nachhaltigen Ausstellungsplanung S 27
2 Ressourcenschonende Planung
3 Materialien in Ausstellungen
S 31
S 38
4 Nachhaltiger Leihverkehr S 43
C Nachhaltige Realisierung: Die Realisierungsphase
1 Das Design-Briefing
2 Besprechungen nachhaltig gestalten
3 Nachhaltige Vergabe
4 Beim Ausstellungsaufbau
5 Die Eröffnung in Sicht
D Nachhaltiger Betrieb & Nachnutzung: Die Betriebsphase
1 Über gute Kommunikation
2 Nachnutzung & Dokumentation
3 Nachhaltig abschließen
5 Treibhausgas-Bilanzierung einer Ausstellung
S. 47
S 47
S 48
S 49
S 55
S 56
S. 58
S 58
S 64
S 65
S 67
6 Wieviel ist viel? Die Wertungsmatrix S 72
7 Praxisbeispiel S 75
8 Worüber man nicht spricht – der Elefant im Raum S 79
9 Bildnachweis S 80
10 Impressum S 81
Redaktioneller Hinweis:
Für die Erstellung dieses Leitfadens hat die Autorin über eine breit angelegte Recherche Informationen von verschiedenen Organisationen und Websites zusammengetragen Das Dokument enthält weiterführende externe Links, für deren Inhalte die Landesstelle für Museen in Baden-Württemberg nicht verantwortlich ist Für Hinweise auf aktuellere Quellen bedanken wir uns und berücksichtigen die Punkte bei der nächsten Überarbeitung
Liebe Museumsmachende Grußwort
Klimaneutralität zu erreichen, ist eines der zentralen Ziele der Landesregierung BadenWürttemberg, für das wir uns mit voller Kraft einsetzen Die Kultur kann durch ihre Entscheidungen und Maßnahmen als Vorbild dienen und dazu beitragen, nachhaltiges Handeln in der Gesellschaft zu verankern Die Museen in Baden-Württemberg nehmen dabei eine wichtige Rolle ein
Mit dem Leitfaden »Green Culture« hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst den Grundstein für mehr Klimaschutz in Kultureinrichtungen gelegt
In Zusammenarbeit mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien wurde der CO2-Kulturstandard zur Bilanzierung von CO2-Emissionen entwickelt Dieser wird von Bund, Ländern und Kommunen zur Anwendung empfohlen – auch die staatlichen Kultureinrichtungen in Baden-Württemberg erfassen ihre Emissionen nach diesen Grundsätzen
Wir wollen unsere Lebensweise auf eine nachhaltige Grundlage stellen, wir wollen gemeinsam aktiv werden! Klimaschutz betrifft sämtlich Bereiche in der Kunst – den Energiebezug, die Beschaffung sowie das Mobilitätsverhalten des Museumsteams und des Publikums An all diesen Stellen können wir ansetzen, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten
Die Landesstelle für Museen Baden-Württemberg hat den Leitfaden »Nachhaltig Ausstellen« für die mehr als 1 200 Museen in unserem Land entwickelt Der Aspekt der Nachhaltigkeit ist eine Querschnittsaufgabe, die in nahezu jeder Phase einer Ausstellung eine wesentliche Rolle spielt Gemeinsam können die Ziele – von einer ressourcenschonenden Produktion des Ausstellungsbaus bis hin zu einem qualitativ hochwertigen und publikumsorientierten Bildungs- und Vermittlungsangebot – festgelegt, abgestimmt und umgesetzt werden

Arne Braun Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
Ich möchte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Museen in BadenWürttemberg ermuntern, die Ziele ihrer Institution weiter verstärkt auf mehr Nachhaltigkeit auszurichten Nutzen Sie den Leitfaden, um kleine und größere Maßnahmen zum Klimaschutz anzustoßen Betrachten Sie diesen als wertvolle Unterstützung, um ihr Nachhaltigkeitsprofil von Ausstellung zu Ausstellung zu schärfen und so einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten
Ich bedanke mich herzlich bei allen Mitwirkenden, die gemeinsam den Leitfaden »Nachhaltig Ausstellen« konzipiert haben und bei all jenen, die sich für mehr Nachhaltigkeit engagieren
Liebe Kolleg*innen, Vorwort
wie wollen wir heute leben, damit unsere nachfolgenden Generationen ebenfalls gut leben können? Wie wollen wir im Jetzt die Zukunft gestalten? Welche Rolle können Museen hierbei einnehmen? Durch die Zusammenarbeit mit Ihnen wissen wir, welch ein vielfältiges Kulturerbe in den Museen Baden-Württembergs vorhanden ist und mit welch einem beachtlichen Angebot an Ausstellungen zu unterschiedlichsten Themen Sie die Museumslandschaft in Baden-Württemberg bereichern Ihnen ist es zu verdanken, dass Wissen und Kultur über attraktive Präsentationen dem Publikum vermittelt werden können Die jüngsten museumsfachlichen Studien zeigen deutlich, dass durch Ihre Arbeit die Menschen Museen als zuverlässige und vertrauensvolle Institutionen einschätzen, die seit langem unser Kulturelles Erbe für heute und für die Zukunft bewahren und es durch gesellschaftsrelevante Ausstellungen sichtbar machen
Nachhaltigkeit auszustellen geschieht nicht erst infolge der aktuellen Debatten über den Klimaschutz Museen aller Art setzen sich in ihrer Programmatik für einen schonenden und bewussten Umgang mit Ressourcen, einen differenzierten und schützenswerten Blick auf Flora und Fauna, ein gerechtes Handeln gegenüber unseren Mitmenschen und für eine gesellschafts- und zukunftsorientierte Gestaltung unserer Welt ein
Der Leitfaden »Nachhaltig Ausstellen« möchte Ihre wertvolle Arbeit unterstützen, um Ihre Botschaft zum Erhalt von Kultur und Natur mit dem eigenen nachhaltigen Handeln zu untermauern Mit seinem Fokus auf dem Klimaschutz zeigt der Leitfaden die vielfältigen Möglichkeiten zum umweltbewussten Ausstellen auf Beginnend mit der Initiierung, über die Planung und Realisierung, während des Betriebs bis hin zur Nachnutzung einer Ausstellung begleitet er Sie bei Ihrem Ausstellungsprojekt Damit können Sie ressourcenschonend handeln und einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Anpassung möglicher Klimafolgen leisten

Shahab Sangestan Leiter der Landesstelle für Museen
Foto: Sebastian Berger

Dr. Yvonne Schülke Referentin der Landesstelle für Museen
Foto: Sebastian Berger
Wir danken an dieser Stelle ganz herzlich Stefanie Dowidat, die als Projektleiterin den Leitfaden federführend entwickelt hat Zudem gilt ein großer Dank der Resonanzgruppe, die sich in ehrenamtlicher Tätigkeit viele Arbeitsstunden mit wertvollen Hinweisen, Tipps und großer Fachexpertise eingebracht hat: Namentlich danken wir für diese Unterstützung Stefanie Cossalter-Dallmann (Museumsverband Hessen e V ), Karen Hehnke (Die Etagen GmbH), Sina Hermann (Deutscher Museumsbund e V ), Caren Jones (Museum Wiesbaden), Marc Kähler (Landesmuseum Württemberg), Olga Panic-Savanovic (Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg), Nina Schallenberg (Jüdisches Museum Berlin), Markus Speidel (Stadtmuseum München) Frauke Stengel (Zeppelin Museum Friedrichshafen), Susanne Zils (Historische Museum Saar) Weiterhin danken wir all denjenigen Museen, die in der Testphase der Wertungsmatrix mitgearbeitet haben
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung des Leitfadens und freuen uns auf viele nachhaltige Ausstellungen
IchNachhaltigkeit?
bin ganz Ohr!



MUSEUMSOBJEKT ABC Fibel »Novi Bukvar« 1932, Belgrad Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm
Warum dieser Leitfaden? Vorwort
Nachhaltigkeit ist ein Thema der Gegenwart und der Zukunft Zahlreiche Studien belegen, dass die von Menschen gemachten Treibhausgase für den Klimawandel verantwortlich sind Seit Beginn der Industrialisierung hat die Konzentration von CO2 und anderen Treibhausgasen deutlich zugenommen Dies spüren wir unter anderem an der Zunahme von Hitzetagen und Starkwetterereignissen Auch Museen sind von den Folgen des Klimawandels betroffen Darüber hinaus tragen sie durch ihr Handeln direkt und indirekt zum Klimawandel bei Gerade im Ausstellungsbereich können durch Parameter wie Materialien, digitale Anwendungen, internationale Leihgaben und vielem mehr hohe CO2e-Emissionen entstehen Gleichzeitig ist das Ausstellungsmachen prädestiniert für den Einstieg in das Thema Nachhaltigkeit Nicht nur, weil die Verantwortung und Entscheidungskompetenz mehrheitlich beim Museumsteam liegt, sondern auch wegen der Sichtbarkeit des Erreichten nach innen und außen Dies motiviert und kann Ausgangspunkt für weitere Nachhaltigkeitsmaßnahmen in der gesamten Organisation sein
Im Kultur- und Museumsbereich gibt es bereits erste Publikationen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, jedoch bisher noch keine explizit zum Thema Ausstellungen Vor dem Hintergrund, dass das Ausstellen zu den Kernaufgaben von Museen gehört, soll diese Lücke mit dem vorliegenden Leitfaden geschlossen werden Dabei geht es nicht nur darum, Wissen zu vermitteln und praktische Tipps zu geben Parallel zum Leitfaden wurde eine Wertungsmatrix entwickelt, die als digitales Instrument zur Selbstevaluation dient und gleichzeitig als Checkliste fungiert
Der Leitfaden versteht sich als Orientierungshilfe für die Museen in Baden-Württemberg Er steht allen Museen in Deutschland und darüber hinaus kostenlos zur Verfügung Aus diesem Grund wurde versucht, auf die verschiedenen Bedarfe und Rahmenbedingungen einer breit gefächerten Museumslandschaft einzugehen und unterschiedliche Ausgangssituationen für Sonder-, Wander- und Dauerausstellungen zu berücksichtigen Die Landesstelle ist sich jedoch bewusst, dass nicht alle Empfehlungen für alle Museen geeignet sind und viele Umsetzungen individuell betrachtet werden müssen
Der Leitfaden ist so aufgebaut, dass er kapitelweise gelesen und je nach Bedarf individuell genutzt werden kann Ebenso können die begleitenden Fragen in der Wertungsmatrix einzeln oder phasenweise beantwortet werden Der Leitfaden möchte damit einen einfachen Einstieg in nachhaltiges Ausstellen bieten und Mut machen, »einfach anzufangen«, konkret ins Handeln zu kommen und mit kleinen sowie großen Schritten nachhaltiger zu werden

Stefanie Dowidat Ausstellungsgestalterin, Museologin, Transformationsmanagerin für nachhaltige Museen
Was ist eine nachhaltige Ausstellung?
Einführung in den Leitfaden und die Wertungsmatrix
Was eine nachhaltige Ausstellung ist, ist nicht immer klar definiert In den meisten Fällen ist damit eine Einsparung von Ressourcen und/oder die Nutzung umweltfreundlicher Materialien und Herstellungsverfahren gemeint Nachhaltiges Ausstellen bedeutet jedoch weit mehr! Insbesondere am Anfang werden dafür wichtige Weichen gestellt
Idealerweise verknüpft sich die Nachhaltigkeit einer Ausstellung mit einer Nachhaltigkeitsstrategie des Museums oder eines Ausstellungshauses Aber auch ohne eine Strategie sind Ausstellungen mit ca 6 233 Umsetzungen pro Jahr in Deutschland (Stand 2022)1 ein wirkungsmächtiger Hebel für Museen und ihre Träger, nachhaltiger zu agieren
Der vorliegende Leitfaden möchte entlang der vier Phasen einer Ausstellung – der Initiierung bzw der Konzeption, der Planung, der Realisierung, während der Laufzeit und in der Nachnutzung – vielfältige Möglichkeiten und Tipps geben, emissionsärmer und ressourcenschonender zu handeln Hiermit können Sie nicht nur den Footprint (der ökologische Fußabdruck ist ein Indikator für Nachhaltigkeit und steht als Maß dafür, wie die Lebensweise die Umwelt beeinflusst) kritisch in den Blick nehmen, sondern sich auch der Auswirkungen des Handprints bewusst werden (u a ist damit eine positive Wirkung durch Wissensweitergabe gemeint)
Der Leitfaden fokussiert sich auf die ökologische Nachhaltigkeit, wobei soziale und ökonomische Aspekte nicht außer Acht gelassen werden Basierend auf den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN (Abb 1) dienen insbesondere die Nachhaltigkeitsziele Hochwertige Bildung (4), Bezahlbare und saubere Energie (7), Nachhaltiger Konsum und Produktion (12), Maßnahmen zum Klimaschutz (13) und Partnerschaften zur Erreichung der Ziele (17) als Grundlage eines nachhaltigeren Ausstellens
Wieviel ist viel? Sich selbst einschätzen können mit der Wertungsmatrix Begleitend zum Leitfaden gibt es eine Wertungsmatrix zur Selbstevaluation Damit möchte die Landesstelle für Museen Baden-Württemberg den Leser*innen Kriterien für eine Selbsteinschätzung ihres nachhaltige(re)n Handelns an die Hand geben Ausstellungsmacher*innen werden hiermit befähigt, ihre Umsetzungen in der Konzeption, Planung, Realisierung und im Betrieb bzw in der Nachnutzung einer Ausstellung selbstständig bewerten und gemeinsam mit dem Team reflektieren zu können Die Wertungsmatrix versteht sich demnach auch als Anreiz für eine stete Verbesserung Über die Website der Landesstelle www landesstelle de/nachhaltigkeit/matrix können verschie-
2

1 Die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN2
dene Fragen pro Ausstellungsphase beantwortet werden Damit dient die Wertungsmatrix zugleich als Checkliste, ob an alles gedacht bzw nichts vergessen wurde Die Ergebnisse in der Bewertung geben an, in welcher Phase bzw in welchen Handlungsfeldern noch Spielräume sind und was bereits gut funktioniert Anhand der Ergebnisse kann zudem intern wie extern über Nachhaltigkeit nachweislich und transparent kommuniziert werden Wie die Wertungsmatrix im Detail funktioniert, wird in Kapitel 6 beschrieben
Die Struktur der nachfolgenden Kapitel lehnt sich weitestgehend an das Handbuch Ausstellungspraxis in Museen3 des Arbeitskreises Ausstellungen im Deutschen Museumsbund e V an Darüber hinaus besteht eine enge Verknüpfung zu den Leitfäden Green Culture. Leitfaden für den Klimaschutz in den Kultureinrichtungen in Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg4 und Klimaschutz im Museum5 sowie zu den Ergebnissen der AG Nachhaltig Ausstellen6 (beides Deutscher Museumsbund e V ) Der Leitfaden fußt auf der aktuellen Museumsdefinition des International Council of Museums (ICOM)7 und verweist auf weitere Quellen zur Vertiefung des Themas
Im Leitfaden tauchen verschiedene Fachtermini aus dem Nachhaltigkeitsbereich auf, welche in Kurzform im Text erläutert werden
1 Institut für Museumsforschung (2023): »Museen und Ausstellungshäuser auf Konsolidierungskurs«, 19 12 2023, www museumsbund de/wp-content/uploads/2023/12/231218-ifm-besuchszahlen-museen-d pdf (letzter Zugriff: 06 09 2024)
2 Ziele für Nachhaltige Entwicklung (2015): dgvn de/ziele-fuer-nachhaltige-entwicklung (letzter Zugriff: 06 09 2024)
3 Arbeitskreis Ausstellungen (Hg ) (2023): Handbuch Ausstellungspraxis in Museen, Deutscher Museumsbund e V , www museumsbund de/publikationen/handbuch-ausstellungspraxis-in-museen (letzter Zugriff: 06 09 2024)
4 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (Hg ) (2023): Leitfaden Klimaschutz in Kultureinrichtungen, Green Culture: mwk baden-wuerttemberg de/fileadmin/redaktion/m-mwk/intern/dateien/pdf/green_culture_broschuere_leitfaden_download_final pdf (letzter Zugriff: 06 09 2024)
5 Deutscher Museumsbund e V (Hg ) (2023): Leitfaden Klimaschutz im Museum, www museumsbund de/leitfaden-klimaschutz (letzter Zugriff: 06 09 2024)
6 AG Nachhaltig Ausstellen im Arbeitskreis Ausstellungen (Hg ) (2022): Handout Nachhaltig Ausstellen, Deutscher Museumsbund e V , www museumsbund de/wp-content/uploads/2022/12/nachhaltig-ausstellen-handout pdf (letzter Zugriff: 06 09 2024)
7 ICOM (2023): Neue Definition für Museen, icom-deutschland de/de/component/content/category/31-museumsdefinition html?Itemid=114 (letzter Zugriff: 06 09 2024)
Läuft bei dir?

Sogar geringemmitFootprint!

MUSEUMSOBJEKTE
Tischuhr 2. Hälfte 19. Jahrhundert, China Deutsches Uhrenmuseum Furtwangen
Tischuhr Junghans 1929, Schramberg, Baden-Württemberg Deutsches Uhrenmuseum Furtwangen
Nachhaltigkeit in Ausstellungen
Um zu wissen, welche Maßnahmen viel oder wenig im Sinne eines ressourcenschonenden Handelns und der Einsparung von CO2-Emissionen bewirken, werden eingangs die verschiedenen Handlungsfelder vorgestellt, welche einen Einfluss auf die Nachhaltigkeit einer Ausstellung haben Je nach Größe eines Hauses, der Trägerschaft, der Werte und Strukturen sowie der Rahmenbedingungen bestehen in manchen Handlungsfeldern mehr Chancen, nachhaltiger zu agieren als in anderen
In einigen Handlungsfeldern kann der Footprint verringert, in anderen eher der Handprint gestärkt werden Beides sind wichtige Säulen einer nachhaltigen Praxis Beispielsweise kann im Handlungsfeld Energie durch den Einsatz von LED-Beleuchtung der Energieverbrauch gesenkt werden Diese Maßnahme zählt klassischerweise zur Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks Der Handabdruck wird beispielsweise verbessert, wenn im Handlungsfeld Kooperation gemeinsam mit lokalen Partnern Fahrradständer angeschafft werden, damit Besucher und Besucherinnen ihre Räder sicher abschließen können
Footprint
Der ökologische Fußabdruck bezeichnet die biologisch produktive Fläche auf der Erde, die notwendig ist, um den Lebensstandard eines Menschen dauerhaft zu ermöglichen (u a Flächen zur Produktion von Kleidung, Nahrung, Bereitstellung von Energie, aber auch zur Entsorgung von Müll oder Binden von Kohlenstoffdioxid) Der ökologische Fußabdruck ist ein Indikator für Nachhaltigkeit Das Konzept wurde 1994 von M Wackernagel und W Rees entwickelt 8
Die Strukturierung in Handlungsfelder ermöglicht, alle Bereiche systematisch zu erfassen, um gezielt Maßnahmen für Verbesserungen ergreifen zu können Wird zudem eine Treibhausgasbilanzierung durchgeführt, kann genau analysiert werden, in welchen Handlungsfeldern viel oder wenig Treibhausgas-Emissionen entstehen (Hinweis: wie eine Bilanzierung durchgeführt wird, wird in Kapitel 5 beschrieben)
Handprint
Der ökologische Handabdruck steht für die Aktivitäten von Personen, Unternehmen oder Institutionen, die nicht nur die eigenen Umweltauswirkungen, sondern auch die Anderer verringern und/oder durch gemeinschaftliche Aktionen positive Auswirkungen ausüben Handlungen wie bspw eine Wissensweitergabe, Unterstützung von lokalen Gruppen oder Umweltverbänden sind Beispiele eines Handabdrucks 9
Die Handlungsfelder einer Ausstellung fußen zum einen auf den klassischen Handlungsfeldern einer Treibhausgasbilanzierung Zum anderen werden museumsspezifische Bereiche wie das Ausstellungsmanagement oder die Vermittlung beleuchtet Nicht immer lassen sich die Handlungsfelder scharf voneinander trennen bzw überschneiden sich die Inhalte Dennoch bietet die Einteilung gute Anhaltspunkte, Maßnahmen für Verbesserungen ergreifen zu können
Zentrale Handlungsfelder einer Ausstellung
Projektorganisation/ Management
u a Ausstellungsmanagement, Planung von Ressourcen (Zeit- und Finanzpläne, Personal- und Materialeinsatz), Koordination von Schnittstellen und Abläufen sowie Teamkoordination, Erstellung von Leistungsbeschreibungen
Konzeption
u a Erstellung von Grob- und Feinkonzepten, Auswahl der Themen und Exponate, Verfassen von Texten (Ausstellung, Katalog), Organisation des Leihverkehrs (abhängig von der Größe des Hauses)
Planung
u a Planung der Architektur/Szenografie/ des Ausstellungsdesigns, der Exponatpräsentation, der Besucher*innenführung, medialer und grafischer Komponenten, von Immersionen
Einkauf/Beschaffung
u a Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Firmenauswahl, Beschaffung und Vergabe mit nachhaltigen Eignungsund Wertungskriterien, Beauftragung von Firmen
Material/Bau
u a Bauen in Kreislaufwirtschaft, Suffizienz/Effizienz/ Konsistenz, Materialwahl, Ressourceneinsatz, Verpackung, Lagerfähigkeit, Abfall
Kommunikation/ Vermittlung
u a Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsplanung, Angebote der Vermittlung bzw der Museumspädagogik Kommunikation mit dem Publikum, Stakeholdern, Trägern, externen Künstler*innen Interne Kommunikation mit dem Team
Kollaboration/ Kooperation
u a Zusammenarbeit und Partnerschaften sowie Vernetzung mit unterschiedlicher Zielsetzung, bspw Ressourcenteilung oder Wissensweitergabe mit verschiedenen Partner:innen
Mobilität u a Dienstreisen, Leihverkehr, Publikumsmobilität
Energie u a Strom für Beleuchtung, Medieneinsatz, Technik und Datenspeicherung sowie Energie für Wärmeerzeugung, Kühlung und Lüftung bzw Klimatisierung
Im Leitfaden Klimaschutz im Museum, Deutscher Museumsbund e V , wird als weiteres Handlungsfeld »Wasser« genannt In vielen Fällen ist dieses Handlungsfeld für den Ausstellungsbereich wenig relevant und wurde deshalb weggelassen Jedoch kann es beispielsweise bei Ausstellungen im Außenbereich oder in naturkundlichen Museen ein sinnvolles Handlungsfeld sein, um nachhaltiger zu agieren Ein immer wichtiger werdendes Handlungsfeld sind zudem »Klimafolgeanpassungen«
Klimafolgeanpassungen
Zunehmend stehen Klimafolgeanpassungen (auch Mitigation genannt) bei einer Ausstellungsplanung im Zentrum eines vorausschauenden Handelns Zum Schutz von Kunstwerken, Exponaten und Menschen ist es notwendig, Maßnahmen bei großer Hitze und im Fall von Starkwetterereignissen ergreifen zu können Insbesondere für Dauerausstellungen sollte ein Notfallplan vorliegen, welcher auch Extremwetterereignisse berücksichtigt Eine gute Empfehlung hierfür ist bspw der SicherheitsLeitfaden
Kulturgut der Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen
KNK 13 Auf der Website stehen Fragebögen, Infomaterial und Publikationen rund um das Thema Sicherheit und Kulturgutschutz zur Verfügung
Definition Treibhausgasbilanz
Eine Treibhausgasbilanzierung ist die Ausgangsbasis und ein Steuerungselement für Klimaschutzmaßnahmen Wer die Hauptverursacher von Treibhausgasemissionen kennt, kann passende Handlungsfelder festlegen und wirksame Maßnahmen initiieren Die Bilanzierung erfolgt nach dem Standard des Greenhouse Gas Protocol Die Recheneinheit hierbei sind CO2-Äquivalente 11
Definition Handlungsfeld Handlungsfelder beleuchten in einem Zusammenhang stehende Problemund Aufgabenstellungen, die mittels konkreter Maßnahmen gelöst werden sollen oder benennen Bereiche, in denen ein eigenes Handeln notwendig und möglich ist 12
CO2-Emissionen
Mit dem Begriff der CO2-Emissionen werden Treibhausgase bezeichnet, die das Klima beeinflussen Sie entstehen durch die Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Materialien wie Diesel, Kohle, Benzin, Erdgas, Flüssiggas oder Holz Durch die Verbrennung wird Kohlendioxid produziert, das in die Erdatmosphäre abgegeben wird und sich dort anreichert CO2-Emissionen sind ein wesentlicher Bestandteil des Treibhauseffekts und führen zu einer klimatischen Erwärmung, die gravierende Folgen für die Umwelt hat 10
Darüber hinaus helfen auch Notfallverbünde, um im Falle eines Notfalls schnelle Hilfe zu erhalten Eine gute Übersicht über die verschiedenen Notfallverbünde bietet u a das Portal der Notfallverbünde für Kulturgutschutz in Deutschland 14
Die im Leitfaden angegebenen Handlungsfelder sind nicht für alle Museen gleich relevant Es wird empfohlen, sich auf die für das jeweilige Haus wichtigen Handlungsfelder zu fokussieren Die neun Handlungsfelder spielen für die Auswahl von Zielen und Maßnahmen, mit denen eine Verbesserung erreicht werden soll, im folgenden Kapitel Von A-Z eine wichtige Rolle
Mein Handlungsfeld:persönliches Mobilität!

MUSEUMSOBJEKT
Dreirad Hahn Keltermuseum Unterjesingen

10 Fokus (2022): Was sind CO2-Emissionen, praxistipps focus de/was-sind-co2-emissionen-einfach-erklaert-mit-beispielen_151008 (letzter Zugriff: 06 09 2024)
11 Universität München (2021): Treibhausgas-Bilanzierung, www unibw de/finance-and-controlling/forschung/treibhausgasbilanz (letzter Zugriff: 07 09 2024)

12 In Anlehnung an: Der deutsche Wortschatz: Handlungsfeld, www dwds de/wb/Handlungsfeld (letzter Zugriff: 07 09 2024)
13 SiLK GbR (2010): Sicherheitsleitfaden Kulturgut, silk-project de (letzter Zugriff 06 09 2024)
14 Website Notfallverbünde Kulturgüterschutz in Deutschland, notfallverbund de/verbuende/kartenansicht (letzter Zugriff 06 09 2024)

MUSEUMSOBJEKTE

Weißer Elefant aus Holz mit vier Rädern 1924, Berlin
Landesmuseum Württemberg
Elefant, einen Obelisken tragend 1763–1765, Porzellan-Manufaktur Ludwigsburg Landesmuseum Württemberg


Von A-Z: Umsetzung einer nachhaltigen Ausstellung
Das Kapitel gibt einen Überblick über Maßnahmen und Praxistipps, um eine Ausstellung nachhaltiger gestalten zu können Die vier Unterkapitel gliedern sich entlang der vier Phasen einer Ausstellung, ergänzt durch thematische Vertiefungen, u a zur Vergabe, zu den Materialien oder zum Thema Bauen in einer Kreislaufwirtschaft
Initiierung Konzeption
Nachhaltigkeit in der Konzeption von Ausstellungen
Betrieb & Nachnutzung
Nachhaltigkeit im Ausstellungsbetrieb und Nachnutzung
A D B C
ANachhaltige Konzeption
Planung
Nachhaltigkeit in der Planung und im Management
Realisierung
Nachhaltigkeit in der Realisierung und Produktion
Wie eine Ausstellungsidee zum Projekt wird –Die Initiierungsphase
Die Initiierungsphase beginnt, wenn seitens des Museums der Entschluss für eine Ausstellungsidee gefallen ist. Während die Ideenfindung anfangs meistens noch informell stattfindet, wird das festgelegte Thema nun im Projektteam diskutiert. Diese frühe Phase ist entscheidend für die Gesamtausrichtung des Ausstellungsvorhabens, da hier Leitlinien und grundlegende Ziele festgelegt werden. Nach der Projektinitiierung (Entwicklung von Ideen, politische und organisatorische Entscheidungen sowie offizielle Bestätigung und Kosteneinstellung) wird mit der inhaltlichen Ausarbeitung eines Grobkonzeptes begonnen. Das Grobkonzept ist Grundlage für die weitere Kommunikation mit allen Beteiligten und dient der Information sowie der Gewinnung potenzieller Fördermittelgeber*innen.15
In dieser frühen Phase, welche mancherorts auch nur Konzeptphase genannt wird, werden nicht nur die Gesamtausrichtung der Ausstellung festgelegt, sondern auch wichtige Weichenstellungen eines nachhaltige(re)n Handelns Nicht immer lässt sich alles umsetzen, was notwendig wäre oder wünschenswert ist Umso wichtiger ist es, am Anfang SMARTe16 Ziele der Ausstellung zu benennen
15 Klinge, Astrid: »Wie eine Ausstellungsidee zum Projekt wird – die Initiierungsphase«, in: Arbeitskreis Ausstellungen im Deutschen Museumsbund e V (Hg ): Handbuch Ausstellungspraxis in Museen, S 23, www museumsbund de/wp-content/uploads/2023/05/2023-ausstellungspraxis-in-museen-160dpi, (letzter Zugriff: 06 09 2024)
16 SMART: Akronym für Specific Measurable Achievable Reasonable Time-bound ist ein Kriterium zur eindeutigen Formulierung von messund überprüfbaren Zielen Das Konzept geht auf den Managementforscher und Unternehmensberater Peter Drucker (1909–2005) zurück SMART (Projektmanagement), in: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie (07 2024), de wikipedia org/w/index php?title=SMART_(Projektmanagement)&oldid=247092312 (letzter Zugriff: 07 09 2024)
1. Ziele festlegen
Am Anfang einer Ausstellung steht das klare Bekenntnis, dass die Ausstellung nachhaltig konzipiert, geplant, realisiert und nachgenutzt werden soll Dazu sind konkrete Ziele zu formulieren, was genau damit gemeint ist Beispielsweise kann eine prozentuale Angabe eingesparter Ressourcen genannt werden, welche am Ende der Ausstellung erreicht sein soll Drei bis vier Ziele sind ein guter Start, um den Fokus nicht zu verlieren Diese sollten den zuvor beschriebenen Handlungsfeldern zugeordnet werden Nicht immer fällt es leicht, Ziele spezifisch zu beschreiben oder etwas prozentual anzugeben, wenn man den Ausgangswert (noch) nicht kennt Dennoch führt bereits der Prozess der konkreten Benennung dazu, sich mit möglichen sowie machbaren Ergebnissen auseinanderzusetzen
Eine Priorisierung der Ziele wirkt sich auch auf die Budgetverteilung aus Nachhaltige Ausstellungen sind nicht per se teurer, dennoch können sie anfangs mehr Geld benötigen Die für eine Erstanschaffung ggf anfallenden höheren Kosten amortisieren sich im Laufe einer längeren Nutzungsdauer Hierbei lohnt es sich, die kommenden Ausstellungen im Blick zu haben und Neuerwerbe entsprechend einer mehrfachen Nutzungsmöglichkeit einzukaufen Die Ausgaben dafür sind im Kostenfinanzierungsplan entsprechend einzukalkulieren
Zudem sollte ausreichend Zeit eingeplant werden, u a für Recherchen nach neuen Materialien oder Firmen Da vieles noch nicht erprobt ist, können auch längere Planungszeiten anfallen, um bspw Bauten aus neuen Materialien vor der finalen Fertigung zu testen Auch können in der Beauftragung längere Vergabezeiten nötig sein, weil das sog Verhandlungsverfahren das am besten geeignete ist, um ein neues Produkt erstellen zu lassen Eine längere Vorbereitungszeit mag nicht attraktiv klingen, ist aber wichtig, um Neues erfolgreich einzuführen
ZIEL-LEUCHTTURM
Jetzt ordnet Eure Ziele als Leuchtturm.
Welches strahlt am stärksten und soll zuerst erreicht sein?
Welche stehen an zweiter und dritter Stelle? Welches ist zwar wünschenswert, aber nicht zwingend?
EURE NACHHALTIGKEITSZIELE
Printprodukte nur digital –Ausnahme Flyer für Kinder
Unser Ziel mit der höchsten Priorität ist:
50 % der Bauten recycelfähig ausführen und für die Nachnutzung sorgen
Unser Ziel mit der zweithöchsten Priorität
Klimaschädliche Transporte gegenüber der letzten Ausstellung reduzieren
Langfristig: längere Laufzeit von Ausstellungen
2 Beispiel Zielangabe in den Handlungsfeldern Material, Bau und Mobilität für die Ausstellung und Kinderbiennale Embracing Nature, Japanisches Palais, Staatliche Kunstsammlungen Dresden 2021
Energie
Weniger Stromverbrauch durch
• Einsatz energieeffizienter Geräte
• Bewegungsmelder für Strahler
Abfall
• Min 50 % Wiederverwendung der Materialien der letzten Ausstellung
• Reste in der Herstellung vermeiden
Mobilität
• Anreiz schaffen für Besucher*innen, mit dem Rad und /oder ÖPNV anzureisen
• Leihverkehr: Sammelfahren nutzen
• Dienstreisen mit dem Zug, wo möglich
Einkauf
• Neben dem Preis min 50 % Nachhaltigkeit als Wertkriterium in Ausschreibungen
• Beim Einkauf auf Gütesiegel achten
• Leihen statt kaufen
3 Beispiel Zieleangabe in den Handlungsfeldern Energie, Abfall, Mobilität und Einkauf für die Ausstellung Modern Times. Archäologische Funde der Moderne und ihre Geschichten inkl der Maßnahmen, mit denen die Ziele erreicht werden sollten © LWL-MAK, Museum für Archäologie und Kultur, Westfälisches Landesmuseum Herne
2. Themen- und Exponatauswahl
Eine nachhaltige Ausstellung muss nicht zwingend Klimaoder Umweltthemen in den Fokus stellen Vielmehr sollten alle Ausstellungen betriebsökologisch nachhaltig geplant und produziert werden Die Entscheidung eines Museums für oder gegen ein bestimmtes Thema ist davon unberührt Es geht nicht darum, die Kunst- und Kulturfreiheit einzuschränken Im Gegenteil: »Kunst und Kultur werden als Treiber einer Transformation angesehen, welche notwendig sind, den Wandel emotional erfahrbar zu machen« (Uwe Schneidewind18)
Betriebsökologie
Unter Betriebsökologie versteht man die direkten ökologischen Auswirkungen, die durch den Betrieb entstehen Betrachtete Bereiche sind: Energie, Wasser, Abfall, Einkauf, Ernährung und Mobilität Daten aus diesen Bereichen bilden in der Regel die Grundlage für eine Treibhausgas-Bilanz 17
Dennoch bedingen kuratorische Entscheidungen Konsequenzen, über die sich das Team klar werden sollte, beispielsweise bei der Auswahl von Exponaten oder Beauftragung bestimmter Künstler*innen Damit kann beispielsweise vermieden werden, dass Installationen oder Kunstwerke nicht nachhaltig produziert werden oder nach der Laufzeit als Sondermüll entsorgt werden müssen Das Team sollte Aspekte wie die verwendeten Materialien der Künstler*innen oder solche für Installationen kritisch hinterfragen bzw eine Auswahl bewusst treffen An dieser Stelle wird angeraten, sich bereits bei der Konzeption einer Ausstellung mit den Grundprinzipien einer nachhaltigen Ausstellungsplanung (siehe Seite 27) vertraut zu machen
Die Auswahl der Exponate, welche in einer Ausstellung gezeigt werden, kann einen großen oder geringen Einfluss auf die Treibhausgas-Emissionen einer Ausstellung haben
Folgende Kriterien sind bei der Auswahl entscheidend:
17 Unter diesem Begriff versteht man, bezogen auf den Kultursektor, das Betriebssystem von Kunst und Kultur Dieses Betriebssystem beschreibt alles, was benötigt wird, um Kunst zu produzieren, zu distribuieren, zu speichern, zur Aufführung zu bringen oder zu vervielfältigen Der Blick wird damit gerichtet auf das, was hinter den Kulissen passiert Green Culture Anlaufstelle (2024), www greenculture info/betriebsokologie (letzter Zugriff 06 09 2024)
18 Schneidewind, Uwe (2018): »Die große Transformation Eine Einführung in die Kunst des gesellschaftlichen Wandels«, Frankfurt am Main: Fischer
CO2e-Emissionen im Handlungsfeld Mobilität sind neben dem Handlungsfeld Energie in den meisten Treibhausgasbilanzierungen von Museen am höchsten19 Entscheidend für die Klimawirkung in diesem Bereich sind u a die Antriebstechnologien der Fortbewegungsmittel und alle Emissionen, welche bei der Herstellung von Fahrzeugen und Kraftstoffen oder Strom anfallen Es macht also einen großen Unterschied, ob für Dienstfahrten ein PKW mit Diesel oder ein E-Auto gefahren wird Noch besser schneiden Zugfahrten bzw die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs ab Dies gilt auch für die Transporte von Exponaten Deshalb sollte in der Ausstellungskonzeption bei der Auswahl von Kunstwerken und Objekten auch danach gefragt werden, woher diese kommen: Stammen die Ausstellungsstücke aus der eigenen Sammlung oder werden sie geliehen? Im Falle einer Ausleihe oder eines Depots, welches nicht Teil des Museumsgebäudes ist: Womit werden die Stücke transportiert? Mit dem Flugzeug, per LKW, PKW mit oder ohne E-Mobilität, Zug oder ggf per Lastenrad? Können sie via Sammeltransport angeliefert werden oder fallen für jedes Objekt Einzelfahrten an? Exponate, welche geflogen oder über weite Strecken gefahren werden müssen, erzeugen demnach viele Emissionen Ausstellungen mit Stücken aus der eigenen Sammlung dagegen weniger Dies sollte bei der Wahl der Ausstellungsstücke berücksichtigt werden Weitere Informationen zum nachhaltigen Leihverkehr finden Sie in Kapitel 4 B 4 Leihverkehr
Mobilität
Klimatisierung
Um eine gleichbleibende Temperatur und Luftfeuchte in Ausstellungsräumen zum Schutz von Exponaten zu gewährleisten, werden die Räume häufig klimatisiert Dies führt jedoch zu höheren Energieverbräuchen und damit zu mehr CO2e-Verbräuchen Wo und wie Exponate aus gestellt werden, sind demnach zentrale Fragen in der Ausstellungskonzeption Es stellen sich Fragen wie: Be nötigen Objekte im Raum eine aktive oder passive Klima tisierung?22 Muss der gesamte Ausstellungsraum für die Präsentation der Objekte klimatisiert sein oder können bei mehreren Räumen auch nur einzelne teilklimatisiert werden? Ggf kann auch ein Klimakorridor mit 18–26°C und 40–60 % eingerichtet werden, wie es der Deutsche Museumsbund empfiehlt23 Die Einführung eines erweiterten Klimakorridors sollte jedoch von Fachleuten vorgenommen und mit einem hinreichenden Monitoring begleitet und ausgewertet werden
CO2e und Treibhausgasbilanz
Die Schreibweise CO2e steht für CO2Äquivalent und ist eine Maßeinheit, um die Klimawirksamkeit von Treibhausgasen vergleichbar zu machen Die Mengen anderer Treibhausgase (etwa von Methan oder Lachgas) werden dabei umgerechnet in die Menge Kohlendioxid, die denselben Effekt für die Erderwärmung hätte Eine Treibhausgasbilanz (engl Carbon Footprint) beschreibt alle klimawirksamen Emissionen einer Institution oder eines Unternehmens, eines Produkts oder Projekts innerhalb eines vorab definierten Bilanzrahmens Hierbei werden alle direkten und indirekten Emissionen erfasst, die durch die Aktivitäten des Unternehmens/der Institution oder im Rahmen der Herstellung eines Produkts oder Projektes entstehen 20
CO2-Äquivalente21
CO2-Äquivalente (CO2e) sind Maßeinheiten, die verschiedene Treibhausgase in einem Wert zusammenfassen Diese Maßeinheiten erlauben es, die Auswirkungen verschiedener Gase auf den Klimawandel zu vergleichen und zu quantifizieren
Wo geht’sbittezum Klimakorridor?


MUSEUMSOBJEKT
Porzellanfigur eines Eisbärs, Thüringen, 1900, Landesmuseum Württemberg

Alternativ kann für sensible Exponate über eine aktive Vitrinen-Klimatisierung nachgedacht werden, ohne dass der gesamte Raum klimatisiert werden muss Ebenso können Objekte mit denselben klimatischen Anforderungen zusammen präsentiert werden Auch die kluge Nutzung von Räumen kann hilfreich sein, um auf eine Klimatisierung zu verzichten, bspw indem licht- und wärmeempfindliche Objekte an der schattigen Nordseite präsentiert werden Selbstredend ist, dass bei der Verteilung von Objekten oder Objektgruppen eines Themenbereichs sich diese nicht so einfach woanders verorten lassen Es bleibt demnach eine »Königsaufgabe« von Kurator*innen, inhaltliche und nachhaltige Aspekte so gut wie möglich zu vereinbaren
Für den Einsatz empfindlicher Objekte und deren konservatorisch korrekter Präsentation empfiehlt es sich, fachkundige Restaurator*innen in die Planung einzubeziehen und/oder Erfahrungswerte anderer Museen einzuholen
Mit welchen Materialien darf das Exponat in Berührung kommen? Dürfen Exponate bspw auf organischen, nachwachsenden Rohstoffen wie Holz oder Baumwollstoff präsentiert werden? Sind organische Materialien generell im Raum zugelassen? Vorgaben von leihgebenden Museen wie die ausschließliche Verwendung von im Oddy-Test-Verfahren als schadstofffrei deklarierten Materialien erschweren oftmals den Einsatz natürlicher und/oder umweltfreundlich hergestellter Materialien und Farben
Materialien
Der zählt!Inhalt

_
MUSEUMSOBJEKT

Weihwasser-Flasche in Form einer Madonna, 1989, Lourdes, Landesmuseum Württemberg

Oddy-Test
Mit Hilfe des Oddy-Tests kann man die Verträglichkeit von Materialien für Vitrinen, Schränke, Museumsräume oder auch Verpackungsmaterialien mit musealen Objekten überprüfen Der Test folgt genauen und reproduzierbaren Arbeitsschritten, die von Andrew Oddy 1973 etabliert wurden 24
19 Siehe bspw die Treibhausgasbilanzierungen von elf Hamburger Museen (2022): elfzunull de (letzter Zugriff: 06 09 2024)
20 Myclimate Schweiz: Was sind CO2-Äquivalente?, www myclimate org/de-ch/informieren/faq/faq-detail/was-sind-co2-aequivalente (letzter Zugriff 06 09 2024)
21 ebenda
22 Eine passive Klimatisierung verwendet Feuchtigkeit absorbierende Materialien wie z B Silikagel Damit wird die relative Feuchtigkeit in der Vitrine konstant gehalten Ein separates Klimafach ermöglicht einen einfachen Wechsel der Klimakassetten Weitere Infos unter: Schöninger GmbH Vitrinenbau: aktive und passive Klimavitrinen, klimavitrine de (letzter Zugriff: 06 09 2024)
23 Deutscher Museumsbund e V (2022): Museumsbund empfiehlt neue Richtlinien für die Museumsklimatisierung, www museumsbund de/energiekrise-museumsbund-empfiehlt-neue-richtlinien-fuer-die-museumsklimatisierung (letzter Zugriff: 06 09 2024)
24 Rathgen Forschungslabor: Der Oddy-Test, www smb museum/museen-einrichtungen/rathgen-forschungslabor/forschung/forschungsergebnisse/der-oddy-test (letzter Zugriff: 06 09 2024)
Sicherheit
Auch Vorschriften im Bereich Brandschutz können den Einsatz umweltfreundlicher Materialien wie Karton und Holz erschweren Sicherheitsbestimmungen dienen zu Recht der Sicherheit von Besuchenden und Mitarbeitenden Doch je höher eine Feuerschutzklasse ist, desto weniger kann mit brennbaren Materialien gearbeitet werden In der sogenannten B1-Klasse (schwer entflammbar) bspw werden Holzplatten mit einem Flammschutzmittel versehen, welches in der Regel ökologisch bedenklich ist

Vermittlung
Sicher ist sicher!


MUSEUMSOBJEKT

Neben diesen »harten« Faktoren spielen weitere bei der Auswahl eines Exponates eine Rolle, u a wie gut sich anhand des Exponates Nachhaltigkeit vermitteln lässt Kommt das Objekt aus einem bestimmten Kontext oder steht symbolisch für ein spezielles Thema? Bspw wurden im Arp Museum Bahnhof Rolandseck Kunstwerke gezeigt, welche die Flutkatastrophe im Ahrtal überlebten, neben solchen, die sich thematisch mit einem Neuanfang auseinandersetzten
Zusammengefasst
Bei der Auswahl von Exponaten für Sonder-, Wander- oder Dauerausstellungen können Emissionsverbräuche reduziert werden Konservatorische Vorgaben und Richtlinien des Brandschutzes dagegen geben vor, ob und welche umweltfreundlichen Materialien und Farben für die Präsentation verwendet werden dürfen Daneben spielen u a auch Vermittlungsaspekte bei der Wahl eine Rolle
Schlüsselbrett mit 92 Schlüsseln, 20. Jahrhundert, Hammerschmiede mit Bienenund Heimatmuseum, Reichenbach
Schemata Objektauswahl
Exponate werden häufig danach ausgesucht, ob sie für das Ausstellungsthema passend sind, besonders interessant und/oder ästhetisch sind, sie von bestimmten Künstler*innen geschaffen wurden und sich gut vermarkten bzw vermitteln lassen Manche Häuser beziehen zudem Aspekte wie Ausgaben für ein Objekt (u a Versicherungssumme, Leihgebühr, Kosten für Restaurierungen oder Objektpräsentation) und Zeiten in die Kalkulation mit ein (u a für restauratorische Arbeiten, Transportwege, Akklimatisierung)
Mit Blick auf die Nachhaltigkeit macht es viel Sinn, auch die Treibhausgas-Emissionen zu berücksichtigen
Praxistipp: Anhand eines einfachen Übersicht-Schemas können die verschiedenen
Aspekte bei der Exponatauswahl miteinander verglichen werden, um alle Faktoren für eine Entscheidung zu berücksichtigen Insbesondere mögliche Treibhausgasemissionen, die mit der Ausstellung eines Objektes zusammenhängen, sollten von Anfang an mitbedacht werden
Objekt 1
Lange Transportwege per Spedition, hohe Versicherungskosten, Highlight-Exponat, gute Vermarktbarkeit, wenig Anknüpfungspunkte an Lehrinhalte von Schulen
Objekt 2
Sammeltransport für Ausleihe möglich, viele Anknüpfungspunkte in der Vermittlung, niedriger Versicherungswert, kein HighlightExponat
Objekt 3
Aus eigenem Bestand, hohe Kosten für die Restaurierung, bereits bekannt – von daher kein HighlightExponat, aber zur Vermittlung gut geeignet
4 Übersichts-Schema zur Bewertung von Exponaten. Das Tool dient zur Selbsteinschätzung und verdeutlicht die Vor- und Nachteile eines Exponates in verschiedenen Kategorien Neu bei der Bewertung ist der Einbezug des möglichen CO2-Ausstoßes Je höher die Anzahl der Kreuze, desto höher sind bspw Emissionen
Das Designmuseum London hat ebenfalls ein Schema zur Exponatauswahl entwickelt25, welches explizit die Reduzierung von Treibhausgasen in den Fokus stellt und für den Leitfaden ins Deutsche übersetzt wurde
1. Handelt es sich um ein »Highlight-Objekt«?
2. Ist das Objekt verfügbar?
3. Muss das Objekt transportiert werden?
4. Ist das Objekt noch anderswo vorhanden? (d h gibt es mehrere Versionen / eine alternative Ausleihmöglichkeit)
5. Wie hoch ist der CO2-Fußabdruck des Transports?
6. Wie hoch sind die Transportkosten?
7. Nach der Berechnung der Emissionen –soll das Exponat nach wie vor geliehen werden?
8. Liegen die Kosten für die Ausleihe des Objektes im Budget?
9. Kann der Transport mit weiteren Leihexponaten zusammen erfolgen?
10. Kann das Objekt auf andere Weise dargestellt oder lokal reproduziert werden?
11. Wie hoch ist der CO2-Fußabdruck des Nachbaus/ des Modells?
12. Nach der Berechnung der Emissionen –soll das Exponat nachgebaut, reproduziert oder anders dargestellt werden?
Nein
Nein
Bewerten Sie das Objekt, sobald alle Highlight-Objekte analysiert und ausgewählt wurden
Gehen Sie zu Frage 10
Nein
Nein
B Berechnen Sie bei zwei Möglichkeiten (Transport A + B) die CO2e-Werte
Gehen Sie zu Frage 10
Verwenden Sie einen CO2-Rechner zur Berechnung der CO2e-Werte des Nachbaus
Versuchen Sie künftig, vorwiegend Leihexponate auszustellen, welche per Sammelfahrt transportiert werden können
5 Schema zur Auswahl von Exponaten. Das Schema fußt auf dem Object Desision Tree vom Designmuseum London und wurde ins Deutsche übersetzt
Kreative Lösungen für Ausstellungen
Wenn sich das Team aus Nachhaltigkeitsgründen gegen ein bestimmtes Exponat entscheidet, stellt sich die Frage, wodurch das Exponat ersetzt werden oder wie ein Thema alternativ erzählt werden könnte Seien Sie kreativ und entwickeln Sie neue Möglichkeiten
Kann das ursprünglich angedachte Exponat durch ein anderes Objekt, durch ein Foto, eine Nachbildung oder eine grafische Darstellung ersetzt werden? Ist ein Digitalisat oder 3D-Druck (aus biobasierten Materialien) denkbar? Können Themen anders gewichtet oder anders erzählt werden? Es gibt eine Vielzahl an Ideen!
3. Das Akteursmapping
Eine Ausstellung macht man in der Regel nicht allein und Nachhaltigkeit ist ein Teamsport, welcher am besten gemeinsam gelingt Viele Kompetenzen sind gefragt Durch die nachhaltige Ausrichtung ergeben sich Chancen für neue Kooperationen oder Partnerschaften, an die ggf bisher nicht gedacht wurde oder die nicht infrage kamen Auch Fördergelder für Nachhaltigkeit können im Rahmen des Projektes beantragt werden Eine gute Übersicht bietet bspw der Deutsche Museumsbund e V auf seiner Website 26 Neben möglichen Unterstützer*innen gibt es aber vielleicht auch Personen, die Bedenken haben Sich bereits im Vorfeld klar zu werden, welche Erwartungen oder auch Ängste im Team bestehen und wer darüber hinaus Nachhaltigkeit in unterschiedlicher Art und Weise unterstützen wird oder kann, ist unerlässlich Dazu gehört auch, diejenigen, die eine nachhaltige(re) Ausrichtung maßgeblich beeinflussen bzw die weitreichende Entscheidungen treffen können, mit ins Boot zu holen
Wird man sich seiner Stakeholder bewusst, kann man gezielt in der Kommunikation darauf eingehen, siehe auch Seite 58 Aus diesem Grund wird bereits in der Initiierungsphase empfohlen, ein Akteursmapping durchzuführen Ein Akteursmapping ist eine Methode, bei der im ersten Schritt wesentliche Akteur*innen notiert und in einer Kreisdarstellung angeordnet werden Zum inneren Zirkel gehört in der Regel das Team Im zweiten Feld werden bspw Vereinsmitglieder, Ehrenamtler*innen und enge Partner verortet Weiter entfernt befinden sich übergeordnete Akteure wie bspw die Stadt oder Kommune
Stakeholder
Als Stakeholder wird eine Person oder Gruppe bezeichnet, die ein Interesse an einem Unternehmen oder an einer Institution beziehungsweise an dem Ergebnis eines Prozesses oder Projektes hat Dies können für Museen bspw die Mitarbeitenden, der Verein oder der Träger sein oder auch das Publikum sowie Fördergeldgeber*innen 27
Akteursmapping
Das Mapping von Akteur*innen meint die Erstellung einer Art »Landkarte«, auf der wesentliche Stakeholder zu unterschiedlichen Schwerpunkten verortet und gruppiert werden Zudem werden die Beziehungen der Akteur*innen zueinander dargestellt 28
6 Schema eines Akteursmapping nach S. Jellinghaus
Überregional
Lokal
Intern Leitung TEAM
Im zweiten Schritt wird gewichtet, wie groß oder klein das Interesse der jeweiligen Akteure an Nachhaltigkeit ist und wer auf die Umsetzung der Ausstellung Einfluss haben kann Mit diesem Wissen kann die Kommunikation mit den Akteuren strategisch gesteuert werden
Interesse
hohes Interesse niedriger Einfluss
niedriges Interesse niedriger Einfluss


hohes Interesse hoher Einfluss
niedriges Interesse hoher Einfluss
Einfluss
7 Schema eines Akteursmapping mit Angaben zu Interesse und Einfluss
Zusammengefasst
In der Initiierungsphase wird der Grundstein für die Nachhaltigkeit einer Ausstellung gelegt Insbesondere in den Handlungsfeldern Management, Themen- und Exponatauswahl, Kooperation, Mobilität und Energie führen bereits erste Entscheidungen zur Vermeidung von Treibhausgas-Emissionen und/oder zum bewussten Ausbau von Netzwerken Neben Ideen, Themen und ersten Exponatvorschlägen werden Nachhaltigkeitsziele für die Ausstellung benannt Sie dienen bei der weiteren Auswahl von Inhalten und Exponaten, aber auch beim Einwerben von Fördergeldern und Eingehen von möglichen Kooperationen, als Leitlinie
Bei der Aufstellung der Kosten- und Zeitpläne wird zudem ein Puffer berücksichtigt, um Zeit für Recherchen oder Kosten für Probebauten einzukalkulieren
Die Initiierungsphase endet mit der Verschriftlichung eines Grobkonzepts und der Verabschiedung durch Entscheidungsträger*innen
BMich hat man immer schon mehrfach genutzt.
Nachhaltige Planung
Die Planungsphase


MUSEUMSOBJEKT
Getreidesack Förderkreis Unterjesinger Kelter e V

In der Planungsphase werden inhaltliche, pädagogische und gestalterische Ideen innerhalb des verfügbaren Zeit- und Kostenrahmens konkretisiert. Diese Phase dient der Weiterentwicklung des Grobkonzepts zum Feinkonzept, d. h. aufeinander aufbauend wird sowohl die inhaltliche Ausrichtung als auch die Ausstellungsgestaltung spezifiziert. Die allgemeinen wie die nachhaltigen Ziele der Ausstellung und die konsequente Ausrichtung auf das Publikum bilden dabei die Grundlage. Die Phase ist gekennzeichnet durch intensive Abstimmungsprozesse und das Ineinandergreifen von Inhalten, Themen, Exponaten, der Ausstellungsdramaturgie und dem Erscheinungsbild im Raum. Dabei arbeiten Projektverantwortliche aus den Bereichen inhaltliche Konzeption, Bildung und Vermittlung, Gestaltung, Restaurierung, Verwaltung, Kommunikation und weitere vertrauensvoll zusammen.29
Nachdem in der Initiierungsphase die nachhaltigen Ziele der Ausstellung festgelegt wurden, werden diese in der Planungsphase mit konkreten Maßnahmen zur Zielerreichung hinterlegt Bei der Planung einer nachhaltigen Ausstellung gelten Grundprinzipien eines ökologischen, ökonomischen und sozialen Handelns als Leitfaden Dazu zählen im ökologischen Sinne vor allem die folgenden Grundprinzipien einer nachhaltigen Ausstellungsplanung
1. Grundprinzipien einer nachhaltigen Ausstellungsplanung
Refuse, Reduce, Reuse, Recycle Suffizienz, Effizienz und Konsistenz
Cradle to Cradle –Ausstellungen im Kreislauf denken
Refuse, Reduce, Reuse, Recycle (verzichten, reduzieren, wiederverwenden und recyceln) Beim Reduzieren oder auch Verzichten geht es um Produkte und Materialien, die nach der Ausstellung meist weggeschmissen werden wie bspw Flyer, die aus Kostengründen in einer hohen Auflage bestellt wurden Zudem um Produkte, welche umweltschädlich produziert wurden und/oder nicht recycelfähig sind Eine gute Übersicht über verschiedene Werkstoffe bietet bspw die Website nachhaltige-ausstellungen.de oder das Materialschema in Kapitel 4 C
Reuse: Die meisten Museen nutzen Vitrinen und Sockel vorhandener Ausstellungen wieder Das ist gut so! Dennoch werden jährlich – häufig aus Platzmangel in Lagerräumen – Materialien, Teile von Szenografien oder Druckgrafiken entsorgt Als Alternative sei an dieser Stelle auf die Materialbörse des Museumsverbandes Baden-Württemberg sowie die Materialbörse des Deutschen Museumsbundes verwiesen, wo nicht mehr genutzte Materialien, aber auch Vitrinen und Ausstellungen abgegeben werden können: www.museumsbund.de/materialboerse
Suffizienz, Effizienz, Konsistenz
Auch bei der Suffizienz geht es um Reduktion Jedoch wird hier genereller die Frage gestellt, wie mit weniger Aufwand dieselbe oder eine ähnliche Wirkung erzielt werden kann Bei der Ausarbeitung des inhaltlichen Feinkonzeptes kann beispielsweise eine hohe Anzahl von Exponaten derselben Gattung in einem Bereich kritisch hinterfragt werden beziehungsweise eruiert werden, ob dieselbe Aussage oder Wirkung auch mit weniger Exponaten erzeugt werden könnte
Suffizienz
Weniger produzieren und konsumieren: Energie- und Materialverbrauch begrenzen
Effizienz
Besser produzieren: gleicher Nutzen, weniger Energieverbrauch
Zum Beispiel: vom Besitzen zum Teilen (z B Werkzeug)
Zum Beispiel: von der Glühbirne zur LED
8 Erläuterung des Prinzips Suffizienz, Konsistenz und Effizienz30
Konsistenz
Anders produzieren: mit regenerativen Energien oder durch wiederverwertbare Materialien
Zum Beispiel: von der Plastiktüte zur kompostierbaren Tüte aus Maisstärke
In der Ausstellungsplanung sollte geprüft werden, inwieweit die gewünschte Wirkung in der Gestaltung mit einfache(re)n Mitteln umgesetzt werden kann Insbesondere bei stark inszenierten Ausstellungen, Themenwelten oder szenografischen Nachbauten realer Kontexte (wie bspw einem mittelalterlichen Markt, einer Wüste oder einem Wald) werden nicht selten Kulissen erstellt, welche nicht nur materialintensiv sind, sondern auch häufig umweltschädlich hergestellt wurden Die Frage stellt sich daher: Könnte bspw für die Darstellung eines Waldes anstelle von nachgebauten Bäumen aus Kunststoffmasse mit einer Großgrafik gearbeitet werden? Wären Baumsilhouetten aus Wabenkarton einsetzbar oder könnte mit einer immersiven Medieninstallation gearbeitet werden? Die kreativen Möglichkeiten sind vielfältig!
Die Konsistenz fragt nach einer anderen Art der Planung und Produktion Dies schließt beim Entwurf u a Gedanken zur Weiternutzung und/oder Entsorgung mit ein Bei der Planung von Dauerausstellungen spielen zudem Reparaturfähigkeit und Austauschbarkeit von Einheiten eine wichtige Rolle Reste und Sondermüll sollten dabei vermieden werden Neben der Wiederverwendung von Elementen aus dem eigenen Haus können auch Bauten oder Materialien von Materialinitiativen oder anderen Museen in die Planung einbezogen werden Als Ausgangspunkt dient die Frage: Was ist bereits vorhanden und kann (wieder-)verwendet werden?
In der Nachhaltigkeit wird Effizienz primär im Sinne einer besseren Ressourcennutzung bspw in der Einsparung von Energie verstanden
Cradle to Cradle – Ausstellungen im Kreislauf denken Für eine Wiederverwendbarkeit von Bauten und Materialien spielen nicht nur ihre Eigenschaften und die Herstellung eine Rolle, sondern auch, was am Ende der Laufzeit mit ihnen passiert Um zukünftig auch weiterhin eine Rohstoffversorgung gewährleisten zu können, wurden und werden Gesetze zur Zirkularität von Materialien verabschiedet 31 Das Cradle-to-Cradle-Prinzip im Sinne eines zirkulären Ausstellungsdesigns trägt dazu bei, dass Produkte nutzbar bleiben, reparierbar sind und wieder aufbereitet werden können
Eine ganze Reihe an bereits verfügbaren Ausstellungssystemen mit modularen Wänden, Stecksystemen und einer standardisierten Bauweise sind so konzipiert, dass sie langfristig wiederverwendet werden können Ebenfalls nehmen Systeme zu, die aus umweltfreundlichen Rohstoffen wie Abfallhölzern bestehen und nach ihrer Nutzung fachgerecht entsorgt werden können Dazu zählen auch Bauten, die ohne Leim- und/oder Schraubverbindungen auskommen Stattdessen ermöglichen Bespannungen, Einhängebeschläge, Zapfenverbindungen oder Verriegelungen mit Holzdübeln eine effiziente Montage und einen kreislauffähigen Rückbau In den meisten Fällen wird derzeit eine zirkuläre Bauweise eher für temporäre Bauten und Wanderausstellungen genutzt Doch auch bei neu geplanten Dauerausstellungen sollte an eine rückbaubare bzw in Teilen austauschbare und leicht reparierbare Produktion gedacht werden Anregungen zur Umsetzung finden sich u a auf der Website nachhaltigeausstellungen.de 33 unter Praxisbeispielen
Cradle to Cradle (engl sinngemäß »vom Ursprung zum Ursprung«, abgekürzt auch C2C) ist ein Ansatz für eine durchgängige und konsequente Kreislaufwirtschaft Das auch als Philosophie bzw System wahrnehmbare Prinzip wurde Ende der 1990er-Jahre von dem deutschen Chemiker Michael Braungart und dem US-amerikanischen Architekten William McDonough entworfen »Cradle-toCradle-Produkte« sind demnach solche, die entweder als biologische Nährstoffe in biologische Kreisläufe zurückgeführt oder als »technische Nährstoffe« kontinuierlich in technischen Kreisläufen gehalten werden können 32
Nach der Ernte ist vor der Ernte.



_ MUSEUMSOBJEKT
Einkochglas, Firma J. Weck GmbH und Co. KG, Öflingen, 1951-2000, Landesmuseum Württemberg

30 BUND: Suffizienz, Effizienz, Konsistenz – Wörter die den Weg in eine nachhaltigere Zukunft zeigen, www bund-bawue de/themen/mensch-umwelt/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsstrategien (letzter Zugriff: 06 09 2024)
31 BMUV: Nationale Kreislaufstrategie, www bmuv de/themen/kreislaufwirtschaft/kreislaufwirtschaftsstrategie (letzter Zugriff: 06 09 2024)
32 Cradle to Cradle, in: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie (01 2024), de wikipedia org/w/index php?title=Cradle_to_Cradle&oldid=240803370 (letzter Zugriff: 07 09 2024)
33 Expo-Etage (2023): nachhaltige-ausstellungen de/praxisbeispiele (letzter Zugriff: 06 09 2024)

9 Beispiel eines Holzstecksystems, welches weder Leim noch Schrauben beim Zusammenbau benötigt, für die Sonderausstellung Beyond Bauhaus, Berlin

10 Beispiel einer Ausstellung zur Kreislaufwirtschaft, Projekt :metabolon, Bergisches Energiekompetenzzentrum, mit Einbezug von TRIQBRIQ - einem kreislauffähigen Holzbausystem34
2. Ressourcenschonende Planung
Mit den vorab definierten Grundprinzipien geht es in diesem Abschnitt in die konkrete Planung der Ausstellung
Den Überblick haben – Guter Start am Anfang
Eine ressourcenschonende Planung fängt zuerst bei der Dokumentation bzw Erfassung aller vorhandenen Elemente an Dies schließt eine Raumdarstellung mittels bemaßter Grundrisse und Ansichten/Schnitte ein Auch Raummodelle – ob analog oder in 3D –sind für alle Planer*innen nützlich, um die Ausstellung planen zu können
Tipp: Arbeitet ein Museum mit einem Ausstellungsbüro zusammen, welches vorhandene Grundrisse digitalisiert oder den Ausstellungsraum neu erfasst, dann kaufen Sie dem Büro diese Grundlage besser ab, um auch in Zukunft über digitalisierte Pläne zu verfügen Aktualisierte Vitrinen- und Medienlisten mit den genauen Maßen, technischen Beschreibungen und fotografischen Abbildungen zählen ebenfalls dazu Zudem sollten weitere verfügbare Lagerbestände wie Rahmen, Displays, Sockel und Podeste sowie Stoffe erfasst sein Dies kann als Excel-Tabelle erstellt oder in eine Datenbank eingegeben werden Auch Lagerverwaltungssysteme mit Barcode-Scanner für größere oder auf mehrere Standorte verteilte Einlagerungen sind nützlich, um den Überblick zu behalten, was im Haus vorhanden ist
Nur neu produzieren, was nötig ist – Planung mit Vorhandenem Die Planung mit vorhandenen Elementen bedingt auch ein Akzeptieren von heterogenen Beständen Vielfach besteht ein gewachsenes Sammelsurium an unterschiedlichsten Elementen Schon allein Glashauben für Exponate können unterschiedlich produziert sein – ob aus Acrylglas, VSG oder ESG-Glas, mit Schraubverbindungen, Schließblechen oder Steckschlössern Zugegebenermaßen ist das unterschiedliche Erscheinungsbild nicht immer ästhetisch Dennoch lassen sich mit einer einheitlichen Farbgebung, gebauten Einfassungen, Podesten oder gleichen Hintergründen ansprechende räumlich-gestalterische Bezüge herstellen Langfristig wird empfohlen, nur ein Vitrinen- bzw Haubensystem zu verfolgen und neu Benötigtes in dem gewählten System einzukaufen oder produzieren zu lassen
Materialmaße kennen und ausnutzen
Sockel, Wände oder Aufbauten werden für eine Ausstellung in der Regel nach den Vorgaben der Gestalter*innen bzw nach den Anforderungen des Museumsteams gebaut Im Sinne einer ressourcenschonenden Planung rückt eine kluge (Aus-)Nutzung von Materialien hierbei in den Fokus Produzierende Gewerke – z B Druckereien oder Tischlereien – erstellen in der Regel Materiallisten und planen die Einzelteile oder bedruckbaren Elemente so, dass die Maße von Holzwerkstoffen oder Druckbögen bestmöglich ausgenutzt werden Hier gilt es, keine unnötigen Reste zu erzeugen Sprechen Sie mit den produzierenden Gewerken über Verbesserungen in der Verwertung von Materialien Gegebenenfalls müssen dafür Maße angepasst oder verändert werden Dies lohnt sich! Neben einem geringeren Emissions- und Materialverbrauch bewirken Einsparungen häufig auch weniger Kosten
It’s a match!




MUSEUMSOBJEKT
Tierbaukasten. Entwurf: Hans von Klier, 1958.
Material: Holz Foto: Ernst Fesseler
© HfG-Archiv Ulm, Signatur: HfG-Ar MS 0055
Auf die Nutzung standardisierter Systeme oder modularer Bauweisen wurde bereits zuvor hingewiesen Beispielsweise lassen sich für Wände einheitlich konfektionierte Unterkonstruktionen aus Holzwerkstoffen oder Metallständern nutzen, welche anschließend beidseitig beplankt oder bespannt werden Das äußere Erscheinungsbild kann dabei individuell gestaltet werden
Materialien klug wählen
Materialentscheidungen haben einen entscheidenden Einfluss darauf, Ausstellungen umweltfreundlicher, emissionsmindernder und ressourcenschonender umzusetzen Für die Entscheidung, welche Materialien eingesetzt werden, sind zunächst die Anforderungen zu klären Wichtige Parameter sind u a Belastbarkeit, Brandschutzauflagen, Gewicht, Nutzbarkeit für Druck und Lackierung, konservatorische Vorgaben, Kantenbeschaffenheit und Haltbarkeit Dabei macht es einen großen Unterschied, ob die Ausstellung als Wanderausstellung auf Reisen geht, nur temporär gezeigt oder als Dauerausstellung geplant wird
Tipp: Auf der Website nachhaltige-ausstellungen.de findet sich unter dem Menüpunkt Werkstoffe eine gute Übersicht von Produkteigenschaften verschiedenster Werkstoffe und ihrer Bearbeitungsmöglichkeiten
Der ökologische Rucksack
Der ökologische Rucksack drückt das Gewicht aller natürlichen Rohstoffe aus, die für ein Produkt anfallen – von der Rohstoffgewinnung und Herstellung über die Nutzungsdauer bis zur Entsorgung Alle Rohstoffe zusammengezählt ergeben eine Maßzahl für die Belastung der Umwelt Je weniger natürliche Rohstoffe verbraucht werden, desto geringer sind die Umweltauswirkungen35 Laut dem Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH hat bspw ein Smartphone gegenüber seinem Eigengewicht einen fast 1000-mal so schweren ökologischen Rucksack Das Institut hat dafür die sogenannte MIPS-Formel (Material-Input pro Serviceeinheit) entwickelt, mit der ein Umweltverbrauch verschiedener Produkte in Kilogramm berechnet werden kann Die Bezeichnung Material Footprint löst zunehmend den Begriff Ökologischer Rucksack ab
Stehen die Anforderungen fest und wurden diese im Team sowie mit den ggf beauftragten Gestalter*innen und/oder ausführenden Firmen besprochen, gilt es, die passenden Produkte zu recherchieren Neben dem Blick auf Treibhausgas-Emissionen von Materialien kann bei der Auswahl geeigneter Produkte auch der »ökologische Rucksack« helfen
Ein 80 g schweres Handy hat einen Rucksack von 75,3 kg, wiegt ökologisch also fast so viel wie vier voll gepackte Reisekoffer
11 Darstellung zur Bewertung des ökologischen Rucksacks eines Handys
75,3 kg
Für verschiedene Ausstellungsmaterialien gibt es ungefähre Angaben zum durchschnittlichen ökologischen Rucksack Bei Metallen sollte jedoch genau abgewogen werden, welches für Vitrinen oder Unterkonstruktionen eingesetzt wird Stahl schneidet bspw deutlich besser ab als Aluminium Empfohlen wird, bei allen Werkstoffen solche mit einem möglichst hohen Recyclinganteil und Biowaren zu bevorzugen Für Papier und Pappe gibt das Wuppertal Institut den ökologischen Rucksack mit Faktor 7 an, das heißt, dass für Kataloge mit einem Kilo Gewicht sieben Kilogramm Naturverbrauch vonnöten sind Das Forum für Verantwortung hat für Plastik als Faustregel Faktor 5 genannt: »Bei Plastik ist der Naturverbrauch für die Herstellung und Entsorgung des Gutes, gemessen am Gewicht des fertigen Produkts, fünfmal so groß «36 Weitere Quellen zur Beurteilung von Materialien bietet auch das Ökologische Baustoffinformationssystem Wecobis37
Generell gilt, je länger Materialien verwendet werden, desto besser ist es für die Umwelt Somit kann auch eine energieintensiv hergestellte Stahl-Glas-Vitrine ihre Berechtigung haben, wenn sie 30 Jahre im Einsatz ist
Material 1 kg Durchschnittlicher ökologischer Rucksack in kg Naturverbrauch
Glas 1,5
Gummi 5,0
Holz
Elektronik-Bauteile
Diese Tabelle des Wuppertal Instituts macht die Größenverhältnisse der ökologischen Rucksäcke verschiedener Basismaterialien deutlich Bei den Metallen ist die Spannweite sehr hoch: Stahl (6,4 kg), Aluminium (60,8 kg), Messing (350 kg), Gold (500 t)
12 Angaben zum durchschnittlichen ökologischen Rucksack verschiedener Materialien in kg38
35 Siehe auch Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie: Ressourcen berechnen, wupperinst org/themen/ressourcen/ressourcen-berechnen (letzter Zugriff: 06 09 2024)
36 Forum für Verantwortung: Ökologischer Rucksack – Unser Leben mit schwerem Gepäck, www forum-fuer-verantwortung de/wp-content/uploads/2013/02/pre_bigfm_oekologischer-rucksack-1 pdf (letzter Zugriff: 06 09 2024)
37 WECOBIS, ökologisches Bauinformationssystem: Produktinformationen Stahl, www wecobis de/bauproduktgruppen/metalle-pg/stahl-pg html (letzter Zugriff: 06 09 2024)
38 Biosphärenzweckverband Bliesgau: Mit dem ökologischen Rucksack durch den Blieskasteler Wald, www blieskastel de/fileadmin/user_upload/Blieskastel/PDF-Dokumente/Flyer/Unterrichtshilfe_Oekologischer_Rucksack-1 pdf, S 11 (letzter Zugriff: 06 09 2024)
Nicht einfach zu bewerten
Nicht immer ist es einfach, sich für oder gegen ein bestimmtes Material zu entscheiden Gegensätzliche Aussagen in unterschiedlichen Quellen und die Komplexität in der Beurteilung können zu Verwirrung führen Vergleicht man bspw Glas mit Acrylglas, benötigt Acrylglas im Vergleich weniger Energie zur Herstellung und Verarbeitung Es kann sowohl weitergenutzt als auch vollständig recycelt werden Es hat zudem weniger Gewicht, was für ein Handling von großen Hauben nicht unwichtig ist Acrylglas wird jedoch aus Polymethylmethacrylat (PMMA) hergestellt und ist damit ein thermoplastischer Kunststoff aus Erdöl, einem fossilen Brennstoff Die Gewinnung und Verarbeitung von Erdöl sind mit dem Wunsch einer klima- und umweltfreundlichen Produktion kaum vereinbar Zudem zerkratzt Acrylglas schneller als Glas und je nach Verklebung können die Kanten bereits nach kurzer Zeit vergilben Je nach Zweck, Nutzungsdauer, Anforderungen und Eigenschaften werden Materialien ausgewählt Da dies nicht immer einfach zu entscheiden ist, werden im vertiefenden Kapitel Materialien weitere Kriterien zur Nachhaltigkeit vorgestellt
Gütesiegel und Zertifizierungen
Voll gut!


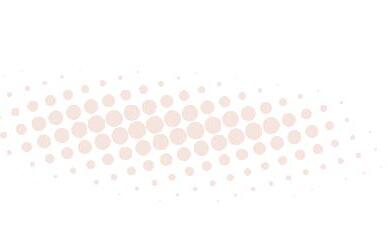
Viele Firmen nutzen inzwischen Gütesiegel für ihre Produkte Da auch hier die Transparenz und Standards in der Bewertung für Verbraucher*innen nicht immer eindeutig sind, werden Websites wie Siegelklarheit39, eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), oder Kompass Nachhaltigkeit40 empfohlen Auch Label Online41 der Verbraucher Initiative e V ermöglicht eine unabhängige Bewertung von Gütesiegeln anhand eines transparenten Kriterienkatalogs Darüber hinaus gibt es Zertifizierungen, welche von anerkannten Zertifizierungsstellen ausgestellt werden und anhand von Prüfnormen die Einhaltung bestimmter Anforderungen garantieren sollen Zertifizierungen gibt es etwa zur Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards, man denke an die Zertifizierung für nachhaltig erzeugtes Holz in der Forstwirtschaft FSC42
MUSEUMSOBJEKT
Siegelstock des Schreinerhandwerks
Alte PosthaltereiStadtmuseum Mengen
Die Reparaturfähigkeit und eine recyclinggerechte Konstruktion werden ebenfalls bewertet Computer, die das Umweltzeichen Blauer Engel tragen, erfüllen entsprechend durch ihre Reparaturfähigkeit, recyclinggerechte Konstruktion, Werkstoffwahl und die Möglichkeit des Aufrüstens die Voraussetzung für das Label43

13 Für die klimasensible Ausstellung »Modern Times. Archäologische Funde der Moderne und ihre Geschichten«, LWL-MAK, Westfälisches Landesmuseum Herne, wurden u. a. Cortenstahlplatten und Tablets geliehen, welche nach der Ausstellung wieder zurückgegeben wurden.
Leihen statt kaufen
Manchmal werden für bestimmte Ausstellungsideen, Exponate oder Umsetzungen Materialien oder Vitrinen benötigt, bei denen von Anfang an klar ist, dass sie danach nicht weiterverwendet werden können In dem Fall sollte bei der Ausstellungsplanung über eine Ausleihe nachgedacht werden Ob Medien, Vitrinen, Bilderrahmen, Leuchtdisplays oder Vorhänge – vieles bieten Firmen inzwischen auch als Leihware an bzw man kann dies bei den entsprechenden Fachfirmen nachfragen Damit lassen sich CO2e-Emissionen sparen und das Lager wird nicht unnötig mit Dingen vollgestellt Empfohlen wird, bei Vertragsabschluss mit den Firmen festzuhalten, in welchem Zustand die Ware angenommen wurde und nach der Ausstellung wieder abzugeben ist Ebenso bedingen Haftungsfragen für ev auftretende Schäden, Regelungen zur Rückgabe sowie weitere Modalitäten eine vertragliche Grundlage Leihwaren sind leider nicht immer günstiger als ein Kauf Dennoch bieten sie die Chance, Produkte und Materialien weiter im Kreislauf zu halten, statt sie entsorgen zu müssen und gleichzeitig individuelle Ausstellungsideen verwirklichen oder besondere Exponate zeigen zu können
Zweckentfremden und Upcycling
Viele Dinge lassen sich für Ausstellungen kreativ zweckentfremden Ob Obst- oder Getränkekisten als Regal gestapelt, gebrauchte Parketthölzer als Wandpanel, gebündelte Zeitschriften als Sitzhocker oder Bannerstoffe für Raumteiler – im Ausstellungsdesign finden sich viele gute Beispiele, die als Inspirationsquelle dienen Auch aus einer alten Ausstellung lässt sich Neues herstellen So ließ das Team des Museums am Schölerberg Reste von Vitrinen, Aufbauten und Kulissen aus der in die Jahre gekommenen Dauerausstellung schreddern und als »Kunstbäume« in der neuen Ausstellung wieder einbauen 44
39 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, www siegelklarheit de (letzter Zugriff: 06 09 2024)
40 ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH, www kompass-nachhaltigkeit de (letzter Zugriff: 06 09 2024)
41 label-online de (letzter Zugriff: 06 09 2024)
42 FSC Deutschland, www fsc-deutschland de (letzter Zugriff: 06 09 2024)
43 Der Blaue Engel, www blauer-engel de/de/zertifizierung/vergabekriterien#UZ78-2017 (letzter Zugriff: 06 09 2024)
44 Schomaker, Elisabeth/Museum am Schölerberg (2023): Recyclingbäume für den Wald der Zukunft, www museum-am-schoelerberg de/recycling-baeume-fuer-den-wald-der-zukunft (letzter Zugriff: 06 09 2024)

14 Blick in die Dauerausstellung des Museums am Schölerberg, Osnabrück
Die aus geschredderten Altmaterialien wie Vitrinen und Büromöbel kreierten »Bäume« sind neben ihren Eigenschaften als Recyclingprodukt auch Träger für Texte und Hands-On Stationen
Digital
statt analog
Mehr und mehr Museen setzen bei der Planung einer Ausstellung auf den Einsatz digitaler Techniken Insbesondere Printprodukte wie Flyer oder Texttafeln werden durch digitale Angebote ersetzt Damit werden wertvolle Ressourcen geschont, statt diese am Ende der Ausstellung zu verschwenden und im Müll zu entsorgen Doch so einfach ist es nicht: Jeder Online-Katalog und jedes Video verbrauchen ebenso Ressourcen, insbesondere Strom Auch die Endgeräte und Server, auf denen die Daten gespeichert sind, benötigen stetig mehr Energie Der jährliche CO2e-Ausstoß durch das Internet ist inzwischen höher als der des globalen Flugverkehrs45 Ist das Digitale nun eine umweltfreundlichere Alternative zum Analogen oder nicht? Das Umweltbundesamt konstatiert hierzu ein »ja, aber«46 Für eine Einschätzung der Emissionen von Medien und digitalen Anwendungen in Ausstellungen sind u a folgende Faktoren wichtig:
• Mit welchem Strom wird das Gerät betrieben (konventionell, Ökostrom)?
• Wo steht der Server (Deutschland, USA)?
• Wird das Gerät mit W-Lan oder Kabelanschluss betrieben? Auch die Art des Kabels ist entscheidend Glasfaserleitungen reduzieren gegenüber Kupferkabeln viele Emissionen
• Wie energieeffizient ist das Endgerät?
• Kann das Endgerät abgeschaltet werden (z B außerhalb der Öffnungszeiten)?
• Sind Einzelteile des Endgerätes austauschbar und/oder reparaturfähig?
• Wie groß ist das Datenvolumen bzw wurde das Bild- oder Videomaterial kleinstmöglich runtergerechnet?
• Bring your own device: Können die zur Verfügung gestellten Daten von den Endgeräten des Publikums genutzt werden, bspw mittels QR-Code auf dem Smartphone?
Zu meiner Zeit gab’s noch kein digital.


_ MUSEUMSOBJEKT

Je nach Antwort wird mehr oder weniger Energie bzw werden viele oder wenige Emissionen verbraucht Eine Treibhausgas-Bilanz kann helfen, genauere Daten zu ermitteln (siehe Seite 67)
Was den meisten Ausstellungsmacher*innen weniger bekannt sein dürfte, ist der hohe Emissionsfaktor von E-Mails im Projektverlauf Er reicht von 0,03 bis 26 Gramm pro E-Mail47 Ständig werden Informationen per E-Mail ausgetauscht und nicht selten eine ganze Reihe an beteiligten Personen dabei in CC gesetzt, häufig mit angehängter Datei Bei der Sonderausstellung Waste Age bspw entfielen 10,5 % der Ausstellungsemissionen bis Ende der Laufzeit (10 t CO2e; nach Abschluss des Projektes 28 t) auf die digitale Kommunikation mit 11 000 E-Mails, 11 GB Datenaustausch und 750 Stunden Video Calls48
Tipp: Statt jedes Mal Anhänge per E-Mail zu verschicken, können diese alternativ über einen Cloud-Speicher zugänglich gemacht und nur der Link versendet werden So wird die Datenlast deutlich verringert Für die interne Kommunikation im Haus werden zudem Chat-Programme empfohlen, über die sich die Projektbeteiligten austauschen können Dies erspart zudem überflüssige Dankes- und Bestätigungs-Mails An dieser Stelle sei zudem auf weiterführende Literatur zum Thema verwiesen, u a die Handreichung Nachhaltige Digitalisierung49 des Bundesverbandes Soziokultur e V
Zusammengefasst
Die Projektbeteiligten starten in der Regel mit dem Wissen, was sie sich an nachhaltigen Zielen für die Ausstellung vorgenommen haben In der Planungsphase wird konkretisiert, wie das Vorhaben innerhalb der Rahmenbedingungen umgesetzt werden kann Eine ressourcenschonende Planung bezieht verschiedene Aspekte eines verantwortungsvollen Einsatzes von Personal, Zeit, Budget, Materialien und Produkten ein Werkstoffe und digitale Anwendungen werden mit Bedacht gewählt und bestmöglich genutzt Dies gilt ebenso für deren Weiterverwendung Die Handlungsfelder Planung, Bau und Management stehen in der Planungsphase besonders im Fokus Mit konkreten Angaben zur Ausführung am Ende der Planungsphase wird die Produktion vorbereitet und es werden Aufträge vergeben Die Realisierung kann beginnen
Kaffeemühle aus Holz, Remscheid, 1910–1920 Heimatmuseum der Bessarabien- und Dobrudschadeutschen (D4229)
45 Nach einer Studie der Universität Lancaster war die IT- und Telekommunikationsindustrie bereits im Jahre 2019 für 2,8 % der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich Siehe: Weber, Klaus (2022): Wie umweltschädlich ist das Internet?, in: ZDF heute, www zdf de/nachrichten/panorama/internet-oekobilanz-klima-energie-100 html (letzter Zugriff: 07 09 2024)
46 Umweltbundesamt (2022): Digitale Nachhaltigkeit, www umweltbundesamt de/themen/digitalisierung/digitale-nachhaltigkeit (letzter Zugriff: 06 09 2024)
47 LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg: Der nachhaltige Warenkorb, www nachhaltiger-warenkorb de/klimabilanz-e-mail-vs-brief (letzter Zugriff: 06 09 2024)
48 The Design Museum London: exhibition design for our time (2023), www ecsite eu/sites/default/files/the_design_museum_impact_guide_feb23 pdf, S 11 (letzter Zugriff: 06 09 2024)
49 Bundesverband Soziokultur e V : Nachhaltige Digitalisierung, soziokultur de/wp-content/uploads/2023/09/202309_Nachhaltige-Digitalisierung pdf (letzter Zugriff: 06 09 2024)
MUSEUMSOBJEKTE
Statuette einer Frau Terrakotta, 19. Jahrhundert
Museum Alte Kulturen, Schloss Hohentübingen
Frauenfigur
Holz, Hans Schmitt, 1980-1987, Landesmuseum Württemberg
Niki de Saint Phalle: La Moyenne Waldaff Polyester, Acrylfarben, Metallsockel 1969 © Museum Ulm
Stiftung Sammlung Kurt Fried Foto: Bernd Kegler, Uml
Wir sind aus natürlichen Materialien hergestellt.




3. Materialien in Ausstellungen
In Ausstellungen wird eine ganze Reihe an unterschiedlichsten Materialien für verschiedene Zwecke eingesetzt Typische Materialien sind u a :
Holz bzw. Holzplattenwerkstoffe
Kunststoffe u a Acrylglas

Glas
Verbundwerkstoffe
Stahl und Aluminium
Papier, Karton
biobasierte, kompostierbare Materialien
Noch recht neu sind biobasierte und kompostierbare Materialien, die bspw aus Mycel (Pilz), Lehm oder Agar-Agar hergestellt sind Sie werden derzeit in ersten Ausstellungen erprobt oder sind Teil von künstlerischen Installationen Ihr Einsatz ist jedoch geringer gegenüber den anderen Materialien
Zu den problematischsten Stoffen gehören Verbundstoffe und Materialien aus PVCKunststoff, zu denen u a Aludibond und Forex-Platten zählen Beide Materialien werden sehr gerne in Ausstellungen eingesetzt, da sie sehr gut bedruckt und geschnitten werden können, vielseitig einsetzbar und kostengünstig sind Leider sind sie entweder schwer zu recyceln (Verbundstoffe) oder enthalten bedenkliche Stoffe wie Weichmacher (PVCKunststoff) Sogenannte Biokunststoffe nehmen derzeit zu und es bleibt abzuwarten, ob sie künftig auch im Ausstellungsbereich eingesetzt werden können
Das Prinzip Refuse, Reduce, Reuse, Recycle (verzichten, reduzieren, wiederverwenden und recyceln) verdeutlichte am Anfang des Kapitels, dass ein bewusster(er) Umgang mit Vorhandenem und Neuanschaffungen vonnöten ist, will man betriebsökologisch handeln Dies gilt auch für Materialien Die Abbildung der Materialhierarchie-Pyramide verdeutlicht, dass sowohl bei der Herkunft des Materials als auch bei der Nachnutzung Gebrauchtes zu bevorzugen und bei Neueinkäufen auf recycelte Ware bzw CO2 arme Rohstoffe geachtet werden sollte
Herkunft des Materials
Neuware und Rohstoffe: Stahl, PVC, tropische Harthölzer, synthetische Kunststoffe, Glitter, giftige Farben und Färbemittel, PVC (vermeiden)
CO2-arme Rohstoffe: Holz, Platten oder recycelter Stahl, natürliche und biologische Materialien
Wiederverwendete oder Netto-Null-Materialien: wiederverwendetes Holz oder Stahl, recycelte Materialien oder Verschnitt
Ein Vorleben in der Region (Lagerung, Second Hand, Verleih, andere Produktionen, Online-Sharing oder Tauschbörsen)
Ein Vorleben vor Ort oder am Veranstaltungsort (Lagerung, Second Hand, Verleih, andere Produktionen)
Einsparung unnötiger Materialien
15 Materialhierarchie-Pyramide des Green Theatre Book
Hieran wird ein bewusster Umgang mit Ressourcen verdeutlicht, sowohl in der Herkunft des Materials als auch in seiner Nachnutzung
Nachleben des Materials
Mülldeponie (vermeiden)
Als Biomasse zum Heizen verbrannt
Zerlegt und recycelt
Verkauft, gespendet, regional gelagert
Verkauft, gespendet, lokal oder am Veranstaltungsort gelagert
Einsparung unnötiger Materialien
Das Design Museum London hat für die Planung von Ausstellungen ein Schema entwickelt, welches Ausstellungsmacher*innen ermöglichen soll, Materialien je nach Einsatz für eine Dauer-, Sonder- oder Wanderausstellung bewerten zu können Das Schema wurde für deutschsprachige Museen übersetzt und als Vorlage für die nachfolgende Struktur genutzt Die ebenfalls aus aus England stammenden Materialkategorien – im Original vier Stück – wurden zugunsten einer übersichtlichen Materialampel zusammengefasst und um weitere Materialien ergänzt (siehe S 40) Dabei wurden die Ampelfarben in rot, gelb und grün beibehalten Die Materialampel bietet damit zu verschiedenen Materialtypen einen guten Überblick
Um welche Art von Ausstellung handelt es sich?
dauerhaft
Dauerausstellung (ab 5 Jahre und länger)
Erfasse den Bestand (bei bestehenden Dauerausstellungen soweit machbar)
Ist die Liste aktuell? Falls nein, aktualisiere die Liste
temporär Sonderausstellung
temporär und an versch. Orten Wanderausstellung
Bestandserfassung
Besteht eine Liste bzw Übersicht über alle Materialien, Bauten, Elemente, Vitrinen, Rahmen, Beleuchtungs- und Medientechnik etc ? In Dauerausstellungen über die ver- bzw eingebauten Elemente, bei Sonder- und Wanderausstellungen über alle verfügbaren und nutzbaren Elemente
Wiederverwendung von Vorhandenem Prüfe den Bestand auf die Nutzungsmöglichkeiten für die geplante Ausstellung
Neukauf Wenn Neuanschaffungen oder Neuproduktionen unumgänglich sind, achte beim Kauf oder der Herstellung auf eine langjährige Verwendungsmöglichkeit, gute Umweltverträglichkeit, leichte Reparaturfähigkeit und sortenreine Recyclingfähigkeit in der Nachnutzung
Dauerausstellung
Achte beim Kauf auf folgende Eigenschaften: langlebig, robust, modular gebaut,gute Reparaturund Austauschfähigkeit
Sonderausstellung
Achte beim Kauf auf folgende Eigenschaften: mehrfach nutzbar, leicht auseinander- und zusammenbaubar, flexibel, anpassbar, platzsparend lagerbar
Wanderausstellung
Achte beim Kauf auf folgende Eigenschaften: wenig Gewicht, robust, leicht auseinander- und zusammenbaubar, platzsparend pack-, transportier- und lagerbar
Nachnutzung / Entsorgung
Kann sichergestellt werden, dass die eingesetzten Materialien, Bauten, Vitrinen, Technik etc am Ende ihrer Nutzungsdauer anderweitig verwendet, abgegeben oder sortenrein recycelt werden können?
Prüfe die Möglichkeiten, wie künftig ein Wegschmeißen von Ressourcen und/oder Sondermüll vermieden werden kann Ja Nein
Ergänze die Bestandsliste mit Angaben zur möglichen Nachnutzung (z B Abgabe an Materialbörsen) bzw zur Abfallverwertung (recyclingfähig ja/nein) als »End-of-Life-Plan«
16 Struktur für den Einsatz von Materialien in Dauer-, Sonder- und Wanderausstellungen
Materialampel
Für alle Materialien gilt, dass diejenigen, bei denen Ökostrom zur Herstellung verwendet wurde, eine bessere CO2e-Bilanz aufweisen
Material Rot
Stahl nur einmal genutzt bzw nicht langjährig einsetzbar oder wiederverwendbar
Aluminium grundsätzlich sollte
Gelb
Grün
aufgrund seiner Konstruktion schwer auseinanderbaubar bzw kaum wiederverwendbar mit hohem Recyclinganteil, mehrfach in Gebrauch bzw langjährig eingesetzt
Aluminium aufgrund seiner bedenklichen Umweltverträglichkeit nur mit Bedacht eingesetzt werden nur einmalig in Gebrauch mit hohem Recyclinganteil, mehrfach in Gebrauch bzw langjährig eingesetzt
Vollholz (u a Konstruktionsvollholz KVH)
nur einmalig in Gebrauch, nicht zertifiziert
Holzwerkstoffplatte nur einmalig in Gebrauch, nicht zertifiziert
min FSC/PEFC-zertifiziert mit Gebrauchtholzanteil, min FSC/PEFC zertifiziert bzw mit Umweltzeichen wie Holz von Hier, natureplus, Blauer Umweltengel etc , mehrfach in Gebrauch
min FSC/PEFC-zertifiziert mit Gebrauchtholzanteil, min FSC/PEFC zertifiziert bzw mit Umweltzeichen wie Holz von Hier, natureplus, Blauer Umweltengel etc , mehrfach in Gebrauch
MDF-Holzwerkstoff mit Formaldehyd-Anteil, nur einmalig in Gebrauch, nicht zertifiziert
Verbindung dauerhafte Verbindung wie Montagekleber, Klebstoff etc
Glas/Kunststoff Plexiglas aus Polymethylmethacrylat (PMMA), ohne Recyclinganteil, nur einmalig in Gebrauch
Paneele nur einmalig in Gebrauch, nicht zertifiziert
formaldehydfrei verleimt, min FSC/PEFC zertifiziert alternativ: Dreischichtplatte oder Sperrholz formaldehydfrei, min FSC/PEFC zertifiziert bzw mit Umweltzeichen wie Holz von Hier, natureplus etc , mehrfach in Gebrauch
geschraubte Verbindung lösbare Verbindungen ohne Schrauben oder Kleber etc wie z B Holzdübel
recyceltes Acrylglas Glas (Klarglas) mit Recyclinganteil, kohlenstoffarm produziert, mehrfach in Gebrauch
min FSC/PEFC zertifiziert Recyclingware, Paneele mit Gütesiegel wie Blauer Engel, mehrfach in Gebrauch alt auch Leichtbauplatte aus recyceltem Altglas
Material Rot Gelb
Bodenbelag PVC, nur einmalig in Gebrauch
Teppich, mehrfach in Gebrauch
Farben
Textilien
Farbe mit hohem VOC-Anteil (flüchtige organische Verbindungen/ Ausdünstungen)
Materialmix, keine Bioware, Textil mit Kunststoffanteil
Drucke Druck auf Verbundmaterialien, nur einmalig in Gebrauch
17 Materialampel
Farbe ohne VOC-Anteil
Grün
Bodenbeläge aus Sisal, Kork, natürlicher Kautschuk und/oder mit Recyclinganteil, Linoleum, Vinyl ohne PVC-Anteil und recycelbar, Laminatfußboden, Nadelvlies etc mit Gütesiegel wie Blauer Engel, GuT, TFI-TÜV, mehrfach in Gebrauch
biobasierte Farben, auf Wasserbasis, mit Gütesiegel wie Blauer Umweltengel, natureplus etc
recyceltes Textil
Direktdruck, mehrfach in Gebrauch
Naturtextilien, naturbelassen bzw kaum gefärbt, mit Gütesiegel wie Cradlet to Cradle, Baluer Umweltengel, EU Ecolabel, Naturtextil IVN etc , mehrfach in Gebrauch
Direktdruck mit biobasierten Farben auf Papier, Karton, Tapete mit Recyclinganteil, mit Gütesiegel wie Blauer Engel, EU Ecolabel, ÖkopaPlus etc , Druckmaterialien mehrfach in Gebrauch
Das Schema lehnt sich an die vier RAGs vom Designmuseum London an und wurde für den Gebrauch in deutschsprachigen Museen überarbeitet und übersetzt
Fazit
Die Websites nachhaltige-ausstellungen.de oder Wecobis bieten eine gute Übersicht über verschiedene Ausstellungsmaterialien Ergänzend dazu stellt das Schema des Designmuseums London mit seinen vier Kategorien eine erste Hilfestellung dar, Materialien nach nachhaltigen bzw umweltfreundlichen Kriterien auswählen zu können, auch wenn nicht alles davon auf deutsche Museen übertragbar ist Ein Planen und Bauen in der Kreislaufwirtschaft sollte von Anfang an mitgedacht, und es sollten nachhaltigere Alternativen zu bisher bekannten Werkstoffen berücksichtigt werden Dabei sind pauschal-stigmatisierende Aussagen wie »Holz ist immer nachhaltig« oder »Plastik ist immer schädlich« zu vermeiden Es gilt, genau hinzuschauen, statt Allgemeinplätze zu bedienen!
4. Nachhaltiger Leihverkehr
In Kapitel 4A wurde bereits darauf eingegangen, dass der Leihverkehr von Exponaten einen großen Anteil an den Emissionen einer Ausstellung haben kann Am Beispiel einer Treibhausgasbilanz eines größeren Museums entfielen 41 % der CO2e-Emissionen innerhalb eines Jahres auf die Anlieferung und Abholung von Kunstwerken, inklusive der begleitenden Kurierreisen sowie der für die Ausstellung getätigten Geschäftsreisen
In Relation bedeutete dies knapp 280 000 gefahrene oder geflogene Kilometer, welche ca 300 Tonnen CO2e verursachten 51 Für viele Ausstellungshäuser, die über keine eigene Sammlung verfügen, oder für Museen, welche traditionsgemäß überwiegend mit Leihgaben arbeiten, bedeutet dies nicht selten einen Zielkonflikt in der Ausstellungspraxis, wenn sie emissionsärmer arbeiten wollen
Mit dem Flieger, Zug oder LKW – Auswahl der Transportmöglichkeiten Neben Überlegungen, wie viele Exponate geliehen werden und woher sie stammen, ist ein erster wichtiger Schritt zur Reduktion von Emissionen die Art des Transportes; gleich ob dieser von Fachunternehmen, die auf Exponathandling spezialisiert sind, durchgeführt wird oder vom Museumsteam selbst Als Verkehrsträger werden je nach Leihbedingungen u a Lastenräder, PKWs, LKWs, Züge, Flugzeuge oder Seeschiffe eingesetzt Es dürfte dabei kaum verwundern, dass geflogene Exponate den höchsten CO2e-Anteil haben Wird bspw ein Objekt von Berlin nach Mailand transportiert, verbraucht es per Flieger 1,546 Tonnen CO2e, mit dem LKW nur 0,077 Tonnen (als Teilladung in einem ausgelasteten LKW) 52 Da jedoch noch weitere Faktoren für einen Exponattransport eine Rolle spielen, kann das folgende Schema helfen, ein geeignetes Transportmittel auszuwählen Dabei sollte beachtet werden, dass es Transportbedingungen und Strecken gibt, die mit der Darstellung nicht übereinstimmen
18 Abbildung der Firma Hasenkamp zum Vergleich verschiedener Verkehrsträger zum Transport von Exponaten
MUSEUMSOBJEKT
Der kleine Lieferant mit Federwerkantrieb, Firma Fernand Martin, Frankreich, 1900 Kleines Museum HagnauSpielzeug aus 2 Jahrhunderten, Gerda-Marie Rößler
Ich liefere nachhaltig aus!



Bei einem Transport mit einem LKW werden vier Arten unterschieden:
• Exklusiver Direkttransport: Der LKW fährt nur von der Abholung zur Auslieferung
• Direkttransport: Der LKW fährt nach Abholung am gleichen Tag zur Auslieferung
• Kombinierte Direktfahrt (oder auch Sammeltransport genannt): Der LKW darf am gleichen Tag weitere Stationen anfahren
• Beiladung: Als Beiladung bezeichnet man die Mitnahme zusätzlicher Objekte auf einem bereits feststehenden Transport Die Zustellung erfolgt innerhalb von 5–10 Tagen
Sammelfahrten und Beiladungen haben den geringsten CO2e-Ausstoß, ein exklusiver Direkttransport den höchsten Für kürzere Strecken wird von Speditionen zunehmend auch E-Mobilität angeboten Bei Ausschreibungen sollte auf die Vermeidung von Leerfahrten sowie intelligente Routenführung zur Emissionsvermeidung im Leihverkehr hingewiesen werden
Die digitale Begleitung
Nicht nur Exponate reisen, sondern auch Kurier*innen und/oder Restaurator*innen, welche das Stück begleiten und vor Ort sicherstellen, dass dieses schadensfrei angeliefert wurde bzw nach der Ausstellung schadensfrei die Rückreise antreten kann Seit der Corona-Pandemie werden neben analogen Kurierbegleitungen auch digitale durchgeführt Diese hybride Form der Begleitung kann eine Menge an CO2e-Emissionen einsparen Zur Durchführung sind vor allem die technischen Voraussetzungen wie eine stabile Internetverbindung, die Qualität der Kamera und die Nutzung eines Stativs (bspw Gimbal) für das Gelingen einer virtuellen Kurierbegleitung entscheidend53 Ein Laptop auf einem Rollwagen, kombiniert mit einem Smartphone oder Tablet mit hochauflösender Kamera, empfiehlt u a der Arbeitskreis Konservierung/Restaurierung im Deutschen Museumsbund e V zur Durchführung 54 Neben der Technik werden präzise angefertigte Zustandsprotokolle sowie Packanweisungen samt Fotos und natürlich der Einbezug der Restaurator*innen der jeweiligen Häuser angeraten
Die Ergänzung von analogen Begleitungen durch digitale Formate spart neben Emissionen auch Geld und Arbeitszeit Dennoch gibt es Grenzen Technische Probleme, Sprachbarrieren oder der hohe Aufwand in der Abstimmung seien hierfür beispielhaft genannt Unklar sind auch Haftungsfragen, wenn aufgrund nicht erkannter Schäden falsche Entscheidungen getroffen werden Alternativ kann deshalb über die Beauftragung von freiberuflichen Restaurator*innen, welche in der Nähe des leihnehmenden Museums arbeiten, nachgedacht werden
Exponate nachhaltig verpacken
Um Exponate und/oder Kunstwerke, die im Rahmen des Leihverkehrs von einem Ort zum anderen gebracht werden, vor Klimaschwankungen, Erschütterung, Witterung, Berührung oder weiteren Einwirkungen zu schützen, werden sie verpackt Nicht selten geht damit ein hoher Verbrauch von Ressourcen einher Typische Verpackungsmöglichkeiten reichen bspw von Luftpolsterfolie, Tyvek, Kartonagen bis hin zu Transportrahmen oder -kisten, welche zum Teil klimatisiert sind (Klimakiste)
Bei den Verpackungen finden sich zunehmend umweltfreundliche und/oder recycelte Materialien So gibt es inzwischen Polsterkissen aus recycelter Altkartonage (statt aus Kunststoff) oder Verpackungschips aus Maisstärke Der Leitfaden »Klimaschutz im Museum« des Deutschen Museumsbundes e V bietet weiterführende Tipps für ein sorgsames Materialmanagement im Sammlungsbereich55
Für die Herstellung von Klimakisten werden eine ganze Reihe verschiedenster Materialien eingesetzt, darunter Holz, Sperrholz, Kunststoff, Schaumstoff, Aluminium, Stahl, Gummi, Klettband und Silikon Doch auch hierfür gibt es Alternativen Neben Leihkisten werden von Kunstspeditionen auch solche angeboten, welche überwiegend aus Recyclingmaterialien wie PET-Flaschen, ausgedienten LKW-Reifen und Kaffeesäcken gefertigt sind Andere Transportkisten sind wiederum so langlebig erstellt, dass sie laut Hersteller für mindestens zwei Jahrzehnte halten und am Ende ihrer Laufzeit fast komplett recycelbar sind56 Zudem gibt es kluge Systeme, bei denen die Kisten einheitlich groß produziert werden, und die dank verschiedener Inletts für unterschiedlich große Exponate genutzt werden können
Klimakorridore im Leihvertrag vereinbaren
Vermehrt nutzen Museen, welche über eine Klimatisierung in ihren Ausstellungsräumen verfügen, einen Klimakorridor Durch die Tolerierung größerer Feuchtigkeitsschwankungen und einer höheren Temperaturspanne kann der Energieverbrauch in klimatisierten Räumen deutlich gesenkt, und es können damit Kosten und Emissionen eingespart werden Gibt es besondere Objekte mit höheren Anforderungen, kann es zielführend sein, diese im Hinblick auf klimatische Stabilität und spezifische Werte gesondert zu behandeln und nicht das gesamte Raumklima nach ihnen auszurichten57
Die Aufbewahrung und/oder Präsentation von Exponaten in Räumen mit Klimakorridoren sind in jedem Fall mit fachkundigen Restaurator*innen, den Leihgeber*innen und Versicherungen abzusprechen, und es müssen entsprechende Verträge angepasst werden Dies kann auch für ausgehende Leihgaben gelten Die Kunstsammlung NRW beispielsweise hat die Nutzung von Klimakorridoren in ihren Leihverträgen adaptiert, um Projektpartnern die Umsetzung ähnlicher Maßnahmen zu ermöglichen58
55 Deutscher Museumsbund e V (2023): Leitfaden Klimaschutz im Museum, www museumsbund de/wp-content/uploads/2023/05/dmb-leitfaden-klimaschutz pdf (letzter Zugriff: 06 09 2024)
56 Turtle uNLtd: Nachhaltigkeit, turtlebox com/de/nachhaltigkeit (letzter Zugriff: 06 09 2024)
57 Verband der Museen Schweiz (2022/2024): Plattform Museumsklima, www museums ch/de/unser-engagement/schwerpunkte/nachhaltigkeit/plattform-museumsklima-1515 html (letzter Zugriff: 06 09 2024)
58 www museumsbund de/klimabedingungen-in-museumssammlungen-energienutzung-im-wandel (letzter Zugriff: 06 09 2024)
§ 9
Klima- und Beleuchtungswerte
Folgende Klima- und Beleuchtungswerte sind vorgeschrieben:
Die Klima- und Beleuchtungswerte müssen konstant nachgewiesen werden können
19 Angabe Klimakorridor im Leihvertrag: Beispielhafte Darstellung zu zulässigen Richtwerten für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Licht, welche von der Kunstsammlung NRW im Leihvertrag eines Exponates angegeben sind.
Fazit
Auch im Leihverkehr gibt es eine Menge Stellschrauben, die eine nachhaltigere Ausstellungspraxis verbessern Die verschiedenen Möglichkeiten insbesondere in den Handlungsfeldern Mobilität (Transport), Energie (Klimakorridor) und Abfall (weniger Verpackung, umweltfreundlichere Materialien) sind in jedem Fall mit Restaurator*innen, den leihgebenden Museen, den Versicherungen und Transportunternehmen abzusprechen Es gibt mehr Möglichkeiten als man denkt!
Nachhaltige Realisierung
Die Realisierungsphase
Die Realisierungsphase beinhaltet die Umsetzung der Ausstellung. Sie setzt mit der Einleitung des Vergabeverfahrens für den Ausstellungsbau bzw. der Übergabe der Ausführungspläne an die hauseigenen Werkstätten ein und endet mit der Eröffnung der Ausstellung. Manche Teilaufgaben wurden bereits in früheren Phasen begonnen und/ oder sie sind, je nach Projektverlauf und -umfang, bereits abgeschlossen. Die Grenzen sind hier fließend.
Die Phase kennzeichnet das konkrete Bauen, Umsetzen und Herstellen. Eine erneute Vergrößerung des bisherigen Teams tritt ein: Es kommen Kolleg*innen aus den eigenen Werkstätten oder museumsexterne Firmen hinzu, was zu vermehrten Absprachen und Aufgaben in der Projektkoordination führt59
Mit der konkreten Umsetzung der Ausstellung erhöht sich die Kommunikation zwischen den Mitarbeitenden, Externen, Firmen und Projektpartnern Alle Beteiligten sind nicht nur zu Beginn der Zusammenarbeit bzw bei der Angebotseinholung von externen Leistungen, sondern wiederholt im Verlauf des Projektes gezielt über die nachhaltige Ausrichtung der Ausstellung zu informieren Dies kann beispielsweise im Rahmen von Projekt- bzw Baubesprechungen stattfinden (Handlungsfeld Kommunikation) Bestenfalls wird hierdurch die Motivation des Teams geweckt Sowohl Mitarbeiter*innen des Museums (darunter auch extern angegliederte Abteilungen wie die Verwaltung, Restaurierungswerkstatt oder Haustechnik sowie freie Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen) als auch extern beauftragte Gestaltungsbüros, Fachfirmen, Versicherungen oder Transportunternehmen haben in vielen Fällen sehr gute Ideen für eine nachhaltige Umsetzung Oft kennen sie umweltfreundliche Alternativprodukte, fragen Sie daher gezielt nach Möglichkeiten und Optionen!
1. Das Design-Briefing
Das Design-Briefing fängt bereits bei der Beschreibung von Leistungen an, welche u a Ausstellungsgestalter*innen60 übernehmen sollen Gestaltungsbüros werden in der Regel in der Planungsphase beauftragt, jedoch wurde das Design-Briefing aus Gründen der Verständlichkeit an dieser Stelle mit dem nachfolgenden Exkurs Vergabe zusammengefasst
Design-Briefing
Ein Design-Briefing ist ein Dokument, das die Kernbestandteile und wichtigsten Anforderungen sowie Rahmenbedingungen eines Ausstellungsvorhabens zusammenfasst
Für eine Ausstellungsgestaltung bspw : Nennung des Themas der Ausstellung inkl kurze Beschreibung der Inhalte, Nennung der Zielgruppen und Projektverantwortlichen, Auflistung der Highlight-Exponate, Angaben zur Zeitund Budgetplanung, Darstellung der Räumlichkeiten (z B Mitschickung eines Grundrisses und Fotos des Raumes) und Angaben zum gewünschten Umfang der Leistungen
Für grafische Leistungen wie die Gestaltung einer Ausstellungsgrafik bspw : Nennung des Themas der Ausstellung inkl kurze Beschreibung der Inhalte, Nennung der Zielgruppen und Projektverantwortlichen, Angaben zur Zeit- und Budgetplanung, Angaben zum Corporate Design des Museums (soweit vorhanden) und Angaben zum gewünschten Umfang der Leistungen
In Bezug auf die Nachhaltigkeit sind für eine Ausstellungsgestaltung folgende Punkte relevant:
• Nennung der allgemeinen Nachhaltigkeitsziele des Museums oder Auszüge aus einer Nachhaltigkeitsstrategie (soweit vorhanden)
• Nennung der wesentlichen Nachhaltigkeitsziele der Ausstellung
• Auflistung der für die Ausstellung im Haus vorhandenen und einsetzbaren Vitrinen, Medien und Beleuchtungstechnik sowie des Mobiliars und der Rahmen
• Angaben zur Berücksichtigung von nachhaltigen Design- und Produktionsmethoden als sogenannte Muss- oder Kann-Kriterien
• Forderung von Designlösungen, welche unnötigen Abfall und/oder umweltschädliche Materialien vermeiden
• Angabe zur leichten Demontierbarkeit und Wiederverwendbarkeit von Bauten als Muss- oder Kann-Kriterien
• Angabe, ob die Ausstellung zur Weitergabe geplant oder als Wanderausstellung umgesetzt werden soll
• Nennung der vom Museum geplanten Nachnutzungsmöglichkeiten der Ausstellung
Seien Sie bei allen Angaben so spezifisch, aber auch realistisch wie möglich Geben Sie an, zu wieviel Prozent bspw vorhandene Materialien wiederverwendet werden müssen oder neu hergestellte Bauten aus recycelbaren Materialien bestehen sollen (soweit Sie dies einschätzen können) Ein gutes Beispiel ist das Haus der Bayerischen Geschichte, welches seine Vorgaben für Gestaltungsbüros auf seiner Website veröffentlicht hat 61
Hinweis: Die museumseigenen Listen mit für die Ausstellung verfügbaren Materialien müssen zwingend aktuell sein Sollte sich im Verlauf der Planung herausstellen, dass Vitrinen fehlen oder aufgelistete Beamer doch nicht zur Verfügung stehen, geht der Mehraufwand der Planung nicht zu Lasten der Gestalter*innen, sondern ist nachträglich separat zu honorieren Eine gute Dokumentation bringt viele Vorteile mit sich! Zu wissen, was man hat und wo es untergebracht ist, spart unnötiges Suchen und doppelten Planungsaufwand Einmal pro Jahr sollte eine Inventur durchgeführt werden, siehe auch Seite 64 Diese kann man dazu nutzen, Überflüssiges bspw an lokale Vereine, Werkstätten oder an Materialbörsen (wie den vom Deutschen Museumsbund62) abzugeben oder ggf zu entsorgen Das entschlackt das Lager und dient der besseren Übersicht
2. Besprechungen nachhaltig gestalten
Auch die Art und Weise, wie Meetings durchgeführt werden, kann unnötige Emissionen vermeiden Im Projektmanagement sollte deshalb festgelegt werden, welche Besprechungen online stattfinden können und welche besser vor Ort durchzuführen sind (etwa, um sich Exponate anzuschauen oder im Ausstellungsraum bestimmte Dinge zu klären) Auch hybride Formate setzen sich mehr und mehr durch Es gilt abzuwägen, ob Personen, welche weite Strecken zum Museum zurücklegen müssen, nicht besser digital teilnehmen können Neben einer stabilen Netzverbindung erfassen Universalgeräte wie bspw eine Meeting Owl 3 per Audio und Bild die Teilnehmer*innen vor Ort
und ermöglichen eine gute Verständigung Auch digitale Boards und eine in einer Cloud organisierte Datenablage erleichtern eine kollaborative Zusammenarbeit
3. Nachhaltige Vergabe
Das Handlungsfeld Beschaffung und Vergabe ist neben der Mobilität, Energie und dem Abfall elementar zur Verringerung des Footprints Bei wem wir produzieren lassen, welche Materialien dafür verwendet werden, wo wir einkaufen und welche Wege mit welchem Verkehrsmittel dafür zurückgelegt werden, bestimmen den CO2e-Wert eines Produktes oder einer Dienstleistung
Was ist eine nachhaltige Beschaffung?
Nachhaltig ist die Beschaffung, wenn sie Ressourcenschutz, Menschenrechten und fairem Handel Rechnung trägt Sowohl soziale als auch ökologische Aspekte sollten während der gesamten Lieferkette und dem Lebenszyklus eines Produktes betrachtet werden Ziel ist es, den Einfluss von Einkauf und Verbrauch auf die Umwelt und zukünftige Generationen möglichst gering zu halten Eine nachhaltige Beschaffung umfasst alles, was eingekauft und verbraucht wird – von Papier, Strom oder Dienstfahrzeugen bis hin zu den für Ausstellungen verwendeten Materialien Eine nachhaltige Beschaffung ist eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN (Sustainable Development Goals, SDG) Im Unterziel 12 7 heißt es: »In der öffentlichen Beschaffung sollen nachhaltige Verfahren gefördert werden «63
Die Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsstrategie im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in Baden-Württemberg hat zur Beschaffung den empfehlenswerten Leitfaden Nachhaltige Beschaffung konkret. Arbeitshilfe für den umweltfreundlichen und sozialverträglichen Einkauf in Kommunen mit vielen Tipps herausgebracht 64 Darin wird u a der Rechtsrahmen zur Berücksichtigung von Umweltkriterien und Sozialstandards erläutert: »Unabhängig vom Auftragswert ist es […] grundsätzlich möglich, Anforderungen an die Nachhaltigkeit der beschafften Güter oder Dienstleistungen zu stellen, solange die Grundsätze der Gleichbehandlung, der Transparenz, des freien Warenverkehrs, der Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs eingehalten werden […]« Das bedeutet, dass Nachhaltigkeitsstandards beim Einkauf berücksichtigt werden können, jedoch regionale Firmen nicht per se bevorzugt werden dürfen (Grundsatz der Gleichbehandlung)
In einer Angebotswertung sind soziale und umweltorientierte Gesichtspunkte darüber hinaus nicht nur ein Kann-Kriterium, sondern durch den Gesetzgeber zum Teil bereits Pflicht 65 Der Leitfaden räumt ebenfalls mit dem Vorwurf auf, dass das wirtschaftlichste Angebot das billigste meint: »Haushaltsrechtlich sind Mehrpreise aufgrund von Umweltverträglichkeit oder besseren Produkteigenschaften gerechtfertigt […] und der höhere Preis für die Beschaffung unter Umständen kein Hindernis […] «
63 Gifhorn, Nicole; Hrsg (2022): Bündnis Eine Welt Schleswig-Holstein; Kiel, www bei-sh org/news-reader-globales-lernen/tun-was-wir-lehren (letzter Zugriff: 07 09 2024)
64 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (2017): Nachhaltige Beschaffung konkret, um baden-wuerttemberg de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Umwelt/ Nachhaltigkeit/Leitfaden_Nachhaltige_Beschaffung_konkret pdf (letzter Zugriff: 06 09 2024)
65 Baden-Württemberg Landesrecht (2019): Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Vergabe von Aufträgen im kommunalen Bereich, www landesrecht-bw de/bsbw/document/VVBW-VVBW000030370 (letzter Zugriff: 07 09 2024)
Tipp: Wer noch nie ein Leistungsverzeichnis erstellt oder an einem Vergabeverfahren mitgewirkt hat, kann zum besseren Verständnis der komplexen Materie auf das Handbuch Ausstellungspraxis in Museen66 zurückgreifen
Nachhaltigkeit bewerten
Grundsätzlich gilt, dass nachhaltige Kriterien für die Beauftragung von externen Leistungen sowohl bei den Eignungs- als auch Wertungskriterien angewendet werden können Dies meint, dass zum einen bereits bei der Auswahl von Unternehmen nachhaltige Kriterien berücksichtigt werden können Kriterien der Eignung sind, neben der fachlichen Qualifikation und Einhaltung arbeitsrechtlicher Bestimmungen (werden automatisch abgefragt), folgende:
• Keine Verstöße gegen Umweltrecht
• Anwendung von Normen für das Umweltmanagement (z B EMAS)
Auch Referenzen sind zur Bewertung der Eignung zulässig Je nach Vergabeverfahren (öffentliche Ausschreibung, beschränkte Ausschreibung, freihändige Vergabe mit/ohne Teilnahmewettbewerb, Direktauftrag etc ) wird die Eignung der Firmen oder Dienstleister vor der Angebotsabgabe geprüft
Bei der Angebotsabgabe können neben dem Preis bis zu 70 % nachhaltige Wertungskriterien (auch Zuschlagskriterien genannt) geltend gemacht werden Diese sind67:
• Qualitative, umweltbezogene oder soziale Kriterien, u a nachgewiesen durch die Einhaltung von Gütesiegeln und/oder Zertifikaten
• Die Berechnung von Lebenszykluskosten
Hinweis: Die Kriterien der Eignung und der Wertung sind vorab transparent zu kommunizieren! Listen Sie bei den Vergabeunterlagen auf, welche Nachhaltigkeitskriterien wie bewertet werden (bspw mit einer prozentualen Verteilung) Dabei ist zu beachten, dass eine Verbindung zum Auftragsgegenstand bestehen und eine Verhältnismäßigkeit der geforderten Eignungs- und/oder Zuschlagskriterien gegeben sein müssen (nichts verlangen, was das Unternehmen nicht leisten kann) Und – es können nicht dieselben Angaben zweimal bewertet werden! Werden beispielsweise Referenzen verlangt, können diese entweder nur bei der Eignung berücksichtigt werden oder in die Wertung des Angebotes einfließen
Leistungen beschreiben
Eine Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis oder Leistungsprogramm beschreibt, was produziert oder geliefert werden soll bzw welche Leistungen gefordert und/oder gewünscht sind In der Leistungsbeschreibung werden die Merkmale des Auftragsgegenstandes genannt, u a welche Aspekte der Qualität, Innovation und/oder soziale sowie umweltbezogene Kriterien zu erfüllen sind Man unterscheidet dabei Kann- und Muss-Kriterien Für einen Nachweis der Kriterien können Gütesiegel oder Zertifikate verlangt werden, ggf auch die Berechnung von Lebenszykluskosten (Tipp: Zur Angabe von Lebenszykluskosten kann u a das Excel-Tool des Umweltbundesamtes
66 Arbeitskreis Ausstellungen im Deutschen Museumsbund e V (2023): Handbuch Ausstellungspraxis in Museen, www museumsbund de/wp-content/uploads/2023/05/2023-ausstellungspraxis-in-museen-160dpi pdf (letzter Zugriff: 06 09 2024)
67 Kötter, Patrick/LWL-Rechnungsprüfungsamt (2022): Nachhaltige Vergabe Vortrag im Rahmen der AG Nachhaltig Ausstellen, AK Ausstellungen im Deutschen Museumsbund e V , in Auszügen veröffentlicht unter: www museumsbund de/wp-content/uploads/2022/12/nachhaltig-ausstellen-handout pdf (letzter Zugriff: 06 09 2024)
68 Umweltbundesamt (2023): Lebenszykluskosten, www umweltbundesamt de/themen/wirtschaft-konsum/umweltfreundliche-beschaffung/lebenszykluskosten (letzter Zugriff: 06 09 2024)
verwendet werden68) Auch hier gilt: Nichts verlangen, was es nicht gibt! Werden Gütesiegel auf Produkte angegeben, ist vorab sicherzustellen, dass diese die geforderten Auflagen erfüllen
Weitere Anwendungsbeispiele nachhaltiger Aspekte in der Leistungsbeschreibung sind u a :
• Begrenzung des Energieverbrauchs (z B Betriebszustand, Stand-by)
• Reduktion von umwelt- oder gesundheitsgefährdenden Stoffen im Produkt
• Ressourcenschonender Materialeinsatz (z B Nutzung von Recyclingmaterialien)
• Langlebigkeit (z B Reparierbarkeit, Ersatzteilversorgung, Update-Fähigkeit)
• Recyclinggerechte Konstruktion (z B lösbare Verbindungen, geringe Materialvielfalt, Kennzeichnung von Kunststoffen)
• Geringe CO2e-Emissionen bei Transport und Nutzung
Beispiel Ausschreibung Ausstellungskatalog und Schema der Bewertung Am Beispiel eines Auszuges aus einem Leistungsverzeichnis für einen Ausstellungskatalog soll die Vergabe mit nachhaltigen Wertungskriterien verdeutlicht werden Ein Leistungsverzeichnis (abgekürzt LV) setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen Während anfangs allgemeine Angaben zum Projekt wie bspw das Ziel der Ausschreibung, der Zeitplan und die Mitwirkenden an dem Projekt genannt werden, geht es nachfolgend um die detaillierte Beschreibung der Leistungen, die ein Unternehmen zu erbringen hat Häufig wird einem LV ein Preisblatt angefügt, in dem die zum Angebot aufgeforderten Unternehmen ihre Preise eintragen können Auch Ergänzungen wie Pläne, Fotos, schriftliche Konzepte, technische Angaben, ein Facility Report und weitere Informationen werden – je nach Umfang einer Vergabe – mitgeschickt
Um Nachhaltigkeit in einer Ausschreibung zu platzieren, sollten bereits im allgemeinen Teil Angaben zur Nachhaltigkeit gemacht werden, bspw kann ein Auszug aus der Nachhaltigkeitsstrategie des Museums angegeben oder die Nachhaltigkeitsziele der Ausstellung genannt werden In der nachfolgenden konkreten Leistungsbeschreibung werden hernach detaillierte Vor- und Angaben zur Nachhaltigkeit gemacht, bspw zu umweltfreundlichen Materialien oder einer ressourcenfreundlichen Herstellung
Bei der Ausschreibung eines Ausstellungskatalogs wurden bei der Verarbeitung und dem Druck auszugsweise folgende Punkte genannt:
VERARBEITUNG
DRUCK
• Papier innen: 135 g/qm weiß, geeignet für Bilderdruck, matt, 100 % Recycling-Papier mit dem Umweltsiegel Blauer Engel oder vergleichbar ausgezeichnet
• Vorsatz/Nachsatz: Recycling Offset, 120 g/qm oder stärker, 100 % Recycling-Papier, ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen Blauer Engel, Euroblume oder gleichwertig
• Bezug: 150 g/qm weiß Bilderdruck matt, Papier mit dem Umweltsiegel Blauer Engel oder vergleichbar ausgezeichnet
• Überzug: 4/0 farbig mit Kaschierung matt ohne Lackierung
• Drucktinte: Verwendung von Bio-Druckfarben ohne Schadstoffe und Mineralölanteil
Die Biofarben entsprechen den Vorgaben eines der folgenden Gütesiegel: EU-Ecolabel, Nordic Swan, Blauer Engel (UZ 195) oder dem Österreichischen Umweltzeichen (UZ 24)
WEITERVERARBEITUNG
• Schneiden, Falzen, Fadenheftung, Ableimen, in Buchdeckel einbinden
• Einschweißen der Bände möglichst vermeiden! Stattdessen umweltfreundliche Alternative anbieten, beispielsweise Kunststoffmaterial aus Rezyklaten, Papierumschläge oder Verpackung in Kartons
• Fertige Druckware transportsicher auf Europalette absetzen
Zudem wurden nicht nur das Preisangebot gewertet, sondern auch die Nachhaltigkeitsaspekte der anbietenden Firmen:
Dem Museum ist es wichtig, dass der Preis nicht das ausschlaggebende Kriterium ist Bewertet werden zudem nachhaltige Umsetzungen und betriebsökologische Maßnahmen der Firmen mit 50 %
Aus diesem Grund ist dem Angebot eine Anlage wie folgt anzufügen:
Angaben zur Nachhaltigkeit in Ihrem Betrieb. Gehen Sie insbesondere auf folgende Punkte ein:
1 Referenzen im Bereich umweltfreundlicher Druck, soweit vorhanden
2 Angaben zur Nachhaltigkeit im eigenen Betrieb (soweit vorhanden), beispielsweise Angaben zur Nutzung von Ökostrom, Druck im Sammeldruckverfahren, emissionsarm hergestellte Produkte, CO2-Bilanzierungen mittels Umweltmanagementsystemen wie EMAS oder andere
Die Angaben sind nachweislich zu benennen und mit Zertifikaten zu belegen
3 Angaben zu recyclingfähigen Druckpapieren und umweltschonenden Druckverfahren inklusive der verwendeten Gütesiegel
4 Angaben zum nachhaltigen Transport der Ware, beispielsweise durch E-Mobilität oder Sammelfahrten (sofern bereits umgesetzt)
5 Angaben zur Erreichung eines klimaneutralen Drucks, insbesondere Angaben zur Vermeidung von Emissionen und bei Kompensation Angaben zu den Ausgleichszertifikaten
Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot auf Grundlage der nachstehenden Kriterien erteilt:
a ) Preis (50 %)
Die Angebotssumme wird durch Addieren der wertungsrelevanten einzelnen Positionen ermittelt Der niedrigste Preis erhält die volle Punktzahl (100 Punkte), die übrigen werden im Verhältnis niedriger bewertet b ) Angaben zu Nachhaltigkeitskriterien (50 %)
Die Bewertung des vom Bieter eingereichten Angebotes erfolgt zusätzlich anhand der zuvor beschriebenen Kriterien der Nachhaltigkeit, insbesondere:
1 Referenzen im Bereich umweltfreundlicher Druck
2 Angaben zur Nachhaltigkeit im eigenen Betrieb
3 Angaben zu recyclingfähigen Druckpapieren und umweltschonender Druckart inklusive Gütesiegel
4 Angaben zum nachhaltigen Transport der Ware
5 Angaben zur Erreichung eines klimaneutralen Drucks
Jedes Kriterium kann maximal 20 Punkte erzielen Die Gesamtpunktzahl der genannten
5 Kriterien fließt mit einer Gewichtung von 50 % in die Gesamtwertung ein Die Gesamtbewertung des Angebotes wird im angegebenen prozentualen Verhältnis (50/50) ermittelt
Name Auftraggeber Wertung
Datum Vergabenummer:
Nachhaltigkeitskriterien (50%)
1 Referenzen umweltfreundlicher Druck Nennen Sie bis zu drei Referenzen
Punkte: gesamt 20
2 Angaben zur Nachhaltigkeit im eigenen Betrieb Nennen Sie bis zu vier ökologische und/oder soziale Maßnahmen
Punkte: gesamt 20
3 Angabe zu umweltfreundlichen Druckpapieren und Gütesiegel Geben Sie bis zu drei mögliche Papiere inkl. Gütesiegel an
Punkte: gesamt 20
4 Angaben zum Transportwesen/Mobilität Nennen Sie bis zu drei Möglichkeiten
Punkte: gesamt 20
5 Angaben zur Erreichung von Klimaneutralität Nennen Sie bis zu drei Maßnahmen
Punkte: gesamt 20 Gesamtpunkte: max. 100
Bruttowertung (von 0 bis 100)
Ergebnis Nachhalt (gewichtet)
Angaben zu Referenzen (Titel, Erscheinungsdatum, Auftraggeber, Auflage etc ), welche umweltfreundlich und CO2-mindernd produziert wurden
Angaben bspw zur Nutzung von Ökostrom, Verwendung eines Umweltmanagementsystems, Nutzung einer E-Flotte oder Lastenrad, Maßnahmen zur Inklusion etc soweit vorhanden
Angaben zu Ihren im Betrieb verwendeten umweltfreundlichen Druckpapieren, inkl der Gütesiegel, welche für den Ausstellungskatalog geeignet sind (siehe Angaben im LV)
Soweit bereits vorhanden und machbar –Angaben zur Auslieferung von Drucksachen per E-Mobilität, als Sammeltransport, Lastenräder etc
Soweit bereits vorhanden – Maßnahmen zur Erreichung einer Klimaneutralität, bspw Ausgleichszertifikate zur CO2Kompensation, ergriffene Maßnahmen zur Emissionsminderung
20 Wertungsschema der Ausstellung Modern Times. Archäologische Funde der Moderne und ihre Geschichten, LWL-Museum für Archäologie und Kultur, Westfälisches Landesmuseum Herne
Name Auftraggeber Wertung
Datum Vergabenummer:
Angebotssumme gesamt gemäß Leistungsverzeichnis
1 Ausstellungskatalog
2 Mehrkosten Bild (optional)
3 Minderkosten Bild (optional)
4 Korrektorat Seite (optional)
Bruttowertungssumme (Teilergebnis)
Abweichung von Minimum (%)
Bruttowertungssumme
Bruttowertungssumme
Bruttowertungssumme
Bruttowertungssumme
5.1. Auflage 1 200 Bitte geben Sie hier den Preis für eine Festabnahme in Höhe von 1 200 Exemplaren an
5.2. Auflage 1 500 (optional) Bitte geben Sie hier den Preis für eine Festabnahme in Höhe von 1 500 Exemplaren an
6 Angebotssumme
Gesamtergebnis
Rang
7 Preis Brutto (50%) Ergebnis Kriterium Preis (bestes Angebot mit 100)
Ergebnis Preis (gewichtet)
8 Nachhaltigkeitskriterien (50%)
Gesamtbewertung
Bewertung (von 0 bis 100) Ergebnis Nachhalt (gewichtet)
20 Wertungsschema der Ausstellung Modern Times. Archäologische Funde der Moderne und ihre Geschichten, LWL-Museum für Archäologie und Kultur
Fazit
Ein wesentliches Handlungsfeld ist die Vergabe Bei der Beauftragung von Firmen und der Beschaffung von Materialien und Produkten spielen Nachhaltigkeitskriterien wie bspw faire Löhne, Lebenszykluskosten oder Energieeffizienz neben dem Preis eine wichtige Rolle Das günstigste Angebot ist nicht immer das wirtschaftlichste, umweltfreundlichste oder sozial gerechteste Eine nachhaltige Beschaffung unterstützt soziale und ökologische Standards, und die Einhaltung solcher sind für Museen, welche Steuergelder beziehen, gesetzlich bereits Vorschrift Durch die Anwendung von nachhaltigen Eignungs- und Wertungskriterien können diese gezielt gefördert werden Als öffentliche Institution nehmen Museen und ihre Träger eine Vorbildfunktion ein, um an der Einhaltung der globalen Nachhaltigkeitsziele beizutragen Pos.
Ganz natürlich und ohne
4. Beim Ausstellungsaufbau
Bereits am Anfang der Zusammenarbeit wurde mit den an der Planung und am Bau Beteiligten über die nachhaltige Ausrichtung der Ausstellung gesprochen Zu Beginn der Arbeiten auf der Baustelle ist dies noch einmal zu wiederholen Nicht selten kennen ausführende Kräfte das Leistungsverzeichnis nicht und sind sich dementsprechend nicht bewusst, dass für die Ausstellung nachhaltige Standards gelten Zudem wird häufig nicht – insbesondere beim Transport oder Verschicken von Drucken, Mobiliar, Modellen, Bauten oder Vitrinen – über die Art der Verpackung nachgedacht, was in den meisten Fällen zu einem Konvolut an Verpackungsmaterial führt Es gilt, bei den beauftragten Firmen und Partnern eine Sensibilisierung in folgenden Punkten zu erreichen:
• Vermeidung von unnötigem Müll auf der Baustelle
• Vermeidung von Einwegplanen bei Malerarbeiten und sonstig ausführenden Tätigkeiten (stattdessen Nutzung von Malervlies zum Schutz von Böden oder Möbeln Auch alte Teppiche können verwendet werden)



• Vermeidung von nicht benötigter Umverpackung wie bspw eine Mehrfacheinwicklung mit Luftpolsterfolie oder Kunststofffolie (stattdessen Alternativen wie Kartonagen, Paletten mit Wellpappen-Deckel prüfen bzw biologisch abbaubare Stretch-Folie verwenden)
• Vermeidung von nicht fachgerechter Entsorgung der Umverpackungen
• Vermeidung überflüssiger Fahrten (bedingt eine gute Projektorganisation und Koordination von Anlieferungsterminen)
Auch hier hilft es, mit den ausführenden Firmen über Alternativen zu sprechen Nicht selten haben die Firmen ausrangierte Kisten oder Kartons im Betrieb, welche für Transportzwecke genutzt werden können Ein leidiges Problem ist zudem der Müll, welcher auf der Baustelle entsteht: Kreppband, Kabelreste, Malerrollen, Schrauben und vieles mehr finden sich nicht selten neben leeren Getränkedosen und Resten von Süßwarenverpackungen Abends zusammengefegt, werden sie über den Hausmüll entsorgt
Auch hier gilt es, wiederholt freundlich, aber bestimmt darauf hinzuweisen, dass auch der eigene Müll zu trennen und zu entsorgen ist
Ich komm dann morgen noch mal wieder
Der zweithöchste Wert an Emissionen in Ausstellungen entsteht in den meisten Fällen im Handlungsfeld Mobilität Unnötige Fahrten sind deshalb zu vermeiden Verzögerungen auf der Baustelle sind direkt mit weiteren Beteiligten oder nachfolgenden Firmen zu kommunizieren Mit Firmen, die nur stundenweise vor Ort sind, sollte über Alternativen bzw ein Zusammenlegen von ganzen Arbeitstagen gesprochen werden, sofern dies von der Tätigkeit her machbar ist Besprechungen mit Projektleiter*innen können digital durchgeführt werden Eine gute Koordination der Arbeiten und eine gelingende Kommunikation ist dabei unerlässlich Weitere Tipps zur Anlieferung, zu den Arbeiten im Ausstellungsraum, zum Aufbau und zur Abnahme finden sich im Handbuch Ausstellungspraxis in Museen.69
Esslinger Einmachhaut, Firma Langheck & Co. KG, 1933-1945 Städtische Museen Esslingen



MUSEUMSOBJEKT
Kerzenleuchter aus emailliertem Blech
Förderkreis Unterjesinger Kelter e V

Der Letzte macht das Licht aus Zu guter Letzt noch ein Tipp zum Stromsparen auf der Baustelle: Am Abend immer alle strombetriebenen Geräte ausschalten Dabei Mehrfachsteckdosen mit zweipoligem Schalter und/oder Steckdosenleisten mit beleuchtetem An- und Ausschalter nutzen Tablets, Maschinen und weitere Elektrogeräte können damit vom Netz getrennt werden Auch die Verwendung von Tageslicht, LED-Baustrahlern und/oder das Anschalten des Reinigungslichtes im Raum während der Bauphase anstelle der Ausstellungsbeleuchtung (insbesondere, wenn diese mit Halogenleuchtmitteln betrieben werden) reduzieren den Stromverbrauch deutlich Damit tut man nicht nur der Umwelt einen Gefallen, sondern auch dem Geldbeutel
Nur gesagt ist noch nicht kontrolliert Auch wenn am Anfang der Zusammenarbeit auf die Nachhaltigkeit der Ausstellung hingewiesen wurde oder entsprechende Angaben in der Leistungsbeschreibung standen – leider ersetzt dies nicht die Kontrolle und Frage, ob diese Punkte auch eingehalten wurden Zum Controlling in der Realisierungsphase gehört die Prüfung der beauftragten Umsetzungen auf die vorab vertraglich festgelegten Nachhaltigkeitsstandards, bspw durch Vorlage von Gütesiegeln der Firmen Lassen Sie sich diese zeigen bzw fordern Sie die Nachweise ein, sollten sie nicht bereits bei der Beauftragung eingereicht worden sein
5. Die Eröffnung in Sicht
In der Realisierungsphase rückt die Eröffnung der Ausstellung näher Wurde sie bereits vorab im Jahresprogramm, auf der Website und in sozialen Medien angekündigt, verstärken sich in dieser Phase die Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing Dazu gehören vielfach die Erstellung von Printprodukten wie Flyer, Einladungen, Plakate oder Pressemappen Es stellt sich auch hier die Frage, was davon auf digitalem Wege hergestellt und/oder verbreitet werden kann
Doch Vorsicht – nicht immer ist das Digitale auch das emissionsärmere Medium Eine regionale Druckerei, welche in Kleinstauflagen umweltfreundlich druckt, im Betrieb ein Umweltmanagementsystem implementiert hat und per Lastenrad oder E-Mobilität ausliefert, kann den CO2e-Fußabdruck auf ein Minimum reduzieren Ausstellungsfotos und Pressematerial dagegen können problemlos über die Website bzw über Online-Links verfügbar gemacht werden, welche sich Medienpartner downloaden können Formate wie Twitter-Gewitter, Insta-Walks und Social Media-Events sowie Beiträge in Blogs, auf Facebook, TikTok und Co sorgen kurz vor der Ausstellungseröffnung für zusätzliche Aufmerksamkeit bei einem digital affinen Publikum
Bei allen Online-Medien sollte man allerdings die enormen Treibhausgas-Emissionen für digitale Formate im Blick haben Eine mit Ökostrom betriebene, schlanke Website bspw mit komprimierten Bildern und Videos, einem effizienten Skript und ohne hohen Datentransfer in der Server-Kommunikation senkt den Ressourcenverbrauch enorm Zum Thema Green Hosting und Green IT finden sich im Netz zahlreiche Links mit guten Praxisbeispielen
Produkte und Geschenke im Shop
In vielen Museumsshops werden passend zur Ausstellung Kataloge, Bücher, Postkarten, Spielzeug, Tassen, Geschenke, Stifte und vieles mehr angeboten Auch hierfür sollten nachhaltige Standards gelten wie:
• Nachhaltiger Wareneinkauf
• Vermeidung von unnötigen Umverpackungen
• Vermeidung von Produkten aus Plastik
• Sammelbestellungen und Einkauf in kleinen Mengen
Eröffnungsfeier – Catering
Die derzeitige Produktion von Lebensmitteln verursacht einen erhebli chen Anteil der weltweiten Treibhausgasemissionen Insbesondere gilt dies für die Produktion von Fleisch, aber auch für den weltweiten Transport von Lebensmitteln 70 Wird eine Eröffnungsfeier mit einem Catering geplant, sollten die verwendeten Lebensmittel aus der Region stammen und saisonal sein Vegetarische oder vegane sowie biologisch hergestellte Angebote sind dabei zu bevorzugen Einweggeschirr (Teller, Besteck, Becher etc ) und Plastikeinwegflaschen sind dagegen zu vermeiden In den meisten Fällen reicht es völlig aus, das lokale Leitungswasser zum Trinken in Glaskaraffen anzubieten
Eröffnungsfeier – Übernachtungen
Ich mach mich gut in der Vitrine.




MUSEUMSOBJEKT
Erinnerungstasse für König Wilhelm I. von Württemberg, Ludwigsburg, um 1814 Landesmuseum Württemberg


Sind im Rahmen der Eröffnungsfeier Übernachtungen bspw für Referent*innen geplant, kann geprüft werden, ob die umliegenden Hotels über ein Zertifikat oder Siegel zur Nachhaltigkeit verfügen Die Website fairweg71 gibt eine gute Übersicht über die verschiedenen Siegel im Tourismusbereich
Eröffnungsfeier – Anreise

MUSEUMSOBJEKT

Besteckkasten mit je sechs Suppenlöffeln, Messern und Gabeln, Augsburg, 1833, Landesmuseum Württemberg
Ob bei Projektbesprechungen, Einladungen von Referent*innen oder Künstler*innen, auf der Website oder zur Eröffnungsfeier – werben Sie für eine Anreise mit dem ÖPNV und/oder Rad, sofern das Museum einigermaßen gut erreichbar und angebunden ist Erste Museen bieten bereits eine E-Ladestelle für PKWs72 und/oder überdachte und sichere Radständer an Für die Eröffnung kann ggf ein Shuttleservice zum Museum organisiert werden
70 Kulturstiftung des Bundes (2023): Leitfaden Veranstaltungen klimabewusst planen und umsetzen, www kulturstiftung-des-bundes de/fileadmin/user_upload/content_stage/Zero/KSB_Nachhaltigkeit_Klimaleitfaden_ Sept-23 pdf (letzter Zugriff: 06 09 2024)
71 Fairweg GmbH: Nachhaltigkeits-Zertifikate, fairweg de/nachhaltigkeits-zertifikate (letzter Zugriff: 06 09 2024)
72 Museum Folkwang: Das grüne Museum, www museum-folkwang de/de/das-gruene-museum (letzter Zugriff: 06 09 2024)
Zusammengefasst
In der Realisierungsphase nimmt das Geplante Form an Je näher die Eröffnung rückt, desto entscheidender ist die termingerechte Fertigstellung aller Arbeiten sowie die koordinierte Einbringung der Exponate und Planung der Eröffnungsfeier Mit der Ausstellungseröffnung ist die Realisierungsphase abgeschlossen, auch wenn ggf im Nachgang noch Korrekturen anstehen oder Mängel beseitigt werden müssen
Der Kreis der beteiligten Personen und Firmen nimmt in dieser Phase in der Regel stark zu Um die Nachhaltigkeitsziele trotz aller Hektik nicht aus dem Blick zu verlieren, sind diese mit allen Beteiligten wiederkehrend zu kommunizieren Und wenn doch etwas vergessen wurde, nicht mehr umweltfreundlich produziert werden kann und über Nacht bestellt werden muss? Dann ist dies kein Beinbruch! Beim nächsten Mal macht man es (hoffentlich) besser
DNachhaltiger Betrieb & Nachnutzung
Die Betriebsphase
Nach der Eröffnung werden Arbeiten zu Ende geführt und Mängel beseitigt. Neben der Durchführung von Begleitprogrammen und Führungen fallen Arbeiten wie das Auswechseln von Objekten oder die Wartung von technischen Geräten an. Zur Optimierung zählt auch die Auswertung von Besucher*innenstimmen und das Beschwerdemanagement, ggf. mit nachfolgenden Verbesserungen an der Ausstellung.
Eine kontinuierliche Bewerbung der Ausstellung, Prüfung und Bezahlung von Rechnungen sowie die Planung der Objekt-Rückgabe und des Abbaus sind weitere Aufgaben.
Die Arbeit an einer Ausstellung endet zudem mit der Rückgabe der Objekte, der Einlagerung des Mobiliars, der Ablage der Unterlagen, der Abrechnung und Abnahme des Verwendungsnachweises, der Projektnachbesprechung und der Dokumentation.73
1. Über gute Kommunikation
In dieser Phase schlägt die große Stunde der Kommunikation mit dem Publikum und den Partnern, sofern sie nicht bereits zuvor involviert waren Hat man sich bereits in der Initiierungsphase bewusst gemacht, welche Akteur*innen welche Rolle(n) spielen, kann nun gezielt in der Außenkommunikation darauf eingegangen und es können verschiedene Zielgruppen spezifisch angesprochen werden (Public Awareness)
Anmerkung: Das Marketingkonzept wird in der Regel in der Planungs- oder Realisierungsphase erstellt Aus Gründen einer guten Zusammenfassung verschiedener Aspekte wurde das Thema Kommunikation jedoch an dieser Stelle verortet
»Museen können Katalysatoren einer nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft sein, indem sie neue Werte vermitteln und Menschen dazu befähigen, ihre Rolle beim Klimaschutz zu verstehen und einzunehmen«, heißt es im Leitfaden Klimaschutz im Museum.74
Dies gilt insbesondere für die Zielgruppen Waren einige von ihnen bereits in Form eines Beirats partizipativ, kollaborativ oder gar co-kreativ an der Entstehung der Ausstellung beteiligt, sind sie damit wichtige Stakeholder bei der Einhaltung nachhaltiger Ziele Bestenfalls fungieren sie dabei als Multiplikator*innen und geben Wissen zur Nachhaltigkeit weiter
Museen können durch ihre verschiedenen Austauschformate wesentlich zu einem nachhaltigen Handeln beitragen Während den die Ausstellung begleitenden Vermittlungsangeboten, Veranstaltungen, Diskussionsabenden, aber auch durch die Ausstellung selbst können Menschen ermutigt, begeistert und befähigt werden, sich aktiv für den Klima- und Umweltschutz einzusetzen Bildung für nachhaltige Entwicklung und die Vermittlung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen seien hier als Stichworte genannt
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist in BadenWürttemberg seit 2007 als Schwerpunkt in der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes verankert 76 BNE begrenzt sich dabei nicht auf den Umweltbereich, wie es vereinzelt dargestellt wird Es geht vielmehr um gesellschaftsrelevante Kompetenzen wie u a die Fähigkeit, verschiedene Problemlösungen auf komplexe Nachhaltigkeitsprobleme anzuwenden oder eigene Visionen für die Zukunft zu entwickeln und dabei effektiv mit Partnern zusammenzuarbeiten
Gerade sogenannte »kleinere« Museen punkten in diesem Bereich Viele leisten Grundlegendes bspw zur Umweltbildung, indem sie die regionale Flora und Fauna fördern und Wissen dazu vermitteln Oder sie zeigen umweltschonende Herstellungs- und Bauweisen aus Naturmaterialien, welche über Jahrhunderte angewandt wurden Sie sind es gewohnt, vernetzt zu denken und zu handeln und bieten nicht selten mit ihren Häusern und Aktionen einen lokalen Treffpunkt beziehungsweise dienen als Identifikationsort für ihr Publikum, Vereinsmitglieder und Ehrenamtler*innen Mehrheitlich arbeiten sie generationsübergreifend und gehen darüber hinaus oftmals Kooperationen mit regionalen Betrieben ein oder unterstützen ortsansässige Künstler*innen
Bildung für nachhaltige Entwicklung
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) soll das Individuum zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigen und es den Menschen ermöglichen, die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen und verantwortungsvolle, nachhaltige Entscheidungen zu treffen
Die Ziele sind eine Ermächtigung der Lernenden, fundierte Entscheidungen und verantwortungsvolle Maßnahmen für Umweltintegrität, wirtschaftliche Lebensfähigkeit und eine gerechte Gesellschaft für heutige und zukünftige Generationen zu treffen und gleichzeitig die kulturelle Vielfalt zu respektieren BNE ist ein integraler Bestandteil der qualitativ hochwertigen Bildung und hat den Zweck, die Gesellschaft im transformatorischen Sinne positiv zu verändern 75
74 Deutscher Museumbund e V : Leitfaden Klimaschutz in Museen, www museumsbund de/wp-content/uploads/2023/05/dmb-leitfaden-klimaschutz pdf (letzter Zugriff: 06 09 2024)
75 Bundesministerium für Bildung und Forschung: Bildung für nachhaltige Entwicklung, www bne-portal de/bne/de/einstieg/was-ist-bne/was-ist-bne_node html (letzter Zugriff: 06 09 2024)
76 Bundesministerium für Bildung und Forschung: Bildung für nachhaltige Entwicklung in Baden-Württemberg, www bne-portal de/bne/de/bundesweit/bundeslaender/baden-wuerttemberg/baden-wuerttemberg html (letzter Zugriff: 06 09 2024)
Wirkung und Wirksamkeit
Aus Sicht von Museumsfachleuten spielt die Entfaltung von gesellschaftlicher Wirkung und Wirksamkeit durch Museen eine große Rolle Das Nachhaltigkeitsprojekt 17 x 17 von ICOM Österreich77 oder auch MOI! Museums of Impact78 gehen davon aus, dass Museen zu einer besseren Zukunft beitragen können MOI! arbeitet dafür im Rahmen eines Selbstevaluierungstools mit sogenannten Wirksamkeitsmodulen Aus Sicht der an der Entwicklung Beteiligten sind für die Entfaltung von Wirksamkeit u a gesellschaftliche Relevanz sowie nachhaltige Organisationen und Gesellschaften wichtig
Im Projekt 17 MUSEEN x 17 SDGs – Ziele für nachhaltige Entwicklung wurde mit den beteiligten Museen u a herausgearbeitet, welche Wirkung durch das Projekt – mehrheitlich eine Ausstellung –erzielt werden soll
Anhand historischer Kulturtechniken lässt sich zudem aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen So verwundert es nicht, dass bspw Freilichtmuseen zurzeit einen großen Zulauf von Architekturstudierenden haben, welche sich mit nachhaltiger Bauweise beschäftigen Mit diesem positiven Handprint leisten Museen Wesentliches und wirken in die Gesellschaft hinein
Bedarf
Vision & Ziele
Ressourcen Input
Gesellschaftliches Problem sozial, ökologisch,
GESELLSCHAFT UMFELD
Wirkungen Outcome & Impact
Leistungen Output
Wirkungskette / Wirkungslogik des Angebots
Zielgruppen
21 Wirkungsschema, welches für das Projekt 17x17, ICOM Österreich, von Doris Rothauer/ Cultural Impact verwendet wurde. Die Frage, welche Wirkung mit einem Projekt oder einer Ausstellung erzielt werden soll, sollte bereits in der Initiierungsphase diskutiert werden
77 icom-oesterreich at/page/17-museen-x-17-sdgs-ziele-fuer-nachhaltige-entwicklung (letzter Zugriff: 06 09 2024)
78 Institut für Museumsforschung (2023): MOI – Analyserahmen für Museen, www smb museum/nachrichten/detail/moi-analyserahmen-fuer-museen-auf-deutsch-verfuegbar (letzter Zugriff: 06 09 2024)
Wie und worüber reden
Es lässt sich sowohl begleitend zur Ausstellung (bspw im Marketing, in der Vermittlung oder bei Veranstaltungen) über Nachhaltigkeit sprechen als auch in der Ausstellung selbst anhand der Inhalte und ausgestellten Exponate Zu unterscheiden sind in der Kommunikation zum einen die betriebsökologischen Maßnahmen, welche das Museum ergriffen hat, um ressourcenschonender und emissionsärmer zu werden Zum anderen können Ausstellungsthemen und Exponate mit Aspekten wie Klimawandel, Klimagerechtigkeit oder Ressourcenverschwendung verknüpft werden Dabei sollte man sich vergegenwärtigen, dass leider immer noch große Wissensunterschiede und -lücken bestehen79
Das Reden über Klimawandel schließt auch den Umgang mit negativen Reaktionen und Emotionen wie Verärgerung, Trauer, Wut, Negierung oder Verzweiflung der Besuchenden ein Das Handbuch Über Klima sprechen gibt wertvolle Tipps für den Umgang mit verschiedenen Reaktionen zu den Themen Klimawandel und Klimafakten80 Die Ausstellung Klima_X stellte sogar die Kommunikation und das eigene Verhalten in den Mittelpunkt und ermunterte das Publikum auf spielerische Weise, sich ihrer Emotionen bewusst zu werden 81
Welches Klimatier bist du?
Der Gedanke an die Klimakrise löst in uns Emotionen aus Bilder von Überschwemmungen und Waldbränden machen die eine sorgenvoll, den anderen versetzen sie in Alarmbereitschaft Du findest hier verschiedene Tiere, denen wir Emotionen zugeordnet haben Entscheide Du, welcher Klimatyp Du bist, das aufgescheuchte Huhn oder doch die langsam dahinschlurfende Schildkröte?

Die langsame Schildkröte
Ah, die Klimakrise Mh, wir müssen etwas tun Mh mir fällt da etwas ein Es ist nur klein, aber es macht einen Unterschied Aber nichts
Unüberlegtes tun Also ich mache mich dann mal langsam auf den Weg, einen Schritt nach dem anderen

Die fleißige Biene
Die Krise ist da und wir müssen handeln Ich fang schon mal an In meiner Wabe Und den Waben meiner Umgebung Mit den anderen zusammen Ich bin also fleißig dabei Wir schaffen im Kleinen ganz viel und so kann es zu etwas Großem werden
22 Illustrationen zweier Klimatiere für die Ausstellung Klima_X, Museum für Kommunikation, wechselnde Standorte, 2022–2024
79 Laut Befragung des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen (Bayerischer Rundfunk) hatten rund 20 Prozent der 12- bis 19-jährigen Menschen in Deutschland noch nie vom Klimawandel gehört und ein Sechstel der 18- bis 19-Jährigen konnten mit dem Begriff nichts anfangen Quelle: Götz, Maya/Mendel, Caroline/IZI München (2024): Was Kinder und Jugendliche in Deutschland über den Klimawandel wissen, izi br de/deutsch/Goetz_Mendel-Was_Kinder_und_Jugendliche_in_Deutschland_wissen pdf (letzter Zugriff: 07 09 2024)
80 2050 Media Projekt gGmbH: Über Klima sprechen, klimakommunikation
06 09 2024)
Museum für Kommunikation (2023): Ausstellung Klima_X, klima-x museumsstiftung de (letzter Zugriff: 06 09 2024)
Transparent, aber ehrlich
Das Engagement in der ökologischen, z T auch sozialen Nachhaltigkeit wird von vielen Museen über die Ausstellung hinaus beworben Auf das, was Museumsmitarbeiter*innen in ihren Häusern machen, können sie zu Recht stolz sein Darüber zu berichten ist demnach nicht nur legitim, sondern erhöht auch das Interesse für jetzige und potenzielle Besucher und Besucherinnen sowie verschiedene Partner Dabei sollte man aber unbedingt ehrlich bleiben Ohne nachweisbare Maßnahmen sollte nicht für Nachhaltigkeit geworben werden Schnell verspielen Museen ihre Glaubwürdigkeit oder laufen Gefahr, sich dem Vorwurf des Greenwashings ausgesetzt zu sehen Ein hohes Gut, hat doch das Institut für Museumsforschung wissenschaftlich belegt, dass Museen die höchsten Vertrauenswerte unter allen öffentlichen Einrichtungen erzielen 82
Greenwashing
Das Verbreiten von Informationen und Kommunikationsinhalten, die bewusst darauf zielen, einem Unternehmen in der Öffentlichkeit ein umweltfreundliches Image zu verleihen, ohne dass es dafür eine hinreichende Grundlage gibt, gilt als Greenwashing 83
Tipp: Bei der Bewerbung der Ausstellung können die am Anfang festgelegten Nachhaltigkeitsziele genannt und deren Ergebnisse transparent gemacht werden Im besten Fall erfolgt dies über prozentuale Angaben wie bspw »50 % Wiederverwendung von Mobiliar der letzten Ausstellung« oder in Aussagen wie »in 9 von 10 Fällen erfolgten die Transporte mit Sammelfahrten« Sollte eine CO2eBerechnung zur Ausstellung erfolgt sein, kann diese öffentlich in der Ausstellung oder auf der Website sichtbar gemacht werden

23 Ansicht des Checkpoint Nachhaltigkeit in der Ausstellung Grüne Moderne, Museum Ludwig, Köln, 2022/2023
82 Institut für Museumsforschung (Hg ) (2024): Vertrauen in Museen in Deutschland: Wie die Menschen in Deutschland auf eine Kultureinrichtung im Wandel blicken, vgl zenodo org/records/11092248 (letzter Zugriff: 06 09 2024)
83 Greenwashing, in: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie (07 2024), de wikipedia org/w/index php?title=Greenwashing&oldid=246804878 (letzter Zugriff: 06 09 2024)
Fazit
Die Vermittlung von Nachhaltigkeit nimmt in der Betriebsphase eine besondere Rolle ein Auch wenn bereits in allen Phasen intern wie extern über Nachhaltigkeitsziele und Maßnahmen gesprochen wurde, so erhöht sich der Wirkungskreis mit dem Publikum um ein Vielfaches Dabei gilt es, ehrlich zu sein und nichts zu bewerben, was sich nicht nachweisen lässt Die Ausstellung und ihre Vermittlungsangebote und begleitenden Formate ermöglichen es, mit dem Publikum gemeinsam ins Gespräch zu kommen, zu motivieren, zu diskutieren und Standpunkte auszutauschen Dies ist vielleicht nicht immer einfach, aber lohnend
Zum Schluss – Alles so schön sauber hier
Mit welchen Mitteln in Ausstellungsräumen und im Museum selbst gereinigt wird, darüber machen sich vermutlich die wenigsten Gedanken Bei täglichen Wischvorgängen wird eine Menge an Reinigungsmitteln verbraucht, welche leider häufig nicht biologisch abbaubar sind und die Gewässer belasten Es lohnt demnach, auch hier einmal genauer hinzuschauen und bei der Beauftragung von professionellen Reinigungskräften umweltverträgliche Produkte vorzugeben
Gebäudereinigung
Umweltzeichen, Blauer Engel, Nordic Swan, EU-ECOLABEL: Wir bemühen uns um die flächendeckende Verwendung von ISO1zertifizierten Reinigungsmitteln
Gemeinsam mit unseren Zulieferbetrieben stellen wir auf nachhaltige Produkte um und bleiben laufend über Entwicklungen am Markt informiert

24 Auszug der Website des Kunsthistorischen Museums Wien, wo auf die Reinigung der Ausstellungsräume verwiesen wird.
2. Nachnutzung & Dokumentation
Der Abbau einer Ausstellung wird spätestens während der Laufzeit vorbereitet und organisiert Während der Betriebsphase erfolgt die genaue Planung des Rückbaus und Rückgabe der Exponate Ist eine Weitergabe der Ausstellung nicht geplant, so sind die für weitere Ausstellungen im Haus nutzbaren Teile, Bauten, Materialien etc zu dokumentieren und für die Einlagerung vorzubereiten
Bei einer Weitergabe der gesamten Ausstellung oder Teilen davon sollte – wie beim Aufbau auch – unnötiger Verpackungsmüll vermieden und die Ausstellung en bloc (statt in mehreren Einzelfahrten) weitergegeben werden Für Dinge, die übrig bleiben und im Haus keine Verwendung finden, sollten Anstrengungen für eine Abgabe an weitere Museen und/oder Materialbörsen unternommen werden Neben der Materialbörse des Deutschen Museumsbundes e V sei auch die Website www.how2-reuse.com84 beispielhaft empfohlen Je nach Trägerschaft sind auch Abgaben von Materialien an lokale Vereine, Schulen oder Privatpersonen erlaubt
Kein Geheimtipp mehr ist mittlerweile das Upcycling von Bannerstoffen oder textilen Werbeträgern Die daraus bspw genähten Taschen können als Unikate im Shop verkauft oder im Falle von Backlitfolien sogar als attraktive Lampenschirme genutzt werden
Auch Upcycling-Workshops mit Resten aus der Ausstellung erfreuen sich großer Beliebtheit beim Publikum


25 Taschen und Lampenschirme aus der Backlitfolie der Ausstellung PEST!, LWL-Museum für Archäologie und Kultur, Westfälisches Landesmuseum Herne
3. Nachhaltig abschließen
Die Planung des Ausstellungsabschlusses und der Nachnutzung werden oftmals unterschätzt Insbesondere bei projektbezogenen Beschäftigten und extern Beauftragten ist der letzte Arbeitstag häufig die Eröffnung Im Sinne eines professionellen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmanagements ist dies fatal Ein nachhaltiger Abschluss beinhaltet neben der Rückgabe der Objekte, der Einlagerung der Bauten und Nachrechnung des Projektes vor allem eine gute Dokumentation des Prozesses Konnten die in der Initiierungsphase gesteckten Nachhaltigkeitsziele eingehalten werden? Wenn nein, an welchen Stellen gab es Hindernisse? Welche Umsetzungen der Maßnahmen haben besser funktioniert und welche eher nicht? Gibt es dafür Ideen, wie es beim nächsten Mal besser gelingen könnte (und sind diese verschriftlicht, damit man sich daran erinnert)?
Die Dokumentation spiegelt dabei nicht nur die Meinungen des Teams wider, sondern umfasst bestenfalls auch die Stimmen des Publikums sowie Ergebnisse durchgeführter Evaluierungen Sie dient vor allem zur Wissensweitergabe im Haus, besonders wenn mit wechselnden Kurator*innen und/oder Gestalter*innen gearbeitet wird Für einen ehrlichen Austausch zum Prozess wird begleitend ein Feedbackgespräch mit allen Beteiligten empfohlen 85
Zum Abschluss des Projektes gehört selbstredend auch die Aktualisierung der Stücklisten mit Angaben zu vorhandenen und/oder neuen Materialien, Bauten sowie der Medien- und Beleuchtungstechnik Hier gilt das Motto: Gut abgeschlossen ist bereits halb initiiert und fast geplant!86
Treibhausgasbilanzerei

MUSEUMSOBJEKTE
Fingerrechenmaschine
Gütersloh, 1920er-Jahre, Schulmuseum im Klösterle
Schickard’sche Rechenmaschine (Rekonstruktion)
Bruno von Freytag-Löringhoff, 1957 Stadtmuseum Tübingen


Treibhausgas-Bilanzierung einer Ausstellung
Wer mit seinen Ausstellungen Emissionen einsparen will, muss erst einmal wissen, wo er steht Viele Häuser erfassen ihren Fußabdruck mittlerweile durch regelmäßige Klimabilanzierungen (Corporate Carbon Footprint, abgekürzt CCF), die alle Emissionen, die das Museum über ein Jahr erzeugt, darstellen Mithilfe von CO2-Rechnern können jedoch auch einzelne Ausstellungsprojekte berechnet werden (Project Carbon Footprint, abgekürzt PCF) Die Quantifizierung von Emissionen bildet also die Grundlage, um zu verstehen, an welchen Stellschrauben hinsichtlich der Emissionsreduktion gedreht werden kann und muss Erste Museen beginnen im Rahmen von ZerO – klimaneutrale Kunst- und Kulturprojekte, einem Förderprogramm der Kulturstiftung des Bundes86, ihren CO2e-Verbrauch von Ausstellungen zu ermitteln
Die Durchführung von Treibhausgas-Bilanzierungen ist für Kulturinstitutionen kein »nice to have« Weisen öffentliche Institutionen bspw einen hohen Jahresenergieverbrauch auf, sind sie gesetzlich verpflichtet, nachweislich Energie einzusparen87 und/oder ein Umweltmanagementsystem wie EMAS88 (Eco-Management and Audit Scheme) einzuführen Das Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz in Baden-Württemberg macht dazu klare Vorgaben: Der Treibhausgasausstoß des Landes soll im Vergleich zu den Gesamtemissionen des Jahres 1990 bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 Prozent gesenkt werden und bis zum Jahr 2040 (über eine schrittweise Minderung) die NettoTreibhausgasneutralität (»Klimaneutralität«) erreichen 89
t Co2-Äquivalente
CO2 Andere Treibhausgase (CH4, N2O, F-Gase) Ziele 2030, 2040 und 2045 der Bundesregierung
26 Abb. zur Treibhausgasneutralität nach Prof. Dr. Schiffer90
86 Kulturstiftung des Bundes (2022): Zer0 – klimaneutrale Kunst- und Kulturprojekte, www kulturstiftung-des-bundes de/de/projekte/klima_und_nachhaltigkeit/detail/zero_klimaneutrale_kunst_und_kulturprojekte html (letzter Zugriff: 06 09 2024)
87 Die Bundesregierung (2023): Energie-Effizienzgesetz, www bundesregierung de/breg-de/aktuelles/energieeffizienzgesetz-2184812 (letzter Zugriff: 06 09 2024)
88 Umweltgutachterausschuss (2020): EMAS, www emas de (letzter Zugriff: 06 09 2024)
89 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (2023): Klima- und Klimaanpassungsgesetz, um baden-wuerttemberg de/de/klima-energie/klimaschutz/klimaschutz-und-klimawandelanpassungsgesetz-baden-wuerttemberg (letzter Zugriff: 06 09 2024)
90 Grafik: Prof Dr Schiffer, in: Umweltbundesamt (2021):
Zugriff: 07 09 2024)
Zur Bilanzierung von Treibhausgasemissionen empfehlen wir den kostenlosen CO2Kulturrechner, der auf dem Greenhouse Gas Protocol basiert 91 Ein Handbuch sowie eine Anleitung und ein Video im Netz gibt es gratis dazu Der Excel-basierte Rechner wurde vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien beauftragt Entwickelt wurde er von einer Expert*innengruppe, die von zwei Dienstleistern im Bereich Kultur und Treibhausgasbilanzierung, namentlich Thema1 GmbH und KlimAktiv gGmbH, unterstützt wurde
Der CO2-Kulturstandard wurde im Kulturpolitischen Spitzengespräch im Oktober 2023 von Bund, Ländern und Kommunen zur Anwendung empfohlen und gilt seitdem als bundesweiter Standard bei der CO2-Bilanzierung im Kulturbereich In Baden-Württemberg sind die staatlichen Kultureinrichtungen verpflichtet, ihre Emissionen ab dem Jahr 2025 damit zu bilanzieren
Eine Reihe an wertvollen Leitfäden helfen dabei, eine Klimabilanzierung zu verstehen und durchführen zu können Als Empfehlung seien drei genannt: Zum einen der Leitfaden Klimaschutz im Museum des Deutschen Museumsbundes e V sowie der Leitfaden Green Culture für Kultureinrichtungen des Landes Baden-Württemberg Zum anderen die praxisorientierte Klima-Toolbox der Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg, welche mit Videoschulungen, einem Leitfaden und verschiedenen Folien leicht verständlich Wissen vermittelt92 Hierüber steht auch eine PCF-Wesentlichkeitsanalyse sowie eine PCF-Vorlage zur Datenerhebung beispielsweise einer Ausstellung zur Verfügung
Wer die Bilanzierung nicht selbstständig durchführen möchte, kann selbstständige Transformations- und Nachhaltigkeitsmanager*innen bzw Firmen aus dem Umweltmanagementbereich für eine professionelle Unterstützung anfragen Wozu das Ganze? Eine Bilanzierung lohnt sich trotz Mehraufwand langfristig in mehrfacher Hinsicht, denn:
1 Es geht um konkrete Kosteneinsparungen, wenn der Energieverbrauch gesenkt wird
2 Mit der Berechnung werden Kostentreiber ermittelt und diese können nachfolgend optimiert werden Die Ausstellung Waste Age im Designmuseum London optimierte bspw im Planungsverlauf die ursprünglich geplante Umsetzung Sie verbrauchte damit gegenüber zuvor berechneten 185 Tonnen am Ende nur 28 Tonnen CO2e93
3 Die Einhaltung nachhaltiger Kriterien spielt bei der Einwerbung von Fördergeldern eine immer wichtigere Rolle Wer nachweisen kann, dass er Emissionen einspart, ist hier klar im Vorteil
4 Nachhaltig agierende Museen sind nicht nur für Partner und Fördergeldgeber attraktiv, sondern auch für qualifizierten Nachwuchs Junge Fachkräfte suchen sich ihre Arbeitgeber gezielt aus und achten auf deren Umweltmanagement
5 Es geht um Reputationssteigerung: Im besten Fall erhöht sich die Aufmerksamkeit für das Museum und das Interesse an der Ausstellung; digital wie analog
6 Es geht um eine Risiko-Einschätzung: Die Auseinandersetzung mit Emissionen zieht häufig eine Auseinandersetzung mit Themen wie Klimawandel und Klimafolgeanpassungen nach sich Das Bewusstsein für Risiken wie Dürre oder Extrem-
91 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg: CO2-Kulturstandard, mwk baden-wuerttemberg de/de/kunst-kultur/kulturpolitik/green-culture/co2-kulturstandard (letzter Zugriff: 07 09 2024)
Anleitung: www kmk org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2023/Anleitung_zum_CO2-Kulturrechner pdf
92 Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg (2023): Toolbox Klimaschutz in Kultureinrichtungen, www klimaschutzstiftung-bw de/de/klimaschutz/klimaschutzprogramme/klimaschutz-in-kultureinrichtungen/klima-toolbox-kultur (letzter Zugriff: 06 09 2024)
93 www ecsite eu/sites/default/files/the_design_museum_impact_guide_feb23 pdf
wetterereignisse steigt und geeignete Anpassungen zum Schutz von Exponaten, Menschen und Gebäuden können frühzeitig gestartet werden
7 Für ein zukunftsfähiges Haus, das seine Nachhaltigkeitsziele erreichen und Maßnahmen umsetzen möchte, braucht es das gesamte Team Eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit ist teambildend und motiviert
Mobilität und Energie – Zwei Big Points
Wer sich bereits mit der Berechnung von Emissionen beschäftigt hat, weiß, dass die Handlungsfelder Mobilität und Energie in der Regel die höchsten Emissionen aufweisen94 Maßnahmen zur Reduzierung in diesen Bereichen wurden zuvor bereits beschrieben
Der Leitfaden Green Culture für Klimaschutz in Kultureinrichtungen95 gibt hinsichtlich einer nachhaltigeren Publikumsmobilität weitere Tipps Gegen Vorlage eines tagesaktuellen bwtarif-Tickets, eines Schüler-Ferien-Tickets oder eines aktuellen DeutschlandTickets zahlen Besucher und Besucherinnen in einigen Einrichtungen nur den ermäßigten Eintritt Damit soll ein Anreiz geschaffen werden, klimafreundlicher anzureisen
Ausstellungen messen
Für die Emissionsermittlung in Ausstellungen sind folgende Angaben wichtig:
• Stromverbrauch (wird anteilig z B per Quadratmeter-Ausstellungsfläche und Nutzungsdauer berechnet)
• Verbräuche für Heizung, Kühlung (wird anteilig z B per QuadratmeterAusstellungsfläche und Nutzungsdauer berechnet)
• Wasserverbrauch (anteilig berechnet)
• Dienstreisen, Fahrten der externen Firmen, Speditionen und Partner zum Museum, Fahrten der Mitarbeiter*innen zur Arbeitsstelle
• Anreise des Publikums (nach einem Staffelprinzip berechnet)
• Verbräuche im Bereich Kommunikation (Mailings, Online-Meetings, Printprodukte und deren Distribution etc )
• Einkauf von Materialien und Produkten
• Müllverbrauch (anteilig berechnet), unterschieden in recyclingfähige und nicht recyclingfähige Stoffe
94 Hamburger Museen (2022): ELF ZU NULL, elfzunull de (letzter Zugriff: 06 09 2024) 95 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (2022): Green Culture - Leitfaden für den Klimaschutz in den Kultureinrichtungen in Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg, mwk baden-wuerttemberg de/fileadmin/redaktion/m-mwk/intern/dateien/pdf/green_culture_broschuere_leitfaden_download_final pdf (letzter Zugriff: 06 09 2024) 5 What you measure you will
Ich messe alles!

MUSEUMSOBJEKT
Streckenmeßgerät
W. u. T. Gilbert, London, 1810 TECHNOSEUM, Foto: Klaus Luginsland


Wärme (kWh)
Strom (kWh)
Wasser (l)
Anreise MA*Innen (pkm)
Dienstreisen (km)
Kommunikation (individuell)
Wärme (kWh)
Strom (kWh)
Wasser (l)
Anreise MA*Innen (pkm)
KunstgegenständeKauf (t)
Vorbereitung Räumlichkeiten (t) Kommunikation (individuell)
KunstgegenständeTransport (km)
KunstgegenständeMiete (km)
Wärme (kWh)
Strom (kWh)
Wasser (l)
Anreise MA*Innen (pkm)
Anreise Kü*Innen (pkm)
Anreise BE*Innen (pkm)
Klimatisierung Extra (kWh)
Begleitende Prozesse
Einlagerung (kWh)
Transporte (km)
THG-Emissionen (t) Konzept Planung/Bau Betrieb Nachnutzung
THG-Emissionen (t)
Abfälle (t)
27 Schema einer Projektbilanzierung für eine Ausstellung
THG-Emissionen (t)
Abfälle (t)
THG-Emissionen (t)
Abfälle (t)
Konzeption
6,5 t CO2eq (0,7%)
Umsetzung
900,3 t CO2eq (98,9%)
Vorbereitung
3,0 t CO2eq (0,3%)
Nachbereitung
0,2 t CO2eq (0,0%)
28 Klimabilanzierung der Ausstellung Into the Deep. Minen der Zukunft, Zeppelinmuseum Friedrichshafen, 2023
Insgesamt wurden 910 t CO2e verbraucht Ohne Publikumsmobilität beträgt der Ausstoß 122 t

29 Ausstellungsansicht Into the deep. Minen der Zukunft, Zeppelin Museum Friedrichshafen
Eine nachhaltig umgesetzte Ausstellung mag gegenüber dem Austausch einer Klimaanlage oder der Dämmung eines Gebäudes im Hinblick auf Emissionsminderungen nur einen kleinen Teil ausmachen Der Vorteil liegt jedoch darin, dass Museen in diesem Bereich selbstständig handeln und kurzfristig Maßnahmen umsetzen können Verbesserungen am Gebäude oder der Austausch von Geräten dagegen sind meist nur langfristig erreichbar und bedingen Überzeugungsarbeit beim Träger sowie das Einwerben von Fördermitteln Ein weiterer Vorteil ist die Sensibilisierung des Teams Abteilungsübergreifend arbeiten Mitarbeiter*innen u a aus der Verwaltung, der Kuration, der Restaurierung, dem Sammlungsmanagement, der Vermittlung und dem Handwerk für eine Ausstellung zusammen »Gemeinsam ins Handeln kommen« bedeutet Lösungen zu suchen, wo und wie Verbesserungen in der Ausstellungspraxis erreicht werden können
Nicht mit Kanonen auf Spatzen
Für kleinere Museen ist die Erstellung einer CO2e-Bilanz oder die Einbettung einer Ausstellung in eine Nachhaltigkeitsstrategie aufgrund der begrenzt verfügbaren Ressourcen kaum realisierbar Über den Bereich Ausstellungen hinaus empfiehlt der Verband der Museen in der Schweiz dazu: »Für den Umbau zu einer nachhaltigen Organisation profitieren kleinere Museen von flachen Hierarchien und nicht existenten Abteilungen Darauf aufbauend kann sich die Umsetzung in kleineren Museen an vier Ansätzen orientieren:
1 Gemeinsames Leitbild: Partizipativ entwickelte Vision
2 Bedeutung der Leitungsposition: Motivation durch Führungsstil und Authentizität
3 Empowerment: Befähigung der Mitarbeiter*innen zu nachhaltigem Verhalten
4 Zielgerichtete Lernpartnerschaft: Nachhaltigkeits-Tandems mit größeren Museen«96
Zusammengefasst
Die Erfassung von Ausstellungen in CO2e kann für Museen lohnend sein, um ihre Verbräuche zu kennen und nachfolgend konkrete Verbesserungen angehen zu können Anhand der Zahlen lassen sich Desiderate und Bedarfe erkennen, die für ein Gespräch mit Fördermittelgeber*innen und/oder Träger*innen wichtig sind, um geeignete Maßnahmen anzustoßen Die Berechnung einer Ausstellung sollte im besten Fall in die Nachhaltigkeitsstrategie des Hauses eingebunden sein und kein Solitär bleiben
Eine Bilanzierung ist jedoch für manche Museen kaum realisierbar und nicht für alle verpflichtend Für die sogenannten kleineren Museen macht es mehr Sinn, im Handprint-Bereich zu agieren, dort eine Wirkung zu entfalten und sich selbst sowie ihr Publikum zu einem nachhaltigen Verhalten zu motivieren
Wieviel ist viel? Die Wertungsmatrix 6
Den vorliegenden Leitfaden ergänzt eine digitale Wertungsmatrix zur Selbstevaluierung
Diese steht allen Museen und Ausstellungshäusern kostenfrei über die Landesstelle für Museen Baden-Württemberg zur Verfügung: www landesstelle de/nachhaltigkeit
Damit will die Landesstelle für Museen Baden-Württemberg einen Anreiz schaffen, sich nicht nur Wissen über eine nachhaltige Ausstellung anzueignen, sondern auch den eigenen Status quo ermitteln zu können Ziel ist es, nachfolgend an Verbesserungen in den verschiedenen Handlungsfeldern zu arbeiten Weiterhin möchte die Matrix eine Gesprächsgrundlage bieten für das Team, aber auch für einen Austausch mit Trägern, Fördergeldgebern und Partnern, um gemeinsam den Weg einer nachhaltigeren Ausstellungspraxis auszubauen
Die Wertungsmatrix zur Selbstevaluierung ist entlang der vier Phasen einer Ausstellung angelegt Museen können mit Hilfe des digitalen Tools einen prüfenden Blick auf ihre eigenen Aktivitäten und umgesetzten Maßnahmen werfen und potenzielle Bereiche für Verbesserungen identifizieren In welchen Bereichen gibt es noch Luft nach oben? Worüber hat das Team unterschiedliche Sichtweisen? Die Wertungsmatrix möchte anregen, über Möglichkeiten und Differenzen zu diskutieren und Vorbehalte offen anzusprechen Die Matrix ist modular angelegt, d h jede Phase kann für sich ausgewertet werden Sie ist damit gleichzeitig als Checkliste geeignet, um in allen Phasen an die vielfältigen Maßnahmen zur Umsetzung von Nachhaltigkeit zu denken
Anwendung
der Matrix
Die Wertungsmatrix ist eingeteilt in die vier Phasen einer Ausstellung mit je fünf Unterkapiteln Pro Kapitel werden im Mittel acht bis zehn Fragen gestellt, welche auf einer Skala von 1 bis 10 beantwortet werden können 10 entspricht »ja / viel / besonders gut umgesetzt«, 1 dagegen »nein / gar nicht / ungenügend umgesetzt« Manche Fragen sind geschlossener formuliert (ja / nein), andere offener Zudem gibt es Freitextfelder, in denen Angaben oder Stichpunkte gemacht werden können Diese dienen bspw dazu, Ziele zu notieren oder Diskussionspunkte aufzuschreiben Für die Auswertung spielen sie keine Rolle, sie helfen aber als eine Art von Checkliste dabei, an alles zu denken bzw sich Wichtiges zu merken
Die Skala dient dazu, sowohl erste Schritte abzubilden (»wir haben schon etwas gemacht«, beispielsweise mit einer 3 angegeben) als auch fortgeschrittene Umsetzungen darzustellen (»wir sind schon sehr weit«, beispielsweise mit einer 8 angegeben) Die Landesstelle für Museen Baden-Württemberg ist sich bewusst, dass diese Beurteilung einige Unschärfen erzeugt Insgesamt überwiegen jedoch die Vorteile, um Stärken und Schwächen in der nachhaltigen Ausstellungspraxis gut evaluieren zu können
Die Antworten werden prozentual berechnet, d h in der Skala aufsteigend werden die angegebenen Werte addiert Der damit erreichte Gesamtwert wird pro Phase dargestellt (bspw »50 % in der Planungsphase«) Die Auswertung aller Phasen zeigt sich als Netzdiagramm und verdeutlicht den Stand der Nachhaltigkeit auf einen Blick Ebenfalls werden Tipps für Verbesserungen in den verschiedenen Phasen und Bereichen angegeben
Die insgesamt rund 160 Fragen können etappenweise bearbeitet und jederzeit beendet oder weiterbearbeitet werden; das Programm merkt sich automatisch den Stand Die Fragen verweisen zudem auf den digitalen Leitfaden und sind mit den jeweiligen Kapiteln verlinkt, sodass Informationen und Inhalte stets verfügbar sind
Datenschutz
Auf die Daten haben nur die jeweiligen Museen Zugriff und Einsicht Erhoben werden zur kontinuierlichen Verbesserung statistische Daten der quantitativen Nutzung und die Nutzungsdauer

Habt ihr den Durchblick?
Mit dem Mehr-Augen-Prinzip geht’s besser!


MUSEUMSOBJEKTE
Brille aus Metall und Glas
Heimatmuseum Aichstetten
Augenprothesen
Bruno Köhler, Wertheim, 1950er-Jahre
Glasmuseum Wertheim
Praxisbeispiel
Im Folgenden soll anhand eines fiktiven Beispiels ein schematischer Ablauf von vorgenommenen Zielen (in verschiedenen Handlungsfeldern, bei geplanten Maßnahmen und deren Umsetzungen sowie in den jeweiligen Ausstellungsphasen) vorgestellt werden:
Initiierungsphase
Ziele:
1 Energie: Reduzierung der Energie um 50 %
2 Mobilität: Reduzierung der leihgebenden Institutionen um 30 %
3 Beschaffung: Ausschließlicher Einkauf von umweltfreundlichen Farben und Druckmaterialien
4 Bau: Vermeidung von Verbundwerkstoffen beim Bau
Wünschenswerte Ziele (2. Priorität):
5 Vermittlung: Wissensweitergabe ermöglichen Verfügungstellung der Inhalte der Ausstellung als kostenloser Download
6 Kooperation: Förderung der Kooperationen mit lokalen Vereinen/Gruppen, welche sich für Umwelt- und/oder Klimaschutz engagieren (Hinweis: Die Ausstellung wird als Startpunkt genutzt, um ein generelles Vorhaben umzusetzen)
Planungsphase
Geplante Maßnahmen:
1 Reduzierung der Energie: Einkauf von Strahlern mit LED
2 Reduzierung der leihgebenden Institutionen: Auswahl der Leihexponate in mehreren Runden anhand des Bewertungsschemas In einem Bereich Umstellung der Inhalte und Darstellung des Themas mit Illustrationen sowie Hands-On statt mit Exponaten
3 Verwendung von umweltfreundlichen Farben und Druckmaterialien: Ausschreibung von biobasierten Farben und Druckmaterialien aus 100 % Recyclingmaterial inkl Angabe von Gütesiegeln
4 Vermeidung von Verbundwerkstoffen: Die Nicht-Verwendung von Aludibond wurde als Ziel vom Museumsteam zurückgenommen Nach Vorstellung von Alternativen durch das Grafikbüro wurde das Ziel (Druck auf Karton) wieder verfolgt
5 Wissensweitergabe: Kostenloser Download der Inhalte wird in mehreren Gesprächen mit dem Förderverein und Projektpartnern diskutiert Die prognostizierten fehlenden Einnahmen (kein Verkauf des Katalogs) sollen mit anderen Maßnahmen kompensiert werden
6 Kooperation mit lokalen Vereinen/Gruppen, welche sich für Umwelt- und/oder Klimaschutz engagieren: Erste Gespräche mit ortsansässigem Landschaftsgartenbauer zum Anlegen einer Blühwiese und einem Imkerverein zur Aufstellung von Bienenstöcken
Realisierungsphase
Umgesetzte Maßnahmen:
1 Reduzierung der Energie: Einbau von Bewegungsmeldern für Beleuchtung, Umstellung zu 100 % auf LED (vorab 70 % LED-Strahler)
2 Reduzierung der leihgebenden Institutionen: bereits umgesetzt Transporte konnten zu 70 % als Sammeltransport organisiert werden
3 Verwendung von umweltfreundlichen Farben und Druckmaterialien: Druck auf Recyclingkarton wie ausgeschrieben Vorhaben, ausschließlich biobasierte Farben zu verwenden, wurde aus Kostengründen zugunsten des digitalen Katalogs s o zurückgestellt
4 Vermeidung von Verbundwerkstoffen beim Bau: Druck auf Karton (Themen- und Objekttexte) zu 100 % realisiert
5 Wissensweitergabe: Alle Inhalte der Ausstellung wurden als Online-Katalog erstellt Die PDF wird als kostenloser Download über die Website angeboten
6 Förderung der Kooperationen mit lokalen Vereinen/Gruppen, welche sich für Umwelt- und/oder Klimaschutz engagieren: Für das Anlegen einer Blühwiese konnten erfolgreich Fördergelder eingeworben werden Gespräche mit dem lokalen Imkerverein laufen
Betriebsphase und Nachnutzung
Bewertung:
1 Reduzierung der Energie: Es wurden nachweislich 30 % Energiekosten eingespart
2 Reduzierung der leihgebenden Institutionen: Der veränderte Bereich mit Darstellung des Themas als Illustration sowie Hands-On war überraschenderweise der beliebteste beim Publikum
3 Verwendung von umweltfreundlichen Farben und Druckmaterialien: Der Druck auf Karton war eine gute Alternative, kann jedoch nicht weiterverwendet werden (Papierabfall) Die Nutzung biobasierter Farben soll in der nächsten Ausstellung umgesetzt werden
4 Vermeidung von Verbundwerkstoffen beim Bau: Karton statt Dibond einzusetzen, war eine gute Alternative Die Befürchtung vor einer schnellen Verschmutzung trat nicht ein
5 Wissensweitergabe: In der nächsten Ausstellung soll es wieder einen gedruckten Ausstellungskatalog geben, jedoch nur in begrenzter Auflage Parallel dazu soll eine Wissensweitergabe online möglich gemacht werden
6 Förderung der Kooperationen mit lokalen Vereinen/Gruppen, welche sich für Umwelt- und/oder Klimaschutz engagieren: Die Blühwiese ist angelegt, die weitere Nutzung durch den Imkerverein kann jedoch erst im nächsten Jahr erfolgen Das Publikum äußert sich in den sozialen Medien sehr positiv über das Engagement des Museums und das neue Erscheinungsbild mit angelegter Blühwiese vor dem Haus
Fazit
In der Beispielausstellung wurde in sechs Handlungsfeldern der Initiierungsphase je ein konkretes Ziel formuliert Vier Ziele sollten erreicht werden, zwei weitere waren als KannZiele deklariert
Die Idee, eine Blühwiese anzulegen und mit dem örtlichen Imkerverein zusammenzuarbeiten, war zudem nicht ausstellungsspezifisch Jedoch diente der Projektbeginn dazu, einen langgehegten Plan des Mustermuseums umzusetzen
In der Planungsphase wurde deutlich, dass das Ziel, eine Wissensweitergabe durch einen kostenlosen Online-Katalog (statt eines gedruckten Verkaufsprodukts) zu ermöglichen, nur zulasten eines anderen Ziels umsetzbar war: Aufgrund der fehlenden Einnahmen beschloss das Team, auf einen Anstrich des Ausstellungsmobiliars mit biobasierten Farben zu verzichten
In der Realisierungsphase mussten Abstriche im Bereich Sammelfahrten im Leihverkehr gemacht werden Dafür konnten mit der Umstellung auf 100 % LED sonstige Energiekosten eingespart werden Im Betrieb zeigte sich zudem, dass ein Druck auf umweltfreundlichem Karton (statt auf dem sonst üblichen Aludibond) keinen Qualitätsverlust bedeutete
Positiv bewertete das Publikum darüber hinaus eine Station, die geändert wurde, um den Transport eines Objektes per Flugzeug zu vermeiden Darüber hinaus gewann das Museum an Aufmerksamkeit durch das Anlegen einer Blühwiese, welche künftig auch für Outdoor-Vermittlungsprogramme genutzt werden soll Zur Bewerbung der Ausstellung konnten ebenfalls eine gemeinsame Kampagne mit dem Landschaftsgartenbauer und dem Imkerverein gestartet werden, außerdem wurden Flyer der Ausstellung per Lastenrad verteilt
Von den sechs Zielen wurden somit vier zu 100 % erreicht Am Ende steht noch die Aufstellung der Bienenstöcke aus, und auf das Vorhaben, biobasierte Farben einzusetzen, musste aus Kostengründen verzichtet werden Diese Projekte sind für die Zukunft bzw die nächste Ausstellung geplant
Nachhaltigkeit ist teuer!

Dieses Vorurteil ist älter als du!

MUSEUMSOBJEKTE
Inkuse Denarprägung des Q. Caecilius Metellus Pius Scipio mit Darstellung eines Elefanten 47–46 v. Chr.
Landesmuseum Württemberg
Aureus des Titus mit Darstellung eines Elefanten 80 n. Chr.
Landesmuseum Württemberg
Worüber man nicht spricht –der Elefant im Raum
Wie eine Ausstellung in allen vier Phasen nachhaltiger initiiert, geplant, umgesetzt und nachgenutzt werden kann, wurde zuvor beschrieben Zum Schluss bleibt noch »der Elefant im Raum« – eine Metapher für ein Problem oder ein Tabu, das für alle Beteiligten erkennbar ist, aber nicht thematisiert wird Was ist damit gemeint? Nachhaltigen Ausstellungen wird leider immer noch Vieles nachgesagt – sie gelten als zu teuer oder sie bedeuten viel zu viel Aufwand für alle Beteiligten Vor allem aber hält sich hartnäckig der Vorwurf, sie seien uninspiriert, langweilig und nicht ästhetisch
Wer sich umschaut, wird genau das Gegenteil erleben: Schöne, innovative, gut gemachte, spannende, interessante, beeindruckende, witzige, berührende, wunderbare Ausstellungen Diese sind technisch raffiniert, mit neuen Materialien und recycelten Produkten ausgestattet und gleichzeitig ressourcen- und energiearm produziert!
Probieren Sie es selbst aus und werden Sie Teil eines wachsenden Netzwerkes und eines Pools an Museen, welche mit Begeisterung nachhaltig produzieren! Werden Sie dabei Vorbild für andere, haben Sie Mut für Neues, geben Sie Wissen weiter und erfreuen Sie sich an der Vielfalt innovativer Ausstellungen
9. Bildnachweis
1 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, Quelle: © Bundesregierung
2 Ziele für die Ausstellung Embracing Nature, Quelle: © Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 2021
3 Ziele und Maßnahmen für die Ausstellung Modern Times. Archäologische Funde der Moderne und ihre Geschichten, Quelle: © LWL-Museum für Archäologie und Kultur/S Dowidat, 2023
4 Schema Objektbewertung, Quelle: © LWL-Museum für Archäologie und Kultur/S Dowidat, 2024
5 Object Decision Tree, Quelle: © Design Museum London, 2023 Die Angaben beruhen auf Daten der britischen Regierung (DEFRA)
6 Stakeholder-Analyse/Akteursmapping Quelle: © S Jellinghaus, 2024
7 ebd
8 Effizienz, Konsistenz, Suffizienz © C Sauter in Anlehnung an die Darstellung des BUNDjugend Bundesverbandes
9 Ausstellungssystem der Ausstellung Beyond Bauhaus, CLB Berlin, Quelle: © Studio Milz, 2019
10 Ausstellung :metabolon, Entsorgungszentrum Leppe, Quelle: © Kessler & CO GmbH/H Kessler, 2023
11 Ökologische Rucksack, Quelle: © Wuppertal Institut, © C Sauter in Anlehnung an die Darstellung des Wuppertal Instituts, 2013
12 Angaben zum durchschnittlichen ökologischen Rucksack verschiedener Materialien in kg © Wuppertal Institut, erschienen beim Biosphärenzweckverband Bliesgau, 2015
13 Ausstellung Modern Times. Archäologische Funde der Moderne und ihre Geschichten
Quelle: © LWL-Museum für Archäologie und Kultur, Westfälisches Landesmuseum Herne, 2023
14 Bäume aus Altholz in der Dauerausstellung Museum am Schölerberg, Quelle: © Museum am Schölerberg/ A von Brill, 2023
15 Materialhierarchie-Pyramide, Quelle: © DTHG Green Book/Christof Jakob Heinz, 2022, greenbook dthgev de
16 Materialschema
Quelle: © S Dowidat in Anlehnung an den Material Decision Tree des Design Museums London, 2023
17 Ampelschema Materialangaben
© S Dowidat in Anlehnung an das Schema RAG 1–4 des Design Museums London, 2023
18 Vergleich Verkehrsträger zum Transport von Exponaten, Quelle: © Hasenkamp Holding GmbH, 2023
19 Leihvertrag Deutscher Museumsbund e V mit einem eingefügten Passus der Kunstsammlung NRW
Quelle: © Deutscher Museumsbund e V und Kunstsammlung NRW, 2023
20 Wertungsschema, Quelle: © LWL-Museum für Archäologie und Kultur / S Dowidat 21 Wirkungsschema, Quelle: in Anlehnung an © Cultural Impact/D Rothauer, 2021 22 Klimatiere aus Ausstellung Klima_X
Quelle: © MSPT & Reflekt Berlin, Gestaltung Studio it’s about 23 Checkpoint Nachhaltigkeit, Quelle: © Museum Ludwig/Leonie Braun, 2022
24 Gebäudereinigung,
Quelle: © Kunsthistorisches Museum Wien
25 Nachnutzung Banner aus der Ausstellung PEST!
Quelle: © LWL-Museum für Archäologie und Kultur/ S Dowidat & A Jordan, 2021
26 Statistik Treibhausgasneutralität
Quelle: © Prof Dr H -W Schiffer, 2021
27 Schema Projektbilanzierung einer Ausstellung
Quelle: © Arqum, 2023
28 CO2-Bilanz Ausstellung Into the Deep, Zeppelinmuseum Friedrichshafen
Quelle: © Zeppelinmuseum/F Stengel, 2024
29 Ausstellungsansicht Into the deep Minen der Zukunft
Quelle: Copyright Zeppelin Museum Friedrichshafen/ Tretter, 2023
30 Übersicht Wertungsmatrix
Quelle: © media | machine GmbH, 2024
MUSEUMSOBJEKTE
Die im Leitfaden gezeigten Objekte finden Sie alle auf der Plattform museum-digital Hier können Sie auch außerhalb der Museen in Baden-Württemberg und ganz Deutschland auf Schatzsuche gehen Viel Freude beim Stöbern
bawue.museum-digital.de
10. Impressum
Nachhaltig Ausstellen – Ein Leitfaden für Museen Stuttgart, 2025
Gefördert aus Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
Herausgeber:
Landesstelle für Museen Baden-Württemberg Dorotheenstraße 4, 70173 Stuttgart www landesstelle de
Autorin: Stefanie Dowidat
Resonanzgruppe:
Stefanie Cossalter-Dallmann, Museumsverband Hessen e V Karen Hehnke, Die Etagen GmbH, Osnabrück Sina Herrmann, Deutscher Museumsbund e V Caren Jones, Museum Wiesbaden
Dr Marc Kähler, Landesmuseum Baden-Württemberg
Dr Olga Panic-Savanovic, Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg Shahab Sangestan, Landesstelle für Museen Baden-Württemberg
Dr Nina Schallenberg, Jüdisches Museum Berlin
Dr Yvonne Schülke, Landesstelle für Museen Baden-Württemberg
Dr Markus Speidel, Stadtmuseum München
Frauke Stengel, Zeppelinmuseum Friedrichshafen
Susanne Zils, Historisches Museum Saar
Lektorat: WortKunst Ahrens, Dr Beatrix Ahrens, Köln
Gestaltung: Christoph Sauter Grafikdesign, Augsburg
Druck: Die Grasdruckerei, Eine Marke der e kurz+co druck und medientechnik gmbh Kernerstraße 5, 70182 Stuttgart
Programmierung Wertungsmatrix: Fa media I machine GmbH, Mainz
Übersetzung: Anica Jacobsen, Stuttgart
Glossar: Lisa Mentzl, Bochum
Alle Rechte, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung, Verbreitung und Übersetzung, vorbehalten Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden Das Werk einschließlich seiner Bestandteile ist urheberrechtlich geschützt Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung der Rechteinhaber unzulässig
© Copyright Landesstelle für Museen Baden-Württemberg, 2025
ISBN 978-3-00-080956-9
Der Umschlag dieses Leitfadens wurde auf 200 g/m² Graspapier mit bis zu 40% Zellstoff aus regionalen Grasfasern von Ausgleichsflächen gedruckt
Der Inhalt wurde auf 100% Recyclingpapier gedruckt

Gefördert vom
