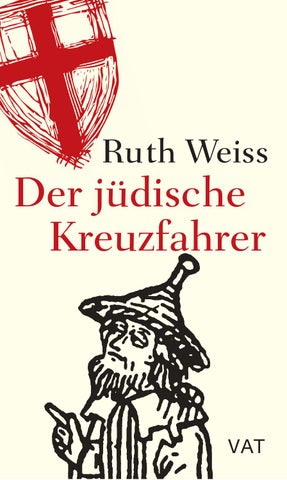Ruth Weiss
Der j端dische Kreuzfahrer
VAT
Ruth Weiss
DER JÜDISCHE KREUZFAHRER
nz ai ug M .de sz lag nz au er ai se T V t-m Le VA .va © ww w
Roman
Verlag André iele
© VAT Verlag André iele, 2014 Alle Rechte vorbehalten. Lektorat: Sabine Krieger-Mattila, Königswinter Satz: Felix Bartels, Eberbach Umschlag: Jürgen Meyer, Hamburg Druck: ANROP Ltd., Jerusalem Printed in Israel. www.vat-mainz.de isbn 978-3-95518-019-5
Für meine Aschaffenburger Freunde Ruth Weiss
5
1084 1. Narrentag Am frühen Morgen war alles in dichten Nebel gehüllt. Noch zogen die Nachtwächter mit ihren Laternen durch die Stadt, doch in den meisten Häusern herrschte schon emsiges Treiben. Knechte und Mägde beeilten sich, in den Haushalten ihrer Herrschaften die nötigsten Dienste zu verrichten, denn dieser Tag gehörte ihnen, den niedrigsten der Niedrigen, und sie wollten keine Minute vergeuden. Es war Fastnachtmontag, der 12. Februar im Jahr des Herrn 1084. Der weithin bekannte und beliebte Rabbi Isaak ben Ruben beeilte sich ebenfalls. Ein stattlicher Mann von zweiundvierzig, dessen schwarzer Bart kaum von Silberfäden durchzogen war, die dunklen Augen klar und leuchtend, trotz seines unermüdlichen Studierens der Heiligen Schriften. Er war sich wohl bewusst, dass dieser Montag kein normaler Tag war, und vor allem keiner, an dem sich ein Jude in den Straßen sehen lassen sollte. Es würde Trubel herrschen und viel Durcheinander mit Lärm und Gekreisch. Wenn das gemeine Volk den einen oder anderen Becher Wein zu viel geleert hatte, wandte es sich nur zu oft in trunkener Ausgelassenheit gegen die jüdischen Nachbarn. Trotzdem wollte er zur Stunde des Morgengebetes in der Shul sein, er durfte sich nicht wie ein Feigling gebärden. Als eins der zwölf Mitglieder des Ältestenrats musste er den anderen ein Vorbild sein und wie immer seinen Beitrag leisten, damit ein Minjan zustande kam. Mindestens zehn jüdische Männer wurden benötigt, um einen vollständigen Gemeindegottesdienst abzuhalten.
7
Am Eingang der Shul traf er auf Samuel ben Gideon, den wohl beleibtesten und vermögendsten Mann der Stadt, den König der Fernhandelskaufleute, dessen Geschäftsverbindungen bis nach China reichten. Mit seinem scharfen Verstand und dem weiten Netz von Mischpoche und Geschäftsfreunden war Samuel am richtigen Platz: Magenza, wie die Juden die Stadt nannten, lag direkt gegenüber der Mündung des Mains in den Rhein, von hier aus liefen die Schiffsladungen mit bester Ware zu den Messen, vor allem ins nahe Frankfurt. Samuel, dessen Sohn Jehuda dem Rabbi einer der liebsten Schüler war, schlug wie dieser seinen Tallit auf und flüsterte Isaak zu, was auch der schon zufrieden festgestellt hatte: »Mehr Leute als Minjan!« Fast alle waren gekommen, selbst Saul ben Izak, der Älteste, der sich schwer auf die Schulter seines jüngsten Enkels stützte. Trotzdem gingen sie nach dem Gebet eilig auseinander. Dies war kein Tag, an dem man gesellig zu einem Gespräch beieinanderstand. Auf dem Nachhauseweg sah Isaak, dass sie sich bereits trafen, die Feiernden in ihren unsinnigen Gewändern, um ihr närrisches Spiel zu treiben, mit Umzügen, Gelächter, Getränken und derben Scherzen, den närrischen Sprüchen. Alles war auf den Kopf gestellt, selbst die untersten Klerikalen hatten heute ihren Tag, an dem sie mehr zu sagen hatten als alle gesalbten Bischöfe zusammen. In einem Seitenweg der Schustergasse sah Isaak schwarze Gestalten an einem Brunnen versammelt, mit Teufelsmasken und Peitschen, mit denen sie vermutlich die Kobolde und Geister des Winters vertreiben wollten, so wie die Mägde die Spinnweben und den Schmutz des Winters aus Kisten und Kästen, Schränken und Ecken vertrieben. Vor allem würden heute die Vorratskammern geleert für den Festschmaus vor der kommenden Fastenzeit. Ostern: das große Fest der Christen, dachte Isaak. Nicht einmal jeder Pfarrer war sich bewusst, dass damals Jesus und seine Jünger nach
8
Jerusalem gekommen waren, um mit ihren Glaubensbrüdern Pessach zu feiern, das Fest des Auszugs aus der ägyptischen Sklavenzeit. Die Römer, die das Königreich Juda besetzt und zur römischen Provinz gemacht hatten, nahmen Jesus fest und kreuzigten ihn. Hatte der jüdische Hohepriester den römischen Statthalter wirklich dazu überredet? Wer konnte das sagen, nach eintausend Jahren? Wo doch selbst die Chronisten, die Jünger Jesu, die Geschichten erst nach vielen Jahrzehnten aufgeschrieben hatten. Die Wahrheit ist die, die man glaubt, sagte sich Isaak, Christen werden ewig glauben, wir haben ihren Erlöser ermordet und werden uns ewig dafür bestrafen wollen. Der Rabbi sah mit Genugtuung, dass die Tür seines Hauses sich öffnete und seine Frau Eva und die vierzehnjährige Hannah ihm mit dem kleinen Samson an der Hand entgegenkamen. Der Junge riss sich los, um den Abba zu begrüßen. Er hob ihn mit beiden Händen hoch in die Luft, und Samson jauchzte freudig, während Eva ihrem geliebten, lebenslustigen Sohn stolz zulächelte. Er begrüßte Hannah und seine Gattin, die sagte: »Miri schläft. Aber Samson wollte zu dir!« Miriam war Samsons Zwilling, die Dreieinhalbjährigen ein Geschenk des Allmächtigen, denn die Eltern hatten nicht erwartet, nach Hannah noch einmal Nachwuchs zu bekommen. Der erstgeborene Sohn Abraham hatte sich soeben vermählt, und auch die zwei ältesten Töchter waren verheiratet und lebten nicht mehr zu Hause. Die Zwillinge waren sich verblüffend ähnlich und gleichzeitig sehr verschieden, Samson wissbegierig und vorlaut, Miri zufrieden und ruhig, stets dem Bruder die Führung überlassend. »Beim Schreinermeister nebenan wird bald gefeiert, sie haben Bänke vor die Tür und in den Hof gestellt«, sagte Hannah und nahm Isaak den kleinen Bruder aus den Armen. »Sie haben gestern gebacken, auch Haferküchlein, für die Vorbeiziehenden!«
9
In Mainz mussten die eintausend Juden unter den insgesamt siebentausend Einwohnern nicht in einem eigenen Viertel leben, sondern durften neben und zwischen christlichen Nachbarn wohnen. Trotzdem blieben sie eng zusammen in ihrem Gebiet, das sich an das Handelsviertel zwischen Fischtor und Karmeliterkirche anschloss. Nur einige der ärmsten Juden wohnten am Stadtrand. Wir sind nun mal ein geselliges Volk, dachte der Rabbi, außerdem ist es sinnvoll, zur Sicherheit zusammen und auch in der Nähe der Synagoge zu sein. »Ja, der Umzug wird hier bei uns vorbeikommen«, sagte Eva und blickte besorgt in die noch leere Gasse, während Samson voller Vorfreude rief: »Wir backen auch!« Sie gingen zusammen ins Haus und schlossen die Tür, nachdem Isaak, wie immer, mit der Hand die Mesusa, die kleine Kapsel mit dem Glaubensbekenntnis der Juden – Höre Israel, der Ewige Ist Eins … – am Türpfosten berührt und die Finger geküsst hatte. »Hör zu«, sagte er ernst zu seinem kleinen Sohn. »Wir haben bald unsere eigene Feier. Purim.« Er ergriff Samsons Hand und sprach weiter, obwohl er nicht wusste, ob sein Kleiner, der ihm angestrengt mit großen Augen zuhörte, alles schon begreifen konnte: »Vor vielen, vielen Jahren lebte das Volk der Juden im Reich der Perser. Der König war mit Esther, einer Jüdin verheiratet. Haman, ein Bösewicht, überredete den König, die Juden in seine Macht zu geben, da er sie töten wollte. Doch der König erfuhr, dass er das Volk seiner Königin massakrieren wollte und ließ Haman hinrichten. Das Gesetz zur Ermordung der Juden konnte er nicht rückgängig machen! Aber er erlaubte den Juden, sich zu bewaffnen und gegen ihre Feinde zu kämpfen. Das taten sie zwei Tage lang, bis sie den Sieg errungen hatten. Den feierten sie in der persischen Hauptstadt Susa. Und wir feiern Purim jedes Jahr! Mit Verkleidung und Gesang, ja auch mit Trinken – und mit viel Lärm. Selbst in der Synagoge machen wir viel Lärm!«
10
Danach fasten wir nicht, dachte er, das tun wir nur am Versöhnungstag, wenn wir den Herrn anflehen, unsere Sünden zu vergeben, und wenn wir jeden, den wir beleidigt haben, um Verzeihung bitten. Auch am Tisha B’Av fasten wir, am neunten Tag des Monats Av, an dem die Babylonier in Jerusalem den ersten Tempel und fünfhundert Jahre später die Römer den zweiten Tempel zerstörten. Danach versklavten sie unsere religiösen und anderen Führer, der Rest wurde vertrieben und Juda wurde der Name unserer Feinde verliehen, der Pharisäer, sodass das Land nun Palästina hieß. Samson zappelte unruhig an der Hand des Vaters und Eva holte den tief in seinen Gedanken versunkenen Isaak wieder in die Gegenwart: »Einige der Schüler waren hier, aber ich hab sie sofort nach Hause geschickt – Jehuda hat den kleinen Simon zu seinen Eltern gebracht. Sie sollen sich heute nicht auf der Straße blicken lassen.« »Gut, meine Liebe.« Isaak wandte sich um und schritt den Gang entlang zu seiner Kammer, um sich seiner Arbeit zu widmen. Nein, heute war kein Tag zum Unterrichten. Nun hatte er Zeit für anderes. Er setzte sich an den Tisch und griff nach einem Schreiben, das er sich zurechtgelegt hatte. Der Oberrabbiner Jakob ben David hatte es ihm gegeben. Es war vom Erzbischof von Speyer, Rüdiger von Huzmann, auf Latein, der Sprache der Kirche, abgefasst, das dem einfachen Volk nicht geläufig war, und an die Mainzer Parnassim gerichtet. Die Gemeindeältesten in Worms hatten dasselbe Schreiben erhalten. Der Erzbischof lud Juden ein, in seine Stadt zu ziehen, da er überzeugt war, eine große jüdische Gemeinde würde das Ansehen von Speyer erheblich erhöhen, indem sie den Handel, vor allem den Fernhandel, vorantrieb. Er versprach erstaunliche Dinge, Privilegien und Rechte, die noch nie zuvor eine Obrigkeit Juden im Reich gewährt hatte: Grundbesitz sowie Handelsfreiheit, das Recht, Waren ohne Einschränkungen an Christen zu verkaufen, mit Gold und Geld
11
zu handeln, Christen als Knechte und Mägde anzustellen und, was fast unglaublich war, vor dem Gericht dasselbe Recht wie Christen zu haben, also Zeugen aufrufen zu können und einen Eid zu schwören. Darüber hinaus durften Streitigkeiten zwischen Juden von jüdischen Richtern nach jüdischen Gesetzen geregelt werden. Juden würden in der Innenstadt wohnen können, wobei der Erzbischof sagte, er werde um ihr Viertel herum eine Mauer ziehen, die ihnen vor dem gemeinen Volk Schutz böte. Der Oberrabbiner hatte mit einem traurigen Lächeln gesagt: »Wir werden uns beraten müssen. Aus Nächstenliebe lädt der Erzbischof uns nicht ein – eher aus Liebe zu unserem Geld. Er hat gesehen, wie tüchtig unsere Geschäftsleute sind und dass sie zum Wohlergehen von Mainz und Worms beitragen. Aber … er verspricht erstaunliche Dinge, das musst du, das müsst ihr alle lesen.« Rabbi Isaak wiegte bedächtig den Kopf. Er stimmte dem Oberrabbiner zu. Ein Angebot, das zu erwägen war. Im Dorf Altspeyer lebten bereits einige Juden, das wusste Isaak. Der Erzbischof wollte den Dom von Speyer umbauen und zum prächtigsten im christlichen Abendland gestalten. König Heinrich IV. unterstützte dieses Vorhaben, da die Gebeine seiner Vorfahren dort begraben lagen, und hatte Speyer bereits großzügige Geschenke gemacht. Aber um den Bauplan der hohen Herren zu verwirklichen, wurde noch viel mehr benötigt. Und woher sollten sie es nehmen, wenn nicht von den Juden? Dafür waren sie ihnen stets gut genug. Sie sollten schuften und sparen, damit die anderen sich dann bedienen konnten. Obwohl Isaak zugeben musste, dass in diesem Fall der Erzbischof nicht einfach zugriff, sondern eine erhebliche Gegenverpflichtung einging. Rabbi Isaak bedachte, wie gut sich die jüdischen Gemeinden im Rheinland entwickelt hatten. Man sagte, dort hätten Juden bereits vor der Entstehung der Kirche in Ein-
12
tracht mit den anderen gewohnt. Schriftlich hatte es erst der Gelehrte Gerschon ben Jehuda belegt, der bis 1040 in Mainz gelebt und über die Geldgeschäfte der Mainzer und Wormser Juden auf der Kölner Messe geschrieben hatte. Der Rabbi war kein Prophet, wie er manchmal lächelnd zu den Schülern sagte. Deshalb konnte er nicht wissen, dass bald auch Speyer zusammen mit Mainz und Worms zu den größten jüdischen Gemeinden im Kaiserreich zählen würde. Die drei Städte wurden unter den Juden als »Schum« bekannt, nach den ersten Buchstaben der hebräischen Namen der drei Orte: Schin für Schpira (Speyer), Waw (U) für Warmaisa, Mem für Magenza. Ihre Talmudschulen wurden geachtet. Die SchUM-Auslegung der Gesetze galt für alle deutschen Juden. Isaak wusste auch, dass der König im Streit lag mit dem Papst, Gregor VII. Ihm tat der 1050 geborene Heinrich eigentlich leid. Er lächelte, als er sich an eine ungewöhnliche Begegnung erinnerte: Spät an einem Purim-Abend, an dem er etwas zu viel gefeiert hatte, war er durch die Straßen gelaufen – obwohl es bei Strafe verboten war. An der nahen Kirche war er beinah mit einer breiten Gestalt zusammengestoßen. Diese entpuppte sich als Mönch, der ihn brüderlich umfasste, um nicht umzufallen. Auch Bruder Lazarus, der von seinem Abt entsandt worden war, hatte dem Trank des Bacchus in beachtlichem Maße zugesprochen. Fast lallend lud er den Juden ein, in seiner Unterkunft, einer kleinen Kammer hinter der Kirche, ein Glas mit ihm zu genießen – was ebenfalls streng verboten war. Dabei amüsierten sich die ungleichen Bekannten vortrefflich. »Heinrich hat’s nicht leicht gehabt«, erklärte der Mönch. »Nach dem Tod des Vaters ist er als unmündiger König unter der Regentschaft der willensstarken Mutter und dem ungeliebten Erzbischof als Ratgeber aufgewachsen. Man
13
sagt …«, ein Rülpsen verschluckte, was man sagte. »Heinrich hasste ihn. Einer, der dabei war, erzählte, der König sei nach der Zeremonie, die ihn als Fünfzehnjährigen mündig erklärte, dem Erzbischof an die Kehle gesprungen. Er musste von einigen Edelleuten zurückgerissen werden.« Ein neuer Rülpser. »Man sagt auch viel über den Lebenswandel des hohen Herrn«, warf der Rabbi ein. Er wusste, der junge König hatte sich seine Braut nicht aussuchen können. Das war eben üblich. Auch bei Juden. Heinrich liebte seine Königin nicht. »Stimmt! Er lebt anders, als man von ihm erwartet hat.« Der Mönch stierte in den Krug und stellte fest, dass er nichts Flüssiges mehr enthielt. Er fuhr fort: »Außerdem hatten die großen Fürsten dem unmündigen König nur unter der Bedingung die Treue geschworen, dass er ein guter und gerechter König werde! Nein, kein Wunder, dass er dieser Forderung trotzte. Und dass die Fürsten sich nun zum Teil gegen ihn auflehnten und einen König ihrer Wahl haben wollten… Ach was! Es geht um Macht.« Ob es dem frommen Bruder später leid tat, mit einem Juden getrunken und geredet zu haben? Isaak wusste es nicht. Er wusste auch nicht, wie er später in sein Haus gekommen war. Er war mit einem dicken Kopf in seiner Tageskleidung aufgewacht, und bis zum Abend hatte niemand gewagt, ihn anzusprechen. Er selbst hatte nie ein Wort über diese Nacht verloren. Der Mönch hat Recht behalten, sagte er sich jetzt: Es ging um Macht. Ein Kampf zwischen kirchlicher und weltlicher Herrschaft. Die Fürsten wollten nicht, dass der König ihnen befehlen konnte, was sie zu tun und zu lassen hatten. Der König wiederum wollte nicht nur die Fürsten beherrschen, sondern auch die Kirche. Dagegen sträubte sich der Papst. Verständlich war das alles schon.
14
Isaak durchsuchte einige Schriftstücke und fand endlich die Abschrift von Heinrichs Anklage gegen den Papst: »Ich, Heinrich, durch die Gnade Gottes König, sage dir mit allen meinen Bischöfen: Steige herab, steige herab, du auf ewig zu Verdammender.« Kein Wunder, dass der Papst danach den König mit dem Bann belegte, was den erschrecken musste, denn aus der Kirche ausgeschlossen zu sein, so glaubten die Christen, bedeutete, ins Fegefeuer zu kommen. Diesmal hatte der Papst gewonnen, denn die Fürsten stellten einen Gegenkönig auf, sodass Heinrich IV. vor sieben Jahren dem Papst nach Canossa nachreisen musste, um ihn demütig zu bitten, ihn wieder in die Kirche aufzunehmen. Die andauernden Machtkämpfe hatten Europa verunsichert. Deswegen war es für die Juden als gebeutelte Minderheit wichtig, das Richtige zu tun. Die Gemeindeältesten mussten über den Brief des Speyrer Erzbischofs diskutieren. Im September 1009 hatte der Fatimiden-Kalif die Grabeskirche auf dem Tempelberg in Jerusalem geplündert und das Felsengrab Jesu zerstört, eine irrsinnige Tat. Im gesamten Reich der Fatimiden wurden danach Christen diskriminiert. Christliche Symbole und Feiertage wurden verboten. Christen mussten bestimmte Gürtel und schwarze Kopfbedeckungen tragen, die sie als Verfolgte erkennbar machten. Im Abendland war die Empörung über die Schändung des Heiligen Grabes groß. Es kam darauf zu Verfolgungen von Juden – aberwitzig, dass Juden stellvertretend für Muslime bestraft wurden! Aus Mainz wurden Juden vertrieben, nachdem man verlangt hatte, sie sollten sich taufen lassen. Einige wenige stimmten der Taufe zu, die Mehrheit, darunter Isaaks Vater und Großvater, floh aus der Stadt. Nach ein paar Jahren durften sie zurückkommen, man hatte gemerkt, dass sie in der Wirtschaft fehlten. Aber sicher hatten die Rückkehrer sich nicht gefühlt. Das konnte keine jüdische Gemeinde. Sollte es in Speyer wirklich anders sein? Das eben war die Frage, die schwer zu beantworten war. Nach-
15
denklich legte der Rabbi den Brief beiseite. Morgen würden sie darüber beraten können.
2. Der Graf Wie versprochen, wurde gekocht, gebacken, genäht und gelacht. Dabei hatte Eva die Hilfe von Dinah – einer Verwandten von Isaak, deren Eltern froh gewesen waren, als Eva sie als Magd in ihren Haushalt aufgenommen hatte. Hannah hatte gerade den Zwillingen ihre Kronen aufgesetzt, zwei Reifen, die sie mit Spänen aus der Werkstatt des Nachbarn gebastelt hatte. Miri sollte als Königin Esther, Samson als König Ahasverus verkleidet werden. Kaum hatte Samson die Krone auf den wirren Locken, als er rief: »Ich bin der König!« Zu seinem Leidwesen war die Tür zur Kammer seines Abba verschlossen. Samson wusste, dass er dann nicht stören durfte. Er lief zurück und merkte, dass die Vordertür etwas offen stand. Neugierig stieß er sie weiter auf und staunte, als er das Treiben in der Gasse sah. Gerade kam eine wilde Horde vorbei, maskierte Menschen in merkwürdigen, bunten Kostümen, einige trugen Stöcke, andere Peitschen und Ruten, mehrere hatten auch Krüge dabei. Das Geschrei erschreckte den Knaben, er wollte zurückweichen, als ihn eine Hexe mit ellenlanger Nase und wirren Haaren erblickte. »Erlauchter König!«, schrie sie, »ein Tänzchen gefällig?« Und ehe Samson weglaufen konnte, hatte sie blitzschnell eine seiner kleinen Hände ergriffen und ihn aus dem Eingang gezogen. Eine zweite Hexe, ein Teufel und zwei Kobolde umtanzten grölend das ungleiche Paar. Ein Laienbruder in schmutziger, brauner Kutte, der sich das Gesicht halb rot, halb schwarz bemalt hatte und Arm in
1
Arm mit einem Dämon lief, fasste die Hexe um die Hüfte und schrie: »Was soll der Spuk? Was willst du mit dem Judenkind?!« »Tanzen!«, brüllte sie zurück und herrschte Samson, der sich nun wehrte und losreißen wollte, an: »He, Hübscher, so schnell entkommst du mir nicht!« Sie erblickte einen Krug in den Händen des Dämons, riss ihn an sich, tauchte die Hand in das Nass und grölte: »Was ich will mit dem Judenkind? Was man mit allen tun soll! Ich … ich taufe es!« Die Maskierten waren zum Teil weitergezogen, zum Teil geblieben, um den Spaß mitzumachen. Der Menge gefiel das Spektakel, die Leute schrien vergnügt: »Ja! Ja! Tauf ihn! Tauf ihn!« Die Hexe ließ sich das nicht zweimal sagen. Sie warf ihren Besen zur Seite, tauchte die Hand noch mal in den Krug und rief: »Hört, Ihr Herren, lasst’s euch sagen – ich taufe dich … im wahren Glauben … im Namen des Herrn!« »Im Namen des Herrn, Amen!«, schrien die anderen zurück. Die Hexe nahm ihren Besen, ohne Samson loszulassen, und der Laienbruder verkündete: »Zur Kirche! Wir geben das Kind der Kirche!« Auch das gefiel der Menge. Als Samson sich weiter wehrte und nach der Mame schrie, hob ihn der Dämon auf, hielt ihn fest und lief mit der Hexe den anderen voraus. Zwei Buben hatten den Ruf gehört und rannten zusammen zur Kirche, um dem Pfarrer Bescheid zu sagen. Im Haus hatte man zwar das Gekreisch gehört, ahnte aber nicht, dass Samson die Ursache dafür war. Erst als das Kind laut brüllte, erkannte Eva die Stimme ihres Sohnes und lief auf die Straße. Entsetzt sah sie Samson in den Armen eines Dämons und rannte dem Zug schreiend hinterher. Die zweite Hexe, die sich ärgerte, nicht wie die andere im Mittelpunkt zu stehen, versetzte der Jüdin einen heftigen
17
Schlag. Eva wurde schwarz vor Augen, sie konnte sich nirgendwo festhalten und schwankte. Ein zweiter Schlag ließ sie bewusstlos umsinken. Isaak, von Hannah alarmiert, stürmte aus dem Haus, hob seine Frau auf und brachte sie mithilfe der jammernden Magd in Sicherheit. Es dauerte eine Weile, bis er verstand, was Dinah ihm zu sagen versuchte: »Eva ist rausgelaufen, weil der Pöbel Samson fortgeschleppt hat.« Verzweifelt überließ der Rabbi Eva den Frauen und rannte los, als ginge es um sein Leben. Die grölende Meute hatte inzwischen die Kirche erreicht, wo der Pfarrer vor dem Eingang auf der obersten Stufe stand. Der Dämon hielt ihm das Kind entgegen und sagte stolz: »Der ist der Kirche!« Der Pfarrer zögerte. Er hatte schon gehört, was geschehen war und wusste nun nicht, wie er sich verhalten sollte. Was würde der Bischof sagen? Würde er sich empören, weil der heilige Akt der Taufe von diesen betrunkenen Hörigen entwürdigt wurde? Oder würde er gutheißen, dass ein Jude getauft wurde? Er würde das herausfinden müssen. »Gebt mir das Kind«, forderte er schließlich. »Und geht in Frieden.« Noch ehe er die Arme ausstrecken konnte, sah er, dass der Mob sich von ihm abgewandt hatte. Die Leute hatten etwas gehört, was der Pfarrer erst jetzt bemerkte: das Stampfen von Pferdehufen. Ein mächtiger Hengst bahnte sich einen Weg durch die Menge, hinter ihm tauchten drei weitere Pferde auf. »Was gibt es?«, fragte mit dröhnender Stimme der erste Reiter, dessen Reisemantel und pelzgesäumter Hut den Herrn von Adel verrieten. »Ein Kind der Kirche!«, wiederholte der Dämon. »Wir haben der Kirche ein Judenkind vermacht!« »Und getauft!«, fügte die Hexe stolz hinzu. »Ich hab ihn im Namen …« »Sei still«, herrschte der Pfarrer sie an. »Du lästerst den Herrn!«
18
»Getauft?« Der Adlige zog nachdenklich die Stirn in Falten. August von Raabe stammte aus Sachsen, kannte die Städte am Rhein aber schon seit seiner Kindheit und besuchte sie oft und gern. Sein Vater hatte ihn als Kind einem rheinischen Fürsten übergeben, an dessen Hof er dann aufgewachsen war. Die ersten Jahre hatte er als Page gedient, später war er zum Knappen ausgebildet worden. Zur Zeit der Sachsenkriege zwischen König Heinrich IV. und den Sachsenfürsten war er im Oktober 1080 zum Ritter geschlagen worden, vor der Schlacht, in der Rudolf von Rheinfelden, ein Gegenkönig zu Heinrich, seine Hand und kurz danach sein Leben verlor. Seitdem verwaltete von Raabe sein Lehen und hielt sich aus der Politik heraus. August war stets auf sein Wohl bedacht. Er überlegte, ob es für ihn von Vorteil sein könnte, der Kirche ein Judenkind zu geben. Er könnte es auch auf seiner Burg selbst zu einem guten Christen erziehen. Jedenfalls sollte man ein Geschenk nicht ablehnen. »Nimm ihn!«, befahl er dem Ältesten seines Gefolges, der sofort sein Pferd zu dem Dämon bewegte und ihm Samson aus den Armen riss. Nun hatte Isaak die Menge endlich erreicht und bahnte sich einen Weg zu den Reitern. Samson streckte die Ärmchen aus, aber sein Schrei nach dem Abba ging im Lärm unter. »Mein Sohn! Herr, gebt mir meinen Sohn!«, rief Isaak. »Ein Christ hat nichts mit einem Juden zu tun!«, sagte von Raabe verächtlich und zog an den Zügeln, um den Kirchplatz zu verlassen. »Er ist ein Jude! Er ist mein Sohn!« Von Raabe sagte ruhig: »Das war er. Nun ist er es nicht mehr.« Dann setzte er sein Pferd in Trab. Wie auf Kommando erhoben die zwei Hexen ihre Besen und schlugen auf Isaak ein. Auch andere fanden Spaß daran, sodass Rabbi Isaak sich nicht lange wehren konnte und wie zuvor seine Frau bewusstlos in die Knie sank. Das Letzte,
19
was er sah, war eine Pferdedecke und darauf einen Greif, dessen Flügel ihn erschreckten.
3. Der Novize Auf einer breiten Felsenplatte hoch über dem lieblichen Neckartal lag das Kloster des Heiligen Antonius. Die Bewohner der Dörfer ringsum waren glücklich, es in ihrer Nähe zu haben. Sie besuchten zwar für gewöhnlich nicht die Kirche, die über die Klostermauer hinausragte, dafür war der Weg nach oben zu beschwerlich. Doch mehrere Wohlhabende hatten, wie es damals üblich war, vor ihrem Ableben dem Kloster irdische Güter vermacht, um sich den Weg ins Himmelreich zu ebnen, darunter auch einige Äcker und Obstgärten. Deshalb arbeiteten stets Brüder am Abhang oder im Tal und erfreuten viele mit ihrem Gesang. Der Abt hatte den Mönchen, die Feldarbeit verrichteten, Dispens von einigen der sieben Gebetszeiten erteilt. Also beugten sie zu diesen Stunden draußen die Knie und sangen zusammen ihre Gesänge. Im Kloster gab es um zwei Uhr morgens die Vigilien – den Nachtgottesdienst –, bei Sonnenaufgang die Laudes – den Morgengottesdienst –, danach die Gebete zur Prim, Terz, Sext, Non, gefolgt von der Vesper und zuletzt vom Komplet. Danach, wenn die Mönche sich in das Dormitorium zum Schlafen zurückzogen, herrschte Redeverbot. Fünf Monate nach Ostern sandte Petrus von Stein nach Bruder Lukas. Der begab sich so schnell er konnte zum Haus des Abtes, wo man ihn zum Klostergarten schickte. Hier fand der etwas atemlose Lukas seinen Abt, einen untersetzten, stämmigen Mann, der aus einem alten Adelsgeschlecht stammte, jedoch mehr wie ein Bauer denn wie ein Aristokrat wirkte. Er studierte die kränklich wirkenden Blätter eines Rosenstrauchs. Als der Bruder sich verbeugte, fragte
20
er ohne den Blick zu heben: »Wie geht es mit unserem jüngsten Novizen? Bemüht er sich, die Regeln des Hauses zu befolgen?« Lukas, der für die neuen Brüder verantwortlich war und sie alle liebte, besonders aber die kleinsten, die manchmal sogar als Säuglinge der Obhut der Kirche übergeben wurden, bedrückte es, wenn er einen seiner Lieblinge nicht loben konnte. »Ich tue, was ich kann, mein Herr!« »Das war nicht meine Frage. Tut er, was er kann?« »Julian ist ein liebes Kind«, antwortete Lukas traurig, »Aber er vermisst seine … sein Zuhause.« Mame und Abba, manchmal auch Miri, sagt er, wenn er weint, was oft der Fall ist, dachte der Bruder. Er selbst hatte sich glücklich gefühlt, als er als Postulant, dann als Bruder, in diese Gemeinschaft aufgenommen wurde. Ein Glück, für das er nicht jede Stunde, sondern jede Minute Gott dankte. Als Sohn einer Magd, die in einem Pfarrhaus gearbeitet hatte, und eines unbekannten Vaters – von dem die Dorfbewohner sagten, der Pfarrer wüsste wohl am besten, auf welchen Namen er hörte – hatte Lukas Demut mit der Muttermilch aufgesogen, Demut – keine Liebe. Es schmerzte ihn, dass die Eltern ein Kind, das sie so liebte, wie Julian es tat, der Kirche gegeben hatten. Er war wohl wie die meisten Novizen ein zweiter oder dritter Sohn, der nichts erben würde. Sie hatten das Beste für ihr Kind gewollt. Nun musste das Kind sich einordnen, es würde die Regeln des Klosters verinnerlichen, würde seine Pflichten kennenlernen, um zu wissen, dass das Gebet an erster Stelle stand, dass dann arbeiten wichtig war, und dann noch das Lesen. »Hier ist sein Zuhause«, sagte der Abt streng. »Also, versteht er, dass er nicht in den Gängen umherrennen kann? Dass beim Essen Schweigen herrschen muss? Dass er lernen muss, dem Herrn gehorsam und in Liebe zu folgen?« Ein Wortschwall brach aus Lukas heraus: »Er ist anders als die anderen, er ist – er hat wohl viel Freiheit gehabt.
21
Manchmal spricht er in fremder Sprache … er ist lieb und versucht zu tun, was ich verlange, aber … und dann … nachts schreit er oft im Schlaf und erschreckt die anderen, sodass ich ihn wie die Allerkleinsten in meiner Zelle auf den Strohsack bette.« In Sankt Antonius hatten Mönche mit bestimmten Aufgaben eigene Zellen, so auch Bruder Lukas, der Tag und Nacht in der Nähe seiner Schützlinge sein musste. »Hm.« Der Abt überlegte, was er tun könnte. Er hatte gehofft, dass fünf Monate genug waren, um das Kind gefügig zu machen. Das schien nicht der Fall zu sein. Er würde mit dem Novizenmeister reden müssen, um eine Lösung zu finden. Doch auch dem konnte er nicht verraten, was in der Nacht nach Fastnachtmontag geschehen war, als nach Komplet ein ihm unbekannter Geistlicher erschöpft nach einem langen Ritt eingetroffen war, das schlafende Kind übergeben und erklärt hatte, der Bischof wisse darüber Bescheid. Abt Petrus rief sich die Ereignisse dieser Nacht ins Gedächtnis. Als er die Decke zurückgeschlagen und das nackte Kind betrachtet hatte, hatte er gedacht, auch ich weiß nun Bescheid, und mit gerunzelter Stirn gefragt: »Ist er getauft?« Der fremde Geistliche hatte genickt. »Zweimal. Das erste Mal …« Es folgte eine wegwerfende Geste. »Ich taufte ihn Julian, in Gegenwart des Herren, der ihn – beschützt hat an jenem Fastnachtmontag.« Das sagte dem Abt wenigstens, dass er zuvor geraubt worden war, wahrscheinlich von einer übermütigen Gruppe von Narren, die ihn im Scherz tauften. Nur: Für die Kirche war auch solche eine Taufe kein Scherz. Der Adlige hatte das Richtige getan. Das Kind sollte vorerst in Obhut der Kirche bleiben. Vielleicht für immer. Der Abt tauchte aus seinen Gedanken auf und wollte Lukas schon wegschicken, als ihm etwas in den Sinn kam, was der Bruder gesagt hatte. »Wie war das?«
22
Verwundert wiederholte Lukas: »Ich sage, er kann lesen, Buchstaben und Wörter, Vater!« Ein zweites Stutzen. Er kann lesen? Natürlich. Die Juden konnten lesen, schreiben und rechnen. Im Gegensatz zum Rest der Bevölkerung. Sicher lernten es ihre Kinder sehr früh. War das nicht Grund genug, dass das Volk sie fürchtete, mit ihren Büchern und diesen fremden Gebräuchen? Das Volk des Teufels. Und der Knabe sprach manchmal hebräisch. Vielleicht aus Trotz? Eine Sprache, die der Abt beherrschte. So wusste er, dass sein Titel »Abt« von abba, Vater, hergeleitet war. »Der Novizenmeister wird von nun an für Julian verantwortlich sein«, erklärte Petrus mit mildem Ton, denn er war sich sicher, dass die Entscheidung Bruder Lukas kränken würde. »Er soll weiter lesen lernen, mit den Fünfjährigen.« Aber mit lateinischen Buchstaben, nicht mit dem hebräischen Aleph Bet. Vielleicht hatte er beides gelernt? Jedenfalls würde ihn das gefügiger machen, wenn er Spaß am Lernen hatte. Lukas entfernte sich. Er bedauerte den Beschluss seines Herrn, und doch verstand er ihn. Er war in einem Dorf aufgewachsen und wusste, wie man Tiere zahm machte. Sie wollten Julians Willen brechen! Würde es gelingen? Er war anders, dieser Novize. Und nicht nur, weil er beschnitten war, wahrscheinlich wegen einer Infektion, das geschah öfters. Er war eben anders. Julian war klug, seine schwarzen Augen sahen mehr als die der Älteren. Er würde die Schule absolvieren, dann ein Studium, und Priester werden. Nicht wie er, Lukas, der nie einen höheren Rang erreichen würde. In der Nacht konnte Lukas nicht schlafen. Deshalb schlich er am folgenden Tag in der Ruhestunde der Kleinen in den Schreibsaal, in dem die Brüder Texte kopierten. Lukas konnte mit einer Feder auf Pergament, auch mit einem
23
Griffel auf eine Wachstafel langsam schreiben. Er wusste, wo die Federn und wo die Pergamente aufgehoben wurden. Er betete, dass Gott ihm verzeihen würde und begann zu schreiben: »Ich, Lukas, erhielt am Morgen vor Aschermittwoch im Jahr unseres Herrn 1084 …« Er hatte sich vorgenommen, alles aufzuschreiben, was er über Julian wusste. Eines Tages, wenn der Jüngling das Gelübde geschworen hatte, würde er ihm die Aufzeichnungen überreichen. Jeder hatte das Recht zu wissen, woher er stammt.
4. Der Umzug Im selben Monat, in dem Julian zum ersten Mal in der Novizenschule saß – allein, wie die Regel befahl, denn privater Kontakt mit anderen war verboten –, erschien beim ersten Morgenlicht am Tor von Mainz eine kleine Gruppe, die wünschte, die Stadt zu verlassen. Der Wächter blinzelte, als er sie betrachtete. Juden. Ein Mann mit einem schwarzen, von vielen Silbersträhnen durchzogenen Bart und ein Weib mit roten Augen und starrem Blick, zwei Mädchen, eins getragen von dem älteren, sowie eine Magd. Dass die Silbersträhnen erst in den letzten Monaten im Bart des Mannes erschienen waren und dass die Frau noch nicht lange gebeugt ging, konnte der Torhüter nicht wissen, noch würde er es wissen wollen. Für ihn war anderes Silber wichtig, nämlich die silbernen Münzen in einem kleinen Beutel, den der Mann in seiner Hand gehalten hatte und der nun in seinem Wams verschwand. Er warf einen misstrauischen Blick auf die Packesel, sodass der Mann erklärte, er hätte eine Tochter in Worms, die in den Wehen läge, was der Wahrheit entsprach. Weniger nahe der Wahrheit waren seine weiteren Erklärungen, dass seine Frau als Hebamme der Tochter helfen wollte und dass die Esel Geschenke trugen.
24
Der Wächter ließ sie ziehen, das Beutelchen war schwer genug für ein wenig Großmut. Außerdem bedeutete es einige Juden weniger in der Stadt und das war nur gut. Nach drei Stunden erreichte die kleine Gruppe ein Wirtshaus, in dem Isaaks ältester Sohn Abraham mit Pferden und zwei christlichen Knechten auf sie wartete. Der Erzbischof von Speyer hatte sein Wort gehalten und den Juden die versprochenen Privilegien eingeräumt. Trotzdem zog Rabbi Isaak ungern nach Speyer, aber er glaubte, es der Familie zu schulden. Vor allem Hannah, denn Samuel ben Gideon, Jehudas Vater, hatte ihn formell gebeten, ein Schidduch zwischen Jehuda und Hannah zu besprechen. Die beiden waren seit ihrer Kindheit befreundet, und Isaak wusste, dass Hannah nie einen anderen Gatten gewünscht hätte. Er hatte befürchtet, dass Samuel seinem Sohn eine der Töchter seiner Geschäftsfreunde aussuchen würde, deren Mitgift viel größer wäre als alles, was er Hannah geben könnte. Aber als er Samuel seine Sorgen gestanden hatte, hatte dieser schallend gelacht und gesagt, Geld hätte Jehuda genug. Was er brauche, sei eine Perle unter den Frauen und die, so hatte er gesagt, hätte er in Rabbi Isaaks Haus gefunden. Nun wollte er dem verehrten Rabbi ein förmliches Angebot für die Hand seiner Tochter machen. Das hatte Isaak mit Freude angenommen. Nun war Jehuda nach Speyer gezogen, wo er die Geschäfte des Vaters leitete. In ein oder zwei Jahren würden die jungen Leute heiraten. Es war richtig, dass die Braut in derselben Stadt lebte wie ihr Verlobter. Isaak wäre am liebsten dort geblieben, wo Samson entführt worden war, er hatte noch immer die Hoffnung, dass er ihn ausfindig machen und zurückholen könnte. Er selbst war damals – vor fünf Monaten – nach Hause getragen worden, nachdem Hannah ihn gefunden hatte. Erst nach vier Wochen liebevoller Pflege durch Hannah und Dinah hatte er sich wieder erholt. Selbst Miri war mit Krügen voll Wasser und
25
Aufgaben, die ihr die Älteren übertragen hatten, eifrig hin und her gelaufen. Der Rabbi konnte sich bald wieder um seine Schüler kümmern. Doch er war nicht mit dem Herzen dabei, es war ihm unmöglich, Samsons Schicksal zu vergessen oder sich keine Sorgen darum zu machen, wie es ihm erging, ob man ihn gut behandelte. Außerdem bangte er um Eva, die nicht völlig genesen war. Sie war bereits nach zehn Tagen aufgestanden, hatte am selben Tag einen Weinkrampf bekommen und geschrien, dass sie an allem schuld sei, sie hätte sofort nach dem Kind sehen müssen, als das Gebrüll auf der Straße begonnen hatte. Nichts und niemand konnte sie trösten. Danach war sie in Trauer versunken, war apathisch geworden, ihr Verhalten hatte sich geändert, sie wurde träge und bewegte sich wie eine alte Frau. Nichts konnte sie aufheitern, sie redete kaum, vernachlässigte sich selbst und musste von Hannah immer wieder an manches erinnert werden. Das Mädchen hatte viele der Haushaltspflichten übernommen. Vor allem versuchte sie, der kleinen Miri die Mutter zu ersetzen. Die Kleine war traurig und verwirrt, sie verstand nicht, wo der Bruder geblieben war; sie waren stets zusammen gewesen, er war ihr Halt, nach der Mame und dem Abba, vielleicht sogar noch vor ihnen! Samson besaß ihr ganzes Vertrauen und ihre Liebe. Miri war immer ein ruhiges Kind gewesen, das sich selten auflehnte und nie beschwerte, aber jetzt wurde sie ganz still und in sich gekehrt. Nur Hannah gelang es, sie zum Reden und manchmal sogar zum Singen zu bewegen. Isaak hatte Grund, sich Sorgen um seine Frau zu machen. Der Arzt Saul, dem er am meisten vertraute, war hilflos, er hatte zwar einen Trank verordnet, den er aus einer Heilpflanze zubereitete, konnte damit aber keine Besserung bewirken. »Wir wissen nicht, was im Kopf vorgeht«, hatte er bekümmert gesagt. »Oder in der Seele.« Saul konnte auch nicht sagen, wie viel dem Schlag zuzurechnen war, den Eva
2
erhalten hatte, ob diese Verletzung etwas im Kopf zerstört hatte oder ob alles auf dem Kummer wegen Samsons Entführung beruhte. Eva schien wie eine Schlafwandelnde durch den Tag zu gehen. Manchmal sagte sich Isaak, dass sie in einer Welt lebte, in der er keinen Platz hatte. Es war ihm, als hätte er nicht nur einen Sohn, sondern auch seine liebende Gattin verloren. Dabei hatte er, genau wie die Kehille, alles getan, um Samson zu finden. Isaak wusste nicht, ob der Adlige das Kind behalten oder der Pfarrer die Verantwortung übernommen hatte. Bittbrief auf Bittbrief war verfasst und gesendet worden, an die Stadtoberen, den Erzbischof und andere. Der benachbarte Schreinermeister, der Erste in seinem Gewerbe, versprach, ausfindig zu machen, was mit Samson geschehen war, doch auch er kam nicht weiter. Die Kehille bot der Kirche ein großes Geschenk an, das wurde empört als Bestechung abgewiesen, dann insgeheim angenommen, half aber auch nicht. Schließlich hatte Isaak sich dazu durchgerungen, nach Speyer zu ziehen. Er hoffte, dass eine neue Umgebung Eva helfen würde, sich zu erholen. Ihr trauriger Zustand bedrückte nicht nur ihn, sondern die gesamte Familie und schreckte am Ende alle Besucher ab. In Isaaks Jeschiwa spürten selbst die Schüler, dass mit Rabbi Isaak etwas nicht in Ordnung war. Inzwischen hatten viele Juden das Angebot des Erzbischofs angenommen, vor allem, weil König Heinrich IV., inzwischen vom Papst zum Kaiser gekrönt, wie Erzbischof Rüdiger den Bau des Doms weiter vorantrieb. Der Kaiser hatte schriftlich das einzigartige Schutzabkommen des hohen Würdenträgers gutgeheißen. Mehr noch, er hatte angedeutet, dass ein ähnliches kaiserliches Dekret für das gesamte Reich erwogen werden könnte. Unglaublich! Großartig! War es wirklich möglich? Würden Juden einen Weg gehen können, der zur Gleichwertigkeit
27
mit den »anderen« führte? Rabbi Isaak hoffte und betete dafür mit derselben Inbrunst, mit der er hoffte und betete, dass seine Frau genesen würde. Mehr noch, dass er einmal, nur einmal noch, seinen Sohn in die Arme nehmen könnte, ehe er für immer die Augen schloss.
28
ÂťEines Tages wird es Frieden geben zwischen uns allen, sagte sich Samson ben Isaak. Wie konnte es anders sein?ÂŤ
19.90 EUR [D] inkl. eBook ISBN 978-3-95518-019-5