TIERE IM WINTER
Über Strategien und Gefahren

Ratgeber: Selbst was tun
Aktuell: Neue BUND-Reisen Gasbohrung? Nein danke!


Über Strategien und Gefahren

Ratgeber: Selbst was tun
Aktuell: Neue BUND-Reisen Gasbohrung? Nein danke!


AKTUELLES
4/5 Aktuelle Meldungen
6 Kommentar
7 Gerettete Landschaft
8 -10 Aktuelles
TITELTHEMA
12/13 Tiere im Winter
14-16 Wie überleben?
17 Wie Wildtieren helfen?
18/19 Voller Gefahren
GU T LEBEN + AKTION
21 Zehn Ökotipps: Selbst was tun
22 Igel melden
NATUR IM PORTRÄT
23 Grünes Band aktuell
24 Pflanzenporträt Wilde Karde
25 Spurensuche Gartenschläfer
26/27 Jahresschwerpunkt Wasser
28/29 Schutz für gefährdete Arten


30/31 Bedroht: Äsche
32/33 EUSchutzgebiet
34 /35 INTERNATIONALES
URL AUB & FREIZEIT
36 BUNDReisen 2025
37 Umweltbildung
38 Reise Litauen
39 Wanderung Steinachtal
BN AKTIV + NAH
40 Neue Serie: BNGrundstücke
41 Editorial des Vorstands
42–46 Meldungen
48 Porträt
49 Aus dem Bundesverband
50 Jubiläen
51-57 Regionalseiten
58 /59 Junge Seite
SERVICE
60 Ratgeber
61 Leserbriefe
Die Natur+Umwelt ist das Mitgliedermagazin des BUND Naturschutz und die bayerische Ausgabe des BUNDmagazins.
62/63 Medien und Reisen
66 Ihre Ansprechpartner*innen/ Impressum


zu einem ganz kleinen Bällchen hat sich die putzige Haselmaus auf unserem Titelfoto zusammengerollt, um Winterschlaf zu halten. Für Tiere stellt der Winter eine enorme Herausforderung dar: Je kälter es draußen wird, desto mehr müssen sie auf ihre Energiereserven achten. Im Schwerpunkt dieser Ausgabe erfahren Sie, wie sich Säugetiere und Vögel, Amphibien und Insekten über die kommenden Monate retten und wie wir Menschen ihnen helfen können.
Die Klimakrise mit steigenden Temperaturen bringt unsere heimischen Wildtiere in Gefahr, denn an sehr milden Winter tagen wachen sie auf, verbrauchen dabei Energiereserven und finden dann aber keine Nahrung. Dies ist nur einer von vielen Gründen, warum es gilt, beherzt gegen eine weitere Erderhitzung vorzugehen. Doch statt die Energiewende voranzubringen, lässt die Bayerische Staatsregierung neue Gasbohrungen in Südbayern zu, obwohl das Wir tschaftsministerium sehr wohl eine Handhabe dagegen hätte. Lesen Sie dazu den Bericht auf Seite 9 und unterzeichnen Sie am besten gleich unsere Petition.
Luise Frank Redaktion Natur+Umwelt
Severin Zillich Redaktion BUNDmagazin

In jedem Herbst weist der BUND auf die Bedeutung unserer heimischen Alleen hin. Zum Tag der Allee am 20. Oktober kürte eine Jury aus 222 eingesendeten Bildern die »Allee des Jahres 2024«. Jürgen Guhlke hat sie fotografiert – eine belebte Platanenallee im Archäologischen Park von Xanten am Niederrhein. Gefragt waren diesmal besonders Alleen in Städten und Dörfern, wie die prächtige Lindenallee an der Störtebekerstraße im


Zentrum von Wilhelmshaven. Mit ihr kam Katharina Dietrich auf den zweiten Platz. Den dritten Platz erreichte Lydia Hübenthal für das stimmungsvolle SchwarzWeißBild einer Kastanienallee zwischen Klein und Groß Flotow nahe dem MüritzNationalpark.
www.allee-des-jahres.de

… Vögel etwa kommen allein in Deutschland jedes Jahr an Glasscheiben zu Tode. Daran konnten die vielfach aufgeklebten Greifvogel-Silhouetten nie etwas ändern. Wirksam Abhilfe zu schaffen war bislang sehr aufwendig, speziell an großflächig verglasten Gebäuden. Nun gibt ein neues Produkt Hoffnung. Die silbernen Vogel
schutzPunkte der Schweizer Firma SEEN AG haben sich in Tests als hochwirksam erwiesen. Weltweit wurden damit schon Gebäude nachgerüstet, zum Beispiel das Futurium in Berlin. Für den Hausgebrauch bekommen Sie die Punkte unter: www. bundladen.de/vogelschutz-markierung
»Only bad news is good news«
heißt es, vor allem schlechte Nachrichten erregen also unsere Aufmerksamkeit.
Doch positive Neuigkeiten aus dem Naturund Umweltschutz tun einfach gut. Einige aus jüngster Zeit haben wir wie immer für Sie ausgewählt.
Mit Friedensnobelpreis gewürdigt:
Die japanische Organisation Nihon Hidankyo ist für ihren Kampf gegen Atomwaffen mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden. Sie wurde von Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki gegründet. Für die nukleare Abrüstung setzt sie sich u. a. im internationalen Bündnis ICAN ein (Friedensnobelpreis 2017), dem auch der BUND angehört. Wir gratulieren unserem Partner zu der hohen Auszeichnung – und freuen uns, dass kürzlich weitere Staaten dem Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinen Nationen beigetreten sind.
Aufwind für den Luchs: Im Rahmen des Projektes »Luchs Thüringen –Europas Luchse vernetzen« hat der BUND Ende August zwei weitere Luchse im Thüringer Wald ausgewildert. Vreni und Kilian folgen den Spuren von Frieda und Viorel, die hier im Mai angesiedelt wurden. Im südlichen Thüringer Wald lieferte eine Wildkamera zudem ganz überraschend Bilder einer Luchsin mit mindestens zwei Jungtieren: der erste Beweis von wildem Nachwuchs im Thüringer Wald seit über 150 Jahren! Zusammen mit ihren ausgewilderten Artgenossen legen diese Luchse den Grundstein für ein hoffentlich bald stabiles Vorkommen in der Mitte Deutschlands.
Ölförderung im Regenwald beendet: Seit August wird im YasuníNationalpark kein Öl mehr gefördert. Mit beinahe 60 Prozent hatten die Ecuadorianer*innen 2023 in einer landesweiten Abstimmung für einen Stopp der Erdölförderung in dem Schutzgebiet votiert. Die staatliche Ölgesellschaft bekam ein Jahr Zeit, um all ihre Bohrlöcher zu schließen und ihre Infrastruktur zu entfernen. Die Umsetzung des Referendums ist ein toller Erfolg für die indigene Bevölkerung und viele UmweltAktive im Land. Der 10 000 Quadratkilometer große Yasuní-Nationalpark liegt im AmazonasRegenwald und gehört zu den Lebensräumen mit der weltweit höchsten biologischen Vielfalt.
Tausende Setzlinge gepflanzt: Bis zum Jahresende wird der BUND im Rahmen seines Naturschutzprojekts »Wildkatzenwälder von morgen« mehr als 20000 Setzlinge in die Erde gebracht haben. Und schon am 23. November wird das nächste Pflanzfest stattfinden, im Thüringer Landkreis SchmalkaldenMeiningen. Auch hier hat das Fichtensterben kahle Flächen ohne Deckung hinterlassen. Gemeinsam mit der Stadt Wasungen und vielen Freiwilligen werden wir Laubbäume und Büsche anpflanzen, um der Wildkatze und anderen Waldtieren neuen Lebensraum zu schaffen. Mehr dazu unter: www.bund.net/wildkatzenwaelder
Flächenfraß verhindert: Im Nordwesten Sachsens hat eine Bürgerinitiative mit BUNDUnterstützung vorerst den Bau eines riesigen Industriegebiets gestoppt. 400 Hektar bester Ackerböden (Bodenwert 80 bis 100!) wären verloren gegangen. Am 1. September stimmten satte 65,2 Prozent der Wähler*innen der betroffenen Gemeinde Wiedemar gegen den Bebauungsplan. Die BUNDOrtsgruppe Delitzscher Land hatte sich intensiv für die Erhaltung des wertvollen Ackerlandes engagiert – mit Erfolg. Jetzt muss der Gemeinderat den Bürgerentscheid rechtsverbindlich umsetzen.
KOMMENTAR
OLAF BANDT ist der Vorsitzende des BUND.

Im September wurden drei ostdeutsche Landtage neu gewählt –mit, wenn auch nicht überraschenden, so doch erschütternden Ergebnissen für den Umwelt- und Naturschutz und unsere Demokratie. Wie können wir hier gegensteuern?
Wählerbefragungen zeigen: Die Zustimmung für wichtige Maßnahmen zum Schutz des Klimas sinkt. So wird der nötige Umbau der Heizungen hin zu erneuerbaren Energieträgern vielfach als teuer und kompliziert wahrgenommen. Gleiches gilt für den baldigen Abschied von Benzin und Diesel mit der Absicht, Neuwagen nur noch mit grünem Strom anzutreiben. Die Folge: Nicht wenige Menschen kaufen weiterhin (oder wieder) Gasheizungen und Autos mit Verbrennungsmotor. Und sie wählen Parteien, die ihnen – einfach gesagt – versprechen, dass alles so bleiben kann, wie es ist.
Das ist nicht nur eine Herausforderung für problembewusste Politiker*innen oder uns Umweltverbände, die wir für den Klimaund Naturschutz trommeln. Sondern auch dafür, dass wir die so notwendigen Klimaziele insgesamt erreichen. Was folgt daraus? Zum ersten sollten wir erkennen, dass allein der wissenschaftlich begründete Verweis darauf, dass wir unsere Klimaziele schaffen müssen, nicht mehr genügt. Genauso, wie wir über Jahrzehnte für die Nutzung der Wind und Sonnenenergie geworben haben, sollten wir das nun auch tun mit Blick auf Wärmepumpen, Elektroautos oder den sowieso schon elektrifizierten öffentlichen Nahverkehr.
Das betrifft den BUND als großen Umweltverband, und mitunter auch uns ganz persönlich. Dazu kann ich Ihnen zwei ermutigende Momente schildern. Im Jahr 2000 ist der BUND von Bonn nach Berlin gezogen. Als Familie haben wir damals ein Holzhaus mit Wärmepumpe gebaut. Die Schwarzmalerei der »Bild«Zeitung
gab es damals noch nicht. Mir war nur klar, dass die Wärmepumpe die Zukunft der Heizung sein würde. Wie sinnvoll und dauerhaft kostengünstig diese frühe Anschaffung war, hat sich seitdem immer wieder bestätigt. Kein Wunder, Wärmepumpen funktionieren wie Abermillionen von Kühlschränken. Auch die werden nicht mehr mit Gas betrieben oder gar »technologieoffen« mit nicht vorhandenen synthetischen Kraftstoffen.
Der zweite ermutigende Moment passierte in diesem Sommer. Für die wenigen Male, die wir als Familie ein Auto brauchen, sollte es endlich ein Modell sein, das mit Strom aus Wind und Sonnenenergie fährt. Am Anfang schien das kaum bezahlbar. Dann habe ich meine Nachbar*innen gefragt, ob wir das EAuto nicht gemeinsam kaufen und nutzen wollen. Innerhalb von vier Wochen war der Kaufpreis beisammen. Ich war baff und froh, mich überwunden zu haben, andere Menschen um ihr Geld zu fragen, für eine (wenn auch gemeinsame) Anschaffung.
Warum schreibe ich Ihnen das? Ich bin sicher, wir müssen in Deutschland wieder mehr Geschichten des Gelingens erzählen. Nicht zuletzt hier in der Natur+Umwelt. Vielleicht möchten auch Sie, liebe Leser*innen, einmal mitteilen, was Ihnen gelungen ist im Hinblick auf eine zukunftsgerichtete Entwicklung? Je öfter wir alle das tun, desto eher werden wir dem fossilen Pessimismus die Grundlage entziehen – in den vier Wänden, am Steuer und hoffentlich schon bald an den Wahlurnen.
Was ist Ihre Geschichte? Schreiben Sie mir gern.

Das Schwenninger Moos ist seit 1939 Naturschutzgebiet. Dennoch wäre es heute längst bewaldet und weitgehend trockengefallen –zu stark hatte der Mensch es bereits genutzt und entwässert. Der BUND-Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg kümmert sich seit Jahrzehnten darum, den Lebensraum des seltenen Hochmoor-Glanzflachläufers (Foto)
zu renaturieren. Ehrenamtlich Aktive verschließen Gräben und entfernen Baumschösslinge, um das Moor wiederzuvernässen. Besonders Schulklassen und Kindergruppen vermittelt der BUND auf vielen Führungen, wie sehr das dem Natur- und Klimaschutz zugutekommt.


Die Flughafen München Gesellschaft (FMG) hat beim Luftamt Südbayern einen sogenannten feststellenden Verwaltungsakt beantragt. Das wäre eine unbegrenzt geltende Genehmigung für den Bau einer dritten Start- und Landebahn. Der BN und andere kämpfen seit Jahren gegen den Bau der dritten Start und Landebahn am Münchner Flughafen. Der Planfeststellungsbeschluss dieses Projekts ist nur noch bis 2026 gültig. Sollten bis dahin keine Baumaßnahmen beginnen, verfällt dieser und mit ihm die Erlaubnis für die Umsetzung des Projekts. Des
halb hat die FMG nun eine unendliche Gültigkeit dieses Beschlusses beantragt. Der BUND Naturschutz kritisiert diese beantragte Ewigkeitsgenehmigung scharf und sieht darin den Versuch, ein in der Öffentlichkeit unpopuläres und für die Umwelt extrem schädliches Projekt im Verborgenen voranzutreiben. Aus diesem Grund fordert der BN Einsicht in die Unterlagen, die aktuell dem Luftamt Südbayern vorliegen, um eine eigene Einschätzung über die Pläne der FMG treffen zu können und auf dieser Basis mögliche rechtliche Schritte zu überprüfen.

Am 20. September gingen in ganz Deutschland wieder Menschen für eine wirksame Klimaschutzpolitik auf die Straße. Auch BN-Aktive waren dabei. Immer mehr Extremwetterereignisse und gleichzeitig immer laschere Klimaschutzgesetze – das bereitet vielen Menschen Sorge. Dem Aufruf zum Klimastreik schlossen sich deshalb auch BUNDGruppen in ganz Deutschland und forderten:

»Klima retten!« Die größte Demo fand in München auf dem Königsplatz statt, wo BNLandesbeauftragter Martin Geilhufe als Redner die Bayerische Staatsregierung und vor allem Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger eindringlich aufforderte, neue Gasbohrungen in Bayern zu verhindern (siehe nächste Seite) und statt dessen endlich die Energiewende voranzubringen.
Die EU hat beschlossen, den Schutzstatus des Wolfs herabzustufen. Grund hierfür waren wachsende Bedenken bezüglich des Herdenschutzes von Weidetieren. Die entscheidenden Stimmen kamen unter anderem aus Deutschland. Von nun an gilt der Wolf nicht mehr als »streng geschützt«, sondern nur noch als »geschützt«. Der BUND Naturschutz sieht dadurch aber keine Möglichkeit zur Bejagung des Wolfes in Bayern. Zwar ermöglicht diese Änderung den Abschuss von

Wölfen, die noch nie ein Weidetier gerissen haben. Doch Voraussetzung dafür ist ein »günstiger Erhaltungszustand« der Art. Das ist in Bayern nicht der Fall. Der BNWolfsexperte Uwe Friedel betont: »Die Staatsregierung sollte den Weidetierhaltern jetzt keine falschen Hoffnungen machen – nach wie vor ist Herdenschutz das einzige Mittel, um die Weidetiere vor Wolfsübergriffen präventiv zu schützen! Bejagung ohne Herdenschutz führt zu hohen Risszahlen, wie Beobachtungen aus anderen Ländern wie beispielsweise Norwegen zeigen.«
AKTIV AUF FACEBOOK
Lust auf Dialog? Der BUND Naturschutz tauscht sich auf Facebook täglich mit seiner Community über Natur und Umwelt in Bayern aus. Schließen Sie sich an!
Werden Sie BN-Freund*in www.facebook.com/ bundnaturschutz
Trotz heftigem Dauerregen kamen im September über 100 Menschen aus der Region zu einem Protest gegen die Gasbohrung am Ammersee zusammen.

WEG VON FOSSILEN ENERGIEN!
Bayern hat sich gesetzlich verpflichtet, bis 2040 klimaneutral zu werden. Doch statt auf dieses Ziel hinzuarbeiten, plant die Staatsregierung Gasbohrungen in Südbayern – neben einem Vogelschutzgebiet!
Kaum zu glauben, aber leider wahr: Während wir miterleben, wie die Klimakrise für immer mehr Extremwettereignisse sorgt, laufen in Bayern Planungen für die Neuerschließung fossiler Rohstoffe! Der BUND Naturschutz, Greenpeace und weitere Organisationen lehnen das entschieden ab und sagen: »Koa Gas!« Geplant ist konkret eine Bohrung südöstlich von Reichling in der Nähe des Ammersees im Landkreis Landsberg am Lech. In 3000 Meter Tiefe soll dort künftig eine Gasmenge von 300 bis 500 Millionen Kubikmeter Gas gefördert werden, was etwa 0,5 Prozent des jährlichen Energiebedarfs in Deutschland entspricht. Verdienen will
daran die Firma Genexco Gas, unter anderem mit Kapital des kanadischen Investors MCF. Geplant ist, das geförderte Gas an regionale Energieanbieter zu verkaufen. Das wird dazu führen, dass die bayerischen Anbieter weiterhin auf fossiles
Gas setzen, statt auf Erneuerbare Energien umzustellen. So wird die Energiewende auf Jahre hinaus blockiert!
Die Investoren und die Bayerische Staatsregierung rechtfertigen die Pläne mit der Behauptung, »heimisches« Gas wäre besser als per Schiff angeliefertes LNG. Richtig ist, dass LNG hohe MethanEmmissionen verursacht. Dennoch ist in Bayern gefördertes Erdgas nicht die Lö
sung, denn »sauberes« Gas gibt es nicht. Neue Projekte verlängern die Nutzung dieses Energieträgers, von dem wir uns schleunigst verabschieden müssen. Zudem wird dieses Gas LNG nicht verdrängen, sondern zusätzlich genutzt werden. Eine Brücke ins Klimachaos also.
Auch für Mensch und Natur vor Ort ist das Vorhaben eine Bedrohung: In direkter Nachbarschaft der Bohrstelle liegt ein Trinkwasserschutzgebiet. Sowohl bei der Bohrung als auch bei der Handhabung von Chemikalien und Treibstoffen kann hier bei einem Unfall das Trinkwasser verunreinigt werden. Seltsam ist in diesem Zusammenhang, dass auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet wurde. Gleichzeitig ist aber ein TrinkwasserNotfallkonzept vorgesehen.
Zudem liegt die geplante Bohrung nah an zwei Schutzgebieten: ein FloraFaunaHabitat(FFH)Gebiet und das Europäische Vogelschutzgebiet »Mittleres Lechtal«. Viele geschützte Arten wie Uhu, Gelbbauchunke oder Kammmolch finden hier ein Zuhause – noch! Doch Lärm und Abgase der Baustelle belasten das Biotop, und bei einem Unfall könnten giftige Stoffe ins Wasser geraten und Flora und Fauna gefährden.
Aktuell ist eine Probebohrung genehmigt (ohne Umweltverträglichkeitsprüfung!), eine Förderung von Erdgas aber noch nicht. Der Reichlinger Gemeinderat und der Landrat haben sich gegen die Gasförderpläne ausgesprochen, doch die Firma Genexco hat bereits weitere Bohrungen in Planung. Dabei könnte das bayerische Wirtschaftsministerium, anders als von Minister Hubert Aiwanger behauptet, künftige Erdgasförderungen in Bayern verbieten. Dies belegt ein von BN und Greenpeace in Auftrag gegebenes Gutachten.
Julika Schreiber, Kasimir Buhr (lf)
Unsere Petition Unterzeichnen auch Sie die Petition gegen eine Gasbohrung in Bayern! www.bund-naturschutz.de/kein-gas

Mit CCS soll die Wirtschaft fossil bleiben.
Der BUND warnt vor einem gefährlichen Kurswechsel in der Klimapolitik.

KERSTIN MEYER
ist die BUNDExpertin für Wir tschaft und Finanzen.
CCS, das steht für »Carbon Capture and Storage«: Um weiter fossile Brennstoffe vertreiben zu können, drängt die Öl- und Gasindustrie darauf, das entstehende Kohlendioxid einzufangen (Capture) und unterirdisch zu deponieren (Storage). Per Gesetzesänderung will die Bundesregierung ihr dafür den Weg ebnen – und das Aus für fossile Energien verhindern. »Schon die Erkundung möglicher Lagerstätten mit Schallkanonen ist eine enorme Belastung für die Meerestiere.« Ein Naturschützer hat das Wort ergriffen, bei einer öffentlichen Diskussion zu CCS in Berlin. Unterstützung kommt vom ehemaligen Mitarbeiter einer Naturschutzbehörde:
»In dieser Dimension haben wir das in der Nordsee noch nie erlaubt.« Tatsächlich droht eine heftige Industrialisierung der Meere, wenn das Geschäft mit den CO2Deponien anläuft. Und potenziell soll die Gasindustrie das CO2 auch an Land in den Boden pressen dürfen.
Vor 15 Jahren, als die Energiekonzerne ihre Kohlekraftwerke weißwaschen wollten, konnten Proteste derartige Deponien noch verhindern. »Wir haben damals um den Schutz unserer Lebensgrundlagen gekämpft«, so die Vertreterin einer Bürgerinitiative aus SchleswigHolstein, »diese Deponien könnten das Grundwasser verschmutzen.« Nun sammelt sie wieder Unterschriften gegen CCS, das nicht nur an der Küste zum neuerlichen Politikum geworden ist. Dort klärte der BUND im
Kieler Landtag über falsche Versprechen und drohende Schäden auf.
Diesmal aber sind weit mehr Menschen betroffen. Auf einer Deutschlandkarte sind 5000 Kilometer lange CO2Leitungen skizziert. Gaskraftwerke und Fabriken allerorts sollen sich anschließen. Fatal wäre das nicht nur für die Energiewende. Mit CCS hofft auch die Chemieindustrie fossil zu bleiben. Damit droht zum Beispiel der Weg zur Kreislaufwirtschaft blockiert und die Plastikflut noch verstärkt zu werden.
Das Versprechen, mit CCS das Klima zu schützen, ist hohl. Bislang werden nur fünf Tausendstel des weltweiten CO2Ausstoßes unterirdisch verklappt. Seit Jahrzehnten erweisen sich CCSVorhaben als leistungsschwach, werden mehrheitlich abgesagt oder immer wieder verschoben. Das Märchen von CCS gleicht einer Fata Morgana, die ablenkt und in die Irre führt. Milliardenschwere Subventionen sind der Öl und Gasindustrie dennoch sicher. Geld, das für echte Lösungen fehlt.
Auch in Mainz hat der BUND kürzlich vor der neuen CCSPolitik gewarnt, beim Klimastreik im September. Denn vor Ort schlägt jede CCSAnlage mit viel Flächen, Energie und Wasserverbrauch zu Buche. Zudem kommen auf die Kommunen hohe Planungskosten für die CO2Leitungen zu. Es gibt sogar Pläne, dass die öffentliche Hand (also wir alle) das Investitionsrisiko tragen soll. Die Ewigkeitskosten für CO2Endlager sind, ähnlich wie beim Atommüll, überhaupt nicht abzusehen.
Für Umweltverbände wird es schwer, vor Ort Einspruch zu erheben. Denn das geplante Gesetz behauptet ein öffentliches Interesse für die CO2Leitungen. So sollen Enteignungen erleichter t werden.
Noch können Bundestag und Bundesrat verhindern, dass der Irrweg zum Gesetz wird. Der BUND ruft in einem Bündnis von Bürgerinitiativen und Umweltverbänden zum Widerspruch auf.
















Mal wieder steht der Winter vor der Tür. Tag für Tag wird das Wetter unbehaglicher. Wohl dem, der jetzt ein warmes Zuhause hat. Nur wenige Arten von Wildtieren leisten uns daheim Gesellschaft: neben unzähligen Milben meist ein Haufen größerer Spinnen, dazu wohl einige Tag- und Nachtfalter oder Marienkäfer im Keller, eine Wespenkönigin oder ein Siebenschläfer unterm Dach … Die weitaus meisten Tiere aber müssen den Winter im Freien überdauern.
Wie schaffen die das eigentlich, ohne Heizung und dicke Jacke, Mütze, Schal? Damit Tiere wie die Graugänse im Bild die kalte Jahreszeit überleben, hat die Natur verschiedenste Strategien ersonnen. Lesen Sie auf den nächsten Seiten über Winterflüchter und Winterschläfer. Lesen Sie, welche Gefahren den Tieren von uns drohen und wie wir Tiere kurzoder längerfristig unterstützen können.




Unsere Wildtiere haben unterschiedlichste Strategien entwickelt,
um die kalte Jahreszeit bei oft karger Kost zu überstehen.
Sein Name trügt: Strenge Winter mit großflächig vereisten Gewässern überleben nur wenige Eisvögel.

Die meisten Tiere drosseln ihren Bedarf an Energie, indem sie Winterschlaf und Winterruhe halten oder indem ihr Stoffwechsel auf ein kältestarres Minimum sinkt. Andere vermögen dem Winter in mildere Regionen auszuweichen, neben Vögeln auch manche Fledermäuse und Insekten. Wieder andere versuchen den Härten des Winters aktiv zu trotzen.
So wie der Eisvogel. Leuchtend blau glänzt sein Rücken, tief rotbraun ist die Brust gefärbt. In Deutschland ist der Eisvogel weit verbreitet – und doch in manchen Jahren ausgesprochen rar. Während langer Frostwinter verhungern oft über 90 Prozent dieser Fischfresser, da ihr Gefieder vereist und die Gewässer zufrieren. Nur weil die Überlebenden in den Folgejahren bis zu drei Bruten mit fünf und mehr Jungen hochbringen, sind solche Einbrüche im Bestand bald wieder wettgemacht.
Viele Vögel suchen jedoch das Weite, lange bevor der Winter beginnt. Sie ziehen im Spätsommer und Herbst nach Westund Südeuropa. Oder noch deutlich weiter, wie der Kuckuck ins südliche Afrika, der Zwergschnäpper nach Indien oder die Küstenseeschwalbe bis an den Rand der Antarktis. Dem deutschen Winter sind sie damit entkommen. Doch zahlen sie hierfür einen hohen Preis. Der Vogelzug ist strapaziös und voller Gefahren. Manche Zugvögel werden mit der Klimaerwärmung zu Teilziehern. Arten wie Rotmilan, Kiebitz, Star oder Mönchsgrasmücke versuchen vermehrt bei uns zu überwintern.
Neben den Vögeln wandern auch einige Fledermäuse im Herbst nach Süden und Westen. So fliegen der Große und Kleine Abendsegler oder die Rauhautfledermaus mitunter über tausend Kilometer bis in ihr Winterquartier. Die insektenarme Jahreshälfte verschlafen sie aber wie andere Fledermausarten in frostfreien Höhlen und Gewölben.
AUCH INSEKTEN ZIEHEN
Feuerwanzen wärmen sich an einem lauen Wintertag in der Sonne.
Wer im Frühling schon mal einen arg zerfledderten Distelfalter bemerkt hat, weiß: Auch manche Insekten kommen weit herum. In welchem Ausmaß dieser Wanderfalter im Herbst dem Winter entflieht, zeigte vor einigen Jahren eine Stichprobe am Ärmelkanal: 26 Millionen Distelfalter überquerten den Meeresarm im Herbst 2009 gen Süden.








Unzählige Insekten tun es ihm Jahr für Jahr gleich. Beobachten lässt sich das eher selten , etwa am nur 30 Meter breiten Pyrenäenpass Puerto de Bujaruelo. Ihn überfliegen jeden Herbst ca. 17 Millionen Insekten – zu 90 Prozent Schweb, Grasund andere Fliegen. Zur selben Zeit dürften auch Deutschland Unmengen geflügelter Insekten verlassen. Zurück bleiben ihre winterfesten Eier und Larven. Und solche Arten, die ausgewachsen überdauern.
ENERGIE SPAREN
Wie aber behelfen sich die Dagebliebenen? Ein Gebot gilt für fast alle Überwinterer, egal, ob und wie gut sie während dieser kurzen kalten Tage an Nahrung kommen: Energie sparen! Und vorher möglichst noch viel fressen.
Um nicht unnötig Energie zu vergeuden, hat die Natur einige radikale Strategien erdacht. So fallen viele Tiere, die ihre Körpertemperatur nicht selbst regeln können, in eine Kältestarre. Zu diesen »wechselwarmen« Tiergruppen zählen Insekten wie Ameisen und Wildbienen, aber auch Schnecken, Reptilien und Amphibien. Ihr Stoffwechsel fährt im Winter auf ein absolutes Minimum hinunter. Atmung und Herzschlag sind dann stark verlangsamt oder ganz gestoppt. Eine Art Frostschutzmittel bewahrt ihre Körperflüssigkeit davor,
Wasser wärmer als an der Oberfläche. Fische im Fluss verringern ihre Aktivität ebenfalls und ziehen sich in Bereiche mit wenig Strömung zurück.
Doch wer starr und unbeweglich wird, ist seinen Fressfeinden hilflos ausgeliefert. Ganz wichtig ist also ein gutes Versteck: in Erdhöhlen unter Wurzeln und Steinen, im Holz, im Laub oder in Pflanzenstängeln, in Kellern, Dachstühlen oder Mauerritzen. Besonders geschützt sind Molche und
Der Hermelin wechselt mit dem Fell sogar die Farbe, um im weißen Winterkleid besser getarnt zu sein. Dafür sollte allerdings Schnee liegen …




Ein sicheres Versteck ist das A und O auch für jene Säugetiere, die Winterschlaf halten. Igel, Gartenschläfer, Feldhamster, Murmeltiere oder Fledermäuse senken ihre Lebensfunktionen auf das Nötigste. Sie fressen nichts, atmen kaum und fahren ihren Herzschlag herunter, der Igel etwa von 200 auf fünf Mal pro Minute. In dieser Zeit – sie dauert beim Siebenschläfer bis zu acht Monate – zehren sie von ihrer Fettschicht. Nur selten sind sie kurz wach, um sich umzulegen oder zu erleichtern.
Häufigere Wachphasen durchleben Säugetiere in der Winterruhe. Eichhörnchen, Dachse oder Waschbären werden munter, wenn der Hunger nagt. Sie gehen an ihre Vorräte oder suchen Nahrung, danach schlafen sie weiter. Ihr Stoffwechsel läuft nicht ganz so auf Sparflamme. Eine isolierende Speckschicht und ein dichtes Fell helfen auch ihnen zu überleben.


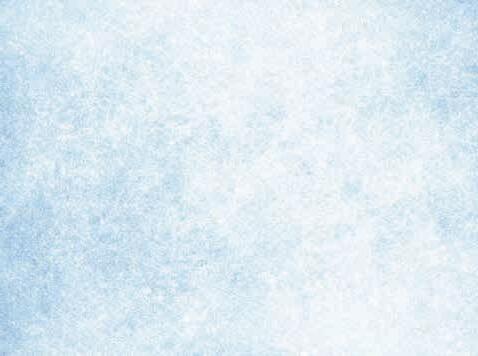
Säugetiere, die ganzjährig aktiv und draußen unterwegs sind, legen sich meist ein dickes Winterfell zu. Doch bei Kälte sind auch sie im Sparmodus, ob Reh und Hirsch, Fuchs und Wolf, Luchs und Wildkatze oder Biber und Fischotter. Sie verhalten sich ruhiger als sonst und bewegen sich nur, wenn es wirklich nötig ist – etwa zur Paarungszeit, die bei vielen Säugern schon im (Spät)Winter beginnt.
Mäuse bleiben im Winter ebenfalls aktiv. Damit sichern sie nicht nur Fuchs, Wiesel oder Wildkatze das Überleben, sondern auch Greifvögeln, Eulen und Reihern. Nur bei wochenlang geschlossener oder gar überfrorener Schneedecke steigt die Sterblichkeit dieser Mäusejäger.
Überhaupt sind die meisten Wintervögel besser gegen Frost gewappnet als

der aus den Tropen stammende Eisvogel. Ein aufgeplustertes Gefieder schützt wirksam vor Kälte. Sehr kleine Vögel, die mehr Wärme verlieren als große, übernachten gern geschützt in Höhlen und Nistkästen. Zaunkönig und Baumläufer wärmen sich sogar in Schlafgemeinschaften.
Um Energie zu sparen, wandern einige Vögel zudem in die Siedlungen. Hier ist es milder und oft nahrungsreicher. Allerdings lauern in der Nähe des Menschen neue Gefahren. Wirklich sicher sind Tiere im Winter eben kaum irgendwo. Mehr dazu auf der nächsten Seite.
sz



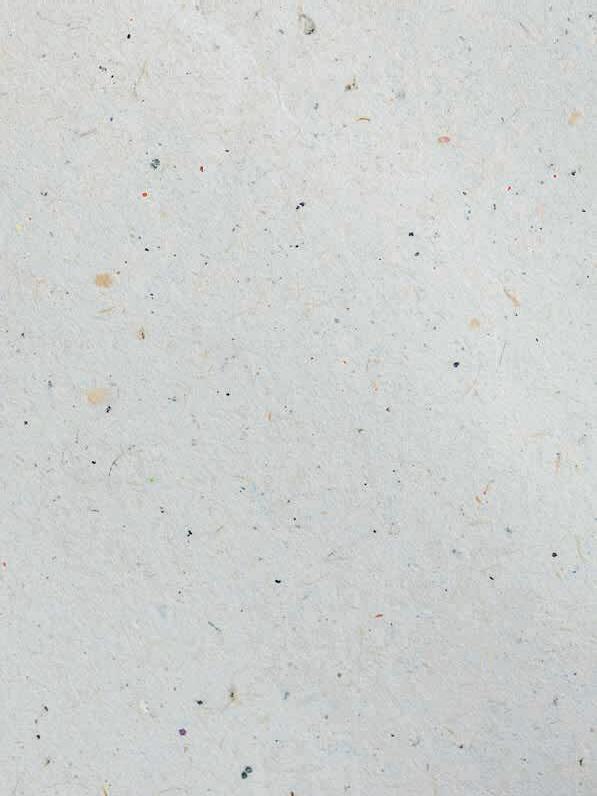


Einmal abgesehen von zentralen Stellschrauben wie der Agrarpolitik: Was können wir persönlich tun oder unterlassen, damit Tiere gut über den Winter kommen? Auskunft gibt der Biologe Tobias Windmaißer, tätig im Bayerischen Wald für das BUND-Kompetenzzentrum Grünes Band.
Winterhilfe für Tiere? Da denken viele wohl zuerst daran, Vögel zu füttern. Wie sinnvoll ist das?
Nur in Maßen. Wildvögel sind ja auf ein jahreszeitlich wechselndes Nahrungsangebot eingestellt. Und ihr Energiebedarf ist im Winter sowieso reduziert – wenn man sie in Ruhe lässt. Auch besucht nur etwa ein Dutzend verbreiteter Vogelarten die Futterstellen. Die aber kann man bei Schnee und Eis schon unterstützen.
Am besten füttert man moderat und mit Futterspendern und silos, die den Inhalt vor Schmutz und Nässe schützen. Auch sollten Katzen ringsum keine Deckung finden, um sich anzuschleichen. Ein schöner Nebeneffekt ist, dass so ein Futterplatz tolle Einblicke in die wunderbare
werte erreicht. Das erschwert die Waldverjüngung und den so wichtigen Umbau von Fichten und Kiefernplantagen in naturnahe Mischwälder stark. Um dem nicht noch Vorschub zu leisten, fordert der BUND die Fütterung grundsätzlich einzustellen.
Gut gemeint kann also auch schaden. Wo können wir wirklich helfen?
Damit Wildtiere mit ihren Reserven zurechtkommen, sollten sie im Winter so wenig wie möglich gestresst werden. Bleibt man auf den Wegen – nicht zuletzt beim boomenden OutdoorSport –, haben Tiere meistens genug Rückzugsorte und kommen auch mit menschlichen Aktivitäten gut klar. Sorgen wir dann noch dafür,



Kann, wer die Tiere unterstützen will, bestimmte BUND-Projekte fördern?
Ja, zum Beispiel unser Projekt »Quervernetzung Grünes Band«. Es dient dazu, dass Wildtiere ganzjährig leichter hin und herwandern können, rund um die ehemals innerdeutsche Grenze. Letztlich leistet aber jedes unserer Naturschutzprojekte seinen Beitrag.
Wo wir gezielt etwas für den Feuersalamander tun, schützen wir damit auch Überwinterungsorte für viele Amphibien. Wo wir ungestörte Nahrungshabitate für die Wildkatze schaffen, profitieren Kleinsäuger, Reptilien oder Vögel. Und wo wir Arten wie der Waldbirkenmaus oder der Kreuzotter besonders vielfältige Lebensräume sichern, mit einem Mosaik von

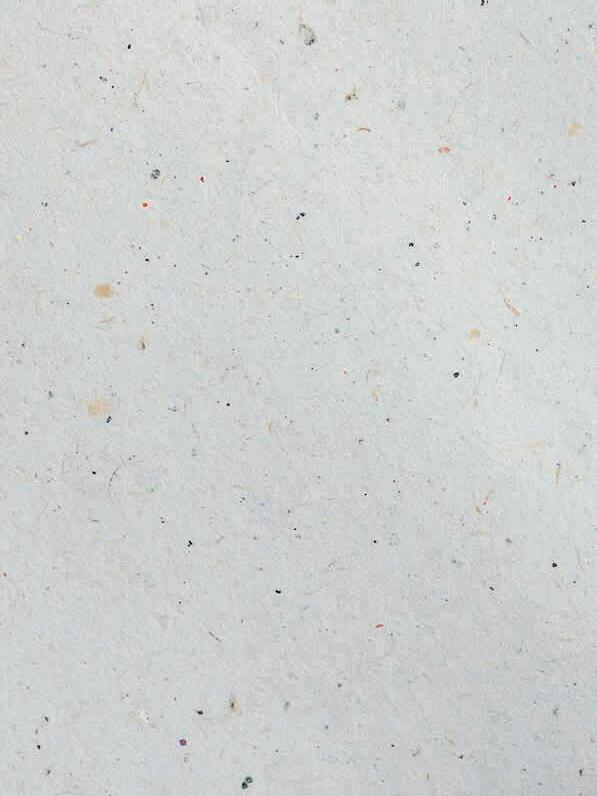

Untersuchungen ergaben: Wenig beunruhigt Wasservögel schon auf große Distanz mehr als das StandupPaddeln.
In den Wintermonaten sind wild lebende Tiere verletzlicher als sonst im Jahr. Womit machen wir Menschen ihnen das Leben schwer?
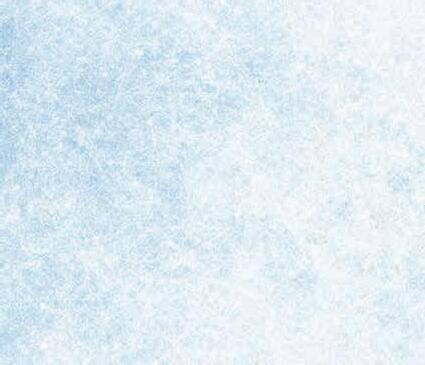
WAS ALLES STÖRT
Einst drohten Wildtieren ausschließlich natürliche Gefahren. Neben den schon immer lauernden Fressfeinden forderten früh einsetzende oder lang anhaltende Frostwinter genauso ihre Opfer wie wechselhaftes Wetter mit unerwarteten Tauphasen oder Überschwemmungen.
Seit dem Erscheinen des Menschen sind Tiere mit neuen Gefahren konfrontiert. Doch profitieren sie nicht auch von uns, etwa weil die Winter menschengemacht immer milder werden?
Keine Frage, ein Winter ohne vereiste Gewässer und wochenlang gefrorene Böden bietet aktiven Tieren mehr Nahrung und schont ihre Energiereserven. Gleichzeitig werden damit mehr Tiere zur Beute, die unter einer Eisschicht oder Schneedecke gut geschützt waren. Auch sonst fordern Warmphasen mitten im Winter einigen Arten viel ab.
TRÜGERISCH WARM
Speziell für Winterschläfer bergen außerordentlich milde Tage ein Risiko. Häufiger
unterbrechen sie dann ihren Schlaf. Das kostet viel Energie, weshalb sie sterben können, bevor sich der Winter wirklich verabschiedet hat.
Problematisch wird es auch, wenn die Erderhitzung über Wochen so durchschlägt wie im vergangenen Februar. Der war im Schnitt mehr als sechs Grad wärmer als im Vergleichszeitraum 1961–1990, ein bisher beispielloses Phänomen. Verlassen Molche und Frösche, Eidechsen und Schlangen oder Insekten dann vorzeitig ihre Verstecke, kann ein abermaliger Wintereinbruch ihren Tod bedeuten. Unter den Vögeln überleben in milden Wintern zwar viele Dagebliebene. Doch gibt es auch hier Leidtragende. Während mehr Meisen oder Stare als sonst früh die besten Brutreviere und Nisthöhlen belegen, haben gefährdete Arten wie der Trauerund Halsbandschnäpper das Nachsehen. Denn die überwintern südlich der Sahara, bleiben in ihrem Rhythmus und geraten bei ihrer Rückkehr im April zunehmend in Wohnungsnot.
Doch zurück in den Winter. Die Tiere leben dann auf Sparflamme. Jede Störung schmälert ihre Aussichten, die kalte Zeit zu überstehen. Und das unabhängig davon, ob sie in einem Versteck ruhen und schlafen oder – gebremst – aktiv bleiben. Wovon gehen diese Störungen aus? Oft ohne Absicht von uns Menschen, die wir gern draußen unterwegs sind. Vor allem, wenn wir abseits der Wege laufen. Wenn wir Hunde von der Leine lassen. Wenn wir uns laut und rasch durch die Landschaft bewegen. Oder wenn wir in bisher ruhige Bereiche vordringen. Daran haben Trendsportarten großen Anteil. Der neoprengeschützten StandupPaddlerin auf einem Voralpensee oder dem Kitesurfer an der Küste ist wohl kaum bewusst, wenn ihretwegen Hunderte rastender Enten auffliegen. Für Stress sorgt auch, wer in den Bergen querfeldein auf Skiern oder Schneeschuhen läuft oder dank einem neuen EMountainbike seinen Radius mehr und mehr erweitert. Zumal Tiere der Hochlagen wie die bedrohten Auer, Birk und Haselhühner besonders mit ihren Kräften haushalten müssen.




So nicht: Auf Schneeschuhen querfeldein, hier am Jochberg bei Kochel
Eine krasse Störung bedeutet auch der illegale MotocrossVerkehr, der ganzjährig auf einstigen Truppenübungsplätzen und sonstigen Wildnisarealen tobt. Im Winter geht der wilde Ritt über Stock und Stein vielen Tieren an die Substanz. Apropos Lärm, und auf die Gefahr, als Spaßbremse zu gelten: Kaum irgendwo wird derart brachial und ungehemmt ins neue Jahr gewechselt wie in Deutschland. Nicht nur für Haustiere ist die Silvesternacht die schlimmste des Jahres. Auch Millionen wilde Vögel und Säugetiere erleben die ausgedehnte, in Ballungsräumen schier unausweichliche Böllerei als echten Alptraum. Und das mitten im Winter.
SATT UND SICHER?
Damit Tiere im Winter über ausreichend Reserven verfügen und etwaige Störungen überleben, müssen sie genug gefressen haben. Weite Teile unseres naturfernen Landes bieten allerdings nicht mehr viel Nahrung, Stichwort Insektensterben.
lebenswichtige Nahrungsquellen. Auch Nischen fehlen dann, um sich im Winter zurückzuziehen.
Zum Mangel an Nahrung tritt also der Mangel an Rückzugsorten und Verstecken. Sei es, weil im Wald nur noch wenige Bäume alt werden und verrotten dürfen. Weil es im Offenland an Brachen, Hecken und anderen Strukturen fehlt. Oder weil
schläfer« (siehe Seite 25) gezeigt: Während des langen Winterschlafs zehren die Kleinsäuger – wie viele andere Tiere –von ihrem Fettdepot. Sind darin zu viele Pestizide eingelagert, vergiften sie sich schleichend. Und wachen im Frühling einfach nicht mehr auf.
Auch heimische Seeadler, die in den Wintermonaten vielfach von Aas leben,













Was muss ich für eine Balkonsolaranlage tun?










Wer ist für den Amphibienschutz an Straßen zuständig?

























































































Was blüht denn da?











Sie haben Fragen zu den Themen Artenschutz, Naturschutz, Erneuerbare Energien, Energie sparen oder brauchen Hilfe bei der Bestimmung einer Art?

Am 18. Januar wird der BUND in Berlin wieder mit vielen Verbündeten auf die Straße gehen, für eine bäuerliche und ökologische Landwirtschaft. Parallel zu der Grünen Woche werden wir einmal
mehr deutlich machen: Wir haben die Agrarindustrie satt. Schließen Sie sich uns an!
Wasser wird immer knapper, oder es regnet binnen weniger Tage viel zu viel. Die Klimakrise schreitet voran, genauso das Sterben der Bauernhöfe. Pestizide und Dünger werden weiter in übergroßer Menge ausgebracht, und Abermillionen Tiere grausam schlecht gehalten.
Unter dem Motto »Wer profitiert hier eigentlich?« werden Tausende Menschen
PFAS sind eine von der Chemieindustrie vielfach genutzte Stoffgruppe mit über 10000 Kohlenstoff-Fluor-Verbindungen. Als Ewigkeitschemikalien bauen sie sich in der Umwelt nur sehr langsam ab. Tag für Tag reichern sich damit mehr PFASSubstanzen auch in unserem Körper an. Fordern Sie mit Ihrer Unterschrift den Gesundheitsminister Karl Lauterbach auf, sich für ein EU-weites Verbot der gefährlichen Stoffe einzusetzen. PFAS sind unsichtbar und überall – im Trinkwasser, in der Luft und im Boden, in
am 18. Januar in Berlin gegen globale Ungerechtigkeit, Ackerland als Spekulationsobjekt und die Spaltung unserer Gesellschaft demonstrieren – gemeinsam mit Bäuerinnen und Bauern, Stadt und Land, bio und konventionell, Veganerin und Viehwirt. Denn wir lassen uns nicht spalten. Solidarisieren auch Sie sich und kommen Sie nach Berlin!
www.bund.net/ wir-haben-es-satt

unserer Kleidung, sogar in Muttermilch. Mittlerweile werden kaum mehr Kinder ohne PFAS im Blut geboren. Ein Test des BUND hat gezeigt: Fast in jedem von uns fließen die Ewigkeitschemikalien bereits durch die Adern. Dabei bergen sie enorme Gesundheitsrisiken: Krebs, Organschäden und häufigere Fehlgeburten sind als Folge dokumentiert.
Die Bundesregierung darf dies nicht länger ignorieren. Wir fordern sie dazu auf, die Europäische Chemikalienagentur bei der geplanten Beschränkung der PFAS
zu unterstützen. Und das auch gegen den Widerstand der mächtigen deutschen Chemieindustrie.
Bitte unterschreiben Sie unsere Petition für ein Europa ohne PFAS!
www.aktion.bund.net/pfas
In einer zunehmend digitalisierten Welt können moderne Technologien helfen, unseren Planeten besser zu verstehen und zu schützen. Ein Beispiel dafür ist die neue Igel-Meldeaktion, die von Pro Igel und dem BUND Naturschutz als regionalem Partner ins Leben gerufen wurde.

Verantwortlich für BNMitmachprojekte
Wertvolle Daten über unsere stacheligen Nachtschwärmer sammeln und damit zur wissenschaftlichen Forschung beitragen – die »Igel-Challenge« macht’s möglich. Das Citizen-Science-Projekt läuft über die Plattform Observation.org und die dazugehörige App ObsIdentify. Geplant ist eine langfristige Datenerhebung, denn Entwicklungstrends von Populationen lassen sich erst erkennen, wenn Daten über einen Zeitraum von mehreren Jahren oder Jahrzehnten erhoben werden.
WAS IST DIE IGEL-CHALLENGE?
Die IgelChallenge ist eine innovative BürgerwissenschaftsInitiative, die im Rahmen eines spielerischen Wettbewerbs darauf abzielt, umfassende Informationen über die Igelpopulation in Deutschland zu

Wer einen Igel sieht, kann diesen fotografieren und melden und so der Wissenschaft
sammeln. Initiatoren der Aktion sind Pro Igel e.V. und der BUND Naturschutz. Die gesammelten Daten sollen dabei helfen, die Lebensbedingungen und Verbreitung von Igeln besser zu verstehen und gezielte Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Unter den zehn Teilnehmer*innen mit den häufigsten Beobachtungen werden Sachbücher über Igel und Bausätze für Igelhäuser verlost. Die Challenge findet zunächst von 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025 statt.
Die Teilnahme an der IgelChallenge ist einfach und unkompliziert. Alles, was man tun muss, ist die Naturmeldeplattform Observation.org und die dazugehörige App ObsIdentify zu nutzen. Hier ist eine SchrittfürSchrittAnleitung dazu: • Download der App: Laden Sie die App ObsIdentify herunter. Die App ist kostenlos und sowohl für Android als auch für iOSGeräte verfügbar.
DIGITALER IGEL-STAMMTISCH
IgelFreund*innen sind herzlich eingeladen zur WhatsAppCommunity »IgelStammtisch«. Scannen Sie den QRCode mit Ihrer Kamera und treten Sie der IgelCommunity bei. In der Gruppe Allgemeiner Austausch können sich alle Teilnehmer*innen über Lebensweise, Schutz und Tipps zum igelfreundli
chen Garten austauschen. Die Gruppe »Igel gefunden, was tun?« dient zum Austausch über gefundene Igel. Hier können Sie Fragen stellen, Tipps zur Versorgung teilen und Hilfe bei der Rettung von verletzten oder verwaisten Igeln bekommen. Zudem gibt es eine geschlossene Gruppe für erfahrene Igel
• Benutzeraccount anlegen: Melden Sie sich an. Das ist notwendig, um die Igeldaten nochmal kontrollieren zu können.
• Gehen Sie raus in die Natur: Fotografieren Sie nur zufällig gesichtet Igel in ihrem natürlichen Lebensraum, zum Beispiel im Garten, Park oder am Waldrand. Igel an künstlichen Futterstellen oder Tiere in Pflegestationen sind für das Projekt weniger von Interesse.
• Speichern Sie Ihre Daten ab: Durch das Hochladen der Fotos und das Abspeichern der Meldung, nehmen Sie automatisch an der IgelChallenge teil. Vielen Dank fürs Mitmachen!
Bei Redaktionsschluss wurden in Bayern einige mit dem Borna-Virus infizierte Igel gemeldet. Ob die Krankheit von Igeln auf Menschen übertragbar ist, steht noch nicht fest. Tragen Sie deshalb beim Umgang mit Igeln Handschuhe und fassen Sie tote Igel nicht an. Aktuelle Informationen auf: www.bundnaturschutz.de/ aktionen/igelchallenge

pfleger*innen. Hier werden fachliche Informationen zur Pflege und Freilassung von Igeln geteilt. Ein freundlicher Umgang miteinander und in allen Gruppen ist selbstverständlich.

Gottesanbeterin, neu entdeckt im Grünen Band bei Salzwedel
GRÜNES BAND

Foto: H. Walker

Fachsymposium zum Welterbe Grünes Band bei der Woche der Umwelt in Berlin. Verantwortliche aus den Bereichen Natur und Kultur diskutieren miteinander.
Das Grüne Band ist als Weltnaturerbe nominiert. Darum nimmt der BUND nun dessen Insektenwelt unter die Lupe.

LIANA GEIDEZIS
leitet das Nationale BUNDKompetenzzentrum Grünes Band.
Das Grüne Band steht als UNESCO-Weltnaturerbe auf der deutschen Vorschlagsliste – ein großer Erfolg für den BUND. Die Konferenz der Kulturminister hatte dem Vorschlag zugestimmt, den wir gemeinsam mit dem Thüringer und dem Bundesumweltministerium und weiteren Ländern eingereicht haben.
Die Liste mit dem Grünen Band meldete das Auswärtige Amt an die UNESCO nach Paris. Nun startet der aufwendige Prozess
zur Nominierung. Unser Ziel ist es, das Grüne Band zu einem Natur und Kulturerbe weiterzuentwickeln. Das Grüne Band wäre damit die erste gemischte deutsche Welterbestätte.
In Europa gibt es kein anderes Gebiet, das eine vergleichbare Bedeutung hat für die biologische Vielfalt und zugleich als Erinnerungslandschaft der jüngeren Zeitgeschichte, als ein lebendiges Symbol für Frieden, Freiheit und Demokratie.
WELCHE INSEKTEN?
Um ein solches Welterbe zu schaffen, müssen sich alle Verantwortlichen für Natur und Kultur eng austauschen. Der
Werden Sie jetzt Patin oder Pate für das Grüne Band! Ab einer Spende von 5 Euro im Monat schützen Sie die Lebenslinie an der ehemaligen innerdeutschen Grenze.
BUND hat hierfür (gefördert vom Bundesamt für Naturschutz) ein neues Projekt begonnen. In den nächsten Jahren werden wir beide Bereiche miteinander vernetzen, um speziell die Elemente des Kulturerbes im Grünen Band zu identifizieren. Eine wichtige Voraussetzung für die Nominierung als Welterbe ist auch die ökologische Ausstattung des Grünen Bandes. Um dessen außergewöhnlichen Naturwert zu untermauern, erheben wir in den kommenden drei Jahren erstmals systematisch die Tierwelt im längsten Biotopverbund Deutschlands. Und das besonders im Hinblick auf die wichtige Gruppe der Insekten. Auch hier unterstützt uns das BfN. In Zeiten der Klimakrise kann das von Süd nach Nord verlaufende Grüne Band eine wichtige Funktion als Wanderkorridor einnehmen.
Anzeige

PFLANZENPORTRÄT
Eine stachelige, imposante Erscheinung ist dieses Geißblattgewächs. Die Samenstände bieten im Winter Futter für Vögel.

IRMELA FISCHER
Die Autorin arbeitet selbstständig als Naturbegleiterin und Umweltpädagogin. Sie bietet auch für den BUND Naturschutz und das NEZ Allgäu Exkursionen und Kräuterwanderungen an.
Manchmal über 2 Meter hoch, reich verzweigt, mit bis zu 10 Zentimeter langen, walzenförmigen Blütenständen und wandernden Ringen aus unzähligen violetten Röhrenblüten, dabei über und über stachlig bewehrt: Die Wilde Karde gedeiht an Wegrändern, Flussufern, in Wiesen oder Gärten.
Im ersten Jahr bildet sie eine dichte, grundständige Rosette, im zweiten Jahr ist die Wilde Karde (Dipsacus fullonum) eine stachelige Augenweide, von der man respektvoll Abstand hält. Der Nektar ist bei langrüsseligen Insekten wie Hummeln, Bienen und Schmetterlingen sehr begehrt, die Blätter sind Raupenfutter für Eulenfalter, die unzähligen Samen bieten Vögeln im Winter Nahrung.
Die Laubblätter sind am Stängelansatz verwachsen und bilden einen Trichter, in dem sich Wasser sammelt. Bisher ist ungeklärt, ob dies eine Tränke für Vögel und durstige Wanderer ist oder eine Sperre für krabbelnde Kleininsekten und damit eine zusätzliche Stickstoffversorgung. Als Heil und Schönheitsmittel wurde dieses

Wasser schon in der Antike genutzt (»Waschbecken der Venus« bei den Römern). Der Trichter war auf jeden Fall namensgebend, denn dipsa ist das griechische Wort für Durst.
Die Wilde Karde ist als Heilpflanze wenig bekannt und schulmedizinisch nicht anerkannt. Seit der Antike wird sie aber als Schutzpflanze für Körper und Psyche verwendet. Insbesondere der Wurzel werden antioxidative, antibakterielle, hautheilende, schmerzlindernde, reinigende, entgiftende, verdauungsfördernde sowie schweiß und harntreibende Wirkung zugeschrieben.
Bekanntheit erlangte die Karde aufgrund ihres auffälligen Erblühens: Die ersten Blüten öffnen sich als Ring in der Mitte des Blütenstandes. Dieser Vorgang setzt sich nach oben und unten fort und erinnert an wandernde, kreisförmige Hautveränderungen, die »Wanderröte« als typisches Zeichen von Borreliose. Daher gelten Wurzeltinktur, tee oder Ölauszüge

als Mittel zur Unterstützung bei deren Heilung, auch wenn der wissenschaftliche Nachweis bislang fehlt.
Und es gibt weitere, zum Teil ungewöhnliche Verwendungen, zum Beispiel Kardensuppe in Italien, Kardenschnäpse und liköre, Wurzelpulver als Beimengung in Mehl oder ein Ersatzfarbstoff für Indigo aus der getrockneten Pflanze.
Es gibt etwa 15 Arten weltweit. Alle gehören, wie zum Beispiel auch der Arzneibaldrian, zu den Kardenartigen aus der Familie der Geißblattgewächse.
• Wilde Karde (Dipsacus fullonum) mit nach oben gebogenen Hüllblättern und langen, biegsamen Spreublättern, nicht gefährdet
• Schlitzblatt-Karde (Dipsacus laciniatus) in wärmeren Regionen mit weißen Blüten
• Weber-Karde (Dipsacus sativus L.) mit waagrecht stehenden Hüllblättern und starren, kürzeren Spreublättern, an der Spitze rückwärts gekrümmt – namensgebend, da in der Textilindustrie zum Aufrauen (Kardieren) von Wollgeweben genutzt, bei uns hierfür früher als Kulturpflanze angebaut

SPURENSUCHE
Sechs Jahre lang untersuchte ein Team aus Wissenschaft und Naturschutz, warum Gartenschläfer in Deutschland immer seltener werden. Und erarbeitete diverse Schutzmaßnahmen für die Schlafmaus mit der schwarzen Augenbinde.
Tausende Menschen haben seit 2018 zur »Spurensuche Gartenschläfer« des BUND beigetragen. »Citizen Science« also, gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt. Den würdigen Abschluss dieses erfolgreichen Schutzprojektes bildete kürzlich eine Tagung im Rahmen der Internationalen Schlafmauskonferenz. Ein Großteil der ursprünglich in ganz Ostund Mitteleuropa heimischen Gartenschläfer lebt heute in Deutschland. Damit tragen wir eine besondere Verantwortung für diese Art. Zumal ihr Bestand teilweise drastisch zurückgegangen ist. Unsere Spurensuche hat das für die Wälder in
den deutschen Mittelgebirgen bestätigt. Doch was sind die Ursachen?
Um dem auf den Grund zu gehen, konnte der BUND zusammen mit der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung und der JustusLiebigUniversität Gießen zahlreiche Menschen zur Mithilfe gewinnen. Die Freiwilligen setzten Spurtunnel ein, in denen die Schlafmäuse Abdrücke ihrer Pfoten hinterließen. Und sie kontrollierten Nistkästen und Wildtierkameras. Die Ursachenforschung ergab: Pestizide und besonders Insekten und Nagergifte

setzen dem Gartenschläfer stark zu. Und er verschwindet, wo seine Lebensräume zu eintönig werden. Mithilfe vieler Ehrenamtlicher haben wir daher Waldränder und Säume aufgewertet, Hecken gepflanzt und Steine und Totholz aufgehäuft.
Gleich 2018 wurde außerdem eine Meldestelle eingerichtet, die seitdem sämtliche Sichtungen des Gartenschläfers sammelt. Im Sommer erreichte uns hier die zehntausendste Meldung.
Unsere Spurensuche hat weite Kreise gezogen. Davon zeugte die Internationale Schlafmauskonferenz, die im September zum dritten Mal in Deutschland stattfand. Die Tagung »So kann Artenschutz gelingen?!« im Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt markierte das Ende des langjährigen Projekts. Mehr als einhundert Wissenschaftler*innen aus Europa und aus Asien tauschten dort ihre Erfahrungen zum Schutz der Schlafmäuse aus. Schon jetzt steht fest: Der kleine Zorro wird auch künftig Unterstützung finden, die ihm durch schwere Zeiten hilft.
Rebecca Koch
Aktiv werden
Auch nach Projektende können Sie melden, wann und wo Sie einen Gartenschläfer entdeckt haben.
Geben Sie Ihre Beobachtung weiter an: www.meldestelle.gartenschlaefer.de
Um Bayerns Bäche und Flüsse ist es schlecht bestellt. Viele sind verbaut, kanalisiert und weit entfernt davon, ein guter Lebensraum für Pflanzen und Tiere im und am Wasser zu sein. Das Projekt Fluss.Frei.Raum will das ändern.
Dabei nimmt das Projekt die kleinen Fließgewässer in den Fokus, also die Flüsschen und Bachläufe Bayerns, im Amtsdeutsch »Gewässer dritter Ordnung« genannt. Dazu muss man wissen: Die größeren Flüsse werden von den Wasserwirtschaftsämtern untersucht und betreut, für ihre kleineren Flussgeschwister sind die Kommunen zuständig. Und dort ist das Thema aufgrund von Personalmangel und klammen Kassen oft weit unten auf der Prioritätenliste. Diese Lücke will das neue Projekt so weit wie möglich abdecken. Dafür sorgt ein starkes Bündnis aus WWF Deutschland, BUND Naturschutz, Landesfischereiver
Gefördert durch:


band, dem Bayerischen KanuVerband und dem Landschaftspflegeverband RhönGrabfeld. Gestartet ist »Fluss.Frei. Raum« im März, das Projekt läuft bis 2030. Das erste Ziel: herausfinden, wo überall es in Bayerns kleinen Flüssen Querbauwerke gibt und ob diese noch benötigt werden. Querbauwerke, zum Beispiel Wehre oder Stufen, sind ein großes Problem für die Ökologie eines Fließgewässers, denn sie zerschneiden seine natürliche Dynamik. Auch Rohre, die Wasser ausleiten, sollen im Rahmen des Projekts aufgespürt werden.
Doch dafür braucht es viele Ehrenamtliche, die an den Bach und Flussläufen Detektivarbeit leisten. Hier kommt der BUND Naturschutz ins Spiel: Mit seiner breiten Basis und Kreisgruppen in allen


bayerischen Landkreisen ist er bestens dafür aufgestellt, ein »Bachflüsterer«Netzwerk aufzubauen. Dafür ist Annette Guse in den kommenden Jahren beim BN zuständig. »In jedem Regierungsbezirk wird es eine Auftaktveranstaltung geben«, erklärt sie. Den Anfang machten im Oktober Oberfranken und Schwaben mit Infoabenden in Bayreuth und Lindau.
Die Idee ist, Personen oder Gruppen zu finden, die sich längerfristig um »ihren« Bach oder Fluss kümmern. Denn um etwas ins Rollen zu bringen, ist oft langer Atem gefragt. Zuerst müssen die Flussläufe erkundet und gegebenenfalls die Besitzverhältnisse von funktionslosen, alten Wehren ausfindig gemacht werden. Für einen Rückbau heißt es dann Überzeugungsarbeit leisten und Fördermittel auftreiben. Interessierte bekommen dafür das nötige Wissen.
So können Bayerns Bäche und Flüsschen im wahrsten Sinn des Wortes wieder »in Fluss kommen«. Die Lebensräume entlang der Gewässer werden besser vernetzt und der Transport von Sand und Kies ermöglicht, was Laichplätze für Fischarten schafft. Wandernde Fische können an ihre Laichplätze gelangen und sich fortpflanzen. Das macht Flüsse und Bäche nicht nur zu einem schönen Erholungsort, sondern auch zu einem intakten Lebensraum für viele Arten.
Luise Frank

Machen Sie mit! www.fluss-frei-raum.org Kontakt: annette.guse@bundnaturschutz.de
Arbeitseinsatz an der Kleinen Paar, an dem auch Fördermittelgeber*innen im LebendigeFlüsseProjekt von der Deutschen PostcodeLotterie und der PSDBank München teilnahmen
Natur+Umwelt 4
Wer Wasser entnimmt, soll auch dafür bezahlen – egal, ob für die Landwirtschaft wie hier oder für die Industrie.

RESSOURCE WASSER SCHÜTZEN
Der BUND Naturschutz fordert: Wer Wasser aus der Natur entnimmt, muss dafür zahlen, egal, ob Industrie, Landwirtschaft oder Wasserkraft!
Bayern hat als einziges Bundesland immer noch keinen sogenannten Wassercent – im Amtsdeutsch Wasserentnahmeentgelt – eingeführt. Nicht zu verwechseln mit der Wassergebühr: Das ist der Preis, den man an den Trinkwasserversorger bezahlt für die Förderung und Bereitstellung des Wassers. Wasser ist unsere wichtigste Lebensgrundlage. Dennoch hat diese Ressource in Bayern keinen angemessenen Preis oder ist sogar umsonst. Dabei könnte das Wasser mit der Einführung eines Wassercents effektiv vor Übernutzung geschützt werden. Der BUND Naturschutz hat deshalb im Oktober konkrete Vorschläge gemacht, wie dieses Entnahmeentgelt berechnet werden könnte.
Entscheidend ist hierbei die konsequente Anwendung des Verursacherprinzips. Das heißt: Wer Wasser nutzt, muss zahlen! Bereits im Jahr 2021 hat die Bayerische Staatsregierung die Einführung einer Gebührenordnung angekündigt, und nach der letzten Landtagswahl hat es der Wassercent immerhin in den Koalitions
vertrag geschafft. Nach langem Streit ist nun ein Kompromiss zwischen CSU und Freien Wählern in Sicht, der für den BN aber nicht weit genug geht.
»Das ist kein verantwortungsvoller Umgang mit unserem Wasser. Es darf keine Ausnahmen für Industrie, Wasserkraft oder Landwirtschaft geben – auch nicht bei der Nutzung von Oberflächenwasser!«, betonte der BNVorsitzende Richard Mergner bei einer Pressekonferenz. »Die Einnahmen müssen zudem zweckgebunden sein, etwa für den Erhalt und Schutz von wasserabhängigen Ökosystemen oder zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser«, so Mergner.
Und es ist Eile geboten, denn die Entwicklungen bei dieser lebenswichtigen Ressource sind besorgniserregend. Auch wenn sich die Grundwasserspiegel vor allem in Südbayern in den letzten beiden Jahren etwas erholt haben – insgesamt sinken die Grundwasserspiegel bedingt durch die Klimakrise kontinuierlich. Rund ein Fünftel des bayerischen Grundwas
sers ist zudem stark belastet, etwa mit Nitrat und Pestiziden.
Ein besonderes Augenmerk muss auf dem Tiefengrundwasser liegen. Diese Wasserspeicher sind essentiell wichtig für zukünftige Generationen. Es kann nicht sein, dass private Mineralwasserfirmen das Jahrtausende alte, sehr reine Tiefengrundwasser umsonst aus dem Boden pumpen und teuer verkaufen.
Der BUND Naturschutz schlägt folgende Staffelung des Wassercents für die verschiedenen Nutzungen vor:
• Grundwasser und Oberflächenwasser: 0,07 Euro (jeweils pro Kubikmeter)
• Tiefengrundwasser: 0,10 Euro ansteigend auf 0,16 Euro (privatwirtschaftliche Unternehmen: 1,00 Euro)
• Wasserentnahme mit Wiedereinleitung: 0,01 Euro
• Wasserkraftnutzung: 0,0001 Euro, bei Nichteinhaltung gesetzlicher Anforderungen doppelte bis ansteigend auf fünffache Höhe

Wo naturnahe Quellbäche durch feuchte Laubund Mischwälder fließen, kann man ihn oft finden: den Feuersalamander. Damit das auch so bleibt, haben drei bayerische Naturschutzverbände drei Jahre lang ihre Kräfte gebündelt.
Der Feuersalamander ist in Bayern laut Roter Liste gefährdet: Der Verlust von Lebensräumen sowie zunehmende Hitze und Dürre setzen dem markant schwarzgelb-gefleckten Tier zu. Und seit einigen Jahren droht eine zusätzliche Gefahr: Der vermutlich aus Asien eingeschleppte Hautpilz Bsal (Batrachochytrium salamandrivorans). Er löschte 2010 in Belgien nahezu alle Vorkommen des Feuersalamanders aus. Mittlerweile hat sich der Pilz auch nach Deutschland und Bayern ausgebreitet: Nachgewiesen wurde er 2015 in der Nordeifel und wenig später im Ruhrgebiet. Seit 2020 sind bestätigte Fälle aus dem Steigerwald sowie aus Bayerisch Schwaben bekannt.
Die Naturschutzverbände in Bayern reagierten schnell auf diese Bedrohung: 2021 starteten der BUND Naturschutz, der Landesbund für Vogel und Naturschutz (LBV) und der Landesverband für Amphibien und Reptilienschutz (LARS) ein dreijähriges gemeinsames Hilfsprojekt für den Feuersalamander, das vom
bayerischen Umweltministerium gefördert wurde.
Zuallererst ging es in diesem großen Artenhilfsprogramm darum, sich einen Überblick über den derzeitigen Zustand der FeuersalamanderBestände zu verschaffen. Also zogen haupt und ehrenamtliche Artenschützer*innen los und zählten in den Gewässern von acht Schwerpunktgebieten FeuersalamanderLarven. Wichtig war es, den Status Quo zu ermitteln, um möglichst frühzeitig zu erkennen, wenn ein Bestand einbricht. Auch erwachsene Tiere haben die Artenschützer*innen gesucht, denn sie wollten mehr darüber erfahren, wo sich die Tiere an Land aufhalten. Hinweise kamen auch aus der Bevölkerung: Etwa 300 Sichtungen wurden über das Meldetool der Projektwebseite gemeldet.
Bei den gefundenen Tieren führten die Projektmitarbeiter*innen über 1000 Hautabstriche durch und ließen diese auf ei

nen Befall mit Bsal hin untersuchen. Erfreulicherweise fanden sie kein einziges erkranktes Tier. Der Hautpilz scheint sich entgegen der anfänglichen Befürchtungen nicht schnell in Bayern zu verbreiten. Es besteht also Anlass zu vorsichtigem Optimismus.
Ein weiteres wichtiges Anliegen war es, die Lebensräume der Salamander langfristig zu verbessern. So wurden etwa Quellfassungen zurückgebaut, damit Bäche wieder natürlich fließen können. Auch sogenannte Gumpen wurden angelegt. Das sind Miniteiche im Bachlauf, in denen sich FeuersalamanderLarven halten können, auch wenn der Bach an anderen Stellen austrocknet. Eine Maßnahme, die großen Erfolg zeigte. Im Spessart zählten die Artenschützer*innen Hunderte FeuersalamanderLarven in einer solchen Gumpe.
Wichtige Ansprechpartner*innen für die Projektmitarbeiter*innen waren Waldbesitzer*innen und Verantwortliche in den Forstämtern. Sie können viel für den Feuersalamander tun, indem sie Fichtenmonokulturen entlang von Bächen durch standortgerechte, artenreiche Laub oder Mischwälder ersetzen. Anders als Nadeln von Nadelbäumen versauert Laub das Wasser von Bächen nicht und schafft außerdem Lebensraum für Wasserinsekten und Bachflohkrebse, die wiederum Nah
rung der Salamanderlarven sind. Außerdem verstecken sich die Larven gerne unter Falllaub. Wichtig ist zudem, dass SalamanderWälder nicht zu aufgeräumt sind. In strukturreichen Wäldern mit Laubschicht und Totholz finden die Tiere Verstecke und genügend Nahrung wie Schnecken, Asseln, Ohrwürmer oder Laufkäfer.
Auch für bessere Winterquartiere haben die Artenschützer*innen gesorgt. Amphibien überwintern in frostfreien Verstecken wie Wurzelspalten, Erdlöchern oder spalten, aber auch in Betonschächten, ungenutzten Wasserbehältern oder alten Brunnen. Letztere sind Fluch und Segen zugleich, denn sie können einerseits vielen Individuen als Winterquartier dienen. Andererseits mutieren sie auch schnell zur tödlichen Falle, wenn Ausstiegsmöglichkeiten fehlen. Hier haben die Salamanderschützer*innen angesetzt und für sichere Ausstiegswege gesorgt.
Doch was tun, wenn sich Bsal trotz aller Bemühungen weiter in Bayern ausbreitet und ein Aussterben droht? Für diesen Fall haben die Projektmitarbeiter*innen erforscht, ob es möglich ist, gesunde Populationen in menschlicher Obhut zu züchten und dann wieder auszuwildern. Das Ergebnis war positiv, und mit dem Tiergarten Nürnberg steht ein kundiger Partner für eine Erhaltungszucht bereit. Die Amphibienspezialisten dort haben schon befallene Feuersalamander mittels einer Wärmebehandlung gesund gepflegt und sind deshalb mit der Haltung und Pflege dieser Tiere vertraut. Jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt, um eine Zucht aufzubauen, denn noch ist die genetische Vielfalt für den Erhalt gesunder Populationen vorhanden. Hier ist der Staat gefragt, um solch ein Zuchtprogramm dauerhaft zu finanzieren.
Ordnung: Schwanzlurche (Caudata)
Familie: Echte Salamander (Salamandridae)
Art: Feuersalamander (Salamandra salamandra)

Horst Schwemmer war einer der Projektmanager im Feuersalamanderprojekt. Wir haben ihn gefragt, was die Bevölkerung tun kann, und wie es nun für den Salamander weitergeht.
Natur+Umwelt: Was kann jeder Einzelne unternehmen, um dem Feuersalamander zu helfen?
Horst Schwemmer: Wichtig ist zum Beispiel, die Schuhe nach einer Wanderung auszuklopfen und am besten sogar zu desinfizieren. Das verhindert, dass der Pilz von einem Bestand zum nächsten getragen wird.
Und was kann ich tun, wenn ich einen Feuersalamander sehe?
Auf keinen Fall anfassen, das ist das Wichtigste. Wenn der Salamander gesund aussieht, ist alles in Ordnung und Sie können sich einfach daran erfreuen, das schöne Tier zu beobachten. Sieht der Salamander krank aus oder ist sogar tot, machen Sie ein Foto und nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Gesunde Tiere melden Sie bitte über die Meldeplattform observation.org
Kontakt
horst.schwemmer@bundnaturschutz.de
Wie wird sich der BUND Naturschutz weiterhin für den Feuersalamander einsetzen?
Der BN hat insgesamt 15 Hektar Flächen angekauft, auf denen der Feuersalamander vorkommt. Diese Lebensräume werden nun von BNLeuten so gepflegt und weiterentwickelt, dass sie ideale Lebensbedingungen für den Salamander bieten.
Was ist für Sie das wichtigste Ergebnis des Projekts?
Wir haben es geschafft, die Öffentlichkeit und die Waldnutzer für den Feuersalamander und seine Lebensräume zu sensibilisieren. Bei vielen haben wir ein anderes Verständnis für das besondere Tier geweckt, sodass etwa Lebensräume wie Quellbäche in Zukunft hoffentlich pfleglicher behandelt werden als bisher.
Text und Interview: Heidi Tiefenthaler

Auch schaden lange Dürrezeiten und erhöhte Wassertemperaturen zahlreichen Arten. Darum gilt mehr als die Hälfte unserer Süßwasserfische heute als bedroht oder schon ausgestorben.

Etwa die stark gefährdete Europäische Äsche. Sie lebt in eher kleinen Flüssen oder im Oberlauf der großen Flüsse. Hier laicht sie in klarem, kühlem Wasser auf seichten Kiesbänken. Einst häufig, wird der Fisch mit der markanten Rückenflosse nun immer seltener. Der BUND engagier t sich von der Ems über die Bode bis zum Inn für seinen Lebensraum, natürliche Fließgewässer.


Nein, um kein Rezept soll es hier gehen – sondern um zwei besonders gefährdete Arten, die BUND-Aktive im Wendland seit vielen Jahren schützen.
Traurig, aber wahr. Bis in die jüngste Vergangenheit wurde der Ortolan auf seinem Herbstzug durch Frankreich tausendfach gefangen, grausig gemästet und als Delikatesse verspeist. (Trotz Verbot passiert dies noch immer.) Der ebenfalls essbare Kriechende Sellerie dürfte dagegen – so klein er ist – nur selten auf einem Teller landen. Stark gefährdet sind beide Arten heute vor allem, weil ihre Lebensräume verschwinden. Die Ökologische Station Wendland-Drawehn des BUND arbeitet daran, ihnen wieder bessere Bedingungen zu bieten.
Es ist Herbst im östlichsten Ausläufer von Niedersachsen, dem Wendland. Petra Bernardy, Leiterin der Station, steuert ihr Auto auf einer schmalen, von Eichen gesäumten Straße in die Feldflur. An einer
Wegkreuzung machen wir Halt. Ihr Arm weist einmal ringsum: »Hier findet der Ortolan im Frühjahr alles, was er braucht: In den Alleebäumen können mehrere Männchen gemeinsam singen. Und die Getreide und Erbsenfelder sind ideal für den Bodenbrüter.«
Schade, sehen lässt sich die rare Ammer Ende September nicht mehr. Sie ist bereits auf dem Flug in ihr Winterquartier südlich der Sahara. Zur Brutzeit aber ist sie nirgends leichter zu beobachten als im Wendland, ihrem deutschen Dichtezentrum. Damit das so bleibt, kümmert sich die Biologin Petra Bernardy schon lange um ihren Lebensraum – ehrenamtlich im Vorstand der BUNDKreisgruppe
LüchowDannenberg, hauptamtlich seit zwei Jahren in besagter Ökologischer Station.
Im Zuge des »Niedersächsischen Wegs« (siehe Kasten) setzen sich heute landesweit 28 Stationen dafür ein, den europäischen FFH und Vogelschutzgebieten vor Ort besser gerecht zu werden. Mit der bloßen Ausweisung dieser Gebiete ist es nämlich nicht getan.
Auch im Wendland ist der Ortolan stellenweise auf dem Rückzug. Petra Bernardy wundert das nicht: »Selbst in Schutzgebieten muss die Landwirtschaft nicht angepasst werden. Und anders als auf Wiesen erhalten Landwirte auf Äckern keinen Erschwernisausgleich, wenn sie
Diese Flächen betreut die Ökologische Station des BUND im Wendland. Sie sind überwiegend als europäische FFH und Vogelschutzgebiete ausgewiesen.
Landkreis Lüneburg
Landkreis Uelzen
Landkreis LüchowDannenberg
Ökologische Station des BUND
MECKLENBURGVORPOMMERN
SACHSEN-ANHALT ELBE
seltene Arten berücksichtigen.« Sie ist also auf deren freiwillige Mitwirkung angewiesen, um den Ortolan zu schützen. Und die sichert sich die BUNDExpertin mit viel Überzeugungsarbeit.
Zumindest im Osten des Landkreises sind die Bestände daher noch weitgehend stabil. Von der kleinteiligen, eher extensiven Feldwirtschaft profitieren weitere gefährdete Vögel wie Rebhuhn und Turteltaube, Feld und Heidelerche.
EHRENAMTLICHE VORARBEIT
Den Grundstock für die Naturschutzarbeit im Wendland legte in den 1970er und 80er Jahren die erwähnte Kreisgruppe des BUND. Früh erwarb sie wertvolle Grünflächen, nicht zuletzt um schon damals mehr Wasser in der Region zu halten. Das Mahdgut wurde als »Kräuterheu« an Reitställe verkauft.
Bis heute ist die Gruppe vielfältig aktiv. Um die Naturschönheiten des Wendlands zu bewahren, legt sie Flachgewässer für Amphibien an, schützt Fledermäuse oder Schwertlilien und Knabenkräuter. Doch ehrenamtlicher Einsatz kann staatliche Strukturen nicht ersetzen, schon gar nicht auf Dauer.
BRANDENBURG
Landkreis Lüneburg
Betreuungskulisse
Landkreis Uelzen
Landkreis LüchowDannenberg
Erweiterte Betreuungskulisse
Darum ist die neue Ökologische Station so notwendig. Sie weiß Förderprogramme zu nutzen und kooperiert eng mit der Landesbehörde für Naturschutz und der Landwirtschaftskammer. Davon profitiert auch ein selten gewordener Doldenblütler. Seinen Lebensraum wollen wir an diesem Tag ebenfalls besichtigen.
Petra Dittberner, eine Mitarbeiterin der Station, leitet uns über einen Feldweg zu mehreren Kleingewässern, um die herum Ziegen weiden. Nach kurzer Suche auf der BUNDeigenen Fläche ist der Kriechende Sellerie entdeckt. Im schütteren Uferbewuchs finden sich seine gefiederten Blätter und sogar drei noch blühende Pflänzchen.
Die global bedrohte Art benötigt Licht, ist aber konkurrenzschwach. Sie wächst nur an feuchten Stellen, die regelmäßig Störungen erfahren, durch Wildtiere etwa oder Überschwemmungen. Wo dies von Natur aus kaum mehr passiert, muss mit viel Aufwand nachgeholfen werden.
Damit aber neben ikonischen Arten wie Weißstorch und Wildkatze auch ein so unscheinbares Gewächs zu seinem Recht gelangt, benötigt der Naturschutz ein

Männchen singen im endland mit eigenem Dialekt.

MECKLENBURGVORPOMMERN

BRANDENBURG
Der Kriechende Sellerie blühte noch Ende September.
professionelles Gerüst. Niedersachsen scheint hier seit 2020 auf einem guten Weg zu sein.
Ökologische Station des BUND
Severin Zillich
SACHSEN-ANHALT
... ist eine in dieser Form bundesweit einmalige Vereinbarung von Landwirtschaft, Naturschutz und Politik. Damit verpflichteten sich 2020 die Landesregierung, das Landvolk, die Landwirtschaftskammer sowie BUND und NABU Niedersachsen, gemeinsam für einen besseren Natur, Arten und Gewässerschutz zu sorgen. Die damals rotschwarze Regierungskoalition kam so einem vom BUND maßgeblich unterstützten Volksbegehren zuvor, das zu einem wirksameren Naturschutz führen sollte. Eine Frucht dieser Vereinbarung ist die Ökologische Station im Wendland mit ihren fünf Mitarbeiter*innen.
GRO SSBRITANNIEN
Ende September schloss das letzte verbliebene Kohlekraftwerk Großbritanniens endgültig seine Tore. Mit dem Abschied von dem Klimakiller in Ratcliffe-on-Soar gelang ein entscheidender Schritt beim Kohleausstieg, auch international. Für eine weitere positive Wendung sorgte die »Coal Authority« des Ministeriums für Energiesicherheit. Sie entscheidet über die Kohleförderung und prüft die Betriebsfähigkeit und die finanziellen Garantien vorgeschlagener Minen. Im September verweigerte sie die Genehmigung für einen neuen, umstrittenen Abbau von Kohle im Nordwesten Englands. Die Entscheidung

Foto: www.glennbartley.com
Gefährdete Vielfalt: Vom in Kolumbien endemischen Gelbohrsittich gibt es keine 1000 Individuen mehr. Der Gastgeber der UNKonferenz ist das vogelartenreichste Land der Erde.
Ende Oktober trafen sich in Kolumbien die rund 200 Vertragsstaaten des UNÜbereinkommens über die Biologische Vielfalt zu ihrer 16. Konferenz. Im Fokus
Kohleabbau verhindert: unsere Verbündeten vor den Königlichen Gerichtshöfen in London

folgte auf ein Urteil des Obersten Gerichtshofs. Er hatte die Pläne in der Irischen See vor Cumbria für ungültig erklärt.
Unsere Verbündeten von »Friends of the Earth England, Wales, Northern Ireland« haben maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen. Deren Sprecher Tony Bosworth
KOLUMBIEN
kommentierte: »Das ist der Todesstoß für diese völlig unnötige Kohlemine. Jetzt muss die Regierung mit den Menschen vor Ort zusammenarbeiten, um West Cumbria auf dem Weg zu einem grünen Wandel zu unterstützen.«
Susann Scherbarth
stand die Umsetzung eines »Global Biodiversity Framework«, das 2022 in China und Kanada verabschiedet wurde – mit neuen Zielen zum Naturschutz bis 2030. Nun galt es sich auf Instrumente und Fahrpläne zu einigen, um diesen Zielen tatsächlich näher zu kommen. So wurden in Calí Beschlüsse gefasst, wie der Zustand der Natur überwacht und ihr Schutz finanziert werden soll. Auch diskutierten die Delegierten über den Einfluss der Klimakrise auf die biologische Vielfalt. Der BUND begleitete die Konferenz von Berlin aus mit Lobby und Pressearbeit.
Wie planen die Staaten die 23 Ziele der Vereinbarung auf nationaler Ebene zu erreichen? Deutschland machte bei diesem Punkt der Tagesordnung keine gute Figur
– über ihre Strategie ist sich die Bundesregierung noch nicht einig geworden.
Weil die FDP und konservative Kreise Widerstand leisten, stand unser Land in Calí mit leeren Händen da, was den Schutz der heimischen Natur betrifft. Und das, wo wir so gerne mehr Naturschutz in Übersee anmahnen und unterstützen.
Höchste Zeit, bei uns zu stoppen, was die Natur hier sowie anderswo zerstört, siehe Lieferketten, Konsum, Rohstoffe … Wir müssen die Natur wiederherstellen und schützen, nicht nur mit Geld in der Welt, sondern hier bei uns. Ende Oktober erhob der BUND daher die weltweit erste Verfassungsklage für einen besseren Schutz der Biodiversität – um die Bundesregierung zu zwingen, endlich zu handeln. > www.bund.net/naturschutzklage Nicola Uhde
Unser Schwesterverband WALHI hat die Folgen des Nickelabbaus in Indonesien untersuchen lassen. Die BUND-Expertin für Lieferketten, Ceren Yildiz, sprach mit Rere Christianto und Parid Ridwanuddin, zuständig für Bergbau sowie Energie und Klimagerechtigkeit.
Warum ist Nickel heute weltweit gefragt? Und wie wirkt sich der Abbau auf Mensch und Umwelt aus?
Nickel wird hauptsächlich in der Batterieund Speichertechnologie verwendet, ist also entscheidend für die Energiewende. Indonesien gehört zu den größten Nickelproduzenten der Welt. Doch der Abbau ist sehr umweltschädlich. So wurden in den letzten Jahren mindestens 40 000 Hektar Wald gerodet, Tendenz steigend. Die Bergbaugenehmigungen umfassen eine Million Hektar, 70 Prozent noch bewaldet. Hier leben etliche Menschen, die auf diese Ökosysteme angewiesen sind.
In NordMaluku gelten die Wälder den Indigenen zudem als heilig. Der Abbau untergräbt also auch deren kulturelles und

spirituelles Erbe. Und das Meer wird ebenfalls verschmutzt: Viel Bergbau passiert im KorallenDreieck, wo die biologische Vielfalt besonders reich ist.
Halten sich die Bergbaukonzerne an die Umweltgesetze?
Die von uns bewerteten Unternehmen im Wesentlichen ja – weil die Regierung die Vorschriften zugunsten der Industrie geändert und geschwächt hat. Wir beobachten also einen Trend zur Deregulierung. Um neue Arbeitsplätze zu schaffen, wurden Praktiken legalisiert, die bislang gegen Umweltauflagen verstießen. Und Rodungen werden, sobald eine Geldstrafe gezahlt ist, rückwirkend erlaubt. Dieser Abbau von Umweltstandards ist unser
Kernproblem. Gleichzeitig werden schon mindestens 50 Menschen, die gegen den Nickelabbau protestiert haben, strafrechtlich verfolgt.
Was tut ihr gegen den zerstörerischen Abbau von Nickel?
Dass wir unsere fossilen Brennstoffe so dringend ersetzen müssen, dient den Konzernen dazu, die Ausweitung des Nickelabbaus zu rechtfertigen. Sie nutzen die Dekarbonisierung als Vorwand, um ihre schädlichen Praktiken beizubehalten. Wir wollen Gemeinschaften ermächtigen, Widerstand zu leisten, wenn ihre Lebensgrundlagen bedroht sind. Und wir sollten uns einig sein, das Wohlergehen anderer nicht für die Energiewende zu opfern.
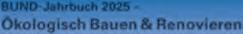


Mit den Themenbereichen: Planung /Grundlagen, Musterhäuser, Grün ums Haus, Gebäudehülle, Haustechnik und Innenraumgestaltung
Auf 244 Seiten finden Sie:
■ zahlreiche Beispiele gelungener Bau- und Sanierungsprojekte
■ Öko-Tipps und Anregungen zur persönlichen Energiewende
■ Artikel über den aktuellen Stand der Energie- und Haustechnik
■ Spektrum der Förderprogramme und Dämmstoff-Übersicht
■ weiterführende Literaturhinweise und unzählige Web-Links
ab Dezember für 9,90 Euro am Kiosk, in BUND-Geschäftsstellen und direkt beim Verlag: www.ziel-marketing.de als E-Paper


BUND-Reisen bietet auch 2025 wieder viele umweltfreundliche Wanderreisen an. Lassen Sie sich von unserem neu gestalteten Katalog inspirieren!
Vorweg: Was macht die BUND-Reisen so einzigartig? Sämtliche Reiseziele sind per Bahn erreichbar. Für weiter entfernte Regionen nutzen wir Nachtzüge und reisen in der Gruppe an. Fähren buchen wir nur, wo notwendig. Im Vergleich zu Flugreisen mit ihrer deutlich schlechteren CO2Bilanz schonen wir so das Klima. Und die Anfahrt selbst wird zum Erlebnis. Von fachkundigen Reiseleitungen begleitet, die Ihr Reiseziel bestens kennen und Ihnen ihr Wissen mit Begeisterung und Herzblut weitergeben, sind Sie in kleinen Gruppen Gleichgesinnter unterwegs. Wir übernachten in ausgewählten, oft privat geführten Hotels und Gästehäusern.
Kalte Luft und friedliche Stille in einer verschneiten Landschaft: So startet das Jahr 2025 mit BUNDReisen. Unser exklusives Angebot auf dem Mesnerhof in Tirol

am
verbindet Schneeschuhwandern mit entspannten Yogaeinheiten und regionaler Bioküche. Winterzauber garantiert!
Auch für das Sommerhalbjahr hat das BUNDReisenTeam etliche neue Reisen geplant, die unterschiedlicher und reizvoller kaum sein könnten. Viel Ruhe und gelebte Geschichte verspricht zum Beispiel das Biosphärenreservat Schaalsee. Wanderungen am Grünen Band und eine WohlfühlUnterkunft direkt am See sorgen für Entschleunigung und für vielfältige Naturerlebnisse. Unsere neue KatalonienReise besticht dagegen mit prickelnden Gegensätzen: Wir bereisen die pulsierende Metropole Barcelona sowie wilde Vulkanlandschaften und ausgedehnte Schilflagunen im EbroDelta.
Der Nordosten Europas lockt seinerseits mit tiefen Wäldern, mit mystischen Mooren und einer der spektakulärsten Landzungen der Welt. Peter Rottner,

BUNDGeschäftsführer in Bayern, lädt Sie dazu ein, »sein« Litauen gemeinsam mit ihm zu entdecken.
Naturschutz zum Anpacken gibt es bei BUNDReisen im MüritzNationalpark oder im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe. Und auf der Insel Juist im niedersächsischen Nationalpark Wattenmeer: Der Klassiker des »Voluntourismus« ist wieder im Programm! Helfen Sie beim Schutz der Dünen und lernen Sie dabei die reiche Vogelwelt kennen.
Wer es noch sportlicher schätzt, dem empfehlen wir unsere Reise in Norwegens Nationalparke Rondane und Dovre. Gipfelbesteigungen, tiefe Schluchten und gemütliche Abende in landestypischen Berghütten inklusive. Apropos Berghütte: Abgeschieden und unweit von Brunftplätzen der Rothirsche liegt die Lyfi-Alm im Martelltal/Südtirol. Im Herbst wird sie zum Zentrum des Geschehens und sorgt für eine spannende Woche mit beeindruckenden Tierbeobachtungen und magischen Herbstwanderungen.
Harry Karpp
Mehr zum Thema Unser vollständiges Angebot finden Sie unter www.bund-reisen.de, Telefon 0911/ 5 88 88-20, info@bund-reisen.de. BUNDReisen trägt das TOURCERTSiegel, ist Mitglied im »Forum Anders Reisen« und kooperiert mit www.fahrtziel-natur.de
Mit dem Grünen Engel zeichnete Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber die Leiterin des BN-Aktivenkreises Stadtnatur in Würzburg, Antonia Wehrhahn (im Bild), aus.
Ihr großes ehrenamtliches Engagement an der Schnittstelle zwischen Wissen und Handeln trägt in Würzburg zu mehr urbanem Grün bei, fördert die Biodiversität und unterstützt Menschen dabei, Baumscheibenpatenschaften zu übernehmen. So entstehen grüne Inseln mitten in der Stadt.
Mit dem Grünen JuniorEngel wurden auch die Juniorbetreuer*innen ausgezeichnet, die für das NaturerlebnisZeltlager im NEZ Allgäu ihre Zeit und ihre Ideen eingebracht haben. So konnten wieder 60 Kinder am Zeltlager teilnehmen. Ohne

Vermutlich kennen Sie diese Situationen: Ein Vorwurf jagt den nächsten, man schaukelt sich immer weiter in der Eskalationsspirale nach oben. Wie aussteigen?
Oder: Im Team gibt eine Person, die viel redet und die Gruppe ist genervt. Was tun – aussitzen oder ansprechen? Aber wie?

diese aktive Unterstützung, die attraktiven Bildungsworkshops und die Übernahme vieler organisatorischer Aufgaben, wäre das nicht möglich gewesen. Dafür gab es ein »Hut ab!« und anerkennende Worte des Umweltministers.
Der Workshop vermittelt Möglichkeiten, wertschätzend und gleichzeitig klar und konstruktiv zu kommunizieren. Auf Grundlage der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg und dem CleartheAirAnsatz nach Georg Tarne erarbeiten die Teilnehmer*innen Kommunikationstechniken und üben diese an praktischen Beispielen. Sie erkunden die Sprache der Bedürfnisse und finden zu einer Haltung, die es ermöglicht, dem Gegenüber auch im Konflikt wieder näher zu kommen.
Termine und Infos
30. November, 10.30 – 17 Uhr, Naturschutzzentrum Wartaweil
Anmeldung: Wartaweil@bundnaturschutz.de Infos: www.wartaweil.bundnaturschutz.de
Zum 33. Mal findet heuer der Donaukongress statt; wie immer in Niederaltaich in der Landvolkshochschule St. Gunther. Unter der Leitung von Richard Mergner und Hubert Weiger diskutieren die Teilnehmer*innen mit Fachleuten die aktuellen Entwicklungen rund um die bayerische Donau.
7. und 8. Dezember 2024
Infos: www.deggendorf.bundnaturschutz.de
Für die vierte Folge der Winterreihe »Ar tenkenntnis für Einsteiger« konnte das BNBildungswerk diesmal Spezialisten zu den Themen Hornissen und Ameisen sowie zur Ordnung der Raubtiere oder zum Wolf gewinnen. Auch die Botanik kommt nicht zu kurz. Im Januar und Februar geht es unter anderem um die heimischen Sträucher sowie das WIPSProjekt zum Wildpflanzenschutz. Termine und Anmeldung unter: www.bund-naturschutz.de/umweltbildung/artenkenntnis-fuer-einsteiger


Sowohl für Familien mit Kindern als auch für Erwachsene bietet das Ökohaus Würzburg WinterExkursionen an. Hier gibt es Antwor ten auf die Frage, was Tiere im Winter machen und welche Spur zu welchem Tier gehört. Ornithologisch Interessierte können das Vogelschutzgebiet Garstadt erkunden, in dem bereits über 270 Vogelarten beobachtet wurden. Im Februar gibt es noch nordische Wintergäste zu bewundern, aber auch erste Rückkehrer aus dem Süden. Termine und Anmeldung: www.wuerzburg.bund-naturschutz.de/ veranstaltungen
UMWELTFREUNDLICH REISEN
Eine Natur- und Wanderreise lädt ein, die Ostseeküste und das grüne Herz Litauens zu entdecken.
Litauen bietet eine beeindruckende Vielfalt an Natur: Küstenabschnitte mit riesigen Dünen, dichte Wälder, naturbelassene Moore und dazwischen fast tausend klare Seen. Durch weite Schutzgebiete streifen Luchse, Wölfe und Elche. Der salzige Wind weht über das Deck, Möwen kreisen über uns, als die Fähre in den Hafen von Klaipėda gleitet. Nach einem kurzen Rundgang durch die Altstadt übernachten wir hier – der Beginn unserer Reise. Am nächsten Morgen führt uns der Weg auf die Kurische Nehrung. Schon von weitem hören wir das Rauschen der Brandung. Diese schmale Landzunge, die das Kurische Haff von der Ostsee trennt, ist fast 100 Kilometer lang und von langen Sandstränden gesäumt. Die Dünen leuchten hell gegen das Blau des Wassers. Ein Naturparkführer begleitet uns und erklärt die Flora und Fauna, die hier seit 2000 unter dem Schutz des UNESCOWeltnaturerbes steht.
Im ehemaligen Fischerdorf Nida strahlen die Häuser in Kobaltblau, Titanweiß und Eisenrot. Hier können wir frischen Räucherfisch probieren. Weiter geht es nach Juodkrantė, wo im Wald eine der größten Kormorankolonien Europas nistet. Das Haff ist ein wichtiger Rastplatz für Zugvögel und an der Windenburger
Beeindruckende Dünenlandschaft auf der Kurischen Nehrung

Ecke besuchen wir eine der ältesten Vogelforschungsstationen Europas. Unsere Reise führt uns tiefer ins Memelland. Vom Kultberg Rambynas öffnet sich ein weiter Blick über Wiesen, Wälder und mäandernde Flüsse. In Kaunas, dem »Herz Litauens«, erzählt die Architektur von der bewegten Geschichte der Stadt. Besonders der Kaunasser Modernismus der Zwischenkriegszeit ist beeindruckend.
HELLE ABENDE IM NORDISCHEN SPÄTFRÜHLING
Im Nationalpark Dzūkija tauchen wir ein in die Stille des größten unberührten Hochmoorgebiets Litauens. Nur in Begleitung eines zertifizierten Wanderführers dürfen wir das empfindliche Ökosystem betreten, das Heimat von seltenen Tieren wie Auerhuhn, Birkhuhn und Kranich ist. Später entdecken wir Druskininkai, Litauens größte Kurstadt – wer mag, entspannt in den heilenden Bädern.
Im Nationalpark Trakai entdecken wir eine idyllische Seenlandschaft, die für ihre seltenen Orchideen bekannt ist. Die mittelalterliche Inselburg von Trakai thront majestätisch über dem Wasser und ist fast schon ein Nationalheiligtum. In Vilnius, das zum UNESCOWeltkulturerbe zählt, schlendern wir durch die baro
cke Altstadt und staunen, wie grün die Hauptstadt ist. Unsere Reise führt uns schließlich in den Nordosten, zum Nationalpark Aukštaitija. Eine Welt aus Wasser und Wald erwartet uns. Über 120 Seen sind hier durch Flüsse und Kanäle miteinander verbunden – perfekt, um die Natur aus dem Kanu zu erkunden. Auf dem Fluss Šventoji gleiten wir lautlos durch die Flusslandschaft und besuchen die historische Wassermühle in Ginučiai, ein technisches Denkmal aus dem 19. Jahrhundert. Diese Reise durch Litauen offenbart die Vielfalt unberührter Natur und die reiche Geschichte des Landes. Ende Mai, wenn die Tage lang und die Abende hell sind, zeigt sich der nordische Spätfrühling von seiner schönsten Seite.
Lucia Vogel
30. Mai – 10. Juni 2025
Infos zu Reisepreis und Anmeldung BUNDReisen
ReiseCenter am Stresemannplatz
Stresemannplatz 10, 90489 Nürnberg Tel. 09 11/5 88 88-20 www.bund-reisen.de

Widersinnige Bauprojekte werden oft vorangetrieben, weil es dafür satte Fördermittel gibt. So auch in Stadtsteinach im Frankenwald: Am nördlichen Rand des Städtchens sollte dort in den 70er Jahren ein Waldweg entlang des Flüsschens Steinach zu einer neuneinhalb Meter breiten Straße ausgebaut werden. Umfangreiche Sprengungen in der Steinachklamm, Verlegungen des Flussbetts und massive Einschnitte in die Böschungen des engen Kerbtals wären dafür erforderlich geworden.
Dabei ist das ruhige Tal direkt vor den Toren von Stadtsteinach der Zugang zu einer beliebten Wander und Naherholungsregion – und bislang hatte dort niemand eine breite Teerstraße vermisst, die nur zusätzlichen Verkehr angezogen hätte.
Das zerstörerische Vorhaben ging nach hinten los: Es gab den letzten Anstoß zur Gründung der BNKreisgruppe Kulmbach. Hubert Weiger forderte 1973 auf einer Pressekonferenz, statt eines Ausbaus nur die Schlaglöcher auszubessern, ein paar Ausweichstellen zu schaffen, und das übrige Geld in den Bau einer Kläranlage zu stecken. Danach hörte man lange nichts.
Im Mai 1977 kam das Thema wieder auf den Plan, und zwar auf kuriose Weise: Am Ende einer Stadtratssitzung meldete
Sprengungen und eine Verlegung des Flussbetts wären nötig gewesen, um diesen Weg in eine breite Straße zu verwandeln.
GERETTETE LANDSCHAFTEN ENTDECKEN
Ein widersinniges Straßenbauprojekt durch das schöne Steinachtal konnte in den 70er Jahren verhindert werden.
Aus diesem Widerstand ging die BN-Kreisgruppe Kulmbach hervor.
sich aus dem Zuschauerraum der Besitzer des örtlichen Sägewerks zu Wort und forderte nachdrücklich den Ausbau. Der Stadtrat stimmt zu und beschloss spontan die Vergabe einer neuen Planung –rechtswidrig, weil der Punkt überhaupt nicht auf der Tagesordnung stand.
Doch die Naturschützer, Wander und Heimatvereine hielten dagegen. Es gelang ihnen, im Stadtrat einen Ausbaubeschluss zu verhindern. Kurze Zeit später wurde das Tal als Teil des Naturparks Frankenwald ausgewiesen. Und so ist der Waldweg bis heute unverbaut – und wird es wohl auch bleiben.
Wer das idyllische Steinachtal kennenlernen möchte, findet an dessen Eingang einen Wanderparkplatz – und kann von da einfach loslegen: An der ehemaligen Papierfabrik vorbei zur Waldschänke und von dort aus weiter, an steilen Felswänden und blumenreichen Talwiesen vorbei, immer dem Waldweg und der munter
sprudelnden Steinach entlang, bis zur Steinachklamm. Das ist eine kurze Engstelle mit schroffen, hoch aufragenden Felswänden, durch die sich die Steinach in erdgeschichtlichen Zeiten hindurchgenagt hat.
Wer nicht nur im Tal wandern will, kann ganz zu Beginn des Weges einen Abstecher zur Burgruine Nordeck machen und danach wieder ins Tal zurückkehren. Weiter hinten im Tal führt von der Neumühle aus ein Steig über prachtvolle Wiesen nach Triebenreuth hinauf – und von dort wieder zurück ins Steinachtal. (Karte oder NaviApp ratsam.)
Ulrike Rohm-Berner, Winfried Berner
• Ausgangspunkt: Stadtsteinach (Bus) oder Wanderparkplatz Steinachtal
Mehr entdecken
Winfried Berner, Ulrike Rohm Gerettete Landschaften

Wanderführer, Verlag Rother, 14,90 Euro Bestellung: www.bnonlineshop.de
• Länge /Gehzeit: 12,7 Kilometer/ ca. 3,5 – 4 Stunden
• Höhenunterschied: bis Neumühle (6 Kilometer) sanft ansteigend, über Triebenreuth ca. 400 Meter
• Einkehr: Waldschänke, Stadtsteinach


Es gibt so viele wunderbare Naturschätze in Bayern – doch oft sind sie bedroht: durch Bebauung, durch immer intensivere Landwirtschaft, durch Straßen, die Lebensräume zerschneiden. Der BUND Naturschutz bemüht sich seit vielen Jahren darum, Flächen anzukaufen, um sie zu schützen und zu bewahren, oft mit Erfolg: Derzeit besitzt der BN 2750 Hektar Flächen in ganz Bayern. In jedem Heft stellen wir ein solches Naturjuwel vor. Die Hersbrucker Alb ist eine wahre Schatzkiste der Artenvielfalt. Hier tummeln sich zahlreiche gefährdete Tiere und Pflanzen auf seltenen Lebensraumtypen wie Blockschutthalden oder DolomitKiefernwäldern. Engagierte Naturschützer*innen haben das schon vor Jahrzehnten er
kannt und sich zusammengetan, um diese Flächen zu schützen.
88 Hektar sind es inzwischen, die angekauft und bewahrt werden konnten. Angefangen hat alles 1976, als der »Arbeitskreis Naturschutz Hersbruck« aus der Taufe gehoben wurde. Sein Ziel war die Erhaltung der naturnahen Kulturlandschaft der Hersbrucker Alb. Aus diesem Arbeitskreis ging 1987 die Ortsgruppe Hersbrucker Land des BN hervor.
Während andere BNKreisgruppen die Kapazitäten für die oft aufwendige Betreuung eigener Flächen selbst aufbauen, hat die Kreisgruppe Nürnberger Land diese Aufgabe weitestgehend an einen eigens gegründeten Verein ausgelagert, das Naturschutzzentrum Wengleinpark.
Kreisgruppe: Nürnberger Land
Fläche: 88 Hektar
Arten: Pfingstnelke, Wendehals, Schlingnatter, GoldaugenSpringspinne (Bild oben); Insekten: Großer Eisvogel (Tagfalter), Gewöhnliche Gebirgsschrecke, Rotflügelige Ödlandschrecke, Rotflügelige Schnarrschrecke, Gestreifte Quelljungfer, Lindenbockkäfer
Karl Heinlein ist Vorsitzender des Naturschutzzentrums und erklärt das Procedere: Das Naturschutzzentrum suche geeignete Flächen und kaufe diese meistens im Rahmen von BayernNetzNaturProjekten an (mit finanzieller Unterstützung durch den Bayerischen Naturschutzfonds). Besitzer der Flächen sei der BN, »Kümmerer« das Naturschutzzentrum.

Dieses hat auch einen eigenen landwirtschaftlichen Weidebetrieb mit Mutterkuhhaltung (natürlich bio-zertifiziert), denn ein Teil der Flächen sind ehemalige HutangerFlächen. Hutanger ist ein fränkischer Begriff für Allmendeweiden. Auf der Hersbrucker Alb wurden solche Weiden bis in die 1960er Jahre genutzt. Die Artenvielfalt auf diesen Flächen war in Gefahr, als die Hutanger nicht mehr gebraucht wurden. 1985 entstand deshalb das Hutangerprojekt, das noch heute lebendig ist. Auf den Flächen grasen gefährdete, alte Rinderrassen, die besonders robust sind: Rotvieh und MurnauWerdenfelser Rinder.
Hier wird also eine Kombination aus genutzten und nicht genutzten Flächen realisiert. Die Rinder verhindern, dass die Weiden verbuschen, während angrenzend Wälder aus der Nutzung genommen wurden und sich ungestört entwickeln dürfen. Die BNFlächen sind Hotspots der biologischen Vielfalt, mit vielen stark gefährdeten bedrohten Arten wie zum Beispiel der GoldaugenSpringspinne, der größten Springspinne, die in Deutschland vorkommt. »Gerade die Übergangsbereiche von Wald zu Offenland«, erklärt Karl Heinlein, »sind die artenreichsten Flächen überhaupt.« Diese Kombination findet sich beispielsweise im Naturschutzgebiet Oberes Molsberger Tal, wo dem BN 14 Hektar gehören. Karl Heinlein und seinen Mitstreiter*innen vom Naturschutzzentrum ist es zudem gelungen, auf der Hersbrucker Alb über eine Fläche von 200 Hektar hinweg einen Biotopverbund, also eine Vernetzung von Lebensräumen, aufzubauen.
Luise Frank Patenschaft übernehmen
Interessierte können das HutangerProjekt mit einer Patenschaft unterstützen. Mit 60 Euro oder mehr kann man eine HutangerprojektPatenschaft übernehmen (oder verschenken). Für 600 Euro im Jahr kann man eine KuhPatenschaft erwerben. Hier erfahren Sie mehr über das Hutangerprojekt und können eine Patenschaft abschließen: hutangerblog.de

das Jahr neigt sich seinem Ende entgegen und wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der BN auch in diesem Jahr viel erreicht hat.
So konnten unsere Kreisgruppen weitere Flächen ankaufen, um den Schutz der dort lebenden Tiere und Pflanzen sichern. Auch zur Energiewende trägt der BN bei, indem er die Suche nach Vorranggebieten für Windenergie begleitet und darauf hinwirkt, dass Windkraftanlagen dort geplant werden, wo es keine Konflikte mit dem Natur und Artenschutz gibt.
In gerichtlichen Verfahren – zum Beispiel beim bayerischen Wolfsabschussverordnung – hat der BN Kommunen und Behörden, aber auch die Bayerische Staatsregierung dazu gezwungen, ihre Maßnahmen nicht an gültigem Naturschutzrecht vorbeizuschummeln. Eine schöne Nachricht kam in diesem Jahr vom Grünen Band: Es ist in die deutsche Vorschlagsliste für das UNESCOWeltnatur und Kulturerbe aufgenommen worden!
Eine sehr wichtige gute Nachricht sind aber Sie, liebe Mitglieder. Denn der BUND Naturschutz hat es auch in diesem Jahr geschafft, mehr Menschen von einer Mitgliedschaft zu überzeugen. Innerhalb von zwölf Monaten ist der BN um rund 2500 Menschen auf einen neuen Rekordwert von mehr als 270 000 Mitgliedern
und Förderern gewachsen! Gerade die neu hinzugekommenen Mitglieder möchten wir an dieser Stelle herzlich grüßen. Die breite Basis des BN ist der Beweis dafür, dass vielen Menschen der Schutz unserer Umwelt am Herzen liegt – gerade in Zeiten, in denen dieses Thema teils heftigen Attacken und Verleumdungen ausgesetzt ist.
Der BUND Naturschutz hat sich seit 111 Jahren als Anwalt der Natur bewährt. Als größter und ältester Umweltund Naturschutzverband Bayerns wird der BN auch künftig die Verantwortlichen in der Politik daran erinnern, dass sie gesetzlich zum Schutz von Umwelt und Klima verpflichtet sind. Gleichzeitig bietet der BN allen Menschen Möglichkeiten, selbst etwas für die Natur zu tun, zum Beispiel durch die Teilnahme an der alljährlichen Amphibienrettung oder an Biotoppflegemaßnahmen, zunehmend auch durch Mitmachaktionen im Bereich Citizen Science. So können Interessierte der Wissenschaft helfen, indem sie per HandyApp zum Beispiel Eichhörnchen, Hummeln oder Igel melden. Dadurch gelang in diesem Jahr einem BNMitglied der erste Nachweis einer Tonerdhummel in Deutschland – eine kleine Sensation!
Wir wünschen Ihnen einen friedlichen Jahresausklang und ein gutes und gesundes neues Jahr!
Doris Tropper stv. Vorsitzende
Richard Mergner Landesvorsitzender
Beate Rutkowski stv. Vorsitzende
Staatsministerin Michaela Kaniber besichtigte am Grünen Band Bayern-Tschechien die innovativen Maßnahmen des Projekts »Quervernetzung Grünes Band« zur Förderung des Biotopverbunds, der biologischen Vielfalt sowie für Umweltbildung und naturnahen Tourismus.
Der Besuch der Staatsministerin in der Gemeinde Hinterschmiding war vor allem aufgrund der letzten Hochwasserereignisse interessant. Seit 2021 wird dort über ein Quervernetzungsprojekt, umgesetzt durch das BUNDKompetenzzentrum Grünes Band, auf mittlerweile rund 5,5 Hektar Ackerfläche ein Mix aus mehrjährigen, blühenden Energiepflanzen angebaut. Dies schafft ökologische Vernetzungsflächen für Insekten und Vögel in der Agrarlandschaft und sorgt für Bodenschutz. Der BNVorsitzende Richard Mergner ergänzte: »Wir konnten zudem gemeinsam mit der Gemeinde Mauth die Renaturierung des ›Mauthler Filz‹ umsetzen. Leider befinden sich aber noch viele weitere Moore in Bayern insgesamt in einem sehr schlechten Zustand – die

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (mit BNVorsitzendem Richard Mergner) in Hinterschmiding, wo sie eine Anbaufläche für blühende Energiepflanzen besichtigte
Staatsregierung sollte wesentlich mehr Flächen renaturieren, um das selbstgesteckte Ziel eines Biotopverbundes auf 15 Prozent des Offenlands bis 2030 zu erreichen«.




Wie kann der Wald in Bayern fit für die Zukunft und klimaresilient gemacht werden? Darüber sprachen Vertreter des BUND Naturschutz mit Mitgliedern des Waldbesitzerverbands. Der bayerische Waldbesitzerverband (WBV) vertritt die Interessen der Privat
Der BUND Naturschutz musste Abschied nehmen von einem hochverdienten Aktiven: Dieter Scherf verstarb im Oktober im Alter von 83 Jahren.
Von 1999 bis 2008 war Dieter Scherf Vorsitzender der Kreisgruppe Deggendorf. In dieser Funktion trug er maßgeblich zur Rettung der frei fließenden Donau in Niederbayern bei, wobei seine ruhige, besonnene und diplomatische Art so manche Tür öffnete.
Von 2000 bis 2005 und 2017 bis 2022 hat er als Mitglied des Landesbeirates und von 2004 bis 2016 als Mitglied des Landesvorstands wesentliche Impulse in der landesweiten Verbandsarbeit gesetzt.
Bis zuletzt stand er an seinem neuen Wohnort der Kreisgruppe RottalInn mit seinem Fachwissen zur Seite.

Sprachen über die Zukunft des Waldes in Bayern: (vo.li.) Götz Freiherr von Rotenhan, WBVPräsidiumsmitglied, Franziskus Freiherr von Gumppenberg, WBVVizepräsident, WBVPräsident Bernhard Breitsameter, BNVorsitzender Richard Mergner und Hans Kornprobst, Sprecher des BNArbeitskreises Wald
waldbesitzer*innen im Freistaat. WBVPräsident Bernhard Breitsameter und weitere Mitglieder des Präsidiums kamen in München mit dem BNVorsitzenden Richard Mergner und Hans Kornprobst, dem Sprecher des BNArbeitskreises Wald, zu einem Gespräch zusammen.
Der Wald in Bayern bereitet den Fachleuten Soge, denn die Klimakrise macht ihm schwer zu schaffen. Ein zentrales gemeinsames Anliegen ist es, den Wald in Bayern so umzubauen, dass er künftigen Belastungen durch Extremwetterereignisse wie Starkregen und Dürre sowie steigenden Temperaturen besser standhält. Möglich ist dies nur, auch darin waren sich beide Seiten einig, wenn der vielerorts stark überhöhte Wildbestand besser reguliert wird, so dass nachwachsende Bäumchen nicht mehr verbissen werden, sondern ohne Zaun und Plastikummantelung heranwachsen können.
Familie Babel aus Pfronten, die mit der 2,2 Hektar großen Bergwiese »Hößles Geschön« den ersten Preis gewonnen hat
Der BUND Naturschutz wirbt stets um Verständnis und Sympathie für den Biber und klärt über seine Bedeutung für den natürlichen Hochwasserschutz auf. Im Sommer gab es dafür eine gute Gelegenheit.
BNVorsitzender Richard Mergner und der Ehrenvorsitzende Hubert Weiger begleiteten die Intendantin des Bayerischen Rundfunks, Katja Wildermuth, bei einer Exkursion. Sie informierten über die Arbeit des »Baumeisters am Wasser«. Durch die Anstauungen, die der Biber erzeugt, schafft er ein Mosaik verschiedener Lebensräume für viele Arten. Zudem leistet er einen wertvollen Beitrag, um Wasser in der Fläche zu halten – ein hervorragender natürlicher Hochwasserschutz!
Katja Wildermuth, seit 2021 Intendantin des BR, trägt die Verantwortung für den gesamten Betrieb und die Programmgestaltung des Bayerischen Rundfunks.

Für eine echte Transformation hin zur Nachhaltigkeit müssen soziale und ökologische Aspekte zusammen gedacht werden. Der BUND Naturschutz steht deshalb in regelmäßigem Austausch mit Sozialverbänden und Gewerkschaften. Zuletzt traf der BNLandesvorsitzende Richard Mergner den Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Bayern, Bernhard Stiedl (im Bild rechts), um gemeinsame Anliegen zu thematisie

Artenreiches Grünland ist für die Erhaltung vieler selten gewordener Wiesenpflanzen und Insekten von enormer Bedeutung. Bei der Wiesenmeisterschaft werden bereits seit 2009 besonders engagierte Bäuerinnen und Bauern für den Erhalt und die Bewirtschaftung artenreicher Wiesen und Weiden ausgezeichnet. In diesem Jahr fand die Wiesenmeisterschaft im Ostallgäu statt.
Bei einer Festveranstaltung in Kaufbeuren wurden 28 Betriebe für ihre vorbildliche artenreiche Wiese von Stephan Sedlmayer, dem Präsidenten der Bayerischen Lan
desanstalt für Landwirtschaft (LfL), und Richard Mergner, dem Vorsitzenden des BUND Naturschutz in Bayern (BN), ausgezeichnet.
Den ersten Platz erzielte Familie Babel aus Pfronten. Die junge Landwirtsfamilie betreibt Milchviehhaltung im Nebenerwerb. Der 28 Hektar große BioBetrieb bewirtschaftet ausschließlich Grünland. Die prämierte, rund 2,2 Hektar große Bergwiese »Hößles Geschön« der Familie Babel überzeugte die Jury vor allem durch die große Artenvielfalt mit über 60 Blütenpflanzen in steiler Hanglage.
ren. Einig waren sich die beiden Vorsitzenden darin, dass die Zeit, in der Umweltschutzbemühungen mit ökonomischen Scheinargumenten abgeschmettert wurden, endgültig vorbei sein müsse.
Bernhard Stiedl betonte: »Wir setzen uns für eine zukunftsfähige Gesellschaft ein, in der Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit Hand in Hand gehen.«


Der BUND Naturschutz ehrte Alfons Leitenbacher, den ehemaligen Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Traunstein, mit der Karl Gayer-Medaille.
Alfons Leitenbacher wird für sein langjähriges und herausragendes Engagement für eine naturgemäße Waldwirtschaft und
vor allem für eine Waldverjüngung durch eine waldgerechte Jagd ausgezeichnet. »Eine gemischte Waldverjüngung, die flächig ohne Zaunschutz hochwächst, ist der beste Hochwasserrückhalt, der beste Boden, Lawinen und Erosionsschutz«, betonte BNLandesvorsitzender Richard Mergner. Obwohl dieses Ziel als Gesetzes

Naturgemäße Landwirtschaft war für den BN schon immer ein zentrales Anliegen. Mit einem verstärkten Team will der Verband das Agrar- und Gentechnikthema noch mehr in den Fokus nehmen. Mit zwei Neubesetzungen hat der BN dafür die idealen Voraussetzungen geschaffen. Rita Rott ist seit Oktober als Landwirtschaftsreferentin mit dabei. Die bis
Ein kompetentes Dreiergespann kümmert sich im BN um den Bereich Landwirtschaft: (vo. li.) Harald Ulmer, Swantje Lüdinghaus und Rita Rott.
herige Regionalreferentin für Niederbayern bringt dafür sowohl praktische Erfahrung als auch theoretisches Wissen mit: Sie stammt aus einem landwirtschaftlichen Betrieb im Landkreis Mühldorf am Inn und hat in Bayreuth Geoökologie studiert mit den Schwerpunkten Agrarökologie und Bodenökologie. Mit ihrem Mann betreibt sie im Landkreis Er
Alfons Leitenbacher (3. vo. li.) wurde die Auszeichnung vom BNEhrenvorsitzenden Hubert Weiger, der stellvertretenden BNVorsitzenden Beate Rutkowski und dem BN-Vorsitzenden Richard Mergner (vo. li.) überreicht.
auftrag klar formuliert ist, wird es seit vielen Jahren in halb Bayern verfehlt. Vielerorts ist das Verhältnis Wald zu Wild nicht im Gleichgewicht, weil zu viele Rehe die nachwachsenden Bäumchen auffressen.
Leitenbacher war am Forstministerium unter anderem persönlicher Referent der Forstminister Hans Maurer und Reinhold Bocklet und Leiter des Referats für Privatund Körperschaftswald. Er leitete die Forstämter Siegsdorf und Ruhpolding und bis zu seiner Pensionierung das AELF Traunstein. Leitenbacher bekleidete –teilweise bis heute – zahlreiche Ämter und Ehrenämter, auch als Mitglied im BNLandesarbeitskreis Wald.
Mit der Karl GayerMedaille zeichnet der BUND Naturschutz seit 1977 Forstleute oder Waldbesitzer*innen aus, die sich vorbildlich für naturgemäßen Waldbau eingesetzt haben.
ding einen Ackerbaubetrieb im Nebenerwerb, zertifiziert nach den strengen NaturlandRegeln. De besten Voraussetzungen also für gute Kontakte in den ländlichen Raum und zu Bäuerinnen und Bauern. Aus Niederbayern nimmt sie ein Thema mit, das in den kommenden Jahren viel diskutiert werden wird: Bewässerung. Auch die Wiesenmeisterschaft ist künftig Rita Rotts Aufgabengebiet. Mit dem BUND Naturschutz kam sie übrigens in Kontakt durch den Widerstand gegen die A 94.
Ihr Kollege im Landwirtschaftsreferat Harald Ulmer hat weiterhin die Auswirkungen europäischer Agrarpolitik auf Bayern im Blick und kümmert sich um den Bereich Gentechnik. Swantje Lüdinghaus unterstützt als Fachassistenz tatkräftig die beiden Referent*innen. Sie hat unter anderem in Eberswalde »Ökolandbau und Vermarktung« studiert.


Die Zahl der Artenkenner*innen in Bayern nimmt besorgniserregend ab. Der BN tut etwas dagegen und bildet in Kooperation mit der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege Amphibienfachleute aus.
Diese werden dringend gebraucht, um bei Eingriffen in die Natur Gutachten über vorkommende Arten oder Konzepte für
Schutzmaßnahmen zu erstellen. Auch beim ehrenamtlichen Engagement im Naturschutz sind Fachleute dringend gefragt. Denn ohne tieferes Verständnis für die Ansprüche einer Art schlagen viele Schutzmaßnahmen fehl.
Der diesjährige Kurs beinhaltete OnlineSchulungen sowie Freilandexkursionen mit Übungen zur Bestimmung und Le

Die Kursteilnehmer bei einer Exkursion. Grünfrosch? Grasfrosch? Die neuen Amphibienfachleute wissen die Antwort.
bensraumkenntnis. Alle 23 Teilnehmer*innen haben erfolgreich die »Prüfung zum BANU-Zertifikat Feldherpetologie-Amphibien« absolviert. Als Reaktion auf das große Interesse soll das Angebot ab jetzt jährlich angeboten werden.
www.facebook.com/bundnaturschutz www.instagram.com/bundnaturschutz www.twitter.com/bundnaturschutz www.youtube.com/@bundnaturschutz

Seit 25 Jahren erzeugen und liefern wir Ökoenergie höchster Qualität. Und mit jeder Kilowattstunde Ökostrom und Ökogas von naturstrom fließt ein hoher Förderbeitrag in den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland.
Wechseln Sie jetzt zu Energie mit Zukunft und sichern Sie sich 30 € Zukunftsbonus: www.naturstrom.de/energie24
Klimaschutz beginnt bei uns!“
Zu einer tschechisch-deutschen Kooperation kamen Ende Juli Naturschützer*innen am Grünen Band Bayern-Tschechien zusammen – zum Feiern und zum Schaufeln.
Am »Transboundary DAY for MIRES« betrieben sie gemeinsam aktiven Moorschutz. Um wertvolles Moor im Bayerischen Wald und im tschechischen Nationalpark Šumava zu erhalten und zu entwickeln, haben die Teilnehmer*innen in mühevoller Handarbeit einen alten Grenzgraben so nachgebessert, dass das Wasser in Moor und Landschaft bleibt, statt weiter entzogen zu werden. Der Anstau

führt nun zu einem steigenden Grundwasserspiegel, und die Moorflächen beidseits der Grenze können wieder wachsen. Auf bayerischer Seite liegt das Moor auf einer BNFläche, der »Schweizerbach« bei Mitter firmiansreut.
Ein Sommerfest von »Life for Mires« Ende Juli zeigte die Erfolge des grenzüber greifenden MoorschutzProjekts, in dem der BUND Naturschutz durch das »Grüne Band«Büro Partner ist.


Bayern sähe anders aus, gäbe es den BUND Naturschutz nicht. Viele Landschaften wie der Königssee im Süden, das Hafenlohrtal im Norden oder die Waldnaab-Aue bei Gumpen würden in ihrer jetzigen, ursprünglichen Form nicht mehr existieren. Die Donau wäre in ihrem letzten frei fließenden Abschnitt im Gebiet der Isarmündung schon lange kanalisiert und gestaut, auch den Weltenburger Donaudurchbruch bei Kelheim gäbe es nicht mehr.
In oft Jahre und Jahrzehnte dauernder Arbeit konnte der BN diese Natur und Landschaftsschätze vor der Zerstörung retten. Und es gibt leider weiterhin viel zu tun. Aktuell setzen wir uns beispielsweise am Riedberger Horn für die Bewahrung unserer Alpen ein.
Dies alles kostet nicht nur direkt Geld, sondern erfordert auch eine politische und finanzielle Unabhängigkeit des BUND Naturschutz. Ein Garant für diese Unabhängigkeit sind Ihre Mitgliedsbeiträge.
Die Höhe dieser Beiträge konnten wir die letzten sieben Jahre trotz verschiedener Kostensteigerungen stabil halten. Jetzt kommen wir aber nicht mehr umhin, sie entsprechend anzupassen.
Bitte bleiben Sie auch bei einem Beitrag von nun 72 Euro pro Jahr für eine Einzelmitgliedschaft an der Seite der Natur, als Mitglied im BUND Naturschutz.
Wir danken Ihnen dafür von Herzen. Sollten Ihre finanziellen Möglichkeiten dies nicht erlauben, so lassen Sie es uns bitte wissen; wir werden gemeinsam eine Lösung finden, Sie dem BN als Mitglied zu erhalten.
Ihr Peter Rottner, Landesgeschäftsführer
neuer Beitrag Einzelmitgliedschaft ab 72 Euro Familien, (Ehe)Paare ab 84 Euro Ermäßigte Mitgliedschaften ab 24 Euro Gemeinden und Kommunen unverändert Schulen, Vereine, Firmen unverändert BEQUEM PER LASTSCHRIFT ZAHLEN
Sie brauchen sich um nichts zu kümmern – wir erledigen alles für Sie. Wir ziehen die neuen Beiträge ab 2025 über das vorliegende SEPAMandat ein. Die Fälligkeitstermine Ihrer Beiträge bleiben unverändert. Sie erkennen unsere Lastschrift an unserer Gläubiger-Identifikationsnummer DE52 0010 0000 2840 19. Als Mandatsreferenz verwenden wir Ihre Mitgliedsnummer. Sie finden diese Num
mer auch auf Ihrem Adressaufkleber dieser Mitgliederzeitung direkt über Ihrer Anschrift.
Sie nehmen noch nicht am Lastschriftverfahren teil? Das ist schade. Denn eine Rechnungsstellung macht mehr Arbeit, belastet die Umwelt und kostet jedes Mal einen Anteil Ihres Mitgliedsbeitrages. Dieses Geld fehlt dann der Naturschutzarbeit. Wenn Sie am Einzugsverfahren nun gerne teilnehmen möchten, informie
ren Sie bitte die zentrale Mitgliederverwaltung.
Kontakt
Tel. 09 41/2 97 20-65 mitglied@bundnaturschutz.de www.bundnaturschutz.de/mitgliedsdatenaendern
Olaf Bandt übergibt unser Forderungspapier an die Abgeordneten Zoe Mayer (ganz links) und Anke Hennig.
NEUES TIERSCHUTZGESETZ

Foto: Anne Barth
Ende September legte Agrarminister Cem Özdemir dem Bundestag die Novelle des Tierschutzgesetzes vor. Mit dieser ersten Lesung begann die entscheidende Phase für das neue Gesetz. Dazu überreichte unser Vorsitzender Olaf Bandt ein Forderungspapier an die Abgeordneten Anke Hennig/SPD und Zoe Mayer/Grüne. Nachdrücklich machte er damit deutlich, dass der BUND auf ein stärkeres Tierschutzgesetz drängt. Schwach ist der aktuelle Gesetzentwurf besonders mit Blick auf die Qualzucht. Zwar ist es bereits verboten, Tiere so zu züchten, dass sie ein Leben mit Schäden und Schmerzen führen müssen. Doch ist diese Qualzucht bislang ganz bewusst so vage definiert, dass das Verbot nicht durchzusetzen ist. Die in der Novelle erwähnten Merkmale betreffen nun beinahe ausschließlich Haustiere. Gegen die Aufnahme landwirtschaftlicher Nutztiere hatte sich besonders die Agrarindustrie gewehrt. Dabei bricht heute bei bis zu 90 Prozent der Legehennen das Brustbein, und manche Rinder können nicht einmal mehr selbstständig gebären.
Nachgebessert werden muss zudem beim Verbot, regelmäßig Körperteile abzuschneiden – seien es die Schnäbel von Geflügel, die Hörner von Rindern oder die Schwänze von Schweinen. Letzteres ist seit mehr als 30 Jahren europaweit verboten und wird in Deutschland ebenfalls nicht geahndet. Außerdem fordert der BUND, die noch über eine Million Rinder in Anbindehaltung spätestens in zehn Jahren von ihrem traurigen Los zu befreien.
Sie möchten in Sachen Umwelt und Naturschutz immer auf dem Laufenden sein? Dann ist unser Newsletter genau das Richtige für Sie. Wir informieren über aktuelle Themen, Aktionen und Termine. www.bund-naturschutz.de/newsletter
Läuft alles wie geplant, wird das Gesetz noch dieses Jahr abschließend beraten und zum 1. Januar 2025 in Kraft treten. Der BUND bleibt hier dran, damit das neue Gesetz seinen Namen verdient.
Patrick Müller


privat

Ludwig Wiedenhofer besitzt selten gewordenes Wissen. Wenn er die Sense ansetzt, hört man das sanfte »Swisch … swisch … swisch«, ein rhythmisches Geräusch, wenn die scharfe Klinge durch das Gras gleitet. »Offenbar«, sagt er bescheiden, »kann ich das richtige Sensen auch anderen erklären.« Der 75-jährige strahlt Ruhe und Geduld aus, und eine natürliche Autorität. Das liegt vielleicht an den vielen Dienstjahren, die er als Polizist im gehobenen Dienst in NürnbergErlenstegen verbracht hat. Dass der Sensenschwung bei ihm so leicht aussieht, hat mit seiner Kindheit zu tun. Schon mit 14 wusste Wiedenhofer, wie man das scharfe Gerät führt. Er ist aufgewachsen auf einem kleinen Hof nahe Regensburg und musste mit anpacken. Das Leben auf dem Hof, umgeben von Tieren, prägt ihn bis heute. In guter Erinnerung ist ihm der nahe Bach von damals, an dem er Forellen fing – natürlich ohne Angelschein. »Erst als ich bei der Polizei war, fragte ich mich, wem eigentlich die Fischereirechte gehörten«, lacht er. »Ist aber alles verjährt.«
»Sind
So wird Ludwig Wiedenhofer von der BN-Kreisgruppe Nürnberg-Stadt oft begrüßt. Ein gutes Dutzend Lernwillige erwartet ihn dann meist auf einer Wiese, bereit, von einem Meister seines Faches zu lernen.
In den 70er Jahren trat er dem BUND Naturschutz bei, aktiv wurde er aber erst um 2000. Damals half er bei einer BiotoppflegeAktion, bei der die Teilnehmer mehr die Luft als das Gras mähten. Er gab ein paar Tipps – und schon bat man ihn, einen Kurs zu leiten. Der Start für eine Tätigkeit, mit der Wiedenhofer seit 20 Jahren bayernweit gefragt ist. Im Sommer gibt er fast jedes Wochenende Kurse, oft für Naturschutz oder Heimatvereine. Zwei Drittel seiner Teilnehmerschaft sind Frauen. »Sensen erfordert Geschick, nicht Kraft«, erklärt er. Anfangs sollte nach drei Stunden Schluss sein, um Blasen zu vermeiden.
Der Sensenschnitt hat viele ökologische Vorteile. Tiere, die sich im Gras verstecken, können der langsamen Klinge entkommen, und der Boden bleibt unverdichtet. »Die Wiese sieht zwar nicht aus wie ein Golfrasen, aber viel natürlicher und schöner«, betont Wiedenhofer. Nach der Arbeit endet die Biotoppflege oft mit einer geselligen Brotzeit. Dass er unter den Leuten »der Sensemann« ist, daran hat er sich längst gewöhnt.
Seit 15 Jahren organisiert die BNKreisgruppe Nürnberg Stadt zudem den »Umweltaktionstag der Religionen«, bei dem Einheimische und Migrant*innen sich bei der Mahd begegnen. »Da kommen 50 bis 70 Leute, darunter viele Familien mit Kindern – Protestanten, Katholiken und Muslime.« Auch hier zeigt Wiedenhofer das Sensen. Aber hier lässt er das Schärfen vorher sein. »Die jungen Burschen schlagen manchmal in den Boden und treffen Steine, da fliegen Funken«, lacht er. Aber es seien immer gelungene Tage des Miteinanders. Kinder können Tiere wie Esel, Schafe oder Ziegen, die zum Weiden geholt werden, streicheln. »Manche haben so ein Tier noch nie berührt und gehen förmlich dabei auf.«
Besonders viel Freude bereitet es ihm, wenn er Kindern das Tierbeobachtungshaus der Kreisgruppe zeigt. Das Holzhaus am Metthingweiher mit den eingebauten Nistkästen ermöglicht es, Vögel beim Nisten und Füttern aus nächster Nähe zu beobachten, ohne sie zu stören. »Da werden auch quirlige Kinder ganz still«, sagt Wiedenhofer. Margarete Moulin
Anfang des Jahres hatte Cem Özdemirs Fischereiministerium erneut das Fischen mit Grundschleppnetzen erlaubt, und das selbst in deutschen Meeresschutzgebieten wie der Doggerbank. Dabei durchpflügen solche Schleppnetze den Meeresboden und verwüsten alles Leben. Gegen diese Zerstörung hatte der BUND Widerspruch eingelegt.
Unseren Widerspruch hat eine Behörde des Ministeriums nun zurückgewiesen. Der BUND wird deshalb Klage erheben, damit die Grundschleppnetze endgültig aus den Schutzgebieten verbannt werden. Die Zeit drängt. Aktuell wird bereits die Fangerlaubnis für 2025 erarbeitet.
Der Schutz der Meeresvielfalt ist ein globales Ziel. Um dem Artensterben im Meer entgegenzuwirken, sollen 30 Prozent des Meeres unter Schutz gestellt werden. Ein zentrales Instrument hierfür ist die Einrichtung von Schutzgebieten. Die deutsche Meeresfläche steht zwar offiziell schon zu 45 Prozent unter Schutz. Doch solange selbst hier Grundschleppnetze erlaubt sind, existiert dieser Schutz einzig auf dem Papier.

Schneise der Verwüstung: Wo ein Schleppnetz über den Grund gezogen wird, wächst nichts mehr.

Länder wie Schweden oder Griechenland haben bereits angekündigt, diese Form der Fischerei gänzlich aus ihren Schutzgebieten zu verbannen. Mit unserer Klage wollen wir gleiches auch in der deutschen Nord und Ostsee erreichen. Den nun eingeschlagenen Rechtsweg beschreitet der BUND übrigens nicht allein.

Jahr für Jahr gut besucht sind die Naturschutztage in Radolfzell am Bodensee.
Vom 3. bis zum 6. Januar 2025 finden im Milchwerk in Radolfzell die 48. Naturschutztage am Bodensee statt. Mit über tausend Gästen ist dies das größte jedes Jahr stattfindende Naturschutztreffen im deutschsprachigen Raum, veranstaltet gemeinsam von BUND und NABU.
In den Niederlanden, in Frankreich und in Spanien führen Partnerverbände vergleichbare Verfahren, um marine Schutzgebiete zu bewahren. Isabelle Maus
Freuen Sie sich auf vier Tage voller spannender Vorträge, auf abwechslungsreiche Exkursionen und viele Workshops und Gespräche. Das Programm verheißt einen rundum lohnenden Auftakt des neuen Jahres – mit Kabarett, Film und Vernetzungstreffen, Infoständen und reichlich Gelegenheit zum Austausch unter Gleichgesinnten.
Lassen Sie sich zu Beginn mit auf eine Reise in die Welt von morgen nehmen und über die nötige Reform der Naturschutzverwaltung informieren. Am zweiten Tag hören Sie Vorträge zu Weidetieren und Artenvielfalt oder dem Baumeister Biber.
Beim Tagesmotto »Klimaschutz« am dritten Tag wird es um zukunftsfähige Mobilität, um Baukultur und das Thema Wasserstoff gehen. Der Schlusstag steht im Zeichen erfolgreicher Projekte und attraktiver Natur und Kulturlandschaften. Hier stellen wir das BUNDProjekt »Wildkatzenwälder von morgen« vor. Und Ruedi Haller, der Direktor des Schweizerischen Nationalparks, gewährt einen Einblick in 111 Jahre Naturschutz im Engadin.
Mehr zum Thema Informationen und Anmeldung: www.naturschutztage.de www.bund.net/ meeresschutzgebiete
In den 70er Jahren wurden viele BN-Kreisgruppen gegründet. Viel Zuwachs gab es 1973 und 1974. Deshalb hatten und haben derzeit viele Kreisgruppen Grund, dieses schöne Jubiläum zu feiern (wir berichteten). Hier weitere Feste aus ganz Bayern.

Cham: Zu einem Fest mit buntem Programm für Jung und Alt in der Klostermühle Altenmarkt hatte die Kreisgruppe Cham eingeladen. BNVorsitzender Richard Mergner, Landrat Franz Löffler und Kreisgruppenvorsitzender Robert Kurzmann pflanzten mit weiteren Ehrengästen eine Esskastanie, die gut mit den steigenden Temperaturen zurechtkommt.
Fürth-Stadt:
Das Jubiläumsfest der Kreisgruppe fand im BUNDNaturschutzGarten im Pegnitztal statt. Der Fürther Vorsitzende Reinhard Scheuerlein gab einen Rückblick in die Geschichte der Kreisgruppe. Für ein halbes Jahrhundert Engagement bedankte sich der Landesvorsitzende Richard Mergner und überreichte als Geschenk einen Plüschbiber.


Regen: Mit einem Frühschoppen und der Ehrung langjähriger Mitglieder startete die Kreisgruppe um den Vorsitzenden Roland Schwab, vertreten durch Eva Molz (im Bild), in ihre Jubiläumsfeier. Danach war ein buntes Programm geboten, zu dem auch befreundete Verbände eingeladen waren.

Neumarkt: Ein großes Event zum Jubiläum bot die Kreisgruppe Neumarkt mit Vorsitzendem Josef Guttenberger. Landrat Willibald Gailler und Stadtrat Werner Thumann in Vertretung für Oberbürgermeister Markus Ochsenkühn sowie BNLandesvorsitzender und der BNLandesbeauftragte Martin Geilhufe waren gekommen. Als Überraschung hatten Sigrid Schindler und Mechthild März mit Kindern aus Sengenthal und Umgebung eine »Umweltmodenschau« (im Bild) organisiert.
Neu-Ulm: Applaus für ein halbes Jahrhundert Engagement für die Natur gab es von der stellvertretenden Landesvorsitzenden Beate Rutkowksi. Sie hatte zur Jubiläumsfeier der Kreisgruppe NeuUlm ein Geschenk und ein »50 Jahre«Schild mitgebracht, das Kreisvorsitzender Wolfgang Döring in Empfang nahm.


Wie hier bei Beuren überprüften BNAktive vor Ort alle Trassenvarianten auf ihre ökologischen Auswirkungen hin.

KREISGRUPPEN AUGSBURG, GÜNZBURG UND NEU-ULM
Nach langer Planung ist es entschieden: Die künftige Bahnstrecke Ulm – Augsburg wird auf der naturschonenden Wunschtrasse des BUND Naturschutz gebaut.
Ende Juni hatte die Deutsche Bahn die Trassenführung bekannt gegeben: Im Landkreis Neu-Ulm auf der bestehenden Strecke und in den Landkreisen Günzburg und Augsburg auf einer neuen Trasse entlang der A 8. Für diese Variante hatten sich die drei betroffenen BNKreisgruppen über Jahre eingesetzt.
Die Strecke zwischen Ulm und Augsburg ist eine der zentralen Bahnachsen in Bayern, aber bislang nicht für schnelle Fernzüge geeignet. Weil sich Güter, Fern und Regionalverkehr die bestehenden zwei Gleise teilen müssen, ist sie chronisch überlastet und es kommt zu Verspätungen. Für den nötigen Aus und Neubau der Strecke waren zuletzt noch vier Trassenvarianten in der Prüfung.
Auch wenn der BN noch Verbesserungsvorschläge im Detail hat: Die jetzt
ausgewählte Variante reduziert den Flächenverbrauch und Eingriffe in die Schutzgebiete. So bleiben das Pfuhler Ried im Landkreis NeuUlm und das nach der FloraFaunaHabitatRichtlinie geschützte Gebiet Schmuttertal unangetastet. Das Naturschutzgebiet Donauauen im Landkreis Günzburg, durch das die Bestandstrasse läuft, wird durch die Trassenführung an der Autobahn weitgehend verschont.
Die Deutsche Bahn hat Bedenken und Anregungen von Politik, Verbänden und Bevölkerung ernst genommen und sich um eine verträgliche Lösung bemüht. Eine solche ergebnisoffene Vorgehensweise wäre auch bei anderen Verkehrsprojekten, insbesondere im Straßenbau, zu wünschen.
Thomas Frey (as)
NEUE GRUPPE: Sechs Ortsgruppen hatte die Kreisgruppe KemptenOberallgäu bislang, doch ausgerechnet in Kempten selbst gab es keine. Dies hat sich nun geändert – seit dem am 18. Juli hat Kempten, die zweitgrößte Stadt des Regierungsbezirks Schwaben, wieder eine eigene BNOrtsgruppe. Bei der Gründungsversammlung wurden Regina Volpert und Julia Allweiler zu den Vorsitzenden gewählt. Die neuen BNAktiven wollen sich unter anderem für Verkehrsberuhigung, Solardächer und mehr Grün in der Stadt einsetzen und sich um konkrete Maßnahmen für den Klimaschutz kümmern. Auch eine Kindergruppe soll ins Leben gerufen werden. Mitwirkende sind herzlich willkommen. Kontakt: kempten@bundnaturschutz.de

NEUER WAGEN: Die Kindergruppe »Schlaufüchse« der BNOrtsgruppe KaisheimBuchdorf im Landkreis DonauRies hat seit Juli ein neues Domizil – einen Bauwagen, der am Ortsrand von Buchdorf auf einem Grundstück der Gemeinde steht. Neben dem Stellplatz unterstützte die Gemeinde auch die Anschaffung des Bauwagens, indem sie die Hälfte des Kaufpreises übernahm; der Rest wurde durch Spenden finanziert. Ihr neues Zuhause präsentierten die jungen BNAktiven unter der Leitung von Claudia WiehlerBuß und Karin Mayer Ende Juli der Bevölkerung und dem Gemeinderat.
IHR ANSPRECHPARTNER
Schwaben: Thomas Frey Tel. 0 89/54 82 98-64 thomas.frey@bundnaturschutz.de
Noch Monate nach der Katastrophe treten die massiven Ablagerungen im geschädigten Flusslauf als Schlammbänke zu Tage.

KREISGRUPPE
Die Pfreimd war ein Naturparadies, bis eine Schlammflut aus der Kainzmühl-Talsperre
dem Fluss fast den Garaus machte. Abhilfe ist bislang nicht in Sicht.
Wegen Bauarbeiten an der Talsperre hatte die Betreiberfirma im März das Wasser aus dem Staubecken abgelassen. Dadurch gelangten gewaltige Mengen Schlamm in den als FFH-Gebiet geschützten Fluss und schädigten massiv die Gewässerfauna. Bei Ortsterminen im Juli und im September forderte der BN eine umgehende ökologische Sanierung. Auf 12 Kilometern hat die braune Flut die Laichplätze von Fischen und die Lebensgrundlage nahezu aller Gewässerlebewesen in einem intakten Flussbett zerstört. Weil diese im Frühjahr plötzlich in der Nahrungskette fehlten, gingen die Bestände an Wasservögeln zurück. So brach beispielsweise der Bestand der Wasseramsel an der Pfreimd fast vollständig ein.
Wo zuvor klares Wasser über Kies und Sand floss, bedeckt jetzt noch immer eine bis zu einem Meter dicke Schlamm
schicht fast flächendeckend das Flussbett und die Ufer. Trotz einiger Hochwässer, die den Fluss nach Angaben der Betreiber wieder freispülen sollten, hatte sich daran bis zum Pressetermin Ende September nicht viel geändert.
Vor Ort zeigten sich Naturschützer*innen und Ortskundige entsetzt angesichts der Schäden. Sie forderten von Landratsamt und Betreiber, den Vorfall endlich ernst zu nehmen und den natürlichen Zustand der Pfreimd schnellstmöglich wiederherzustellen.
Der BUND Naturschutz kritisiert zudem, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung für die Bauarbeiten an der Talsperre das Risiko einer Schlammflut offenbar unterschätzt hat, weshalb keine adäquaten Schutzmaßnahmen vorgesehen wurden.
Reinhard Scheuerlein (as)
FALSCHES SIGNAL: In Regensburg soll für 18 Millionen Euro ein zentrales »MegaParkhaus« am Unteren Wöhrd entstehen – obwohl die Stadt bereits jetzt unter Hitzestress durch versiegelte Flächen und fehlendes Grün leidet. Diese Kritik der BNKreisgruppe wurde Anfang August auch von der Deutschen Umwelthilfe bestätigt. Demnach ist Regensburg »HitzeHauptstadt« Bayerns. Das geplante Parkhaus wäre ein weiterer Schritt in die falsche Richtung, findet nicht nur der BN: Im Juli protestierten rund 200 Menschen aus Natur und Klimaschutzgruppen gegen das Vorhaben. Dabei rief BNKreisvorsitzender Raimund Schoberer die Stadt zum Umdenken bei diesem und weiteren Bauprojekten auf.

RODUNG IN RODING: 6,6 Hektar Kirchenwald sollen der geplanten Erweiterung des Industriegebiets in RodingOberkreith im Landkreis Cham zum Opfer fallen. Gegen das Vorhaben hat die neue BNOrtsgruppe Ende August eine Unterschriftenaktion für ein Bürgerbegehren gestartet. Dafür müssen neun Prozent der 12 000 Gemeindebürger*innen unterschreiben. Neben dieser Herausforderung will sich die erst Ende April gegründete Ortsgruppe »Roding und Umgebung« um Vorsitzenden Konrad Höcherl und Stellvertreter Willi Dirnberger auch um die ökologische Aufwertung kommunaler Ausgleichsflächen bemühen.
IHR ANSPRECHPARTNER
Oberpfalz: Reinhard Scheuerlein Tel. 09 11/8 18 78-13 reinhard.scheuerlein@ bundnaturschutz.de
Dreist: Der Großteil eines Hanges wurde für den Schwarzbau in Oberreuth abgetragen.

KREISGRUPPE LICHTENFELS
In Oberreuth hat ausgerechnet der Bürgermeister schwarz gebaut – eine private Reitanlage auf seinem Grundstück. Die Kreisgruppe Lichtenfels des BUND Naturschutz führt den Protest dagegen seit über einem Jahr an.
Bei einer Kundgebung des BN Ende Juli in Oberreuth protestierten über 50 Menschen gegen die Schwarzbauten und forderten eine Aufarbeitung des Falls: Zwar hatte das Landratsamt schon 2023 auf Rückbau entschieden, doch dagegen klagt Bürgermeister Jochen Weber. Bis zur Entscheidung steht die Anlage weiter. Im Februar 2023 wurde bekannt, dass Weber auf seinem Grundstück unter anderem einen Reitplatz, ein Heulager, Zäune, eine Stützmauer sowie einen Vorplatz errichtet und große Teile des Hangs abgetragen hat – alles ohne Genehmigung.
Der Versuch, die nicht genehmigungsfähige private Anlage nachträglich zu legalisieren, scheiterte am einstimmigen Votum des Gemeinderates. Nach massivem Protest des BN und der Bevölkerung
entschied das Landratsamt im September 2023, dass Weber zurückbauen und ein Renaturierungskonzept vorlegen muss. Dagegen legte dieser Anfang 2024 vor dem Verwaltungsgericht Bayreuth Klage ein. Ein Verhandlungstermin war bis Redaktionsschluss noch nicht festgesetzt.
Für den BN muss angesichts des dramatischen Flächenverbrauchs in Bayern die kommunale Ebene mit gutem Beispiel vorangehen und die Naturschutznormen des Baugesetzbuchs einhalten. »Als Bauunternehmer müsste Herr Weber diese eigentlich kennen«, so BNKreisvorsitzender Anton Reinhardt. Dass es sich in Oberreuth nicht um das Fehlverhalten einer Privatperson, sondern des Bürgermeisters handelt, gibt dem Fall besondere Brisanz. Jörg Hacker (as)
INSEGDA: Dieses Projekt soll die Insektenfauna im Eger und Röslautal fördern. Als Teil des Bundesprogramms »Biologische Vielfalt« entwickelt es im Landkreis Wunsiedel Konzepte für eine insektenfreundliche Bewirtschaftung, wie extensive Beweidung, Mahdkonzepte und naturnahe Gewässerläufe. So sollen die Auen als Lebensraum für an sie gebundene Insektenarten erhalten bleiben. Die Kreisgruppe Wunsiedel unterstützt das Projekt fachlich und bietet unter Leitung des Insektenexperten Jürgen Fischer Exkursio nen im Projektgebiet an, zuletzt Ende Juli an den Höllbach bei Rös lau. Dort siedeln viele typische Insektenarten, darunter Azurjungfer, Dukatenfalter und Sumpfschrecke (siehe Bild).
Weitere Informationen: www.insegda.de


NACHRUF: Nach schwerer Krankheit starb Martin Bücker am 17. September im Alter von 66 Jahren. Der studierte Biologe war von 2018 bis 2022 Vorsitzender der BNKreisgruppe Bamberg sowie Mitglied im städtischen Naturschutzbeirat und über Jahrzehnte im Umweltschutz engagiert. Beim BN galt seine besondere Aufmerksamkeit den Insekten, insbesondere Käfern und Schmetterlingen. Seine Expertise brachte er bei der Erstellung der Roten Liste Bayerns und der Stadtbiotopkartierung ein. Er setzte sich ein für die Ausweisung des Hauptsmoorwalds als Nationales Naturerbe und unterstützte das Volksbegehren Artenvielfalt und die Klimaschutzbewegung. Seine kompetente, freundliche und humorvolle Art wird in Erinnerung bleiben.
IHR ANSPRECHPARTNER
Oberfranken: Jörg Hacker Tel. 01 60/7 92 02 67 joerg.hacker@bundnaturschutz.de
BNVorsitzender Richard Mergner, Ehrenvorsitzender Hubert Weiger und Regionalreferentin Annemarie Räder mit Mitgliedern des Eichstätter Kreisvorstands

KREISGRUPPE EICHSTÄTT
Ende September beging die Kreisgruppe
Eichstätt des BUND Naturschutz ihr 100-jähriges Bestehen. Ohne den BN würde der Landkreis heute anders aussehen.
Bei der Jubiläumsfeier im Alten Stadttheater lobte BN-Landesvorsitzender Richard Mergner das breite Engagement der Kreisgruppe im Naturschutz und zu umweltpolitischen Themen wie Landwirtschaft, Energiewende und Moorerhalt. Ein solcher Jahrestag ist auch im BN alles andere als selbstverständlich: Bereits 1924 als vierte lokale Gruppierung in Bayern gegründet, wurde die Kreisgruppe durch den Biologen, Priester und Hochschulprofessor Franz Xaver Mayr fast 50

Jahre lang geprägt. Unter seiner Leitung kaufte der BN in den 1960er Jahren wichtige Landschaften wie eine Orchideenwiese im Schambachtal, ein großes Grundstück in der Arnsberger Leite und eine Feuchtwiese im Schuttermoos, um sie zu schützen. Mayr war zudem Mitbegründer des JuraMuseums in Eichstätt. Nach seinem Tod 1972 folgten als Vorsitzende Günter Viohl und Friedrich Meierhuber; seit 1987 hat Johann Beck den Vorsitz inne. In seiner Laudation würdigte der BNEhrenvorsitzende Hubert Weiger Mayrs ganzheitlichen Einsatz und die historische Bedeutung der Kreisgruppe für den Naturschutz in Bayern. Johann Beck präsentierte die Erfolge des Eichstätter BN aus jüngerer Zeit in einer Fotopräsentation und ging besonders auf das umfangreiche Exkursionsprogramm der Kreisgruppe ein.
Annemarie Räder (as)
NACHRUF: Völlig überraschend ist Dr. Karin Krause im September durch einen tragischen Unfall ums Leben gekommen. Sie war Mitglied des Vorstandes der Kreisgruppe Landsberg am Lech des BN und Sprecherin des BNLandesarbeitskreises Flächenschutz. Nach ihrem Einsatz 2021 gegen die geplante Ansiedlung des Chipherstellers Intel in Penzberg brachte sie sich im BN mit riesigem Engagement unter anderem bei Wahlbefragungen, im Flächenschutz und zuletzt gegen die bei Reichling geplanten Gasbohrungen ein. Durch ihre sachli che und fundierte Art hat Karin Krause die Kreisgruppe maßgeblich vorangebracht. Sie wird dem BN fachlich wie menschlich sehr fehlen.

ERFREULICH: Gute Nachrichten kommen aus dem Landkreis Miesbach, wo am 9. Oktober die Ortsgruppe Schlierachtal wiederbelebt wurde. Zwar gab es die Gruppe schon seit 1990, doch mangels Kandidat*innen war sie in den letzten Jahren ohne Ortsvorstand. Daher hatte Waltraud Holzfurtner als Sprecherin der Ortsgruppe fungiert. Nach der Auseinandersetzung um ein gigantisches Hotelprojekt direkt am Schliersee, das bei einem Bürgerentscheid abgelehnt worden war, fanden sich nun wieder genügend Aktive, um die BNOrtsgruppe mit einem ordnungsgemäßen Vorstand zu komplettieren. Als Vorsitzender gewählt wurde Alfons Rauch, zum Stellvertreter Gerhard Waas, Waltraut Holzfurtner als Schatzmeisterin und Gaby Schneider und Anneliese Blümel als Beisitzerinnen.
ANSPRECHPARTNERINNEN
Oberbayern: Annemarie Räder Tel. 01 70/4 04 27 97 annemarie.raeder@bundnaturschutz.de Julika Schreiber (Region München) Tel. 01 70/3 58 18 70 julika.schreiber@bundnaturschutz.de

KREISGRUPPE DEGGENDORF
Für ihr Engagement im Donauschutz erhielt die Kreisgruppe Deggendorf des BUND Naturschutz
Ende Juni den international ausgeschriebenen Stiftungspreis »Lebendige Donau«.
Die mit 15 000 Euro dotierte Auszeichnung der Stiftung »Naturerbe Donau« ging zu gleichen Teilen nach Deggendorf und an den bulgarischen Persina Nationalpark. Die BN-Kreisgruppe Regensburg und der Verein Pure Water erhielten Anerkennungspreise.
Bei der Preisverleihung Ende Juni im Auenzentrum auf Schloss Grünau in Neuburg würdigte Ministerialrätin Ulrike Lorenz vom Bayerischen Umweltministerium das Engagement der Deggendorfer BNAktiven für den Erhalt der frei fließenden Donau und lobte den hohen Fachverstand und die planerische Kompetenz der Kreisgruppe.
Über mehrere Jahrzehnte hatte diese, gemeinsam mit anderen Kreisgruppen, dem Landesverband und weiteren Verbänden und Initiativen für eine frei fließende Donau zwischen Straubing und Vilshofen gekämpft – letztlich mit Erfolg:
Das Bündnis erreichte eine neue politische Entscheidung und der Donau blieben dort neue Staustufen und eine Kanalisierung erspart. Davon profitierte zunächst die Region, in der das Bewusstsein für die Qualität der Landschaft gewachsen ist. Doch die Entscheidung stellte letztlich auch die Weichen für mehr Schutz der gesamten europäischen Donau – als Lebensader für Tiere, Pflanzen und Menschen.
Der Preis »Lebendige Donau« wird alle zwei Jahre von der Stiftung »Naturerbe Donau« vergeben. Diese wurde von Dr. Maja Gräfin Du Moulin Eckart und ihrem Mann Dieter Graf von Brühl gegründet, um Projekte zu unterstützen, die die natürlichen Funktionen der Donau und ihrer Auen erhalten und deren biologische Vielfalt sichern.
Rita Rott (as)
IN SORGE: Seit August sind die Aktiven der BN-Kreisgruppe Dingolfing-Landau besorgt um Brachvogel, Kiebitz und Co. An der ohnehin verbauten Autobahn A 92 will die Gemeinde Gottfrieding im Königsauer Moos ein weiteres Gewerbe und Industriegebiet bauen. Das Projekt bedroht den Lebensraum der seltenen Vogelarten. Lärm, Verkehr und nächtliche Beleuchtung werden die empfindlichen Bodenbrüter stören, fürchtet der BN. Damit die Natur eine Chance hat, sollte daher auf der Südseite der Autobahn ein 300 Meter breiter Korridor frei von Bebauung bleiben.

ERFOLG: Ende Juli besichtigten die BNOr tsgruppen Holledauer Eck, Landshut und Altdorf den renaturierten Bachlauf der Pfettrach bei Weihmichl. Zusammen mit Planerin Beatrice Schötz und Bürgermeister HansPeter Deifel machten sie sich ein Bild vom Erfolg der Renaturierung und naturnahen Hochwasserschutzmaßnahmen: So wurde für mehr Wasserrückhalt das Bachbett ausgehoben und Kies für Laichplätze und Jungfische eingebracht. Zudem wurden Auen aufgewertet, flache Uferbereiche angelegt und der Bachlauf um 80 Meter verlängert. Mit Erfolg: Die seltene WalzenSegge und das Sparrige Torfmoos, bislang an der Pfettrach unbekannt, finden sich jetzt ebenso wie BlauflügelPrachtlibellen (siehe Bild).

IHRE ANSPRECHPARTNERIN
Niederbayern: Rita Rott Tel. 0 89/54 83 01 12 rita.rott@bundnaturschutz.de


KREISGRUPPE ASCHAFFENBURG
Blitzblauer Himmel und strahlender Sonnenschein lockten am 22. September wieder über 1000 Gäste zum diesjährigen Ökomarkt auf den Aschaffenburger Schlossplatz.
Bereits zum 20. Mal veranstaltete die Kreisgruppe Aschaffenburg des BUND Naturschutz den Markt, unter dem Motto »regional, saisonal, bio & fair«. Vor der imposanten Kulisse des Aschaffenburger Schlosses hatten 45 Firmen und Organisationen ihre Stände aufgebaut. Kreisvorsitzende Dagmar Förster eröffnete den Markt gemeinsam mit Vertreter*innen des BNLandesvorstands und der Politik, darunter Aschaffenburgs Bürgermeisterin Jessica Euler und Landrat Alexander Legler. Sebastian Schönauer, früherer stellvertretender BNVorsitzender, lobte das Engagement der Kreisgruppe und freute sich über den riesigen Zuspruch der über 1000 Besucher*innen. Anschließend informierte BNGewässer
ökologe Stefan Ossyssek über das Lebensmittel Wasser und den richtigen Umgang damit, gerade in der niederschlagsarmen Mainregion.
Neben Ständen mit ökologischen Produkten und kulinarischen Spezialitäten stellten sich auch viele Vereine und Gruppen aus der Region vor und gaben Anregungen für eine umweltbewusste Lebensweise.
Am BNStand konnte man sich kundig machen, welche Wasserorganismen in heimischen Gewässern vorkommen, und für Kinder gab es ein umfangreiches Programm zum Basteln, Mitmachen und Spielen. Der nächste Ökomarkt ist für September 2025 geplant.
Steffen Jodl (as)
RUHESTAND: Bereits im Mai verabschiedete die Kreisgruppe Kitzingen des BN ihren langjährigen Vorsitzenden Manfred Engelhardt in den wohlverdienten »Ruhestand« und erkor ihn zum Ehrenvorsitzenden. 33 Jahre lang prägte er nicht nur den Natur und Umweltschutz in der Region, sondern engagierte sich auch als Sprecher des Landesbeirates. BNLandesbeauftragter Martin Geilhufe und die stellvertretende Landrätin Doris Paul lobten sein umfassendes und konsequentes Engagement für Natur und Umwelt und bedankten sich für seinen Einsatz. Zu Engelhardts Nachfolger als Vorsitzender wurde der Biologe Johannes Kroiß gewählt.

WASSER UND WEIN: Im Juni tauschte sich der Arbeitskreis Landwirtschaft des BUND vor Ort mit der Bezirksregierung von Unterfranken, der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und dem Würzburger Agenda21Arbeitskreis »Wasser am Limit« aus. Angesichts von Trockenheit und Klimakrise ging es um resilientere Sorten im Gemüsebau und die Frage, wie Weinbau dennoch ohne Bewässerung gelingen kann. Dürre und Starkregen lassen diese in herkömmlich bewirtschafteten Weinbergen erodieren. Gezielte Begrünung dagegen hilft dem Boden Wasser zu speichern und wirkt der Erosion entgegen.
IHR ANSPRECHPARTNER
Unterfranken: Steffen Jodl Tel. 01 60/5 61 13 41 steffen.jodl@bundnaturschutz.de
Die alte Juraleitung, hier bei Wendelstein, soll durch eine neue Trasse ersetzt werden.

KREISGRUPPE NÜRNBERGER LAND
Die 160 Kilometer lange Juraleitung »P53« soll neu gebaut werden, um ihre Kapazität zu erhöhen. Der BUND Naturschutz lehnt die neue Trasse ab.
Damit steht der BN nicht allein: Bei der Veranstaltung »10 Jahre Widerstand« Mitte September in Altdorf bekräftigten über 160 Aktive aus Bürgerinitiativen und Politik ihren Widerstand gegen die geplanten Stromtrassen in Bayern. Sie setzen stattdessen auf eine dezentrale Energiewende.
Der Netzbetreiber Tennet argumentiert, die Spannung müsse von derzeit 220 auf 380 Kilovolt steigen, um ausreichend Kapazität für Strom aus regenerativen Quellen, besonders Windstrom aus Norddeutschland, bereitzustellen. Dem seien die alten Masten nicht gewachsen. Daher ist ein »Ersatzneubau« geplant, im ersten Abschnitt von Raitersaich bis Ludersheim im Landkreis Nürnberger Land. Noch in diesem Jahr will Tennet die Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren einreichen.
Für die nötigen 30 neuen Masten allein im Nürnberger Land müssten mindestens 24 Hektar Wald gerodet werden, plus vier Hektar für das neue Umspannwerk bei Ludersheim – ein massiver Eingriff in den Reichswald. Zudem könnte die neue Leitung das Sechsfache der heutigen Strommenge transportieren, was mehr Belastung durch Elektrosmog für die Anwohner*innen befürchten lässt.
Bis heute gab es weder eine strategische Umweltprüfung, um Alternativen zu prüfen, noch sind Klimaschutz und dezentrale Energiewende in der Planung ein Thema, kritisieren BN und BUND. Auch der Nürnberger Energieversorger NErgie sieht für eine neue Trasse keinen Bedarf.
Tom Konopka und Herbert Barthel (as)
FRANKENSCHNELLWEG: Dieser soll kreuzungsfrei ausgebaut werden – mit geschätzten Kosten von über einer Milliarde Euro. Dagegen kämpfen die BNKreisgruppe NürnbergStadt und Bürgerinitiativen seit 25 Jahren (im Bild eine Protestaktion des BN im September). Nun ist der Rechtsstreit in einer neuen Phase: Im Frühjahr hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Planung für rechtmäßig erklärt. Es wurde keine Revision zugelassen. Dagegen hat der BN Ende August Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht, unter anderem, weil Klimaschutzgesetze im Verfahren nicht beachtet wurden. Mehr Infos auf: www.baulust.de

NACHRUF: Ende August starb Helmut Horneber, ehemaliger Leiter des Forstamts Erlangen, im Alter von 97 Jahren. Er war bis 1999 Mitglied des Naturschutzbeirats der Stadt Erlangen und setzte sich sein Leben lang für den Reichswald ein. Besonders lagen ihm dessen Umbau zum naturnahen Mischwald und die Ausweisung als Bannwald am Herzen. Sein Credo »Die Liebe der Bevölkerung muss den Wald schützen« war ausschlaggebend, den Reichswald für die Bevölkerung zu öffnen. Auch im Ruhestand war Horneber weiter im Waldschutz aktiv. Mit ihm verliert der BN einen streitbaren Verbündeten für den Schutz des Reichswalds.
IHR ANSPRECHPARTNER
Mittelfranken: Tom Konopka Tel. 09 11/8 18 78-24 tom.konopka@bundnaturschutz.de



Ständig neue Klamotten kaufen? Das Projekt
»We Care & Repair« der BUNDjugend stemmt sich gegen den Trend zur Ultra-Fast-Fashion.
So lehrt sie bei Workshops, Kleidungsstücke selbst zu reparieren.
Zu kaufen gibt es nichts am Infostand der BUNDjugend in der Mainzer Innenstadt. Aber viel zu verschenken! Nämlich Klamotten, die noch zu wertvoll sind für den Müll. Deshalb rattern im mobilen Repair-Café auch etliche Nähmaschinen: Was nicht (mehr) passt, wird hier passend gemacht.
Den Riss in der Jeans patchen? Das Loch im LieblingsHoodie stopfen? Oder die ausgefransten Jackenärmel aufhübschen? Ili Großkreutz sitzt an einer Nähmaschine und gibt nebenbei Tipps für andere Reparaturen. Die gelernte Maßschneiderin im Team von »We Care & Repair« ist sichtlich in ihrem Element. »Es ist ein super tolles Gefühl, Dinge selbst flicken zu können.« Wer sich
noch nicht so gut auskennt, den muntert sie auf: »Das kann man lernen!«
Oft sind ja nur kleine Reparaturen nötig, um das Leben eines Kleidungsstückes zu verlängern – vorausgesetzt, es ist ein Qualitätsprodukt und nicht aus billigstem Polyester. Manchmal lassen sich Ressourcen schon ohne Nähmaschine schonen. »Viele Sachen sind einfach zu schade für den Container«, zeigt Denis Biesenbach auf ein paar dicht bestückte Kleiderständer.
Ob TShirt oder Mantel: Was einem selbst nicht mehr gefällt, schließt womöglich wer anderes ins Herz. So hat das Team der BUNDjugend neben den Nähmaschinen auch etliche Kisten

mit Secondhandkleidung per Lastenrad zum Infostand gebracht. Das zieht: Viele Passant*innen bleiben stehen, stöbern im Sortiment. Und wer eine Pause braucht vom samstäglichen Einkaufstrubel, kann sich bei einem Quiz über die Probleme des Textilkonsums informieren.
In die Fußgängerzone zum Einkaufen? Vielen der unter 25Jährigen kommt das kaum mehr in den Sinn. Die meisten sind eher hier, um Freund*innen zu treffen. Noch vor wenigen Jahren pilgerten Teenager in die Läden von H&M und Primark. Dort gab es angesagte Mode für relativ wenig Geld. Heute dreht sich das Rad noch schneller. Unternehmen wie die ShoppingPortale Shein und Temu treiben den Einkaufswahn auf die Spitze. Mit viel Geld sorgen sie dafür, dass ihre Angebote überall sichtbar sind.
»In sozialen Medien wird man gerade mit Werbung für UltraFastFashion zugeballert«, ärgert sich Denis Biesenbach. Modetrends wechseln Woche für Woche, entsprechend wird man pausenlos zum



Shoppen animiert. »Jeden Tag spucken die Apps neue Lockangebote für Kleider aus, die in China hergestellt werden und fast nichts kosten. Das verführt dazu, ständig Neues zu kaufen.«
Wird die Billigware dann aussortiert, landet sie zumeist im Müll. Gegen das Werbebudget von Shein & Co. kommt die BUNDjugend nicht an. Aber Aufklärung ist wichtig: »We Care & Repair« will junge Leute anregen, sich mit den Problemen von Wegwerfmode zu beschäftigen.
WORKSHOPS + PROJEKTTAGE
»Absurd billige Fast Fashion hat nicht nur Folgen für unsere Gesundheit, sondern auch für Umwelt und Klima«, meint Ili Großkreutz: »Nur wer das weiß, denkt beim Einkaufen nach und ändert vielleicht sein Verhalten.« Mit Denis Biesenbach ist sie deshalb seit gut einem Jahr im RheinMainGebiet unterwegs. Das Team bietet kostenlose Workshops und Projekttage in Freizeiteinrichtungen, Jugendzentren und Schulen. Neben einem theoretischen Einstieg gibt es einen praktischen Teil, um den Umgang mit der Nähmaschine zu lernen. Wer will, kann mitgebrachte Kleidung dort gleich reparieren oder upcyceln – und hat dann hoffentlich Lust auf mehr.
»Wir sind bewusst nicht in der BUNDjugendBubble unterwegs, sondern wollen
alle jungen Leute ansprechen, ob in der Brennpunktschule oder im Gymnasium«, so Denis Biesenbach. Nachdem anfangs einige Werbung nötig war, kommen nun deutlich mehr Anfragen für den Workshop. Zwar sind sie auch mal bei einer Feier des Umweltbundesamts in Dessau oder einer Klimakonferenz in Berlin. Doch ihr Fokus bleibt rund um Frankfurt und Mainz. Hier sind noch bis zum Sommer 2025 neben Workshops auch Aktionen und Events geplant.
»Wir überlegen uns, wie wir Leute zum Weitermachen motivieren, wenn sie zu Hause keine Nähmaschine haben«, sagt Ili Großkreutz. Vielleicht entwickelt sich aus dem BUNDjugendProjekt eine lokale Gruppe, die sich regelmäßig zur Textilreparatur trifft. Schon jetzt gibt es in Mainz regelmäßig Kleidertauschpartys. Genügend Leute, die der Textilindustrie auf die Finger schauen und sich für einen nachhaltigeren Konsum einsetzen wollen, haben sich auch gefunden. Einige planen Aktionen im Rahmen der »Fashion Revolution Week« im April.
Schon wenn in der Vorweihnachtszeit mit dem Black Friday der ShoppingDruck noch einmal steigt, will das Team von »We Care & Repair« Alternativen bieten. Der »KaufnixTag« Ende November, an dem man mal 24 Stunden auf Konsum verzichtet, wäre ein guter Anlass. »Vielleicht laden wir zum Adventsbasteln ein: Es gibt viele Ideen für nichtkommerzielle Geschenke, die man in ein paar Stunden herstellen kann«, meint Denis Biesenbach. Wann und wo sie sich treffen, steht noch nicht fest. Aber das Motto: »Selbst machen statt Schrott kaufen.«
Helge Bendl
Aktiv werden
Neben Workshops an Schulen, Unis und Freizeiteinrichtungen bietet »We Care & Repair« regelmäßig öffentliche Termine im RheinMainGebiet. Die Webseite bietet zudem DIYTipps zum Herstellen eines Bügelpatchs und für das Nähen mit der Nähmaschine: www.bundjugend.de/ we-care-repair
Wir in der BUNDjugend wenden uns entschieden gegen Rechtsextremismus und Diskriminierung. Besonders mit Blick auf die jüngsten Landtagswahlen rufen wir dazu auf, demokratische Werte zu stärken und sich gegen menschenverachtende Ideologien zu stellen. Bleibt oder werdet aktiv für Klima und Naturschutz, für Antidiskriminierung und Vielfalt! Wir ermutigen euch, all jenen entgegenzutreten, die rechtes Gedankengut vertreten und diese Werte bedrohen. Wir stehen ein für eine solidarische und gerechte Gesellschaft! www.bundjugend.de/ landtagswahl-in-brandenburg

In einem europaweiten Projekt für Agrarökologie wird die BUNDjugend aktiv für ein gerechtes Ernährungssystem und das Ende kolonialer Lieferketten. Mit re:boot wollen wir junge Menschen in ihrem Engagement unterstützen und fördern, etwa durch Hofbesuche und Schulungen für Multiplikator*innen, mit Aktionen auf Festivals sowie im Austausch mit BIPoCAktiven und Entscheidungsträger*innen. Umgesetzt wird das Projekt in einem Bündnis von 14 Organisationen aus neun Ländern, unterstützt aus dem EUFördertopf »Development Education und Awareness Raising«. Mehr dazu unter: www.bundjugend.de/projekte/reboot instagram.com/bundjugend twitter.com/BUNDjugend facebook.com/BUNDjugend.Bundesverband


PRECHT hat als Bundesfreiwillige die BUNDPressestelle verstärkt.
Gute Öko-Vorsätze für das neue Jahr? Nun, oft erweisen sich große Ziele bald als unrealistisch. Vielleicht probieren Sie sich erst einmal aus? Hier eine bunte Auswahl von Vorschlägen, wie Sie in den Tagen vor Weihnachten und zwischen den Jahren Teile Ihres Alltags umweltgerechter gestalten können – so Sie das nicht längst schon tun.
1 Trinken Sie mehr Leitungswasser. Sie sparen damit Geld und entlasten Ihre Einkäufe. Deutlich umweltfreundlicher ist es sowieso.
> www.bund.net/trinkwasser
2 Sparen Sie Wasser. Was Sie künftig an Leitungswasser trinken, können Sie anderweitig mehrfach wieder einsparen. Etwa indem Sie einen sparsamen Duschkopf einbauen und Ihre Wasch und Spülmaschine immer im EcoModus laufen lassen.
> www.bund.net/wasser-sparen
3 Beziehen Sie echten Ökostrom. Nehmen Sie Ihrem Stromlieferanten die behauptete Umweltfreundlichkeit nur ab,
Sicher, für schnelle Fortschritte beim Natur- und Klimaschutz sind wir darauf angewiesen, dass die Politik gute Leitplanken setzt. Dennoch können wir den nötigen Wandel auch im Kleinen vorantreiben. Wir raten Ihnen, wie.
wenn dieser unser »Grüner Strom Label« vorweisen kann. Wenn nicht, wechseln Sie flugs den Anbieter.
> www.gruenerstromlabel.de (Hier gibt’s auch grünes Gas!)
4 Sparen Sie Strom. Die größten Stromfresser im Haushalt sind Heizungspumpe, Boiler und Durchlauferhitzer, Gefrier und Kühlgeräte, Elektroherd und Trockner. Sollten Sie noch uralte Erbstücke am Netz hängen haben, ersetzen Sie diese Schritt für Schritt. Schenken Sie sich selbst ein Modell der Effizienzklasse A (gemäß EUEnergielabel).
> www.bund.net/besser-haushalten
5 Lassen Sie häufiger Ihr Auto stehen Probieren Sie doch, einen Ihrer Alltagswege (zum Bäcker, zum Yoga etc.) mal zu Fuß oder mit dem Rad zurückzulegen, bei Bedarf kombiniert mit Bus und Bahn. Die zusätzliche Bewegung erspart Ihnen teure Stunden im Fitnessstudio.
> www.bund.net/besser-mobil
6 Elektroschrott ade. Sammeln Sie allen Elektroschrott im Haushalt und bringen Sie ihn zu einem Recyclinghof. Vielleicht lässt sich ein lieb gewonnenes Gerät sogar noch reparieren, von einem Profi alter Schule oder, falls vorhanden, in einem BUNDRepaircafé. Womöglich können Sie dafür einen Reparaturbonus nutzen.
> www.bund.net/reparaturbonus
7 Essen Sie gut. Gönnen Sie sich und der Umwelt öfter mal saisonale Biokost. Sparen Sie über die Weihnachtstage an
der Fleischmenge und planen Sie auch ein leckeres vegetarisches oder veganes Menü mit ein.
> www.bund.net/besser-essen und www.bund.net/nachhaltig-schlemmen
8 Besser schenken (1): Zeit statt Zeug. Verschenken Sie Gutscheine für gemeinsame Aktivitäten – passend für Leute, die schon alles haben. Das kann ein Städtetrip oder eine Wandertour sein, ein Kinooder Restaurantbesuch oder ein selbst gekochtes Menü nach Wahl. Gemeinsame Zeit also, die im Alltag oft zu kurz kommt.
9 Besser schenken (2): Support your local … Behalten Sie doch bei materiellen Geschenken die Läden in Ihrer Nachbarschaft im Blick. Bestellen Sie Bücher über die nahe Buchhandlung statt den globalen Onlinehandel. Und ein Einkaufsbummel bringt Sie vielleicht auf andere Ideen als die xte Internetrecherche.
10 Werden Sie aktiv. Recherchieren Sie, welche Umweltgruppen es in der Region gibt. Nehmen Sie Kontakt auf und lernen Sie mögliche Mitstreiter*innen kennen. Vielleicht freuen sich BUNDAktive auch in Ihrer Gemeinde über Verstärkung?
> www.bund.net/bund-vor-ort
Falls Sie jederzeit gerne gute Vorsätze fassen und in die Tat umsetzen, lassen Sie sich das ganze Jahr über anregen: von unseren Tipps und Ratgebern unter www.bund.net/oekotipps und www.bund.net/besser-leben


Zum Titelthema in N+U 3/2024
Ich bin aufmerksamer Leser ihres regelmäßigen Heftes. Auf S. 20 im dritten Absatz steht: »Täglich fallen in Bayern elf Hektar dem Bau von Straßen und Gebäuden zum Opfer«.
Auf S. 22 steht in der Überschrift: »Über 12 Hektar verschwinden in Bayern unter Asphalt und Beton – jeden Tag!« Der Unterschied/Widerspruch von über 1 Hektar pro Tag erklärt sich mir nicht.
Erläuterung der Redaktion:
Vielen Dank für den Hinweis. Wir freuen uns sehr darüber, dass unser Mitgliedermagazin eine so aufmerksame Leserschaft hat! Hintergrund der unterschiedlichen Zahlen ist, dass die statistischen Angaben zum Flächenverbrauch in Bayern jährlich aktualisiert werden. 12 Hektar ist die aktuelle Angabe. Die Zahlen bewegen sich seit Jahren zwischen knapp 11 und über 12 Hektar. Die niedrigere Zahl war also eine etwas ältere Angabe, die sich hier eingeschlichen hat.
Seit dem Sommer bin ich Mitglied im BUND Naturschutz. Erst heute lese ich Ihre Ausgabe 03/24. Design und Inhalt finde ich sehr gelungen und zeitgemäß. Ihr Engagement für die Schiene als Mobilitätslösung teile ich auf ganzer Linie. Ich freue mich auf viele weitere Beiträge am Puls der Zeit in der Zukunft und wünsche Ihnen und Ihrem Magazin sowie dem Verband alles Gute und ein gutes Händchen bei der Themenwahl.
Jost Sagasser, Aschaffenburg
Ich war über 40 Jahre in einem Rathaus und habe Neuausweisungen von Gewerbegebieten und auch von Wohnsiedlungen auf der grünen Wiese begleitet. Ich kann Ihnen sagen, dass alle diese neuen Nutzungen zu einer Belebung der Flora und Fauna geführt haben. Wo vorher überdüngte, artenarme landwirtschaftliche Flächen waren, sind jetzt rundum der neu entstandenen Gebäude ökologisch wertvolle Begleitflächen entstanden wie dichte Sträucherhecken und Bäume, in denen viele Vögel
Wir freuen uns auf Ihre Meinung
BNMagazin »Natur+Umwelt«, Pettenkoferstr. 10a, 80336 München oder an nu@bundnaturschutz.de Leserbriefe können gekürzt werden. Sie geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.
und Insekten leben. Oft ist es so, dass man bei Gewerbegrundstücken diesen Abstandsflächen nicht viel Pflege angedeihen lässt, was der Natur zugutekommt. So werden angelegte Rasenflächen nicht so oft gemäht wie landwirtschaftliche Flächen. Hinzu kommt, dass bei jeder Neuausweisung Ausgleichsflächen an anderer Stelle geschaffen werden müssen, mit denen ökologische Aufwertungen einhergehen. Die Seitenflächen und Böschungen entlang von Landstraßen bieten fast immer eine deutlich höhere Biodiversität als die angrenzenden Acker und Wiesenflächen.
Robert Höpfner, Grassau
Stellungnahme der Redaktion:
Unsere Forderung nach einem Netto-Null-Flächenverbrauch heißt nicht, dass nicht mehr gebaut werden darf, es soll vermieden werden oder, wenn es zu Neubau kommt, mit einer qualitativ hochwertigen Fläche ausgeglichen werden. Leider findet dieser Ausgleich bei vielen Bauprojekten nicht statt. Der BN hat festgestellt, dass nur ein Bruchteil der Ausgleichsflächen den ökologischen Ansprüchen genügt, wenn er überhaupt stattfindet.
Alles in allem gilt es (Neu-)Versiegelung zu vermeiden und sogar zurückzubauen, um einen natürlichen Wasserhaushalt und einen gesunden Boden zu fördern. Die aktuellen Hochwasser zeigen, was passiert, wenn zu viel Fläche versiegelt ist. Daher befürwortet der BN eine Wohnraummobilisierung im Bestand und sieht auch die großflächigen Gewerbezentren als Teil des Problems.
Zum doppelseitigen Foto »Bedroht« in N+U 3/2024
Ich bin BNMitglied und habe das neue Heft (3/24) wie immer interessiert gelesen. Auf Sei te 30/31 befindet sich ein Beitrag über die »Rote Röhrenspinne«. Als Spinnenfachmann muss ich leider ein wenig den »Besserwisser« spielen: Hinter der »Roten Röhrenspinne« stecken in Deutschland zwei Arten: Eresus kollari (Herbströhrenspinne, früher E. niger oder E. cinnaberinus ) und Eresus sandaliatus (Ringelfüßige Röhrenspinne). Die Angaben zur Verbreitung im Artikel passen zu E. kollari, das Foto zeigt hingegen ein Männchen von E. sandaliatus.

In Bayern kommt E. sandaliatus vor allem im Bereich des Altmühltales vor und E. kollari muss als verschollen gelten (nur historische Nachweise aus der Fränkischen Schweiz und aus Unterfranken). Ich habe aber zum Beispiel kürzlich einen erstmaligen Wiederfund der Art seit den 50erJahren südwestlich von Frankfurt/M. gemeldet bekommen. Die Hoffnung ist also noch da, dass es auch E. kollari noch in Bayern geben könnte. Theo Blick, Hummeltal

VON SPINNEN UND MENSCHEN
Eine verwobene Beziehung
Jan Mohnhaupt
Hanser Verlag, 24 Euro
Verwobene Beziehung
Jan Mohnhaupt hat ein packendes Buch über Spinnen geschrieben. Es ist nicht das erste, das den faszinierenden Achtbeinern gewidmet ist, vor denen so vielen graust. Aber ein besonders leidenschaftliches, das unser heutiges Wissen gut zusammenfasst. Denn »gegen Spinnenfurcht hilft nur Spinnenwissen«, wie der Autor den BUNDMitbegründer Horst Stern zitiert, aus seiner berühmten Filmdokumentation »Leben am seidenen Faden«. Mohnhaupt begibt sich auf die Spur der Spinnen, beginnend bei der Vogelspinne Alpha, die ihn 24 Jahre lang als Haustier begleitet hat. Mit Kapiteln, die Werk, Leib oder Lust überschrieben sind, nähert er sich einer Tiergruppe, mit der uns viel verbindet. Wie haben Spinnen unsere Sprache, unsere Geschichte, unser Wissen beeinflusst? Und woher die so verbreitete Abneigung gegen sie? Lesen Sie selbst!

THE COMING WAVE
Künstliche Intelligenz, Macht und das größte Dilemma des 21. Jahrhunderts
Mustafa Suleyman
Verlag C.H. Beck, 28 Euro
Wie weiter mit KI?
Mustafa Suleyman beleuchtet mit »The Coming Wave« die Herausforderungen und Chancen künstlicher Intelligenz. Wie tiefgreifend wirkt sie sich auf unsere Gesellschaft, die Wirtschaft und Politik aus? Der Mitgründer des KISpezialisten DeepMind erläutert ethische Fragen, den Einfluss künstlicher Intelligenz auf den Arbeitsmarkt und die Notwendigkeit, einen regulativen Rahmen zu schaffen. Außerdem zeigt der KIPionier, wie Technologien künstlicher Intelligenz diverse Bereiche transformieren können, von der Gesundheitsversorgung bis zur Klimakrise. Suleyman fordert mit künstlicher Intelligenz verantwortungsvoll umzugehen und ihre sozialen und politischen Folgen eingehend zu diskutieren. Wissenschaft, Politik und Gesellschaft müssten an einem Strang ziehen, um eine nachhaltige und gerechte Zukunft sicherzustellen.

HAT DAS ZUKUNFT
ODER KANN DAS WEG? Der Fortschrittskompass
Petra Pinzler
Campus Verlag, 29 Euro
Kompass in die Zukunft
In »Hat das Zukunft oder kann das weg?« beschäftigt sich die ZEITJournalistin Petra Pinzler mit der Frage, welche Produkte und Technologien in einer nachhaltigen Zukunft Bestand haben sollten. Und wie die Politik auf kreativere Ideen kommen könnte. Mit einem kritischen Blick analysiert Pinzler gängige Fortschrittskonzepte und die Konsumkultur. Anschaulich zeigt sie, welche Innovationen wirklich zukunftsfähig sind –und welche nur kurzfristigen Trends folgen.
Ihr Buch ist ein wertvoller Leitfaden für all jene, die verantwortungsvoll konsumieren und zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen möchten. Es regt dazu an, Gewohnheiten zu hinterfragen und die eigene Rolle in der Gesellschaft neu zu betrachten. Für alle, die neue Ideen brauchen und sich engagieren wollen, privat, gesellschaftlich oder auch politisch.

DAS ZWITSCHERN DER VÖGEL
Mit VogelstimmenMerksätzen zum Mithören, Mitraten und Ausmalen
Silke Oppermann
Selbstverlag, Buch mit Hörbuch 18,90 Euro
Vogelstimmen lernen »Das Zwitschern der Vögel« ist so vielfältig wie die Vogelwelt selbst. Es verbindet ein HörbuchRatespiel mit echten Vogelgesängen, farbigen Illustrationen, Bildern zum Ausmalen und interaktivem Lernen. Nehmen Sie Ihre Kinder mit auf eine Reise in die Welt der Vögel. Die Wildnispädagogin Silke Oppermann schafft mit dieser gereimten Geschichte einen spielerischen und sehr kurzweiligen Zugang zu heimischen Vogelarten und ihren charakteristischen Stimmen. Dazu liefert sie humorvolle Merksätze. Das liebevoll gestaltete Buch lädt Kinder ab 6 bis 8 Jahren (und älter!) zum Zuhören, Mitmachen und Erkunden ein. Es begeistert, indem es Wissensvermittlung und Kreativität verbindet. Hörproben, Vogelporträts und zusätzliche Einblicke gibt es auf der Webseite unter www.zwitschernbuch.de (mit Bestellmöglichkeit; der Bezug ist versandkostenfrei).

DER LECH – VON DER QUELLE BIS ZUR MÜNDUNG
Mark Robertz
TecklenborgVerlag, 34,50 Euro
Schwabens großer Fluss
Auf Tiroler Seite ist der Lech noch ein echter Wildfluss. Mit seinen weiten Schotterbänken, schäumenden Flussengen, artenreichen Auen und stillen Altgewässern prägt er das gesamte Lechtal. Ab der bayerischen Grenze ist damit weitgehend Schluss. Eine Aneinanderreihung von Stauseen hat aus dem Fluss eine Seenlandschaft gemacht. Mark Robertz hat in seinem Bildband die Vielfalt des Lechs von der Quelle im Hochgebirge bis zur Mündung in die Donau eindrucksvoll eingefangen. Der BNVorsitzende Richard Mergner hat ein Vorwort geschrieben. Darin kommt auch die BNForderung zum Ausdruck, dass der Lech auch in Bayern wieder mehr Wildfluss werden muss. Die Chance dazu besteht aufgrund den auslaufenden Kraftwerkskonzessionen. Der BN hat daher ein Zukunftsprogramm für den Lech vorgelegt.

HÜTER DES FELDES
Horst Jürgen Schunk
Books on Demand, 40,60 Euro oder EBook: 9,99 Euro
Baumdenkmal
Im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels steht eine der ältesten Eichen Bayerns. Offiziell wird der Baum als »Hüter des Feldes« bezeichnet. Vor Ort nennt man das uralte Gehölz auch »Rasierpinselbaum«. Im Kinofilm »Luther« sieht man diesen Baum in der Anfangsszene. Auch Filmbeiträge wurden bereits über ihn produziert, in den Tageszeitungen war er häufig abgebildet. Der Baum besitzt keine vollständige Krone mehr und ist völlig hohl. Der Autor und Baumfreund Horst Schunk fotografiert diesen Baum seit über 40 Jahren. So entstanden Portraits dieses Naturdenkmals zu allen Jahreszeiten und zu allen Tageszeiten. Dieses Büchlein setzt dem Baum ein visuelles Denkmal, das ihn über seine Zeit hinaus in Erinnerung halten soll – eine fotografische Liebeserklärung an ein Naturdenkmal.
SCHNEESCHUHWANDERN IM ALLGÄU
26. – 31. Januar 2025, Deutschland

Das idyllische Wertach am Fuße des Grünten bietet idealen Voraussetzungen für ausgedehnte Schneeschuhwanderungen durch unberührte Bergnatur. Panoramareiche Wanderungen und Abstecher in urige Berghütten stehen ebenso auf dem Programm wie Infos zur Tier und Pflanzenwelt der Allgäuer Alpen.

WINTERERLEBNIS IN TIROL
4. – 10. Februar 2025, Österreich
»Das schönste Ende der Welt«, nennt sich das Bergsteigerdorf Steinberg am Rofan zwischen Rofan und Karwendelgebirge. Hier genießen die Reisenden auf Schneeschuhtouren die zauberhafte Winterlandschaft Tirols, entspannen bei Yogaund Meditationseinheiten und lassen sich bei köstlichem Alpensoulfood die Bergwelt auf der Zunge zergehen …
WANDERN
AUF ELBA
2. – 12. April und 29. September – 9. Oktober 2025, Italien

Zwischen der Toskana in Italien und der Insel Korsika funkelt im Tyrrhenischen Meer eine Insel mit ganz besonderem Flair: Elba. Die Reisenden erwartet ein einzigartiges Naturparadies aus einsamen Felsbuchten, blühender Macchia und schattigen Steineichenwäldern – stets umgeben vom kristallklaren Wasser des Meeres.
Weitere Informationen Tel. 09 11/588 88 20· www.bund-reisen.de

Gebietsheimische Wildblumen • Wildblumensamen speziell zusammengestellt für vier Regionen, die anhand standörtlicher Merkmale aus den 22 Ursprungsgebieten Deutschlands hergeleitet wurden.
Nord Nr. 10 555-A
Ost Nr. 10 555-B
Süd Nr. 10 555-C
West Nr. 10 555-D je 2,90 €

Vogelschutz-Markierung • Ein hochwirksamer Schutz gegen Vogelschlag: Die reflektierenden Aufkleber-Punkte auf dem Fensterglas werden von Vögeln erkannt. 25 m Lauflänge für ca. 2,5 qm, 50 m Lauflänge für ca. 5 qm Fenster fläche.
Nr. 22 400 54,00 €
Nr. 22 401 74,00 €

Igel-Schnecke • Ganzjahresquartier für Igel aus klimaausgleichender Keramik, in Schneckenform zum Schutz vor Fressfeinden.
Ø 35 cm, H 16 cm, 4,5 kg. Nr. 66 021 79,90 €

Bio-Apfelbäume • Alte Obstsorten werden von den meisten Allergiker*innen gut vertragen: ihre Polyphenole schalten das Apfelallergen aus. Drei Jahre alte Apfelbäume aus einer hessischen Baumschule (wurzelnackt, 3 bis 4-jährig, Anleitung, Pfahl und Strick inkl.).
Alter Gravensteiner Nr. 29 007
Gelber Richard Nr. 29 002
Signe Tillisch Nr. 29 005
Holsteiner Cox Nr. 86 006
Berner Rosenapfel Nr. 86 014 je 64,90 €

Futterfeder für Meisen knödel • Wildvögel finden guten Halt, und es bleibt kein Netz im Baum zurück. Ohne Knödel.
Nr. 66 075 8,50 €
BIO Energie-Knödel (ohne Abb.) 25 Stück
Nr. 66 063 22,99 €

Hummelburg • Der bemalte Eingang lockt die fleißigen Gartenhelfer an. Aus Keramik, mit Nistwolle und Anleitung.
Ø 27 cm, H 16 cm, 5,5 kg. Nr. 22 117

Vogelstimmenuhr • Bei dieser Uhr singt jede Stunde ein anderer Vogel. Ø 34 cm. Nr. 21 628

Sonnenglas H 18 cm.
Nr. 33 088 39,99 €
Sonnenglas mini H 10,5 cm. Nr. 33 170 34,99 €

Luchs- und Wildkatzenkalender • Aufgenommen im Wildkatzendorf Hütscheroda. Format: DIN-A4, mineralölfreie Farben, Recyclingpapier. Nr. 39 370 16,90 €

Katzennapf Granicium® • Für Kopfform und Schnurrhaare optimiert, kippsicher und stabil, spülmaschinengeeignet. Ø 16 cm, 350 ml. Nr. 40 046 39,90 €
89,90 €

Weihnachtsstern • Mit Lichtschalter, Fassung E14, LED-Lampe, max. 15 Watt, 3,5 m Stromkabel. ca. Ø 38 cm, T 10,5 cm. Nr. 27 384 49,90 €

Schneeflocken aus Porzellan –6 Stück • Regen - und frostfest, gebrannt bei 1250 Grad, ca. Ø 9 cm. Nr. 41 023 49,00 €

Klimahandtuch • Aus 100 %-zertifizierter GOTS Bio-Baumwolle, hergestellt in Portugal. 180 x 100 cm. Nr. 80 053 55,00 €



Smartphone-Verstärker • Mit Blick auf das Display und verbesserter Akustik. Für Handys bis zu 12 mm tief. In Ahorn-, Kirsch und Walnussholz. Nr. 27 020 je 26,95 €

Indoor CeraNatur ® Zur Verwendung mit Schmelzfeuer Indoor. Nr. 22 299 79,90 € Schmelzfeuer Indoor CeraNatur ® Nr. 22 126 69,90 €

Anhänger Eiskristall – 6 Stück Aus verschiedenen Laubhölzern, 9,5 x 9 cm. Nr. 41 030 24,90 €

Butterkühler • Aus Keramik, Ø 18,5 cm, hergestellt in Deutschland. Nr. 87 028 59,90 €

Strick-Handschuhe gemustert • Aus 100 % Bio-Baumwolle, Gr. S/M, L. Nr. 81 060 24,90 €

Socken mit Streifen – 5 Stück • Frei von Polyamid und Polyester, 97 % Bio-Baumwolle, 3 % Roica. Nr. 62 090 19,90 €

Solarlampe • Die Little Sun verwandelt fünf Stunden Sonnenlicht in vier Stunden helles oder zehn Stunden gedämpftes Licht. Ø 2,9 cm. Nr. 33 087 24,95 €

Schneidebrett groß – Streifen Aus heimischen Hölzern: Buche, Ahorn und Rüster. ca. 27 x 40 x 2 cm. Nr. 21 391 31,50 €

Teelichter aus Bienenwachs 10 Stück Nr. 27 350 9,90 €

Teelichtglas (ohne Teelicht) einzeln Nr. 33 201 0,90 € 4 Stück Nr. 33 202 3,20 €

FRAGEN UND ANREGUNGEN
Tel. 0 91 23/7 02 76 10 fragdenbn@bundnaturschutz.de Mo.–Do. 10–14.30 Uhr, Di. u. Do. 16–19 Uhr

MITGLIEDSCHAFT/ADRESSÄNDERUNG
Tel. 09 41/2 97 20-65 mitglied@bundnaturschutz.de
SPENDENBESCHEINIGUNGEN
Tel. 09 41/2 97 20-66 spenderservice@bundnaturschutz.de





REDAKTION NATUR+UMWELT
Luise Frank
Tel. 0 89/5 14 69 76 12 naturumwelt@bundnaturschutz.de
HAUS- UND STRASSENSAMMLUNG
EHRENAMTLICH AKTIV WERDEN
Christine StefanIberl
Tel. 09 41/2 97 20-11 christine.stefan@bundnaturschutz.de
BN-BILDUNGSWERK
Ulli Sacher
Tel. 09 41/2 97 20-23 ulrike.sacher
BN-STIFTUNG
Christian Hierneis
Tel. 09 41/2 97 20-35 christian.hierneis@bund
SCHENKUNGEN & STIFTUNGSWESEN
Birgit Quiel
Tel. 09 41/2 97 20-69 birgit.quiel@bund
IMPRESSUM

Foto: sonnenglas.net


39,99 €
Solarlampe »Sonnenglas« Generation 6, dimmbar




14,50 €


12,50 €

16,50 €
Solar-Bausätze »Windrad« und »Radfahrer« mit BN-Logo
neue Bücher eingetroffen

BESUCHEN SIE UNSERE BÜCHER-FUNDGRUBE
Holzbroschen »Tiere« ø Köpfe ca. 2 – 2,5 cm; Höhe Tiere sitzend: 3 cm; 9 versch. Motive

27,50 €
Holzohrringe »Fuchs« ø ca. 1 cm

Herausgeber: BUND Naturschutz in Bayern e.V. (BN), vertreten durch Peter Rottner, Landesgeschäftsführer, Dr.JohannMaierStr. 4, 93049 Regensburg, www.bundnaturschutz.de
Leitende Redakteurin (verantw.): Luise Frank (lf), Tel. 0 89/5 14 69 76 12, natur-umwelt@bund-naturschutz.de
Redaktion: Andrea Siebert (as)
Mitglieder-Service: Tel. 09 41/2 97 20-65
Gestaltung: Janda + Roscher, die WerbeBotschafter, www.jandaroscher.de (Layout: Waltraud Hofbauer) Titelbild 4/24 (28. Jahrgang): Haselmaus im Winterschlaf –Foto: blickwinkel/AGAMI/D. Green
34,00 €

»Natur erleben durch das Jahr« mehrjähriger Kalender im Format DIN A2 inkl. Begleitheft; in drei Varianten erhältlich
www.bn-onlineshop.de
BUND Naturschutz Service GmbH Service-Partner des BUND Naturschutz in Bayern e.V. versand@bn-service.de
Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten. Lieferung solange Vorrat reicht, Druckfehler und Preisanpassung vorbehalten.
Redaktion BUND-Magazin: Severin Zillich (verantw.), Kaiserin-Augusta-Allee 5, 10553 Berlin, Tel. 0 30/27 58 64-57, Fax -40 Druck und Versand: Fr. Ant Niedermayr GmbH & Co. KG, Regensburg
Anzeigenverwaltung: Evelyn Alter, Runze & Casper Werbeagentur GmbH, Tel. 0 30/2 80 18-149, Fax -400, alter@runze-casper.de. Es gelten die Mediadaten Nr. 32.
Verlag: BN Service GmbH, Eckertstr. 2, Bahnhof Lauf (links), 91207 Lauf an der Pegnitz, Tel. 0 91 23/9 99 57-20, Fax -99, info@service.bundnaturschutz.de
24: 153 000
Für Mitglieder des BN im Beitrag enthalten, ersandgebühr, ISSN 07216807 Bank für Sozialwirtschaft München, IBAN DE27 7002 0500 0008 8440 00, BIC: BFSWDE33MUE
Mit Namen gezeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder des BN wieder Nachdruck nur mit Genehmigung des BN. Für unverlangt eingesandte Artikel oder Fotos keine Gewähr. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe zu kürzen. »Natur+Umwelt« wird auf 100% Recyclingpapier gedruckt.
FERIEN
Natur pur:
See Suite auf dem Wasser Sanft auf den Wellen schaukelnd, Hausbooturlaub im Schilfgürtel, Panoramablick, Eisvogel & Biber, 100% Sonnenenergie, Süd-Mecklenburg www.kranichboot.de
Usedom: das schöne Haus Komfortables Ferienhaus mit schönem Hof und Garten, 3 SZ, 3 Bäder, Sauna + Kamin, Wald, Wiesen, Seen und mehr www.ferienhus.de
Südliches Leinetal
Fewo bei Göttingen für bis zu 6 Personen, große Wohnküche, 3 Schlafzimmer, 2 Bäder
Tel. 0 55 09/24 40 Ferienwohnungmengershausen.de
Urlaub im Alten Apfelgarten
Sehr ruhige Ferienwohnungen maximal 7 Personen im Naturschutzgebiet in der Nähe der Flensburger Förde
Tel. 0 46 35/27 45 www.alteobstsorten.de

Rügen für Naturfreunde!
Ferienhaus + FeWos in traumhafter Lage im Biosphärenreservat nahe Putbus + Bodden.
Tel. 03 83 01/8 83 24 www.indengoorwiesen.de
Die Perle der Chiemgauer Alpen aus der Türe der FeWo zum Wandern und Klettern zur Hochplatte, Kampenwand, Geigelstein + Badesee.
Absolut ruhige Alleinlage am Waldrand mit Blick auf den Wilden Kaiser.
Tel. 0 86 49/98 50 82 www.zellerhof.de
Wendland
Biosphärenreservat Elbtalaue und Nehmitzer Heide, gemütliches Holzhaus für 4 Personen in Gartow am See, wo die Zugvögel rasten, der Kranich brütet, der Biber zu Hause ist.
Tel. 0 58 46/3 03 31 85 e.topeters@gmx.de
Wieder Nordsee?
Nähe St. Peter Ording, FeWo für kurz entschlossene Naturfreunde, ab 45 € p. T., NR., Kind und Hund willkommen, Garten und Grill.
Tel. 0 48 62/80 52
1000 Gesundheits-Seminare Wandern, fasten, entschlacken. Auch Basenfasten, Yoga, Sauna, QiGong und Wellness. Woche ab 380 €.
Tel. 06 31/4 74 72 www.fastenzentrale.de
FRANKREICH
Zwischen Cévennen, Ardèche und Mittelmeer Wunderschöner Natursteinhof, mediterraner Garten. 5 charmante Ferienhäuschen mit eigenen Terrassen. Dorfladen, mit Baguettes und Metzgerei, sowie Bar und Restaurant in den schattigen Gassen. Willkommen im Süden! www.maschataigner.com
Aufblühen am Millstätter See 2 hochwertig eingerichtete FeWos (55–85 qm) mit traumhaftem Panoramablick; Südbalkon; 100 m über dem glitzernden Wasser; Haus mit ökologischem Ansatz am Wald gelegen; Ortskern, Strandbad & Badehaus fußläufig; Wanderwege direkt vom Haus; Yoga-Angebot.
Tel. 0043 6 64/2 83 68 97 www.fewoweinleiten.at & www.yogaweinleiten.at
klipklap :: Infostände & Marktstände
ökologisch - praktisch - gut für draußen & für drinnen, aus Holz, einfach steckbar, wasserdichte Baumwollplanen, Branding info@klipklap.de 033928 239890 www.klipklap.de


Nächster Anzeigenschluss: 19. Dezember 2024 www.bund-kleinanzeigen.de • Tel. 030/28018-149
Anzeige


Was wir heute tun, entscheidet.

Ihre Weihnachtsspende hilft

Lebensräume seltener Tiere und Pflanzen zu schützen
sauberes Wasser, gesunde Lebensmittel, gutes Klima zu bewahren
SPENDENKONTO BUND NATURSCHUTZ
IBAN: DE24 7002 0500 9300 0005 00

Bitte geben Sie auf dem Überweisungsträger Ihre Mitgliedsnummer und als Verwendungszweck „Weihnachtsspende“ an. Dies hilft uns Verwaltungskosten zu sparen. Bei Spenden über 300 Euro erhalten Sie eine Spendenquittung. Für Zuwendungen bis 300 Euro gilt der Bankbeleg für das Finanzamt.
Oder nutzen Sie unser Onlineformular unter: www.bund-naturschutz.de/weihnachtsspende