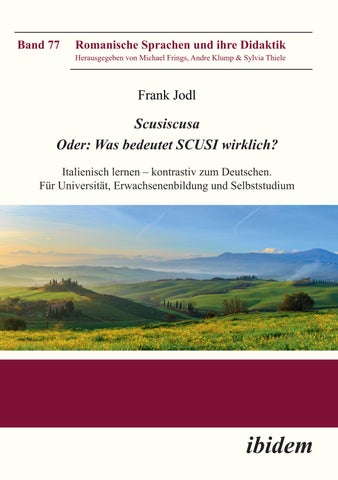Frank Jodl legt ein ungewöhnliches, sehr systematisches und effektives Lehr- und Lernbuch des Italienischen vor, das sich fürs Selbststudium eignet und sich gleichermaßen an Studierende der Italianistik wie an Italienischlernende richtet, die sich für Romanistik, Sprachstruktur sowie Philologie interessieren und Deutsch als Kontrastsprache nutzen möchten. Das Scusiscusa zugrundeliegende didaktische Prinzip beruht vor allem auf dem Konzept, die Erstsprache zu spiegeln, wie es von Wolfgang Butzkamm und John A. W. Caldwell vertreten wird. Danach kann und soll die Mutter- bzw. Erstsprache bewusst als Kontrastsprache eingesetzt werden, um den Lernerfolg zu erhöhen. Frank Jodl studierte Französisch (Galloromanistik), Italienisch (Italianistik) und Geschichte, promovierte in Romanischer Sprachwissenschaft mit anschließender Spezialisierung im Bereich Spanische Sprachwissenschaft. Von 2010–2017 war er als Dozent für spanische und französische Sprachwissenschaft an der Universität Siegen tätig, hatte Lehraufträge an der spanischen Abteilung des Instituts für Übersetzen und Dolmetschen (IÜD) der Universität Heidelberg und ist seit 2017 Dozent am Institut für Translation und mehrsprachige Kommunikation (ITMK) der TH Köln.
RomSD 77
Band 77
Romanische Sprachen und ihre Didaktik
Herausgegeben von Michael Frings, Andre Klump & Sylvia Thiele
Scusiscusa Oder: Was bedeutet SCUSI wirklich?
Das Italienischlehrbuch Scusiscusa zielt darauf ab, sprachliche Strukturen („Grammatik“) durchschaubar zu machen, denn: Die menschliche Sprache ist ein Zeichensystem, funktioniert also wie ein Code. Diesen Code gilt es zu entschlüsseln, nach Wolfgang Butzkamm zu knacken. Daraus ergeben sich für Lernende, die sich sprachliche Strukturen bewusst machen wollen, folgende Fragen bzw. Lerninhalte: • Welche Funktion übernehmen grammatikalische Formen, beispielsweise Verb-Endungen, die auch aus nur einem einzigen Laut bestehen können, für die Kommunikation? • Wie lassen sich auf dieser Basis Inhalte in der neu zu erlernenden Sprache transportieren? • Wie werden Laute und Lautkombinationen in graphische Zeichen („Rechtschreibung“) umgesetzt?
Frank Jodl
Scusiscusa Oder: Was bedeutet SCUSI wirklich? Italienisch lernen – kontrastiv zum Deutschen. Für Universität, Erwachsenenbildung und Selbststudium
Jodl
ISBN: 978-3-8382-0883-1
ibidem
ibidem