
31 minute read
Der Regenwald des Grossen Bären
Um ein Lebewesen wirklich kennenzulernen, muss man seine Herkunft ergründen. In diesem Sinne begann ich meine Suche nach wilden Wölfen zu planen. Ich wollte so weit weg von der Zivilisation wie möglich, in der Hoffnung, Wölfe zu finden, die noch nicht allzu sehr von menschlicher Aktivität beeinflusst waren. Dafür musste ich Europa verlassen. Ich hatte keine Ahnung, wo ich meine Reise beginnen sollte. Zwei Gegebenheiten sollten mich schliesslich zu einem vielversprechenden Wolfspfad führen: Meine Bewerbung für die Auswanderung nach Kanada, die ich Monate zuvor eingereicht hatte, wurde angenommen. Und eine gute Bekannte, die österreichische Biologin und ehemalige Skilanglauf-, Berglauf- und Crosslauf-Spitzensportlerin Gudrun Pflüger, erzählte mir von ihren Erfahrungen als freiwillige Helferin für ein Wolfforschungsprojekt der Raincoast Conservation Foundation an der kanadischen Westküste in der Provinz British Columbia. Die für diese Stiftung arbeitenden Naturschützer und Wissenschaftler setzten sich ein, um das Land, die Gewässer und die Tierwelt des sogenannten Great Bear Rainforest, eines riesigen Küstengebiets zwischen Kanadas Vancouver Island im Süden und der Südküste von Alaska im Norden, unter Schutz zu stellen.
In dieser abgelegenen Region half Gudrun den Wissenschaftlern, Daten über die lokale Wolfspopulation zu sammeln. Das Team war oft auf der Na’walak, einem 17 Meter langen Segelschiff, unterwegs. Na’walak bedeutet in der Sprache der Kwakwak’wakw-Indianer so viel wie Geist oder Seele der Natur, spirit of nature.1 Nicht nur ich war von Gudruns Erlebnissen fasziniert. Ihre tiefgründigen Erfahrungen mit den Wölfen an der Westküste wurden in den nachfolgenden Jahren unter anderem in der ARDFernsehdokumentation «Die Wolfsfrau» und als Buch mit dem Titel «Wolf Spirit» publiziert. Als Gudrun mir eines Tages erzählte, dass David Lutz, der Kapitän der Na’walak, auch Touren für kleine Gruppen anbietet, wusste ich, wo ich meine Suche nach dem Geist des Wolfs beginnen würde.
Ein paar Monate später, Ende Juli 2004, war es so weit. Die Reise zum Great Bear Rainforest war nicht nur der perfekte Einstieg für mich in ein neues Leben in Kanada, sondern eignete sich auch, um wild lebenden Wölfen näher zu kommen. Mein Vater war auch mit von der Partie. Er hatte
1 http://www.emeraldislesailing.com/ourship.html, abgerufen am 20.1.2020.


sich überreden lassen, mich auf meiner Segeltour durch dieses Labyrinth von Inseln und Fjorden zu begleiten. Am 31. Juli landeten wir in Ketchikan, Alaska. Nicht unerwartet regnete es stark, als wir den Flughafen verliessen. In dieser kleinen Stadt an der äussersten Südostspitze von Alaska fallen 3900 mm Niederschlag pro Jahr. Mit anderen Worten, hier regnete es öfter, als die Sonne schien. Trotz des nassen Wetters war unsere Stimmung ausgezeichnet. Nachdem wir im Hotel eingecheckt hatten, nutzten wir die Zeit, um die Stadt mit ihren rund 8000 Einwohnern zu erkunden. Wir liefen zum lebhaften Hafen, wo titanische Luxusliner vor Anker lagen, beobachteten, wie Wasserflugzeuge landeten und mit Touristen voll beladene Busse sich ihren Weg durch die belebten Strassen schlängelten.
Schliesslich fanden wir den Weg zurück zum Hotel, wo wir die letzten Vorbereitungen für unsere Reise trafen, die uns weit weg von der kommerzialisierten Welt von Ketchikan führen sollte. Früh am nächsten Morgen trafen wir unseren Kapitän. David Lutz, ein kleiner, bedächtiger Mann mit einem auffällig markanten Kinn und dunkelblonden, zu einem Pferdeschwanz gebundenen Haaren, begrüsste uns herzlich. Als er auf uns zulief, bemerkte ich, dass sein Gang durch seine stark gekrümmten O-Beine und ein leichtes Hinken beeinträchtigt wurde. Doch dies behinderte seine erstklassigen Navigationsfähigkeiten nicht im Geringsten. David erzählte uns, dass er sein erstes kleines Segelboot bekommen hatte, als er elf Jahre alt gewesen war, und er seitdem im Pazifik umhersegelte. In dieser Zeit erlangte er ein immenses Wissen über die Wasserstrassen des Great Bear Rainforest. Da er von meinem Interesse an Wölfen wusste, versprach er, einige Orte aufzusuchen, an denen diese regelmässig gesichtet wurden. Robert und Jennifer, ein Ehepaar mittleren Alters aus Kalifornien, waren auch mit von der Partie sowie Davids Assistentin Deborah, die gleichzeitig auch unsere Köchin war. Kaum an Bord der Na’walak, wurden die Segel gesetzt. Da die Regenwolken über Nacht weitergezogen waren, schien die Sonne, als wir an den Luxuslinern vorbei auf den grossen weiten Ozean glitten. Dall-Hafenschweinswale begleiteten uns eine Weile lang und auf einer Boje lagen einige Seelöwen, die sich nicht aus der Ruhe bringen liessen, auch nicht von dem hoch über uns kreisenden Weisskopfseeadler.
Am späten Nachmittag verliessen wir die Gewässer von Alaska und stiessen in kanadische vor. In der Bullhead Cove fanden wir unseren ersten Ankerplatz. An diesem Abend nahm ich ein Ritual auf, das ich während unserer Seereise beibehalten sollte: Nach dem stets köstlichen Abendessen schrieb
ich unsere Erlebnisse in meinem Reisetagebuch nieder, und sobald alle schlafen gegangen waren, schlich ich mich an Deck, um die Stille des Great Bear Rainforest ganz für mich alleine zu geniessen. Fernab von künstlichen Lichtern strahlten die Sterne aus voller Kraft. Oft lag ich auf dem Rücken und sah mit dem Fernglas in den grenzenlosen Kosmos hinaus.
Am dritten Tag bogen wir in eine Bucht ein, in der Davids Erfahrung nach ein aktives Wolfsgebiet liegen sollte. Und tatsächlich, während wir den Strand überprüften, fanden wir die Spuren eines einzelnen Wolfs. Es blieb jedoch bei dieser einzigen Spur. Zu wenig, um hierzubleiben. David beschloss, die Na’walak am nächsten Tag zu einer anderen potenziellen Wolfsbeobachtungsbucht zu navigieren. Aber zuerst mussten wir durch die weltberühmte Inside Passage segeln, um den Weg nach Süden zu finden. Vor allem im Greenville Channel mussten wir nach den monströsen Luxusschiffen Ausschau halten, die uns den Weg abschneiden konnten. Zum Glück sichteten wir an diesem Tag keine grossen Schiffe, sondern stattdessen einen weitaus sanfteren Riesen der Meere.
«Blow on one o’clock», hörte ich plötzlich unseren Kapitän rufen, und wir alle rannten an Deck mit unseren Ferngläsern in der Hand. «It’s a humpback!»
Unser Skipper hatte einen Buckelwal entdeckt und steuerte vorsichtig auf ihn zu, bis wir uns parallel zu ihm bewegten, ohne ihn zu stören. Steile Klippen ragten links und rechts auf und über uns schien der Himmel tief azurblau. Der Buckelwal tauchte regelmässig auf, um die verbrauchte Luft auszustossen. Dabei entstand ein herzförmiger Spray, der vor allem im Gegenlicht gut sichtbar war. Der Wal atmete tief frischen Sauerstoff ein, bevor er wieder unter der Wasseroberfläche verschwand. Einige aufsteigende Blasen verrieten, dass er sich nun auf die Klippen zu bewegte. Sobald der Wal in der Nähe der Felsen war, tauchte er kurz auf, um dann wieder auf Tauchstation zu gehen. Nicht lange danach begannen Luftblasen die Oberfläche des Meereswassers zu brechen und bildeten einen riesigen, sprudelnden Kreis. Da tauchte der Wal mit weit geöffnetem Maul direkt neben unserem Schiff auf, inmitten des Luftblasenkreises, und schluckte eine grosse Menge kleiner Fische in einem Zug. Diese Blasennetz-Jagdtechnik wurde bereits mehrmals beobachtet und gefilmt, besonders in Alaska, aber ein einzelner Wal, der diese intelligente Technik ausführte, war bisher niemandem von uns bekannt gewesen – nicht einmal unserem Kapitän David, der diese Gewässer seit vielen Jahren befuhr. Wir
beobachteten, wie der Buckelwal seine Technik mehrmals eindrücklich vorführte, bevor wir beschlossen, diesen sanften Titanen der Meere wieder allein zu lassen.
Nach unserer Begegnung mit dem Wal fuhren wir weiter nach Süden, bis wir den Greenville Channel für eine der unzähligen versteckten Buchten verliessen. Wir wollten einen Wasserfall besuchen, wo sich ab und zu ein Kermodebär sehen liess. Der weisse Kermodebär, auch bekannt als spirit bear, Geisterbär, ist tatsächlich ein Schwarzbär mit einer rezessiven Genmutation. Damit Schwarzbärnachwuchs weiss wird, muss er diese Genmutation von beiden Elternteilen erben. Schätzungen zufolge werden etwa zehn Prozent aller Schwarzbären in dieser Wildnis als spirit bears geboren. Mit etwas Glück konnten wir an diesem Ort nicht nur einen Geisterbär beobachten, sondern auch Hinweise auf Wolfsaktivitäten finden. Wir stiegen in ein kleines elektrisches Gummiboot, um an Land zu fahren. Als wir durch das stille Wasser glitten, sprangen rechts und links von uns Lachse in die Luft – so viele, dass wir befürchteten, einer der grossen Fische würde direkt im Boot landen oder, schlimmer noch, direkt in unseren Gesichtern. Die Lachse hatten alle ein Ziel: Sie schwammen bis zum Wasserfall, wo sie mit unvorstellbaren Kräften das hinabstürzende Wasser überwinden wollten, um in den darüber liegenden See zu gelangen. Von dort führte ihre Reise weiter einen Fluss hinauf bis zur Mündung, wo sie laichten. Der namenlose See und der Wasserfall waren von einem üppigen, uralten Regenwald umgeben. David liess uns am Strand aussteigen und kehrte zur

Na’walak zurück, während wir die Umgebung erkundeten. Dank der Ebbe konnten wir eine faszinierende Welt exponierter Gezeitentümpel begutachten. In den flachen Becken wimmelte es nur so von Leben: bunte Seesterne, Seeigel und viele andere, für mich als Bergler unbekannte Kreaturen. Schliesslich betraten wir den dichten Wald und fanden einen Pfad, den mehrere Bärengenerationen benutzt haben mussten. Jeder Bär schien seine mächtigen Tatzen in die Spur des vorherigen Bären platziert zu haben, und so war dieser deutlich sichtbare, tief ins Moos eingestampfte Bärenpfad entstanden.
Hinweise auf Wölfe fanden wir leider nicht. Also trotteten wir zurück zum Strand, wo wir das Verhalten der Lachse beobachteten. Die Fische hatten sich in grossen Schwärmen unterhalb des Wasserfalls versammelt und warteten darauf, dass die Flut zurückkehrte. Denn nur dann war der Wasserfall niedrig genug, um die donnernde Barriere zu überwinden. Einige Ungeduldige wollten jedoch nicht warten: Mit aller Kraft sprangen sie aus dem Meer in das sprudelnde Kaskadenwasser. Ein Mensch müsste über ein vierstöckiges Haus springen, um eine vergleichbare Leistung zu erbringen. Trotz ihrer beeindruckenden Springeigenschaften schaffte es keiner der Lachse. Die meisten fielen direkt in die Mitte des Wasserfalls und wurden zum Ozean zurück torpediert. Andere landeten auf Felsen und fielen mit einem doppelten Salto zurück ins schäumende Meereswasser. Jedes Mal, wenn das geschah, zuckten wir zusammen und konnten kaum noch hinschauen. Als sich die Sonne dem Horizont näherte, riefen wir David mit unserem Funkgerät an, damit er uns abholte. Während wir auf ihn warteten und den Lachsen zuschauten, bemerkte ich etwas in meinem Augenwinkel. Ich drehte meinen Kopf und sah einen ausgewachsenen Schwarzbären (Ursus americanus), nur 30 Meter von uns entfernt.
Ich war nicht allzu sehr überrascht. All diese Lachse mussten wie ein Magnet auf die Bären wirken. Ich alarmierte die anderen mit einem leisen Flüstern. Als der Bär uns sah, blieb er stehen, zögerte und trat ein paar Schritte zurück. Auch wir traten zurück, doch weit konnten wir uns nicht zurückziehen: Hinter uns war der Wasserfall, rechts eine steile Felswand, links das Meer und vor uns der Bär. Wir waren gefangen. Der Bär atmete ein paar Mal tief durch und beschloss, in unsere Richtung zu marschieren. Wir hielten den Atem an. Zum Glück war der Bär nicht an uns interessiert und begann die Klippe zu unserer Rechten zu erklimmen. Fünf Meter über unseren Köpfen lief er nun Richtung Wasserfall. Erst da bemerkten wir,
dass David das Ganze vom elektrischen Gummiboot aus beobachtet hatte. Er tuckerte zu uns heran, damit wir nacheinander hineinspringen konnten.
«Lasst uns mal schauen, was dieser Bär vorhat», sagte David. Wir glitten über das Wasser zum gegenüberliegenden Ufer und setzten uns auf einen morschen Baumstamm. Die Flut begann zu steigen, und die Fische konnten jetzt etwas höher springen. Wieder fielen einige direkt zurück ins Wasser. Einige Unglückliche landeten im Maul des Schwarzbären. Fing dieser einen Lachs, zog er sich in den nahe gelegenen Wald zurück, um seine Trophäe zu verspeisen. Eine Viertelstunde später tauchte er an seinem Angelplatz wieder auf, und schon bald hatte er einen weiteren Fisch gefangen. Nach einem weiteren genüsslichen Mahl trat er wieder aus dem Wald heraus. Doch diesmal schien ihn etwas zu stören. Er hob die Nase und begann intensiv zu schnüffeln. Wir beobachteten ihn neugierig. Würden wir endlich einen Wolf oder sogar einen weissen Schwarzbären sehen? Nach einigen bangen Sekunden tauchte schliesslich ein weiterer, massiger Schwarzbär auf, der geradewegs auf den Wasserfall zuging. Er war ein ganz besonderer Bär mit ungewöhnlicher Fellfärbung. Der obere Teil seines Körpers war mit einem dunkelbraunen, flauschigen Zottelfell bedeckt, ähnlich wie bei einem Grizzlybären, und der untere Teil seines Körpers war schwarz. Er sah aus wie eine Kreuzung zwischen einem Grizzly- und einem Schwarzbären. Und er war enorm gross. Nicht nur wir bemerkten das, sondern auch der fischende Bär inmitten des Wasserfalls. Ohne zu zögern, lief dieser nun davon und überliess den besten Angelplatz dem Neuankömmling. Der zweifarbige Bär wusste genau, wohin er gehen musste, und er kam gerade rechtzeitig. Die Flut war jetzt so hoch, dass einige Lachse endlich die felsige Barrikade überwinden konnten. Es war, als wäre ein Damm gebrochen, und ein Lachs nach dem anderen nutzte die Gelegenheit, um in den See zu gelangen. Der Bär indes lief gelassen zum tosenden Wasserfall und begann sich gegen die Mitte der Kaskade vorzuarbeiten. Der Fels war offensichtlich rutschig und die Kraft des drückenden Wassers musste enorm sein. Dennoch hielt der Bär dank seiner bemerkenswerten Stärke stand und gelangte zum begehrten Anglerplatz. Dort angekommen, wartete er auf seine Chance. Ein Lachs nach dem anderen flog an ihm vorbei, bis einer direkt auf seiner Nase landete. Der Schwarzbär nahm den Treffer stoisch und fuhr mit seinen Fischversuchen fort. Offensichtlich war er nicht so ein guter Fischer wie der vorherige kleinere Bär. Es dauerte eine volle halbe Stunde, bis er endlich Glück hatte. Seine Belohnung war ein grosser, dicker Rotlachs (Oncorhynchus nerka). Mit dem zappelnden Fisch im Maul verschwand der Bär im Wald. Wir

nutzten die Chance, unseren Beobachtungsposten unbemerkt zu verlassen, und kehrten zum Mutterschiff zurück, wo unser eigener Preis des Tages auf uns wartete: frisch gefangene Schneekrabbe (Chionoecetes opilio). Als wir am nächsten Morgen die Bucht verliessen, stellten wir fest, dass der schwarzbraune Bär immer noch am Fischen war. Er war vielleicht nicht der beste Fischer, war aber enorm ausdauernd, und dank seiner Grösse wagte es kein anderer Bär, ihn herauszufordern.
Wir liessen die magische Bärenbucht hinter uns und segelten nach Südwesten auf der Suche nach Canis lupus. Kanadas Great Bear Rainforest beherbergt eine der letzten Wolfspopulationen, die sich entwickelt haben, ohne übermässig verfolgt zu werden. Wann genau Wölfe und moderne Menschen zum ersten Mal aufeinandertrafen, ist nicht bekannt. Die Wissenschaft liebt Fakten und Zahlen und schafft aus den verfügbaren Hinweisen die bestmögliche Erklärung, die gilt, bis etwas Neues den Status quo herausfordert. Es gibt mehrere Theorien dazu, wann und wo der Wolf als Spezies entstand. War es in Nordamerika oder in Eurasien? Und wann begegneten Menschen ihm zum ersten Mal?
Nach der gängigsten These entstanden Homo sapiens und Canis lupus auf separaten Kontinenten. Der Mensch in Afrika, die Wölfe in Nordamerika. Beiden gemeinsam ist, dass sie die Welt eroberten, wie es nur wenige Arten vor und nach ihnen getan haben. Unsere Spezies, der anatomisch moderne Mensch (Homo sapiens), hat sich vor etwa 200000 Jahren in Afrika entwickelt. Unsere direkten Vorfahren verliessen den Kontinent vor ungefähr 60000 bis 70000 Jahren. Es gibt zwar Hinweise, dass einige Menschen bereits vor 90000 bis 130000 Jahren den Weg aus Afrika fanden, jedoch liessen diese kaum genetische Spuren in den Menschen von heute zurück. Diese frühen Pioniere kehrten also entweder nach Afrika zurück oder starben aus.2 Es scheint, dass unsere direkten Vorfahren Australien vor etwa 50000 Jahren und über den Nahen Osten vor etwa 40000 Jahren Westeuropa erreicht haben. Ost-Eurasien (Sibirien und Japan) wurde vor etwa 35000 Jahren bevölkert, und einige tausend Jahre später, vor ungefähr 14000 Jahren – vielleicht sogar schon früher3 – hatten diese frühen prähistorischen Entdecker ihren Weg auf den nordamerikanischen Kontinent gefunden.
2 https://genographic.nationalgeographic.com/about/, abgerufen am 21.02.2020. 3 Vgl. Forrest, Maura. 2017. «New research finds that humans may have lived in the Yukon 24’000 years ago.»,
Yukon News, 18. Januar.
Der Ursprung des Wolfs kann auf ein fuchsgrosses Säugetier namens Hesperocyon zurückgeführt werden. Es lebte vor etwa 40 Millionen Jahren in Nordamerika und wurde der Vorfahre der gesamten Kaniden-Linie, zu der moderne Wölfe, Kojoten, Füchse, Schakale und Hunde gehören. Um die Schwierigkeit zu verstehen, den genauen Entstehungsort des heutigen Grauwolfs (Canis lupus) zu lokalisieren, muss man berücksichtigen, dass die Erde zu verschiedenen Zeiten massive klimatische Veränderungen durchgemacht hat, die die Entwicklung und Verbreitung aller Arten beeinflusst haben. Es gab Zeiten, in denen unser Planet eisfrei war, und andere Zeiten, in denen gigantische Eismassen fast die Hälfte der Kontinente bedeckten. Solche massiven Veränderungen beeinflussten auch den Meeresspiegel. Während der Eiszeiten war so viel Meerwasser im Eis eingeschlossen, dass ganze Landmassen aus den schrumpfenden Meeren hervortraten. Die wohl berühmteste dieser Landmassen ist Beringia, eine Landbrücke zwischen Ostsibirien und Alaska, die während der verschiedenen Eiszeiten teilweise Nordamerika mit Asien verband.
Es ist wichtig zu verstehen, dass Beringia während der Eiszeiten eisfrei blieb und als eine Art Drehtür für Arten diente, die in beide Richtungen von einem Kontinent zum anderen gelangten. Dieser rege Artenaustausch erlaubte es auch alten Kanidenarten, von Nordamerika nach Asien und zurück zu wandern. Die meisten Gelehrten sind sich einig, dass die ersten echten Wolfsvorfahren ursprünglich aus Nordamerika kamen, Beringia überquerten und vor etwa einer Million Jahren sich in Eurasien zu dem heute bekannten Wolf entwickelten, bevor sie wieder den Weg zurück in die Neue Welt fanden.4 Auf seinem Rückweg nach Nordamerika stiess der Grauwolf auf eine andere Wolfsart, die sich in der Isolation Nordamerikas entwickelt hatte, den imposanten Canis dirus. Dieser enorme, im Lateinischen als «schrecklich» (dirus) bezeichnete Wolf war das grösste Mitglied der Kanidenfamilie und wog bis zu einem Viertel mehr als die grössten modernen Wölfe.5 Er hatte einen massiven Kopf, enorme Zähne und relativ kurze Beine. Die Spuren dieser Wolfsart verschwanden vor etwa 10 000 Jahren und von da an war die Tür für Canis lupus weit geöffnet, um der Top Dog des nordamerikanischen Kontinents zu werden.
4 Busch, Robert H. (2018). The Wolf Almanac. A Celebration of Wolves and Their World. (3. Auflage).
Guilford: The Lyons Press, S. 1. Vgl. Flannery, Tim (2002). The Eternal Frontier: An Ecological History of North America and its Peoples. New York: Grove Press. 5 Nowak, Ronald M. (2003). Wolf Evolution and Taxonomy. S. 243 – 244 in Mech, L. David, & Boitani, Luigi.
Wolves: behavior, ecology, and conservation. Chicago: The University of Chicago Press. Vgl. Anyonge,
William & Roman, Chris (2006). New body mass estimates for Canis dirus, the extinct Pleistocene dire wolf.
Journal of Vertebrate Paleontology. 26: 209 – 212.
Nicht nur in Nordamerika triumphierte Canis lupus. Im Laufe der Zeit wurden Grauwölfe zu einem der am weitesten verbreiteten grossen Säugetiere dieser Welt. Sie etablierten sich von der gefrorenen Arktis bis zu den Halbwüsten der Arabischen Halbinsel, von den Regenwäldern der nordamerikanischen Westküste bis zu den europäischen Alpen, von Indien bis nach Japan. Vor etwa 340000 Jahren hatte sich der Wolf bereits zu der Grösse und Form entwickelt, die uns vertraut sind, wie Wolfsfossilien aus der Tornewton-Höhle im Südwesten Englands belegen.6 Diese mehrere hunderttausend Jahre alten Knochen unterscheiden sich nicht wesentlich von den Knochen der Wölfe, die zum Beispiel heute in Finnland leben.
Alle Wölfe, die heute leben, gehören zur Art Canis lupus (Wolf, Grauwolf) und werden in verschiedene Unterarten unterteilt. Aufgrund des grossen Verbreitungsgebietes in weiten Teilen der nördlichen Hemisphäre, der Hybridisierung zwischen Abstammungslinien und historischen Populationsschwankungen ist die Klassifizierung der einzelnen Unterarten eine grosse Herausforderung für die Wolf-Taxonomie. Wissenschaftliche Debatten zu den verschiedenen Unterarten sind bis zum heutigen Tag im Gang. Zum Beispiel erkannte man allein in Nordamerika für viele Jahre bis zu 23 Unterarten des Grauwolfs an, bis der Zoologe Ronald Nowak 1995 vorschlug, deren Anzahl auf fünf zu reduzieren.7 Dies wurde bis 2012 zur Norm, als der United States Fish and Wildlife Service diese Ansicht herausforderte, indem er den sogenannten Algonquin-Wolf als eine eigene Art einstufte (Canis lycaon) und die Anzahl der Unterarten auf vier reduzierte (Canis lupus arctos, C. l. occidentalis, C. l. nubilus und C. l. baileyi).8 Die wissenschaftliche Debatte zur Klassifizierung des Algonquin-Wolfs ist bis zum heutigen Tag (Stand bei Drucklegung dieses Buches Ende Februar 2020) nicht abgeschlossen.9 Das Gleiche gilt auch für einige Unterarten in Eurasien, wie zum Beispiel für den Mongolischen Wolf (Canis lupus chanco). Allgemein werden heutzutage acht bis zwölf eurasische Unterarten anerkannt, je nachdem wen man fragt. Folgend die zwölf Unterarten, wobei die umstrittenen mit einem Stern (*) versehen sind. Der Hokkaido-Wolf (Canis lupus hattai), von vielen als ausgestorben angegeben, ist mit zwei Ster-
6 Senckenberg Wissenschaftsmagazin 141 (1/2) 2011. 7 Nowak, Ronald M. (1995). Another look at wolf taxonomy. 375 – 398 in Carbyn, Ludwig N. u. a. Ecology and conservation of wolves in a changing world. Canadian Circumpolar Institute, occasional publication 35. 642.
Edmonton: The University of Alberta Press. 8 Chambers, Steven M. & Fain, Steven R. & Fazio, Bud & Amaral, Michael (2012). An account of the taxonomy of North American wolves from morphological and genetic analyses. North American Fauna 77:1 – 67. 9 Persönliche E-Mail-Kommunikation mit L. David Mech, 23. Dezember 2019.
nen versehen, weil es mögliche Hinweise gibt, dass wenige Exemplare dieser Wolfsunterart bis zum heutigen Tag überlebt haben, wie die Japan Times am 25. Mai 2019 berichtete.10 Die heute noch lebenden eurasischen Unterarten sind: Canis lupus albus, C. l. arabs, C. l. campestris, C. l. chanco (= laniger)*, C. l. communis, C. l. cubanensis*, C. l. desertorum (= palies)*, C. l. hattai (= rex)**, C. l. italicus, C. l. lupus, C. l. pallipes*, C. l. signatus.11
Nebst den oben benannten Fällen von Wolfsunterarten ist die Zugehörigkeit folgender «Wolfsarten» weiterhin umstritten: Canis rufus, Canis simensis und Canis lupaster. Canis rufus, der Rotwolf, ist ein kleiner Kanide, der einst im südöstlichen Teil der Vereinigten Staaten heimisch war. Einige Forscher gehen davon aus, dass er keine eigene Art, sondern eine Kreuzung zwischen Kojoten (Canis latrans) und Grauwölfen (Canis lupus) ist. Auch wird darüber debattiert, wo der Äthiopische Wolf (Canis simensis) einzuordnen ist.12 Fortschritte in der Gentechnik enthüllten weitere Überraschungen. So verkündeten Wissenschaftler im Jahr 2011, dass das Genom des Ägyptischen Schakals (Canis aureus lupaster) mehr demjenigen vom Wolf glich als bisher angenommen, und ernannten ihn kurzerhand zum Canis lupus lupaster, der einzigen afrikanischen Unterart des Grauwolfs.13 Nach weiteren genetischen Untersuchungen wurde lupaster wieder umklassifiziert. Aus Canis lupus lupaster wurde im Jahr 2015 Canis anthus, eine nahe verwandte, jedoch eigene und alte Wolfsart.14 Seit Ende Mai 2019 wird der Name Canis lupaster von etlichen Experten bevorzugt.15
Abgesehen von solchen wissenschaftlichen Debatten über Klassifizierung und Neueinstufung kann festgestellt werden, dass die Umwelt eines Tieres nicht nur das Verhalten, sondern auch Körperform und Grösse bestimmt. Zum Beispiel wiegt die Wolfsunterart, die auf der Arabischen Halbinsel lebt (Canis lupus arabs), nur durchschnittlich 18 Kilogramm, während zwei der grössten je dokumentierten Wölfe (beide der Unterart
10 Martin, Alex. 2019. «In search of Japan’s extinct wolves: Sightings of a mysterious canine in Chichibu have been captivating animal enthusiasts.» The Japan Times, 25. Mai. Siehe auch: Busch, Robert H. (2018). The
Wolf Almanac. A Celebration of Wolves and Their World. (3. Auflage). Guilford: The Lyons Press, S. 10. 11 Busch, Robert H. (2018). The Wolf Almanac. Guilford: The Lyons Press, S. 9 – 11. 12 Busch, Robert H. (2007). The Wolf Almanac. Guilford: The Lyons Press, S. 12 – 13. 13 Rueness, Eli K. u. a. (2011). The Cryptic African Wolf: Canis aureus lupaster Is Not Endemic to Egypt.
PLoS ONE 6 (1). 14 Koepfli, Klaus-Peter u. a. (2015). Genome-wide Evidence Reveals that African and Eurasian Golden Jackals
Are Distinct Species. Current Biology 25, 2158 – 2165. 15 Francisco Alvares u. a. (2019). Old World Canis spp. with taxonomic ambiguity:
Workshop conclusions and recommendations. CIBIO, Vairão, Portugal, Mai 2019.
Canis lupus occidentalis) 1939 in Ost-Zentral-Alaska (79,4 kg) und 1945 im kanadischen Jasper Nationalpark (78 kg) geschossen wurden.16
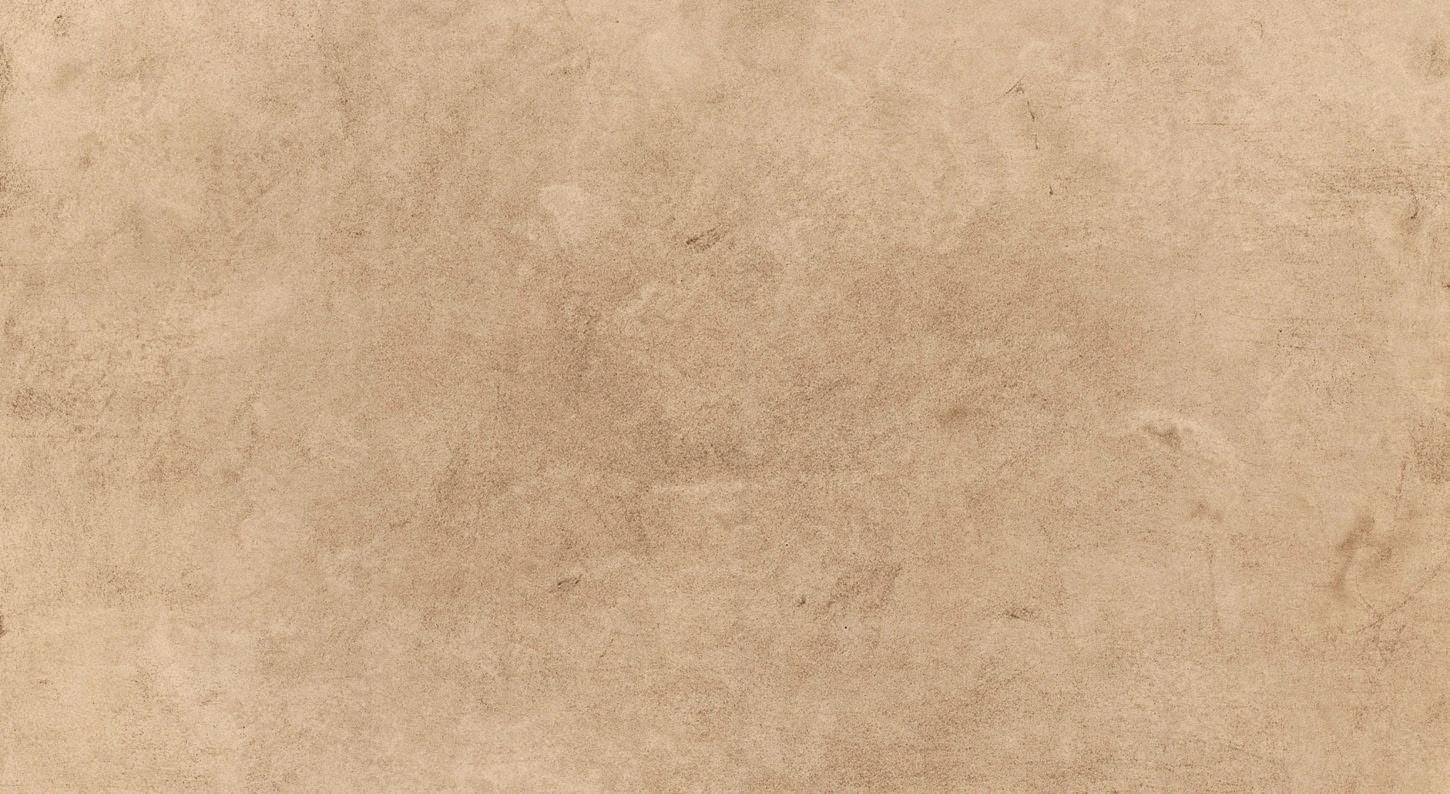
C. I. albus C. I. arabs C. I. arctos C. I. baileyi C. I. campestris C. I. chanco C. l. communis C. I. filchneri C. I. italicus C. I. lupus C. I. lycaon C. I. nubilus C. I. pallipes C. I. occidentalis C. I. signatus
Die Klassifizierung der einzelnen Unterarten des Wolfs ist eine grosse Herausforderung und wissenschaftliche Debatten dazu sind bis zum heutigen Tag im Gang.
Man weiss zwar nicht, wann und wo sich Menschen und Wölfe zum ersten Mal trafen. Sicher ist aber, dass die Wölfe, als die ersten modernen Menschen (Homo sapiens) vor etwa 40000 Jahren Westeuropa erreichten, sich das Gebiet bereits seit Hunderttausenden von Jahren mit einer bemerkenswerten Anzahl von Huftierpopulationen und anderen beeindruckenden Tieren teilten.
Um die extrem reiche Biodiversität besser zu verstehen, welcher der Wolf zu Zeiten des Auftauchens des modernen Menschen in Europa angehörte, lohnt sich der Blick auf den Pont d’Arc, eine 54 Meter hohe und 60 Meter breite, natürlich entstandene Steinbrücke, welche die Ardèche in Südfrank-
16 Busch, Robert H. (2007). The Wolf Almanac. Guilford: The Lyons Press, S. 26.
reich überspannt. Dieses Naturdenkmal wurde bereits vor 36000 Jahren durch Erosionskräfte geschaffen. Das Klima war damals drastisch anders, ähnlich wie heutzutage in Südschweden – durchschnittlich vier bis fünf Grad kälter als heute.17 Zu dieser Zeit war ein grosser Teil Nordeuropas von einer bis zu 3000 Meter dicken Eisdecke bedeckt und massive Gletscher verschlangen gleichsam die europäischen Alpen. Zwischen den Eismassen, im heutigen Westeuropa, lag eine grosse Steppe, die voller Leben war – Wölfe, Rentiere, Löwen, um nur einige Tiere zu nennen, und die ersten anatomisch modernen Europäer. Diese Jäger und Sammler lebten in kleinen, verstreuten Gruppen, die manchmal heilige Orte tief in der Erde besuchten.
Vor ungefähr 26000 Jahren lief ein etwa achtjähriges Kind nahe des Pont d’Arc das Ufer der Ardèche entlang. In Sichtweite der steinernen Brücke verliess es das Ufer und unternahm einen halbstündigen Spaziergang in Richtung einer Kalksteinklippe, die sich nur unweit des Flusses vertikal um 180 Meter erhebt. Der Knabe ging auf einen Felsvorsprung zu, der durch die Kräfte der Erosion in den Fels gehauen worden war, und trat nach einigen hundert Metern barfuss in eine Höhle ein.18
Er liess die Aussenwelt hinter sich und betrat mit einer Fackel in der Hand aufrecht die erste von vielen geräumigen Kammern. In diesem heiligen Ort waren Tierknochen verstreut, wie die intakten Schädel eines Alpensteinbocks (Capra ibex ibex) und eines Höhlenbären (Ursus spelaeus). Der Knabe lief weiter an einer grossen Wand vorbei, die mit vielen grossen roten Punkten verziert war. Ein wenig später erschien im Licht der Fackel der Schädel eines weiteren Höhlenbären. Dieser schien bewusst auf einen Felsbrocken gelegt worden zu sein, der einem Schrein glich. Je tiefer der Junge vordrang, desto dunkler wurde es. Der Bub berührte hin und wieder die Wände mit seiner Fackel, um die Intensität der Flamme zu erhöhen. Einige der Wände waren mit einer weichen lehmigen Schicht bedeckt. Jemand hatte mit den Fingern Tierfiguren darauf gemalt: Pferde, Mammuts und sogar eine Eule. Manchmal waren die Tierfiguren mit Klauenspuren von Höhlenbären, die die Höhlen für ihren Winterschlaf nutzten, verwischt.
Nach fünfhundert Metern erreichte der Knabe das Ende der Höhle. Er hob die Fackel und beleuchtete eines der grössten Meisterwerke mensch-
17 Sabourdy, Marion (2015). «Life in the cold steppe.» Caverne Pont D’Arc magazine. BeauxArts éditions. S. 30. 18 Harrington, Spencer. 1999. «Human Footprints at Chauvet Cave.»
Archaeology, Volume 52 (5). September/Oktober 1999.




licher Kreativität und Fantasie. Mit offenem Mund bewegte er seine Fackel hin und her. Es schien, als würden die gemalten Tierfiguren durch das Licht- und Schattenspiel lebendig. Insgesamt waren etwa tausend bemalte Figuren abgebildet, davon 442 Tiere. Höhlenlöwen gehören zu den am häufigsten dargestellten Tieren mit etwa 80 Bildern, dicht gefolgt von 79 Mammuts. Die Liste setzt sich fort mit 72 Wollnashörnern, 52 Pferden, 30 Bisons, 19 Höhlenbären, 17 Steinböcken, 13 Rentieren, acht Auerochsen, fünf Megaloceros (Riesenhirsche), zwei Rothirschen und je einem einzelnen Moschusochsen, Panther, je einer Eule und wahrscheinlich einer Hyäne. All diese faszinierenden Kunstwerke – die in den Tiefen der Erde vor etwa dreissig Jahrtausenden entstanden – konkurrieren in ihrer künstlerischen Schönheit bis heute mit den bekanntesten Meisterwerken unseres Zeitalters.
Tief beeindruckt lief der Knabe zurück ins Freie. Er wusste es nicht, doch etwa 4000 Jahre später (vor 22000 Jahren) würde der Felsen über der Öffnung einstürzen und den Eingang für eine lange Zeit verschütten.
Die Geheimnisse der Höhle blieben verborgen, bis drei Freunde, Éliette Brunel, Jean-Marie Chauvet und Christian Hillaire, am 18. Dezember 1994 einen Zugang zur Höhle entdeckten. Sie fanden nicht nur die Fussabdrücke des Knaben (die wahrscheinlich bisher ältesten datierbaren Fussabdrücke moderner Menschen), sondern auch eines grossen Kaniden. War die wolfsgrosse Kreatur dem Knaben in die Höhle gefolgt oder war sie vielleicht sogar sein treuer Begleiter gewesen? War sie ein Hund, ein Wolf oder etwas dazwischen? Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Sollten der Knabe und der grosse Kanide die Höhle jedoch tatsächlich gemeinsam betreten haben, wäre dies ein weiteres Indiz für die Annahme, dass die unglaublich faszinierende und höchst erfolgreiche Beziehung zwischen Menschen, Wölfen und Hunden viel früher stattgefunden haben könnte, als lange Zeit angenommen.
Viele Jahre nämlich haben grosse Wissenschaftler wie Charles Darwin und Konrad Lorenz die Herkunft des Hundes in Goldschakalen (Canis aureus) vermutet. Heute wissen wir dank der Gentechnologie, dass der Hund von Wölfen abstammt. Archäologische Funde haben die Zeit der Domestikation auf irgendwann zwischen 20000 bis 40000 Jahre vor unserer Zeit
datiert.19 Eine bemerkenswerte, aber umstrittene Studie geht noch weiter und verrückt den Zeitpunkt der Domestikation auf über 100000 Jahre vor unserem Zeitalter.20
Die Schwierigkeit, den genauen Ort der ersten Wolfsdomestikation zum Hund hin ausfindig zu machen, besteht darin, dass Wölfe sich über grosse Teile der nördlichen Hemisphäre verbreitet hatten. Allein deswegen spekulieren einige Wissenschaftler, dass der Hund mehr als einmal und an verschiedenen Orten domestiziert wurde. Es gibt auch Hinweise darauf, dass nach der Domestikation ein genetischer Fluss zwischen Hunden und Wölfen fortbestand. Zum Beispiel beschreibt ein Artikel im Science Magazin von 2009, wie Hunde, die mit den ersten Amerikanern über die BeringLandbrücke zogen, sich mit Grauwölfen paarten und dadurch eine genetische Mutation im Genpool von Wölfen einführten, die zu schwarzem Fell führte.21 Dies kann ein Vorteil für Wölfe sein, die in stark bewaldeten Gebieten leben. Schwarze Wölfe findet man heutzutage fast ausschliesslich in Nordamerika. Sie werden jedes Jahr von Tausenden von Menschen im Yellowstone National Park in den USA besichtigt.
Früher scheint es sie auch in Europa gegeben zu haben, wie Texte des Schweizer Arztes und Naturforschers Conrad Gessner in seinem von 1551 bis 1558 entstandenen Meisterwerk «Historia animalium» bezeugen:
«Umb Chur und ben den sieben Grauenpündten werden grosse schwärzlichte Wölffe gefunde (…) Im Schwarzwald aber sollen sie überauss gross/ scheusslich und schwarz gesehen und gefangen werden.»22
Nicht nur Wölfe profitierten von diesen Kreuzungen, auch die Hunde. Indigene nordamerikanische Völker kreuzten ihre Hunde absichtlich mit Wölfen, um stärkere Hunde zu züchten, die schwerere Lasten tragen konnten. Dies war von grosser Bedeutung, bevor das Pferd im späten 15. Jahrhundert von den Spaniern in Nordamerika wieder eingeführt wurde. Weiter im Norden nutzten die Inuit dasselbe Prinzip, um leistungsstarke Schlittenhunde zu züchten.
19 Botigué, Laura R., u. a. (2017). Ancient European dog genomes reveal continuity since the Early Neolithic.
Nature Communications 8, 16082. 20 Vilà, Carles u. a. (1997). Multiple and Ancient Origins of the Domestic Dog. Science. 276 (5319). 1687-1689. 21 Anderson, Tovi M. u. a. (2009). Molecular and Evolutionary History of Melanism in North American Gray
Wolves. Science. 323 (5919). 1339 – 1343. 22 Gessner, Conrad (1980). Thierbuch. (Nachdruck der Ausgabe von 1669 unter Verwendung des Originals der
Niedersächsischen Landesbibliothek in Hannover, Signatur N-A 10027). Hannover: Schlütersche Verlagsanstalt und Druckerei. S. 348.
Vieles deutet darauf hin, dass einige Wölfe viel früher domestiziert worden sind, als wir lange angenommen haben. Es stellt sich die Frage, wie und warum es überhaupt dazu kam. Ein möglicher Hinweis auf diese Frage könnte in der Kunst zu finden sein, die von den frühen Menschen in Westeuropa hinterlassen wurde. Die Tierdarstellungen in den Höhlen, wie beim Pont d’Arc, zeigen, dass die Künstler selten die Tiere abbildeten, die sie vorzugsweise jagten – zum Beispiel Rentiere –, sondern vor allem Tiere, die furchteinflössend waren: Mammuts, Wollnashörner, Höhlenbären und Löwen.23 Wölfe wurden in diesen frühen Tagen selten dargestellt, und dies allein mag ein Indiz für die Art der Beziehung zwischen diesen frühen Menschen und Wölfen sein. Vielleicht fehlen die Wölfe ganz einfach deshalb, weil die damaligen Menschen im Wolf keinen Feind, sondern einen vertrauten und nützlichen Verbündeten sahen.
Wir wissen heute, dass die modernen Menschen, als sie vor etwa 40000 Jahren ihren Weg nach Westeuropa fanden, eine raue steppenähnliche Landschaft voller Tiere entdeckten, die gut an ihre Umgebung angepasst waren. Mit Sicherheit mussten die jagenden Menschen ihre Beute gegen grosse Raubtiere wie Löwen verteidigen. Der europäische Höhlenlöwe (Panthera leo spelaea) war etwa zehn Prozent grösser als die grössten heute lebenden männlichen Löwen, die über 250 Kilogramm wiegen können. Wie die Höhlenmalereien andeuten, jagten die Höhlenlöwen in Rudeln und hatten wahrscheinlich ein ähnliches soziales Verhalten wie heutige afrikanische Löwen. Diese Raubkatzen gehörten vor allem in Rudeln zu den wahrscheinlich furchterregendsten Raubtieren, mit denen die Eiszeitmenschen und Wölfe sich das Land teilten. Da die frühen Jäger die Grosskatzen bewunderten, aber auch fürchteten, wurden Löwen zu einem so wichtigen Element in der Höhle von Pont d’Arc.
Im Gegensatz zu diesen furchterregenden Katzen hatten die ersten Menschen Westeuropas offensichtlich keinen Grund, den ihnen gut vertrauten Wolf allzu oft auf den Felswänden tief im Erdinneren zu verewigen. Der Wolf war ihnen einfach zu ähnlich, zu nahe und stellte kaum eine grosse Gefahr dar. Der österreichische Verhaltensbiologe Kurt Kotrschal, emeritierter Professor an der Universität Wien, sagte: «Menschen und Wölfe sind höchst soziale und kooperative Tiere, und teilen ein fast identisches soziales Gehirn und soziale Mechanismen.»24
23 Sabourdy, Marion (2015). «Life in the cold steppe.» Caverne Pont D’Arc magazine. BeauxArts éditions. S. 32. 24 Kotrschal, Kurt (2018). «Die Hundewerdung des Wolfes – 35 000 Jahre Partnerschaft mit dem Menschen.»
Deutschlandfunk Nova. Vortrag an der Berliner Humboldt-Universität. 7. Juni.
Wie Menschen leben auch Wölfe in Familien. Sie kümmern sich umeinander und sind ihrer Familie gegenüber sehr loyal. Mehr noch: Wie (die meisten) Menschen gehen auch Wolfspaare (meistens) eine monogame Langzeitbeziehung ein. Dies ist nur bei 3 bis 5 Prozent aller Säugetiere der Fall.25 Genauso selten bei Säugetieren zu beobachten ist die kooperative Aufzucht der Welpen: Ältere Geschwister, Elterntiere, Grosseltern oder andere Familienmitglieder helfen mit, den Nachwuchs aufzuziehen. Darin sind Wölfe wahre Meister.26 Auch hier ist eine beeindruckende Parallele zu uns Menschen erkennbar.
Zweifelsohne haben frühe Jäger und Sammler Wölfe genau beobachtet und waren tief beeindruckt von der sozialen Struktur der familienorientierten Wölfe. Sie stellten Ähnlichkeiten zwischen den vierbeinigen Kreaturen und sich selbst fest, wobei die Loyalität zur Familie alle anderen Eigenschaften übertrumpfte. Die damaligen Menschen müssen bemerkt haben, wie intelligent die Tiere sich auf der Jagd verhielten. Der Wolf verfügt nicht über die schnelle Tötungskraft der grossen Katzen, die ihre Beute mit ihren ausfahrbaren scharfen Krallen halten und sie dann mit einem gezielten Genick- oder Halsbiss rasch töten können. Deshalb ist er, wie unsere frühen Vorfahren, auf ausgeklügelte Jagdtechniken, Ausdauer, Intelligenz und Mut angewiesen.
Detailliertes Wissen über ihre Beute und zur Topografie ist eine der wichtigsten Überlebensstrategien der Wölfe, um erfolgreich auf der Jagd zu sein. Ebenso wichtig war dies für das Überleben unserer frühen Vorfahren. Vielleicht wurden diese frühen Jäger und Sammler dazu inspiriert, Bisons über steile Klippen zu treiben, nachdem sie beobachtet hatten, wie Wölfe diese Technik benutzten. Vielleicht lernten frühe Eiszeitjäger nicht nur Jagdtechniken von den Wölfen, sondern konnten auch beobachten, wie entschlossen und furchtlos Wölfe viel grössere Tiere wie Bären angriffen, wenn diese ihren Wurfhöhlen zu nahe kamen.
Es ist nicht weit hergeholt zu glauben, dass prähistorische Menschen die positiven Eigenschaften der sozialen und furchtlosen Wölfe in ihr eigenes Leben integrierten, um ihre Lager gegen gemeinsame Gegner zu verteidigen: Sei es, dass sie Wölfe als Schutzschild in Lagernähe tolerierten, oder
25 Bryner, Jeanna. 2012. «Are Humans Meant to Be Monogamous?» Live Science, 6. September. 26 Lukas, Dieter und Clutton-Brock (2012). «Cooperative breeding and monogamy in mammalian societies.»
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 25. Januar.
gar Wolfswelpen aus einer Höhle holten, sie sozialisierten, von menschlichen Müttern stillen liessen und dann als starke und mächtige Gefährten bei sich behielten.27
Genauso gut möglich ist es, dass einige Wölfe dies genauso sahen und die Nähe des Menschen zu suchen begannen. Eine Wurfhöhle in der Nähe eines menschlichen Lagers kann von grossem Vorteil gewesen sein, wenn die Menschen Intimfeinde wie Bären oder Löwen vom Lager fernhielten. Warum nicht zusammenarbeiten, wenn die Sozialstruktur sich ohnehin schon gleicht? Die Voraussetzung dafür ist natürlich gegenseitige Toleranz. Betrachten wir Beispiele aus Nordamerika, wo Europäer bis in der Nähe der Rocky Mountains vorgedrungen waren: 1754 bemerkte Anthony Henday, einer der ersten Europäer, die in die Nähe der Rockies kamen, dass Wölfe gewöhnlich an den Rändern ihrer Lager erschienen. In seinen Tagebüchern schreibt Henday, dass die Wölfe «Menschen keine Probleme bereiten».28 Dieses Verhalten war nicht abnormal. Jahre später, im Jahre 1793, schrieb Alexander Mackenzie, während er als erster Europäer den Landweg über die Rocky Mountains zum Pazifik fand, dass «ein Wolf so kühn war, um sich zwischen die Tipis der Indianer zu wagen».29 Indigene Völker tolerierten also Wölfe und die Wölfe wiederum mieden die Menschen nicht. Diese Zutraulichkeit einiger Wölfe war wahrscheinlich die wichtigste Zutat, um die Tiere zu domestizieren.30 Wolf und Mensch waren einander also viel näher, als man sich dies aus heutiger westlicher Sicht vorstellen kann.
Gut möglich, dass es sich in Europa vor geraumer Zeit ebenso verhielt. Es mochten dies Zeiten gewesen sein, in denen nicht nur Menschen die Wölfe als ihre nützlichen Nachbarn auswählten, sondern auch umgekehrt; ein vorteilhafter Pakt zwischen zwei verschiedenen Arten, der zu einer besseren Überlebenschance in einer rauen Umgebung für beide Arten führte.
Offensichtlich ist vieles von dem, was ich oben beschrieben habe, Spekulation meinerseits, und wir werden die wahre Geschichte wohl nie erfahren. Wir kennen aber das Endergebnis dieses Pakts: Canis lupus familiaris – der
27 Moser, Andreas (Redaktionsleiter). 2019. Am Anfang war der Hund.
Erwähnung bei 11‘33 – 12’26 in der Dokumentation, Netz Natur, SRF, 57’24. 28 Dettling, Peter (2012). The Will of the Land. Victoria: Rocky Mountain Books. S. 79. 29 Dettling, Peter (2012). The Will of the Land. Victoria: Rocky Mountain Books. S. 79. 30 Siehe auch die Beljajew-Theorie, dass das charakteristische Merkmal aller domestizierten Tiere ihre Zahmheit gegenüber Menschen war. Er untersuchte auch, wie man Füchse in Russland zu hundeähnlichen Tieren machen kann. Raisor, M.J. (2004). «Determining the antiquity of dog origins.» S.241. Online verfügbar unter: https://core.ac.uk/download/pdf/4268672.pdf.


