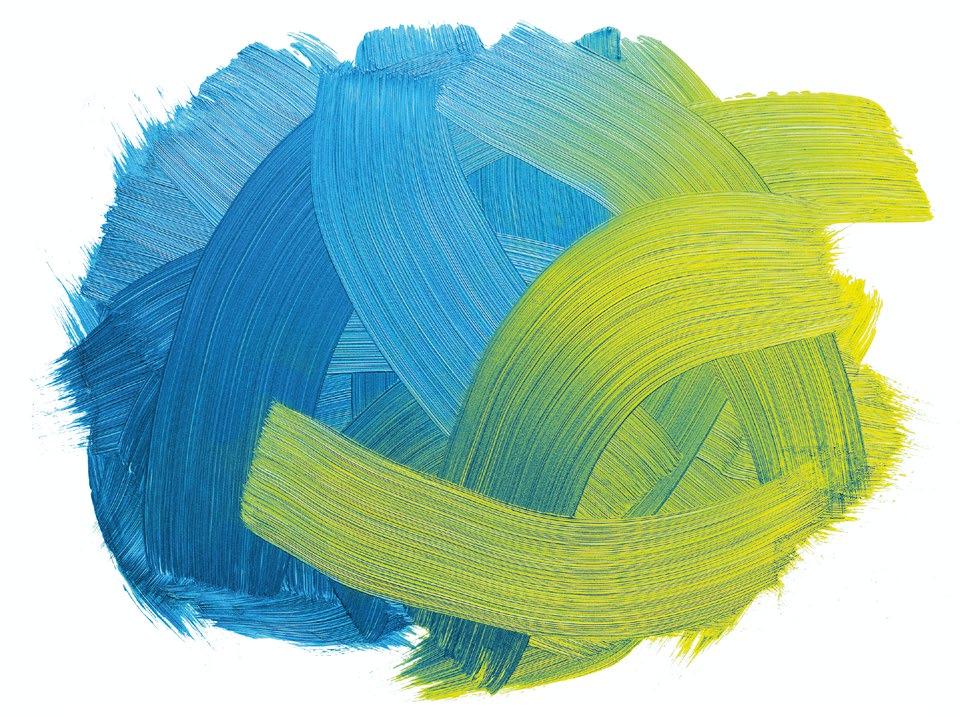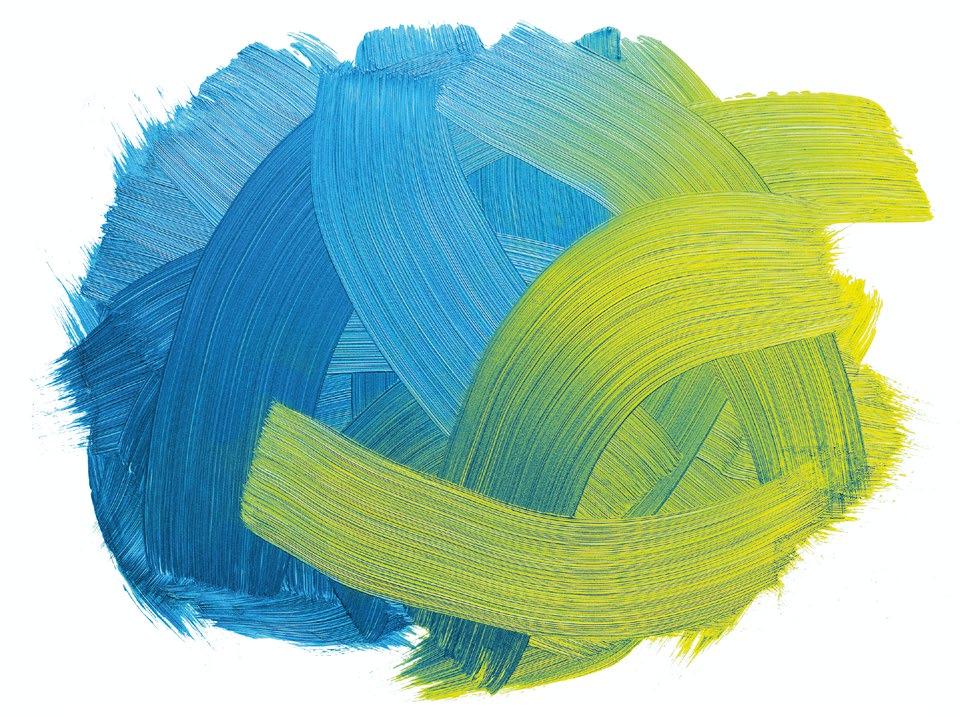
STIFTUNG SUCHT WALLIS EINE
GESCHICHTE
70-JÄHRIGE
Marie-France Vouilloz Burnier
Stiftung Sucht Wallis
zum Jubiläum
Die Vorgeschichte. Vom Kantonalverband des Croix d’Or bis zur Walliser Liga zur Bekämpfung von Alkohol
Ein bewegtes Jahrzehnt
Die Annäherung zwischen der FVAT und der LVT (1989–1990)
Die Entwicklung des stationären Bereichs ab 1992
Die Finanzierung der stationären Einrichtungen
Die Entwicklung des ambulanten Bereichs
Die Weiterentwicklung des Präventionsbereichs
Ein Perspektivenwechsel
Auf dem Weg zu einer neuen Vision für die Betreuung suchtkranker Personen
Die Gründung der Walliser Liga zur Bekämpfung von Alkohol
Die Walliser Liga zur Bekämpfung von Alkohol und ihre Aufgaben
Vom Sittener Dispensarium gegen Alkohol hin zu sozialmedizinischen Diensten
Zusätzliche Aufgaben der Liga
Die Finanzierung der Liga Eine neue Problemstellung
Auf dem Weg zu einer Anpassung der Organisation beim Auftreten der ersten Drogenprobleme
Die Walliser Liga gegen die Suchtgefahren (LVT)
Die Gründung der Walliser Stiftung für Prävention und Behandlung von Alkoholismus und Drogenmissbrauch (FVAT) und des stationären Bereichs
Die Villa Flora, eine Institution für Alkoholabhängige
Die gesetzliche und finanzielle Anerkennung der LVT und der FVAT durch den Kanton
Das Foyer des Rives du Rhône, eine Institution für Drogenabhängige
Ein Informations- und Präventionsauftrag
Auf dem Weg zu einer kritischen Beurteilung der Institution und ihrer Professionalisierung
Streben nach Qualität
Der Kanton als Retter in der Not
Die Teilrevision des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel (BetmG)
Stärkung der Präventions- und Sensibilisierungsbotschaften
Situation der stationären Zentren und Entwicklung von Tagesangeboten
Auf dem Weg zu einer dynamischen Veränderung der Strukturen der LVT
Die Stiftung Sucht Wallis, auf der Suche nach einem Gleichgewicht
Zögerliche erste Schritte
Die Turbulenzen in der Stiftung Sucht Wallis
Auf dem Weg zur Beruhigung
7 8 Vorwort Chronologie
23 24 28 29 30
20
1971 I
1954
74 75 77
72 V 1972 1988 2012 2024 II
34 36 36 37 38 40
32
42 1989 1999 III
44 46 48 49 52 55 57 2000 2011 IV
60 62 63 64 66 69 71 79 81 Schlusswort
90
Fotoprojekt 70 Jahre
Anhang
13
Intro
Grundpfeiler
12 1904 1953
Chronologie
1904
Gründung des Kantonalverbands La Croix d'Or durch den Domherrn Jules Gross
Lösungsansatz für die Problematik des Alkoholkonsums durch Abstinenz und Mässigung
Zusammenarbeit des Croix d’Or mit der Lehrerschaft. Die Schule wird zu einem unverzichtbaren Instrument im Kampf gegen den Alkoholismus
1942
Einweihung des Hilfswerks La Maison Blanche in Salins durch den Verein L’œuvre valaisanne de relèvement et préventorium antialcoolique, die erste Walliser Einrichtung zur Betreuung von Alkoholabhängigen
Gesellschaftliches Engagement auf der Grundlage von Freiwilligenarbeit, Wohltätigkeit und Hingabe
1953
Die Leitung des Maison Blanche wird von Alphonse Loutan übernommen
1954
Gründung der Liga zur Bekämpfung von Alkohol durch Alphonse Loutan und Dr. Pierre Calpini, Leiter der Abteilung für öffentliche Gesundheit
Übertragung der Betreuung von Alkoholabhängigen von Geistlichen an die Ärzteschaft
Eröffnung der ersten Einrichtung für Alkoholkranke in Sitten unter der Leitung von Alphonse Loutan und in Zusammenarbeit mit dem Maison Blanche
Entwicklung der Prävention bei Jugendlichen
Verpflichtung der alkoholabhängigen Person, zu Beginn der Kur die Abstinenz zu unterschreiben
Einführung von Kurmassnahmen zum körperlichen Entzug durch den Einsatz des Antabus-Effekts und zum moralischen Entzug durch soziale Kontrolle
1960
Schliessung des Maison Blanche aufgrund mangelnder Effizienz und fehlender fachlicher Schulung des Personals
1962
Namensänderung der Liga zur Bekämpfung von Alkohol zu Walliser Liga gegen Alkoholmissbrauch
Staatlicher Auftrag an die Liga zur Schulung und Überwachung von Wiederholungstätern bei Alkohol am Steuer
Umwandlung des Dispensariums gegen Alkohol in Sitten in den sozialmedizinischen Dienst mit einer beruflichen Weiterbildung der beiden bisherigen Sozialarbeiter
1963
Eröffnung des sozialmedizinischen Dienstes in Siders
1965
Eröffnung des sozialmedizinischen Dienstes in Martinach
1966
Eröffnung des sozialmedizinischen Dienstes in Brig
Gründung der beratenden Kommission zur Verhinderung von Alkohol am Steuer
1970
Eröffnung des sozialmedizinischen Dienstes in Monthey
Auftreten der ersten Drogenfälle im Oberwallis
1971
Eröffnung des sozialmedizinischen Dienstes in Visp
8
1972
Namensänderung der Liga gegen Alkoholmissbrauch zu Walliser Liga gegen die Suchtgefahren
Gründung der ersten kantonalen beratenden Kommission zur Drogenbekämpfung
Einrichtung der Kontaktzentren in Brig und Sitten, Anlauf-, Beratungsund Informationsstellen für junge Konsumentinnen und Konsumenten, um den Drogenmissbrauch in ambulanter Form zu bekämpfen
1973
Eröffnung des Kontaktzentrums in Martinach
Entwicklung von Präventionsund Informationsaktivitäten in Berufsschulen, im schulischen Umfeld und bei Eltern.
1974
Eröffnung der Kontaktzentren in Monthey und Siders
1975
Gründung der Walliser Stiftung für Prävention und Behandlung von Alkoholismus und Drogenabhängigkeit (FVAT)
Erwerb der Villa Flora in Muraz bei Siders durch die FVAT
1976
Eröffnung und Einweihung der Villa Flora, die 15 bis 20 alkoholabhängige Personen aufnehmen kann, damit sie sich ihrer Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Alkoholmissbrauch bewusst werden
1977
Gesetzliche und finanzielle Anerkennung der LVT und der FVAT durch die Verabschiedung des kantonalen Dekrets zur Umsetzung des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel und psychotropen Stoffe (BetmG)
1980
Verabschiedung des Reglements über die Bekämpfung des Alkoholismus durch den Kanton, das die Aufgaben der LVT (Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention) und ihre Finanzierung (zu 96 %) festlegt, was deren Handlungsspielraum einschränkt
1981
Eröffnung und Einweihung des Foyer des Rives du Rhône für erwachsene Drogenabhängige. Es bietet Platz für 15 Personen und verfolgt einen auf Abstinenz basierenden Therapieansatz, der darin besteht, bei der Person das Gleichgewicht des Bewusstseins auf emotionaler, körperlicher, mentaler und symbolischer Ebene wiederherzustellen
Zunahme des Mehrfachkonsums, Verschärfung des Alkoholproblems bei Jugendlichen
1982
Start der Informations- und Gesundheitsaufklärungsmassnahmen «Topform», Beteiligung an der Schulung und Einführung von Schulmediatorinnen und -mediatoren
1984
Vollständige Subventionierung der FVAT-Heime durch den Kanton (u. a. mit einer Defizitdeckung durch die LVT) und durch den Bund (über das BSV)
1987
Entwicklung von originellen Informations- und Präventionsprogrammen wie «T’as pas 5 minutes ?» oder «Bar Ouvert»
Mitarbeit bei der Ausarbeitung von Methadonprogrammen mit Dreiervertrag (Arzt, Klient, LVTFachkraft) und dem Erlass der daraus resultierenden Richtlinien vom 28. April 1987 über die Verordnung von Methadon an Drogenabhängige in Behandlung
Eröffnung einer Aids-Antenne im Kontaktzentrum Sitten in Zusammenarbeit mit der Walliser Liga zur Bekämpfung der Tuberkulose und Lungenkrankheiten
1989
Pragmatische Annäherung zwischen der FVAT und der LVT, die sich in der Annahme einer Vereinbarung niederschlägt
1990
Inkrafttreten der FVAT-LVTVereinbarung, die eine originelle und in der Schweiz einzigartige Struktur schafft, durch welche die FVAT die administrative und buchhalterische Leitung ihrer Heime der LVT überträgt, während sie ihre Vorrechte bezüglich ihrer Infrastruktur und das Personalmanagement behält
Gründung der Konzeptkommission, deren Aufgabe es ist, Optionen zur Bekämpfung der Drogensucht in den Bereichen ambulante und stationäre Hilfe sowie Information, Schulung und Prävention zu erarbeiten
Gründung der Drogenforen in Zusammenarbeit mit der Walliser Ärztegesellschaft und den psychiatrischen Institutionen des französischsprachigen Wallis; ein in der Schweiz einzigartiges Modell zur Annäherung der im Suchthilfedispositiv engagierten Partner
9
1992
Bestätigung der vom Kanton Wallis gewählten Politik zur Bekämpfung der Drogensucht, die Repression, verstärkte Prävention, Erleichterung des Übergangs von einer Strafanstalt zu einer Therapieeinrichtung, Methadonersatztherapie und ambulante Betreuung umfasst
Eröffnung und Einweihung des Foyer François-Xavier Bagnoud in Salvan, das dieselbe Betreuungsphilosophie wie das Foyer des Rives du Rhône in Sitten vertritt
Eröffnung und Einweihung des Reha-Zentrums in Gampel mit einer Kapazität von zwölf Plätzen für die Aufnahme von alkoholabhängigen Personen für Kurzaufenthalte
Umstrukturierung der Villa Flora mit der Einführung eines überarbeiteten und originellen Konzepts zur Rehabilitation und beruflichen Wiedereingliederung
Entflechtung der Betreuung von Alkohol- und Drogenabhängigen
Gründung der Hilfs- und Präventionszentren (CAP) durch die Zusammenlegung der sozialmedizinischen Dienste mit den Kontaktzentren
Unterstützung bei der Gründung der Vereinigung von Betroffenen mit Drogenproblemen
Anstieg der tödlichen Überdosierungen und der Aids-Fälle
1994
Annahme des Entwicklungsprojekts des LVT (Einrichtung eines Präventionsfonds als Finanzierungsquelle für künftige Präventionsmassnahmen der LVT) durch den Staatsrat, nachdem das BSV einen den Anspruch auf Subventionen für seinen ambulanten Sektor genehmigt hat
1996
Verabschiedung der Verordnung über Drogenabhängigkeit durch den Staatsrat, mit der das Dekret von 1977 über die Anwendung des BetmG und das Reglement von 1980 zur die Bekämpfung des Alkoholismus aufgehoben werden
In Zusammenarbeit mit dem Groupement romand d’étude sur l’alcoolisme (GREA) wird im Bereich Prävention das interaktive Tool «Café Saïgon» realisiert, das in drei Landessprachen verfügbar ist und in der gesamten Schweiz eingesetzt wird
1997
Verabschiedung der Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen dem Gesundheitsdepartement und der LVT
Anpassung der Statuten der LVT, wobei die 15 Mitglieder des Vorstands auch den Stiftungsrat der FVAT bilden
Schrittweiser finanzieller Rückzug des BSV, was zu einer vorübergehenden Finanzhilfe durch das BAG und einer finanziellen Unterstützung durch den Staat Wallis führt
1999
Beginn der Kampagne zur Senkung des durchschnittlichen Alkoholkonsums «wie viele?» (2007 eingestellt), die auf einem innovativen Konzept beruht, das Humor in die Präventionsbotschaften einbringt
Entwicklung einer Stelle für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter mit Unterstützung und Aufsicht der Gruppe RISQ, die der Universität Montreal angegliedert ist
Annäherung des Reha-Zentrums an das Psychiatriezentrum Oberwallis (PZO)
2001
Ausarbeitung und Beteiligung an der Entwicklung des Sozialkonzepts und der Präventivmassnahmen des Casinos Saxon
Einführung eines Instruments, mit dem die Schwere der Probleme im Zusammenhang mit dem übermässigen Konsum von Drogen und Alkohol bewertet und der zusätzliche Behandlungsbedarf quantifiziert werden kann
2002
Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems QuaTheDA für jedes Wohnheim und den ambulanten Bereich der LVT
Namensänderung des RehaZentrums in Gampel zu via Gampel anlässlich seines zehnjährigen Bestehens
2003
Integration aller Dienste in die harmonisierte nationale Statistiksammlung act-info
Einführung eines neuen Finanzierungsmodells für die Wohnheime der FVAT nach der Einstellung ihrer Subventionierung durch den Bund mit der Einführung eines neuen Leistungsvertrags zwischen der LVT und dem Kanton Wallis
2004
Einführung des Labels Fiesta (zur Risikominderung im Partybereich) in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern, darunter die Kantonspolizei, die Gemeindepolizeien, dem Verband der Walliser Gemeinden und die kantonale Dienststelle für Gesundheitswesen
10
2008
Engagement der LVT auf Westschweizer und Bundesebene bei der Umsetzung einer koordinierten Politik zur Bekämpfung von Alkohol, Drogen und stoffungebundenen Süchten
Annahme der Teilrevision des Betäubungsmittelgesetzes durch die Schweizer Bevölkerung, welche die Vier-Säulen-Politik des Bundes (Prävention, Therapie, Schadensminderung, Repression) bestätigt
Verabschiedung des neuen Gesundheitsgesetzes, das den Bereich der Prävention auf Alkoholismus und andere Suchtarten ausweitet und die beratende Kommissionen zur Bekämpfung von Drogenmissbrauch verankert
Erweiterung des Auftrags der LVT, um Präventionsmassnahmen gegen Spielsucht zu schaffen und verschiedene Betreuungsmöglichkeiten für abhängige Personen anzubieten
Ausbau des Angebots an Tagesangeboten in der Villa Flora und via Gampel zur Rückfallprävention
Staatliche Gründung des Zentrums für Indikation und Betreuung durch die Dienststelle für Sozialwesen, die Einweisungsanträge in subventionierten Sozialeinrichtungen im Behinderten- und Suchtbereich beurteilt
2009
Umwandlung der Position des Generalsekretärs der LVT in die eines Generaldirektors
2011
Annahme neuer Statuten, die den Übergang der LVT in die FVAT festlegen, welche den Namen Stiftung Sucht Wallis annimmt
2012
Beginn der Tätigkeit der Stiftung Sucht Wallis, deren Organisation aus΄einem ambulanten und einem stationären Sektor sowie einem Leistungszentrum zur Unterstützung ihrer Tätigkeiten besteht
2015
Umsetzung einer Neuorientierungsstrategie mit organisatorischen Veränderungen in den Führungspositionen, die eine echte Kultur der Zusammenarbeit zwischen allen Bereichen von Sucht Wallis einführen soll
2017
Angekündigter Abbruch der Zusammenarbeit mit Sucht Wallis durch die Association des amis et anciens des Rives du Rhône
Unabhängige Studie im Auftrag des Staatsrats über die Begleit-, Leistungs- und Betriebskonzepte der Stiftung. Sie empfiehlt, die Stiftung als kantonale Referenzinstitution beizubehalten, empfielt jedoch die Einführung eines Konzepts für das Personalmanagement
2018
Übertragung der Aktivitäten im Bereich der Primärprävention an Gesundheitsförderung Wallis im Rahmen einer Zusammenarbeitsvereinbarung
Erhalt der Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems QuaTheDA für die gesamte Stiftung
Eröffnung des Jardin des Berges im renovierten Gebäude des ehemaligen Foyer des Rives du Rhône in Sitten und damit Ende der Existenz von Rives du Rhône innerhalb der Stiftung
Einführung von JobcoachingLeistungen im Oberwallis
2019
Umwandlung der Villa Flora in ein Tageszentrum
2022
Einführung von Leistungen der sozialtherapeutischen Unterstützung zu Hause (STUZ)
2023
Annahme des neuen Begleitkonzepts von Sucht Wallis, das die Recovery-Philosophie in der Stiftung verankert
Erste Frau an der Spitze der Institution in der Person von Rechtsanwältin Géraldine Gianadda
11
Grundpfeiler zum Jubiläum
Die Stiftung Sucht Wallis wurde offiziell am 1. Januar 2012 gegründet. Ihre Tätigkeit geht jedoch bis ins Jahr 1954 zurück, unter dem ersten Namen Walliser Liga zur Bekämpfung von Alkohol, die sich zur Walliser Liga gegen Alkoholmissbrauch und später zur Walliser Liga gegen die Suchtgefahren weiterentwickelte, parallel zur Entwicklung der Walliser Stiftung für Prävention und Behandlung von Alkoholismus und Drogenmissbrauch.
Die Stiftung feiert somit im Jahr 2024 ihr 70-jähriges Bestehen. Dies ist ein perfekter Anlass, um auf die Entwicklungsgeschichte dieser in der Schweiz einzigartigen und oft innovativen Organisation zurückzublicken, die im so besonderen Bereich von Abhängigkeit und Sucht tätig ist. Die vorliegende Publikation zeichnet diese Entwicklung in fünf Kapiteln nach, die von
visionären oder bahnbrechenden Persönlichkeiten und wichtigen Paradigmenwechseln geprägt sind. Diese Meilensteine werden im Zusammenhang mit den Entwicklungen des soziopolitischen Kontexts im Wallis, des Konsums von Substanzen und der damit verbundenen Problematik, der Prävention und der professionellen Begleitung von Suchtkranken sowie der Rolle von Bund, Kanton und Gemeinden betrachtet.
12
1953
1904
Einleitung
Die Vorgeschichte. Vom Kantonalverband des Croix d’Or bis zur Walliser Liga zur Bekämpfung von Alkohol
In einem Kanton, in dem der Weinanbau seit Jahrtausenden von Tradition und Leidenschaft genährt wird1, ist der Wein, der als Geschenk Gottes betrachtet wird, voll und ganz Teil des heiligen Rituals, Ausdruck eines bemerkenswerten alten Fachwissens, Illustration einer von Geselligkeit geprägten Gesellschaft und Symbol für den Rausch des Übergangs ins Erwachsenenalter. Wie kann man sich unter diesen Umständen mit dem Alkoholismus und dem emotionalen, sozialen und familiären Elend, das er hervorrufen kann, auseinandersetzen?
Die Folgen des Alkoholismus für den Einzelnen und seine Nachkommen werden im Wallis wie anderswo seit Urzeiten weitgehend unterschätzt. Als die Walliser Behörden am 20. März 1616 eine Verordnung des Landtags veröffentlichten, die den Verkauf von Wein auf den Märkten von Sitten verbot, wollten sie damit unterstreichen, dass «die Menschen nach dem Trinken am nachlässigsten sind».2 Die Geistlichen, die Weinberge besassen, bezahlten ihre Angestellten jedoch regelmässig mit Wein und schenkten den Wein sogar ihren Pfarrkindern für Prozessionen, bei denen es manchmal zu Verfehlungen kam, die selbst vom Bischof getadelt wurden.3
Ab dem 18. Jahrhundert wurden öffentliche Unruhen, die durch Alkoholmissbrauch verursacht wurden, sowohl in den Gerichtsarchiven, wenn es um Straftaten ging, als auch in den Gemeindearchiven, wenn es um den Missbrauch durch den Besuch von Wirtshäusern ging, und in den Archiven von Familien, wenn es um die Trunkenheit des Hauspersonals oder die der Gäste bei der Organisation von Festen oder religiösen Zeremonien ging, dokumentiert.4
Es dauerte jedoch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, bis auf die Volksgesundheit ausgerichtete und moralistische Geistliche die durch Alkohol verursachten Gefahren für die Würde des Menschen, seine Moral und seine Gesundheit in Betracht zogen. Auf Betreiben der Schweizer Bischöfe entstanden im ganzen Land Gesellschaften für Abstinenz und Mässigung, die sich zur «Schweizerischen Katholischen Abstinenten-Liga» zusammenschlossen. Im Wallis wurden die ersten Vereinigungen für Abstinenz 1886 in Champéry auf Initiative einer Engländerin, 1891 in Sitten auf Druck von drei Geistlichen, 1894 in Leukerbad auf Betreiben von Dr. Joseph de Werra und 1898 in Siders gegründet. Der Domherr Jules Gross, ein herausragender Propagandist der Abstinenz, vereinigte diese kleinen Vereinigungen 1904 in der Föderation der Sektion für Abstinenz und Mässigung des Kantons Wallis, die unter dem Namen Croix d’Or (Goldenes Kreuz) bekannt ist, und wurde deren Sekretär.5 «Das Croix d’Or, eine Bewegung leidenschaftlicher Abstinenzler, verbindet das Heil der Seele mit Nüchternheit und den Rausch mit der höllischen Verdammnis.»6 Neben den Geistlichen waren im Vorstand des Croix d’Or zwei Ärzte vertreten, Dr. Paul Repond, Leiter des Gesundheitszentrums von Malévoz, und Dr. Rodolphe de Riedmatten, der spätere Kantonsarzt7; wie nachfolgend noch erwähnt wird, setzten sie sich für die Anerkennung des Alkoholismus als Krankheit ein, deren Folgen über das Individuum hinausgehen und sich auf die Familie und insbesondere auf die Kinder erstrecken.

13
Die Umgestaltung der Villa Flora
Die aus einer privaten Stiftung hervorgegangene, 1976 gegründete Initiative Villa Flora war ein in der Walliser und Westschweizer Szene anerkanntes
Behandlungszentrum für alkoholabhängige Personen. Während vier Jahrzehnten wurden rund 2500 Personen aufgenommen, um auf dem Weg zu einer besseren Lebensqualität begleitet zu werden. Ihnen wurden ein kurzfristiges
Rehabilitationsprogramm und eine mittelfristige berufliche Wiedereingliederung in einem warmherzigen und für die therapeutische Arbeit geeigneten Rahmen angeboten. Anfang der 1990erJahre versuchte das Zentrum, die Angehörigen und die Familie in den Genesungsprozess einzubeziehen, indem es ein speziell auf sie ausgerichtetes
Leistungsangebot entwickelte. 1986 gründete die Villa Flora eine Gruppe ehemaliger Bewohner, die sich unter dem Namen Amicale «Entre-Nous» zusammenfand und die Vorstufe zum Verein der ehemaligen Sympathisanten der Villa Flora bildete.
Die Umwandlung der Villa Flora in ein Tageszentrum stellt ein bedeutendes Kapitel in der Geschichte der Betreuungspolitik von Sucht Wallis dar.
76
Auf dem Weg zur Beruhigung
Die neue Unternehmensführung der Stiftung besteht nun aus einem siebenköpfigen Stiftungsrat und einem Direktionskomitee, das sich aus dem im November 2018 ernannten neuen Generaldirektor Pascual Palomares, den Verantwortlichen der Sektoren und den Humanressourcen zusammensetzt.246 Gleich bei seinem Amtsantritt erinnerte der neue Präsident, Dr. Ioan Cromec, daran, dass die Stiftung die kantonale Referenz im Bereich der Sucht ist. Mit dem Willen, sich an die Nationale Strategie Sucht 2017–2024 anzulehnen, stellt der Stiftungsrat die Arbeit der Stiftung in Einklang mit der im Eichenberger-Bericht vorgeschlagenen Linie.247 Die Direktion ist bestrebt, die Empfehlungen des Berichts umzusetzen. Dies ist möglich, da die Stiftung dank der neuen Organisation, die vom alten Stiftungsrat konzipiert wurde, und der Erlangung der neuen Qualitätszertifizierung im Oktober 2018 zu einer gewissen Ruhe zurückgekehrt ist.
Im November 2018 wird der Jardin des Berges seine Türen im renovierten Gebäude des ehemaligen Foyer des Rives du Rhône in Sitten mit einem neuen Betreuungskonzept eröffnet. Dieser Meilenstein markiert das Ende der Existenz von Rives du Rhône innerhalb der Stiftung.
Ab 2019, nach der Umwandlung der Villa Flora in ein Tageszentrum, verfügt die Stiftung über zentrale Dienste, fünf ambulante Stellen (Monthey, Martigny, Sitten, Siders und Visp)248, einen stationären Sektor an drei Standorten (via Gampel, François-Xavier Bagnoud, Jardin des Berges), ein Tageszentrum in der Villa Flora, Leistungen der sozialpädagogischen Unterstützung zu Hause sowie Leistungen des Jobcoachings (Unterstützung bei der beruflichen Wiedereingliederung). Die durchlässigen Strukturen zwischen den verschiedenen Bereichen fördern die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die Angemessenheit und Kohärenz der erbrachten Leistungen sowie die Kontinuität der Leistungen innerhalb der Stiftung. Das Ganze wird durch die Einführung des Stepped-CareModells unterstützt, das darauf abzielt, die Leistungen auf das Profil der betreuten Personen abzustimmen.
Das Management von Covid
Die Covid-19-Pandemie hat den Alltag aller Schweizerinnen und Schweizer beeinflusst, auch denjenigen von alkohol- oder drogenabhängigen Personen. Um die Situation dieser Personen nicht zu verschlechtern, hat sich Sucht Wallis laufend an die vom Bund und vom Kanton erlassenen Richtlinien zur Bekämpfung der Pandemie angepasst und gleichzeitig niemanden am Wegrand zurückzulassen. Thomas Urben, Mitglied der Direktion von Sucht Wallis, erklärte: «Wir müssen Verbindungen fördern, damit sie sich die Betroffenen nicht so allein und unterstützt fühlen. Sie brauchen Kontakte, denn das Risiko eines Rückfalls oder eines Abbruchs der Beziehung ist sehr hoch.» Sucht Wallis hat daher sehr schnell Massnahmen eingeleitet, um die Fortsetzung der ambulanten soziotherapeutischen Begleitung auf Distanz durch Gespräche per Telefon oder Videokonferenz zu gewährleisten.
Nach fünf Jahren akuter Krise und mit wiederhergestellten Vertrauensverhältnissen innerhalb und ausserhalb der Stiftung hat sie endlich zu Ruhe gefunden. Als Thomas Urben, Leiter des ambulanten Sektors, 2021 die Nachfolge von P. Palomares antritt, vergewissert sich der Präsident des Stiftungsrats auf diese Weise, dass die Struktur solide und das Personal kompetent ist.249 In Absprache mit dem Stiftungsrat erstellt der neue Direktor einen strategischen Plan 2023–2027, in dem die grundlegenden strategischen Achsen festgelegt werden. Um die Personen zu begleiten, entscheidet sich die Direktion für ein neues Konzept der Begleitung, das sich an der Genesung (Recovery) orientiert. Die strategische Priorität der Stiftung besteht seither in der Individualisierung der Leistungen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse, Motivationen und Ressourcen jeder/jedes Einzelnen: «Der Inhalt der Leistungen muss es der Person ermöglichen, neue Fähigkeiten zu erwerben, ihre Handlungsfähigkeit zu festigen und zu stärken und eine positive Vision von sich selbst zu schaffen.»250 Die Person wird bei der Realisierung ihres eigenen Projekts von Personal begleitet, das über Qualitäten der Bescheidenheit und des Engagements für eine reflexive Praxis verfügt. Diese Praxis wird nur durch eine angemessene Betreuung der Fachkräfte ermöglicht, die durch interne Schulungen motiviert werden, die «die Reflexion fördern, den kritischen Geist schärfen und die Fähigkeit erhöhen, in ihrem beruflichen Umfeld selbstständig zu handeln.»251
Schliesslich übernimmt Géraldine Gianadda am 1. Juni 2023 den Vorsitz des Stiftungsrats von Dr. Ioan Cromec, der Mitglied des Stiftungsrats bleibt.
77
Schlusswort
Dieser 70-jährige Weg der Stiftung Sucht Wallis zeigt, dass der Kampf gegen die verschiedenen Formen der Abhängigkeit ein langwieriges Unterfangen ist, das sich, wie das Spitalsystem des Kantons, ausserhalb der staatlichen Vormachtstellung strukturiert, dank der privaten Initiative und der Mobilisierung einiger Persönlichkeiten. Unter ihnen Pierre Calpini, Kantonsarzt und Mitbegründer der Walliser Liga zur Bekämpfung von Alkohol, der sich regelmässig beim Kanton dafür einsetzte, die Aktivitäten der Liga zu finanzieren, ihr aber gleichzeitig eine weitgehende Autonomie bei der Wahl ihrer Therapiekonzepte gewährte.
Im Wallis wie auch in Frankreich stellt der Kampf gegen den Alkoholismus das erste soziale Engagement dar, das darauf abzielt, «das Volk vor der Knechtschaft des Alkohols zu retten».252 Geistliche und Ärzte taten sich zusammen, um in den Schulen Alkoholprävention zu betreiben und damit eines der Gründungsprinzipien der Liga einzuführen, lange bevor der Kanton in diesem Bereich gesetzgeberisch tätig wurde. Sie legten eine repressive und moralische Linie fest, welche die sozialmedizinischen Betreuungsprozesse prägte und das Streben nach Abstinenz um jeden Preis zur Folge hatte. Doch auch nach sieben Jahrzehnten der Prävention bleibt Alkohol im Wallis die am häufigsten konsumierte Suchtquelle, wenngleich der Konsum seit 1992 stetig zurückgeht.253 Die Lobbygruppen des Alkoholsektors (Weinbauern, Gastwirte, Händler) beeinflussen nachhaltig die Politik des Kantons, die sich noch im Jahr 2000 im Gegensatz zu den Fachpersonen vor Ort für die Revision eines Betäubungsmittelgesetzes einsetzte, das auf illegale Substanzen beschränkt ist.254
Parallel zum Kampf gegen den Alkoholismus sah sich die LVT ab Anfang der 1980er-Jahre mit der grossen Herausforderung der wachsenden Drogenabhängigkeit konfrontiert. Der Kanton beauftragte sie mit der Ausarbeitung von Präventionsprojekten, der Einrichtung eines Dienstes für schulische Mediation, der Konzeption einer Aids-Hilfe und der Mitarbeit an der Entwicklung der Methadon-Substitutionstherapie. Sie ist sich der Notwendigkeit bewusst, die «Repression-Abstinenz»-Politik weiterzuentwickeln, und beteiligt sich aktiv an der Umsetzung der Vier-Säulen-Politik des Bundes, die den Menschen in den Mittelpunkt der
sozialen Anliegen stellt und die Lebensbedingungen von Drogenkonsumenten und -konsumentinnen verbessern, die Sterblichkeitsrate von Drogenabhängigen senken und die Drogenkriminalität verringern soll. Die Walliser Drogenpolitik orientiert sich an der Bundespolitik, bewahrt jedoch einige Besonderheiten, die auf die Situation eines von den grossen städtischen Zentren weit entfernten Kantons zurückzuführen sind.
Mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts wird der Bereich der Sucht auf stoffungebundene Süchte wie Glücksspiel und Internetsucht ausgeweitet. Mit ihrem strategischen Plan 2023–2027 möchte die Stiftung Sucht Wallis die Politik für das breite Feld der Sucht sensibilisieren, ihren Leistungsempfängerinnen und -empfängern kohärente, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Leistungen anbieten, zugängliche und qualitativ hochwertige Infrastrukturen bereitstellen und eine angemessene Personalführung gewährleisten.255 Die Einführung von Crack, der Droge der Armen, einem billigen, stark süchtig machenden Produkt mit heftigen Nebenwirkungen, stellt die Suchtpolitik auf den Kopf. Es braucht innovative Lösungen, um die zunehmende Prekarität auf dem Land und in den Städten zu bekämpfen. Das GREA fordert eine fünfte Säule, um mehr Mittel bereitzustellen für die Gesundheit, die Wohnsituation und die soziale Eingliederung von Menschen, die unter dem Einfluss dieser Geissel stehen.256 Auch die Frage der Entkriminalisierung des Konsums und der Regulierung des Markts für psychotrope Substanzen ist wieder in den Vordergrund gerückt. Ruth Dreifuss, die Pionierin der Vier-Säulen-Politik, sagte, dass das Drogenverbote ebenso falsch seien wie die Bestrafung der Konsumenten und das Überlassen des Markts in kriminelle Hände.257 Darin stimmt sie mit der Eidgenössischen Kommission für Fragen zu Sucht und Prävention nichtübertragbarer Krankheiten (EKSN) überein, die einen neuen Weg sucht und eine bestimmte Form der Regulierung vorschlägt, die der Kriminalisierung vorzuziehen ist. Es geht darum, den Markt besser zu kontrollieren, die Prävention gezielter einzusetzen und für eine bessere Qualität der Drogen zu sorgen, ohne jemals Suchtmittel zu fördern.258
79
Dieses durch Marie-France Vouilloz Burnier verfasste Werk schildert die 70-jährige Geschichte der Stiftung Sucht Wallis seit ihrer Entstehung im Jahr 1954 unter dem Namen Walliser Liga zur Bekämpfung von Alkohol. Sie erinnert an die spannenden Etappen ihrer Entwicklung im gesamten Wallis, die von visionären und bahnbrechenden Persönlichkeiten getragen wurde und geprägt war von wichtigen Paradigmenwechseln in der Prävention und der professionellen Begleitung von Personen, die von einer Abhängigkeit oder Sucht betroffen sind.
Marie-France Vouilloz Burnier ist freiberufliche Historikerin und promovierte in Erziehungswissenschaften an der Universität Genf. Sie hat mehrere Bücher im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens, der medizinischen Berufe, der Kleinkinderbetreuung und der Geschichte der Frauen veröffentlicht. Sie ist Mitbegründerin des Vereins Via Mulieris zur Förderung der Forschung von und über Frauen im Wallis und unter anderem Autorin von Marie-Rose Zingg et la Pouponnière valaisanne. Une pionnière de l’accueil de la petite enfance, Les Cahiers de Vallesia, Sitten, 2021.
Unter der künstlerischen Leitung von Alexia Turlin beauftragte die Stiftung Sucht Wallis die Fotografin Florence Zufferey und den Fotografen Olivier Lovey, beide aus dem Wallis, mit einem Projekt, das zum Nachdenken anregen, das Unsichtbare sichtbar machen und das Stigma von Suchterkrankungen überwinden soll. Die Fotos am Ende des Buchs sind in diesem Rahmen entstanden und werden in die Kunstsammlung des Kantons Wallis aufgenommen, der dieses Projekt grosszügig unterstützt.