
34 minute read
KULTUR
@engagiert
Instagram erreicht vor allem junge Menschen. In dem bildstarken Online-Netzwerk machen sich auch Künstler_innen für Menschenrechte stark. Eine Auswahl von Malte Göbel
Advertisement
Instagram rückt Fotos in den Mittelpunkt und trifft damit den Zeitgeist junger Menschen wie derzeit kein anderes soziales Medium. Der Kanal ist nicht so überladen wie Facebook, nicht so aufwändig wie TikTok, nicht so textbasiert wie Twitter. Ein Foto, egal ob lange inszeniert oder schnell geschossen, kann einen unmittelbar berühren. Kein Wunder, dass auch und gerade Künstler_innen Instagram für sich entdeckt haben – einige von ihnen machen sich mit ihrer Kunst explizit für Menschenrechte stark. Um die Accounts anzusehen, muss man sich übrigens nicht die App herunterladen – es reicht ein normaler Browser mit der Adresse: www.instagram.com/ [Accountname].
@smishdesigns
Die indische Künstlerin Smish ist seit 2019 auf Instagram und hat inzwischen knapp 54.000 Abonnent_innen. »Ich äußere mich zu Dingen, die mir am Herzen liegen, Diskriminierung und Ungleichheit«, beschreibt sie im Podcast Redesyn ihre Arbeit. Smish ist ein Pseudonym, ihren bürgerlichen Namen will sie im Zusammenhang mit ihrer aktivistischen Arbeit nicht angeben – aus Angst, sexistischen Repressionen ausgesetzt zu sein, denn die Rechte von Frauen sind oft Thema ihrer Werke. So fordert sie etwa einen besseren Zugang zu Verhütungsmitteln und das Recht auf Abtreibung. Als im September 2020 indische Bauern massenhaft gegen die Landwirtschaftspolitik protestierten, schuf Smish ein Porträt des indischen Premierministers Narendra Modi im Stil von Obamas ikonischem »Hope«-Plakat – nur dass darunter »Shame« stand. Die Künstlerin zeichnet vor allem digital und reduziert ihre Zeichnungen auf das Wesentliche, dazu verwendet sie klare Farben – mit Erfolg, wie sie im Podcast erzählt: »Instagram ist eine tolle Plattform für Künstler und Grafikdesigner, um die eigene Arbeit zu zeigen und sich mit anderen Künstlern zu vernetzen, deren Werk man mag.« Als sie anfing, habe sie vor allem für sich selbst gemalt. »Aber dann hat mich Instagram sehr motiviert und mir geholfen, zu wachsen.«
@vhils
Auf Instagram ist der Streetart-Künstler Alexandre Farto unter seinem Pseudonym Vhils ein Star – fast eine halbe Million Menschen folgen dem bärtigen Portugiesen, der Kunst per Kratztechnik schafft: Statt Farbe aufzubringen, raut er Oberflächen auf, bohrt, sprengt oder schlägt den Putz weg und visualisiert so Konturen und Muster, die sich zu meist großflächigen Bildern formen. »Scratching the Surface« nennt Vhils die Technik und beschreibt auch seinen politischen Anspruch, nicht oberflächlich schöne Bilder zu schaffen, sondern tiefer zu gehen und der eigenen Kunst eine Bedeutung zu geben. Oft setzt sich Vhils mit der Menschenrechtslage in Brasilien auseinander, 2018 hat er etwa in Kooperation mit Amnesty International ein überlebensgroßes Porträt von Marielle Franco in eine Betonwand gekratzt. Die Aktivistin wurde im März 2018 ermordet, weil sie sich in ihrer brasilianischen Heimat für Schwarze Frauen, LGBTI und
Foto: Instangram/@smishdesigns

smishdesigns. Die indische Künstlerin Smish zum #WorldWaterDay. vhils. Der portugiesische Künstler vor einem seiner Murals in Beja.
Jugendliche eingesetzt hatte. »Dass ich mit meiner Kunst auf ihre Geschichte hinweisen kann, ist für mich ein Privileg«, sagte Vhils damals. Auf Instagram postet der 34-Jährige alle paar Tage Fotos seiner Werke und Making-Of-Videos. Er ist längst in den Galerien dieser Welt angekommen und bearbeitet die verschiedensten Materialien, etwa Möbel oder Türen, er filmt und druckt, am beeindruckendsten sind jedoch seine großflächigen Werke an Häuserfassaden, inzwischen meist Auftragsarbeiten. Im Sommer 2020 schuf er vor einem Krankenhaus in der portugiesischen Stadt Porto ein Wandbild, um den Beschäftigten für ihr Engagement in der Corona-Pandemie zu danken.
@ich_bin_barbara
»Das Kleben ist schön« steht auf dem Instagram-Account von »Barbara.« (mit Punkt), der knapp 370.000 Abonnent_innen hat. Barbara. ist bekannt für ihre künstlerischen Interventionen im öffentlichen Raum: Ein Spruch in weißen Buchstaben auf einem schwarzen Plakat, hingeklebt und fotografiert, eignet sich perfekt für Instagram! So klebte sie zum Beispiel unter die Werbung eines Sportstudios »Gezielte Behandlung von Problemzonen« den Kommentar: »Die Missachtung der Menschenwürde ist hier die einzig wahre Problemzone.« Vor eine Kebab-Imbissbude hängte sie ein Schild mit der Aufschrift: »Fremdenhass, das ist bekannt, endet oft hungrig am Dönerstand.« 2017 war sie mit der Initiative Viva con Agua in Uganda und klebte dort an einen Brunnen das Schild: »Build wells not walls.« 2016 hatte sie bereits die Kampagne unterstützt und ein Schild aufgehängt: »Armut ist krass, Durst ist noch krasser, Viva con Agua, Leben braucht Wasser.« Wegen ihrer politisch bewussten Kunst wird Barbara. auch als »der deutsche Banksy« bezeichnet. Dazu passt, dass kaum etwas über ihre Person bekannt ist – ihre Kunst tauchte zunächst in Berlin auf, dann in Heidelberg und dann über ganz Deutschland verteilt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung vermutete hinter dem Namen ein Kollektiv aus mehreren Künstler_innen. Zuletzt versteigerte sie ein Spruchband mit der Aufschrift: »Hass ist krass. Liebe ist krasser.« Der Erlös ging an die Seenotrettung der Mission Lifeline im Mittelmeer.
@thefakepan
Der Comic-Zeichner Pan Cooke hat als thefakepan rund 360.000 Abonnent_innen auf Instagram – dafür ist Cooke erstaunlich bescheiden, in seiner Kurzbiografie steht: »Still learning.« Das bezieht sich jedoch nicht auf Kunst oder Zeichnen – sondern auf Politisches. Künstlerisch ist Pan Cooke kein Anfänger, der 1990 geborene Ire wurde mit Straßenkunst in Dublin bekannt und verdient sein Geld vor allem mit Porträts. Erst 2019 startete er seinen Cartoon-Account thefakepan mit zunächst autobiografisch gefärbten Strips. Politisch wurde es ab Juni 2020, als nach dem Tod von George Floyd die Black-Lives-Matter-Bewegung laut wurde. »Meine eigene passive Unkenntnis war der Hauptgrund für meine Comics«, sagte Cooke im Interview mit der Website artshelp.net. »Ich hatte mit ihnen ein einfaches Ziel – mich selbst kreativ weiterzubilden.« Er recherchierte über Fälle von Polizeigewalt und fasste sie in kurzen Comics zusammen, etwa über Eric Garner, Tamir Rice und Breonna Taylor. Seine prägnante grafische Darstellung fand schnell Fans, die Like-Zahlen verzehnfachten sich. Inzwischen liegt sein Schwerpunkt auf Menschenrechtsverletzungen überall in der Welt, auch in SaudiArabien und der Türkei.
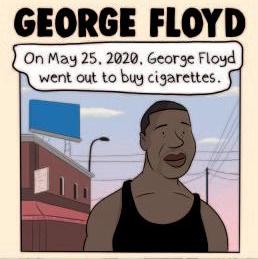
Foto: Instangram/@ich_bin_barbara

ich_bin_barbara. Barbara. auf der Woche des Erinnerns in Dresden. thefakepan. Der Zeichner Pan Cooke zu Rassismus in den USA.
Mit Worten nach Hause finden
Die syrische Lyrikerin Lina Atfah ist vor sieben Jahren vor dem Assad-Regime geflohen. Sie lebt nun in Wanne-Eickel. Inzwischen befassen sich ihre Gedichte mit ihrem Leben in Deutschland. Von Elisabeth Wellershaus
Salamiyya ist hässlich«, sagt Lina Atfah. »Aber auf eine ganz romantische Art«. Ihr Mund verzieht sich zu einem breiten Lächeln, das die Zweidimensionalität des Bildschirms für einen Moment auszuhebeln scheint. Die 32Jährige sitzt in ihrem Wohnzimmer in Wanne-Eickel, ich aus Mangel eines ruhigen Raums in meinem Badezimmer in Berlin. Und ihre Erzählungen transportieren uns an einen Ort, der sie bis heute nicht loslässt. Ihre Heimatstadt habe sie als Schriftstellerin und Lyrikerin stark geprägt, erzählt Atfah. Auf den ersten Blick sei die kleine syrische Stadt am Rande der Wüste nichts Besonderes. Zwar gebe es eine große kulturelle Vielfalt, ansonsten aber vor allem unfruchtbares Land und seit jeher zu wenig Arbeit. Nur eines sei an Salamiyya bemerkenswert: die Dichte an schriftstellerischem Talent. »In meiner Kindheit schienen fast alle Menschen um mich herum zu schreiben«, erzählt Atfah. »Gedichte, Kurzgeschichten oder Romane – alles, was die Situation in der Stadt und im Land reflektierte. Es gab einfach nicht viel anderes zu tun.«
Atfahs Familie wohnte in Salamiyya direkt neben einem Friedhof. Zwischen den Gräbern tobte sie zusammen mit ihrer Schwester und den Kindern aus der Gegend umher. Im Dezember zog sie mit ihnen durch die Stadt, wenn ihr Onkel – je nach Stimmungslage – als Weihnachtsmann oder Gorilla verkleidet, in Salamiyya Geschenke verteilte. Im Frühling saß sie unter dem Orangenbaum im Innenhof ihres Hauses und ersann erste Gedichte. Als der Friedhof irgendwann in einen »kahlen Park« umgewandelt wurde, hatte sie sich bereits mit dem Tod ausgesöhnt, sagt Atfah. Doch da begannen die Probleme gerade erst.
Wegen eines Gedichts zum Verhör
Bereits als Jugendliche trat Atfah regelmäßig im Literaturhaus der Stadt auf, das ihr Großonkel vor seiner Inhaftierung geleitet hatte. Sie war vier Jahre alt gewesen, als er nach zwölf Jahren Haft unter dem damaligen Präsidenten Hafiz al-Assad entlassen wurde, und zwölf Jahre, als sie ihr erstes Gedicht vortrug. Die »oppositionelle Gesinnung« innerhalb der Familie war ausgeprägt, und das spiegelte sich in ihrem Schreiben. Atfah war mit einem Bewusstsein für die politischen Verhältnisse aufgewachsen, auch mit dem Wissen um die ständige Gefahr von Verhören und Verhaftungen. Und doch war sie nicht darauf vorbereitet, eines Tages selbst ins Visier der Behörden zu geraten. »Das Gedicht, das alles für mich verändert hat, war eigentlich nichts Besonderes«, sagt Atfah heute. Das Werk einer 17-Jährigen, die sich über den desolaten Zustand ihrer Umgebung ausließ, das Militär kritisierte und sich leise fragte, ob Gott sich nicht schlecht fühle, bei all der Ungerechtigkeit. Kurz nachdem sie es vorgetragen hatte, wurde sie zum Verhör geladen. Auch ihr politisch engagierter Vater wurde in der folgenden Zeit immer häufiger verhört, Jahre später inhaftierte man ihre Schwiegermutter. Irgendwann ging es für Atfah nur noch darum, den richtigen Zeitpunkt abzupassen, um die Flucht anzutreten und ihrem Mann nach Deutschland zu folgen.
Kurz vor der Flucht im Jahr 2014 hatte der syrische Geheimdienst Atfah ein Angebot gemacht: Sie müsse lediglich ein Lobgedicht auf Baschar al-Assad schreiben und man würde sie mit Freuden in Syrien behalten, ihr Talent und Schreiben fördern und feiern. Atfah entschied sich dagegen, und so gab man ihr eine Warnung mit auf den Weg: »Du hast immer noch Familie hier, also pass gut auf, was Du in Deutschland schreibst.«

Schreiben aus Tradition. »In meiner Kindheit schienen fast alle Menschen um mich herum zu schreiben«, sagt Lina Atfah.
Ihre Eltern, Geschwister, der Ehemann – sie alle leben heute in Deutschland. Atfahs 87-jährige Großmutter aber lebt noch in Salamiyya. Ihr Onkel Thaer, der sich nicht mehr als Weihnachtsmann verkleidet, arbeitet heute als Totenwäscher. Ihr Großonkel liegt seit zwei Jahren in Salamiyya begraben. Bis heute prägt sein Schicksal ihre Arbeit als Lyrikerin. Er hat sie in die Welt der Worte eingeführt, hat ihre Verbindung zur Lyrik geprägt, auch weil diese Welt ihm selbst nie ganz zugänglich war. Sein Vater hatte ihm das Dichten mit der Rute ausgetrieben, als er in der Religionsstunde anstatt einer Freitagsrede ein Gedicht vortrug. »Ich glaube, er hat mich deshalb schon als Kind ermutigt, mich in meinen Texten auszudrücken«, sagt Atfah heute. Aktuell schreibt sie einen Roman über jenen Mann, den sie Großvater nennt. Doch das Schreiben fällt ihr schwer. »Die Erinnerungen an Salamiyya sind übermächtig«, sagt sie und hebt hilflos die Schultern. Sie erzählt von Alpträumen, in denen die Straßen von Salamiyya mit denen von Wanne-Eickel verschmelzen. Davon, dass der Schmerz über das Zurückgelassene einen Raum braucht, in dem er sich sortieren kann.
Schlafstörungen im Gepäck
Als Lina Atfah in Deutschland ankam, trug sie ein weißes Kleid, ihren Hochzeitsschleier und hatte Schlafstörungen im Gepäck. Noch immer hat sie sich nicht gänzlich vom Schock des Verlusts und des Ankommens erholt. Aber die Lyrik hat sie zurück ins Leben geholt. Über Literaturinitiativen und Kontakte fand sie Möglichkeiten, ihre Texte in Deutschland zu veröffentlichen. Nach zehn Jahren steht sie endlich wieder auf Bühnen, tauscht sich mit anderen Autorinnen aus. Manchmal schreibt Atfah noch über die Vergangenheit, aber sie schreibt auch über Wanne-Eickel, wo sie mit ihrem Ehemann Osman Yousufi lebt, der ihre Gedichte ins Deutsche übersetzt. Sie schreibt darüber, wie sie in der Stille des ersten Corona-Jahres Fahrradfahren gelernt hat oder über ihr Unbehagen mit der deutschen Einwanderungspolitik.
Ohne ihren Großonkel, sagt sie, wäre es vermutlich nie soweit gekommen. Ohne ihn hätte sie als Zwölfjährige vermutlich kaum ihre erste Lesung gehalten. In den Jahren bis zur Flucht – als sie nicht mehr auftreten durfte – war er ihr Publikum, vor dem sie sich literarisch ausprobieren konnte. Vielleicht stünden ihre Geschichten sonst heute nicht in der Vogue und auf Zeit Online. Und alte Gedichte von ihr lägen nicht zusammen mit dem Hochzeitsschleier im Auswandererhaus in Bremerhaven.
Doch mittlerweile wird Atfahs Stimme in Deutschland gehört. Sie hat den LiBeraturpreis und den Kleinen Hertha KoenigLiteraturpreis gewonnen – für letzteren hatte Nino Haratischwili sie vorgeschlagen. In den literarischen Briefwechseln der beiden Autorinnen lässt sich eine außergewöhnlich starke Verbindung herauslesen. »Schreib’ mir Nino«, heißt es in einem von Atfahs Briefen, »weil ich jedes Mal, wenn ich deine Worte lese, den Rückweg nach Hause finde«. Es ist der Austausch mit anderen Autorinnen, der Atfah das Gefühl von Zugehörigkeit vermittelt: Mit dem Schreiben ist sie angekommen.
Von Utopien und Realitäten

Kritischer Blick. Der Rechtsanwalt Wolfgang Kaleck untersucht die Lage der Menschenrechtsarbeit.
Die Menschenrechte sind eine konkrete Utopie, für die es sich zu kämpfen lohnt. Davon ist der Berliner Rechtsanwalt Wolfgang Kaleck überzeugt. In einem Essay analysiert er aktuelle Herausforderungen und zeigt Perspektiven auf. Von Wera Reusch
Von außen betrachtet mute die tägliche Menschenrechtsarbeit wenig strategisch an, stellt Wolfgang Kaleck fest: »Oft reagieren wir zu spät, mit unzureichenden Mitteln, machtlos angesichts der gewaltigen Gefahren. Trotz oder gerade wegen dieser alltäglichen Belastungen kommen wir nicht umhin, unsere Praxis kritisch zu reflektieren.« Der 60-Jährige gründete 2007 gemeinsam mit anderen international aktiven Anwältinnen und Anwälten das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) in Berlin. Die juristische Menschenrechtsorganisation hat seither in zahlreichen Fällen dafür gesorgt, dass Verantwortliche für Folter, Kriegsverbrechen, sexualisierte Gewalt und wirtschaftliche Ausbeutung nicht ungestraft davonkamen.
Kaleck hat die Ruhe des Corona-Lockdowns zum Anlass genommen für eine kritische Reflektion der Praxis. In seinem gut lesbaren Essay erinnert er an die Geschichte der Menschenrechte und ihre Bedeutung für historische Freiheitskämpfe von religiösen Minderheiten, Frauen, Schwarzen und Arbeitern. Unter der Überschrift »Die konkrete Utopie der Menschenrechte und die Realität nach 1945« analysiert er die politischen Entwicklungen und Instrumentalisierungen dieser Rechte vom Kalten Krieg über den »Krieg gegen den Terror« bis hin zur Gegenwart. Sehr lesenswert ist nicht zuletzt sein Überblick über wichtige Etappen der juristischen Menschenrechtsarbeit – angefangen von den Nürnberger Prozessen über die Pinochet-Verhaftung 1998 bis zu den jüngsten Verfahren gegen globale Unternehmen.
Ausführlich geht Wolfgang Kaleck auf aktuelle menschenrechtliche Herausforderungen und Bewegungen wie #MeToo, Fridays for Future und Black Lives Matter ein. Ein eigenes Kapitel ist Amnesty International und der Geschichte der Organisation gewidmet. Er bescheinigt ihr einen enormen Erfolg, kritisiert aber ihre »Betroffenheitspolitik«. Amnesty habe darauf gezielt, »die Substanz der Politik, das Politische schlechthin zu moralisieren und nicht darauf, die Verhältnisse, die zu Menschenrechtsverletzungen führten, grundsätzlich in Frage zu stellen oder gar umstürzen zu wollen«. Dies sei »zugleich Grund für die Erfolgsgeschichte der Organisation wie für das Dilemma, unter dem sie bis heute leidet«. Inzwischen habe sich Amnesty zwar thematisch geöffnet und sei auch im globalen Süden besser verankert, dies habe jedoch zu einem neuen Dilemma geführt: »Der allenthalben sichtbare und bekannte Markenkern löste sich zunehmend auf.«
Kaleck plädiert für breite Ansätze und Allianzen: Die juristische Menschenrechtsarbeit müsse stets von politischen Strategien begleitet werden. Neben politischen und bürgerlichen Rechten sollten wirtschaftliche und soziale Rechte stärker in den Mittelpunkt rücken. Menschenrechtsarbeit müsse »dekolonial, feministisch und ökologisch konzipiert werden«. Zudem fordert er eine stärkere Zusammenarbeit mit Kunstschaffenden. Selbst wenn man nicht alle Einschätzungen Kalecks teilt – seine Standortbestimmung ist zweifellos ein sehr sinniges Geschenk zum 60-jährigen Bestehen von Amnesty!
Wolfgang Kaleck: Die konkrete Utopie der Menschenrechte. Ein Blick zurück in die Zukunft, Fischer Verlag, Frankfurt/M. 2021, 176 Seiten, 21 Euro
Die mutigen Demonstrationen in Belarus haben das Interesse für ein Land geweckt, das zuvor nur bekannt war als »letzte Diktatur Europas« samt Todesstrafe. Der Debütroman »Camel Travel« der belarussischen Autorin Volha Hapeyeva kommt daher zum richtigen Zeitpunkt. Die Ich-Erzählerin berichtet leichtfüßig von einer Kindheit in den 1980er- und 1990er-Jahren – von Zöpfen, Buchweizengrütze, Spagat und Klavierunterricht. Abgesehen von der Scheidung der Eltern und dem Zerfall der UdSSR keine dramatischen Ereignisse, wie es scheint. Und doch deutet die 1982 in Minsk geborene Autorin mit feiner Ironie an, was für ihre Generation kennzeichnend war: ein autoritäres Schulsystem, eine dogmatische Staatsideologie, ein ambivalentes Verhältnis zur Sowjetunion, der Reaktorunfall in der benachbarten Ukraine, Mangelwirtschaft und ein reaktionäres Frauenbild. Hapeyeva hat ihr Buch zwar lange vor der gefälschten Präsidentschaftswahl geschrieben. Es bildet jedoch einen interessanten Hintergrund; man versteht, warum so viele Frauen gegen das autoritäre und patriarchale Regime von Alexander Lukaschenko protestieren, der seit 1994 an der Macht ist. Volha Hapeyeva verließ das Land bereits vor der Wahl. Sie war als Übersetzerin für die OSZE ins Visier des Geheimdienstes geraten. Literaturstipendien ermöglichten ihr Aufenthalte in Österreich und Deutschland.
Volha Hapeyeva: Camel Travel. Aus dem Belarussischen von Thomas Weiler. Droschl Verlag, Graz 2021, 128 Seiten, 18 Euro
Die Welt zu Tisch
In 80 Rezepten um die Welt – die Amnesty-Asylgruppe in Münster hat ein neues Kochbuch veröffentlicht. Es ist bereits die neunte überarbeitete Auflage von »Die Welt kocht«, die erste erschien Anfang der 1980er-Jahre. »Wir sammeln seit fast 40 Jahren Rezepte von Menschen, denen wir bei unserer Arbeit begegnen«, berichtet die Gruppe. »Wir treffen uns zu Kochabenden und probieren uns gemeinsam durch die Küchen dieser Welt. Unsere Erfahrungen und kulinarischen Entdeckungen möchten wir mit allen Kochbegeisterten teilen.« Wer internationale Klassiker sucht wie Chapati oder Empanadas, Taboulé oder Guacamole, Falafel oder Borschtsch wird hier fündig. Aber auch weniger bekannte Küchen werden vorgestellt: Ob aus Afghanistan oder Eritrea, Sri Lanka oder Georgien, Myanmar oder Uganda. Fast die Hälfte der Gerichte ist vegan, ein gutes Viertel ist vegetarisch, etwa ein Viertel enthält Fleisch oder Fisch. Bemerkenswert sind neben der schönen Gestaltung des Buchs und der praktischen Spiralbindung auch die 24 informativen Länderporträts, die den jeweiligen Rezepten vorangestellt sind. Sie sorgen dafür, dass »Die Welt kocht« mehr ist als eine bunte Sammlung: Es ist eine Einladung, sich mit Menschen jedweder Herkunft zu treffen und zu kochen, gemeinsam zu essen und sich auszutauschen.
Amnesty International Asylgruppe Münster – Bezirk Münster-Osnabrück: Die Welt kocht. Rezepte. Menschen. Rechte. Überarbeitete 9. Auflage, Münster 2020, 191 Seiten, 19,50 Euro. Bezug: bestellung@dieweltkocht.de »Wenn ich einmal an der Reihe bin, die Welt zu erschaffen – womit ich fest rechne! –, soll mein Mai neunzig Tage dauern.« Jamaica Kincaid hat neben dem Schreiben eine weitere Leidenschaft: ihren Garten. Und im US-Bundesstaat Vermont, wo die Schriftstellerin wohnt, ist der Mai der Wonnemonat. Geboren 1949 auf der Karibikinsel Antigua, kam Kincaid als Au-pair-Mädchen in die USA, machte sich mit Kolumnen und Romanen einen Namen und unterrichtete afrikanische und afro-amerikanische Studien an der Harvard University. In »Mein Garten(Buch)« schildert sie mit Verve ihre eigenen Vorlieben und Fehlschläge, zitiert aus Samenkatalogen und Gartenklassikern, beschreibt Besuche in Botanischen Gärten und Parks. Immer wieder kommt sie darauf zurück, dass auch Pflanzen eine Kolonialgeschichte haben: So stammt die Dahlie von den Azteken und hieß cocoxochitl, bevor der schwedische Botaniker Andreas Dahl sie weiterzüchtete. Jamaica Kincaid ist meinungsfreudig und impulsiv. Ihr rhythmischer Stil erinnert an gesprochene Sprache. Ihre häufig autobiografisch grundierten Bücher sind im Deutschen in den vergangenen Jahrzehnten in unterschiedlichen Verlagen erschienen und teilweise vergriffen. Der Kampa Verlag bereitet Kincaid nun mit einer Neuausgabe ihrer Werke erneut eine Bühne. Ihre Gartenessays sind ein guter Einstieg, um die originelle Autorin (wieder) zu entdecken.
Jamaica Kincaid: Mein Garten(Buch). Aus dem Englischen von Renate Orth-Guttmann, Kampa Verlag, Zürich 2021, 272 Seiten, 22 Euro
Mordnacht der Nazis
Kirsten Boie ist zugleich eine der renommiertesten und engagiertesten deutschsprachigen Autorinnen. Geradezu unermüdlich ist ihr Einsatz für Kinder, Leseförderung und gegen Rechtsextremismus. Mit »Dunkelnacht« schreibt sie nun eindrucksvoll gegen das Vergessen der nationalsozialistischen Verbrechen an: Ihre Novelle beruht auf den historischen Geschehnissen um die Penzberger Mordnacht. Am Nachmittag des 28. und in der Nacht auf den 29.April 1945 – nur zwei Tage vor Hitlers Selbstmord – wurden in der oberbayerischen Kleinstadt 16 Menschen auf Befehl der Wehrmacht als »Verräter und Verbrecher am Volke« hingerichtet. Sozialdemokratisch gesinnte Penzberger hatten versucht, das Rathaus zu übernehmen, um die Zerstörung des Ortes zu verhindern und die erwartete Ankunft der Amerikaner vorzubereiten. Mitten hinein in die dramatischen Geschehnisse kurz vor Kriegsende setzt Boie drei Jugendliche, fiktive Charaktere, die sie die Schrecken, Brutalität und Grausamkeit beobachten und miterleben lässt. Marie und Schorsch sind frisch verliebt, aber wegen ihrer Väter – der eine »Soze«, der andere Polizeimeister – im inneren Zwiespalt. Und Gustl hat sich der nationalsozialistischen Organisation »Werwolf« angeschlossen, die in dieser Nacht acht Menschen erhängt. Dicht, bedrückend und aufwühlend ist das, was Boie erzählt, auch, weil es zeigt, wozu »ganz und gar durchschnittliche Menschen fähig« sind.
Kirsten Boie: Dunkelnacht. Oetinger, Hamburg 2021, 112 Seiten, 13 Euro, ab 15 Jahren
Vor Gericht werden Schuldige bestraft, in der Wahrheitskommission werden Reuige belohnt – nach diesem Muster sollte nach der Apartheid-Ära die Aufarbeitung von Gräueltaten in Südafrika funktionieren. Mörder, die sonst nicht gestanden hätten, gaben ihre Taten zu, und gingen dafür straffrei aus. Mit diesem Verfahren beschäftigt sich Regisseur Roland Joffé in seinem Film »The Forgiven«. Leiter der »Truth and Reconciliation Commission« (TRC) war der südafrikanische Bischof Desmond Tutu, der im Film in Gestalt von Schauspieler Forest Whitaker im Mittelpunkt steht. Es ist das Jahr 1996, und nachdem Tutu den Angehörigen eines Opfers versprochen hat, die Wahrheit über dessen Verschwinden herauszufinden, führen ihn seine Nachforschungen zu dem Mörder und Rassisten Piet Blomfeld. Der sitzt in Kapstadts Pollsmoor-Gefängnis und sucht Vergebung für seine Verbrechen. Auf erstaunliche Weise nähern sich die unterschiedlichen Charaktere an. Ein Geständnis Blomfelds würde allerdings auch frühere Komplizen benennen, und da wird es für die Beteiligten gefährlich; die Handlung nimmt ein rasantes Tempo auf. »The Forgiven« ist sowohl aufwühlendes Plädoyer gegen Rassismus als auch handfestes und zuweilen brutales Justizkino. Sehenswert, aber nichts für schwache Nerven.
»The Forgiven«. GB 2017. Regie: Roland Joffé, Darsteller: Eric Bana, Forest Whitaker. Video on Demand und DVD
Der echte Messias
Am 3.Mai ist Festtag in Siculiana, einer kleinen Stadt an der südlichen Grenze Europas. An diesem Tag ehren die Einwohner die Statue eines schwarzen Jesus mit einer Prozession. Schon seit Jahrhunderten geht das so. Die Figur hat viele Fans, man freut sich das ganze Jahr auf den Umzug. Woher die schwarze Färbung des Holzes kommt, darin ist man sich nicht einig, und auch Regisseur Luca Lucchesi, der aus dem sizilianischen Ort stammt, klärt in seinem Film »A Black Jesus« nicht darüber auf. So bleibt es bei dem Mythos: Der Jesus sei schwarz, weil er die Sünden der Menschen habe auf sich nehmen müssen. Der 19-jährige Edward, der aus Ghana stammt und im Flüchtlingszentrum der Stadt hängengeblieben ist, fühlt sich von dem Brauch angesprochen. Weil der Mann am Kreuz aussehe wie er, sei es nur folgerichtig, dass er die Statue am Prozessionstag trage. Siculianas Einwohner müssen sich ihrer Geschichte stellen, aber schließlich begeben sie sich auf eine interessante Reise zu sich selbst, auch wenn diese von Angst vor dem Fremden und Vorurteilen gegenüber »dem Anderen« gekennzeichnet ist. Um das Andere geht es in diesem Fall aber letztlich nicht, denn keiner kann sich schließlich mit der Statue so identifizieren wie Edward. Und bald ist auch den Siculianern der echte Mensch lieber als ein Holzstück. Lucchesis Film ist Kino pur, die Kamera hält auf den Alltag der Leute an Europas Rand – und dokumentiert so ganz beiläufig, wie sich alte Grenzen auflösen und das Menschliche zum Vorschein kommt.
»A Black Jesus«. D 2020. Regie: Luca Lucchesi. Kinostart: 13.Mai 2021 Es ist eine Geschichte, die so unglaublich ist, dass sie nur wahr sein kann. Lea-Nina Rodzynek wird 1925 in einem Dorf in der Nähe von Treblinka geboren. Nach dem Einmarsch der Deutschen in Polen wird ihre jüdische Familie umgebracht. Ihr gelingt als Kind die Flucht nach Hamburg, sie versteckt sich, wird verraten und überlebt das Konzentrationslager. Im Nachkriegsdeutschland wird sie unter den Namen Belina zum Star, singt Volkslieder und Chansons in 17 Sprachen und reist in den 1960er-Jahren im Auftrag des Auswärtigen Amtes um die ganze Welt. In mehr als 120 Ländern verkündet die polnische Jüdin die Botschaft, dass das Land der Täter zu einem neuen, friedlichen Deutschland geworden sei. Sie habe niemals vergessen, hat die 2006 verstorbene Belina einmal gesagt, aber sie habe vergeben. Dass ihre Lieder und ihr engagiertes Leben für Versöhnung und Frieden heute nahezu vergessen sind, ist nicht nur eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, sondern sagt auch viel über den Umgang dieses Landes mit seiner Schuld. Dass ihr musikalisches Werk für sich allein stehen kann, beweist nun »Music For Peace«: Erstmals erscheinen Belinas Lieder auf CD. Nun ist wieder zu hören, wie sie mit einem Timbre zwischen Hildegard Knef und Juliette Greco Klassiker wie »Sag mir wo die Blumen sind« singt, aber auch Lieder aus dem Ghetto, jiddische, spanische und französische Folklore. Zu verdanken ist die Wiederentdeckung dem Regisseur Marc Boettcher, der mit seiner demnächst zu sehenden Dokumentation über Belina eine große Frauenstimme dem Vergessen entreißt.
Belina: »Music for Peace« (Unisono Records/Edel)
Schwarze Lehrstunde
Ja, was ist das? Lehrstunde oder Popmusik? Materialsammlung, Geschichtsvorlesung, Propaganda oder DiscothekenFutter? Wohl alles auf einmal. Mit »The American Negro« entwirft Adrian Younge einen komplexen, durchaus widersprüchlichen und unbedingt faszinierenden Beitrag zur aktuellen Rassismus-Diskussion. Während Spoken-Word-Stücke und Songs sich abwechseln, verschränkt der Filmkomponist, Musikproduzent, Labelbetreiber, Plattenladenbesitzer und Rechtsanwalt aus Los Angeles historische Quellen und philosophische Gedanken, gesellschaftspolitisches Essay und persönliche Erfahrungen mit Soul, Funk, HipHop und R&B – und lässt so diese Musiken Schwarzer Tradition in Korrespondenz treten mit der Geschichte von Sklaverei, Unterdrückung und Diskriminierung. Flankiert wird das Album von einem Kurzfilm auf Prime Video und dem Podcast »Invisible Blackness«. Ein Mega-Projekt, das den Hörer fordert und durchaus überfordern soll: Auf dem Cover ist Younge selbst zu sehen, inszeniert als Opfer eines Lynchmordes, fotografiert im Stil sogenannter Lynch-Postkarten, wie es sie in der US-Geschichte Jahrzehnte lang tatsächlich gegeben hat. Dass der Rassismus heutzutage besser getarnt daherkommt, so die Botschaft von Adrian Younge, macht ihn nicht weniger grausam.
Adrian Younge: »The American Negro« (Jazz Is Dead/Indigo)
Nein zum Schweigen sagen

Gefährdet. Carmen Aristegui ist eine der bekannstesten politischen Journalistinnen Mexikos.
Die Regisseurin Juliana Fanjul hat einen grandiosen Film über die mexikanische Radiomoderatorin Carmen Aristegui gedreht. Von Jürgen Kiontke
Die Demonstration ist laut, bunt und wütend. Javier Valdez, der Journalist, dem der Protest gewidmet ist, war bekannt für seine Recherchen zum Drogenkrieg in Mexiko. Nun haben Auftragskiller ihn ermordet – er war Verbindungen zwischen Politik und Bandenwesen auf der Spur.
Es ist das Jahr 2017, und Nachrichten wie diese sind in Mexiko keine Seltenheit. Die Wahrheit herauszufinden, kann das Leben kosten. Investigative Journalisten und missliebige Politiker, Staats- und Rechtsanwälte zu töten, ist an der Tagesordnung.
Unter welchen Bedingungen da noch gearbeitet werden kann, ist auch das Thema von Juliana Fanjuls mitreißendem Dokumentarfilm »Silence Radio« über die engagierte Reporterin Carmen Aristegui, die in Funk und Fernsehen immer wieder auf die Verflechtungen von Politik und Verbrechen aufmerksam gemacht hat. Täglich hörten mehr als 18 Millionen Menschen ihre Sendungen im Radio. Auch sie berichtete über Javier Valdez.
Fanjul begleitet Aristegui bei ihrer Arbeit, bis die Journalistin Opfer eines politischen Skandals wird. Weil sie über Absprachen von Präsident Enrique Peña Nieto mit chinesischen Unternehmern über den Bau einer Bahnstrecke berichtet, kündigt ihr der Sender. Sie hatte berichtet, China habe Nieto für den Zuschlag eines Bauauftrages eine Villa spendiert. Aber Aristegui ist eine Berühmtheit: Mehr als 200.000 Menschen demonstrieren und unterschreiben eine Petition, in der ihre Rückkehr zum Sender gefordert wird. Das Unternehmen reagiert darauf zwar nicht, aber die engagierte Journalistin lässt sich nicht beirren und berichtet im Internet weiter.
Als ihr Laptop mit Recherche-Ergebnissen und Kontakten gestohlen wird, beginnt Carmen Aristegui sich bedroht zu fühlen. Die Diebe haben keine Scheu, ihr öffentlich zu drohen. Eines Tages erscheint in ihrer Timeline der Tweet »Ich twittere am Computer von Carmen«.
Angst ist bei mexikanischen Medienschaffenden kein unbegründetes Gefühl. Seit dem Jahr 2000 wurden 104 Journalisten ermordet; 25 weitere gelten laut Amnesty International als »verschwunden«. Mexiko gleiche einer Verbotszone für Medienmitarbeiter, die den Mut hätten, über Themen wie organisierte Kriminalität und Komplizenschaft der Machthaber zu berichten, sagt Erika Guevara-Rosas von Amnesty International. Reporter ohne Grenzen spricht von einem Krieg gegen Medienschaffende – nirgendwo sonst würden so viele gezielt ermordet wie in Mexiko, und so gut wie nie finde eine vollständige Aufklärung statt. Landet ein Fall vor Gericht, müssen sich die Zeugen mehr fürchten als die Täter. Nur selten kommt es zu Verurteilungen.
Juliana Fanjul fängt die Stimmung dieses Kampfes in ihrer Dokumentation gut ein, schildert aus der Perspektive der Betroffenen und bezieht so Position. Sie arbeitet mit drastischem Material, etwa aus Überwachungskameras: So ist zu sehen, wie ein Attentäter während einer Wahlkampfveranstaltung die Pistole zieht und einen oppositionellen Politiker erschießt.
Der Film liefert Bilder von den gefährlichen Auseinandersetzungen mit einem autoritären und korrupten politischen System, das durch Drohungen und Einschüchterungen von Drogenkartellen ausgehöhlt ist. Aber er zeigt auch Menschen, die sich mit außergewöhnlichem Mut der Aufgabe stellen, einen Raum für die Pressefreiheit zu schaffen, um die Missstände öffentlich zu machen.
»Silence Radio«. CH/MEX 2019. Regie: Juliana Fanjul. Kinostart: 15.April 2021

RUSSISCHE FÖDERATION ELENA MILASHINA
Die russische Journalistin Elena Milashina, die im Zuge ihrer Arbeit Menschenrechtsverletzungen in der russischen Teilrepublik Tschetschenien aufdeckt, wird erneut mit dem Tode bedroht, eingeschüchtert und tätlich angegriffen.
Milashina veröffentlichte am 15.März 2021 in der unabhängigen russischen Zeitung Novaya Gazeta die Geschichte eines ehemaligen Polizisten unter dem Titel »Ich arbeitete für die tschetschenische Polizei und wollte keine Menschen töten«. Seither gehen die tschetschenischen Behörden mit einer Verleumdungs- und Einschüchterungskampagne gegen Elena Milashina und die Novaya Gazeta vor.
Repressalien, Drohungen, Einschüchterungen, Verleumdungen und körperliche Gewalt gegen Journalist_innen und Menschenrechtsverteidiger_innen sind in Tschetschenien an der Tagesordnung. Bereits im Jahr 2020 war die Journalistin
BRIEFE GEGEN DAS VERGESSEN
Tag für Tag werden Menschen gefoltert, wegen ihrer Ansichten, Hautfarbe oder Herkunft inhaftiert, ermordet, verschleppt, oder man lässt sie verschwinden. AMNESTY INTERNATIONAL veröffentlicht regelmäßig an dieser Stelle Einzelschicksale, um an das tägliche Unrecht zu erinnern. Internationale Appelle helfen, solche Menschenrechtsverletzungen anzu prangern und zu beenden.
Sie können mit Ihrem persönlichen Engagement dazu beitragen, dass Folter gestoppt, ein Todesurteil umgewandelt oder ein Mensch aus politischer Haft entlassen wird. Schreiben Sie bitte, im Interesse der Betroffenen, höflich formulierte Briefe an die jeweils angegebenen Behörden des Landes.
ACHTUNG! Wegen der Verbreitung des Corona- Virus ist die weltweite Briefzustellung momentan eingeschränkt. Deshalb bitten wir Sie, Ihre Appell schreiben per E-Mail oder Fax bzw. an die Botschaft des jeweiligen Ziellandes zu schicken.
angegriffen und mit dem Tode bedroht worden. Bisher sind die Verantwortlichen immer straffrei ausgegangen. Angesichts der erneuten Schikanen besteht große Sorge um die Sicherheit von Elena Milashina.
Bitte schreiben Sie bis zum 30.Juni
2021 höflich formulierte Briefe an den russischen Generalstaatsanwalt und fordern Sie, dass Elena Milashina vor Angriffen und Einschüchterungen geschützt wird und ihrer journalistischen und menschenrechtlichen Arbeit in einem sicheren Umfeld und ohne Angst vor Repres salien nachgehen kann.
Bitten Sie ihn, umgehend eine zielführende und unparteiische Untersuchung der Drohungen gegen die Journalistin und die Novaya Gazeta einzuleiten. Fordern Sie zudem eine Untersuchung der in dem Artikel gegen tschetschenische Sicherheitskräfte erhobenen Vorwürfe, Menschen rechtswidrig festgenommen, gefoltert und außergerichtlich hingerichtet haben.
Schreiben Sie in gutem Russisch, Englisch oder auf Deutsch an:
Igor Viktorovich Krasnov Prosecutor General’s Office Ul. Bolshaya Dmitrovka, 15a Moscow GSP-3, 125993 RUSSISCHE FÖDERATION Fax: 007-4959875841 Twitter: @Genproc (Anrede: Dear Prosecutor General / Sehr geehrter Herr Generalstaatsanwalt) (Standardbrief Luftpost bis 20 g: 1,10 €)
Senden Sie bitte eine Kopie Ihres Schreibens an:
Botschaft der Russischen Föderation S. E. Herrn Sergei Nechaev Unter den Linden 63–65, 10117 Berlin Fax: 030-2299397 E-Mail: info@russische-botschaft.de (Standardbrief: 0,80 €)
CHINA YU WENSHENG
Yu Wensheng ist ein bekannter Menschenrechtsanwalt, der bereits zahlreiche Angeklagte in öffentlichkeitswirksamen Menschenrechtsfällen vertreten hat – bis er selbst wegen »Anstiftung zur Untergrabung der Staatsgewalt« verurteilt und inhaftiert wurde. Nachdem die von ihm eingelegten Rechtsmittel zurückgewiesen worden waren, wurde er am 26.Januar 2021 ohne vorherige Ankündigung in das Gefängnis von Nanjing überstellt – 1.000 Kilometer vom Wohnort seiner Familie entfernt. Yu Wensheng wurde in der Haft gefoltert und anderweitig misshandelt, zudem hat sich sein Gesundheitszustand aufgrund der Haftbedingungen massiv verschlechtert: Er hat bereits vier Zähne verloren, weist Zeichen von Unterernährung auf und kann seinen rechten Arm aufgrund eines Nervenschadens kaum noch bewegen. Dies berichtete seine Frau Xu Yan, die am 5.Februar mittels eines Video-Calls eine halbe Stunde mit ihrem Mann sprechen konnte.
Wenn Yu Wensheng nicht umgehend medizinisch behandelt wird, steht zu befürchten, dass sich sein Gesundheitszustand weiter verschlechtert und er sich davon nicht mehr erholen wird.
Bitte schreiben Sie bis 30.Juni 2021
höflich formulierte Briefe an den Direktor der Haftanstalt von Nanjing und fordern Sie ihn auf, dafür zu sorgen, dass Yu Wensheng umgehend und bedingungslos freigelassen wird. Bis dahin muss er uneingeschränkten Zugang zu angemessener Ernährung und medizinischer Versorgung sowie zu einem Rechtsbeistand seiner Wahl und seiner Familie erhalten. Er darf nicht gefoltert oder anderweitig misshandelt werden.
Schreiben Sie in gutem Chinesisch, Englisch oder auf Deutsch an:
Director Zhu Yonghong Nanjing Prison 9 Ning Shuang Lu Yuhuatai Qu, Najing City Jiangsu Sheng, 210012, CHINA (Anrede: Dear Director / Sehr geehrter Herr Direktor) (Standardbrief Luftpost bis 20 g: 1,10 €)
Senden Sie bitte eine Kopie Ihres Schreibens an:
Botschaft der Volksrepublik China S. E. Herr Ken Wu Märkisches Ufer 54, 10179 Berlin Fax: 030-27588221 E-Mail: de@mofcom.gov.cn (Standardbrief: 0,80 €)
Briefentwürfe auf Englisch und Deutsch finden Sie unter www.amnesty.de/briefe. Sollten Sie eine Antwort auf Ihr Appellschreiben erhalten, schicken Sie sie bitte an: info@amnesty.de
AMNESTY INTERNATIONAL
Zinnowitzer Straße 8, 10115 Berlin Tel.: 030-420248-0, Fax: 030-420248-488 E-Mail: info@amnesty.de, www.amnesty.de
GUINEA AISSATOU LAMARANA DIALLO
Seit sechs Jahren fordert die Guineerin Aissatou Lamarana Diallo die Aufklärung der Erschießung ihres Ehemanns Thierno Sadou Diallo durch Sicherheitskräfte. Am 7.Mai 2015 hatte die Opposition in Conakry zu Protesten aufgerufen. Thierno Sadou Diallo nahm nicht daran teil, wurde jedoch am selben Abend von Personen in Gendarmerie-Uniform getötet, als diese eine Razzia im Stadttteil Ratoma durchführten. Fünf Sicherheitskräfte kamen auf Thierno Sadou Diallo und seine Freunde zu, die auf der Straße standen, und richteten eine Waffe auf sie. Als die Gruppe aus Angst in eine Seitenstraße floh, feuerten die Gendarmen zwei Schüsse ab, von denen einer Thierno Sadou Diallo in den Rücken traf.
Aissatou Lamarana Diallo war zum Zeitpunkt der Tötung ihres Mannes schwanger und brachte zwei Wochen später ein Kind zur Welt. Sie hat drei Kinder und ist nun alleinerziehend. Auch sechs Jahre nach dem Vorfall hat sie weder Gerechtigkeit erfahren noch eine Entschädigung erhalten. Auch wurde bislang niemand für die rechtswidrige Tötung von Thierno Sadou Diallo zur Rechenschaft gezogen.
Bitte schreiben Sie bis zum 30.Juni 2021
höflich formulierte Briefe an den Justizminister von Guinea und fordern Sie ihn auf, die Tötung von Thierno Sadou Diallo umgehend unabhängig und unparteiisch untersuchen zu lassen und die Verantwortlichen in Verfahren vor Gericht zu stellen, die internationalen Standards entsprechen. Fordern Sie zudem eine umfassende Entschädigungszahlung für Aissatou Lamarana Diallo, damit sie für ihre drei Kinder sorgen und in Würde leben kann.
Schreiben Sie in gutem Französisch, Englisch oder auf Deutsch an:
Minister of Justice Maitre Mory Doumbouya BP: 564 Conakry, GUINEA E-Mail: maitredoumbouya@yahoo.com (Anrede: Dear Minister / Sehr geehrter Herr Minister) (Standardbrief Luftpost bis 20 g: 1,10 €)
Senden Sie bitte eine Kopie Ihres Schreibens an:
Botschaft der Republik Guinea S. E. Herrn Mamadou Siradiou Diallo Jägerstraße 67–69, 10117 Berlin Fax: 030-200743333 E-Mail: t.knoechel@amba-guinee.de (Standardbrief: 0,80 €)

Berliner Wandkunst mit Engagement. Katerina Voronina.
»IHR MUT IST UNGLAUBLICH MITREISSEND«
Anlässlich des Weltfrauentags am 8.März 2021 wurde eine Berliner Hauswand in ein Kunstwerk verwandelt. Die in Moskau geborene Künstlerin Katerina Voronina (32) hat das Motiv entworfen. Es soll auf Frauenrechtlerinnen weltweit aufmerksam machen. Das Wandgemälde ist Teil des sogenannten »Brave Walls«-Projekts, einer internationalen Kooperation zwischen Amnesty International und der globalen Street Art-Community. Im Interview erzählt Katerina Voronina, was das Projekt für sie bedeutet.
Interview: Parastu Sherafatian
Wie wurden Sie Teil des »Brave Walls«-Projekts?
Ich gewann im Herbst 2020 den künstlerischen Wettbewerb, den das Urban Nation Museum for Contemporary Modern Art in Kooperation mit Amnesty International durchführte. Dabei ging es darum, das Motiv für die Hauswand in Berlin auszuwählen. Ich war sehr aufgeregt, in Berlin ein Kunstwerk kreieren zu dürfen, das in der Öffentlichkeit sichtbar ist. Von so einer Möglichkeit habe ich schon lange geträumt.
Auf der »Brave Wall« in Berlin ist auch die brasilianische Menschenrechtlerin Marielle Franco abgebildet, die 2018 ermordet wurde. Wieso haben Sie sich dafür entschieden?
Als ich in Vorbereitung für den Wettbewerb von bewundernswerten Frauenrechtlerinnen las, berührte mich ihr Schicksal besonders. Es war sehr schmerzlich für mich, von ihrem bis heute unaufgeklärten Mord zu erfahren. Ich entschied mich für sie als Protagonistin meines Motivs, um an ihre Geschichte zu erinnern. Gleichzeitig war es mir wichtig, dass auch Menschen die Botschaft des Bildes verstehen, die Marielles Fall nicht kennen. Deshalb sind neben ihr weitere Frauen zu sehen. Ich habe sie bei alltäglichen Tätigkeiten gemalt: Frauen in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, eine Frau beim Musizieren. Es sind Aktivitäten, die für viele leider keine Selbstverständlichkeit sind.
Was macht das Projekt für Sie besonders?
Es inspiriert mich, dass Frauen trotz aller Gefahren für ihre Rechte kämpfen. Ihr Mut ist unglaublich mitreißend. Hoffentlich lassen sich Betrachter_innen davon anstecken.
Manche Menschen behaupten, die Gleichberechtigung der Geschlechter sei bereits erreicht. Was entgegen Sie?
Menschen, die das behaupten, müssen sich einfach die vielen Berichte über Femizide, sexualisierte Gewalt und Dis kriminierung von Frauen anschauen. In meinem Heimatland Russland kämpfen wir zum Beispiel immer noch für ein Gesetz gegen häusliche Gewalt. Viele Länder sind von dem Ziel der Geschlechtergleichstellung noch weit entfernt.
Was haben Sie sich für den Weltfrauentag gewünscht?
Mein Wunsch war, dass wir Themen offen ansprechen, die uns Frauen betreffen. Um Probleme angehen zu können, muss man sie benennen. Das bedeutet auch, dass wir gegenüber Ungerechtigkeiten aufmerksam bleiben müssen. Und zwar weltweit. Es wäre einfacher, wegzuschauen und sich einzureden, dass uns die Rechte von Frauen oder LGBTI in Brasilien nichts angehen. Doch der Einsatz von mutigen Menschenrechtsverteidiger_innen wie Marielle hat Auswirkungen für uns alle: Er gibt uns den Mut, an eine bessere Welt zu glauben.
Der Fußballverein SV Darmstadt 98 unterstützt eine Amnesty-Kampagne gegen Rassismus.
»Wir sind nicht nur ein Sportverein, sondern auch eine Wertegemeinschaft«, sagte Markus Pfitzner, der Vizepräsident des SV Darmstadt 98. »Es geht darum, rassistischen Tendenzen konsequent entgegenzuwirken. Egal, ob auf dem Platz, der Tribüne oder an irgendeinem anderen Ort.«
Der Darmstädter Verein will nicht wegschauen, sondern dem Rassismus aktiv entgegentreten und verhindern, dass er sich in der Gesellschaft weiter verbreitet. »Viele Menschen in Deutschland werden Tag für Tag rassistisch diskriminiert, ausgegrenzt oder angegriffen«, heißt es in einer Mitteilung des privaten Umgebung auf die Menschenrechte und das Thema Rassismus aufmerksam machen kann. In den kommenden Wochen will der SV Darmstadt 98 eine seiner Werbeflächen auf der vereins eigenen Homepage Amnesty zur Verfügung stellen, um auch an dieser Stelle auf das Thema hinzuweisen. »Alle haben den gleichen Anspruch auf Menschenrechte und Freiheit, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft oder Religion«, sagte Amnesty-Generalsekretär Markus N. Beeko. »Aber die Realität ist, dass in Deutschland Tag für Tag Menschen rassistisch beleidigt, bedroht und benachteiligt werden.« Beeko freute sich deshalb über das Engagement des SV Darmstadt 98. »Die Lilien beziehen Stellung und sagen: ›Kein Platz für Rassismus!‹ Nicht auf dem Platz, nicht im Stadion, nicht im Fanclub, nicht in Darmstadt.«
Fußballvereins. »Trotzdem wird Rassis mus in unserer Gesellschaft weiterhin normalisiert.«
Die Lilien, wie der Verein wegen seines Logos auch genannt wird, haben gemeinsam mit Amnesty ein Video produziert, das für Rassismus sensibilisieren soll. Darin zeigen die Spieler Haltung und positionieren sich klar gegen Diskriminierung. »Ich nehme Rassismus persönlich«, sagen Spieler nacheinander und deuten auf einen Amnesty-Button, den sie sich angesteckt haben. Der Spieler Erich Berko berichtet davon, wie er im Alltag Rassismus erlebt – etwa, wenn er darauf hingewiesen werde, wie gut sein Deutsch sei.
Jeder Spieler hat eines der kostenlosen Amnesty-Aktionspakete gegen Rassismus erhalten, damit er auch in seiner
Erstklassiger Antirassismus eines Fußball-Zweitligisten. Der SV Darmstadt 98 bekennt sich.

IMPRESSUM
Amnesty International Deutschland e.V.
Zinnowitzer Str. 8, 10115 Berlin Tel.: 030 - 42 02 48 - 0 E-Mail: info@amnesty.de Internet: www.amnesty.de Redaktionsanschrift: Amnesty International, Redak tion Amnesty Journal Zinnowitzer Str. 8, 10115 Berlin E-Mail: journal@amnesty.de Adressänderungen bitte an: info@amnesty.de Redaktion: Maik Söhler (V.i.S.d.P.), Jessica Böhner, Lea De Gregorio, Anton Landgraf, Tobias Oellig, Pascal Schlößer, Uta von Schrenk Mitarbeit an dieser Ausgabe: Birgit Albrecht, Lisa Anke, Tamana Ayazi, Jamil Balga-Koch, Markus N. Beeko, Agnès Callamard, Jan Eckel, Peter Franck, Malte Göbel, Oliver Grajewski, Annette Hartmetz, Claudia Hülsken, Annette Jensen, Jürgen Kiontke, Felix Lill, Frank Odenthal, Barbara Oertel, Tigran Petrosyan, Teresa Quadt, Ralf Rebmann, Wera Reusch, Bettina Rühl, Thore Schröder, Parastu Sherafatian, Klaus Ungerer, Frédéric Valin, Wolf-Dieter Vogel, Elisabeth Wellershaus, Cornelia Wegerhoff, Thomas Winkler, Marlene Zöhrer
Layout und Bildredaktion:
Heiko von Schrenk / schrenkwerk.de Druck und Verlag: Hofmann Druck Spendenkonto: Amnesty International Bank für Sozialwirtschaft IBAN: DE23 3702 0500 0008 0901 00 BIC: BFS WDE 33XXX (Konto: 80 90 100, BLZ: 370 205 00) Das Amnesty Journal ist die Zeitschrift der deutschen Sektion von Amnesty International und erscheint sechs Mal im Jahr. Der Verkaufspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Für unverlangt eingesandte Artikel oder Fotos übernimmt die Redaktion keine Verantwortung. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung von Amnesty International oder der Redaktion wieder. Die Urheberrechte für Artikel und Fotos liegen bei den Autoren, Fotografen oder beim Herausgeber. Der Nachdruck von Artikeln aus dem Amnesty Journal ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion erlaubt. Das gilt auch für die Aufnahme in elektronische Datenbanken, Mailboxen, für die Verbreitung im Internet oder für Vervielfältigungen auf CD-Rom.
ISSN: 2199-4587




