Projektbericht
Untersuchung des Einsatzes von Fahrrädern im Wirtschaftsverkehr (WIV-RAD) Schlussbericht an das Bundesministerium fßr Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) Stand: 6. Mai 2016 FoPS 70.0884/2013
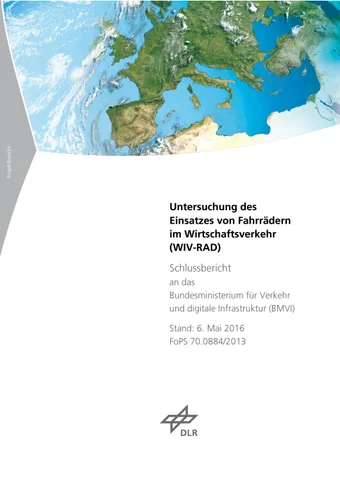
Projektbericht
Untersuchung des Einsatzes von Fahrrädern im Wirtschaftsverkehr (WIV-RAD) Schlussbericht an das Bundesministerium fßr Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) Stand: 6. Mai 2016 FoPS 70.0884/2013