

„AUGENBLICK, BITTE!“



„Als der Kleine dann da war, hat mich der Alltag eingeholt.“
Jennifer hat Retinitis pigmentosa - eine voranschreitende Netzhauterkrankung



NICHT VERPASSEN:
Kindliches Glaukom
Warum große (schöne) Kinderaugen ein Grund sind, genauer hinzusehen
Seite 07


Alles im Blick?!
Unter diesem Motto findet die diesjährige Woche des Sehens statt
Seite 10


Blindenfußball
Zwei Spieler der deutschen Nationalmannschaft im Interview
Seite 13


Carolin Babel

IN DIESER AUSGABE
Mit der Woche des Sehens steht eine Woche voller Aktionen für und mit Menschen, mit und ohne Sehbehinderung vor uns. Gutes Sehen ist nicht selbstverständlich – achten Sie auf sich! 04

Myopie Management
Kurzsichtigkeit effektiv bremsen! 11

Altersbedingte Makuladegeneration (AMD) Ist hier neue Hoffnung in Sicht?!
Mehr Nachhaltigkeit, damit wir auch
morgen noch
Blindheit
Alle Artikel,
facebook.com/MediaplanetStories @Mediaplanet_germany
vermeiden können

Prof. Dr. med. Gerd Geerling
Präsident der Deutschen
Hätten Sie's gewusst? Das Gesundheitswesen hat mit etwa fünf Prozent einen größeren Anteil am CO2-Fußabdruck als der internationale Flugverkehr! Und in dieser Bilanz spielt die Augenheilkunde keine Nebenrolle: Aufgrund von Volkskrankheiten wie Grauer Star oder Makuladegeneration und den damit verbundenen operativen Eingriffen, den Vor- und Nachuntersuchungen ist der Verbrauch an Ressourcen immens.
Möglichkeiten, die Augenheilkunde ökologisch nachhaltiger zu gestalten, sind daher ein Schwerpunktthema des diesjährigen DOG-Kongresses. Das beginnt bei der Operation des Grauen Stars, die allein in Deutschland eine Million Mal jährlich stattfindet. Der CO2-Fußabdruck der Kataraktoperation mit moderner Phakoemulsifikationstechnik kann möglicherweise drastisch reduziert werden, wie ein Vergleich eines europäischen mit einem asiatischen Land zeigt. Waschbare, wiederverwertbare OPTextilien verursachen bis zu 50 Prozent geringere CO2-Emissionen als Einmaltextilien, die mit bis zu 300 Prozent höherem Energie- und Wasserverbrauch und 750 Prozent mehr Müll verbunden sind. Die Verwendung umweltschonender Inhalationsanästhetika senkt den CO 2 -Abdruck bei Narkosen um 95 Prozent.
Hinzu kommt der Faktor Mobilität. Patientinnen und Patienten, aber auch medizinisches Personal müssen für unzählige Vor- und Nachuntersuchungen anreisen. Doch wie viele dieser Termine sind tatsächlich erforderlich? Eine Studie zeigt, dass nach einer komplikationslosen Operation des Grauen Stars eine kurzfristige Verlaufsuntersuchung nicht
Mit gesunden Kinderaugen in eine gute Zukunft blicken
Wussten Sie, dass bereits Kinder vom Grauen Star betroffen sein können? In Europa kennen wir die Trübung der Augenlinse als typische Erkrankung in der zweiten Lebenshälfte. Sie tritt im Zuge des natürlichen Alterungsprozesses auf – eine einfache Operation verschafft schnelle Abhilfe. Im globalen Süden hingegen ist der Graue Star der Hauptgrund für Erblindungen.
Als Folge von unbehandelten Augenentzündungen oder -verletzungen kann er sich auch schon bei jüngeren Menschen und Kindern entwickeln. Der angeborene Graue Star kommt ebenfalls oft vor. Eine Virusinfektion der Mutter während der Schwangerschaft, z.B. mit Röteln oder Windpocken, kann die Ursache sein.

notwendig ist; sie hat keinen Einfluss auf das endgültige Sehvermögen. Auch Telefonkonsultationen können Kontrollen ersetzen – und sogar die Zufriedenheit von Patientinnen und Patienten erhöhen. Die Telemedizin bietet weitere Optionen, die Zahl ärztlicher Besuche abzusenken. Großbritannien hat es vorgemacht, dort erfolgt auch die Verschreibung dauerhaft eingenommener Medikamente schon auf App.
Ziel ist ein möglichst geringer Ressourcenverbrauch bei gleichbleibend hoher Versorgungsqualität.
Bleibt der Bereich Fort- und Weiterbildung. Auf dem Kongress etwa sprechen wir nicht nur über mehr Nachhaltigkeit, wir setzen sie auch um: Die DOG hat den Papierverbrauch minimiert, nutzt möglichst umweltfreundliche Drucksachen, unterstützt die Anreise zum Kongress per Bahn, reduziert den Fleischanteil beim Catering und legt Wert auf nachhaltige Partner*innen in der Organisation. Ziel ist ein möglichst geringer Ressourcenverbrauch bei gleichbleibend hoher Versorgungsqualität – damit wir auch morgen noch über genügend Kapazitäten verfügen, um Augenerkrankungen früh zu erkennen und Blindheit zu vermeiden. Über diese Themen informieren der Kongress, die vorliegende Ausgabe und die Woche des Sehens, die vom 5. bis 15. Oktober stattfinden wird.
Dramatische Folgen für das Kind

Nicht selten bleibt der Graue Star zu lange unentdeckt. In vielen Ländern südlich der Sahara ist die augenmedizinische Versorgung gerade für Kinder katastrophal. Es gibt zu wenige Augenärzt*innen und Kliniken. Während sich Augenärzt*innen in Deutschland umfassend um ihre Patient*innen kümmern können, gibt es beispielsweise in ganz Burkina Faso nur 31 praktizierende Augenärzt*innen. Rein rechnerisch kommen so auf einen Facharzt 1,2 Millionen Menschen. Die Folgen für die Kinder sind dramatisch. Denn Lernprozesse laufen bei ihnen vor allem über das Sehen ab. Unbehandelte Augenprobleme können die Bildungschancen und die soziale Entwicklung eines Kindes ein Leben lang beeinträchtigen. Fehlsichtigkeit und Erblindung führen zu mehr Schulund Bildungsabbrüchen. Damit steigen Armut und sogar Sterblichkeit: Zwei Drittel der Kinder, die in den armen Regionen der Welt erblinden, sterben innerhalb von zwei Jahren.

Vermeidbare Erblindung verhindern Sehen zu können bedeutet, selbstbestimmt zu leben, eine Zukunft zu haben – vor allem für Kinder in Subsahara-Afrika. Dafür setzt sich Light for the World als internationale Fachorganisation für Augengesundheit seit mehr als 30 Jahren ein. Light for the World baut augenmedizinische Versorgung auf und ermöglicht Menschen den Zugang zu ärztlicher Versorgung. Dabei wird nachhaltig gehandelt. Neben der Verfügbarkeit von Hilfsmitteln und Arzneien sind Infrastruktur und gut ausgebildetes Personal vor Ort entscheidend. Die Ausbildung im Bereich der Kinderaugengesundheit wird gezielt gefördert. Das Ziel: Kein Kind soll erblinden, wenn es sich vermeiden lässt.
Ihre Spende schafft Perspektiven: IBAN: DE58 7002 0500 0009 8342 00 BIC: BFSWDE33MUE
Der Herbst kann kommen!
Brillen sind nicht nur praktische Sehhilfen, sondern für viele Träger ein echtes Statement-Piece. So manches Outfit bekommt erst durch die passende Brille den perfekten Feinschliff.
Bevor man sich jedoch für ein neues Modell entscheidet, sollte man zunächst in den Spiegel sehen und prüfen, welche Brillenform grundsätzlich zur Gesichtsform passt
Für eine eckige Gesichtsform empfehlen Experten runde oder ovale Brillengestelle, die einen Ausgleich zum markanten Gesicht bieten. Im Gegenzug dazu setzt man bei einer runden Gesichtsform auf eckige Formen bei der Brillenwahl, da sie Kontur geben und das Gesicht schmaler erscheinen lassen. Für herzförmige Gesichtsformen sind besonders ovale und runde Brillenmodelle geeignet, aber auch allgemein Brillenfassungen mit schmalen Rändern. So fungieren sie fast als eine Art Weichzeichner und kreieren eine softe Silhouette. Mit einer ovalen Gesichtsform hat man freie Wahl. So gut wie jede Brille harmoniert mit dieser Gesichtsform.
Brillen- Herbsttrends 2022 – der Fokus liegt auf Nachhaltigkeit Naturmaterialien, Recyclingmaterialien und 3D-Druck Brillenfassungen aus Naturmaterialien, wie Büffelhorn oder Holz, sind die Klassiker in Sachen Nachhaltigkeit. Ergänzt werden sie heute durch eine Vielzahl an Produktneuheiten, basierend auf modernen Produktionsverfahren, die den Recyclinggedanken aufnehmen sowie neue Materialansätze beinhalten.
Acetatbrillen gehören inzwischen zu den Lieblingen der trendigen und modeorientierten Hersteller. Durch chemische Prozesse und Weiterverarbeitung entstehen aus Baumwolle so genannte Acetatplatten, die in der Brillenproduktion eingesetzt werden. Bei Acetate Renew wird sogar aller Kunststoffabfall, der bei der Produktion übrig bleibt, durch ein spezielles Rückgewinnungsverfahren zum Rohstoff für nachhaltigere Celluloseacetatplatten − bestehend aus 60 Prozent biobasiertem und 40 Prozent zertifiziertem, recyceltem Ausgangsmaterial. Heißt: weniger Abfall und, im Vergleich zu herkömmlich hergestelltem Acetat, um 25 bis 50 Prozent weniger Emissionen.
Auch im 3D-Druckverfahren ist das Thema Nachhaltigkeit präsent. Hier kommen mittlerweile biobasierte Materialien zum Einsatz, beispielsweise ein Polymer, das aus gentechnikfreiem Rizinusöl gewonnen wird. Es stammt nicht nur von einer erneuerbaren Rohstoffquelle, sondern ermöglicht, Brillenfassungen tatsächlich in No-Waste-Methode herzustellen.1
Style-Trends in diesem Herbst
1.Puristische Modelle
Transparente Kunststoffmodelle in neutralen Farben sind jetzt super angesagt. Ob braun, taupe, beige oder ganz durchsichtig, softe Töne passen zu vielen Outfits und lassen sich im Herbst gut mit warmen Erdtönen kombinieren.
2.Farbe zeigen!
Ganz im Gegensatz dazu kann man aktuell aber auch mit Farbe ein Mode-Statement setzen!
Mit auffälligen Modellen aus Kunststoff in bunten Farben ist man derzeit angesagt. Ob Kobaltblau, knalliges Pink oder ein sattes Grün, gerade an grauen Herbsttagen bringen Farben Gesichter zum Strahlen.
3.Metallrahmen
Ein eher zeitloser Trend, der schon das ganze Jahr begleitet, ist eher zurückhaltend: Brillen mit filigranem Metallgestell. Besonders angesagt sind sie in Gold- oder Kupfertönen, die vor allem sehr edel wirken. Je nach Geschmack kann man aber auch den Bügel der Brille in einer auffälligeren Farbe wählen. Bei den Brillenformen ist erlaubt, was gefällt. Der Vorteil eines dünnen Gestells: Es wirkt nicht so hart, steht vielen Gesichtern und ist vielfach kombinierbar.


Kurzsichtigkeit ausbremsen, geht das?
Und ob! Myopie-Management kann das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit (Myopie) bei Kindern verlangsamen und sie später vor schweren Augenerkrankungen schützen.
Bei Kindern werden leider 60 % der Sehschwächen zu spät erkannt.
Dabei gilt: Je früher Kinderaugen getestet werden, desto besser.


Die Zahlen sprechen für sich. Jedes zehnte Kind in Deutschland sieht schlecht. Und weit über ein Drittel der Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind kurzsichtig. Sie sehen nur Nahes scharf. Das ist an sich kein Problem, denn dafür gibt es Brillen und Kontaktlinsen. Liegt die Kurzsichtigkeit allerdings später bei –6,00 Dioptrien und mehr, steigt im Alter, ab etwa 50 Jahren, das Risiko schwerer Augenerkrankungen wie Netzhautablösung, Degeneration oder Grüner Star, welche schlimmstenfalls zur Erblindung führen können.
Rückgängig machen kann man die Fehlsichtigkeit leider nicht. Aber es gibt eine gute Nachricht: Per Myopie-Management lässt sich bei Schulkindern das übermäßige Längenwachstum des Augapfels –meist verantwortlich für die Kurzsichtig-
Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit der CooperVision GmbH entstanden.

Wkeit – verlangsamen. Das Fortschreiten der Myopie wird gebremst, und ihr Endwert kann teilweise sogar um die Hälfte verringert werden.
Optionen der Myopie-Kontrolle
Bei Kindern werden leider 60 Prozent der Sehfehler zu spät erkannt. Dabei gilt: Je früher Kinderaugen getestet werden, desto besser. Welche präventiven Maßnahmen zur Myopie-Kontrolle zum Einsatz kommen, ist individuell verschieden und darf nur in Abstimmung mit spezialisierten Augenoptiker*innen, Optometrist* innen und Augenärzten/-ärztinnen erfolgen – regelmäßige Kontrolle inklusive. Die Optionen reichen dabei von der optischen Korrektion mit speziellen Brillengläsern und Kontaktlinsen bis zu Medikamenten – begleitet von der Empfehlung, sich täglich im Freien aufzuhalten.
Brillengläser: Neu auf dem Markt sind speziell entwickelte Brillengläser, welche einerseits die Kurzsichtigkeit korrigieren. Um einen neun Millimeter großen zentralen Bereich herum enthalten sie viele kleine Zusatzlinsen mit höherer Stärke. Mit ihnen wird eine zweite Bildebene im Auge gebildet, die auch das Längenwachstum des Augapfels eindämmen kann.
Weiche Kontaktlinsen
Myopie-Management-Linsen: Mit einem besonderen optischen Design korrigieren diese, eigens für die Myopie-Kontrolle bei Kindern entwickelten und zugelassenen Kontaktlinsen die Kurzsichtigkeit – und verringern zugleich das Längenwachstum des Auges.
Klassische Mehrstärkenlinsen: Ursprünglich wurden sie für das scharfe Sehen von Alterssichtigen konzipiert. Mit der Fernwirkung im Zentrum der Linse und der Nahwirkung außerhalb des Zentrums können sie aber auch das Fortschreiten der Myopie bei Kindern reduzieren.
Orthokeratologie: Seit Langem bekannt sind formstabile, hoch sauerstoffdurchlässige Nachtlinsen. Sie werden nur während des Schlafens getragen und verändern dabei sanft die Hornhautform. Die dadurch erzielte spezielle Optik der Hornhaut reduziert das Fortschreiten der Myopie. Am Tag sehen die Kleinen so gestochen scharf – ohne Brille und Linsen.
Atropin-Augentropfen: Der stark verdünnte Wirkstoff der giftigen Tollkirsche verringert das Fortschreiten der Myopie um bis zu 50 Prozent.
Aufenthalt im Freien: Zu viel Indoorzeiten und zu langes Sehen auf nahgelegene digitale Geräte können die Kurzsichtigkeit fördern. Also zur Vorbeugung: Bei Tageslicht raus ins Freie! Zwei Stunden am Tag sollten es sein. Einen einfacheren Weg, die Welt lange Zeit scharf, bunt und gesund zu sehen, gibt es nicht.
Anmerkung: Häufig ist eine Kombination aus den verschiedenen Maßnahmen am erfolgreichsten.
stehende Sehfehler korrigiert. Gleichzeitig wird aber auch die Zunahme der Kurzsichtigkeit verlangsamt, indem die Sehhilfe mit ihrer optischen Beschaffenheit das Augenlängenwachstum bremst.
MiSight® 1 day Einmalkontaktlinsen von CooperVision – speziell entwickelt für Kinder

eltweit steigen die Zahlen kurzsichtiger Kinder rapide. Durch die Lockdowns sind sie noch einmal um das 1,4- bis 3-Fache gestiegen.1 Diese Entwicklung wird unter anderem auf die zunehmende Beschäftigung mit digitalen Medien zurückgeführt. Der ständige Blick auf Handy, TV und PC und wenig Aufenthalt bei Tageslicht im Freien begünstigen das übermäßige Längenwachstum des Auges, eine der Ursachen der Kurzsichtigkeit. Aber auch genetische Faktoren spielen eine Rolle. Kurzsichtigkeit bei Kindern entsteht üblicherweise im Alter zwischen 6 und 14 Jahren. Mögliche Symptome, auf die Sie als Eltern achten können, sind häufiges Blinzeln, ein zu geringer Abstand zum Buch oder Fernsehgerät, müde Augen, Kopfschmerzen,
verschwommenes Sehen entfernter Objekte oder auch nachlassende Schulleistungen.2 Je früher eine Kurzsichtigkeit oder auch nur ihr Risiko diagnostiziert werden umso effektiver kann man dieser entgegenwirken oder das Fortschreiten entschleunigen und das Risiko für spätere Komplikationen vermindern.
Myopie Management statt Myopie Korrektur
Ist bereits eine Kurzsichtigkeit vorhanden, ist es Zeit für ein wirksames Myopie Management. Der Begriff steht für eine optimale Versorgung kindlicher Kurzsichtigkeit nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das Besondere: Das Myopie Management führt gleich zwei Behandlungsziele in einer Maßnahme zusammen. Zum einen wird der be-
Die Vorteile der Kontaktlinse liegen auf der Hand. Kontaktlinsen garantieren freie Sicht und Beweglichkeit von früh bis spät: kein Verrutschen beim Toben und beim Sport, keine Gefährdung durch Stoßeinwirkungen, keine Fassung, die das Blickfeld einschränkt. Kontaktlinsen sind heute dank ihrer fortschrittlichen Technologien die praktische Alternative zur Brille, sie verlangsamen die Zunahme der Kurzsichtigkeit um die Hälfte3 und sind auch für Kinder einfach und sicher zu handhaben. 1

Hand in Hand:
Myopie Management und Patientenau lärung
Die Zahl der weltweiten Myopie-Fälle ist in den letzten Jahren drastisch gestiegen. Unbehandelt kann sich die Myopie bei Kindern und Jugendlichen zu einer hohen Myopie entwickeln, die das Risiko von Grauer Star, Grüner Star, Netzhautablösung und myopischer Makuladegeneration birgt. Neue Technologien bieten optimale Möglichkeiten, eine voranschreitende Kurzsichtigkeit zu messen, zu erkennen und über die Jahre zu begleiten. In den letzten Jahren hat sich die Messung der axialen Augenlänge als hervorragende Möglichkeit erwiesen, den Verlauf einer Myopie vorherzusagen, da sie unabhängig von subjektiven Einflüssen des Auges funktioniert und weniger vom seelischen Befinden und der Kooperationsbereitschaft des Patienten abhängig ist.
Haag-Streit verwendet in seinem Lenstar Myopia die neuesten Axiallängen-Wachstumskurven der MyopieExperten des niederländischen Erasmus University Medical Center in Rotterdam und ermöglicht darüber hinaus die Visualisierung der Refraktionsfehlervorhersage auf der Basis von benutzerdefinierbaren Kontrollraten und Umgebungsfaktoren. Ein automatisches Positionierungssystem ermöglicht eine einfache und schnelle Messwerterfassung, die besonders bei unruhigen Kindern unverzichtbar ist. Neben der präzisen Messung der Axiallänge trägt das

Gerät auch zu anderen unverzichtbaren Faktoren des Myopie-Managements bei, wie z. B. der Keratometrie (Vermessung der Hornhaut), und stellt somit eine Vielzahl von Daten zur Verfügung, mit denen man den Verlauf einer Myopie prognostizieren kann.
Ein weiterer wichtiger Faktor im Myopie Management sind die ermittelten Werte der Brillenglasbestimmung. Die Entwicklung im Kindesalter gibt Vorhersagen über den Verlauf der Myopie bis zum Erwachsenenalter. Die Lenstar Myopia Software überlagert diese Daten mit dem vorhergesagten Myopie-Verlauf unter Verwendung verschiedener Behandlungsmethoden und auf der Grundlage ihrer entsprechenden Kontrollraten. Der dritte wichtige Punkt im Myopie Management sind Umgebungsfaktoren wie myope Eltern, das Alter beim Auftreten der Myopie sowie die Zeit, die mit Lesen oder der Nutzung elektronischer Geräte oder bei Tageslicht im Freien verbracht wird.

änderungen über den Zeitraum des Myopie Managements zu veranschaulichen.
Eine der großen Stärken des Lenstar Myopia sind die grafischen Visualisierungen. Dank übersichtlicher Grafiken und anschaulicher Berichte können
Patienten, bzw. deren Eltern aktiv in das Myopie Management eingebunden werden, sodass eine vertrauensvolle Beziehung über viele Jahre aufgebaut werden kann. Die Software wurde in enger Zusammenarbeit mit führenden Myopie-Experten entwickelt und wird von Haag-Streit laufend weiterentwickelt.
Die Haag-Streit Gruppe ist ein international tätiges Schweizer Medizintechnikunternehmen auf dem Gebiet der Augenheilkunde. Nach dem Motto “Look closer, see further“ entwickelt, produziert und vertreibt sie innovative und fortschrittliche Gesamtlösungen für die medizinische Diagnose, Behandlung und Ausbildung für Augenspezialisten.
Diese Faktoren können sowohl Risiko- als auch Schutzfaktoren für die Myopie-Progression, also das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit, sein. Die Software bietet die Möglichkeit, Umgebungsfaktoren und deren Auswirkungen auf der Grundlage aktueller Forschungsergebnisse zu definieren und ihre Ver-
bietet die Möglichkeit, Umgebungsfaktoren und

Für die Zukunft unserer Kinder:
Nicht nur die Kurzsichtigkeit korrigieren, sondern auch dessen Fortschreiten reduzieren – mit MiYOSMART

Fortschreitende Kurzsichtigkeit – mehr als nur dickere Brillengläser Eine kontinuierlich fortschreitende Kurzsichtigkeit hat nicht immer nur dickere Brillengläser zur Folge, sondern erhöht auch das Risiko für verschiedene Augenerkrankungen im späteren Leben des Kindes. Diese können zu nicht korrigierbaren Sehbeeinträchtigungen bis hin zu einem Verlust der Sehkraft führen. Da die Kurzsichtigkeit (Fachbegriff: Myopie) häufig bereits im jungen Schulalter beginnt, sollte frühzeitig damit begonnen werden, ein übermäßiges Fortschreiten der Myopie bestmöglich zu reduzieren. Einen wichtigen Faktor für die Kontrolle des Fortschreitens der Myopie bei Kindern stellt dabei die Zusammenarbeit verschiedener Fachdisziplinen wie Kinderheilkunde, Augenheilkunde, Orthoptik und Augenoptik dar.
Bisher wurden kurzsichtige Kinder mit konventionellen EinstärkenBrillengläsern ausgestattet. Diese korrigieren zwar die Kurzsichtigkeit des Kindes, jedoch wird heutzutage angenommen, dass durch die Abbildung dieser Gläser die Myopie noch schneller voranschreitet.1

Eine innovative und effektive Technologie für das Myopie-Management Das MiYOSMART Brillenglas ist das erste seiner Art und basiert auf der innovativen „Defocus Incorporated Multiple Segments“-(D.I.M.S.) Technologie, welche das Fortschreiten der Myopie des Kindes signifikant verlangsamen kann.2 MiYOSMART mit D.I.M.S. Technologie ist ein speziell für Kinder geeignetes Brillenglas und beinhaltet auf der Vorderfläche Hunderte kleine fast unsichtbare Segmente. Durch diese Segmente wird zusätzlich zur scharfen Abbildung eine zweite Abbildungsebene im Auge erzeugt, wodurch eine effektive Verlangsamung des übermäßigen Längenwachstums des Auges erreicht und somit das Fortschreiten



der Kurzsichtigkeit reduziert wird.2 Ein weiterer Vorteil ist auch, dass MiYOSMART Brillengläser wie ganz normale Brillengläser aussehen und dem Kind nach einer kurzen Eingewöhnungszeit ein klares Sehen wie mit den herkömmlichen Brillengläsern ermöglicht. Mit dem Hintergrund, dass Kinder sehr aktiv sind, wurde für MiYOSMART ein besonders robustes Material gewählt, welches Kindern außerdem einen 100-prozentigen UV-Schutz für alle Aktivitäten im Freien bietet.
MiYOSMART Brillengläser bieten eine sichere und nachweisbar effektive Methode zur Hemmung des Fortschreitens der Myopie.2 Innerhalb der am längsten durchgeführten klinischen Studie zu Brillengläsern für das Myopie-Management wurde bewiesen, dass das Fortschreiten der Myopie nach zwei Jahren des Tragens von MiYOSMART um durchschnittlich 60 Prozent verlangsamt werden kann2 und dass der Therapieeffekt auch über sechs Jahre des Tragens hinweg bestehen bleibt.3,4 Dabei wurde auch festgestellt, dass acht von zehn Kindern im dritten Jahr keine neuen Brillengläser benötigten, da sich die Stärke nicht oder nur gering geändert hat.3 Darüber hinaus wurde das übermäßige Augenlängenwachstum auf das Niveau eines altersgerechten Wachstums verlangsamt und damit normalisiert.5
Das innovative MiYOSMART Brillenglas wurde bereits von rund zwei Millionen Eltern erworben.6 In Asien, Australien, Kanada, Frankreich und Italien ist es bereits seit Längerem auf dem Markt, und seit dem Frühjahr 2021 ist es auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Text Dr. med. Hakan Kaymak, Pascal Blaser Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit Hoya Lens Deutschland GmbH entstanden.
Mehr als eine TV-Kampagne:
Mit dem Zweiten (Auge) sieht man besser!

Die Augen sind an der Wahrnehmung unserer Umwelt zu 80 Prozent beteiligt, gutes Sehen ist daher für die gesamte Entwicklung des Kindes wichtig.
Die Sehfunktionen entwickeln sich ab dem Säuglingsalter. Sie sind in dieser sensitiven Phase, der Zeit der schnellen visuellen Reifung, extrem störanfällig. Diese hat ihr Maximum in den ersten Lebensmonaten und nimmt langsam bis zum 6. Lebensjahr ab. Eine Restsensibilität ist noch bis etwa zum 14. Lebensjahr vorhanden.
Schielen (Strabismus) ist eine der Störungen, die die Sehentwicklung beeinträchtigen können. Unter Schielen versteht man eine ständige oder immer wieder auftretende Fehlstellung der Augen. Rund vier Millionen Menschen in Deutschland haben eine Schielerkrankung. Durch das Schielen kommt es neben dem Verlust des räumlichen Sehens (3D-Sehen) in vielen Fällen auch zu einer Sehschwäche (Amblyopie). Um Doppelbilder zu vermeiden, wird der Seheindruck am schielenden Auge unter-
drückt. Dies führt dazu, dass sich das Sehen auf dem betroffenen Auge nicht weiterentwickelt. Wird eine Amblyopie nicht rechtzeitig erkannt und behandelt, bleibt sie lebenslang bestehen. Es gibt verschiedene Therapieformen bei Amblyopie, angefangen bei einer Brille bis zu Augenpflastern sowie in den letzten Jahren auch digitalen Trainingsmethoden. Dabei ist die Therapieform von der Art der Amblyopie und auch von ihrer Stärke abhängig. Für alle Amblyopietherapien gilt, dass durch eine vorübergehende Schwächung des Seheindrucks des besser sehenden Auges eine verstärkte Nutzung des amblyopen Auges entsteht und dadurch die Sehentwicklung wieder aktiviert wird.
Die sogenannte faziale Okklusionstherapie (Pflasterbehandlung) ist trotz neuer digitaler Therapieformen die effektivste. Dabei wird je nach Alter des Kindes das gute Auge stundenweise abgedeckt. Der Vorteil der Therapiemethode liegt neben der einfachen Handhabung auch in den guten Ergebnissen bei konsequenter Durchführung.
Das schwache Auge wird durch die Okklusion (Abdeckung) trainiert.
Die Therapiedauer hängt von vielen Faktoren ab, vor allem davon, wie ausgeprägt die Amblyopie ist. Ein weiterer wichtiger Faktor ist – wie bei allen Therapien – die Akzeptanz der Therapie. Je sorgfältiger die Therapie durchgeführt wird, desto schneller stellt sich ein Erfolg ein. Gerade bei der Amblyopietherapie ist es wichtig, sie möglichst früh konsequent durchzuführen, denn je weiter die sensitive Phase vorangeschritten ist, desto länger dauert es, bis sich ein Erfolg zeigt. Daher gilt:
Je früher Schielen und Sehschwäche entdeckt und behandelt werden, umso erfolgreicher kann die Amblyopie behandelt werden!
Unser Video „Mia und die Augenpflaster“ zeigt Ihnen und Ihrem Kind, wie der Ablauf der Untersuchung und Therapie erfolgt.

Weitere Informationen und Patientenratgeber finden Sie unter: www.orthoptik.de























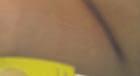

































Man darf sich nicht verstecken
Jens Flach ist in vielerlei Hinsicht ein Vorbild. Selbst vom Glaukom betroffen und quasi blind, Familienvater, darunter ein ebenfalls an Glaukom erkranktes Kind, hält ihn nichts davon ab, sein Leben positiv zu gestalten. So unterrichtet er als Lehrer an einem Gymnasium für Blinde und Sehbehinderte, ist nebenbei Musiker und engagiert sich ehrenamtlich für andere Betroffene im Bundesverband GlaukomSelbsthilfe. Hier fungiert er als stellvertretender Vorsitzender und Leitung Fachbereich Kinder Bundesverband Glaukom-Selbsthilfe e. V. Im Interview erzählt er von seinen persönlichen Erfahrungen und davon, wie es ist ein Kind mit dieser Erkrankung zu unterstützen.
Bei Ihnen hat die Krankheit, anders als in den meisten Fällen, einen schwerwiegenden Verlauf genommen. Erzählen Sie uns kurz von Ihrem persönlichen Schicksal. Ich kam mit Glaukom zur Welt, und so gehörten OPs und Besuche beim Augenarzt ganz selbstverständlich dazu. Mir fiel zwar auf, dass das bei anderen Kindern nicht so war, was mich aber nicht weiter störte, weil meine Eltern nie ein Drama daraus machten.
Da Glaukom schleichend voranschreitet, bemerkte ich die Sehverschlechterungen nie abrupt. Im Rückblick werden sie aber deutlich. Nach zwei Jahren Grundschule musste ich auf eine Schule für Blinde wechseln, um Braille-Schrift zu lernen. Bis zu meinem Studium arbeitete ich dann mit einer Mischung aus Punkt- und vergrößerter Normalschrift. Dann musste ich mich sukzessive vom Lesen mit den Augen verabschieden. Mit Anfang 30 erlitt ich eine Netzhautablösung und kann heute nur noch Licht wahrnehmen.
Eines von Ihren drei Kindern hat die Krankheit geerbt. Wann wurde das festgestellt und wie wurde Ihre Tochter dann behandelt? Wie auch bei mir wurde es bei unserer Tochter mit etwa sechs Monaten festgestellt. Beim angeborenen Glaukom sind OPs die erste Wahl. Mittlerweile – sie ist heute 11 – waren insgesamt 20 OPs nötig. Begleitend wird noch mit Augentropfen therapiert.
Wie geht es Ihrer Tochter heute? Wie meistert sie ihren Alltag? Sie ist ein sehr lebensfrohes und starkes Kind. Ein Auge ist zwar blind, aber dies kann sie mit dem anderen so kompensieren, dass man ihr im Alltag nichts anmerkt. Schule, Sport, Freundinnen treffen – wir sind sehr glücklich, dass dies nicht anders läuft als
bei anderen Mädels.
Der Alltag mit drei Kindern ist auch für Familien mit gesunden Kindern manchmal eine Herausforderung. Welche Situationen sind für Sie besonders schwierig?
Das ist die Welt, in der unsere Kinder aufwachsen, die für sie normal ist. Belastungen treten immer nur punktuell auf: z. B. Krankenhausaufenthalte oder organisatorische Schwierigkeiten, weil ich wegen meiner Blindheit gewisse Aufgaben nicht übernehmen kann.
Woher nehmen Sie diese Stärke und was möchten Sie anderen betroffenen Eltern mit auf den Weg geben?
Man darf Belastungen nicht leugnen, sollte ihnen und der Erkrankung aber nicht zu viel Bedeutung beimessen. Wir versuchen, uns auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Selbst mit einer Sehbehinderung oder Blindheit kann man ein glückliches Leben führen. Man darf sich nicht verstecken. Gerade Kinder mit einer Sehbehinderung müssen Bewegungs- und Umwelterfahrungen machen, um sich zu entwickeln. Ermöglichen Sie es ihnen!
Wie kann der Bundesverband Glaukom-Selbsthilfe dabei unterstützen?
Neben unserem Infoangebot rund um Medizin und Förderpädagogik sehen wir uns als Vernetzungs- und Austauschbörse. Wenn man spürt, dass man mit der Erkrankung nicht alleine ist, fällt es viel leichter, das Gefühl der Belastung abzuschütteln. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme im Internetforum, bei Facebook, per E-Mail oder Telefon.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.glaukom-kinder.de

Strong
So heißt das Lied, das Jens Flach aus Marburg für seine Tochter Norina (11) geschrieben hat.
“You’re strong“, heißt es in dem Text – und stark ist Norina wirklich, mit der musikalischen Unterstützung von Papa und seiner Band J-Flat Major meistert sie ihr Schicksal.
Auf dem Youtube-Kanal von Jens Flach
„J-Flat Major“ oder auch auf Spotify können Sie den Mutmacher-Song selbst hören!

Deutsches Kinder-Glaukomzentrum
Text Univ.-Prof. Dr. med. Esther M. Hoffmann, Dr. med. Julia V. Stingl
Das kindliche Glaukom

Univ.-Prof. Dr.
med. Esther M.
Hoffmann
Leitung der Abteilung für Glaukomerkrankungen und des Deutschen
Kinder-Glaukomzentrums der Augenklinik der Universitätsmedizin Mainz
Glaukom (im Volksmund „Grüner Star“ genannt) ist eine der häufigsten Erblindungsursachen weltweit. Ursache ist der unwiederbringliche Untergang von Nervenfasern des Sehnervs, der durch einen hohen Augendruck oder schlechte Durchblutung bedingt sein kann. 1-2 Prozent der Bevölkerung sind von dieser Volkskrankheit betroffen, die zu fortschreitenden Ausfällen des äußeren Gesichtsfeldes führt. Dabei nimmt das Risiko mit dem Alter zu.
Doch nicht nur ältere Menschen sind von der Erkrankung betroffen. Das Glaukom kann in seltenen Fällen auch angeboren sein oder in der Kindheit auftreten. Unbehandelt führt das kindliche Glaukom zur Erblindung. Während die Erkrankung beim Erwachsenen langsam und schleichend vorangeht, führt ein angeborenes Glaukom meist schon direkt nach der Geburt aufgrund eines sehr hohen Augeninnendruckes zu einem krankhaft vergrößerten Augapfel („Buphthalmus“).
borenen Glaukoms erfordert eine Operation, die bei 80 - 90 Prozent der Kinder erfolgreich verläuft und den Augeninnendruck stabilisiert. Da die kleinen Augen durch den hohen Augeninnendruck schnell größer werden, ohne dass die zarten Strukturen mitwachsen können, ist dadurch die Lederhaut oftmals sehr dünn. Das Operieren solcher Augen verlangt daher nach einer erfahrenen Hand mit hoher Expertise.
Trotz Operation wird eine gute Sehschärfe, die beispielsweise Lesen ermöglicht, im Schnitt nur in 40-80 Prozent erzielt. Ursache für eine reduzierte Sehkraft können neben dem druckbedingten Glaukom-schaden am Sehnerv und Eintrübungen der Hornhaut auch durch eine Schwachsichtigkeit („Amblyopie“) entstehen. Um dies zu verhindern, ist eine enge Zusammenarbeit mit einem/r Orthoptisten/in notwendig, der/die den Refraktionsfehler mittels Brille korrigiert und ein eventuell schwachsichtiges Auge durch Abkleben des besseren Auges „trainiert“ (sogenannte Okklusionstherapie).
Deutsches Kinder-Glaukomzentrum Mainz

Häufig wird der Buphthalmus von Lichtempfindlichkeit und Tränenlaufen begleitet, da die Hornhaut eintrüben kann. Ursache ist eine embryonale Fehlbildung des Kammerwinkels, wodurch die Ableitung des Kammerwassers, das ständig neu im Auge gebildet wird, fehlt. Wie es zu dieser Fehlbildung kommt, ist weitgehend ungeklärt. In manchen Fällen können Veränderungen in bestimmten Genen gefunden werden, die weiter vererbbar sind.
Eine erfolgreiche Behandlung des ange-
Die Augenklinik der Universitätsmedizin Mainz betreibt seit 2017 das Deutsche Kinder-Glaukomzentrum. Pro Jahr werden etwa 200 Kinder in der Kinderglaukomsprechstunde betreut, knapp die Hälfte wird operiert. Etwa 20 Prozent der Kinder sind dabei jünger als 1 Jahr. Für eine umfassende und erfolgreiche Behandlung steht ein eingespieltes Team
an Pflegekräften, NarkoseärztInnen, KinderärztInnen, HumangenetikerInnen und OrthoptistInnen zur Verfügung, die die Betreuung rund um den stationären Aufenthalt übernehmen und die Kinder begleiten. Die Untersuchung muss insbesondere bei Neugeborenen und Kleinkindern in der Regel in Vollnarkose stattfinden. Hierfür steht ein spezialisiertes Kinder-Anästhesieteam der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsmedizin Mainz zur Verfügung. Bereits bei Erstvorstellung der kleinen PatientInnen im Kinder-Glaukomzentrum erfolgt eine anästhesiologische Mitbeurteilung. Besondere Aspekte, wie Frühgeburtlichkeit oder das Vorliegen von syndromalen Erkrankungen können so frühzeitig festgestellt werden, um individuellen Bedürfnissen und Erfordernissen vor, während oder nach der Operation entsprechend nachkommen zu können. Weiter erhalten PatientInnen und Eltern Informationen über die Möglichkeit einer genetischen Beratung über das Humangenetische Institut. Um weitere Informationen über kindliche Glaukome zu gewinnen, spielt auch die Forschung eine wichtige Rolle im Kinder-Glaukomzentrum. Beispielsweise wurde eine Registerstudie („Register für kindliche Glaukome in Deutschland“) etabliert, dessen Ziel die Untersuchung von Häufigkeit, Ursachen, Versorgung und Therapie dieser Erkrankung ist. Aktuell wird dieses Register zu einer multizentrischen, deutschlandweiten Studie erweitert, um möglichst alle Kinder mit Glaukom in Deutschland zu erfassen.

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kinder- Glaukomzentrum Mainz entstanden. Qr Code scannen

Wie schafft sie das bloß?
Jennifer Malcherek ist sehbehindert und täglich mit ihrem kleinen Sohn auf Achse.

Text Susanne Hölter


Jennifer Malcherek ist Mama mit jeder Faser ihres Herzens. Lio heißt der süße Junge. Er ist gerade zwei Jahre alt geworden und hält seine Mama ganz schön auf Trab. Wie anstrengend das sein kann, wissen viele junge Mütter. Aber die Geschichte von Jennifer Malcherek ist eine besondere: Sie hat Retinitis pigmentosa. Das ist eine Sehbehinderung, bei der man von seiner Umwelt ungefähr so viel sieht, als würde man durch ein Schlüsselloch gucken. Ein Normalsichtiger hat ein Blickfeld von 180 Grad, bei der 30-Jährigen sind es gerade noch fünf Grad.
Das ist wenig, verdammt wenig. Ein vermaledeiter Zufall war es, dass bei Jennifer die Augenerkrankung durchbrach. Retinitis pigmentosa ist eine Genkrankheit. Bei Jennifer Malcherek tragen beide Elternteile sie in ihrem Erbgut – ohne selbst erkrankt zu sein. Beide haben sie an Jennifer vererbt; ihre Augen erkrankten.
Wie alles begann? Sonnenlicht hat sie schon früh stark geblendet, und in der Nacht konnte sie früh schlecht sehen. „Ich habe Gläser umgeworfen bei Tisch“, erzählt die Hamburgerin, „fünfmal hintereinander.“ Beim Autofahren sei sie unsicher gewesen; verursachte sogar wegen ihrer eingeschränkten Sicht zwei Unfälle. „Ich war mehrmals beim Augenarzt“, erzählt sie. „Doch der hat immer gesagt, dass die Sehschärfe okay sei“, erinnert sich Jennifer. „Er hätte das Gesichtsfeld kontrollieren müssen“, weiß sie heute. Die Freundin ihres Bruders hat sie schließlich zu einem anderen Augenarzt gelotst. „Die Freundin lernte bei einem Augenarzt und sah, was mir ständig passierte“, so Jennifer Malcherek.
Als die junge Frau die Diagnose bekam, war sie schwanger. Im dritten Monat. Die Freude über das noch ungeborene Kind war riesig. Das Hochgefühl trug sie durch die Schwangerschaft. „Als der Kleine dann da war, hat mich der Alltag eingeholt.“ Alles, alles, alles ist beschwerlich. „Ich muss mich immer konzentrieren, immer aufpassen.“ Es kann passieren, dass sie mit dem Kinderwagen versehentlich gegen Poller fährt, die Wege begrenzen „Doch der Kleine soll ja auch raus an die frische Luft kommen“, sagt sie. Einkaufen mit einem Kleinkind ist der pure Stress. Davon können auch normal sehende Mütter ein Lied singen. Doch für Jennifer Malcherek ist alles noch schwieriger: „Habe ich alles aufs Band geräumt? Habe ich danach alles wieder in meinen Einkaufswagen gepackt? Hoffentlich bleibt das Kind ruhig.“ Und wenn wieder einmal ein Missgeschick passiert, auch das: „Was mögen nur die anderen denken?“
Sehr geholfen hat das Miteinander mit anderen Betroffenen, die ich in der Selbsthilfegruppe von PRO RETINA kennenlernte.
Auf dem Spielplatz macht sich der kleine Lio gerne selbstständig. Spielt hier, will dahin klettern, läuft zu anderen Kindern. Jennifer ist ständig auf „hab acht“. „Ich kann mich kein Stück ablenken lassen. Im Gespräch mit anderen kann ich mich anderen nicht zuwenden. Ich kann die anderen Mütter nicht ansehen.“ Möglicherweise wirke das auf die anderen arrogant, bedauert sie. Doch im Allgemeinen sei das Verständnis sehr groß, wenn sie ihre Beeinträchtigung darlege. Jennifer trägt auch einen Sehbehinderten-Button an der Kleidung, das sind drei schwarze Punkte auf gelben Grund, das helfe ihr.
Wenn sie ohne Kind unterwegs ist, nimmt sie ihren weißen Langstock zur Hand. Aber auch das gibt es: „Manchmal fühle ich mich beobachtet von anderen Müttern. Ein unausgesprochenes ,Wie schafft die das bloß?‘ liegt dann in der Luft. Aber die Leute meinen es ja nicht böse“, sagt die Mutter.
Seit Anfang August ist Jennifer zurück aus der Elternzeit und wieder in ihrem Beruf tätig. Sie ist gelernte Kauffrau für Dialogmarketing und arbeitet in der Mahnabteilung einer Bank. „Mein Arbeitgeber ist sehr kulant und hat mir einen Homeoffice-Arbeitsplatz eingerichtet“, freut sie sich.
„Jetzt aber Butter bei die Fische“, sagt die Hamburgerin. „Es klingt alles gut – aber es ist nicht einfach.“ Der Augenarzt lobt sie gerne beschwichtigend: „Sie kommen doch super zurecht!“ Doch das wird ihr nicht gerecht. Es gibt auch Angst und trübe Tage. „An schlechten Tagen frage ich mich, warum ich es so schwerhabe“. Sehr geholfen hat ihr das Miteinander mit anderen Betroffenen, die sie in der Selbsthilfegruppe von PRO RETINA kennenlernte. Das sind Gespräche auf Augenhöhe. „Betroffene wissen, wovon sie sprechen. Ihre Tipps sind authentisch, sie sind hilfreich.“ Und ganz besonders dankbar ist sie ihrer Familie: „Ich bekomme so viel Unterstützung von meinem Mann, meinen Eltern und meiner Tante, das ist im Alltag eine große Hilfe und bedeutet mir sehr viel.“
Wenn Lio alt genug ist, wird die Familie auch ihn durchchecken lassen. Zum Glück ist die Wahrscheinlichkeit jedoch gering, dass der Junge den Gendefekt geerbt hat, aber „es ist natürlich wichtig, die Augen untersuchen zu lassen, wenn Erkrankungen in der Familie vorliegen“, so Jennifer.
Auf die Frage, was Jennifer sich von der Zukunft erhofft, antwortet die starke Frau zuversichtlich, aber auch demütig. „Ich hoffe, dass die Krankheit langsam voranschreitet und ich noch ganz viele Jahre mit meiner Familie genießen kann, und natürlich, dass die Forschung weiter vorankommt.“
Information
Der Selbsthilfeverein PRO RETINA Deutschland e. V. ist mit bundesweit mehr als 6.500 Mitglieder in rund 60 Regionalgruppen die größte und älteste Patientenvereinigung von und für Menschen mit Netzhauterkrankungen und deren Angehörige. PRO RETINA unterstützt Betroffene und ihre Angehörigen nach dem Leitsatz „Krankheit bewältigen, selbstbestimmt leben“, fungiert als Bindeglied zwischen Patient und Arzt und unterstützt die Forschungsförderung, damit neue Therapien entwickelt werden.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.pro-retina.de
LHON: Rasche Aufklärung ist wichtig
Bei LHON, der Leberschen hereditären Optikusneuropathie, kommt es durch eine erbliche Mutation in Nervenzellen der Netzhaut zu einer Schädigung des Sehnervs. Die Erkrankung geht mit einer massiven Verschlechterung des Sehvermögens einher. Wir sprachen mit Professor Dr. Wolf Lagrèze vom Universitätsklinikum Freiburg über die Erkrankung, eine vielsprechende neue Behandlungsmethode und darüber warum es wichtig ist, bei Diagnosestellung auch an seltene Erkrankungen zu denken.
Text Miriam RauhProf. Lagrèze, derzeit wird ein Verfahren für eine Gentherapie bei LHON geprüft. Um was geht es genau?
Das Medikament wird dabei mit einer Kanüle in den Glaskörper injiziert, ähnlich der Behandlung von Makuladegeneration. Dabei schleust ein Virusvektor eine intakte Kopie des defekten Gens in die Nervenzellen ein, welche als Vorlage für die Produktion des Proteins ND4 dient. ND4 spielt in den Mitochondrien eine zentrale Rolle für die Energieproduktion der Zellen. Die Mitochondrien erzeugen in der Folge mehr Energie und sichern die Versorgung der Nervenzellen, sodass wieder Seheindrücke an das Gehirn weitergeleitet werden können.
Es heißt, das Auge ist ein „Immunprivilegiertes Organ“. Was bedeutet das?
Es zeigt eine andere Immunreaktion als andere Organe. Das hat den biologischen Sinn, dass die Entzündungsreaktionen des Auges bei einer Verletzung etwas milder ablaufen und damit die Sehfunktion weniger beeinträchtigt wird. Sowohl das Auge als auch das Immunsystem spielten in der Evolution für das Überleben eine wichtige Rolle. Um die negativen Folgen einer Immunantwort zu mildern, hat sich im Auge ein einzigartiger immun-


regulatorischer Mechanismus entwickelt. Würde man den Virusvektor in ein anderes Organ injizieren, zöge dies möglicherweise eine heftigere Immunantwort nach sich. Das Auge ist somit für eine derartige Behandlung prädestiniert.
Wie sicher ist das Verfahren?
Ich halte es für sicher, zumal Sicherheitsaspekte jeder neuen Therapie in den zulassungsrelevanten Studien sehr sorgfältig geprüft werden. Injektionen in das Auge sind eine inzwischen 100.000-fach praktizierte Verabreichung von Medikamenten. Bei dieser sogenannten IVOM kann es zu Blutungen oder zu einer Infektion kommen, aber das sind seltene Nebenwirkungen. Wenn lokale Entzündungsreaktionen auftreten, können diese in der Regel gut mit Cortison behandelt werden.
Wie wirksam und nachhaltig ist diese Behandlung? Muss mehrfach behandelt werden?
Nein, es gibt zu dieser Therapie Studiendaten mit fünf-Jahres-Ergebnissen, die zeigen, dass eine einmalige Behandlung innerhalb dieser Zeit einen dauerhaften Effekt hat.
Gibt es die Möglichkeit zur Heilung? Von Heilung würde ich nicht sprechen.

GENOMISCHE MEDIZIN
BEI SELTENEN NETZHAUTERKRANKUNGEN
GenSight Biologics, ein Biopharma-Unternehmen aus Frankreich, hat sich auf die Forschungsarbeit an schweren neurodegenerativen Augenerkrankungen und Erkrankungen des zentralen Nervensystems spezialisiert. Die innovativen Therapieansätze fokussieren sich dabei besonders auf Patientinnen und Patienten mit Leberscher hereditärer Optikusneuropathie (LHON) und Retinitis pigmentosa.
Am weitesten fortgeschritten ist eine Gentherapie, die aus der Forschung am Institut de la Vision in Paris hervorgeht und in einem klinischen Studienprogramm bei mehr als 200 Patientinnen und Patienten mit Leberscher Hereditärer Optikusneuropathie (LHON) entwickelt wird. Der gentherapiebasierte Ansatz ist so konzipiert, dass beide Augen mittels einer einzigen intravitrealen Injektion behandelt werden. Ziel ist es, den Patientinnen und Patienten eine nachhaltige
Eine 100-prozentige Erholung ist nicht möglich, da durch die Erkrankung bereits Nervengewebe geschädigt wurde. Man schätzt, dass die Wahrscheinlichkeit, als LHON-Patient von einer schweren Sehbehinderung betroffen zu sein und im Sinne des Gesetzes als „blind“ zu gelten, was in Deutschland eine Sehschärfe unter 0,02 bedeutet, bei 60 Prozent liegt. Mit einer medikamentösen Behandlung durch Idebenon sinkt die Wahrscheinlichkeit auf 30 Prozent und mit der Gentherapie wird sie bei etwa 20 Prozent liegen.
Ist die Gentherapie in Deutschland zugelassen? Aktuell nicht, die klinischen Studien wurden international durchgeführt – nun werden die Zulassungen auf nationaler Ebene geprüft. Hierbei geht es um Nutzensowie Sicherheitsbewertung und um Preisfindung.
An wen können sich Betroffene wenden?
Wenn man eine beträchtliche Minderung des Sehvermögens feststellt, sollte man zunächst zu einem Augenarzt gehen und die Symptome abklären lassen. Denn es können ja viele verschiedene Augenerkrankung die Ursache sein.



Wiederherstellung des Sehvermögens und eine weitgehende Verbesserung der Lebensqualität zu ermöglichen. Damit wird ein großer medizinischer Bedarf in dieser sehr seltenen Erkrankung angegangen. Von der European Medicine Agency wird derzeit der Antrag auf Marktzulassung überprüft. Diese wird für 2023 erwartet.
GenSight Biologics untersucht mit seinem zweiten Therapiekandidaten eine Behandlung zur Wiederherstellung des Sehvermögens bei Patienten, die an Retinitis pigmentosa im Spätstadium leiden. Der optogenetische Ansatz ist unabhängig von den spezifischen genetischen Mutationen und hat potenzielle Anwendungen bei anderen Erkrankungen der Netzhaut, wie der trockenen altersbedingten Makuladegeneration.
Diabetes kann ins Auge gehen
Diabetes hat Auswirkungen auf den ganzen Körper- auch auf die Augen. Die diabetische Retinopathie ist eine häufige Komplikation des Diabetes. Unbehandelt kann dies zu Sehverlust und Erblindung führen. Da erste Schädigungen der Netzhaut vom Betroffenen selbst nicht erkannt werden können, sind regelmäßige Augenuntersuchungen von großer Wichtigkeit. Denn frühzeitig erkannt, kann der Augenarzt frühzeitig mit der Therapie beginnen und ein mögliches Fortschreiten der Krankheit einschränken.
Was passiert bei der diabetischen Retinopathie?
Bei einem lange bestehenden oder schlecht eingestellten Diabetes kommt es zu Gefäßveränderungen und Durchblutungsstörungen der Netzhaut (Retina). Die Erkrankung beginnt mit Schäden der kleinsten Blutgefäße in der Netzhaut. In der Folge werden die Gefäße durchlässig und brüchig, es tritt Blut in das umliegende Gewebe aus.
Bei ungefähr einem Viertel der Menschen mit Typ-1-Diabetes tritt im Laufe ihrer Erkrankung eine diabetische Retinopathie auf. Bei einem Typ2-Diabetes besteht oft schon bei der Diagnose eine beginnende diabetische Retinopathie. Häufig ist es sogar der Augenarzt, der aufgrund von Veränderungen der Netzhautgefäße einen Diabetes (Typ 2) diagnostiziert.
Erste erkennbaren Veränderungen am Augenhintergrund machen keine Beschwerden, sie werden kaum bemerkt. Nur in fortgeschrittenen Stadien der Netzhautschädigung können Symptome auftreten:
• Sehverschlechterung, die nicht durch eine Änderung der Sehhilfe behoben werden kann
• Leseschwierigkeiten
• Störung des Farbsinns
• Verschwommenes und/ oder verzerrtes Sehen
• Blutungsherde entstehen, die Betroffene als schwarze Flecken wahrnehmen (Rußregen)
Welche Stadien der diabetischen Retinopathie werden unterschieden?
1Nicht proliferative Retinopathie
Im Anfangsstadium bleibt sie für den Patienten lange unbemerkt, da die Veränderungen nur sehr leichte oder noch gar keine Sehstörungen verursachen. Bei der augenärztlichen Untersuchung können hier vor allem Blutungen und Gefäßveränderungen am Augenhintergrund festgestellt werden.
2Proliferative Retinopathie
Sie stellt die schwerste Ausprägung der diabetischen Netzhauterkrankung dar und geht aus der nicht proliferativen Form hervor. In diesem Stadium der diabetischen Retinopathie werden mehr und mehr Blutgefäße blockiert. Dadurch kommt es zu einer Unterversorgung, auf die der Körper reagiert, indem er neue, krankhafte Gefäße bildet.
Diese Gefäße wachsen – wie bei Glaskörpererkrankungen – in den Glaskörper hinein und führen dort zu Blutungen und zu Ablösungen der Netzhaut. Die Sehkraft verschlechtert sich dabei schlagartig.
3Diabetisches Makulaödem
Ist der Bereich des scharfen Sehens (Makula) von den Gefäßveränderungen mit einhergehender Schwellung der Netzhaut betroffen, ist ein diabetisches Makulaödem entstanden.
Behandlungsmöglichkeiten der diabetischen Retinopathie Heilbar ist die Erkrankung bisher nicht. Die Behandlung zielt vor allem darauf ab, ein Fortschreiten zu vermeiden. Die Behandlungsmöglichkeiten der Retinopathie in den frühen Stadien schließen die Prävention und eine optimale Diabetestherapie ein. Sehschäden, die als Folge einer diabetischen Retinopathie auftreten, lassen sich in der Regel nicht rückgängig machen. In Frage kommen je nach Befund am häufigsten eine Laserbehandlung (Laser-Photokoagulation) oder die operative Eingabe von Medikamenten in das Augeninnere (den Glaskörper). Größere Sehminderungen sind so oft vermeidbar. Ist die Erkrankung bereits so weit fortgeschritten, dass mit dem Laser oder der Medikamenteneingabe eine effektive Behandlung alleine nicht mehr möglich ist, steht ein Operationsverfahren, die Viktrektomie, zur Verfügung. Dabei entfernt der Arzt den Glaskörper sowie das in das Augeninnere ausgetretene Blut und ggf. Narbengewebe.
Diabetesmanagement bei Augenerkrankungen Patient*innen können sehr viel dazu beitragen, Folgeschäden am Auge vorzubeugen bzw. einer Sehverschlechterung entgegenzuwirken:
• Gute Einstellung des Blutzuckerspiegels und des Blutdrucks
• Verzicht auf das Rauchen und übermäßigen Alkoholkonsum
• Therapie einer bestehenden Fettstoffwechselstörung
• Und ganz besonders: regelmäßige augenärztliche Untersuchungen
Außerdem kann der Austausch mit anderen Betroffenen sehr hilfreich sein. Selbsthilfegruppen sind hierfür die perfekte Anlaufstelle.
Information
Die bundesweit aktive Selbsthilfeorganisation Deutsche-Diabetes-Hilfe –Menschen mit Diabetes (DDH-M) e.V. setzt sich für eine bessere Lebensqualität für Menschen mit Diabetes ein und macht Selbsthilfe erlebbar – digital und im echten Leben.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.menschen-mit-diabetes.de

Alles im Blick?! –
Die Woche des Sehens 2022
Text Anna Derbsch
Gutes Sehen ist nicht selbstverständlich.
Häufig fällt das erst auf, wenn die eigene Sehleistung nachlässt oder sogar Erblindung droht. Daher machen die Partner der Woche des Sehens vom 8. bis 15. Oktober 2022 bereits zum 21. Mal auf die Bedeutung guten Sehvermögens und die Ursachen von Blindheit aufmerksam.
Höhepunkte sind in jedem Jahr die zwei internationalen Aktionstage “Welttag des Sehens“, dieses Jahr am 13. Oktober und “Tag des weißen Stocks“ am 15. Oktober.
Partner der Woche des Sehens
Getragen wird die Aktionswoche von der Christoffel-Blindenmission, dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, dem Berufsverband der Augenärzte, dem Deutschen Komitee zur Verhütung von Blindheit, der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, dem Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf und PRO RETINA Deutschland. Die Woche des Sehens ist durch das Engagement der sieben Partner sowie die Unterstützung von Aktion Mensch und ZEISS möglich.
Prominente Schirmherrin der Woche des Sehens ist Gundula Gause, bekannt aus dem „heute journal“ im ZDF. Bereits seit 13 Jahren begleitet die TV-Journalistin die Woche des Sehens und steht mit ihrer Stimme, ihrem Gesicht und Namen für die gute Sache.
Bundesweite Au lärungskampagne
Bundesweit laden während der Woche des Sehens zahlreiche Veranstaltungen dazu ein, sich zu informieren und zu engagieren. Das breit gefächerte Angebot steht in diesem Jahr unter dem Motto „Alles im Blick?!“. Die Kampagne macht auf die Bedeutung eines guten Sehvermögens, die Ursachen vermeidbarer Blindheit und auch auf die Situation blinder und sehbehinderter Menschen in Deutschland und in den ärmsten Ländern der Welt aufmerksam.
Ob auch in Ihrer Nähe eine passende Veranstaltung stattfindet, können Sie unter der folgenden Webseite nachsehen:
www.woche-des-sehens.de
Verlauf der Krankheit und Therapiemöglichkeiten
Die altersabhängige Makuladegeneration (AMD)
– Hoffnung in Sicht?
Die altersabhängige Makuladegeneration, AMD, ist eine Erkrankung der Stelle des schärfsten Sehens im hinteren Augenbereich (Makula). Sie ist in den westlichen Industrieländern eine der häufigsten Ursachen für gravierende Sehbehinderung. Allein in Deutschland sind ca. 7,5 Millionen Menschen betroffen, davon ca. 500.000 Menschen mit einer späten AMD.

GEine frühe Diagnosestellung kann entscheidend sein für den weiteren Verlauf.
Empfehlenswert ist eine jährliche Routineuntersuchung durch einen Augenarzt ab dem 40. Lebensjahr.
rundlegend ist die AMD eine Erkrankung, die sich aus den altersabhängigen Veränderungen der zentralen Netzhaut entwickelt. Es kommt bei jedem Menschen im Laufe des Lebens zu Ablagerungen von Abfallprodukten unter der zentralen Netzhaut. Diese gelblichen Ablagerungen, sogenannte Drusen, sind das Kennzeichen der frühen und intermediären AMD. In diesem Stadium ist das Sehen oft noch wenig beeinträchtigt und daher ist das Tückische, dass die Krankheit in diesem Stadium nur durch eine spezielle Untersuchung rechtzeitig erkannt werden kann.
Risikofaktoren und Warnzeichen
Zu den Hauptrisikofaktoren für die altersbedingte Makuladegeneration zählen nach derzeitigem Kenntnisstand Rauchen, Belastung der Augen durch Licht, insbesondere UV-Strahlung, sowie Bluthochdruck. Eine besondere Rolle spielt die Ver-
Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit Samsara Vision, Inc. entstanden.

anlagung. Mit dem Alter, meist nach dem 60. Lebensjahr, nimmt die Erkrankung sprunghaft zu. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist mit einer deutlichen Zunahme von Betroffenen zu rechnen.
Symptome bei Makuladegeneration
Oft ist zunächst nur ein Auge betroffen, Sehausfälle am erkrankten Auge können noch durch das gesunde Auge ausgeglichen werden. Frühe Symptome sind ein gesteigertes Lichtbedürfnis und Blendempfindlichkeit sowie blassere Farbwahrnehmungen, eine Abnahme der Sehschärfe in der Mitte des Gesichtsfeldes und des Kontrastsehens sowie ein verzerrtes Sehen gerader Linien (siehe Selbsttest: www.amd-netz.de/amslergitter) Eine frühe Diagnosestellung kann entscheidend sein für den weiteren Verlauf. Empfehlenswert ist eine jährliche Routineuntersuchung durch einen Augenarzt ab dem 40. Lebensjahr.
Neue Hoffnung bei AMD
Für Patienten mit altersbedingter Makuladegeneration (AMD) gibt es neue Hoffnung: Dank eines innovativen Implantats lässt sich bei einer AMD im Spätstadium das zentrale Sehen wieder deutlich verbessern.
Das neue implantierbare Miniaturteleskop von Samsara Vision vergrößert Bilder und projiziert diese auf die noch gesunden Fotorezeptoren der Makula im Augenhintergrund. Dafür wird die winzige Sehprothese mit einem kleinen Schnitt, ähnlich einer Katarakt-Operation, eingesetzt. Die Auswirkungen des gefürchteten „blinden Flecks“ werden auf diese Weise deutlich verringert.1,2
Gute Erfolge nach der Behandlung Dank des Vorgängermodells, das bereits bei rund 700 Patienten implantiert wurde, kann man auf umfangreiche, gute Erfahrungen mit dem Produkt zurückgreifen, und zwar weltweit.
Studien zeigen, dass behandelte Patient:innen wieder Gesichter sehen konnten, sie konnten wieder lesen, ihren Hobbys und anderen Aktivitäten nachgehen.
Ein kleiner Wermutstropfen: Es kommen nicht alle für das Verfahren infrage. Vor der Behandlung muss geklärt werden, ob die neue Therapie angewendet werden kann. Ist dies gegeben, kann der Eingriff deutschlandweit in Krankenhäusern durchgeführt werden, sofern es dort erfahrene Katarakt-Operateure gibt. In der Augenklinik Sulzbach am Knappschaftsklinikum Saar beispielsweise kam das
Die Erkrankung schreitet von einer frühen zu einer mittleren und dann zu einer fortgeschrittenen AMD voran. Letztere wird wiederum in eine trockene und eine feuchte Form unterteilt, die trockene kann sich zu einer feuchten Form entwickeln.
Die feuchte Form, die etwa 10 bis 15 Prozent aller Fälle ausmacht, lässt sich mit Medikamenten wirksam behandeln. Bei dieser Behandlung werden Präparate zur Hemmung des sogenannten Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) schmerzfrei in den Glaskörper des Auges injiziert. Mit dieser sogenannten intravitrealen Injektion von VEGF-Hemmern (IVOM-Therapie) lässt sich der Erkrankungsverlauf deutlich positiv beeinflussen. Jedoch ist hier ein hohes Maß an Therapietreue gefragt und die Spritzen müssen regelmäßig in kurzen Abständen injiziert werden. Die Therapie ermöglicht durch die Reduktion der Flüssigkeit in der Netzhaut, die Sehkraft bei der Mehrzahl der Patienten längerfristig zu erhalten.
Am häufigsten tritt jedoch die trockene Makuladegeneration auf (etwa 85 Prozent der Fälle). Bis heute gibt es für diese Form keine zugelassenen erfolgreichen Therapien. Doch mittlerweile tut sich hier etwas. Erstmals überhaupt gibt es positive Phase-3-Studiendaten mit einem sogenannten komplementhemmenden Protein. Dieses Medikament soll den Verlust der zentralen Netzhautzellen verlangsamen können.
Auch gibt es Positives aus der Medizintechnik zu verzeichnen. Im Rahmen einer Studie wurde 2021 ein Netzhaut-Implantat das erste Mal in Deutschland erfolgreich eingesetzt. Eine weitere Möglichkeit zur Behandlung der trockenen AMD im Spätstadium kann ein implantierbares Miniaturteleskop sein. Zwar kann die Krankheit so nicht geheilt werden, die Aussicht auf eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität sei aber gegeben, so der Hersteller. Betroffenen bleibt also die Hoffnung, dass die Forschung weiter vorankommt und weiterhin neue Behandlungsmethoden schafft und so der Volkskrankheit wirksam entgegentritt.


neue Verfahren bereits zum Einsatz. Sehtraining nach der OP Wichtig ist, dass Patient:innen ein mehrwöchiges, qualitatives Sehtraining durchlaufen. Erfahrene Low-Vision- und Ergotherapeuten begleiten den Rehabilitationsprozess, der mehrere aufeinanderfolgende Termine erforderlich macht. Erfolge stellen sich in der Regel schnell ein. Schon nach wenigen Tagen kommen Patient:innen gut mit dem Implantat zurecht, können wieder kleine Dinge selbstständig erledigen und freuen sich über die neu gewonnene Lebensqualität.
Für wen ist die Therapie geeignet?
• Sie haben trockene oder feuchte AMD im Endstadium.
• Sie sind mindestens 55 Jahre alt.
• Ihre Weitsicht liegt zwischen 20/80 (6/24) und 20/800 (6/240).
• Sie haben noch keine Katarakt-Operation gehabt.
• Mit einem externen Teleskop verbessern sich Ihre Ergebnisse bei einem Sehtest.
• Sie erklären sich damit einverstanden, nach der Teleskopimplantation mit einem Low-VisionSpezialisten zu trainieren.
• Sie sind über die Risiken und Vorteile des Teleskopimplantats informiert.
Barrieren in der digitalen Welt
Auf der Arbeit zwei Videokonferenzen, in der U-Bahn nach Hause ein bisschen Online-Shopping, abends eine Übung aus der AntiStress-App von der Krankenkasse und dann noch die neue Streaming-Plattform installiert – unser Alltag wird immer digitaler. Leider jedoch haben nicht alle gleichermaßen Zugang zur digitalen Welt. Für Menschen mit Seheinschränkungen gibt es zwar entsprechende Hilfsmittel, wie zum Beispiel eine Bildschirmvergrößerung oder eine spezielle Software, die den Bildschirminhalt vorliest, aber wir stoßen auf digitale Barrieren. Und die sind für uns genauso real wie Stufen für jemanden, der im Rollstuhl sitzt.
Digitale Barrieren sind zum Beispiel fehlende Bildbeschreibungen auf Webseiten und in den sozialen Medien oder digitale Anwendungen, auf die man mit den oben genannten Hilfsmitteln nicht zugreifen kann. Seit Jahrzehnten gibt es einen internationalen Standard für den Zugang zu digitalen Informationen im Web – die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Auf dieser Basis wurden auch Anforderungen an die barrierefreie Gestaltung von Apps,
digitalen Dokumenten oder DesktopProgrammen formuliert.
Es wird höchste Zeit, diese Standards auch anzuwenden, denn der Bedarf ist riesig. In Deutschland leben über eine Million Menschen mit Blindheit oder einer Sehbehinderung. Fast zehn Millionen Menschen haben eine Augenerkrankung, die zu einer Sehbehinderung führen kann. Aber auch viele Menschen mit Einschränkungen des Gehörs, der Motorik oder der Kognition sind auf Barrierefreiheit in der digitalen Welt angewiesen. Übrigens profitieren auch Menschen ohne Beeinträchtigungen von Barrierefreiheit, weil dadurch beispielsweise Webseiten klarer strukturiert und besser lesbar sind.
Barrierefreiheit ist kein Selbstläufer. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband sieht deshalb folgenden Handlungsbedarf:
1.Bisher sind nur öffentliche Stellen wie Behörden verpflichtet, ihre digitalen Angebote barrierefrei zu gestalten. Hier gilt es, Strukturen und Prozessabläufe für die Herstellung digitaler

Barrierefreiheit zu entwickeln und einzuhalten. Vor allem aber müssen endlich auch alle privaten Anbieter von digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Barrierefreiheit verpflichtet werden. Ein erster Schritt ist das sogenannte Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das ab 2025 für bestimmte Bereiche wie E-Books und digitales Banking eine solche Pflicht vorsieht. Auf diesem Weg muss es weiter gehen.
2.Es bedarf einer Sensibilisierung für den Nutzen digitaler Barrierefreiheit. Damit digitale Barrierefreiheit umgesetzt wird, muss sie Thema in den Ausbildungs- und Studienplänen, Prüfungsordnungen, Weiterbildungsprogrammen und Schulungsmodulen aller Berufssparten werden.
3.Bei
öffentlichen Ausschreibungen wie auch bei Wirtschafts- und Forschungsförderungen im Digitalbereich muss Barrierefreiheit konsequent zur Bedingung gemacht und dann auch wirklich durchgesetzt werden. Wir fordern zudem gezielte Förderprogramme für barrierefreie Innovationen im Digitalbereich.

Orientierungsprobleme bei Blindheit müssen nicht sein Unterwegs immer die Orientierung behalten – das ist für blinde und sehbehinderte Menschen oft eine Herausforderung.
Anne K. (63) ist vor zwölf Jahren unerwartet erblindet. Im Alltag kommt sie mittlerweile gut zurecht, die Orientierung draußen machte ihr aber lange Zeit zu schaffen. Dank des Mobilitätstrainings kann sie mit dem Langstock Hindernisse umgehen. Trotzdem fiel es ihr stets schwer, eine Richtung ohne Leitlinie zu halten: „Ich habe mich immer unbewusst gedreht. Dadurch konnte ich z. B. keine breite Straße überqueren. Einmal bin ich schräg direkt in den Verkehr auf die Kreuzung gelaufen. Seitdem traute ich mir viele Wege alleine nicht mehr zu, schon gar nicht zu unbekannten Zielen.“
Ihre Tochter machte sich deswegen große Sorgen: „Meine Mutter war immer ein sozialer Mensch, sie war ständig unterwegs und unternahm viel. Jetzt ist sie so unsicher, dass sie oft auf Hilfe angewiesen ist, um das Haus zu verlassen. Sie geht viel seltener raus, das tut ihr nicht gut.“
Sicher und selbstbestimmt unterwegs Vor einem Jahr hat Anne K. dann bei einer Hilfsmittelausstellung den feelSpace naviGürtel kennengelernt. Nach einer Testphase, die die Firma feelSpace kostenlos anbietet, war sie davon überzeugt. „Es war tatsächlich noch mal etwas ganz anderes, den Gürtel selbst zu tragen und ihn zu Hause auszuprobieren!“, sagt sie. Dieser Gürtel zeigt per Vibration rund um den Bauch herum Richtungen auf eine leicht verständliche Weise an.

Mehr Informationen und zwei kurze Erklärfilme
Stefanie H., eine Mobilitätstrainerin für blinde Menschen, erklärt: „Der naviGürtel hat auch eine Straßenüberquerfunktion. Wenn sich Anne K. an der Bordsteinkante ausrichtet, vibriert der Gürtel per Knopfdruck am Bauchnabel. Wenn sie schief läuft, spürt sie das und kann sich wieder richtig ausrichten. Damit kann sie entspannt und vor allem sicher Straßen und große Plätze zielgerade überqueren!“ Anne K. hat den naviGürtel über ihre Krankenkasse bekommen. Mit der feelSpace-App kann sie auch Ziele per Sprache eingeben und Favoriten speichern, der Gürtel kann die Richtung dorthin und auch konkrete Wege anzeigen. „Jetzt habe ich keine Angst mehr vor unbekannten Orten und kann endlich neue Wege alleine gehen!“, freut sich Anne K. Auch ihre Tochter ist begeistert: „Endlich traut sie sich wieder etwas zu, sie ist richtig aufgeblüht!“
Der naviGürtel ist ein anerkanntes Hilfsmittel, das von der Krankenkasse übernommen wird. Er kann unkompliziert und kostenlos zu Hause im Alltag getestet werden. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich einfach bei feelSpace. Die Firma berät Sie gerne und unterstützt Sie beim Ausprobieren und der Beantragung über Ihre Krankenkasse. Auch das mobile Vorlesegerät OrCam und die Hinderniserkennungs-Schuhe InnoMake hat sie im Angebot.

Die schönste Sache, die man nicht sehen kann
Blindenfußball erfreut sich einer stetig steigenden Beliebtheit, die deutsche Meisterschaft ist längst eine ernst zu nehmende Sache geworden. Anlässlich der Woche des Sehens haben wir die deutschen Blinden-Nationalspieler Alexander Fangmann (Kapitän) und Sebastian Themel (Torwart, sehend) zum Interview gebeten.
Alexander, wie kam es bei dir zum Sehverlust?
Alexander Fangmann (AF): Ich wurde nicht blind geboren. Ich hatte seit dem 6. Lebensjahr verschiedene Augenkrankheiten, die operativ behandelt wurden, und nach der 10. Operation kam es zu einer Netzhautablösung, die sich dann auch als nicht mehr reparabel erwies. Da war ich acht Jahre alt.
Was bedeutet das für ein Kind?
AF: Sportlich betrachtet hatte ich mich schon davor immer weiter zurückziehen müssen, einfach aufgrund der Augenkrankheiten. Aber der Sport stand gar nicht im Vordergrund, sondern es galt, ein ganzes Leben umzubauen. Ich bin fast froh, dass es mir so früh passiert ist, weil man in diesem Lebensalter sowieso jeden Tag etwas Neues lernt. Nach einem Jahr in der Blindenschule war ich zurück in meiner Grundschule, am Wochenende war ich nach wie vor mit meinen Freunden von vorher unterwegs. Die waren vor allem happy, dass ich immer noch mit dabei war, auch wenn man mich etwas an die Hand nehmen musste.
An die Hand nehmen als Stichwort: Wie lief das mit der Unterstützung im Alltag?
AF: Ich hatte bis zum Abitur einen Zivildienstleistenden an der Seite, der im Alltag assistiert hat, etwa beim Schulweg.
OrCam MyEye 2
Ich hatte ab der fünften Klasse einen Laptop in der Schule. Das war damals besonders, aber heute wird ja alles smarter, und das hilft meistens gerade auch blinden Menschen, zum Beispiel Trainingsapps und Sprachassistenten. Früher musste man riesige Kämpfe austragen, heute ist Sprachausgabe im Handy Standard für alle, auch Barrierefreiheit ist kein Thema mehr.
Sebastian, du selbst hast keine Einschränkungen in der Sicht, spielst aber Blindenfußball. Wie kann man sich das vorstellen?
Sebastian Themel (ST): Das Spielfeld ist durch Banden begrenzt und dreigeteilt, wobei es in jeder Zone einen Guide gibt, der Anweisungen gibt. In der Verteidigungszone ist das der Torhüter, das ist meine Rolle dort. Der Ball hat Rasseln, damit die Spieler ihn hören können. Sehr spannende Sache – ein Freund hat mich damals mitgenommen, die von ihm trainierte Mannschaft einmal zu unterstützen. Ich war davor schon als Tormann aktiv und habe dem einmal eine Chance gegeben. Seit 2015 bin ich jetzt in der Liga dabei.
Was ist für dich das Faszinierende an diesem Sport?
ST: Mich begeistert, wie frei sich die Spieler im Raum bewegen und wie körperlich intensiv es zur Sache geht, da
ist wirklich Geschwindigkeit und immer mehr Professionalität dabei. Technisch und taktisch entwickelt sich der Sport in Deutschland gerade unglaublich stark.
Was war für dich persönlich bis jetzt der größte Erfolg?
ST: Letztlich die deutsche Meisterschaft mit Marburg 2019, dicht gefolgt vom Vizemeistertitel 2015 mit Chemnitz, weil das eine noch viel größere Überraschung war und wir die Meisterschaft nur knapp verpasst haben.
Alexander, wie ist das bei dir?
AF: Ich bin ja schon länger dabei, hatte viel Glück mit meinen Teamkollegen und war sieben Mal deutscher Meister, wobei 2018 nach einer gewissen Pause ein schöner Erfolg war, der bestätigt hat, dass Veränderungen manchmal guttun. Für den Standort Stuttgart war es auch wichtig.

Für Menschen mit Sehbehinderung und Blindheit
OrCam unterstützt im Alltag
OrCam MyEye 2 ist eine Minikamera, die mit einem Magneten am Brillengestell befestigt wird.
Hauptfunktionen sind:
Lesen von Text
Erkennen von Gesichtern

Erkennen von Produkten Erkennen von Geldscheinen


Du engagierst dich ja auch nebenher für den Sport. Was motiviert dich, was bräuchte es für den Sport?
AF: Durch die Sportlerkarriere bin ich in diverse Verbandsfunktionen reingerutscht, als Spielervertreter oder bei der Sepp-Herberger-Stiftung. Überall dort versuche ich natürlich, den Blindensport voranzubringen. Rein strukturell dauern Dinge einfach ihre Zeit. Das Thema Förderungen würde für sich allein Bände füllen, Geld braucht’s ja logischerweise immer und überall. Es ist nicht einfach, die Leute zu finden – etwa eben auch sehende Torhüter, die man schon besonders motivieren muss. Wir brauchen immer gute Leute und sind für die auch immer offen. Meldet euch gerne!
Mehr Informationen finden Sie unter: www.blinden-fußball.de










Augenprobleme?!
Optometristen wissen Rat
Optometristinnen und Optometristen sind Personen, die umfassende Gesundheitsdienstleistungen rund um das Auge und das visuelle System erbringen. Sie führen über die Refraktionsbestimmung hinaus Messungen von Sehfunktionen und Untersuchungen zur Augengesundheit durch und sind zur Interpretation des entsprechenden Befundes berechtigt und befähigt. Bei Bedarf verweisen sie zielgerichtet an einen Arzt, damit dieser eine Diagnose stellen und eine rechtzeitige Therapie einleiten kann.
 DStephanie Mühlberg M.Sc. Augenoptik/ Optometrie
DStephanie Mühlberg M.Sc. Augenoptik/ Optometrie
er in weiten Teilen der Welt verbreitete Beruf des Optometristen hat sich im Laufe von Jahrzehnten aus dem Beruf des Augenoptikers entwickelt. 1909 wurde in Deutschland der erste Studiengang Augenoptik an der neu gegründeten Fachschule für Optiker in Mainz durchgeführt und 1912 nach Berlin verlagert. Seit dieser Zeit ist die Augenoptik/Optometrie in Berlin an der heutigen Berliner Hochschule für Technik (BHT) angesiedelt; sowohl Bachelor of Science als auch Master of Science Studiengänge Augenoptik/ Optometrie werden hier angeboten.
Mehr Informationen
finden Sie unter: www.vdco.de
Heute kann an sechs Hochschulen in Deutschland Augenoptik/Optometrie studiert werden. Die Vereinigung Deutscher Kontaktlinsen- Spezialisten und Optometristen (VDCO) e. V. vertritt die Interessen von verantwortungsvollen Vision-Care-Dienstleistern gegenüber der Bevölkerung, den Institutionen und der Industrie. Die VDCO gewährleistet beste Fortbildung für ihre Mitglieder, gibt Patienteninformationen zu speziellen Eye-Care-Themen heraus, ist in diversen Ausschüssen für berufspolitische Entscheidungen vertreten, erarbeitet Qualitätsstandards, und Letzteres auch international durch die Mitgliedschaft im European Council of Optometry and Optics (ECOO).
Um auch die Wissenschaft auf dem Gebiet der Augenheilkunde zu unterstützen ist das neue Peer Review Journal Optometry & Contact Lenses (OCL) seit Einführung
Veranstaltungstipp
im Juni 2021 Verbandsorgan der VDCO. Als Gründungsvereinigung einer reinen Vereinigung von Kontaktlinsenspezialisten legt die VDCO noch immer einen ausgeprägten Fokus auf die korrekte Handhabe und den Umgang mit Kontaktlinsen- und Pflegemitteln. Wie wichtig dies ist, zeigt die Tatsache, dass auch heute die fehlerhafte Compliance der häufigste Grund ist, welcher zum Trageabbruch von Kontaktlinsen führt. Moderne Kontaktlinsenpflege ist ausgesprochen einfach: Kontaktlinsenpflegemittel müssen individuell auf Auge, Menge und Qualität des Tränenfilms und das Kontaktlinsenmaterial abgestimmt sein. Wichtig ist, dass die empfohlenen Pflegeschritte stets eingehalten werden. Durch falsche Kontaktlinsenhandhabung können Kontaktlinsen beschädigt werden. Um eine optimale Verträglichkeit der Kontaktlinsen und somit Sicherheit für die Gesunderhaltung des Auges sicherzustellen, ist eine korrekte Pflege und Hygiene unverzichtbar. Ein Wechsel des Pflegemittels sollte mit dem Kontaktlinsenspezialisten abgesprochen sein. Die Verwendung eines nicht auf den Tränenfilm oder das Kontaktlinsenmaterial abgestimmten Hygieneprodukts kann zu Unverträglichkeiten oder zur Beschädigung der Kontaktlinse führen sowie den Tragekomfort negativ beeinflussen.
Das nebenstehende Fact-Sheet zeigt die notwendigen Pflegeschritte von weichen Kontaktlinsen bei Verwendung einer Kombi-Lösung.

Die richtige Kontaktlinsenp ege von weichen Kontaktlinsen mit Kombi-Lösung Händewaschen


Bitte reinigen Sie vor jeder Berührung Ihrer Kontaktlinsen die Hände mit Wasser und Seife und trocknen Sie diese mit einem sauberen und fusselfreien Papiertuch ab.
Reinigung von weichen Kontaktlinsen mit der Kombi-Lösung

Auf die Innenseite der Kontaktlinse einige Tropfen Kombi-Lösung auftragen.
Die Kontaktlinse ohne großen Druck in der Hand äche reiben (mind. zehn Sekunden), am besten von der Mitte über den Rand der Kontaktlinse reiben.


Die Kontaktlinse mit Kombi-Lösung gründlich abspülen.
Die Kontaktlinse in den gereinigten Kontaktlinsenbehälter legen und so weit mit Kombi-Lösung au üllen, bis die Kontaktlinse vollständig bedeckt ist.

Reinigung des Kontaktlinsenbehälters
Nach dem Aufsetzen der Kontaktlinsen muss der Kontaktlinsenbehälter gereinigt werden.
Die genutzte KombiLösung ausgießen. Frische Kombi-Lösung in den Behälter einfüllen.

Den Behälter und den Deckel mit einem sauberen und fusselfreien Papiertuch abtrocknen.
Den Behälter innen gründlich mit dem Finger ausreiben.
Auch den Rand und den Deckel abreiben und alles nochmals mit der Kombi-Lösung abspülen.


Den Behälter o en auf den Kopf gedreht auf einem trockenen und sauberen Papiertuch lagern.
!Den Behälter spätestens alle 3 Monate ersetzen. Bitte gehen Sie alle 6 Monate zur Nachkontrolle Ihrer Kontaktlinsen und Augen!
Mehr Infos: www.vdco.de
opti 2023: Mitte Januar mit dem ganzen augenoptischen Spektrum
Die opti 2023 findet zum angestammten Mitte-Januar-Termin vom 13. bis 15. Januar statt. Im vergangenen Mai hatte die augenoptische Branche mit einer außertourlichen opti-Sommeredition in München ihr Wiedersehen gefeiert.
„Wir wollen unsere Aussteller dabei unterstützen, alle Märkte zum Vertriebsstart 2023 in Einklang zu bringen,“ so Klaus Plaschka, Geschäftsführer der veranstaltenden GHM Gesellschaft für Handwerksmessen. Messeleiterin Bettina Reiter ergänzt: „Wir schaffen für die Branche offensiv die bestmöglichen Rahmenbedingungen. Der branchenbekannte und etablierte Termin im Januar bildet dann seit 15 Jahren die perfekte Startrampe für den augenoptischen DACHMarkt in das neue Jahr.“
Den Austausch im Fokus
Augenoptiker, Optometristen, Einkäufer und Kontaktlinsenspezialisten finden von 13. bis 15. Januar 2023 drei Tage lang gewohnt gebündelt alles, was sie für gute Geschäfte benötigen. Dabei ist die Show traditionell mehr als eine reine Produktschau: Neben technologischen und design-funktionalen Neuheiten ist die opti vor allem Plattform zum Netzwerken, die Möglichkeit, alte Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen, sich auszutauschen und zu informieren.
Trend-Themen Nachhaltigkeit und Myopie-Management
Wie schon auf der Sonderedition im Mai, liegt der Fokus in allen vier Hallen der opti 2023 auf den Themen Nachhaltigkeit und MyopieManagement. Aussteller, die die Trends im Fokus ihres Angebots haben, sind auch im Januar wieder besonders gekennzeichnet. Individuelle Informationsveranstaltungen und Round-TableGespräche ergänzen den Austausch zu Nachhaltigkeit und Myopie Management. Die Webinar-Reihe opti FORUM XT wird die Zeit bis zur Live-Veranstaltung und zum persönlichen Wissensaustausch verkürzen. Save the date: 20. Oktober, 17. November und 8. Dezember 2022.
Die Vorfreude auf die opti 2023 zum etablierten Termin und mit ihrem bekannt-beliebten opti-Feeling ist also groß. Tickets für die Messe gibt es ab Oktober wieder nur online über die Website der Messe. Unter www.opti.de finden sich auch alle Infos zu Ausstellern, Produkten und Marken sowie rund um das aktuell gültige Sicherheitskonzept.

FOTO: GHM

Gute Sicht für Gute Fahrt

Zwei Drittel der Deutschen benötigen eine Brille oder Kontaktlinsen, Tendenz steigend – und mehr als 34 Millionen Autofahrer sind Brillenträger. Nach dem Führerscheinsehtest wird die eigene Sehstärke aber vor allem bei denjenigen, die bisher keine Brille brauchten, meist jahrelang nicht mehr überprüft. Dabei ist gute Sicht für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr wichtig.
Eine Fehlsichtigkeit ist keine Krankheit – und Veränderungen beim Sehvermögen machen sich in der Regel nicht unmittelbar bemerkbar. Doch bei vielen Menschen verschlechtert sich die Sicht zwischen dem 18. und 30. Lebensjahr, manchmal sogar erheblich. Danach treten altersbedingte Sehprobleme auf. Mobile Sehtestaktionen ergeben immer wieder, dass etwa jeder zweite Verkehrsteilnehmer mit seiner Sehhilfe nicht mehr ausreichend sieht oder erstmals eine Brille benötigt, ohne dies selbst zu merken. Ein regelmäßiger Seh-Check beim Augenoptiker oder Optometristen ist deshalb unbedingt empfehlenswert und ein Termin in der Regel schnell und einfach vereinbart.
Sicherheit und Sehkomfort im Straßenverkehr Eine verminderte Tagessehschärfe kann zu Fehleinschätzungen beim Abbiegen und Überholen führen, Abstände werden falsch eingeordnet, das Unfallrisiko steigt. Auch die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt bei schlechtem Sehen ab – in manchen Situationen können aber schon Sekunden etwa für die Länge des Bremsweges entscheidend sein. Hinzu kommen im Alter eine erhöhte Blendempfindlichkeit, etwa durch die Scheinwerfer entgegenkommender Fahrzeuge, sowie eine abnehmende Sehschärfe bei Dämmerung und Dunkelheit. Augenoptiker und Optometristen können neben der Überprüfung der Tagessehschärfe weitere wichtige Funktionen des Auges testen, wie zum Beispiel das Farbsehen, das Dämmerungs- und


Kontrastsehen oder das Gesichtsfeld. Sollten sich die Werte der bisherigen Brille oder Kontaktlinsen verändert haben oder erstmals eine Sehhilfe nötig sein, gibt es beim Augenoptiker für Verkehrsteilnehmer – ob auf zwei Rädern oder vier – individuelle Lösungen: Für Autofahrer können spezielle, komplett alltagstaugliche Brillengläser mit Superentspiegelung, minimaler Tönung und/oder einem Blaulichtfilter sinnvoll sein, um Kontraste zu verstärken und Blendung zu vermeiden. Eine gut angepasste und geeignete Sonnenbrille sollte außerdem immer griffbereit sein. Für Zweiradfahrer kommen Sportbrillen mit entsprechender Tönung mit oder ohne Korrektionswirkung infrage, die Brille muss außerdem zum Helm passen.
Die






Wunschlos glücklich?
Gesundheit und Glück wünschen wir uns alle. Aber die materiellen Wünsche werden im Alter weniger. Wenn es Ihnen auch so geht, bitten Sie Ihre Gäste anlässlich Ihres Geburtstags oder eines anderen Jubiläums um Spenden für PRO RETINA.
Wir beraten Sie und helfen Ihnen bei der Organisation. Alle Spenden kommen zu 100 Prozent der Arbeit für Menschen mit Netzhauterkrankungen zugute.
Kontakt: spenden@pro-retina.de oder (0228) 227 217-0.
