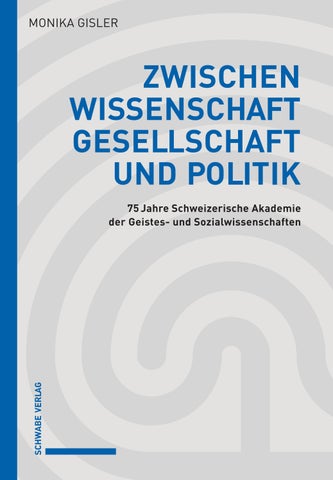4 minute read
Vorgeschichte
Vorgeschichte
1939 hatte sich die Union Académique Internationale (UAI), eine internationale Dachorganisation von Akademien der Geistes- und Kulturwissenschaften, mit dem Vorschlag an Hans Nabholz gewandt, die geisteswissenschaftlichen Fachgesellschaften der Schweiz aufzunehmen. Dafür hätten sich diese jedoch national organisieren müssen, da es zu dem Zeitpunkt noch keine Akademie gab. Nabholz war rasch bereit, sich diesbezüglich zu engagieren. Er lud verschiedene Exponenten der Fachgesellschaften zu einer ersten Sitzung nach Bern ein, wobei er all jene Disziplinen adressierte, die noch nicht Teil einer bestehenden oder, im Falle der Medizin, einer im Werden begriffenen nationalen Dachgesellschaft waren. So gingen Einladungen auch an den Schweizerischen Juristenverein, die Schweizerische Gesellschaft für Statistik und Volkswirtschaft oder an die Freunde Ostasiatischer Kunst. Die zukünftige Vereinigung der Gelehrten Gesellschaften sollte sich dabei nicht einfach mit ihrem Beitritt zur UAI zufriedengeben, sondern sich darüber hinaus auch für die Förderung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit den angeschlossenen Körperschaften einsetzen. Die für den September 1939 einberufene Gründungssitzung konnte dann allerdings im Zuge des Kriegsbeginns nicht mehr abgehalten werden, sie wurde « auf Friedenszeiten» verschoben.1 So lange mochte Nabholz dann aber doch nicht warten. Im September 1943 gelangte er mit einem Schreiben an den Präsidenten der Gesellschaft für Kunstgeschichte und erinnerte diesen an die Verhandlungen vom Frühjahr 1939, die zum Ziel gehabt hatten, eine «Vereinigung der geisteswissenschaftlichen schweizerischen Gesellschaften unter einer Dachorganisation» ins Leben zu rufen.2 Auf das Anliegen wurde prompt ein weiteres Mal eingegangen, nun aber vonseiten der Nationalen Vereinigung Schweizerischer Hochschuldozenten, einer Organisation von Hochschullehrern aus allen Disziplinen, der selbstredend auch Nabholz angehörte. Inzwischen war ein Zusammenschluss der geisteswissenschaftlichen Fachgesellschaften im Interesse einer «Hebung ihrer wissenschaftlichen Leistungen »3 und im Hinblick auf eine Wiederaufnahme der Beziehungen mit ausländischen Wissensorganisationen nach Kriegsende zu einem Desiderat geworden. Denn es war immer deutlicher geworden, dass die Geisteswissenschaften während des Zweiten Weltkriegs im Vergleich zu den Vorjahren an Ansehen verloren hatten.4 Ihr konkret-praktischer Nutzen wurde in den Nachkriegsjahren europaweit stark
Advertisement
angezweifelt vor dem Hintergrund, dass sie die «Schrecken des 20. Jahrhunderts»5 nicht hätten eindämmen können und auch nichts zur Etablierung moderner, demokratischer Gesellschaften in Ländern ohne entsprechende Tradition beigetragen hätten. Die Gründungsmitglieder der zu konstituierenden Gesellschaft sahen sich mit einer Krise des Ansehens der Geisteswissenschaften konfrontiert.
Nabholz zeigte sich bereit, die organisatorischen Aufgaben für einen solchen Zusammenschluss in die Wege zu leiten. Sekundiert wurde er vom umtriebigen Sekretär der Vereinigung Schweizerischer Hochschuldozenten, dem schillernden Eduard Fueter, Wissenschaftshistoriker und Mitbegründer der Neuen Front, einer Gruppierung der Frontenbewegung der 1930er-Jahre, aber auch Gründungsmitglied und bis 1952 Stiftungsrat der Pro Helvetia.6 1945, wiederum anlässlich der Jahresversammlung der Vereinigung Schweizerischer Hochschuldozenten, konkretisierte sich das Vorhaben: Nun wurde der «Plan einer Dachorganisation der grossen geisteswissenschaftlichen Gesellschaften der Schweiz» im Detail besprochen. Eine vorhergehende Interessensondierung unter den geisteswissenschaftlichen Fachgesellschaften hatte deutlich gemacht, dass die dafür notwendige Unterstützung gegeben war.7 Paul Niggli, ETH-Professor für Mineralogie und in jenen Jahren Präsident der Vereinigung, warb für die Schaffung einer «Fachorganisation demokratischen Charakters»,8 ohne dass diese eine Monopolstellung einnehmen würde – Niggli dachte hierbei wohl an eine vermeintliche Konkurrenz gegenüber den Hochschulen. Nicht ein straffes Gefüge, sondern ein « repräsentierendes Organ, das verschiedene vordringliche Aufgaben übernehmen kann», wurde gefordert, mit « streng wissenschaftliche[m ] Charakter» und einer öffentlichkeitswirksamen Kommunikation vor dem Hintergrund, später einmal Gelder von Bund und Privaten zu erhalten.9 Erste Delegierte wurden ernannt, und der Name der zu gründenden Gesellschaft wurde diskutiert.
Die Schaffung einer Organisation erwies sich als umso dringlicher, nachdem die Vereinigung Schweizerischer Hochschuldozenten im Oktober 1946 an ihrer Generalversammlung das Thema «Wissenschaftliche Forschung und Arbeitsbeschaffung» auf die Tagesordnung gesetzt hatte. Als Referent eingeladen war Otto Zipfel, Delegierter des Bundesrats und mit den Arbeitsbeschaffungsmassnahmen betraut. Dieser hatte während des Kriegs ein Programm für die wirtschaftliche Landesverteidigung initiiert und darauf
Abb. 1.1: Hans Nabholz (1874–1961), Präsident der Allgemeinen Geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz und einer der Initiatoren der Schweizerischen Geisteswissenschaftlichen Gesellschaft.
Hans Nabholz (1874–1961) Der Zürcher Hans Nabholz studierte ab 1895 Geschichte und Germanistik in seiner Heimatstadt sowie in Berlin und Paris. Vier Jahre später wurde er in Zürich promoviert, 1911 habilitiert. Zunächst als Bezirksund Mittelschullehrer tätig, war er anschliessend von 1903 bis 1931 Zürcher Staatsarchivar. Zudem trat er 1924 eine ausserordentliche und 1931 eine ordentliche Professur für Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Zürich an, die er bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1945 innehatte. Schwerpunktmässig beschäftigte er sich mit Themen wie der Entstehung der Alten Eidgenossenschaft, ihrer Wirtschaftsstruktur und Bündnispolitik sowie ihrer Einbettung in das europäische Bündnissystem. Er war führend beteiligt an der Herausgabe von Quellenwerken zur Zürcher Wirtschaftsgeschichte und zur Schweizer Landes- und Verfassungsgeschichte.
Ab 1928 präsidierte Hans Nabholz die Allgemeine Geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz und vertrat sein Land beim Internationalen Komitee der Historischen Wissenschaften, dem er ab 1947 ebenfalls als Präsident vorstand. Es war diesen Funktionen geschuldet, dass Nabholz von der Union Académique Internationale angesprochen wurde und im Folgenden eine Konsolidierung der Geisteswissenschaften in der Schweiz vorantrieb. Der Historiker engagierte sich für den Beitritt der Schweiz zum Völkerbund sowie für die Schliessung des Grabens zwischen Welsch- und Deutschschweiz, der insbesondere im Kontext des Ersten Weltkrieges aufgerissen worden war. Als Präsident des 1950 in Paris tagenden Internationalen Historikerkongresses setzte er sich zudem dafür ein, dass trotz heftiger Widerstände auch eine deutsche Delegation daran teilnehmen konnte.
Feller-Vest, 2009; https://www.deutsche-biographie.de/gnd118785532.html#ndbcontent ( konsultiert am 22. 7. 2021).
aufbauend 1944 als erstes derartiges Gremium auf eidgenössischer Ebene überhaupt eine Kommission zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung aus Mitteln der Arbeitsbeschaffung mit Vertreter:innen aus Bund,