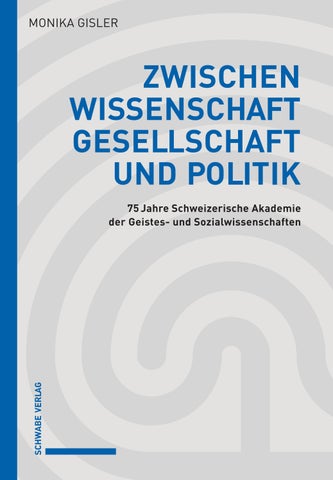4 minute read
Einleitung
Die SAGW feiert ihr 75-jähriges Bestehen. So lange schon agiert sie im Schweizer Bildungs- und Forschungssystem als Vermittlerin zwischen Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit. Als Dachorganisation ist sie die Stimme eines heterogenen Ensembles aus wissenschaftlichen Fachdisziplinen und hat es von Anfang an verstanden, sich in das Geflecht aus unterschiedlichsten Interessenvertretungen respektive Organen der Schweizer Wissenschaftspolitik einzufügen und ihren Einflussbereich fortlaufend zu erweitern. Dabei rührte sie nicht von Beginn weg mit der grossen Kelle an, vielmehr war sie in den ersten Jahrzehnten oft gezwungen, mehr zu reagieren als zu agieren. Gleichzeitig hatte sie von Anfang an gesellschaftspolitisch relevante Themen aufgegriffen und sich in den zukunftsweisenden Debatten um die Ausrichtung der Schweizer Forschungslandschaft engagiert. Früh schon trat sie auch als Enablerin auf, beispielsweise bei disziplinenübergreifenden Forschungsprojekten oder im Rahmen der von ihr geförderten Langzeitunternehmungen. Zunächst nur mit wenig finanziellen Mitteln ausgestattet, legte die SAGW ihren Schwerpunkt auf die Unterstützung der geistes-, später auch der sozialwissenschaftlichen Forschung, auf die Förderung von Nachwuchsforschenden sowie auf die Ausrichtung von Patronaten und Publikationsbeiträgen.
Die unspektakulär aufgegleiste Organisation hat dabei nach und nach ein vielschichtiges Netzwerk aufgebaut, das nicht nur zahlreiche Fachgesellschaften und Unternehmungen über die Sprachgrenzen hinweg vereinte, sondern auch in einer sich ständig erneuernden wissenschaftspolitischen Landschaft bestehen konnte. Als zunächst unbekannte Akteurin auf Bundesebene hatte sie sich verschiedentlich gegen Interessengruppen zu behaupten, die auf das Primat von Natur- und Technikwissenschaften pochten und die Geistes- und Sozialwissenschaften am liebsten ins Abseits katapultiert hätten. In engagierten Debatten setzte sich die Akademie wiederholt für deren Da-
Advertisement
seinsberechtigung ein und verteidigte den Legitimationsanspruch dieser wissenschaftlichen Fachdisziplinen.
Wenn im Folgenden die Geschichte der Akademie nachgezeichnet wird, so bewegt sich diese also im Spannungsfeld von überdauernden konflikthaften Auseinandersetzungen mit Akteur:innen aus Gesellschaft, Wissenschaft und Politik und den sich wandelnden Bedingungen auf konkret-praktischer Ebene, auf die die Akademie je nach Umständen reagieren musste.
Eingestiegen wird mit der Vorgeschichte und der Gründung der Schweizerischen Geisteswissenschaftlichen Gesellschaft als Dachgesellschaft, die das Ziel der Förderung geisteswissenschaftlicher Forschung und Lehre und deren Interessen gegen aussen vertrat. Dabei haben sich Auftreten und Selbstbild über die Jahre hinweg stark gewandelt, wie mit Blick auf die wichtigsten Akteur:innen, die Fachgesellschaften und Unternehmungen, aber auch am Beispiel der Namensänderungen hin zur Schweizerischen Akademie für Geistesund Sozialwissenschaften zu zeigen ist. Damit einhergehend werden die Argumente in den Debatten um die Ausrichtung der Akademie als gesamtschweizerische Dachorganisation zusammengetragen. Welche Rolle spielte diese im Spannungsfeld von Politik, Gesellschaft und den Partnerorganisationen und wie veränderte sich ihr Auftrag über die Jahrzehnte? Wie brachte sich die Akademie auf nationaler Ebene ein, auf welche politischen und gesellschaftlichen Kontexte hatte sie zu reagieren und welche Transformationsprozesse konnte sie anstossen?
Drei Schwerpunkte werden verfolgt: Erstens wird in chronologischer Abfolge der Frage nach der wissenschaftspolitischen Einbettung und dem Wirken der Akademie nachgegangen und genauer analysiert, wann sie als Akteurin auftreten und ihre Reputation in die Waagschale werfen konnte und wann wissenschaftspolitisch Handlungsanleitungen von aussen an sie herangetragen wurden. Zweitens sollen die Kontroversen und Dispute, die sie gegen innen und aussen auszutragen hatte, zur Sprache kommen: Wann und unter welchen Voraussetzungen hatte sie intellektuelle und politische Kämpfe auszufechten, in welchen Phasen hingegen herrschte Normalbetrieb? Und drittens sind die langfristigen Erfolge der Akademie zu würdigen und zu bedenken, dass sie als Dachorganisation vielfältigste Interessen unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen und Fachgesellschaften in der Arena der nationalen und internationalen Wissenschaftspolitik öffentlichkeitswirksam zu vertreten hatte und noch immer vertritt. Die SAGW wird, in
ihrer Funktion als soziale Institution, als eine unter sich stets wandelnden Voraussetzungen konstant funktionierende wissenschaftspolitische Gesellschaft ausgelotet, die sich über die Jahrzehnte wieder und wieder neu ( er‐) finden musste.
Die nachfolgende Schilderung beruht auf Ereignismomenten, die mit quellenbedingten Zufälligkeiten und mit der Entscheidung, was erzählt werden soll und was nicht, zu tun haben. Nicht eine umfassende Darstellung wird angestrebt, sondern die Veranschaulichung von Konstellationen, Möglichkeiten und Zufällen und den Bedeutungen, die ihnen retrospektiv zugeschrieben wurden. Die vorliegende Schrift stützt sich dabei auf Gespräche mit ehemaligen Vorstandsmitgliedern und Zugewandten, auf Akten aus dem Bundesarchiv und dem SAGW-eigenen Archiv (Jahresberichte, Protokolle, Zeitschriften) sowie auf ältere und jüngere Arbeiten von Kolleg:innen und Zeitzeug:innen.
Wozu jedoch spezifisch eine Jubiläumsschrift? – Wir brauchen Rituale; Rhythmen und Symbole prägen unser Leben. Wir brauchen Momente, in denen wir uns zurücklehnen und fragen, wer wir sind. Als Vertreterin der Reflexionswissenschaften geht es der SAGW denn auch darum, sich die eigene Geschichte vor Augen zu führen und zu rekonstruieren, wie die Akademie wurde, was sie heute ist. Entsprechend ist mit der vorliegenden Festschrift keine teleologische Erzählung beabsichtigt, vielmehr interessiert, wie sich die Akademie in den vergangenen 75 Jahren behauptet hat – in einer Zeit, die stark geprägt war von Institutionalisierungsprozessen, einer zunehmenden disziplinären Ausdifferenzierung, einer Diversifizierung von Forschung und Lehre sowie einer wechselvollen Geschichte der Konstituierung eines Selbstverständnisses und der Selbstbehauptung geistes- und sozialwissenschaftlicher Disziplinen auf dem Schauplatz der Forschungs- und Hochschulpolitik. Die vorliegende Schrift leuchtet die Rolle der Akademie in der Wissenschaftslandschaft der Schweiz aus, zeichnet die grossen Linien seit ihren Anfängen Mitte der 1940er-Jahre bis heute nach und ordnet sie ein.