
Offizielles Organ des Schweizerischen Chemie- und Pharmaberufe Verbandes März/April 2025 3–4/2025
DIE FACHZEITSCHRIFT FÜR DIE CHEMIE- UND LABORBRANCHE




Offizielles Organ des Schweizerischen Chemie- und Pharmaberufe Verbandes März/April 2025 3–4/2025



Der Ausgabeautomat H-Save von Haberkorn ist die einfache und flexible Lösung für Ihre dezentrale Versorgung. Er ist ideal für Arbeitsschutz, Werkzeuge, Ersatzteile sowie Betriebs- und Hilfsmittel. Gerne beraten wir Sie, wie auch Sie mit H-Save in Ihrem Betrieb Wege einsparen, eine 24-h-Versorgung sicherstellen, Zugriffe kontrollieren und automatisiert nachbestellen. haberkorn.com

Taten statt Worte

«Corporate Volunteering» – so der starke Ausdruck für die Ausübung gemeinnütziger Tätigkeiten im Namen des Arbeitgebers – ist das neue Bäumepflanzen. Wer die Kommunikationsaktivitäten von Unternehmen beobachtet, stellt fest: Das längst veraltete Motto «Tue Gutes und rede darüber» wird nach wie vor munter angewendet.
Wer sich mit Wohltätigkeit zu fest brüstet, erweckt den Eindruck, dass es ihm oder ihr nur um Imagebildung geht. Zu viel Selbstdarstellung schürt Zweifel an der tatsächlichen oder konsequenten Umsetzung des Kommunizierten.
Unaufrichtigkeit wird durchschaut, Authentizität geht anders. Da helfen auch bildliche Beweise mit lachenden Gesichtern nicht – wer kennt sie nicht, die LinkedIn-Beiträge über soziale und ökologische Aktivitäten, die nur vom eigenen Personal geliked und geteilt werden!
Ein oder zwei Tage Gutes tun ist zwar nett, aber nicht das Nonplusultra (und wird damit nicht auch ein bisschen impliziert, dass man beim normalen Job nichts Gutes tut?). Um sich von anderen abzuheben, braucht es mehr. Denn gesellschaftliche Verantwortung soll Bestandteil der Geschäftstätigkeit sein, nicht PR-Thema.
Givaudan gründete letztes Jahr einen neuen humanitären Fonds, um bei grösseren Krisen wie Naturkatastrophen, Pandemien oder Konflikten in Gebieten, in denen das Unternehmen präsent ist, finanzielle Unterstützung zu leisten. Als erste Spende wurden 100 000 Schweizer Franken für die Flutopfer in Valencia dem Spanischen Roten Kreuz bereitgestellt.
Ein solches Engagement hat nicht nur eine positive Auswirkung auf die Gemeinschaft, sondern ist auch kritikresistent. Eine Antithese zu den bunten Corporate-Social-Responsibility-Seiten voller Floskeln, die nur dazu anspornen, CSR-Diskrepanzen aufzudecken.
Was kürzlich zum Beispiel bei Nestlé geschah. Als der grösste Kaffeekonzern versprach, ab 2025 nur noch «verantwortungsvoll» beschafften Kaffee zu verkaufen, legte ein Bericht von Public Eye das Gegenteil offen: In Brasilien und Mexiko können Kaffeebauern und -Arbeiterinnen vom Anbau kaum leben. Sessel-Aktivismus (oder stark ausgedrückt: «Wokewashing») als oberflächliche Unterstützung sozialer Anliegen ohne echtes Engagement schadet dem Image.
An sich ist soziales Engagement nichts Neues: 1906 spendeten die Standard Oil Company und Andrew Carnegie (damals einer der reichsten Menschen der Welt) jeweils 100 000 US-Dollar zur Soforthilfe nach dem Erdbeben in San Francisco. Umso erfreulicher, dass Unternehmen wie Givaudan wieder entdecken, sich für gute Zwecke einzusetzen. Wäre vielleicht auch etwas für Milliardäre.
Die Redaktion wünscht Ihnen eine spannende Lektüre!

Luca Meister l.meister@sigimedia.ch






Labore werden in Zukunft eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Wissenschaftliche Forschung, technologische Entwicklungen, synthetische Biologie und künstliche Intelligenz haben das Potenzial, unser aller Leben nachhaltig zu verändern. Labore sind die Innovationszentren, die unsere Gesundheit, unsere Umwelt und die Technologien unseres Alltags voranbringen.
Mit unserer großen Auswahl an Chemikalien und Laborbedarf und unserer professionellen Beratung sind wir Teil dieses Zukunftsprozesses.




Der molekulare «Einstein»

Kann man eine Fläche mit einer einzigen Form – einer «Kachel» –so parkettieren, dass sich das Muster niemals wiederholt? EmpaForschende haben eine chemische Lösung entdeckt.

Faszination leuchtender Pilze

Was bedeutet hier «Auflösung»?
Neue Erkenntnisse über die dritte Dimension: Ein neues Mikroskopie-Verfahren kann Moleküle identifizieren. Die damit verbundene Frage nach dem Auflösungsvermögen wurde gelöst.

Durch Zufall haben zwei Kunstschaffende die Biolumineszenz eines Pilzes entdeckt. Gemeinsam mit einer Pilzexpertin der WSL beschreiben sie das noch wenig erforschte Phänomen.

Ein Hydrogel, das wie Haut heilt
Forschende an der Universität Bayreuth und der Aalto-Universität haben ein Hydrogel mit einzigartiger Struktur entwickelt, das erstmals Stärke, Flexibilität und Selbstheilungsfähigkeit vereint.
IMPRESSUM
Die Fachzeitschrift für die Chemie- und Laborbranche www.chemiextra.com
Erscheinungsweise
7 × jährlich
Jahrgang 15. Jahrgang (2025)
Druckauflage
7300 Exemplare
WEMF / SW-Beglaubigung 2024 6326 Exemplare Total verbreitete Auflage 1699 Exemplare davon verkauft
ISSN-Nummer 1664-6770
Verlagsleitung
Thomas Füglistaler

Herausgeber/Verlag
SIGI media AG
Alte Bahnhofstrasse 9a
CH-5610 Wohlen
+41 56 619 52 52 info@sigimedia.ch www.sigimedia.ch www.chemiextra.com
Anzeigenverkauf
SIGI media AG
Jörg Signer
Thomas Füglistaler
Andreas A. Keller
Alte Bahnhofstrasse 9a
CH-5610 Wohlen
+41 56 619 52 52 info@sigimedia.ch
Redaktion
Luca Meister
Alte Bahnhofstrasse 9a
CH-5610 Wohlen
+41 56 619 52 52 redaktion@sigwerb.com
Dr. Christian Ehrensberger +41 56 619 52 52 info@sigimedia.ch
Neuer Test verbessert Diagnose von Allergien
Ein neuer Test vereinfacht die Diagnose von Allergien. Dessen Wirksamkeit wurde mit klinischen Proben von Kindern und Jugendlichen mit Erdnussallergie bestätigt.

Geruchsstoffe fehlerfrei analysieren
Verfälschte Ergebnisse: Jetzt wurde gezeigt, dass die Wahl der Injektionsmethode bei der gaschromatografischen Geruchsstoffanalyse die Artefaktbildung entscheidend beeinflussen kann.
Vorstufe
Triner Media + Print Schmiedgasse 7 CH-6431 Schwyz +41 41 819 08 10 beratung@triner.ch www.triner.ch
Abonnemente
+41 56 619 52 52 info@sigimedia.ch www.chemiextra.com
Druck Fontana Print SA Via Giovanni Maraini 23 CH-6963 Pregassona +41 91 941 38 21 www.fontana.ch
Jahresabonnement Schweiz: CHF 38.00 (inkl. Porto/MwSt.)
Jahresabonnement Ausland: CHF 58.00 (inkl. Porto)
Copyright Zur Veröffentlichung angenommene Originalartikel gehen in das ausschliessliche Verlagsrecht der SIGI media AG über. Nachdruck, fotomechanische Vervielfältigung, Einspeicherung in Datenverarbeitungsanlagen und Wiedergabe durch elektronische Medien, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlags. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.
Copyright 2025 by SIGI media AG, CH-5610 Wohlen

Holz in Biochemikalien verwandeln
Herstellung von Biochemikalien aus nachhaltig erwirtschaftetem Laubholz: Für eine neuartige Bioraffinerie in Deutschland liefert Bilfinger eine zugeschnittene Full-Service-Instandhaltung.

Künstliche Huminstoffe für die Landwirtschaft
Schnell, kontrolliert und aus Reststoffen: Ein in Deutschland entwickeltes Verfahren zur künstlichen Herstellung von Huminstoffen ermöglicht eine vollständige Verwertung biologischer Reststoffe.
36

Nachhaltigere Alternative zur Veresterung
Ei ne deutsch-dänische Kooperation präsentiert eine Technologie zur Herstellung biobasierter Schlüsselkomponenten für Lebensmittel, Körper- und Haushaltspflege sowie technische Anwendungen.

ZUM TITELBILD
Effizienz und Sicherheit durch Laborautomatisierung unter Containment-Bedingungen
Die Automatisierung repetitiver Prozesse unter Containment-Bedingungen revolutioniert die Laborarbeit. Steigende Sicherheitsanforderungen, Fachkräftemangel und Kostendruck machen innovative Lösungen unverzichtbar. Robotik steigert Produktivität, Konsistenz und Sicherheit, indem sie kritische Aufgaben präzise übernimmt –von der Probenvorbereitung bis zur aseptischen Abfüllung. Ein herausragendes Beispiel ist die robotergestützte Füll- und Verschlussanlage für Injektionslösungen von Weiss Technik und Goldfuss Engineering.

Auf dem Weg zum graphen-basierten Biosensor
Moleküle interagieren mit atomar dünner Schicht: Forschende haben eine Lösung entwickelt, um bei der Umsetzung vieler Ideen die Hürde der Hypersensivität von Graphen zu überwinden. 40
42
Recycling von CO 2 aus Abgasen für künftige Applikationen Gewässerreinigung mit Algen Chloraminiertes Trinkwasser –unbekannte Verbindung identifiziert
VERBANDSSEITEN SCV-Informationen



Die Kombination aus Reinraumtechnologie und Automatisierung gewährleistet höchste Qualität und Effizienz. So wird Laborautomation zum Schlüssel für Fortschritt in Biotechnologie und Pharmazie.
Weiss Technik AG Brügglistrasse 2, CH-8852 Altendorf +41 55 256 10 66 info.ch@weiss-technik.com www.weiss-technik.ch

Kann man eine Fläche mit einer einzigen Form – einer «Kachel» – so parkettieren, dass sich das Muster niemals wiederholt? 2022 wurde erstmals eine mathematische Lösung für dieses «Einstein-Problem» gefunden. EmpaForschende haben jetzt auch eine chemische Lösung entdeckt: Ein Molekül, das sich auf einer Fläche von selbst zu komplexen, sich nicht wiederholenden Mustern anordnet. Die so entstehende aperiodische Oberfläche könnte gar neuartige physikalische Eigenschaften aufweisen.
Anna Ettlin ¹
Es steht an der Schnittstelle zwischen Mathematik und dem Handwerk des Plattenlegers: das sogenannte Einstein-Problem. Mit dem Nobelpreisträger Albert Einstein hat diese mathematische Fragestellung indes nichts zu tun. Sie lautet: Kann man eine endlose Fläche mit einer einzigen Form (also einem «Einstein») nahtlos so kacheln, dass sich das entstehende Muster nie wiederholt? Gefunden hat eine solche «Proto-Kachel» erst 2022 der englische Hobby-Mathematiker David Smith. Empa-Forscher Karl-Heinz Ernst ist weder Mathematiker noch Plattenleger. Als Chemiker forscht er an der Kristallisation von Molekülen an Metalloberflächen. Dass ihn das Einstein-Problem eines Tages beruflich beschäftigen würde, hätte er nicht erwartet – bis sein Doktorand Jan Voigt mit ungewöhnlichen Ergebnissen eines Experiments auf ihn zukam. Bei der Kristallisation eines bestimmten Moleküls auf einer Silberoberfläche bildeten sich anstelle der erwarteten regelmässigen Struktur unregelmässige Muster, die sich nie zu wiederholen schienen. Noch verwunderlicher: Bei jeder erneuten Durchführung des Experiments fielen die Muster anders aus. Ernst und Voigt vermuteten zunächst einen experimentellen Fehler. Doch schon bald wurde klar: Der merkwürdige Befund war echt. Nun galt es herauszufinden, warum sich die Moleküle so einzigartig verhielten. Die Antwort auf diese Frage veröffentlichten die Forschenden in der Zeitschrift Nature Communications.
1 Eidgenössische Materialprüfungsund Forschungsanstalt


Dreiecke und Defekte: Durch die Chiralität (Händigkeit) der Moleküle passen die einzelnen Dreieckskacheln nie ganz genau aneinander. Es entstehen Defekte und Versätze, die der Fläche ihre Aperiodizität verleihen. (Bild: Empa)
Ernst und Voigt interessieren sich für die sogenannte Chiralität, die «Händigkeit», die viele organische Moleküle auszeichnet. Chirale Strukturen sind zwar chemisch identisch aufgebaut, lassen sich aber nicht durch Rotation ineinander überführen – in etwa so, wie unsere rechte und linke Hand. Essenziell ist diese Eigenschaft insbesondere in der Pharmazie. Über die Hälfte aller modernen Medikamente sind chiral. Da Biomoleküle wie Aminosäuren, Zucker und Proteine in unserem Körper alle die gleiche Händigkeit besitzen, müssen auch pharmazeutische Wirkstoffe chiral sein. Stimmt die Händigkeit des Medikaments nicht, so ist es bestenfalls wirkungslos, schlimmstenfalls sogar schädlich. Die Kontrolle der Händigkeit bei der Synthese organischer Moleküle ist daher von enormem Interesse für die Chemie. Eine der Möglichkeiten ist die Kristallisation von
chiralen Molekülen. Sie ist günstig, effektiv und weit verbreitet – und trotzdem noch nicht vollständig verstanden. Dieses Verständnis wollten die beiden Forscher mit ihrem Experiment ursprünglich fördern. Dafür nahmen sie ein ganz besonderes Molekül, eines, das seine Händigkeit bei Raumtemperatur leicht wechselt – etwas, was die meisten chiralen Moleküle praktisch nie tun.
«Wir haben erwartet, dass sich die Moleküle nach ihrer Händigkeit im Kristall anordnen», erklärt Karl-Heinz Ernst, «also entweder abwechselnd oder in Gruppen mit derselben Händigkeit.» Stattdessen fügten sich die Moleküle scheinbar willkürlich zu unterschiedlich grossen Dreiecken zusammen, die auf der Oberfläche ihrerseits unregelmässige Spiralen bildeten –die nicht-wiederholende oder aperiodische Struktur, welche die Forschenden zunächst für einen Fehler hielten.

Nach langem Tüfteln gelangt es Voigt und Ernst schliesslich, die molekularen Muster zu entschlüsseln – nicht nur durch Physik und Mathematik, sondern auch durch das Ausprobieren mit Puzzleteilen am Computer oder gar zuhause am Küchentisch. Komplett willkürlich ist die Anordnung der Moleküle nämlich nicht. Sie bilden Dreiecke, die zwischen zwei und 15 Moleküle pro Seite messen. Bei jeder Versuchsdurchführung dominierte jeweils eine Dreiecksgrösse. Ausserdem waren Dreiecke eine Grösse grösser und eine Grösse kleiner vertreten, aber keine weiteren.
«Unter unseren experimentellen Bedingungen wollen die Moleküle quasi die Silberoberfläche so dicht wie möglich bedecken, weil das energetisch am günstigsten ist», erklärt Ernst. «Aufgrund der Chiralität passen die Dreiecke, die sie bilden, an den


Rändern aber nicht exakt zusammen und müssen sich leicht versetzt anordnen.» Damit die Fläche trotzdem so effizient wie möglich ausgefüllt wird, braucht es die kleineren und grösseren Dreiecke. Bei dieser Anordnung entstehen ausserdem an manchen Stellen Defekte – kleine Unstimmigkeiten oder Löcher, die zum Zentrum einer Spirale werden können.
«Defekte sind eigentlich energetisch ungünstig», so Ernst weiter. «Sie ermöglichen in diesem Fall aber eine dichtere Anordnung der Dreiecke, was die sozusagen verlorene Energie wieder kompensiert.» Dieses Gleichgewicht erklärt auch, warum die Forscher nie zweimal dasselbe Muster vorgefunden haben: Wenn alle Muster von ihrem Energiezustand her gleich sind, entscheidet die Entropie.
Die Forschenden verwendeten ein Molekül namens Tris(tetrahelicenebenzen) oder t[4]HB, das seine Händigkeit ganz einfach wechseln kann. (Bilder: Empa) Übernehmen Sie die Führung bei
COMSOL Multiphysics®
Das Rätsel um den «molekularen Einstein» ist gelöst – aber was bringt uns diese Erkenntnis? «Oberflächen mit Defekten auf atomarer oder molekularer Ebene können besondere Eigenschaften aufweisen», erklärt Ernst. «Gerade für eine aperiodische Oberfläche wie unsere wurde vorhergesagt, dass sich die Elektronen darin anders verhalten und daraus eine neue Art von Physik entstehen könnte.» Um dies zu untersuchen, müsste man allerdings das aperiodische Molekül unter dem Einfluss von Magnetfeldern auf einer anderen Oberfläche untersuchen. Das überlässt Karl-Heinz Ernst, der inzwischen im Ruhestand ist, nun anderen. «Ich habe ein bisschen zu viel Respekt vor der Physik», schmunzelt der Chemiker.
www.empa.ch

Multiphysik-Simulation spielt eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung lebensrettender medizinischer Geräte und Behandlungen. Mithilfe eines präzisen Modells können die Wechselwirkungen zwischen dem menschlichen Körper und dem Medizinprodukt simuliert werden. Dies hilft bei Designentscheidungen, beschleunigt die Herstellung sicherer und wirksamer Produkte und erleichtert die Zulassungsverfahren.

erfahren sie mehr comsol.com/feature/medizintechnik-innovation


3-D-Strukturen von zwei Zielproteinen, Histon-Deacetylase 6 (blau) und Tyrosine-Proteinkinase JAK2 (rot), zusammen mit jeweils einem selektiven Inhibitor. Der duale Inhibitor in der Mitte ist gegen beide Enzyme aktiv. Die Vorhersage von Verbindungen mit prädefinierter dualer Aktivität ist die Aufgabe des chemischen Sprachmodells. (Bild: Sanjana Srinivasan, Jürgen Bajorath)
Wie künstliche Intelligenz das Auffinden neuer Arzneistoffe erleichtert
Forschende an der Universität Bonn haben ein KI-Verfahren so trainiert, dass sich damit potenzielle Wirkstoffe mit besonderen Eigenschaften vorhersagen lassen. Dazu nutzten sie ein chemisches Sprachmodell – eine Art Chatbot für Moleküle. Nach einer Trainingsphase konnte die KI die chemischen Strukturformeln von Verbindungen erzeugen, die sich möglicherweise als besonders wirksame Medikamente eignen.
Wer jemanden zum Geburtstag mit einem Gedicht erfreuen möchte, muss heute kein Poet sein: Ein kurzer Prompt bei einem Chatbot genügt, und binnen weniger Sekunden spuckt die KI eine lange Liste von Wörtern aus, die sich auf den Namen
der Jubilarin reimen. Auf Wunsch erzeugt sie dazu sogar ein Sonett.
Forschende der Universität Bonn haben in einer Studie ein ähnliches Modell implementiert – ein sogenanntes chemisches Sprachmodell. Damit lassen sich allerdings keine Reime produzieren. Stattdessen gibt die KI die Strukturformeln chemischer Verbindungen aus, die möglicherweise eine besonders begehrenswerte Eigenschaft aufweisen: Sie sind dazu in der Lage, an zwei unterschiedliche Zielproteine zu binden. Im Organismus können sie so zum Beispiel gleichzeitig zwei Enzyme hemmen.
«In der Pharmaforschung sind derartige Wirkstoffe aufgrund ihrer Polypharmakologie sehr begehrt», erläutert Prof. Dr. Jürgen

Bajorath. Der Chemieinformatiker leitet am Lamarr-Institut für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz den Bereich KI in den Lebenswissenschaften sowie am b-it (Bonn-Aachen International Center for Information Technology) der Uni Bonn das Life Science Informatics-Programm. «Da sie mehrere intrazelluläre Prozesse und Signaltransduktionswege zugleich beeinflussen, sind sie oft besonders wirksam –etwa im Kampf gegen Krebs.» Im Prinzip lässt sich dieser Effekt zwar auch durch die Kombination verschiedener Präparate erreichen. Dabei riskiert man aber Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Medikamenten. Ausserdem werden verschiedene Verbindungen meist unterschiedlich schnell abgebaut, was ihre gemeinsame Verabreichung erschwert.
Ein Molekül zu finden, das die Wirkung eines einzelnen Zielproteins spezifisch be -
einflusst, ist nicht einfach. Umso komplizierter ist es, Verbindungen zu designen, die gleich zwei «Wirkungen» haben. Chemische Sprachmodelle können dabei künftig möglicherweise helfen. ChatGPT, zum Beispiel, wird mit Milliarden Seiten von geschriebenen Texten trainiert und lernt daraus, selbst Sätze zu formulieren. Chemische Sprachmodelle funktionieren ähnlich, haben aber nur vergleichsweise kleine Datenmengen zur Verfügung. Aber auch sie werden im Prinzip mit Texten gefüttert, zum Beispiel den sogenannten SMILES-Strings (Simplified Molecular Input Line Entry System), die organische Moleküle und deren Struktur als eine Sequenz von Buchstaben und Symbolen darstellen. «Wir haben unser chemisches Sprachmodell nun mit Paaren von Strings trainiert», sagt Sanjana Srinivasan aus Bajoraths Ar
als würde man ChatGPT instruieren, diesmal kein Sonett zu erzeugen, sondern einen Limerick. Tatsächlich spuckte das Modell nach dem Feintuning Moleküle aus, bei denen bereits nachgewiesen wurde, dass sie gegen die gewünschten Kombinationen von Zielproteinen wirken. «Das zeigt, dass das Verfahren funktioniert», sagt Bajorath. Die Stärke des Ansatzes ist seiner Meinung nach aber nicht, dass sich damit auf Anhieb neue Verbindungen finden lassen, die die verfügbaren Pharmaka in ihrer Wirkung übertref
fen. «Interessanter ist aus meiner Sicht, dass die KI oft chemische Strukturen vorschlägt, an welche die meisten Chemiker auf Anhieb gar nicht denken würden», erklärt er. «Sie generiert gewissermassen sogenannte Out-of-the-Box-Ideen und kommt so auf originelle Lösungen, die die Pharma-Forschung zu neuen Ansätzen inspirieren können.»
Die Studie ist in der Fachzeitschrift Cell Reports Physical Science erschienen.
www.uni-bonn.de

unterschiedliche Klassen von Enzymen oder Rezeptoren beeinflussen. Um die KI auf diese Aufgabe vorzubereiten, erfolgte nach der generellen Lernphase ein Feintuning. Darin brachten die Forschenden dem Algorithmus mit Hilfe von ein paar Dutzend speziellen Trainings-Paaren bei, gegen welche unterschiedlichen Proteinklassen sich die vorgeschlagenen Verbindungen richten sollten. Das ist in etwa so,



Breites Anwendungsspektrum

Ideale Trennungen für kleine Moleküle und Biomoleküle
Robuste und hocheffiziente (U)HPLC
Nano- bis (semi)präparativer Maßstab
Schneller, kompetenter und individueller Support Ihr Erfolg ist unsere Priorität! Profitieren Sie vom YMC-Expertenwissen.
Bleiben Sie up-to-date mit dem YMC Expertise Portal www.ymc-schweiz.ch | info@ymc-schweiz.ch | + 41 61 561 80 50

Durch Zufall haben zwei Kunstschaffende die Biolumineszenz eines Pilzes entdeckt. Gemeinsam mit einer Pilzexpertin der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) beschreiben sie das noch wenig erforschte Phänomen.
Haoyun Liu ¹
Bei leuchtenden Pilzen denkt man oft an tropische Regionen, aber auch in der Schweiz kommen sie vor. Die Zürcher Kunstschaffenden Heidy Baggenstos und Andreas Rudolf beschäftigen sich seit über 10 Jahren mit biolumineszenten Organismen. «Wir wollen zeigen, dass diese biolumineszenten Pilze in Schweizer Wäldern vorkommen und dass wir nicht weit reisen müssen, um sie zu finden», erklärt Baggenstos.
Eines Abends, als sie durch den Wald in Zürich-Albisrieden spazierten, beobachtete das Duo durch ihre Kamera grünes Licht. Manchmal ist die Biolumineszenz der Pilze so schwach, dass sie mit blossem Auge nicht zu sehen ist. «Heute verwenden wir meistens unsere Smartphones oder eine Taschenlampe, aber um Biolumineszenz im Wald zu sehen, muss es stockdunkel sein», sagt Rudolf.
Die Kunstschaffenden sammelten einige Proben des leuchtenden Exemplars, da sie dachten, es handele sich um Mycena haematopus, eine bekannte biolumineszente Art. Zurück in ihrem gut beleuchteten Atelier stellten sie fest, dass es sich um eine andere Art handelte, Mycena crocata, den Gelbmilchenden Helmling, der für seine safranfarbene Milch bekannt ist und bisher nicht als biolumineszent beschrieben wurde.
Zuchtkulturen leuchteten bis zu 164 Tage lang
Gemeinsam mit Renate Heinzelmann, einer Pilzexpertin an der WSL, beschrieben sie diese neue Entdeckung genauer. Die Kunstschaffenden massen die von ver-
1 Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft


schiedenen Teilen des Pilzes emittierte Lichtmenge mithilfe von Langzeitbelichtungsfotos und einem Luminometer, das schwächeres Licht stärker verstärkt als eine Kamera. «Die meisten Experimente führten die Kunstschaffenden durch. Sie sammelten die Proben, machten die Fotos und die Lichtmessungen», erklärt Heinzelmann.
Auch das verrottende Holz, auf dem M. crocata wächst, kann beim Aufspalten ein grünes Leuchten abgeben, das bis zu 4 Stunden anhält, bis das Holz austrocknet.
Biolumineszenz ist ein chemischer Prozess, bei dem lebende Organismen Licht erzeugen, und Pilze haben ihren eigenen, einzigartigen Mechanismus entwickelt. Der entscheidende Schritt ist die Umwandlung von Luciferin durch das Enzym Luciferase in ein instabiles Produkt, das bei seinem Zerfall Energie in Form von Licht freisetzt. Im Gegensatz zur Fluoreszenz ist bei diesem Pro -
zess keine externe Lichtquelle erforderlich. Die Lichtmessungen ergaben, dass der Fruchtkörper von M. crocata (Terminologie: siehe Kasten) abgesehen von der Stielbasis nicht leuchtet, während das Myzel die stärkste Biolumineszenz aufwies. Das Myzel ist das unterirdische Geflecht eines Pilzes, das den Wurzeln von Pflanzen ähnelt. Daher kann auch das verrottende Holz, auf dem M. crocata wächst, beim Aufspalten ein grünes Leuchten abgeben, das bis zu 4 Stunden anhält, bis das Holz austrocknet. Als Baggenstos und Rudolf reine Myzelkulturen unter optimalen Bedingungen züchteten, leuchteten diese bis zu 164 Tage lang.
Funktion des «kalten Feuers» nach wie vor unbekannt Heinzelmanns genetische Untersuchungen bestätigten die bestimmte Art sowie die Anwesenheit von Genen, die mit der Biolumineszenz in Zusammenhang stehen und in allen leuchtenden Pilzen der Gattung Mycena, den Helmlingen, vorkommen. «Es werden laufend neue biolumineszente Arten entdeckt werden», prognostiziert Hein -
Pilzanatomie für Anfänger
Fruchtkörper: (auch Basidien genannt): Teil des Pilzes, an den wir normalerweise denken, nämlich das sporenproduzierende Organ (nicht alle Pilze haben einen Fruchtkörper)
Sporen: Fortpflanzungseinheit von Pilzen mit einer ähnlichen Funktion wie jene von Pflanzensamen – aber während ein Samen aus vielen Zellen besteht, ist eine Spore eine einzelne Zelle
Myzel: Unterirdisches Geflecht aus Hyphen (Fäden), das Nährstoffe aufnimmt
Stiel: Stängel des Fruchtkörpers
L atex: Milchige Flüssigkeit, die der Pilz absondert, wenn er beschädigt wird

Mycena crocata im Licht und in der Dunkelheit. Die Biolumineszenz des Myzels lässt das Holz leuchten.
zelmann. «Die Biolumineszenz ist noch wenig erforscht, und je mehr Menschen nachforschen, desto mehr werden sie finden.»
Biolumineszierende Pilze üben seit Aristoteles’ erster Beobachtung vor über 2000 Jahren eine Faszination aus. Er beschrieb sie als «kaltes Feuer», das aus verrottendem Holz austritt. Doch das Rätsel um dieses Phänomen hat sich über die Zeit erhalten. Obwohl der biologische Mechanismus inzwischen verstanden ist, bleibt seine ökologische Funktion unklar. Während einige leuchtende Pilze Insekten anlocken könnten, um Sporen zu verbreiten, passt die Biolumineszenz von verstecktem Myzel nicht zu dieser Hypothese. «Es scheint, dass die Biolumineszenz über lange Zeiträume erhalten geblieben ist, also nehmen wir an, dass sie eine Funktion hat», sagt Heinzelmann, «aber sie ist immer noch ein Rätsel.» Die Forschung wurde in der Fachzeitschrift Mycoscience publiziert.
www.wsl.ch
www.baggenstos-rudolf.ch
Sicheres Arbeiten mit Gefahrstoffen und die technische Lösung VARIO-Flow Gefahrstoffarbeitsplätze (GAP) in einer Broschüre zusammengefasst:
W Einhaltung von maximalen Arbeitsplatzkonzentrationswerten (MAK-Werte)
W STOP-Prinzip mit Fokus auf technischen Schutz
W Lösungskonfiguration und technische Daten

www.denios.ch/gap

Zyanid: Ein giftiges Gas, das für unsere Zellen essenziell ist
Die Dosis macht das Gift – Eine Forschungsgruppe an der Universität Freiburg hat die Mechanismen entschlüsselt, durch die unsere Zellen auf natürliche Weise Blausäure (Wasserstoffcyanid) produzieren. Dieses Gas, das in hohen Dosen giftig ist, spielt eine zentrale Rolle für die normale Funktion unseres Körpers. Die therapeutischen Implikationen dieser Entdeckung sind erheblich.
Obwohl Blausäure als Gift gilt, wird sie nicht nur endogen und auf natürliche Weise von Säugetierzellen produziert, sondern übernimmt auch eine fundamentale Funktion in ihrem Stoffwechsel. Eine so weitreichende Aussage wäre ohne die Arbeit von Prof. Csaba Szabo und seinem Team nicht möglich gewesen. In einer in der Fachzeitschrift Nature Metabolism veröffentlichten Studie beschreiben die Forschenden erstmals die Mechanismen der körpereigenen Blausäureproduktion und die gesundheitlichen Folgen, wenn diese entweder überhandnimmt oder nicht in ausreichender Menge vorhanden ist.
Durch Experimente mit menschlichen Zellen und lebenden Mäusen konnte die Forschungsgruppe nachweisen, dass Blausäure systematisch im Körper vorkommt. «Wir konnten zeigen, dass dieses Gas natürlich

Auch die Kerne einiger Steinobstfrüchte, wie zum Beispiel der Aprikose, enthalten geringe Mengen von Blausäure. (Bild: Adpic)

produziert wird – ohne äussere Einflüsse oder Kontamination», erklärt Szabo. Während dieses Phänomen bereits bei Pflanzen und Bakterien bekannt war, konnte es bei Säugetieren bisher nicht nachgewiesen werden.
Wie es sich für einen Pharmakologen gehört, wollte Szabo daraufhin herausfinden, welche Faktoren für die Produktion von Blausäure verantwortlich sind. Als die Forschenden Zellkulturen mit Glycin versetzte, beobachteten sie eine erhöhte Produktion von Blausäure. «Wir konnten nachweisen, dass Glycin, eine in unserem Körper vorkommende Aminosäure, die Produktion von Blausäure in bestimmten Zellen, wie etwa in der Leber, stimuliert», erklärt Szabo.
Richtige Balance entscheidend
Die nächste Herausforderung bestand darin, zu verstehen, wie der Körper die Blausäureproduktion reguliert, um eine toxische Anreicherung zu vermeiden. In diesem Zusammenhang richteten die Forschenden ihre Aufmerksamkeit auf Rhodanese – ein Enzym, das für die Entgiftung von Blausäure bekannt ist. «Ähnlich wie bei Glycin haben verschiedene in vitro- und in vivo-Experimente gezeigt, dass Rhodanese als eine Art Entschärfungsmechanismus für Blausäure fungiert», erklärt Szabo. «Dieses Enzym wandelt Blausäure in eine ungiftige Form um – das sogenannte Thiocyanat –, wodurch die Zellen vor einer möglichen Vergiftung geschützt werden.»
Therapeutische Implikationen
Szabo ist überzeugt, dass das Verständnis dieser Mechanismen weitreichende medizinische Auswirkungen haben kann. Zwei Beispiele verdeutlichen das Potenzial dieser Entdeckung:
Schutz bei Sauerstoffmangel: In Laborversuchen wurde festgestellt, dass Zellen bei Sauerstoffmangel (Hypoxie) besser überleben, wenn eine geringe Menge Blausäure vorhanden ist. Für Szabo ist dies ein vielversprechender Ansatz für die Behandlung von Schlaganfällen: «Bei einem Schlaganfall leiden die Hirnzellen unter einem akuten Sauerstoffmangel. Da wir nun wissen, dass Blausäure die Zellen schützt, können wir uns gut vorstellen, dass sie dazu beitragen könnte, die Folgeschäden eines Schlaganfalls zu begrenzen.»
Behandlung von Stoffwechselerkrankungen: Die Forschenden fanden ausserdem heraus, dass bestimmte Erkrankungen, wie die nicht-ketotische Hyperglycinämie (NKH), zu einer übermässigen Produktion von Blausäure führen. In solchen Fällen vergiftet das sich anreichernde Gas die Zellen, stört deren Stoffwechsel und kann schwere neurologische Schäden verursachen. Ein besseres Verständnis der Rolle von Glycin und Rhodanese könnte hier neue therapeutische Ansätze ermöglichen.
In Anlehnung an Paracelsus, den berühmten Schweizer Arzt, bestätigen die Forschenden aus Freiburg: Alles ist Gift, nichts ist Gift – es kommt nur auf die Menge an. Diese über 500 Jahre alte Erkenntnis gilt also auch für Blausäure, deren Toxizität allgemein bekannt ist. Szabo betrachtet die Studie als Meilenstein: «Ich bin überzeugt, dass die Arbeit unser Verständnis von Zellbiologie und Stoffwechsel grundlegend verändern wird.»
www.unifr.ch
Eine internationale Forschungsgruppe beschreibt erstmals die Struktur und Funktionsweise des «Zorya»-Systems, eines hochspezialisierten antiviralen Schutzmechanismus gegen Bakterien.
Bakterien werden ununterbrochen von Viren infiziert, sogenannten Phagen, welche die Bakterien als Wirtszellen nutzen. Doch im Laufe der Evolution haben Bakterien eine Vielzahl von Strategien entwickelt, um sich vor diesen Attacken zu schützen. Viele dieser bakteriellen Immunitätssysteme sind schon lange bekannt. Prof. Dr. Marc Erhardt und Prof. Dr. Philipp Popp, beide vom Institut für Biologie der HumboldtUniversität zu Berlin, haben nun gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen in Dänemark und Neuseeland sowie weiteren Kooperationspartnern die Struktur und Funktionsweise eines neuartigen bakteriellen Abwehrsystems gegen Phagen entschlüsselt. Es war ursprünglich 2018 von einer israelischen Forschungsgruppe entdeckt und nach Zorya, einer Figur in der slawischen Mythologie benannt worden. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.
Das Zorya-System erkennt Phagenangriffe und aktiviert eine frühzeitige und präzise Abwehr, die das Virus unschädlich macht, ohne dass die Wirtszelle abstirbt. «Zorya ist wie ein Frühwarnsystem mit einem Schutzschild. Es erkennt die ersten Anzeichen eines Angriffs und reagiert blitz-
schnell, um den Eindringling abzuwehren», erklärt Prof. Marc Erhardt, Leiter der Arbeitsgruppe Molekulare Mikrobiologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und einer der Hauptautoren der Studie.
Die Untersuchung des Zorya-Systems anhand modernster Methoden wie Kryo-Elektronen- und Fluoreszenzmikroskopie zeigt, dass es aus einem einzigartigen molekularen Motor und mehreren spezialisierten Komponenten besteht. Dieser Motor erkennt frühzeitig Veränderungen in der Zellhülle, die durch eindringende Phagen verursacht werden, und löst eine Abfolge von Schutzreaktionen aus. Durch diesen bisher unbekannten Mechanismus kann die Bakterienzelle die Phagen-DNA gezielt abbauen, sodass das Virus sich nicht in der Wirtszelle vermehren kann. Das ist bemerkenswert, denn in der Regel verhindern Bakterien die Vermehrung der Phagen, indem sie den Zelltod einleiten, sich also selbst «opfern». «Die Entschlüsselung des Zorya-Systems war wie das Öffnen einer Schatztruhe», sagt Erhardt. «Man entdeckt immer wieder neue Facetten dieses molekularen Meisterwerks.»

Um die Struktur der Protein-Komplexe zu analysieren, wurden Proben mithilfe der Kryo-Elektronenmikroskopie innerhalb von Sekundenbruchteilen auf sehr niedrige Temperaturen bis zu –260 Grad heruntergekühlt. Diese Schockgefrierung verhindert die Bildung von Eiskristallen, so dass Moleküle in ihrer natürlichen Form erhalten bleiben. Die Fluoreszenzmikroskopie wiederum ermöglichte den Einblick in die Interaktion der Virenpartikel mit den Bakterienzellen.
Die Entschlüsselung dieses Viren-Abwehrsystems hat weitreichende Implikationen: Sie trägt einerseits dazu bei, die Mechanismen der Phagen-Bakterien-Interaktion besser zu verstehen. Andererseits eröffnen die Erkenntnisse neue Möglichkeiten für biotechnologische Anwendungen. «Das Zorya-System könnte als Grundlage für die Entwicklung innovativer Werkzeuge dienen, um gezielt genetisches Material zu manipulieren oder um neuartige Therapien gegen bakterielle Infektionen zu entwickeln», ergänzt Prof. Philipp Popp, Gastprofessor am Institut für Biologie und Mitautor der Studie. Auch die Entwicklung der Crispr-Cas-Methode für die Genom-Editierung geht auf ein in den 2000er-Jahren entdecktes Immunitätssystem von Bakterien zum Schutz vor Viren zurück. Die vorliegende Arbeit ist für Popp auch ein Beispiel für die Schönheit der molekularen Biologie: «Es ist faszinierend zu sehen, welche eleganten Überlebensstrategien Bakterien entwickeln. Zorya zeigt uns, wie viel wir noch über diese winzigen, aber unglaublich komplexen Organismen lernen können.»
www.hu-berlin.de

Forschende an der Universität Bayreuth (D) und der Aalto-Universität (FI) haben ein Hydrogel mit einzigartiger Struktur entwickelt, das erstmals Stärke, Flexibilität und Selbstheilungsfähigkeit vereint.
Gele begegnen uns im Alltag ständig –von weichen, klebrigen Substanzen wie Haargel bis hin zu gelartigen Bestandteilen in Lebensmitteln. Auch menschliche Haut weist gelartige Eigenschaften auf, besitzt jedoch einzigartige Qualitäten, die nur schwer nachzuahmen sind. Sie kombiniert hohe Festigkeit mit Flexibilität und beeindruckenden Selbstheilungskräften, sodass sie sich oft innerhalb von 24 Stunden nach einer Verletzung vollständig regeneriert.
Bisher konnten künstliche Gele entweder eine hohe Steifigkeit oder die Selbstheilungsfähigkeit natürlicher Haut nachbilden, aber nicht beides zugleich. Nun ist es einer Forschungsgruppe der Aalto-Universität, Helsinki, und der Universität Bayreuth erstmals gelungen, ein Hydrogel mit einer einzigartigen Struktur zu entwickeln, das diese bisherigen Einschränkungen überwindet. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für Anwendungen wie die gezielte Medika -

Künstlerische Darstellung von Hydrogelen in einem durch Selbstheilung gebildeten MobiusRing. (Bild: Universität Bayreuth)
mentenfreisetzung, Wundheilung, Sensoren in der Soft-Robotik und künstliche Haut.
In ihrer Studie fügten die Forschenden ultradünne spezielle Ton-Nanoschichten (Nanosheets) mit aussergewöhnlich grossen Durchmessern in Hydrogele ein, die normalerweise weich und elastisch sind. Diese Nanosheets wurden von Prof. Dr. Josef Breu vom Lehrstuhl für Anorganische Kolloide für elektrochemische Energiespeicherung an der Universität Bayreuth entwickelt und hergestellt. Das Ergebnis ist eine hochgeordnete Struktur mit dicht verschlauften Polymerketten zwischen den Nanosheets. Dies verbessert nicht nur die mechanischen Eigenschaften des Hydrogels, sondern ermöglicht weiterhin seine Selbstheilung.
Das Geheimnis des Materials liegt nicht nur in der geordneten Anordnung der Nanosheets, sondern auch in den Polymerketten, die sich dazwischen verschlaufen – kombi-

niert mit einem Hertellungsverfahren, das so einfach ist wie Backen. Chen Liang, Postdoktorand an der Aalto-Universität, mischte ein Pulver aus Monomeren mit Wasser, das Nanosheets enthielt. Anschliessend wurde die Mischung unter eine UV-Lampe gestellt – ähnlich wie bei der Aushärtung von Gelnagellack. Die UV-Strahlung der Lampe bewirkt, dass sich die einzelnen Moleküle miteinander verbinden, sodass ein elastischer Feststoff – ein Gel – entsteht», erklärt Liang.
«Auf molekularer Ebene sind die Fäden äusserst dynamisch und beweglich. Wird das Material durchtrennt, beginnen sich die Fäden erneut ineinander zu verschlaufen.»
Hang Zhang
Aalto-Universität, Finnland
«Verschlaufung bedeutet, dass sich die dünnen Polymerketten wie winzige Wollfäden umeinander zu einem Wollknäuel aufrollen – allerdings in zufälliger Anordnung», ergänzt Hang Zhang von der AaltoUniversität. «Wenn die Polymere vollständig verschlauft sind, kann man zwischen den einzelnen Fäden nicht mehr unterscheiden. Auf molekularer Ebene sind sie äusserst dynamisch und beweglich. Wird das Material durchtrennt, beginnen sich die Fäden erneut ineinander zu verschlaufen.»
Neuer Mechanismus verstärkt konventionell weiche Hydrogel
Vier Stunden nach einem Schnitt mit einem Messer ist dieser daher bereits wieder zu 80 bis 90 Prozent verheilt. Nach 24 Stunden ist das Material in der Regel vollständig repariert. Ein Hydrogelfilm mit einer Dicke von einem Millimeter enthält ca. 10 000 Lagen von Nanosheets. Dadurch ist das Material so steif wie menschliche Haut und besitzt trotzdem eine vergleichbare Dehnbarkeit und Flexibilität.
«Man stelle sich Roboter mit robuster, selbstheilender Haut oder synthetische Gewebe vor, die sich eigenständig reparieren.»
Prof. Olli Ikkala
Aalto-Universität, Finnland
«Steife, starke und selbstheilende Hydrogele waren lange eine Herausforderung. Wir haben einen neuen Mechanismus entdeckt, um konventionell weiche Hydrogele zu verstärken. Dies könnte die Entwicklung neuer Materialien mit bio-inspirierten Eigenschaften revolutionieren», sagt Zhang.
«Diese Arbeit ist ein spannendes Beispiel dafür, wie uns biologische Materialien dazu inspirieren, neue Kombinationen von Eigenschaften für synthetische Materialien zu entdecken», sagt Olli Ikkala von der Aalto-Universität. «Man stelle sich Roboter mit robuster, selbstheilender Haut oder synthetische Gewebe vor, die sich eigen -
ständig reparieren.» Zwar sei es noch ein weiter Weg bis zu realen Anwendungen, doch die aktuellen Ergebnisse seien ein entscheidender Fortschritt. Über ihre Ergebnisse berichten die Forschenden in der Fachzeitschrift Nature Materials
Der Schlüssel zur hohen Festigkeit liegt in der Zugabe von ultrabreiten, aber dünnen Ton-Nanosheets, die sich durch eine äusserst gleichmässige Quellung in Wasser auszeichnen. Das nanoskalige Phänomen erklärt Breu bildlich so: «Man kann es mit





einem Stapel Druckerpapier vergleichen, bei dem die einzelnen Blätter auf einen einheitlichen Abstand von einem Millimeter separiert werden. Die Durchmesser der Polymerknäuel korrelieren mit der entstehenden Schlitzhöhe und werden daher zwischen den Nanosheets quasi eingeklemmt.» Durch die Reibung mit den einschliessenden Nanosheets erhöht sich die Festigkeit.
www.uni-bayreuth.de


















EIN INSTRUMENT. ZWEI FUNKTIONEN.
































Vollautomatisierte Derivatisierung mit patentierter Micro-Droplet Sprühtechnologie und integriertem Plattenheizer








MAXIMAL EFFIZIENT UND FLEXIBEL
Das Module DERIVATIZATION wurde speziell für die vollautomatische Derivatisierung von HPTLC-Platten entwickelt und kombiniert präzises Sprühen von Derivatisierungsreagenzien mit gleichmässigem Erhitzen der Platte – für maximale Effizienz und exakte Ergebnisse.
Flexibel einsetzbar, sowohl stand-alone, als auch nahtlos integriert mit weiteren HPTLC PRO Modulen.



































Höchste Anwendersicherheit durch Automatisierung und Abzugsanbindung
Maximale Homogenität in der Reagenz- und Wärmeverteilung
Optimaler Reinigungsablauf zwischen den Düsenwechseln
Kostengünstig durch geringen Reagenzienverbrauch

Ein neues Mikroskopie-Verfahren kann Moleküle identifizieren. Die Frage nach dem Auflösungsvermögen erwies sich aber als schwieriges Rätsel. Jetzt wurde es an der Technischen Universität Wien gelöst. Mit den neuen Erkenntnissen lassen sich auch Aussagen über die dritte Dimension machen.
Beurteilt man die Qualität eines Mikroskops, lautet die entscheidende Frage: Wie gross sind die kleinsten Strukturen, die man damit gerade noch sichtbar machen kann? Wie nah können zwei Objekte aneinanderrücken, bis sie nicht mehr als zwei getrennte Objekte zu sehen sind, sondern zu einem einzigen Bild-Blob verschwimmen?
Bei gewöhnlichen Lichtmikroskopen lässt sich das mit relativ einfachen Formeln berechnen. Doch mittlerweile verwendet man in vielen Bereichen komplizierte Mikroskopie-Techniken, bei denen diese Frage viel schwieriger zu beantworten ist.
Eine davon ist die RasterkraftmikroskopieInfrarotspektroskopie (AFM-IR), mit der man die Verteilung von chemischen Stoffen abbilden kann. Man kann mit dieser Methode zum Beispiel Proteine in einer Zelle identifizieren und sichtbar machen. Doch wie gut diese Methode in welcher Situation funktioniert, war bisher oft unklar. Das Auflösungsvermögen der Methode variiert und hängt auf komplizierte Weise von vielen verschiedenen Effekten ab. An der TU Wien gelang es nun, diese Effekte zu beschreiben und das Auflösungsvermögen solcher Mikroskope zu berechnen. Was man bisher nur durch Ausprobieren herausfinden konnte, lässt sich nun zuverlässig vorhersagen.
Die Mikroskopie-Technik AFM-IR wird bereits seit einigen Jahren an der Technischen Uni-

Prof. Georg Ramer, Institut für chemische Technologien und Analytik der TU Wien: «Unsere Arbeit erlaubt uns auch, Experimente korrekter zu interpretieren und Empfindlichkeit und Auflösung zu optimieren.» (Bild: TU Wien)
versität Wien beforscht. Sie verbindet Rasterkraftmikroskopie (Atomic Force Microscopy – AFM) mit Infrarot-Spektroskopie (IR). Um grosse Moleküle wie beispielsweise Proteine aufzuspüren, kann man Infrarotstrahlung verwenden: Unterschiedliche Moleküle reagieren auf unterschiedliche Infrarot-Wellenlängen. Durch Messung bei vielen unterschiedlichen Infrarot-Wellenlängen ergibt sich ein sogenanntes Infrarotspektrum – so etwas wie der Fingerabdruck eines Moleküls. An diesem Spektrum lässt sich erkennen, mit welchem Molekül man es zu tun hat. «Allerdings weiss man dann noch nicht, wo sich dieses Molekül genau befindet»,
sagt Prof. Georg Ramer vom Institut für chemische Technologien und Analytik der TU Wien. Man kann aber diese InfrarotMethode mit einem Rasterkraftmikroskop kombinieren. Dabei tastet man die Oberfläche der Probe mit einer sehr feinen Spitze ab. Wenn an einer bestimmten Stelle ein Molekül sitzt, das gerade Infrarotstrahlung aufnimmt, dann führt das genau an dieser Stelle zu einer lokalen Erwärmung. Die Probe dehnt sich ein bisschen aus, und das lässt sich mit dem Rasterkraftmikroskop messen. Man weiss dann also nicht nur, um welches Molekül es sich handelt, sondern auch ganz genau, wo es sitzt.


VOLUMETRISCHE LÖSUNGEN FÜR DIE QUANTITATIVE ANALYSE IN TOP-QUALITÄT VON CHEMSOLUTE®
Das vielfältige CHEMSOLUTE®- Sortiment an volumetrischen Lösungen stellt sicher, dass für jede Anwendung die passende Lösung vorhanden ist.
Die genaue Auflösung? Ein Rätsel
«Viele Forschende und Firmen verwenden diese Methode mit Erfolg, weil sie mit sehr hoher Auflösung sagen kann, wo welche Moleküle sitzen. Sie hatte aber bisher so etwas wie ein schmutziges Geheimnis», sagt Georg Ramer. «Niemand konnte sagen, wie hoch die Ortsauflösung der Technik ist. Die Antworten, die man dazu in der Literatur findet – 10 Nanometer oder auch 100 Nanometer – sind selten wirklich fundiert, sondern eher geraten.» Nicht immer funktioniert die Methode gleich gut, sie ist von Probe zu Probe unterschiedlich.
«Niemand konnte sagen, wie hoch die Ortsauflösung der Technik ist. Die Antworten, die man dazu in der Literatur findet – 10 Nanometer oder auch 100 Nanometer – sind selten wirklich fundiert, sondern eher geraten.»
Prof. Georg Ramer
Institut für chemische Technologien und Analytik, TU Wien
Das ist ein Problem, denn wenn man das Auflösungsvermögen nicht kennt, kann man auch nicht sagen, für welche Anwendungen die Methode eingesetzt werden kann. Man führt möglicherweise Experimente durch, für die diese Technik eigentlich gar nicht geeignet ist.
«Wir haben uns das näher angesehen und sowohl Experimente durchgeführt als auch Rechenmodelle und Computersimulationen entwickelt», sagt Yide Zhang, einer der beiden Doktoranden, die an dem Projekt arbeiten. «So können wir nun endlich genau erklären, warum es zu diesem merkwürdigen Effekt kommt, dass die Auflösung manchmal besser und manchmal schlechter ist.» Wenn ein Molekül auf der Probe Infrarotlicht absorbiert und sich erwärmt, führt das nicht immer zur gleichen gemessenen Ausdehnung. Diese Ausdehnung hängt nämlich auch davon ab, wie schnell die Wärme abgeleitet wird und wieviel Material sich zwischen dem Molekül und der Spitze des Instruments befindet. Mit dem neuen Computermodell lässt sich ausrechnen, wie stark welche Probe auf diesen Wärmeeffekt reagiert, und in welchen konkreten Fällen dieser Effekt sichtbar sein sollte und in welchen nicht.
Mehr über die Probe lernen als
«Unsere Ergebnisse können nun verwendet werden, um im Vorhinein zu entscheiden, ob ein bestimmtes Experiment mit der Methode überhaupt Sinn macht», sagt Georg Ramer. «Und nicht nur das: Unsere Arbeit erlaubt uns auch, Experimente korrekter zu interpretieren und Empfindlichkeit und Auflösung zu optimieren.» So wurde bisher die Probe etwa meist als zweidimensionale Oberfläche betrachtet. Mit den neuen Erkenntnissen lassen sich nun aber auch Aussagen über die dritte Dimension machen: Man kann nun also ein 3-D-Bild der Probe auf Nanometer-Skala erstellen. Publiziert wurden die Forschungsresultate in der Fachzeitschrift PNAS.
www.tuwien.atv

Prozesse verbessern ist wie Rennradfahren. Mit einem ausdauernden Partner läuft alles effizienter.
Energieoptimierung ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen Produktion. Als Ihr starker Partner für strategisches Energiemanagement helfen wir Ihnen, mit steigenden Energiekosten und strengeren Umweltzielen umzugehen. Wir sind an Ihrer Seite – und zeigen Ihnen Wege auf, wie Sie Energie einsparen und ressourcenschonend arbeiten können, ohne auf Sicherheit, Qualität, Zuverlässigkeit und Betriebszeit verzichten zu müssen.
Erfahren Sie mehr unter www.ch.endress.com

65 Prozent der Schweizer Führungskräfte stufen Cyberrisiken als ihr grösstes Risiko ein. 20 Prozent der hiesigen Unternehmen verfügen über Kontrollen, um Cyber-Störungen Widerstand zu leisten. Zwei Drittel der Unternehmen beabsichtigen, ihr Budget für Cybersicherheit bis 2025 zu erhöhen.
2025 Digital Trust Insights Survey PwC Schweiz

24 000 Schweizer KMU sind in den vergangenen drei Jahren Opfer einer Cyberattacke geworden, wie aus der «Cyberstudie 2024» hervorgeht. Dies entspricht 4 Prozent der befragten KMU. Besorgniserregend: 4 von 10 Unternehmen haben im Falle eines schwerwiegenden Cyberangriffs keinen Notfallplan. Weniger als die Hälfte der KMU bestätigte, dass ihre ITDienstleister cyberzertifiziert sind.
https://digitalswitzerland.com

Gefunden wurde der neue Flavivirus-Subtyp in erkrankten Gämsen und anhaftenden Zecken 2017 in Salzburg und 2023 in der Lombardei und im Piemont. Welche Folgen das neu identifizierte «Alpine chamois encephalitis virus» für Mensch und Tier haben wird, lässt sich derweil nicht sagen. Das zoonotische Potenzial und sein Wirtsspektrum bei anderen Tierarten, einschliesslich Nutztieren, muss unbedingt weiter untersucht werden. Sollten etwa auch Ziegen oder Schafe dafür empfänglich sein, bestünde auch die Gefahr von Infektionen des Menschen durch den Genuss von Rohmilch-Produkten dieser Tierarten. Um weitere Forschung zu erleichtern, wurde das Zellkulturisolat des «ACEV» auf der Plattform des Europäischen Virusarchivs hinterlegt.
www.vetmeduni.ac.at
Salzburg Research und die Universität Salzburg entwickelten im Auftrag des Feuerwehrausstatters Texport eine intelligente Feuerwehrjacke. Darin verbaute Sensoren melden, wenn die Person zu überhitzen droht und leiten sofort Gegenmassnahmen ein.
www.salzburgresearch.at


Seit 2014 ermöglicht in der Schweiz ein medizinisches Programm den Einsatz von LSD und Psilocybin bei therapieresistenten psychischen Erkrankungen. Eine Studie der Universität Freiburg zeigt jetzt: Es ist weniger der «Trip», sondern vor allem das Gefühl der Entspannung, das den Unterschied macht. Mystische Erlebnisse, die oft als Kern psychedelischer Behandlungen beschrieben werden, stehen möglicherweise nicht so sehr im Zentrum des Therapieerfolgs wie bisher angenommen. Patienten, die während der Behandlung tiefe Entspannung empfanden, erlebten die stärksten Verbesserungen ihrer depressiven Symptome.
www.unifr.ch
149,08 MRD
Die chemisch-pharmazeutische Industrie bildet das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft. Mit einem Anteil von 52 Prozent an den Gesamtexporten stiegen die Ausfuhren 2024 auf 149,08 Milliarden Schweizer Franken an.
www.scienceindustries.ch
Forschende an der Technischen Universität München haben einen neuen Bereich der Mikroskopie erfunden: die Kernspin-Mikroskopie. Damit können magnetische Signale der Kernspinresonanz mit einem Mikroskop sichtbar gemacht werden. Quantensensoren verwandeln die Signale in Lichtimpulse, die dann eine extrem hoch aufgelöste optische Darstellung ermöglichen.
Ulrich Meyer ¹
Magnetresonanztomographen (MRT) sind bekannt für ihre Fähigkeit, in die Tiefe des menschlichen Körpers zu schauen und Bilder von Organen und Geweben zu erstellen. Die in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichte neue Methode erweitert diese Technik auf den Bereich der mikroskopischen Details. «Die verwendeten Quantensensoren ermöglichen es, Magnetresonanzsignale in optische Signale umzuwandeln. Diese Signale werden mit einer Kamera erfasst und als Bilder dargestellt», erklärt Dominik Bucher, Professor für Quantensensorik und Forscher am Exzellenzcluster Munich Center for Quantum Science and Technology (MCQST).
als Quantensensor
Die Auflösung des neuartigen MRT-Mikroskops erreicht 10 Millionstel Meter – das ist so fein, dass selbst die Strukturen einzelner Zellen zukünftig sichtbar gemacht werden können. Das Herzstück des neuen Mikroskops ist ein winziger Diamantchip. Dieser auf der atomaren Ebene speziell präparierte Diamant dient als hochsensibler Quantensensor für MRTMagnetfelder. Wird er mit Laserlicht bestrahlt, erzeugt er ein fluoreszierendes Signal, das die Informationen des MRTSignals enthält. Dieses Signal wird mit einer Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen und ermöglicht Bilder mit einer deutlich höheren Auflösung bis auf mikroskopische Ebene.
Flüssigbiopsie-Technologie für Krebsmonitoring Auf der Grundlage der neuen Kernspin-Mikroskopie hat sich das Start-up-Team QTAS (Quantum Total Analysis Systems) gebildet. Sein Ziel: Einzelne Krebszellen hochpräzise und in kurzen Zeitabständen erfassen zu können.
Aktuell werden Therapieerfolge oft erst nach 3 bis 6 Monaten überprüft, was zu verzögerten Anpassungen von Therapien und damit zu suboptimalen Behandlungsergebnissen führen kann. Ziel der Flüssigbiopsie-Technologie ist diese Überwachungsintervalle bis auf einige Tage zu verkürzen und eine sehr präzise Überwachung der Krebstherapie zu ermöglichen. Die ersten ermutigenden Ergebnisse zeigen, dass einzelne Krebszellen mit aussergewöhnlicher Präzision detektierbar sind.

Die potenziellen Anwendungen der Kernspin-Mikroskopie sind vielversprechend: In der Krebsforschung könnten einzelne Zellen detailliert untersucht werden, um neue Erkenntnisse über Tumorwachstum und -ausbreitung zu gewinnen. In der Pharmaforschung könnte die Technik genutzt werden, um Wirkstoffe auf molekularer Ebene effizient zu testen und zu optimieren. Auch in den Materialwissenschaften bietet sie ein grosses Potenzial, zum Beispiel zur Analyse der chemischen Zusammensetzung von Dünnschichtmaterialien oder Katalysatoren.
Die Forschungsgruppe hat ihre Entwicklung zum Patent angemeldet und plant bereits, die Technologie weiterzuentwickeln, um sie noch präziser und schneller zu machen. Langfristig könnte sie in der medizinischen Diagnostik und der Forschung als Standardwerkzeug etabliert werden. «Die Verschmelzung von Quantenphysik und Bildgebung eröffnet völlig neue Möglichkeiten, um die Welt auf molekularer Ebene zu verstehen», betont Erstautor Karl D. Briegel.
www.tum.de

Mithilfe von selbstklebenden Objektträgern lassen sich Gewebeschnitte endlich schnell anfärben und dann mit reproduzierbaren Ergebnissen mikroskopieren.
Dr. Christian Ehrensberger
Die Entwicklung von Krankheiten und die Wirkung von Therapien lässt sich mithilfe der Zellmikroskopie besser verstehen. Um die interessierenden Strukturen unter dem Mikroskop gut erkennen zu können, werden Gewebeschnitte in unterschiedlichen Experimenten angefärbt. Für reproduzierbare Ergebnisse müssen die flüssigen Färbe-Reagenzien definiert zugeführt werden 1. Dies gelingt zuverlässig und zeitsparend unter Verwendung spezieller Objektträger mit integrierten Kanälen und mit einer selbstklebenden Unterseite.
Viele Protokolle – ähnliche Schwierigkeiten
Forschende können heutzutage auf eine Vielzahl von Standard-Protokollen zur Behandlung von Geweben für eine effektive Mikroskopie zurückgreifen. Zu ihnen gehören beispielsweise die Immunhistochemie, das Multiplexing und die sogenannten «Spatial Omics». Bei der Immunhistochemie werden Strukturen mit markierten Antikörpern sichtbar gemacht. Eine spezielle
Technik ist die Markierung der Antikörper mit Fluoreszenzfarbstoffen. In diesem Falle spricht man von Immunfluoreszenz. Bei der Multiplex-Mikroskopie werden mit Fluoreszenzfarbstoff markierte Antikörper auf ein Gewebe gegeben. Dadurch können Zellen, die das zum Antikörper passende Molekül auf der Oberfläche tragen, unter dem Mikroskop identifiziert und lokalisiert werden. Anschliessend wird der Farbstoff ausgebleicht, und der nächste Marker kann aufgegeben werden. Diese Prozedur lässt sich beliebig oft wiederholen. In der Regel verwendet man 60 bis 100 Marker pro Experiment 2
Der Begriff «Spatial Omics» wiederum umfasst ein breites Spektrum von Techniken, die gleichzeitig die physikalische Gewebestruktur erkennen lassen und molekulare Eigenschaften messen 3 . Allen diesen Standard-Protokollen gemeinsam sind ein hoher Zeitaufwand und eine geringe Robustheit. Es kommt häufig von Experiment zu Experiment zu unterschiedlichen Ergebnissen. Objektträger mit selbstklebender Unterseite versprechen nun eine einfachere und schnellere
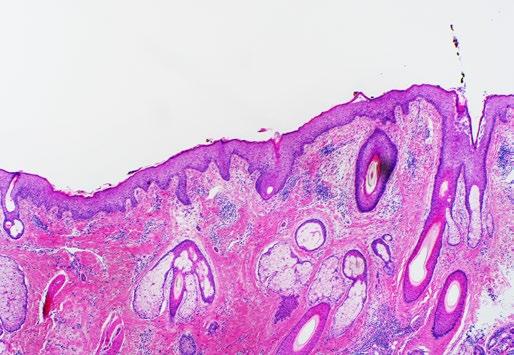
Durchführung und das Erzielen vergleichbarer Ergebnisse.
Anwendung in der Praxis
Die kanaldurchzogenen Objektträger mit selbstklebender Unterseite sind so konzipiert, dass sie auf Standard-Objektträger aufgebracht werden können. So lassen sie sich leicht in bereits etablierte Arbeitsabläufe integrieren. In Kombination mit einem Objektträger oder Deckglas steht dann ein Färbeflüssigkeits-Reservoir mit einem kleinen und definierten Volumen über Gewebeschnitten zur Verfügung. Typischerweise arbeitet man hier entweder mit FFPE-Gewebe oder mit Kryo-Verfahren. Beim gängigen FFPE-Verfahren wird das Gewebe zur Konservierung und Stabilisierung in Paraffin eingebettet und in Formalin fixiert. So kann das Gewebe zunächst gelagert und später beispielsweise mit einem Mikrotom zu mikroskopischen Schnittpräparaten weiterverarbeitet werden. Alternativ dazu kommt das Gewebe in einen Kryostaten, und anschliessend werden Gefrierschnitte durchgeführt; dieses Verfahren wird zum Beispiel auch zur
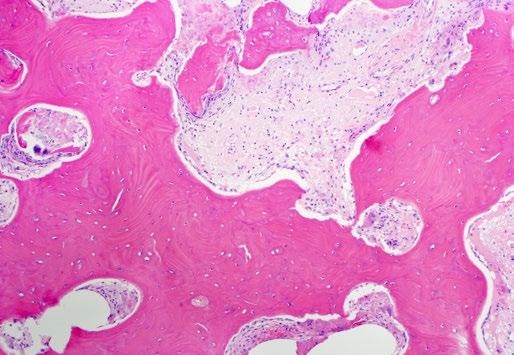
Die breit genutzte Hämatoxylin-Eosin-Färbung lässt sich zur Unterscheidung verschiedener Gewebestrukturen unter dem Lichtmikroskop verwenden (hier: normale Kopfhaut und Paget-Krankheit des Knochens) und lässt beispielsweise in der Pathologie krankhafte Veränderungen erkennen. (Bilder: Envato)


Um Objekte unter dem Mikroskop beurteilen zu können, ist der richtige Objektträger eine entscheidende Komponente – besonders wenn es sich um Gewebeschnitte handelt. (Bild: Adpic)
Beurteilung von Geweben bei laufenden Operationen eingesetzt.
Dies ermöglicht einen einfachen und definierten Austausch von Flüssigkeiten und
Grenze möglich. Nach dieser liegt beispielsweise die maximale Auflösung des Lichtmikroskops bei etwa 0,3 Mikrometern. Diese Grenze lässt sich heute jedoch überschreiten. Für die Mikroskopie von Gewebeschnitten kommen dabei ein klassischer Objektträger, ein Objektträger mit selbstklebender Unterseite und ein Deckglas zum Einsatz 1
Quellen
1 https://ibidi.com/content/1056-ibidi-ress-releases, Pressemeldung der Ibidi GmbH vom 18.2.2025, Zugriff am 19.2.2025
2 https://www.charite.de/die_charite/presse, Pressemeldung der Charité – Universitätsmedi

8–15 OCTOBER 2025
The World’s No. 1 Trade Fair for Plastics and Rubber Düsseldorf, Germany k-online.de/besuch
Forschende der Universität Bern und des Inselspitals, Universitätsspital Bern, haben einen Test entwickelt, der die Diagnose von Allergien vereinfachen soll. Dessen Wirksamkeit wurde jetzt mit klinischen Proben von Kindern und Jugendlichen, die an einer Erdnussallergie leiden, bestätigt.
Nahrungsmittelallergien stellen weltweit ein bedeutendes Gesundheitsproblem dar. In einigen Ländern sind bis zu 10 Prozent der Bevölkerung betroffen, in erster Linie Kleinkinder. Insbesondere die Erdnussallergie gehört zu den häufigsten Erkrankungen und äussert sich oft in schweren, potenziell lebensbedrohlichen Reaktionen. Die Belastung durch Nahrungsmittelallergien wirkt sich nicht nur auf die betroffenen Personen aus, sondern hat auch weitreichende Auswirkungen auf deren Familien, das Gesundheitssystem und die Lebensmittelindustrie. Der orale Provokationstest, bei dem die Betroffenen das Allergen (z. B. Erdnussextrakt) unter Aufsicht einnehmen, um die allergische Reaktion zu testen, gilt nach wie vor als der Goldstandard in der Diagnostik. Die Methode ist jedoch aufwändig
und birgt gesundheitliche Risiken. Auch der Allergen Prick Hauttest und der Bluttest sind oftmals nicht sehr genau, was zu Fehldiagnosen und unnötiger Nahrungsmittelvermeidung führen kann. Forschende der Universität Bern und des Inselspitals, Universitätsspital Bern, haben 2022 einen alternativen Test entwickelt. Dieser ahmt die allergische Reaktion im Reagenzglas nach und bietet somit eine attraktive Alternative zu gängigen Tests. In einer klinischen Studie haben die Berner in Zusammenarbeit mit Partnern vom Hospital for Sick Kids in Toronto, Kanada, jetzt die Wirksamkeit des Tests an Proben von Kindern und Jugendlichen mit bestätigter Erdnuss Allergie und einer gesunden Kontrollgruppe geprüft. Sie konnten zeigen, dass der neue Test eine höhere diagnostische Genauigkeit hat als die

Erdnussallergien gehören zu den häufigsten Nahrungsmittelallergien weltweit. In erster Linie sind Kleinkinder davon betroffen. (Bild: Envato)

bisher verwendeten Methoden. Die Studie wurde jüngst im European Journal for Allergy and Clinical Immunology (Allergy) publiziert.
«Die häufigsten Nahrungsmittelallergien gehören zu den Typ I Allergien. Sie entstehen, wenn der Körper als Reaktion auf eigentlich harmlose Stoffe (Allergene), Antikörper der Klasse Immunglobulin E (IgE) bildet», erklärt Prof. Alexander Eggel vom Department for Biomedical Research der Universität Bern und der Universitätsklinik für Rheumatologie und Immunologie, Inselspital, Universitätsspital Bern. Diese Antikörper binden an spezifische Rezeptoren auf den sogenannten Mastzellen. Dabei handelt es sich um spezialisierte Zellen des Immunsystems, die eine wichtige Rolle bei allergischen Reaktionen und Entzündungen spielen. Sie befinden sich hauptsächlich im Gewebe, etwa in der Darmschleimhaut, und werden durch die Bindung der Antikörper auf das Allergen vorbereitet und sensibilisiert. Bei erneutem Kontakt mit dem Allergen bindet dieses direkt an die mit Antikörpern beladenen Mastzellen, wodurch diese aktiviert werden und eine allergische Reaktion auslösen.
«Bei dem von uns entwickelten Hoxb8Mastzellaktivierungstest (Hoxb8 MAT), werden im Labor gezüchtete Mastzellen mit Blutserum von Allergikerinnen und Allergikern in Kontakt gebracht. Die Mastzellen binden die IgE Antikörper aus dem Serum und werden dadurch sensibilisiert. Anschliessend können wir die Mastzellen mit verschiedenen Mengen der zu testenden Allergene stimulieren», so Eggel. Die Quantifizierung der aktivierten Mastzellen lässt darauf schliessen, wie allergisch ein
Zertifizierung des Tests durch Spin-off
Die beteiligten Forschenden der Universität Bern haben die Technologie und Methodik des «HoxB8 MAT» patentieren lassen und ein Spin off gegründet. Die in Bern ansässige Atanis Biotech AG – ausgezeichnet mit dem Stage Up Award 2022 – will jetzt den Allergietest zertifizieren und weltweit auf den Markt bringen. Das weitere Ziel des Unternehmens, das mittlerweile über 20 Angestellte beschäftigt: Die Allergiediagnostik zu revolutionieren.
www.atanis-biotech.com
Patient oder eine Patientin auf das getestete Allergen ist, ohne dass er oder sie das Nahrungsmittel einnehmen muss.
Höhere diagnostische Genauigkeit als gängige Tests
Für die Studie wurden Serumproben von insgesamt 112 Kindern und Jugendlichen verwendet, die bereits an einer Studie in Kanada teilgenommen hatten und für die eindeutige diagnostische Daten über ihren Erdnussallergiestatus vorlagen. Die im Labor gezüchteten Mastzellen wurden mit deren Serum sensibilisiert und anschliessend mit Erdnussextrakt stimuliert. «Der zellbasierte Test war einfach durchzuführen und hat einwandfrei funktioniert. Innert zwei Tagen waren alle Proben gemessen, was sehr schnell war», sagt Thomas

«Der Test basiert auf stabilem Blutserum, das mittels einfacher Blutentnahme abgenommen und anschliessend im Gefrierschrank aufbewahrt werden kann. Dadurch fallen herausfordernde logistische Hürden, wie sie bei anderen Methoden auftreten, weg.» Assoz. Prof. Dr. Thomas Kaufmann, Universität Bern
Kaufmann. Die Ergebnisse zeigten, dass sehr viele Seren der Allergiker und Allergikerinnen eine allergendosis abhängige Aktivierung aufwiesen, während fast alle Proben der nicht allergischen Kontrollen die Mastzellen nicht aktivierten. «Aus diesen Daten konnte eine aussergewöhnlich hohe diagnostische Genauigkeit von 95 Prozent berechnet werden», ergänzt Eggel. Zudem wurden die in der Studie gemessenen Daten im direkten Vergleich mit anderen, in der Klinik etablierten, diagnostischen Methoden analysiert. Dabei stellte sich heraus, dass der neue Test eine merklich höhere Genauigkeit aufwies als die gängige Messung von allergen spezifischen IgE Antikörpern im Blut oder der oft angewandte Hauttest. «Der Quervergleich mit anderen klinischen Tests war enorm wichtig, um herauszufinden welcher von diesen die allergische Reaktion der Betroffenen am verlässlichsten abbildet. Der Mastzellaktivierungstest hat den Vorteil, dass er funktionell ist und dadurch viele Parameter, die für die Auslösung der Allergie wichtig sind, mit einbezieht», sagt Thomas Kaufmann und fügt an: «Der neue Test basiert zudem auf stabilem Blutserum, das mittels einfacher Blutentnahme abgenommen und anschliessend im Gefrierschrank aufbewahrt werden kann. Dadurch fallen herausfordernde logistische Hürden, wie sie bei anderen Methoden auftreten, weg.» Die Studie konnte zudem zeigen, dass der Hoxb8 MATTest zu weniger falsch negativen Resultaten führt. «Was in dieser Studie für die Diagnose von Erdnuss Allergien gezeigt wurde, kann auf einfache Art und Weise auch auf andere Allergien angewandt werden», schliesst Eggel.
www.unibe.ch
www.insel.ch









Mit FAULHABER



Antriebssystemen für die Laborautomation setzen
Analyselabore in der In-vitroDiagnostik neue Massstäbe für Prozesssicherheit und Effizienz bei der Probenverarbeitung.

www.faulhaber.com/laborautomation



































Antibiotika sind unverzichtbar bei der Behandlung bakterieller Infektionen. Doch warum sind sie manchmal unwirksam, selbst wenn die Bakterien nicht resistent sind? In einer Studie widerlegen Forschende an der Universität Basel das gängige Konzept, dass nur einzelne besonders widerstandfähige Bakterien für das Scheitern von Antibiotika-Therapien verantwortlich sind.
Bei einigen bakteriellen Erkrankungen wirken Antibiotika nicht so gut wie erhofft. Ein Beispiel sind Infektionen mit Salmonellen, die Krankheiten wie Typhus verursachen. Das Hauptproblem, so nahm man lange Zeit an, sind einige wenige Bakterien, die sich in einem schlafähnlichen Zustand befinden. Diese sogenannten «Persister» sind zwar nicht resistent im klassischen Sinne, können aber die Behandlung mit Antibiotika überleben und später Rückfälle verursachen. Forschende weltweit arbeiten daher an neuen Therapieansätzen, die gezielt diese «Schläfer» angreifen und eliminieren sollen.
Das Team um Prof. Dr. Dirk Bumann vom Biozentrum der Universität Basel hinterfragt in einer neuen Studie nun diese Erklärung für unwirksame Therapien. «Entgegen der weit verbreiteten Auffassung ist nicht eine kleine Gruppe von Persistern für das Scheitern von Antibiotika-Behandlungen verantwortlich. Vielmehr sind nahezu alle Salmonellen im infizierten Gewebe nur schwer und langsam abzutöten», erklärt Bumann. «Wir konnten zeigen, dass die üblichen Labortests irreführende Ergebnisse liefern und somit ein falsches Bild von einzelnen widerstandsfähigen Persistern vermitteln.»
Nährstoffmangel macht
Salmonellen widerstandsfähiger
In ihrer Studie untersuchten die Forschenden die Antibiotika-Wirkung sowohl in Mäusen, die mit Salmonellen infiziert waren, als auch in Labormodellen, welche die Bedingungen im Körper simulieren. Der


Körper verringert zur Abwehr von Bakterien zum Beispiel die Verfügbarkeit von Nährstoffen. Wie die Forschenden nun herausfanden, ist ausgerechnet dieser Nährstoffmangel der entscheidende Faktor für die begrenzte Wirksamkeit von Antibiotika gegen Salmonellen. Vermutlich trifft dies auch für andere bakterielle Krankheitserreger zu.
«Bei einem Mangel an Nährstoffen wachsen die Bakterien nur langsam», sagt Bumann. «Das klingt zwar gut, ist aber ein Problem, da die meisten Antibiotika langsam wachsende Bakterien auch nur langsam abtöten.» Weil die Medikamente deutlich schlechter wirken, kann es selbst nach längerer Therapie zu Rückfällen kommen.
decken Fehlannahme auf
Die Entdeckung machten die Forschenden dank einer Methode, mit der sich die Wirkung der Antibiotika auf einzelne Bakterien
live und direkt verfolgen lässt. «So konnten wir nachweisen, dass fast die gesamte Salmonellen-Population eine AntibiotikaTherapie für längere Zeit übersteht und nicht nur einige wenige widerstandsfähige Persister», sagt Dr. Joseph Fanous, Erstautor der Studie.
Das Problem der seit Jahrzehnten weltweit verwendeten Standardtests ist, dass sie das Überleben der Bakterien nur indirekt und verzögert messen. Dies führt zu verzerrten Resultaten. «Die herkömmlichen Tests unterschätzen die tatsächliche Zahl der überlebenden Bakterien», so Fanous. «Und sie suggerieren fälschlicherweise eine kleine Gruppe von widerstandsfähigen Persistern, die in der Realität so nicht existiert.» Diese Fehleinschätzung hat die Forschung über viele Jahre hinweg beeinflusst.
Diese Erkenntnisse könnten die Antibiotika-Forschung grundlegend verändern. «Unsere Arbeit zeigt, wie wichtig es ist, das Verhalten von Bakterien und die Wirkung von Antibiotika unter realistischen Bedingungen live zu untersuchen», unterstreicht Bumann. «In einigen Jahren sind moderne Methoden wie die EinzelzellAnalyse in Echtzeit hoffentlich Standard.» Dass sich der Fokus von den Persistern auf das Problem des Nährstoffmangels verschiebt, ist ein wichtiger Schritt hin zu wirksameren Therapien gegen hartnäckige, schwer zu behandelnde Infektionen. Die in der Fachzeitschrift Nature publizierte Forschungsarbeit entstand im Rahmen des Nationalen Forschungsschwerpunktes «AntiResist».
www.unibas.ch www.nccr-antiresist.ch
Bei der Analyse von Geruchsstoffen in Lebensmitteln oder deren Rohstoffen kann die Bildung von Artefakten die Ergebnisse erheblich verfälschen. Am Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie der Technischen Universität München wurde jetzt in einer Vergleichsstudie gezeigt, dass die Wahl der Injektionsmethode bei der gaschromatografischen Geruchsstoffanalyse die Artefaktbildung entscheidend beeinflusst.
Geruchsstoffe sind flüchtige Verbindungen, die in Lebensmitteln wesentlich zu deren sensorischer Wahrnehmung beitragen und daher die Kaufentscheidung der Konsumentinnen und Konsumenten massgeblich beeinflussen. Ihre Analyse ist jedoch eine herausfordernde Aufgabe. In der Wissenschaft und Forschung hat sich die Gaschromatografie-Olfaktometrie als unverzichtbare Methode etabliert, um geruchsaktive Verbindungen zu identifizieren und sie von der Mehrzahl der geruchlosen flüchtigen Substanzen zu unterscheiden. Bei dieser Methode isolieren Forschende zunächst die flüchtigen Bestandteile möglichst schonend aus dem Lebensmittel. Anschliessend trennen sie die einzelnen Verbindungen mithilfe eines Gaschromatografen auf und erschnuppern am Ende der Trennstrecke, welche Verbindungen riechen und welche nicht.
Generell können Artefakte sowohl bei der Isolierung als auch bei der Analyse flüchtiger Verbindungen entstehen. « Die Artefaktbildung während der Probenaufbereitung ist gut erforscht und lässt sich heute weitgehend minimieren. Hier hat sich die automatisierte Solvent-Assisted Flavor Evaporation bewährt, an deren Entwicklung unsere Gruppe massgeblich beteiligt war», erklärt Studienleiter Martin Steinhaus (siehe Kas-


Gaschromatografie-Olfaktometrie: Identifizierung geruchsaktiver Verbindungen mit Hilfe eines Gaschromatografen. (Bild: Martin Steinhaus)
ten) und fügt hinzu: «Die Artefaktbildung während der Probeninjektion hat man jedoch bislang weitgehend unterschätzt, auch weil aussagekräftige Vergleichsdaten fehlten.»
Julian Reinhardt, Erstautor der Studie, hat daher 10 verschiedene Injektionsmethoden anhand von 14 Testverbindungen überprüft. Wie die Untersuchungen des Doktoranden zeigen, führten vor allem hohe Injektionstemperaturen zu geruchsaktiven Artefakten und haben damit das Potenzial, Geruchsstoffanalysen erheblich zu verfälschen.
«Die On-Column-Injektion erwies sich als besonders zuverlässig, da die Probe so kei-
BSL-4 Anforderungen? Kein Problem!
Die anderen Levels haben wir natürlich auch im Griff!
Fragen?
Wir stehen Ihnen gerne mit Rat & Tat zur Seite

nen hohen Temperaturen ausgesetzt ist», berichtet Martin Steinhaus, der am LeibnizInstitut die Forschungsgruppe Food Metabolome Chemistry leitet. «Im Gegensatz dazu zeigte die Splitless-Injektion bei hohen Temperaturen eine signifikante Artefaktbildung, besonders in Verbindung mit der Headspace-Festphasenmikroextraktion», so der Lebensmittelchemiker weiter. Um ein verlässliches und repräsentatives Geruchsstoffspektrum eines Lebensmittels zu erstellen, empfiehlt er auf jeden Fall die On-Column-Injektion zu verwenden. Die Studie erschien in der Fachzeitschrift Journal of Chromatography A.
www.leibniz-lsb.de


Vom leichten Wein bis zum kräftigen Cru wie zum Beispiel jener der Appellation Dézaley: Mit der Chasselas-Traube lassen sich vielfältige Weine herstellen. (Bild: Carole Parodi, Agroscope)
Eine Studie von Agroscope hat die Appellation Dézaley untersucht und die Chasselas-Weine der Jahrgänge 2009 und 2022 verglichen. Vier Weingüter wurden aufgrund ihrer Qualität und der Verfügbarkeit gealterter Weine ausgewählt, um die Unterschiede zwischen jungen und gereiften Weinen sowie den Einfluss von Jahrgang und Weingut zu analysieren.
Pascal Fuchsmann, Simon Wacker, Lucie K. Tintrop, Ágnes Dienes Nagy, Marie Blackford ¹ Pascale Deneulin 2
Chasselas ist eine elegante Rebsorte, bekannt für ihre Subtilität und ihr aussergewöhnliches Potenzial, Terroir-Nuancen einzufangen. Typischerweise jung getrunken, wird sie für ihren geringen Säuregehalt sowie ihre zarten fruchtigen und blumigen Aromen geschätzt. Unter bestimmten Bedingungen, etwa in Dézaley, kann sie jedoch komplexere Weine mit Noten von
1 Agroscope
2 Changins Hochschule für Weinbau und Önologie

Trockenfrüchten und Honig hervorbringen (Chevalley, 2018).
Material und Methoden
Für die Studie wurden acht ChasselasWeine aus Dézaley (Lavaux, VD) von vier Weingütern – A, B, C und D – untersucht. Jedes Weingut lieferte je einen Wein aus den Jahrgängen 2009 und 2022. Die Region zeichnet sich durch kalk- und tonreiche Moränenböden sowie hohe Sonneneinstrahlung aus. Alle Weine wurden ohne Kaltmazeration vinifiziert, und ein Weingut wechselte beim Jahrgang 2022 von Korken auf Schraubverschluss.
Ein sensorisches Panel aus 11 geschulten Expertinnen und Experten führte eine deskriptive Analyse anhand von 27 Merkmalen durch. Ergänzend wurden die Weine
mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie zur Identifikation flüchtiger Verbindungen sowie Olfaktometrie mit acht Prüferinnen und Prüfern zur Bestimmung aromawirksamer Verbindungen analysiert.
Die Weine des Jahrgangs 2009 zeigen eine intensivere Farbe mit Orangetönen, bedingt durch die Oxidation von Polyphenolen über den Korken (Monforte et al., 2021). Flaschen mit Schraubverschluss sind davon weniger betroffen. Aromatisch dominieren kandierte Früchte, Nüsse, Honig sowie Noten von Pilzen und Milchprodukten. Zudem wirken sie leicht oxidiert, mit höherem Alkoholgehalt und mehr Volumen am Gaumen.
Im Vergleich dazu haben die 2022er Weine eine blassere, grau-gelbe Farbe und Aromen von frischen Früchten, Lindenblüten und intensiver Mineralität. Sie wirken am Gaumen frischer mit stärkerem Prickeln. Die sensorischen Unterschiede zwischen den Jahrgängen variieren je nach Weingut: Während die 2009er Weine von A eine ausgeprägte sensorische Entwicklung mit oxidativem Charakter zeigen, sind die Unterschiede bei B und C geringer.
Flüchtige Verbindungen und Olfaktometrie
Die Analyse der flüchtigen Verbindungen durch Gaschromatographie gekoppelt mit Massenspektrometrie ergab klare Unterschiede zwischen den Jahrgängen 2009 und 2022. Die Tabelle der flüchtigen Verbindungen zeigt einige wichtige Punkte auf: 3-Ethoxy-1-propanol: In den Weinen des Jahrgangs 2022 in hohen, im Jahrgang 2009 nur in geringen Konzentrationen vorhanden. Dies deutet auf seinen Abbau während der Alterung hin (Roca et al., 2019). Diese flüchtige Verbindung hat selbst keine aromawirksamen Eigenschaften, kann jedoch zur Charakterisierung junger Chasselas-Weine genutzt werden. Sie kann mit Carbonsäuren fruchtige Ester oder mit Milchsäure cremige Noten bilden. Furfural: In hoher Konzentration in den 2009er Weinen. Furfural ist ein Indikator für Alterung und Oxidation und wird mit Aromen von Nüssen und Karamell assoziiert (Dumitriu Gabur et al., 2019; Cutzach et al., 1999).
Ethyl-2-hydroxy-4-methylvalerat: In den Weinen des Jahrgangs 2009 in hoher Konzentration enthalten. Diese Verbindung wird mit dem Aroma frischer Brombeeren assoziiert und ist ein guter Indikator für die Alterung (Lytra et al., 2012).
Isopentylacetat: Diese Verbindung, die vor allem in den Weinen des Jahrgangs 2022 vorkommt und ein Aroma nach Banane verleiht, ist in den Weinen des Jahrgangs 2009 fast vollständig verschwunden, was auf einen Abbau im Laufe der Zeit hindeutet (Zhang et al., 2023).
Phenylethylalkohol: Höhere Konzentration in den Weinen des Jahrgangs 2022, deutlicher Rückgang bei den Weinen des Jahrgangs 2009. Diese Verbindung, die mit Rosenaromen assoziiert wird, verschwindet tendenziell bei der Alterung.

Ausgewählte flüchtige Verbindungen, die sich zwischen den Jahrgängen und Weingütern signifikant unterscheiden. (Tabelle: Agroscope)
Carbonsäuren (Buttersäure, Hexansäure und Octansäure): Ihre Konzentrationen variieren je nach Weingut und Jahrgang, sind jedoch in den 2022er Weinen tendenziell höher, insbesondere bei B und C. Diese Säuren entstehen während der Alterung und tragen zu komplexen, säuerlichen Nuancen bei. Durch die/eine Reaktion mit Alkoholen können sie Ester bilden, die fruchtige Noten wie rote Früchte oder Banane verleihen (Prusova et al., 2022).
Die Unterschiede zwischen den Weingütern zeigen, dass die Weinbereitungspraktiken die Konzentration flüchtiger Verbindungen in Chasselas-Weinen erheblich beeinflussen. Während B und C in gealterten Weinen eine Anreicherung bestimmter Verbindungen aufwiesen, zeigte sich bei A und D ein gegensätzlicher Trend, insbesondere bei bestimmten Säuren. Die olfaktometrische Analyse nach Fuchsmann et al. (2015) bestätigte diese Unterschiede: Furfural erwies sich als Marker für die Alterung, während Isopentylacetat fruchtige Noten in jüngeren Weinen vermittelte. 2,3-Butandion (buttrige Note) und Ethylhexanoat (Apfelschalenaroma) waren in jüngeren Jahrgängen intensiver. Ähnliche Alterungsmuster wurden bei Chardonnay beobachtet, wobei Furfural und 2,3-Butandion ebenfalls als Marker
dienten. Die Konzentration von 2,3-Butandion, das während der malolaktischen Gärung entsteht (Virdis et al., 2020), erreicht in jungen Weinen ein Maximum und nimmt mit dem Alter ab. Zudem beeinflussen die Weinbereitungsprozesse und die Verschlussmethode massgeblich die Entwicklung der Weintypizität.
Die Analyse der flüchtigen Verbindungen und sensorischen Profile von ChasselasWeinen aus Dézaley zeigt den Einfluss des Jahrgangs auf die Weincharakteristik. Die Unterschiede zwischen 2009 und 2022 sind deutlich und werden durch Alterung und Weinbereitung geprägt. Furfural und Isopentylacetat erweisen sich als gute Altersmarker.
Eine Ausweitung der Studie auf weitere Rebsorten könnte helfen, die Spezifität dieser Verbindungen besser zu verstehen. Die Ergebnisse vertiefen das Verständnis der Alterungsprozesse und bieten Ansätze zur Optimierung der Vinifikation. Die positive sensorische Bewertung gealterter Chasselas-Weine unterstreicht ihr grosses Potenzial.
www.agroscope.admin.ch

Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence, AI) ist weder künstlich noch intelligent, aber ungemein nützlich in der Wirkstoffentwicklung, in der Materialforschung und vor allem bei der Auswertung unterschiedlichster Bildinformationen. Wie sich diese Chancen in den betrieblichen Alltag eines Chemie-, Pharma- oder Biotech-Unternehmens umsetzen lassen, zeigt die Ilmac 2025 in Basel.
Künstliche Intelligenz stellt bei der Auswertung von Röntgen- und MRT-Aufnahmen (z.B. Mammographie), Infrarot- und Massenspektren eine effektive Unterstützung für den Arzt oder Chemiker dar. Damit lassen sich Krebs und andere Erkrankungen schneller erkennen und mit höherer Erfolgswahrscheinlichkeit behandeln. Ebenso beschleunigt sich der Weg vom Analyseergebnis in Rohdaten bis zur Auswertung. Selbst unbekannte Substanzen lassen sich mit AI-Unterstützung identifizieren. Ein weiteres typisches Einsatzgebiet betrifft die Wirkstoffforschung: Ausgehend von bekannten Substanzen schlägt AI aussichtsreiche Kandidaten vor. Diese können zum Beispiel wirksamer, verträglicher oder komfortabler applizierbar sein. Analog dazu lassen sich in der Materialforschung Werkstoffe mit Wunscheigenschaften in silico kreieren. Dabei kann es sich zum Beispiel um 3D-druckbare Kunststoffe mit bestimmten Festigkeiten und Farben handeln.
Ausserdem kann AI sich bei der Kontrolle von Chemie-, Pharma- und Biotech-Prozessen nützlich machen. Denn beispiels-

Die Chancen von künstlicher Intelligenz im Zusammenspiel mit Automatisierung und Digitalisierung für die betriebliche Praxis sind enorm – und präsent an der Ilmac in Basel. (Bilder: Shutterstock)
weise weisen Temperatur- und Druckverläufe über bestimmte Zeiträume gewisse Charakteristiken auf. Künstliche Intelligenz kann solche Muster prüfen: Bewegt sich der Prozess in ruhigem Fahrwasser, oder kommt es zu Anomalien? Im letzteren Falle ist womöglich ein Eingreifen notwendig. Hier zahlt sich ein hoher Automatisierungs- und Digitalisierungsgrad mehrfach aus. Denn die AI benötigt als Input viele Messwerte in Form digitaler Daten. Das
Erfahren Sie mehr über Ihr Einsparpotential. Wir zeigen Ihnen gerne persönlich unsere neuen individuellen Lösungen.
Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.
info@buschag.ch I www.buschvacuum.com

ZU
können Temperaturen, Drücke, Färbungen von Flüssigkeiten, Vibrationen von Kompressoren, Axialbeschleunigungsmessungen von Motoren und vieles mehr sein. Über diese sensorischen Informationen lässt sich mit AI-Unterstützung eine energetisch günstige Feinsteuerung und eine vorausschauende Wartung realisieren. Allerdings ist AI in der Regel kein «Plugand-play-Werkzeug». Das dafür notwendige Datenerfassungssystem schliesst Ma -
Flex Vac Pro und Nährkartonscheiben das perfekte Duo für mikrobiologische Analysen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie!



... und in der chemischen Analytik (z.B. Massenspektrometrie), ... ... bei der Werkstoffentwicklung (z.B. für den 3-D-Druck) und der Prozesskontrolle.
schinen mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) und daran angeschlossene Sensoren ein. Dazu kommt ein Gateway, d.h. ein Netzwerkknoten für die Datenübertragung, und ein temporärer Speicher zum Datenschnellabruf (Cache). Darüber hinaus muss die Datensicherheit gewährleistet werden, insbesondere bei Internetanbindung zur Nutzung von IoTTools («Internet of Things»).
In allen Anwendungen ist Künstliche Intelligenz nicht künstlich, weil an erster Stelle ein Training durch Menschen steht. Der Arzt teilt der künstlichen Intelligenz mit, ob er auf einem Röntgenbild einen Tumor erkennt; der Analytiker sagt, ob im IR-Spektrum die CO2-Bande sichtbar ist; Wirkstoffund Materialentwickler geben erfolgreiche Medikamente bzw. Werkstoffe als Trainings-Input. Die mit vielen Röntgenaufnahmen, Wirkstoffen, Werkstoffen oder Spektren gefütterte AI erledigt anschliessend viele Aufgaben zuverlässiger als der Mensch. Das birgt für den Einsatz von AI
in der betrieblichen Praxis enorme Chancen, insbesondere im Zusammenspiel mit Automatisierung und Digitalisierung. Greifbar werden sie in ihrer ganzen Bandbreite auf der diesjährigen Ilmac Basel. Vertieft wird dieses Thema an der Conference am 16.09.2025 und bei der Future of Life Sciences-Area.
Ilmac Basel 2025
Datum: 16. bis 18. September 2025
(Dienstag bis Donnerstag)
Öffnungszeiten: 9 bis 17 Uhr
Special Event: Ilmac Party am 16. September ab 17 Uhr in Halle 2.0 (Details auf www.ilmac.ch)
Ort: Messe Basel, Halle 1.0
Veranstalterin: MCH Messe Schweiz (Basel) AG info@ilmac.ch www.ilmac.ch
Mit der Flex Vac Pro von Sebio lassen sich Serienfiltrationen einfach und schnell durchführen.

Technische Daten
– Standardversionen als 1er, 3er, 6er oder 10er Station –
Trichtergrössen 100, 250 oder 500ml – Stützsieb in 25mm oder Stahlfritte in 50mm Durchmesser
– Variation der Systeme kenn praktisch keine Grenzen

Die Nährkartonscheiben von Möller & Schmelz sind sterile Trockennährboden, die nach Befeuchten mit sterilem Wasser sofort einsetzbar sind. Vorteile gegenüber herkömmlichen Agarnährböden sind die Lagerung bei Rautemperatur, die Haltbarkeit von bis zu 2 Jahren und dass der Membranfilter dazu geliefert wird.

Ihr Partner in der Schweiz: info@sebio.ch/www.sebio.ch


UPM Biochemicals nutzt ein einzigartiges Verfahren zur Herstellung von Biochemikalien aus nachhaltig erwirtschaftetem Laubholz. Für die neuartige Bioraffinerie liefert Bilfinger eine zugeschnittene Full-Service-Instandhaltung zur Steigerung der Anlageneffizienz auf Basis eines 6-Jahres-Rahmenvertrages.
Am Standort Leuna (D) wird die weltweit erste Bioraffinerie zur Herstellung von Biochemikalien auf Basis von Laubholz errichtet. Die Anlage folgt einem einzigartigen Verfahren, das besondere Anforderungen an die Instandhaltung stellt. Als Lösungspartner für die Wartung aller beteiligten Gewerke sorgt Bilfinger für den langfristig effizienten Betrieb der Raffinerie. Diese wird jährlich rund 220 000 Tonnen Grundchemikalien produzieren, um damit nachhaltigere Ausgangsmaterialien für die weitere Verarbeitung zu unterschiedlichen Verbraucheranwendungen bereitzustellen.
Die 1180 Millionen Euro teure Bioraffinerie im industriellen Massstab ist eine Weltneuheit. Als Ausgangsmaterial kommt zertifiziertes Buchenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, insbesondere regional aus Sachsen-Anhalt und den angrenzenden Bundesländern zum Einsatz. Die holzige Biomasse wird im Rahmen der Waldbe -

wirtschaftung aus mitteleuropäischen Buchenwäldern geerntet und verwertet, in denen die biologische Vielfalt und die natürlichen Ökosysteme erhalten werden. Sie ist vollständig rückverfolgbar, wird kontrolliert und unterliegt entweder dem FSCoder PEFC-Kontrollsystem.
Basismaterialien
Die Buche gilt als klimastabile Baumart, deren Bestand in deutschen Wäldern in den kommenden Jahrzehnten weiterwachsen wird. Das macht ihr Holz zu einem zukunftsfähigen Rohstoff für UPM. Als Durchforstungsholz, Industrieholz und Sägereste, die üblicherweise als Brennholz weitervertrieben werden, gelangt es über eine regionale Logistikkette nach Leuna. Dort werden aus der Biomasse unter anderem mithilfe der Hydrolyse Biochemikalien gewonnen. Das Ergebnis sind Bio-Monoethylenglykol (BioMEG) als
Basismaterial für zum Beispiel PET-Flaschen, Bio-Monopropylenglykol (BioMPG) zur Herstellung von zum Beispiel Waschmittel und erneuerbare funktionale Füllstoffe (Renewable Functional Fillers, kurz: RFF) als nachhaltige Alternative zu Russ und gefällter Kieselsäure.
«Die Bioraffinerie von UPM spielt eine Schlüsselrolle bei der Transformation der chemischen Wertschöpfungskette hin zur Kreislaufwirtschaft.»
Thomas Schulz, Vorstandsvorsitzender von Bilfinger
«Die Bioraffinerie von UPM spielt eine Schlüsselrolle bei der Transformation der chemischen Wertschöpfungskette hin zur

Wertschöpfungsketten der neuen Bioraffinerie in Leuna (D). (Grafik: UPM)
Kreislaufwirtschaft», sagte Thomas Schulz, Vorstandsvorsitzender von Bilfinger. Sein Unternehmen erbringt alle beauftragten Instandhaltungsleistungen aus einer Hand – von der Anlagen-, Maschinen- und Elektrotechnik bis hin zur Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik sowie Analy -












sentechnik. Dabei profitiert UPM von der über viele Jahre gebündelten Erfahrung des Industriedienstleisters. Was die Steigerung von Effizienz und Nachhaltigkeit betrifft, engagiert sich Bilfinger als Lösungspartner für zukunftsweisende Ansätze wie den von UPM. So beispielsweise auch für



Biochemikalien-Hersteller Metsä Fibre und für Circtec, deren Technologie Altreifen in Biokraftstoffe verwandelt.
www.bilfinger.com www.upmbiochemicals.com














Integrated Systems for Polymer Processing




































Die MAAG Group ist Partner der kunststoffverarbeitenden Industrie weltweit. Unsere integrierten Lösungen für Pumpen- und Filtrationssysteme sowie Pelletizing-, Pulvermühlen- und Recyclingsysteme zeichnen sich durch hervorragende Leistungen für anspruchsvolle Kundenanforderungen aus.












Aufwändige Prozesse unter Containment-Bedingungen sind durch Kostendruck, Fachkräftemangel und zusätzliche Sicherheitsanforderungen mit wachsenden Herausforderungen verbunden. Die Zukunft repetitiver Prozesse unter Containment-Bedingungen liegt daher in der Laborautomatisierung.
Nicht zuletzt durch die Neufassung des Annex 1 der EU-GMP sind die Auflagen an Hersteller und Forschungseinrichtungen weiter gestiegen. Ausdrücklich werden nun Robotersysteme zur Einhaltung der Hygienevorgaben genannt. Dabei spielt der Aspekt des Containments eine ausserordentlich wichtige Rolle, um den Schutz des Produktes sicherzustellen. Nach der im neuen Annex 1 genannten Contamination Control Strategy (CCS) müssen Hersteller Risiken in ihren Prozessen und Verfahren identifizieren und bewerten, Möglichkeiten zur Risikominimierung prüfen und vorbeugende Massnahmen festlegen. Die CCS erstreckt sich u. a. auf das Design von Anlagen und Prozessen, die Räumlichkeiten und die Ausstattung. Im Mittelpunkt stehen die Risiken durch: – mikrobielle Kontamination – Kontamination durch pyrogene oder endotoxine Partikel – partikuläre Kontamination
Mit Robotik neuen
Herausforderungen begegnen
Die Risiken beim Umgang mit gefährlichen Substanzen sind vielfältig und von vielen Faktoren abhängig. Fehler können verheerende Folgen haben. Aber auch wirtschaftliche Aspekte müssen berücksichtigt werden, um im Markt handlungsfähig zu bleiben.
Faktor Mensch: Der zunehmende Fachkräftemangel wirkt sich auch auf das Angebot geschulter und geeigneter Mitarbeitenden aus. Darüber hinaus sind viele Aufgaben im Labor repetitiv und binden wertvolle Arbeitskräfte an zeitaufwändige Standardtätigkeiten. Mit der Robotik werden Aufgaben autonom durchgeführt und Mitarbeitende für komplexere und kreativere Tätigkeiten freigesetzt.
Faktor Produktivität: Automatisierte Systeme können rund um die Uhr arbeiten. So


Der in der Sicherheitswerkbank integrierte Roboter entnimmt die Vials aus einem Magazin, übergibt sie an eine Füllstation zur Dosierung der Injektionslösung mit gravimetrischer Überwachung der Füllmengen, setzt die Stopfen ein und verschliesst die Vials. Ein intuitiv bedienbares Display ermöglicht die Konfiguration von Parametern für verschiedene Flaschengrössen, Füllmengen und Chargengrössen (Bilder: Goldfuss Engineering).
lässt sich die Ausbeute ohne zusätzliche Arbeitskräfte oder Produktionseinrichtungen durch Verlängerung der Betriebszeiten steigern. Das kann auch die Zeit bis zur Markteinführung neuer biotechnologischer oder pharmazeutischer Produkte verkürzen. Neue Entwicklungen erreichen früher die Marktreife und sichern die damit verbundenen Wettbewerbsvorteile.
Faktor Konsistenz: Die Präzision der Robotik in der Laborautomatisierung ermöglicht es, Experimente mit einer Konsistenz durchzuführen, die manuell kaum zu erreichen wäre. Dies verbessert die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse und trägt zur Validität wissenschaftlicher Studien bei. Für die Produktion bedeutet es die zuverlässige Einhaltung vorgegebener Standards.
Die Automatisierung bietet in allen Bereichen des Laborbetriebs von medizinischen Anwendungen bis zur Mikrobiologie und der Forschung mit zellbiologischen Aufgabenstellungen viele Anwendungsmöglichkeiten. Von der Lagerlogistik für Laborware und Probengefässe über die Filtration und Inkubation bis hin zur Detektion von Kolonien ist der gesamte Workflow mit Robotern automatisierbar. Dabei ist der Einsatz von Robotik nicht nur bei grossen Losgrössen sinnvoll, sondern kann schon bei kleinen Batches effizient sein. Der verstärkte Einsatz von Robotiklösungen markiert einen ökonomisch sinnvollen Weg zu mehr Sicherheit.
Wo mit hochaktiven und potenziell gefährlichen Substanzen gearbeitet wird, ist ein effektives Containment unerlässlich. Automatisierte Isolatoren und geschlossene Systeme ermöglichen es, dass selbst hochpotente Substanzen sicher gehandhabt werden können, ohne die Gesundheit des Personals oder die Integrität des Produkts zu gefährden. Die Anwendungsmöglichkeiten im Labor sind sehr vielseitig: – Magazinieren von Behältnissen und Proben, Öffnen und Schliessen von Gefässen, Dosieren von Feststoffen und Flüssigkeiten unterschiedlicher Viskositäten bis in den Kleinstmengenbereich – Aufbereiten der Proben durch Mischen, Schütteln, Zentrifugieren, Erhitzen oder Kühlen
– Liquidhandling mit Pipetten und verschiedensten Pumpensystemen
– Automatisierte Kultivierung von verschiedenen Zelllinien in Nährmedien für Asseys und Screening unter Reinraumbedingungen
– Zellwachstum und Ernte in verschiedenen Gefässen wie Mikrotiterplatten,

Die Dosierpumpe füllt die Injektionslösung in die Vials.
Petrischalen, Flaschen oder Multi-LayerGefässen
– Kultivierung von Zelllinien in verschiedenen Gefässen: Inkubation, Medienwechsel, Splitten und Ernten, Zentrifugation, Zellzählung und Konfluenzüberwachung – Einwiegeprozesse, Pipettierautomation und Abfüllung
Anwendungen in der Biopharma
Ob für Aufgaben in Bereich Forschung, Anlegen von Gewebekulturen, Probenvorbereitung, zellfreien Bioproduktion oder Analytik – Laborautomatisierung kann auch für den wissenschaftlichen Fortschritt und die Effizienzsteigerung in Life Sciences und Biotechnologie entscheidend sein. Die Suche nach neuen pharmazeutischen Wirkstoffen, Impfstoffen und therapeutischen Antikörpern ist sehr aufwändig und mit hohen Kosten verbunden. Weltweit wird an innovativen Verfahren geforscht, die der Therapie von Erkrankungen, der nachhaltigen Rohstoffsynthese oder der Energiegewinnung dienen. Erst die Laborautomatisierung ermöglicht, dass wissenschaftliche Entwicklungen schnell von der Grundlagenforschung zur praktischen Anwendung gelangen. Ohne moderne Analyseautomaten ist die wirtschaftliche Durchführung dieser vielfältigen Prozesse nicht denkbar, da es in Zukunft immer mehr auf geringe Testkosten, schnelle Verarbeitung und leichte Interaktion mit LIS/HIS-Systemen ankommt.
Anwendungen in der Pharmazie
Besonders bei Arzneimitteln in flüssiger Form stellt die aseptische Herstellung und Abfüllung eine besondere Herausforde -
rung dar. Während pulverige Substanzen weniger kritisch in der Verarbeitung sind, ist dies bei flüssigen Darreichungsformen deutlich komplexer. Pulver lassen sich besser vor dem Verpacken sterilisieren als z. B. biotechnisch hergestellte Liquida, die zur Injektion vorgesehen sind. Diese Substanzen gehen direkt in die Blutbahn, wohingegen Pulver oder Tabletten häufig erst in der Darmpassage ihre Wirkung entfalten, nachdem diese «natürlich» im Magen des Patienten von eventuell verbliebenen Keimen befreit wurden. Die aseptische Abfüllung in einem automatisierten Prozess, wie im nachfolgenden Beispiel dargestellt, wird künftig ebenso an Bedeutung gewinnen, wie eine personalisierten Medizin oder die wirtschaftliche Entwicklung und Synthese neuer Wirkstoffe. Nicht zuletzt muss hier auch der Aspekt des Kostendrucks im Gesundheitswesen mitberücksichtigt werden.
«Fill and Finish» individueller Injektionslösungen
Die Abfüllung von Vials mit Injektionslösungen stellt hohe Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Flexibilität. Der Prozess erfolgt in der Regel in Reinräumen, die eine kontrollierte Umgebung mit geringer Partikel- und Keimbelastung bieten. Für kleine Losgrössen ist die Abfüllung mit konventionellen Anlagen oft unwirtschaftlich und zeitintensiv, da sie einen grossen Rüstaufwand und einen hohen Materialeinsatz verursachen. In einem von Weiss Technik und Goldfuss Engineering gemeinsam konzipierten System simuliert eine roboter-gestützte Abfüllanlage beispielshaft für kleine Losgrössen, wie eine automatisierte und präzise Abfüllung von Vials mit einer individuellen Injektionslösung effizient und sicher erfolgt. Die Anlage besteht aus einer Sicherheitswerkbank gemäss ISO 5 bzw. Klasse A Reinraumbedingungen mit einem integrierten Roboter in Pharmaausführung. Der Roboter nimmt mit seinem Dreifachgreifer nacheinander den Stopfen, den Deckel sowie das leere Vial aus den Magazinen auf. Zunächst wird das Vial in der Abfüllstation platziert, wo es über eine Dosierpumpe mit Injektionslösung befüllt wird. Eine integrierte Präzisionswaage mit der Genauigkeit von 0,1 mg überprüft gravimetrisch den Füllstand der Vials. Ein Regelalgorithmus minimiert die Abfülltoleranzen der

Der Dreifachgreifer transportiert und platziert die Vials.
Charge. Nach der Abfüllung wird vom Roboter direkt der Stopfen eingesetzt und das verschlossene Vial in die Verschlussstation transportiert. Dort wird die Kappe auf das Vial aufgesetzt und mit einem Werkzeug vercrimpt. Optische Sensoren überwachen jeweils die exakte Positionierung von Stopfen und Verschlusskappe. Zuletzt setzt der Roboter das fertig abgefüllte und verschlossene Vial in das Ausgabemagazin. Abhängig von den Volumina dauert das Abfüllen und Verschliessen eines Vials rund 30 Sekunden.
Die Sicherheitwerkbank bietet eine laminare Luftströmung, die dem First-Air-Prinzip gemäss Neufassung des EU-GMP Annex 1 «Manufacture of Sterile Medicinal Products» folgt. Diese Anlagen lassen sich modular aufbauen, die Durchsatzzahlen sind nach Bedarf skalierbar.
Weiss Technik ist ein kompetenter Anbieter von anspruchsvollen Reinluft- und Containment-Lösungen. Das Produktprogramm umfasst unter anderem Barrier-Systeme, Laminar-Flow-Anlagen, Sicherheitswerkbänke, Isolatoren, Schleusensysteme und Stabilitätsprüfsysteme. Zusammen mit der auf Robotiklösungen spezialisierten Goldfuss Engineering GmbH werden Automatisierungssysteme für die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen unter ContainmentBedingungen in Biotechnologie- und Pharmalaboren entwickelt.
Weiss Technik AG CH-8852 Altendorf info.ch@weiss-technik.com www.weiss-technik.com

Schnell, kontrolliert und aus Reststoffen: Ein am Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e. V. (ATB) entwickeltes Verfahren zur künstlichen Herstellung von Huminstoffen ermöglicht eine vollständige Verwertung biologischer Reststoffe.
Humus ist wegen der darin enthaltenen Huminstoffe gut für das Pflanzenwachstum. Diese Stoffe haben zahlreiche Vorteile für den Boden: Besonders fruchtbarer Boden enthält etwa 3 Prozent Huminsäuren, Torf etwa 3 bis 10 Prozent. Die Vorteile von Huminstoffen: Sie binden Feuchtigkeit und nützliche Mineralien im Boden und fördern ein gesundes Ökosystem für Mikroorganismen, welche Biomasse in nährstoffreiche Biostimulanzien umwandeln, die das Pflanzenwachstum unterstützen. Landwirte müssen weniger wässern, weniger düngen und der Boden regeneriert sich innerhalb weniger Jahre. Huminstoffe wirken ausserdem als pH-Puffer. Stickstoff, zum Beispiel aus Düngemitteln, verbleibt tendenziell im Boden, wodurch das Grundwasser geschützt wird. Huminstoffe kommen in der Natur vor und werden über viele Jahre hinweg durch biologische Prozesse gebildet, wobei viele
Treibhausgase freigesetzt werden. Das bekannteste Beispiel hierfür ist die Kompostierung. In grossen Mengen sind Huminstoffe in einem Vorläufer der Braunkohle, der Weichbraunkohle, zu finden, welche zu etwa 85 Prozent aus Huminstoffen besteht. Zahlreiche Unternehmen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten auf die aufwändige Gewinnung und schonende Aufbereitung von Huminstoffen spezialisiert, um sie beispielsweise für die Landwirtschaft nutzbar zu machen. Diese Ressourcen sind jedoch endlich, Kohleabbau und -nutzung gelten als umwelt- und klimaschädlich.
Das Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie (ATB) setzt daher, mit Erfolg, auf ein hydrothermales Verfahren. Dr. Nader Marzban, Post-Doktorand am ATB und Experte für Biokohle und Huminstoffe, drückt es so aus: «Was die Natur in Jahren mithilfe von Mikroorganismen schafft, kön -


nen wir in Minuten bis Stunden in einem kontrollierbaren Prozess mit Hitze, Druck und Wasser erreichen.»
«Was die Natur in Jahren mithilfe von Mikroorganismen schafft, können wir in Minuten bis Stunden in einem kontrollierbaren Prozess mit Hitze, Druck und Wasser erreichen.»
Dr. Nader Marzban, Post-Doktorand am Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie
In der Landwirtschaft, aber auch in der Landschaftspflege oder in Privathaushalten, fallen viele organische Abfälle an. Der Forschende wies nach, dass sich viele davon ideal für die Humifizierung eignen. «In einem Hochdruckreaktor mischen wir die Biomasse mit Wasser in einem ungefähren Verhältnis von 0,1 zu 0,4. Die Faserbestandteile Cellulose, Hemicellulose und Lignin werden dann unter hohem Druck (zwischen 6 und 60 bar) und bei hoher Temperatur (zwischen 160 und 240 Grad) aufgeschlossen. Je nach pH-Wert und Temperatur im Reaktor erhalten wir entweder mehr Hydrokohle oder künstliche Huminsäure. Beides sind Feststoffe, deren Farbe von bräunlich bis schwarz reicht.»
Die trockene Verkohlung, auch Pyrolyse genannt, wird von Köhlern schon seit Jahrhunderten genutzt. Im Gegensatz dazu ist die hydrothermale Umwandlung, insbesondere die hydrothermale Humifizierung,
noch sehr neu. Die Forschung und der Einsatz in der Praxis nehmen derzeit Fahrt auf, viele Parameter sind jedoch noch unklar.
«Hier haben wir am ATB in den letzten Jahren Pionierarbeit geleistet. Nur eine Handvoll Forschungsinstitute weltweit hat sich mit dieser Art der Huminstoffproduktion eingehend beschäftigt», sagt Dr. Marzban, dessen Dissertation den Titel «Von der hydrothermalen Karbonisierung zur hydrothermalen Humifizierung von Biomasse: Die Rolle der Prozessbedingungen» trägt.
«Inhaltlich stellen wir – damit sind Forschende weltweit gemeint – uns folgende Fragen: Welche Biomasse-Ausgangsmaterialien lassen sich künstlich humifizieren? Welche Prozessparameter haben den grössten Einfluss auf die Produktion von Huminstoffen? Wie können wir die Eigenschaften unserer Produkte beeinflussen?
Neben den Auswirkungen auf die Landwirtschaft stellen wir natürlich auch die Frage nach den Auswirkungen auf die Umwelt. Wie viel Kohlenstoff können wir dauerhaft im Boden speichern, wenn wir Huminstoffe hinzufügen? Und schliesslich: welchen Erfolg können wir erzielen?» Eine neue Art von Mikrodünger auf Huminstoffbasis ist einer der Ansatzpunkte der Forschenden. Ihre ersten Ergebnisse zeigten, dass die Zugabe von nur 0,01 Prozent der Humifizierungsprodukte in den Boden den Keimungsindex deutlich erhöhen und die Pflanzen bei der Aufnahme von mehr Nährstoffen, zum Beispiel Phosphor, unterstützen kann.
Besonders anschaulich ist auch ein Projekt im historischen Park Sanssouci in Potsdam: Die alten Bäume dort haben mit jahrelanger Trockenheit zu kämpfen, verlieren an Vitalität und werden anfällig für Krankheiten. Die Parkbetreiber unternehmen grosse Anstrengungen, um diese Bäume zu erhalten. In einem Projekt hat das ATB mit anderen Instituten und Akteuren dort versucht, eine 150 bis 160 Jahre alte Buche zu retten. Dazu wurden künstliche Huminstoffe hergestellt und in den Boden rund um den Baum eingebracht. «Die erste Behandlung erfolgte 2022, und die vorläufigen Ergebnisse sind beeindruckend. Der Buche geht es im Vergleich zu unbehandelten Bäumen sehr gut. Natürlich führen wir parallel Versuche an rund 100 kleinen Bäumen durch, um die Ergebnisse zu überprüfen», fährt Dr. Marzban fort.
Mit Gärrest chemische Düngemittel ersetzen
Um die Forschung weiter voranzutreiben und das Potenzial dieser Technologie zu nutzen, arbeitet Dr. Marzban derzeit an mehreren Projektanträgen. Denn die hydrothermale Humifizierung kann auch andere Prozesse erleichtern. «Am ATB nutzen wir zum Beispiel Biokonversionsverfahren, um mit Hilfe von Mikroorganismen hochwertige Milch- und Bernsteinsäure oder den Energieträger Biogas zu erzeugen. Die Humifizierung ermöglicht es uns, Reststoffe vollständig zu verwerten.» Bei der Biogaserzeugung sind beispielsweise Kohlenhydrate schwer abbaubar und Lignin hemmt den Prozess. Unter Zuhilfenahme von künstlicher Humifizierung können bis zu 37 Prozent der Trockensubstanz von Biogasgärresten humifiziert werden. Dabei entstehen Nebenprodukte wie lösliche organische Verbindungen in der Prozessflüssigkeit. Wenn diese bei der Biogaserzeugung wieder dem anaeroben Prozess zugeführt werden, kann die Methanausbeute verdoppelt werden. Ausserdem entsteht ein humusreicher Gärrest, der als Langzeit-Biodünger chemische Düngemittel ersetzen kann.
Für Dr. Marzban liegt die Zukunftstauglichkeit dieses Verfahrens auf der Hand. «Wir schliessen Kreisläufe und ersetzen fossile Ressourcen im Sinne einer nachhaltigen und zirkulären Bioökonomie. Wenn wir sicherstellen, dass unsere Huminsäuren den natürlichen Vorkommen in Qualität und Nutzen in nichts nachstehen – und das können wir nachweisen –, haben wir ein schnelles, kontrollierbares Verfahren, das nachwachsende Rohstoffe nutzt und eine kaskadische, also mehrstufige Nutzung dieser Biomasse ermöglicht.» Gemäss dem Forscher wird die hydrothermale Humifizierung durch das integrierte Reststoffmanagement und die nachhaltige Umgestaltung der Landwirtschaft einen wichtigen Beitrag zur Bioökonomie leisten. «Durch die Integration der hydrothermalen Humifizierung in Bioraffinerien können feste und flüssige Rückstände in Huminstoffe umgewandelt werden, was die Bemühungen um eine abfallfreie Produktion vorantreibt und den Kohlenstoff im Boden bindet», fasst Dr. Marzban zusammen.
www.atb-potsdam.de
• Instrumentenaufbereitung im Krankenhaus
• Infektiöse Labor- und Klinikabfälle
• Für das mikrobiologische Labor
• Steril-, Pharma- und Medizinprodukte
• Gentechnisch veränderte Stoffe

EXCELLENCE IN AUTOCLAVES
• Schnellkühlen von Flüssigkeiten
• Kammervolumina 25 - 200 Liter

• Integrierter Doppelmantel
• Kondensatsterilisation
• Vor-/Nachvakuum
• Abluftfiltration
• Stand- und Tischgeräte
• 100% verschleiß- und wartungsfrei
• Entwickelt für den Dauerbetrieb
• Rührvolumen von 1 ml bis 1.000 Liter
• Mehrstellenrührer bis 96 Rührstellen
• Tauchbare Magnetrührer
• Heizbar bis +200 °C
• Sonderanfertigungen auf Anfrage



Polymerchemiker an der ETH Zürich haben einen überraschenden Weg gefunden, über den sich der als Plexiglas bekannte Kunststoff PMMA fast vollständig in seine Monomerbausteine zerlegen lässt. Selbst Zusatzstoffe stören den Prozess nicht.
Daniel Meierhans ¹
Heutiges Kunststoffrecycling beschränkt sich weitgehend auf die Sammlung sortenreiner Getränkeflaschen aus PET oder Polyethylen. Der gesammelte Kunststoff hat eine identische chemische Zusammensetzung und ähnlich lange Polymermoleküle. Auch Zusatzstoffe, mit denen beispielsweise Farbe, Weichheit oder Lichtbeständigkeit optimiert werden, sind ähnlich. Der Kunststoff kann daher direkt eingeschmolzen und zu neuen Flaschen gegossen werden. So genannte Mischkunststoffe aus verschiedenen Kunststoffsorten und -qualitäten werden dagegen meist nur zur Wärmegewinnung verbrannt, zum Beispiel in Zementwerken. Dadurch gehen wertvolle Rohstoffe verloren.
Forschende um Athina Anastasaki vom Labor für Polymermaterialien der ETH Zürich haben jetzt einen Weg gefunden, Kunstoffe, in dem Fall Plexiglas, fast vollständig in seine Monomerbausteine zu zerlegen. Diese lassen sich dann aus dem Gemisch mit Additiven durch Destillation leicht zu hochwertigen Ausgangsprodukten für die Synthese neuer Plexiglaspolymere aufreinigen.
Und das Potenzial ist gross: Mit einer weltweiten Jahresproduktion von rund 3,9 Millionen Tonnen wird Plexiglas (chemisch: PMMA, Polymethylmethacrylat) als widerstandsfähiges und leichtes Kunststoffglas in der Luft- und Raumfahrt, im Automobilbau, für Bildschirme und in der Bauindustrie immer häufiger verwendet.
Das in der Fachzeitschrift Science vorgestellte Verfahren ist ausgesprochen robust. Es funktioniert auch mit sehr langen Polymerketten, die aus 10 000 Bausteinen
1 Freier Autor


Bunte Plexiglaswelt: Forschende entwickeln ein Verfahren, um diesen Kunststoff komplett in seine Bausteine zu zerlegen und diese wiederzuverwenden. (Bild: Shutterstock)
bestehen. Auch Zusatzstoffe wie Copolymere, Weichmacher oder Farbstoffe und die meisten anderen Kunststoffe stören die Kettenspaltung kaum. Selbst bei verschiedenfarbigem Plexiglas aus dem Baumarkt liegt die Ausbeute zwischen 94 und 98 Prozent.
Erstaunlich einfaches Verfahren
«Unser Verfahren ist denkbar einfach», betont Anastasaki: «Wir brauchen nur ein chlorhaltiges Lösungsmittel, müssen das gelöste Recyclinggemisch mässig auf 90 bis 150 Grad Celsius erwärmen und können dann mit Hilfe von sichtbarem oder UV-Licht die Abbaureaktion gezielt starten.»
Dass das so einfach funktioniert, hat die ETH-Professorin verblüfft. Wie viele andere wichtige Kunststoffe wie Polyethylen oder Polypropylen bestehen auch Plexiglaspolymere aus einer Polymerkette, die ausschliesslich aus Kohlenstoffatomen aufgebaut ist und von der je nach Kunststofftyp verschiedene Seitengruppen abzweigen. Solche einheitlichen Kohlenstoffketten stellten bisher eine unüberwindbare chemische Hürde für die gezielte Aufspaltung in Mono -
mere dar, da sie keine definierten Angriffspunkte für Spaltungsreaktionen bieten. Die einzige Methode, mit der die homogenen Kohlenstoffketten in der industriellen Praxis vollständig gespalten werden können, ist die so genannte Pyrolyse. Dabei werden die Kohlenstoffketten bei etwa 400 Grad Celsius thermisch gespalten. Diese Reaktionen sind jedoch unspezifisch und es entsteht ein Gemisch aus vielen verschiedenen Spaltprodukten. Der hohe Energieaufwand und die aufwendige Separierung des Gemisches schränken die Wirtschaftlichkeit der Pyrolyse stark ein. Seit einigen Jahren experimentieren verschiedene Forschungsgruppen mit modifizierten Polymeren. Dabei werden an den Enden der Polymerketten leicht abspaltbare Molekülgruppen eingeführt, die dann einen Abbau der Kette vom Ende her auslösen. Auf diese Weise erreichen die Forschenden zwar Ausbeuten von bis zu über 90 Prozent. Allerdings haben diese Designerpolymere mehrere entscheidende Nachteile: Sie müssen erst in die etablierte Kunststoffproduktion integriert werden. Zudem schränken ihre reaktiven Endgruppen die
thermische Stabilität der Polymere und damit ihre Einsatzmöglichkeiten deutlich ein. Hinzu kommt, dass viele der üblichen Kunststoffadditive die Ausbeute der Reaktionen verringern und selbst bei längeren Polymerketten, wie sie in kommerziellen Kunststoffen häufig vorkommen, der Abbau nur zu einem geringen Teil funktioniert.
Das Lösungsmittel bestimmt
die Reaktion
Bei der Entdeckung der neuen Methode half, wie so oft in der Chemie, der Zufall, wie Anastasaki erklärt: «Wir waren eigentlich auf der Suche nach spezifischen Katalysatoren, welche die Aufspaltung in die Monomere gezielt fördern. Doch in einem Kontrollexperiment stellten wir zu unserer Überraschung fest, dass der Katalysator gar nicht nötig war.» Das chlorierte Lösungsmittel, in dem die zerkleinerte Plexiglasprobe gelöst war, reichte aus, um das Polymer mit Hilfe von UV-Licht fast vollständig zu spalten.
Als die Forschenden die Spaltungsreaktion genauer untersuchten, stiessen sie auf einen überraschenden Mechanismus. Das chemisch aktive Teilchen der Reaktion ist ein Chlorradikal. Es wird aus dem chlorierten Lösungsmittel abgespalten, wenn es durch UV-Licht angeregt wird. Unerwartet war, dass das langwelliges Licht die Bindung des Chlors an das Lösungsmittelmolekül aufbrechen kann. Dies geschieht durch ein beinahe esoterisch anmutendes photochemisches Phänomen, bei dem ein sehr geringer Anteil der Lösungsmittelmoleküle UV-Licht mit hoher Wellenlänge absorbiert.
Um den Mechanismus der Spaltung aufzuklären, konnte Anastasaki auf die Hilfe von Spezialisten aus anderen ETH-Forschungsgruppen zählen. Tae-Lim Choi vom Laboratorium für Polymerchemie berechnete die theoretischen Elektronenzustände der beteiligten Moleküle, und Gunnar Jeschke vom Institut für Molekulare Physik führte Elektronenspinreso -
nanz-Messungen durch, mit denen die theoretischen Vorhersagen experimentell überprüft wurden.
In Zukunft will die ETH-Forscherin bei ihrem Recyclingverfahren allerdings auf das chlorierte Lösungsmittel verzichten: «Chlorierte chemische Verbindungen schaden der Umwelt. Unser nächstes Ziel ist es deshalb, die Reaktionen so zu modifizieren, dass sie auch ohne das chlorierte Lösungsmittel funktionieren.
In welcher Form und in welchem Zeitrahmen die ETH-Methode in die Praxis umgesetzt wird, ist noch offen. Auf jeden Fall haben die Forschenden um Anastasaki die Tür zu neuartigen Recyclingmethoden aufgestossen, mit denen sich auch die bisher chemisch unzugänglichen Kohlenstoffketten von Kunststoffen gezielt aufspalten lassen.
https://ethz.ch

Mit der limitierten Edition der JULABO Kältethermostate bringen Sie nicht nur Farbe in Ihr Labor, sondern investieren auch in eine zukunftssichere Lösung.
Die Geräte vereinen höchste Energieeffizienz mit dem Einsatz umweltfreundlicher natürlicher Kältemittel.
Sie tragen dazu bei, den ökologischen Fußabdruck Ihres Labors zu verringern – ohne Kompromisse bei Präzision und Leistung.

Jetzt bestellen! www.julabo.com/de/green-your-lab


Reduzierter Energieverbrauch, verbesserte Produktqualität und -sicherheit: Thyssenkrupp Uhde (D) und Novonesis (DK) präsentieren eine neue Technologie zur Herstellung biobasierter Schlüsselkomponenten für Lebensmittel, Körperpflege, Haushaltspflege und technische Anwendungen.
Die Veresterung spielt eine entscheidende Rolle in der oleochemischen Wertschöpfungskette, indem sie natürliche Fettsäuren in die entsprechenden Ester umwandelt. Diese biobasierten und biologisch abbaubaren Ester werden dann in einer breiten Palette von Alltagsprodukten genutzt, unter anderem für Lebensmittel, Körperpflege, Haushaltspflege und in technischen Anwendungen.
Die Herstellung von Spezialestern mit Hilfe von Enzymen ist allgemein bekannt und bietet im Vergleich zu herkömmlichen thermochemischen Verfahren grosse Vorteile für die Umwelt. Die enzymatische Veresterung ist ein inhärent sicherer Prozess mit einem deutlich geringeren Energiebedarf und ermöglicht die Verringerung von Abfällen und entsprechenden Ausbeuteverlusten, wobei auch völlig neue Ester-
produkte hergestellt werden können. Trotz der Vorteile in Bezug auf Produktqualität und Ressourceneffizienz gibt es jedoch grundlegende Herausforderungen bei der enzymatischen Veresterung, die hauptsächlich mit den Betriebskosten zusammenhängen. Ein neues Verfahren mit wettbewerbsfähigeren Betriebskosten soll jetzt Abhilfe schaffen.
Das neue enzymatische Veresterungsverfahren wurde von Thyssenkrupp Uhde, Anbieter chemischer Technologielösungen, entwickelt und nutzt die massgeschneiderten Enzyme von Novonesis, dem dänischen Enzymtechnologie-Pioniers, als Katalysatoren. Bei der «Uhde Enzymatic Esterification» (enzymatische Veresterung) ersetzen die Enzyme herkömmliche che -
mische Katalysatoren wie anorganische Säuren oder Katalysatoren auf Metallbasis. Dies ermöglicht Prozesse bei deutlich niedrigeren Temperaturen, was zu erheblichen Energieeinsparungen und einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen um bis zu 60 Prozent führt. Ausserdem ist das Verfahren aufgrund des Fehlens chemischer Katalysatoren und niedrigerer Betriebstemperaturen grundsätzlich sicherer. «Das gemeinsame Angebot verschafft unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil durch verbesserte Produktqualität und die Möglichkeit, völlig neue Märkte für biobasierte Produkte zu erschliessen», erklärt Nadja Håkansson, Geschäftsführerin von Thyssenkrupp Uhde. «Durch die eigens entwickelten Anlagen von Thyssenkrupp Uhde können wir nun mit unseren Enzymen ein neues Leistungsniveau in der Es-

Blockflussdiagramm einer Strahlreaktoranlage für konventionelle thermochemische und enzymatische Veresterung. (Grafik: Thyssenkrupp Uhde)


Die «Jet Reactor-Technologie» zeichnet sich aus durch schonende Reaktionsbedingungen für die Enzyme und eine effiziente Wasserentfernung bei hohen Umwälzraten, wodurch die Lebensdauer des Katalysators verlängert und die Reaktionszeit reduziert wird. (Bild: Thyssenkrupp Uhde)
terproduktion erreichen», sagt Hans Ole Klingenberg, Marketingleiter bei Novonesis.
Ökonomische und ökologische Vorteile
Das von Uhde entwickelte Reaktordesign und die Enzymtechnologie stellen eine hohe Leistung sicher, minimieren dadurch Nebenreaktionen und verringern Abfallstoffe um bis zu 60 Prozent. Dies steigert nicht nur die Qualität des Endprodukts, sondern öffnet die Tür zur Herstellung völlig neuer Produkte.
Das proprietäre Design des Enzymbetts ermöglicht bis zu 30 Umwälzungen pro Stunde, was eine effiziente und kostengünstige Produktion gewährleistet. So ist der enzymatische Veresterungsprozess für kurze Reaktionszeiten optimiert, was zu wettbewerbsfähigen Enzymkosten pro Tonne Produkt, einer höheren Jahresproduktion und einer hervorragenden Produktqualität führt.
Über Thyssenkrupp Uhde Thyssenkrupp Uhde verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung in Engineering, Beschaffung, Bau und Service von Chemieanlagen. Das Portfolio umfasst Technologien für die Herstellung von Basischemikalien, Düngemitteln und Polymeren sowie komplette Wertschöpfungsketten für grünen Wasserstoff und nachhaltige Chemikalien.
Um den Übergang zur enzymatischen Veresterung zu erleichtern, bietet Uhde ein Nachrüstungspaket an, mit dem bestehende Anlagen sowohl konventionelle als auch enzymatische Veresterungsprozesse durchführen können. Diese schrittweise Umstellung minimiert sowohl Investitionskosten als auch Risiken und ermöglicht Unternehmen einen schnellen Einstieg in den wachsenden Markt für nachhaltige Produkte. Die Technologie wurde bereits erfolgreich in einer Pilotanlage eingesetzt und ist jetzt bereit für die industrielle Skalierung.
Nach dem Konzeptnachweis wurden Pilotversuche mit dem Lipaseprodukt «Lipura Flex» in einem 25-Liter-Jet-Loop-Reaktor (siehe Abbildung) von Thyssenkrupp Uhde zur Demonstration der Technologie und zur Herstellung von Isopropylpalmitat, Isopropylcaprylat/Caprat, Glycerintripalmitat und MCT durchgeführt. Lipura Flex-Lebensdauerversuche wurden von Novonesis im Labormassstab zur Herstellung von MCT durchgeführt, wobei das Enzym seine Leistung mehr als 1000 Stunden bei 85 Grad beibehielt. Überträgt man dies auf das Jet-Reactor-Verfahren, so ergeben sich Enzymkosten von weniger als 5 Prozent des Produktwerts.


20.05. + 21.05.2025


HYPERION
Hotel Basel
www.thyssenkrupp-uhde.com www.novonesis.com

Erleben Sie zwei Tage voller spannender Einblicke und praxisnaher Impulse rund um das Thema Sicherheitstechnik in der Pharmaindustrie.
Weitere Infos



Die Produktion von Feinchemikalien, beispielsweise für Pharmazeutika, ist in der Regel komplex und aufwändig. Eine interdisziplinäre Forschungsgruppe hat ein Verfahren nach dem Vorbild einer Kaskade entwickelt, bei dem mehrere aufeinanderfolgende Synthesestufen ohne Unterbrechung durchlaufen. Möglich wird dies durch den Einsatz neuartiger Katalysatoren in speziell angepassten Durchflussreaktoren.
In der chemischen Industrie gehören Feinchemikalien zu den sehr hochwertigen Produkten. Sie sind überall da gefragt, wo es weniger um grosse Mengen als um präzise Wirkung und hohe Reinheitsgrade geht, beispielsweise bei der Produktion von Arzneimitteln. Die Herstellung von Feinchemikalien ist komplex und erfordert in der Regel mehrere, aufeinander folgende Reaktionsschritte. Die Syntheseverfahren sind seit vielen Jahren etabliert, aber auch technisch weitgehend ausgereizt.
Herausfiltern oder entfernen von Katalysatoren entfällt Forschende haben nun einen innovativen Syntheseprozess zur Herstellung von Feinchemikalien entwickelt. Während herkömmliche Verfahren mit einer Abfolge diverser Reaktoren und Rührkesseln ar-
beiten, bei der nach jeder Reaktion die entstandene Produktlösung für den nächsten Schritt vorbereitet und in einen anderen Behälter überführt werden muss, entsteht das Endprodukt bei dem neuen Verfahren in einer kontinuierlich ablaufenden Synthesekaskade, im besten Fall innerhalb eines Reaktors. Das Verfahren führt zu einer wesentlich effizienteren Prozessführung und einer nachhaltigeren Produktion durch verkürzte Umrüstzeiten und einen geringeren Energiebedarf. Diese Vorteile haben direkten Einfluss auf die CO2-Emissionen des Syntheseprozesses und dessen Kosten.
Die Forschenden setzen bei ihrem Verfahren auf eine neuartige Kombination zweier Katalysemethoden. Dabei werden Photokatalysatoren, die mit Licht aktiv werden, mit ebenfalls als Katalysator wirkenden

Enzymen kombiniert. Die Enzyme werden entweder auf transparenten Folien aufgebracht und damit immobilisiert oder als Partikel im Reaktionsmedium eingesetzt. Projektleiterin Dr. Michaela Müller vom Fraunhofer IGB erklärt den Vorteil dieses Verfahrens: «Wir vermeiden dadurch, dass die Katalysatoren frei in der Lösung herumschwimmen und nach jedem Schritt aufwendig herausgefiltert oder entfernt werden müssen. Die immobilisierten Enzyme respektive Katalysatoren können im Reaktor verbleiben, während das Reaktionsprodukt kontinuierlich entsteht. Verlieren die Enzyme ihre Aktivität, lassen sie sich leicht austauschen, ohne den Prozess unterbrechen zu müssen.»
«Die lichtgetriebene Katalyse für die Kaskadenreaktionen benötigt keine besonders hohen Temperaturen, verträgt sich des -

Die für die Syntheseschritte benötigten Katalysatoren werden auf transparenten Folien immobilisiert (links) oder als Katalysator-Partikel eingesetzt (rechts). Die Aufnahme des Elekronenmikroskops zeigt einen Ausschnitt aus einem Partikel mit den Trägerpartikeln für Enzyme und Photokatalysatoren. Deren Grösse liegt im Nanometerbereich. (Bild links: Fraunhofer IGB / Bild rechts: Fraunhofer ISC)


In den gemeinsamen Projekten wurde eine neue Technologie-Plattform zur Herstellung von Feinchemikalien entwickelt. (Bild: Fraunhofer IMM)
halb gut mit der Biokatalyse und spart damit auch Energie», erklärt Dr. Thomas Rehm, Projektleiter am Fraunhofer IMM und Spezialist für nachhaltige Synthesen in Durchflussreaktoren. Um das Licht möglichst effektiv mit dem Photokatalysator und der Reaktionslösung zu kontaktieren, sind die verwendeten Durchflussreaktoren mit dünnen transparenten Kunststoffröhrchen (Kapillaren) oder mit Folien ausgestattet. Die Ausgangslösung wird entweder durch die Kapillaren des Reaktors gepumpt – samt Katalysatorpartikeln und einem Gas zur Verbesserung des Feststofftransports – oder über die transparente Polymerfolie geleitet, die als Träger der Photokatalysatoren und Enzyme dient. Durch den Einsatz von Enzymen in der Kaskadenreaktion eignet sich das Verfahren besonders für die Herstellung sogenannter chiraler Feinchemikalien, die in Arzneimitteln häufig verwendet werden. Diese chemischen Verbindungen basieren auf Molekülen, die exakt spiegelbildlich aufgebaut sind, aber nicht durch Drehung miteinander deckungsgleich werden, vergleichbar etwa mit menschlichen Händen. Man spricht hierbei von Stereoisomerie. Je nach Version, also Isomer des chiralen Moleküls – linke Hand oder rechte Hand –können diese völlig unterschiedlich wirken. Aus diesem Grund ist die gezielte Herstel -
lung von nur einem Isomer in möglichst hoher Reinheit wichtig, um eine maximal positive Wirkung zu erreichen.
Reaktionen und Katalysekombinationen auf
Um das neuartige Katalyseverfahren zu realisieren, haben die vier Institute ihre sehr unterschiedlichen Forschungskompetenzen zusammengelegt und interdisziplinär zusammengearbeitet. Im Ergebnis ist weit mehr als nur ein neues Verfahren entstanden: Die Expertinnen und Experten haben eine modular aufgebaute Technologie-Plattform zur Herstellung von verschiedenen Klassen an Feinchemikalien entwickelt. Für Industriekunden lassen sich so in einer Machbarkeitsstudie Wunschprozesse individuell für die Reaktionen und Katalysekombinationen massschneidern.
Davon kann die Arzneimittelbranche in besonderer Weise profitieren, denn die Produktionstechnologien sind oftmals ausgereizt. Anstelle Standorte in Niedriglohnländer zu verlegen oder dort Wirkstoffe einzukaufen könnten solche wirtschaftliche Verfahren für eine Produktion auf höchstem technologischem Niveau sorgen, die zugleich nachhaltig sind.
www.fraunhofer.de
Zertifizierter Schutz gegen folgende Risiken:

Rutschsicher unterwegs


für flexible Arbeitsplätze kein Durchkommen für Gefahrstoffe

Ihr Partner für Personenund Umweltschutz


Zweidimensionale Materialien wie Graphen sind ultradünn und äusserst empfindlich. Feldeffekttransistoren auf Graphen-Basis könnten beispielsweise winzigste Veränderungen der elektronischen Eigenschaften registrieren, welche die Moleküle verursachen, wenn sie mit dieser atomar dünnen Schicht interagieren. Doch die Hypersensivität des Materials stand der Umsetzung dieser Idee bisher im Weg. Jetzt haben Forschende an der FriedrichSchiller-Universität Jena eine Lösung entwickelt, um diese Hürde zu überwinden.
Sebastian Hollstein ¹
Genau wie andere Biosensoren benötigt ein graphen-basierter Biosensor eine funktionalisierte Oberfläche, auf der sich nur spezifische Moleküle anlagern. Will man also beispielsweise aus einer Blut- oder Speichelprobe einen ganz bestimmten Biomarker detektieren, so muss auf der Sensoroberfläche ein entsprechendes Gegenstück – ein sogenanntes Fängermolekül – aufgebracht sein. Das Problem: «Funktionalisiert man Graphen auf direkte Weise, dann verändert sich seine elektronische Struktur ungünstig», erklärt Prof. Dr. Andrey Turchanin von der Universität Jena. «Graphen ist dann nicht mehr Graphen – die spezifischen elektronischen Eigenschaften, die man sich eigentlich zunutze machen will, stehen dann nicht mehr zur Verfügung.» Parameter, welche die hohe Sensitivität eines solchen Biosensors ausmachen – zum Beispiel die Mobilität der Ladungsträger – seien zu stark beeinflusst.
Funktionalisierung dank molekularer Zwischenschicht
Doch Turchanin und seine Gruppe haben nun gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft, Forschung und Medizin eine Methode entwickelt, wie sich das Graphen störungsfrei funktionalisieren lässt. «Wir haben auf das Graphen eine molekulare Kohlenstoffmembran aufgebracht, die mit einem Nanometer genauso dünn ist wie Graphen. Diese Zwischenschicht ist dielektrisch – das heisst, sie leitet keinen elekt-

Dr. David Kaiser hält eine Nasenabstrichsprobe, die mit Hilfe des entwickelten Sensors auf Biomarker untersucht wird. (Bilder: Universität Jena, Jens Meyer)
rischen Strom», erklärt der Chemiker. «Beide Komponenten sind durch sogenannte Van-der-Waals-Kräfte miteinander verbunden und bilden eine Heterostruktur, die wir funktionalisieren konnten, ohne die elektronischen Eigenschaften des Graphens zu beeinflussen.» Denn auf die molekulare Zwischenschicht lassen sich störungsfrei chemisch aktive funktionale Gruppen aufbringen, an die sich beliebig viele und unterschiedliche Fängermoleküle anbinden lassen. Lagern sich die gesuchten Gegenstücke an, dann leiten sie das elektrische Feld an das Graphen weiter, was die elektrischen Signale in diesem Material ändert, ohne seine Eigenschaften zu beeinträchtigen.

Untersuchung komplexer klinischer Proben
Als Fängermoleküle statteten die Forschenden die chemisch aktive funktionale Gruppe auf der molekularen Zwischenschicht mit künstlich produzierten Aptameren aus, die sehr gezielt spezifische Moleküle binden können. Ausserdem funktionalisierten sie die Kohlenstoffnanomembran mit einer proteinabweisenden Schicht aus Polyethylenglykol, einem synthetischen Polymer, das in der Medizin häufig angewendet wird. Sie verhindert, dass etwas auf der Oberfläche adsorbiert, was nicht gesucht wird. Auf diese Weise lassen sich in einer komplexen biologischen Probe die gesuchten Biomarker finden.

Ein Graphen-Biosensor-Chip auf einer Leiterplatte, verbunden durch Wirebond-Drähte. Mit diesem Aufbau können hochsensitive Biomessungen direkt in komplexen klinischen Proben durchgeführt werden, ohne dass eine Verstärkung oder Label-Ankopplung erforderlich ist.
Mit dieser Versuchsanordnung gelang es den Deutschen Expertinnen und Experten, Chemokine zu detektieren – also eine bestimmte Proteingruppe, die im menschlichen Immunsystem eine wichtige Rolle spielt und deshalb als Biomarker bei der Diagnose von Krankheiten eine grosse Rolle spielen kann. «Dank der Kooperation mit einem medizinischen Labor in den Niederlanden verwendeten wir für diese Versuche Proben aus Nasenabstrichen von echten Patienten», sagt Andrey Turchanin. «Ausserdem lassen sich mit dem entwickelten Graphen-Sensoren nicht nur ein Biomarker finden, sondern hunderte», ergänzt Dr. David Kaiser, Erstautor der Veröffentlichung.
Ein solcher Biosensor lässt sich in Verbindung mit einem handlichen Point-of-Care-Gerät problemlos in den klinischen Alltag integrieren.
«Das vorliegende Forschungsergebnis kann wegweisend für die Diagnostik der Zukunft sein, denn wir konnten eine grosse Hürde auf dem Weg zum graphen-basierten Biosensor beseitigen, der in seiner Effektivität alles deutlich übertrifft, was heute im normalen klinischen Bereich Anwendung findet», sagt der Chemiker Kaiser. «Er ist wesentlich sensitiver, deutlich schneller – in etwa fünf Minuten liegen die Ergebnisse vor – und kostengünstig, wenn man ihn in grosser Stückzahl produziert.» Das Messprinzip ist rein elektrisch – allein Veränderungen im elektrischen Strom zeigen an, ob die gesuchten Biomarker gefunden wurden. Dementsprechend lässt sich ein solcher Biosensor problemlos in Verbindung mit einem handlichen Point-of-Care-Gerät in den klinischen Alltag integrieren. «Vermutlich geht das sogar mit unseren Smartphones», schliesst Turchanin. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Advanced Materials veröffentlicht.
www.uni-jena.de
Visualisierung von Labordaten mit Excel 6.–7.5.25
Stat. Analyse von Labordaten mit Excel 12.–13.6.25 Methodenvalidierung in der Analytik 22.–23.5.25 Einführung in die Biostatistik mit Excel 26.–27.5.25
• Alle Methoden werden mit praktischen Beispielen illustriert und direkt am PC geübt. Kein mathematischer Formalismus.
• Ort: online oder Basel, oder firmenspezifisch.
• Sprache: Deutsch; Französisch/Englisch auf Anfrage.
Statistische Versuchsplanung und Optimierung am PC
Teil A: 8.–9.5.25: Einführung, Screening, Modellierung, fraktionierte faktorielle und Optimierungspläne, grafische Analyse.
Teil B: 17.–18.6.25: Optimierung von mehreren Zielgrössen (Design Space) und von Formulierungen, eigene spezifizierte Experimente. Prozessoptim. und -überwachung für PAT 12.–13.5.25
Technologies AG Sandweg 46, CH-4123 Allschwil 061 686 98 76, info@aicos.com































Lohnfertigung
• Ausrüstung und Anlagen
• Beratung
• Bioaktive Wirkstoffe
Farbstoffe
• Flammschutzmittel
• Katalysatoren
• Kleb- & Dichtstoffe
• Lösemittel
• Reagenzien
• Spezialadditive
• Stabilisatoren
• Tenside
• Weichmacher Highlights aus dem Konferenzprogramm: Der spannendste Hotspot für Innovationen, Expertise und globale Zusammenarbeit
Insights Stage


CO2 aus Verbrennungsprozessen für Wertstoffe zurückgewinnen ist herausfordernd, da Abgase neben CO2 auch andere Gase enthalten. Eine Forschungsgruppe am Zentrum für Elektrochemie der RuhrUniversität Bochum hat gezeigt, wie man CO2 auch in geringen Konzentrationen elektrochemisch reduzieren kann, um es wiederzuverwerten.
Anders als häufig unter Laborbedingungen, macht CO2 in Abgasen oder der Atmosphäre nur einen geringen Anteil des Gasgemischs aus. Um es unter realistischen Bedingungen zu entnehmen und als Wertstoff wiederverwenden zu können, müssen Katalyseprozesse auch dann bei niedriger CO2-Konzentration funktionieren.
für gewünschte Reaktionen nicht mehr zur Verfügung. Bis zu einem Gehalt an CO2 von 10 bis 20 Prozent wurden schon erfolgreiche Katalyseprozesse für die CO2-Reduktion beschrieben. Was aber, wenn der Gehalt noch geringer ist? «Wir konnten durch die Nutzung eines superaktiven Katalysators auf Nickel-Kupfer-Basis bis 5 Prozent CO2-Gehalt eine erfolgreiche Katalyse betreiben», sagt Adib Mahbub, Erstautor der Publikation in der Fachzeitschrift Angewandte Chemie. Darunter mussten die Forschenden in die Trickkiste greifen: Durch eine Anpassung der elektrischen Potenziale und des Elektrolyten liess sich dann sogar aus einem Gasgemisch mit nur zwei Prozent CO2 eine

«Unser Problem sind die Konkurrenzreaktionen, die in einem Katalysator ablaufen», erklärt Prof. Dr. Wolfgang Schuhmann. «Je weniger CO2-Moleküle umzusetzen sind, desto wahrscheinlicher wird es, dass statt dem gewünschten Produkt bei der Katalyse Wasserstoff entsteht.» Passt man den Elektrolyten an und wählt eine alkalischere Lösung, um das zu verhindern, hat man ein anderes Problem: CO2 wird zu Carbonat umgewandelt und steht

Reduktion durchführen. «Das bedeutet zwar einen Energieverlust, macht uns aber durch geschickte Prozessführung erstmals Quellen zugänglich, die wir bisher nicht für die CO2-Reduktion nutzen konnten», so Schuhmann. «Folgende Generationen werden auf solche Konzepte aufbauen müssen, wenn sie CO2 aus der Atmosphäre entnehmen wollen, in der der CO2-Gehalt noch geringer ist.»
www.ruhr-uni-bochum.de
In Europas Flüssen fanden Forschende über 500 Chemikalien. Sie gelangen durch Industrie und Landwirtschaft in die Wasserläufe und bedrohen die aquatischen Lebensräume. Forschende der Universität Duisburg-Essen haben jetzt eine neue Methode entwickelt, um verschmutzte Gewässer zu reinigen. Das Team um Juniorprofessorin Dr. Anzhela Galstyan will die

Kieselalgen im Rasterelektronenmikroskop. (Bild: AG Phykologie/CCAC)
Chemikalien mit Algen beseitigen. «Kieselalgen sind mikroskopisch kleine einzellige Organismen, die in Gewässern leben und eine Zellwand aus Kieselsäure (Siliziumdioxid) besitzen. Dank ihrer porösen Struktur können sie eine Vielzahl von Schadstoffen aufnehmen». In der in der Fachzeitschrift Advanced Sustainable Systems erschienenen Studie testeten die Forschenden Kieselalgenschalen an zwei exemplarischen Schadstoffen, die häufig aus der Textilindustrie in Flüsse und Grundwasser gelangen: Methylenblau und Methylorange. Um die Adsorptionsfähigkeit zu verbessern, wurde das Kieselgur chemisch modifiziert, indem seine Oberfläche mit
speziellen funktionellen Gruppen versehen wurde. «Das könnte problemlos auch in industriellem Massstab umgesetzt werden», betont Galstyan. Im Labor wurde das Kieselgur unter verschiedenen Bedingungen getestet, etwa bei unterschiedlichen Salzkonzentrationen und pH-Werten. Die Ergebnisse sind gut: Unabhängig von den Bedingungen entfernte das Material die Schadstoffe gleichbleibend effektiv. Zum Vergleich zogen die Forschenden Silica heran, ein Material, das bereits in der Wasserreinigung etabliert ist. Kieselgur schnitt deutlich besser ab: Nach einer Stunde wurden bis zu 100 Prozent des Methylenblaus entfernt, das Si-

licia hingegen entfernte in der selben Zeit nur 88 Prozent des Farbstoffs. Beim Methylorange nahmen sowohl Silica als auch Kieselgur etwa 70 Prozent des Schadstoffs auf.
«Wir sehen in Kieselgur eine umweltfreundliche und kostengünstige Lösung zur Wasseraufbereitung», resümiert Galstyan. Der grosse Vorteil: Algen sind ein nachwachsender Rohstoff und lassen sich mit minimalem Energieaufwand züchten – ganz im Gegensatz zum etablierten Filtermaterial Aktivkohle. Nun prüfen die Forschenden, wie Kieselgur in Membranen zur Wasserreinigung eingesetzt werden kann.


Seit den 1980er-Jahren ist bekannt, dass sich in chloraminiertem Trinkwasser eine mysteriöse Verunreinigung bildet – doch erst jetzt konnte eine SchweizAmerikanisches Forschungsgruppe das unbekannte Abbauprodukt in Trinkwasseranlagen in den USA identifizieren.
Anorganische Chloramine werden häufig zur Desinfektion von Trinkwasser eingesetzt, um die öffentliche Gesundheit vor Krankheiten wie Cholera und Typhus zu schützen. Schätzungen zufolge trinken allein in den USA mehr als 113 Millionen Menschen chloraminiertes Wasser.
Die Forschenden haben das Chlornitramid-Anion (Cl–N–NO2 ) als Endprodukt der Zersetzung von anorganischem Chloramin identifiziert. Derzeit ist nicht bekannt, ob und wie giftig das Chlornitramid-Anion ist. Seine Verbreitung und Ähnlichkeit mit anderen toxischen Verbindungen gibt aber Anlass zur Sorge. Es brauche jetzt
weitere Untersuchungen, um das Risiko für die öffentliche Gesundheit zu bewerten.
Allein die Identifizierung der Substanz sei ein Durchbruch, schreiben die Autoren in ihrer in der Fachzeitschrift Science veröffentlichten Studie. Es handle sich um eine sehr stabile Chemikalie mit einem niedrigen Molekulargewicht, die sehr schwer zu finden sei. «Chloraminiertes Trinkwasser ist in Nordamerika weit verbreitet, aber in der Schweiz wird Chloraminierung nicht wirklich praktiziert, und in Schweizer Gewässern gibt es kein Chlornitramid-Anion», sagt Laszakovits. McNeill ergänzt: «Das erlaubte es uns, Schweizer Leitungswasser als Kontrolle in der Studie zu verwenden.»
Die aktuelle Studie konzentrierte sich auf Wassersysteme in den USA. Allerdings verwenden auch Italien, Frankreich, Kanada und andere Länder Chloraminierung und könnten laut McNeill ebenfalls betroffen sein.

Es dauerte mehr als 40 Jahre, um den Abbau anorganischer Chloramin-Desinfektionsmittel in US-amerikanischen Trinkwassersystemen zu verstehen. (Bild: Envato)
Es ist allgemein bekannt, dass bei der Desinfektion von Trinkwasser eine gewisse Toxizität entsteht. Es handelt sich dabei um eine chronische Toxizität. Eine bestimmte Anzahl von Menschen kann durch das Trinken von Wasser über mehrere Jahrzehnte an Krebs erkranken. Bislang wurde jedoch nicht herausgefunden, welche


www.zimmerliag.com

Chemikalien diese Toxizität verursachen. Ob das Chlornitramid-Anion mit Krebserkrankungen in Verbindung steht oder ob es andere Gesundheitsrisiken birgt, werden Forschende und Aufsichtsbehörden nun untersuchen.
https://ethz.ch
ZIMMERLI Druckregler
• Inertisierungsstandard – präzise, langlebig und zuverlässig
• ressourcenschonend durch reduzierten Gasverbrauch
• Selbsttätige Druckregler ohne Hilfsenergie
• Zertifikate: ATEX, FDA & USP Class VI, ADI-Free, etc.
Der Kanton Solothurn arbeitet mit dem Switzerland Innovation Park Biel/Bienne (SIPBB) im automatisierten Batterie-Recycling zusammen. In Biberist wurde die Tochtergesellschaft Swiss Battery Technology Center Solothurn GmbH gegründet. Das Ziel: Die globalen Abhängigkeiten von kritischen Rohstoffen zu reduzieren. Der nachhaltige Rückgewinnungsprozess von Rohstoffen aus Batterien ist anspruchsvoll. Allein in der Schweiz müssen bis 2040 jährlich mindestens 15 000 Tonnen Lithium-IonenBatterien aus elektrisch betriebenen Fahrzeugen kreislauftauglich rückverarbeitet werden. In Europa wird ein geschlossener Materialkreislauf für E-Batterien Pflicht. Mit den wachsenden Mengen an ausgesonderten Batterien steigen die Anforderungen an die Automatisierung und Sicherheit des Materialkreislaufes. Die Swiss Battery Technology Center Solothurn GmbH kombiniert Automatisierung,
Robotik, künstliche Intelligenz, Sicherheitstechnologien sowie chemische und materialtechnologische Verfahren, um ein effizientes Batterie-Recycling zu gewährleisten. Damit etabliert sich mit der GmbH ab 2026 ein Akteur, der zusammen mit den bereits ansässigen Firmen ein Kreislaufzentrum für Elektromobilität bilden wird.
Die gewonnenen Erfahrungen mit dem neuen Automatisierungsprozess geben wichtige Hinweise auf das technologische Design für besser zerlegbare E-Batterien und auf künftige Regulierungsanforderungen im E-Fahrzeug-Recycling. Das erworbene Wissen positioniert die GmbH darüber hinaus als Aus- und Weiterbildungszentrum für die optimale Konzeption von neuen E-Batterien und den sicheren Umgang mit ihnen.
Vielfältige Kooperationsmöglichkeiten
Der SIPBB mit seiner neuen Tochtergesellschaft sowie Unternehmen in Biberist profitie -

Generisches EV-Akku-Paket auf einer Produktionslinie in der Automobilindustrie. (Bild: Shutterstock)
ren auch untereinander von neuen Kooperationsmöglichkeiten. Während die Librec AG im Batterie-Recycling ihre Rückgewinnungsraten bei den Batterie-Rohstoffen weiter ausbauen kann, ergänzt die Grensol AG ab 2025 das FahrzeugRecycling mit der Verarbeitung der restlichen Automobilbauteile wie den gemischten Kunststoffen, den Metallfragmenten sowie in der Autoglasverwertung. Die Libattion AG
schliesslich bringt im Thema der Batteriespeicherung ihr international führendes Knowhow im Up-Cycling ein. Die Hiag als Areal-Eigentümerin der Papieri Biberist kann die Standortattraktivität der Papieri mit der Entwicklung des Kreislaufzentrums für Elektromobilität weiter erhöhen.
www.sipbb.ch

Be inspired, be there!

Coperion rüstet sein Test-Center in Niederlenz (AG) mit räumlicher Abgrenzung aus. Der Anbieter von Dosier- und Fördertechnik sowie SchüttgutHandling verfügt neu über Containment-Systeme, welche die Sicherheit des Testprozesses, der Mitarbeitenden und der Umwelt sicherstellen.
Die Coperion K-Tron (Schweiz) GmbH führt für ihre Kunden rund 150 Versuche pro Jahr durch. Dabei testet sie verschiedenste Materialien wie Kunststoffgranulate, Pulver, Flocken oder Flüssigkeiten sowie Endprodukte wie Flaschenverschlüsse, Schokoladenchips oder Frühstückscerealien.

Die Erweiterung des Test-Centers soll bis im April 2025 abgeschlossen sein. (Bild: Coperion K-Tron)
Jetzt wird ein neuer Bereich des Test-Centers mit modernster Technologie ausgestattet, um höchste Sicherheits- und Effizienzstandards zu ermöglichen. Der Standort wird für die Handhabung aller Arten von Materialien über Containment-

Verdient Ihr Unternehmen eine Top-Adresse?
VIA bietet Ihnen flexible, moderne Büroflächen direkt am Bahnhof Basel SBB.
• Flexible Flächen von 200 bis 18‘000 m2
• Top-modernisiert und voll ausgebaut
• Kühldecken für ein angenehmes Raumklima
• Moderne Infrastruktur mit Auditorium
• Meeting-Spaces und Food-Lounge
• Repräsentative Lobby mit Empfang via-basel.com

Systeme mit Luftschleusensystemen verfügen. Damit können nun auch Kunden aus der Batterie-, Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie, wo Containment- und Hygieneanforderungen ein kritisches Thema sind, umfangreiche Versuche durchführen.
Die Kundenversuche dienen einem doppelten Zweck: Mit ihnen werden zum einen das Verhalten spezifischer Schüttgüter getestet und Herausforderungen identifiziert und gelöst, bevor sich der Kunde zum Kauf entscheidet. Das Ziel eines jeden Tests besteht darin, dem Interessenten die für ihn am besten geeignete Dosier-
und/oder Förderanlage anzubieten. Darüber hinaus dient das Test-Center den Forschungs- und Entwicklungsteams, ihre Prototypen zu testen oder bestehende Anlagen und Prozesse zu verbessern. Dadurch werden auch die Zusammenarbeit und der Wissensaustausch gefördert. Kunden können so die neuesten technologischen Entwicklungen für ihre Herausforderungen evaluieren. Alle Versuchsergebnisse fliessen in eine globale Datenbank ein, die über 15 000 Werkstoffe umfasst.
www.coperion.com

Wasseranalytik ohne Labor DIMA-easyTOC mit DIMA-easyTNb
Kompakt – Leistungsstark – Preiswert
TOC/TNb-Kompaktanalysator bei geringem Probenaufkommen
Schnelle Analysen bei einfachster Handhabung Sie benötigen lediglich eine 230V-Steckdose
DIN-konform nach EN 1484 und EN 12260 www.dimatec.de
Analysentechnik GmbH
DIMATEC
Analysentechnik GmbH DE-79112 Freiburg (TB-Südwest)
Tel. +49 (0) 76 64 / 50 58 605 essen@dimatec.de www.dimatec.de
Labor | Wasser | Gas
Sie erhalten die DIMATEC-Systeme auch bei unserem Schweizer Vertriebspartner ensola AG 8902 Urdorf
Tel. +41 (0)44 870 88 00 info@ensola.com www.ensola.com
■ Infostelle SCV
Schweizerischer Chemieund Pharmaberufe Verband Postfach 509 CH-4005 Basel info@cp-technologe.ch www.cp-technologe.ch
■ Präsident Kurt Bächtold Bodenackerstrasse 15F CH-4334 Sisseln praesident@cp-technologe.ch
■ Höhere Fachprüfung Chemietechnologe Remo Kleeb weiterbildung@cp-technologe.ch
■ Termine Alle Termine online anschauen: www.cp-technologe.ch

GV im Restaurant Mühle –Amtsantritt
An der letztjährigen GV hat Stefan Zenklusen seinen Rücktritt als Präsident und Silvio Abgottspon seinen Rücktritt als Aktuar bekanntgegeben. An ihrer Stelle wurden Tommy Hellmut und Patrick Vogel neu in den Vorstand gewählt. Nach einem harten Wahlkampf (:-)) führte von da an Tommy Hellmut die Kasse und Patrick Vogel wurde Aktuar. Das Amt als Präsident wurde dann mir zugesprochen. Ich war bis dato bereits 14 Jahre in der Vereinigung als Kassier und hatte den einen oder anderen Präsidenten schon kommen und gehen sehen. Schon früher hatte ich mit dem Gedanken gespielt, vielleicht mal ein anderes Amt einzunehmen im Verein. Dass es dann direkt der Chefposten wird, hätte ich nicht gedacht.
Wie es im Leben so ist, soll man immer wieder etwas neues ausprobieren, damit das Leben nicht eintönig wird: und so startete mein Kariere als Präsident der SCV-Sektion Oberwallis am 19. September 2024.
17. Februar –
Skitag in Zermatt
Zum diesjährigen Skitag fanden sich zwei Mitglieder in Zermatt ein. Orlando Juon hat mich am Bahnhof abgeholt und dann ging es direkt mit der GGB hoch in das traumhafte Skigebiet. Auf der Piste bekamen wir dann Gesellschaft von Jasmin, der Tochter von Orlando, die Skilehrerin ist und an diesem Tag frei hatte. Diese Gelegenheit habe ich, ohne mit der Wimper zu zucken, natürlich genutzt, um an meinem Fahrstil zu feilen. Es war ein wunderschöner Tag bei bes -
Frühling 2025 Interne Exkursion ORCA
6. Juni 2025 Exkursion Stadler Rail
12. September 2025 Curlingplausch
27. September 2025 Familientag Alba
22. November 2025 Klausur in Bern
23. Januar 2026
20. Juni 2026
GV 2026
DV SCV in Bern

tem Wetter und top Pistenverhältnissen. Danke Orlando für die gelungene Routenwahl an diesem Tag und die anschliessende sichere Ablieferung nach dem «Hännustall» am Bahnhof. Danke auch Jasmin für die wertvollen Tipps.
24. Mai –Grillplausch für Lehrlinge
Von den Lehrlingen war ich im Mai etwas enttäuscht. Sie sind als Freimitglieder in der Vereinigung dabei und bezahlen keinen Jahresbeitrag, dürfen aber überall dabei sein. Für den Grillplausch habe ich alle
Lehrlinge eingeladen für einen gemütlichen Austausch an einem Feierabend. Leider habe ich keine Anmeldung und auch keine Rückmeldung erhalten. Ich werde dies gegebenenfalls in zwei Jahren nochmal versuchen. Dazu sollten sich die Lehrlinge aber mehr selber einbringen.
7. Juni –Exkursion Lötschberg
Die Exkursion in den Lötschberg-Basistunnel hatte ich in einem Bericht zusammengefasst und in der ChemieXtra publiziert. Ich hoffe, dass ihr


diesen gelesen habt und meinen Worten entnehmen konntet, wie schön und interessant dieser Ausflug gewesen war.
20. September –Dart-Turnier
Acht Mitglieder trafen sich im September, um ihre Zielgenauigkeit zu verbessern. Die meisten waren blutige Anfänger, doch unter ihnen schlummerte auch ein Talent. Matthias Escher hat als erster das «Bullseye» getroffen und somit die von mir angekündigte Belohnung erhalten. Der auch anwesende Bier-Sommelier hat mit den Biervorlieben von Matthias eine Männerhandtasche mit sechs Spezialbieren zusammengestellt. Diese Belohnung, zusammen mit dem Jubiläumssackmesser der SCV-Sektion Oberwallis, durfte ich dann feierlich an Matthias übergeben. Zwischen den Turnieren haben wir einen Rundgang durch die Briger Bierbrauerei gemacht, welche sich im hinteren Teil der Joker Bar befindet. In dieser gemütlichen Runde konnten wir es uns bei Bier und Snacks gemütlich machen und so zusammen einen gelungenen Feierabend verbringen. Ich freue mich bereits auf eine Fortsetzung beim nächsten Sportanlass.
28. September –Familientag in der Alba Am Familientag konnte ich letztes Jahr leider nicht teilnehmen, da ich in Deutschland bei einem Kollegen zum Poltern eingeladen war. Patrick, Tommy und natürlich Orlando waren in der Alba zusammen mit fünf Mitgliedern und ihren Liebsten versammelt und verbrachten zusammen einen gemütlichen Tag. Wie mir zu Ohren gekommen ist, hatten die Alteingesessenen viel Sitzleder,



Ehrenmitgliedschaft für 25 Jahre Vorstandsarbeit von Orlando Juon –Patrick Vogel (Aktuar), Orlando Juon, Michael Wyer (Präsident).
was mir doch zeigt, dass der Anlass sehr geschätzt wird und ein fester Bestandteil für den kollegialen Zusammenhalt unter den Mitgliedern ist. Danke an alle, die fleissig dabei sind und so auch den Organisatoren für ihre Arbeit eine Wertschätzung schenken.
8. November –Exkursion Apollo
Der Rundgang wurde durch zwei unserer Mitglieder, Philipp Gattlen und Jörg Schnydrig, geleitet. Es war ein sehr interessanter Rundgang durch die neuen Anlagen mit vielen lustigen Anekdoten der Führer. Versammelt haben sich vor dem Apollo 20 Mitglieder. Es kamen Kollegen aus der DSM sowie der Arxada. Sogar zwei Pensionäre wären ebenfalls gerne dabei gewesen, doch leider fand am gleichen Tag der Pensioniertentag von Lonza statt. Es hat mich gefreut, so viele von euch beim Rundgang anzutreffen. Eine Handvoll der anwesenden Mitglieder hat sich anschliessen in das Restaurant Mühle begeben und konnte dort eine gediegene Walliser Platte und etwas zu trinken geniessen.
2. Dezember – Vereinbarung Lonza AG und MA Mitte 2024 habe ich mit Giovanni Gallo das Gespräch gesucht, um die Vereinbarung, die dem einen oder anderen noch bekannt ist, zu aktualisieren. Es gab recht viele Punkte, die in der Vereinbarung von 2010 nicht mehr angewendet werden konnten, und somit nicht wirklich aussagekräftig waren bei den Diskussionen. Ich freue mich, euch nun die neue Vereinbarung zu präsentieren, in der wir wieder klar geregelt haben, dass Ihr bei Exkursionen den halben Tag als Kursgutschrift erhaltet. Weiter ist wieder klar geregelt, dass Delegierte oder andere Vorstandsmitglieder sowie Mitglieder im Zentralvorstand für die aufgewendeten Sitzungen eine Zeitgutschrift bei ihrem Vorgesetzen (Time Keeper) beantragen können. Solltet Ihr keine Unterstützung von Euren Vorgesetzen erhalten, wendet Ihr Euch bitte direkt an mich. Ich werde dies über das HR einspeisen, sodass Ihr zu Eurer Zeitgutschrift kommt.
Liebe Mitglieder, nun bin ich bereits ein Jahr Präsident und
konnte dabei ein paar schöne Anlässe mit Euch durchführen. Bis auf den Familientag konnte ich auch an allen Anlässen teilnehmen. Ich muss sagen: Es hat mir richtig Spass gemacht! Es war sicher etwas mehr Arbeit als gewohnt. Während dem letzten Jahr habe ich mein altes Amt als Kassier an Tommy übergeben und musste hier halt doch nochmals «durch alles durch». Ebenso wurde Patrick in seinem neuen Amt als Aktuar eingearbeitet. Von ihm werdet Ihr nächstes Jahr sicher mehr vermerken. Wie Ihr sicher auch gemerkt habt, verschicke ich die Einladungen jetzt immer mit einem Link, unter dem Ihr Euch direkt an- oder abmelden könnt. Bitte nutzt diese Möglichkeit, denn sie erleichtert uns die Organisation stark, sodass wir uns nicht durch unzählige E-Mails kämpfen müssen.
Während des letzten Jahres war ich ausserdem auf intensiver Suche nach einem Nachfolger für Orlando Juon. Leider habe ich trotz allen Bemühungen bislang nur Absagen erhalten. Einen zweiten Orlando werde ich mit Sicherheit nicht finden –Kollegen, die über Jahre mit Leib und Seele im Vorstand mit dabei sind, sind heute leider schwer zu finden. Ich hoffe, wir werden in diesem Jahr jemanden finden, da es auch Orlando verdient hat, nach so vielen Jahren sein Amt niederzulegen. Wer den Vorstand dabei unterstützen möchte, darf sich gerne bei mir melden.
Zu guter Letzt: Ohne Euch, werte Kollegen im Vorstand, wäre die Arbeit nur halb so schön. Daher danke ich Euch für eure gute Mithilfe!
Michael Wyer, Januar 2025
Jubilaren-Ehrungen 2024
An der 27. Generalversammlung 2025 wurden erneut Mitglieder für ihre langjährige Sektionszugehörigkeit geehrt. Dabei durften Sie während dem Anlass eine edle Flasche Wein entgegennehmen. Leider konnten nicht alle Jubilare persönlich anwesend sein und liessen sich entschuldigen.
50 Jahre Verbandszugehörigkeit
Dem Jubilar Kurt Illner wurde in Anerkennung seiner Treue zum Verband und zur Sektion Nordwestschweiz vom Vorstandsmitglied Martin Nagel eine Flasche Wein überreicht.
Weitere Jubilare
Folgende Jubilare mussten ihre Teilnahme an der Generalversammlung absagen:

Martin Nagel (r.) übergibt Kurt Illner (l.) den Wein für seine 50-jährige Verbandszugehörigkeit. (Bild: SCV)
45 Jahre Verbandszugehörigkeit: Roger Blöchliger
35 Jahre Verbandszugehörigkeit: Felice Bertolami; Thomas Börlin
Die Sektion Nordwestschweiz wünscht allen vier Jubilaren ein herzliches Dankeschön für ihre langjährige Treue zum Verband beziehungsweise zur SCV Sektion Nordwestschweiz.
Für die SCV-Sektion Nordwestschweiz
Martin Nagel, Vorstand i.V. E-Mail-Kontakt: SCV-Sektion-NWS@bluewin.ch

Der Zentralvorstand des SCV wünscht allen frohe Ostern und einen schönen Frühling.


In einem einzigen Gramm Boden finden sich mehr Mikroorganismen

als Menschen auf der Erde. Doch den Lebewesen in der Erde wird oft wenig Beachtung geschenkt. Dabei zeichnet sich der Boden durch eine Fülle an Biodiversität aus und hat eine immense Bedeutung auch für uns Menschen. Von Bakterien, Ursprung allen Lebens, über unersättliche Milben bis hin zu schlauen netzwerkenden Schleimpilzen und «unsterblichen» Bärtierchen ist der Boden bevölkert von faszinierenden Organismen. Der Bildband «Drecksarbeit – Der Mikrokosmos unter unseren Füssen» ist ab sofort erhältlich.
Die spektakulären Aufnahmen von Nicole Ottawa und Oliver Meckes (Eye of Science) zeigen die kleinen
Wesen erstmals umfassend und geben Einblick in einen Mikrokosmos, der den wertvollen Humus herstellt, Grundlage für alles, was oberirdisch wächst. Dafür haben sie unberührten Schwarzwaldboden unter die «Lupe» ihres Rasterelektronenmikroskops genommen. Ihre verblüffend detailreichen Fotografien zeigen durchscheinende Geisseltierchen und an Raumschiffe erinnernde Amöben, geharnischte Raubmilben, Hundertfüsser mit gewaltigen Giftklauen, das irisierende Farbspiel der Schleimpilze, aber auch vermeintlich Vertrautes wie die «Spikes» des Regenwurms oder die Kiemen der Assel. Vertieft werden die optischen Erkenntnisse mit spannenden und
Neben der reinen Inertisierung lassen sich mit der dynamischen Drucküberlagerung insbesondere auch hochreine Flüssigkeiten berührungslos und spaltenfrei pumpen (Hydrostatische Pumpe).
Die dynamische Druckregelung zwischen –1000 und +2500 mbar erfolgt entweder manuell über die entsprechende Federeinstellung oder über den Pilotregler und kann optional im EX-Bereich über die SPS gesteuert werden. Die hierfür vorgesehenen Zimmerli-Niederdruckregler sind in verschiedenen Materialien wie Edelstahl 1.4404, Hastelloy oder Kunststoff erhältlich und bieten dadurch hohe Langzeit-

Sulzer erweitert das Portfolio chemischer Technologielösungen um eine neue Schnellkondensationstechnologie für die Pyrolyse von Biomasse und Kunststoffen. Die neue Technologie wird bei der Erhitzung von Kunststoffen, der Pyrolyse, eingesetzt und kühlt die dabei entstehenden Gase schneller ab. Das daraus resultierende Pyrolyseöl kann als Brennstoff verwendet oder zur Herstellung wertvoller Chemikalien raffiniert werden. Die rasche Abkühlung der Pyrolysegase, das sogenannte «Quenching», verhindert weitere chemische Reaktionen und eine mögliche Pro -

wissenschaftlich fundierten Texten von Veronika Straass und Claus-Peter Lieckfeld. Das Zusammenspiel von Text und Fotografie lehrt das Staunen über den wimmelnden Mikrokosmos Erde. Abgerundet wird der Band mit einem Blick auf die Ursachen für die weltweit zu verzeichnenden rasanten Bodenverluste wie die herkömmliche Landwirtschaft – aber nicht, ohne Alternativen zu nennen, damit die faszinierende Lebenswelt im Untergrund weiterbestehen kann.
Dölling und Galitz Verlag www.dugverlag.de
ISBN 978-3-86218-172-8
stabilität und chemische Beständigkeit. Sie finden Anwendung in Bereichen wie Lagertanks, Reaktoren, Prozessbehältern, Zentrifugen und Nutschen.
Die Regler sind nicht nur für Stickstoff geeignet, sondern auch für Gase wie Erdgas, Methangas, Biogas, Wasserstoff sowie reine Flüssigkeiten. Abhängig vom Material sind die Regler mit verschiedenen Zertifikaten wie ATEX, FDA und weiteren verfügbar.
Zimmerli Messtechnik AG CH-4125 Riehen info@zimmerliag.com www.zimmerliag.com

duktzersetzung. So werden Qualität und Ertrag für das Kunststoffrecycling verbessert. Die neue Technologie berücksichtigt die wichtigsten betrieblichen
Herausforderungen mit einer AntiFouling-Technologie, einer wartungsarmen Konstruktion, einer flexiblen Kapazität und vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Letztere reichen von Polyolefinen (PP/ PE) und Polystyrol (PS) bis hin zu Biomasseabfällen. Sie ermöglicht eine optimale Reaktionskontrolle für Pyrolyseprozesse, was sich positiv auf den Ertrag auswirkt. Die mit «PyroCon» bezeichnete Lösung optimiert die Kondensation überhitzter Dämpfe durch eine Flüssigkeitsrückführung in einem Design, das Dampfeintrittstemperaturen von bis zu 600 Grad aus-
hält. Damit soll die Kreislaufwirtschaft für Lösungsmittel, Chemikalien und Kunststoffe gefördert werden. Tim Schulten, Divisionspräsident der Sulzer Chemtech. «PyroCon fördert den Kreislauf von Kunststoff- und Bioabfällen. Damit handelt es sich um eine wertvolle Technologie für nachhaltiges Abfallmanagement und Wertstoffrückgewinnung.»
Sulzer AG CH-8401 Winterthur chemtech@sulzer.com www.sulzer.com
Mikrowellenaufschlusssysteme zur Spurenelementanalyse können heute ein breites Spektrum an Proben verarbeiten und erreichen aktuell ein neues Niveau von Sicherheit, Probendurchsatz und betrieblicher Effizienz.

Diese Analyseverfahren mit ihrer zukunftsträchtigen Probenvorbereitung eignen sich unter anderem für Bereiche wie Batteriematerialien, Umweltproben, Lebensmittel und Futtermittel sowie Chemikalien und pharmazeutische Produkte. Spitzenleistungen liegen beispielsweise bei 64 Proben in einem einzigen Durchgang, gegebenenfalls verbunden mit komplexen Testbedingungen (z.B. bis zu 300 °C und 100 bar) sowie mit einem hochauflösenden 10.1-Zoll-Touchscreen für eine einfache Bedienung. Selbstkontrollen, Softwareverriegelungen und eine wiederverschliess-
bare Sicherheitstür sorgen für ein hohes Niveau an Sicherheit. Es besteht sogar die Option, ein Modell mit ETL- und GS-Zertifizierung zu wählen. Das bedeutet: Das Mikrowellenaufschlusssystem wurde unabhängigen Prüfungen zur Produktsicherheit unterzogen und erfüllt relevante Produktsicherheitsstandards (ETL, Electrical Testing Laboratories) und führt das nach deutschem Recht geregelte Gütesiegel «Geprüfte Sicherheit» (§ 20 Produktsicherheitsgesetz).
Wer nicht alle Vorzüge benötigt, kann sich für ein etwas kleineres Modell entscheiden. Dieses verar-
Die guten Trennleistungen und Empfindlichkeiten der Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatographie (UHPLC) werden zunehmend für die Grössenausschlusschromatographie (SEC) nutzbar gemacht und erweitern hier die Möglichkeiten von biopharmazeutischen Analysen. Kern dieser Entwicklung sind SECSäulen mit Partikeln im Bereich
von 2 Mikrometern und gutem Zusammenspiel mit zwei Detektorentypen. Besonders eignen sich solche Säulen für die Multi-WinkelLichtstreuung (MALS) und die Mas-

Dünn und dehnbar: latexfreie Einmalhandschuhe
Latexfreie Einmalhandschuhe können jetzt dank einer dünnen Ausführung (Wandstärke etwa 0,07 mm) und einer grossen Dehnbarkeit einen neuen Tragekomfort bieten.
Dabei handelt es sich um Nitrilhandschuhe mit einer speziell entwickelten Rezeptur. Diese bewirkt einen Schutz der Hände vor schädlichen Chemikalien, biologischen Gefahrstoffen und Kontaminationen und bewahren Proben und Arbeitsmaterialien vor Verunreinigungen. Ausserdem liegen Zertifikate für die Verwendung bei Kontakt mit Lebensmitteln vor. Die Handschuhe zeichnen sich durch ein angenehmes Tragegefühl und ein besonders gutes Tastempfinden aus. Texturierte Finger sorgen für einen sicheren Griff, auch bei Nässe. Darüber hinaus sind die Einmalhandschuhe so flexibel, so
beitet zum Beispiel «nur» 41 Proben in einem Durchgang und verzichtet auf die Zertifizierungen. Es verfügt aber wie der «grosse Bruder» über eine Reihe fortschrittlicher Rotorkonzepte, eine freihändige Türbedienung, eine lange Lebensdauer der einzelnen Komponenten und ein Kühlsystem für schnelle Prozesszeiten.
Anton Paar Germany GmbH D-Ostfildern-Scharnhausen info@anton-paar.com www.anton-paar.com
senspektrometrie (MS). Das Ergebnis sind geringe Hintergrundsignale, reduzierte Störungen und eine verbesserte Signalqualität. Diese aktuellen SEC-Säulen-Generation ist auch durch eine gute Reproduzierbarkeit und eine lange Lebensdauer gekennzeichnet. Ihr Haupteinsatzgebiet liegt in anspruchsvollen Einsatzgebieten der Bioanalytik. Dazu zählen die Charakterisierung von Proteinen, Antikörpern und biotherapeutischen Molekülen.
Sebio GmbH CH-4450 Sissach info@sebio.ch www.sebio.ch
dass sie beidhändig verwendet werden können, ohne zu spannen. Das Material ist frei von Phthalat, Weichmachern und Latex und puderfrei zu verwenden. Damit weist es eine hohe Hautfreundlichkeit auf und eignet sich insbesondere auch für Latexallergiker (z.B. Rotiprotect-Nitril light).

Roth AG CH-4144 Arlesheim info@carlroth.ch www.carlroth.ch

Ein neuer Fachbericht befasst sich mit der Optimierung der Hochleistungs-flüssigchromatographie (HPLC) für die Analyse von Polynukleotiden wie DNA und RNA mit «Halo Oligo C18»-Säulen. Im erwähnten Versuchsaufbau –durchgeführt mit einem «Nexera»HPLC-System von Shimadzu – kamen verschiedene mobile Phasen, Flussraten und Temperaturen zum Einsatz. Die Ergebnisse zeigen, dass die Ionenpaarung für die HPLC-Analyse von Oligonukleotiden unerlässlich ist, da sie durch Veränderung der Ladungseigenschaften die Trennung markant verbessert. Ebenso im Fokus steht die Retention von Oligonukleotiden: Der pH-Wert beeinflusst die Retention, sprich ein höherer pH-Wert kann zu einer geringeren Retention führen. Darüber hinaus können

auch Modifikationen an Oligonukleotiden deren Retention beeinflussen.
Im Versuch übertraf die «SPP Halo Oligo C18»-Säule die «FPP C18»Säule bei der Trennung von Oligonukleotiden. Selbst einzelsträngige RNA (ssRNA) unter Ionenpaarungsbedingungen, die geringere Reten -
tionsmerkmale aufweisen, werden erfolgreich aufgetrennt.
Daraus lässt sich schliessen, dass die Ionenpaarung eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Analyse von Oligonukleotiden spielt, während erhöhte pH-Werte und Modifikationen die Analyse zusätzlich erschweren können. Die
Dosierpumpen für Industrie und Anlagenbau verfügen immer häufiger über integrierte Kommunikationsschnittstellen und lassen sich damit direkt in bestehende Steuerungssysteme einbringen. Die Nachrüstung zusätzlicher Hardware ist damit nicht mehr erforderlich. Das reduziert Kosten, vereinfacht die Installation und sorgt für eine reibungslose Prozesssteuerung.
Bisher waren, selbst bei den TopModellen, für die Systemeinbindung von Dosierpumpen noch externe Module vonnöten. Dies ist jetzt mit integrierten Kommunikationsschnittstellen wie Modbus RTU/TCP, Ethernet und Bluetooth obsolet.
Für den Anwender machen digitale Steuerungen per App die Einrichtung, die Fernsteuerung und Firmware-Updates das Handling einer

Ionenchromatographie-Standards und -Eluenten
Neue Standards und Eluenten sorgen für eine zuverlässige und komfortable chemische Analytik im Umwelt- und Industriebereich mit der Ionenchromatographie. Die Ionenchromatographie (IC) dient zur Trennung und Quantifizierung von anorganischen Ionen, Anionen und Kationen, in komplexer Matrix. Der Schlüssel zur Reproduzierbarkeit, Genauigkeit und niedrigen Nachweisgrenzen liegt dabei in zuverlässigen IC-Standards und Eluenten. In diesem Sinne hat die Firma Inorganic Ventures (IV) jetzt ihre Produktpalette um mehr

als zwölf IC-Standards in Reagenzien-Qualität erweitert. Alle sind vollständig auf NIST-Standards (National Institute of Standards and Technology) rückführbar und auf hohe Reinheit, Langzeit-Stabilität und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Insgesamt bietet Inorganic Ventures mehr als 70 IC-Standard-Lösungen an, die die meisten Umwelt- und Industrieanwendungen abdecken. Der Anionen-Standard IC-FAS-1A enthält die folgenden Anionen: Cl –, F –, NO3–, PO4 –3, SO4 –2 , Br- und NO2–. Der Kationen-Standard IV-STOCK-7 enthält: NH4+,
«Halo Oligo C18»-Säule zeichnete sich dabei aus durch eine erfolgreiche Auftrennung von ssRNA. Kurz: Die Integration der Ionenpaarung, die sorgfältige Berücksichtigung des pH-Werts und der Partikelmorphologie sind entscheidend für die Optimierung der Oligonukleotidanalyse.
Über den QR-Code geht es zum von infochroma kostenlos zur Verfügung gestellten Fachbericht.
infochroma AG CH-6410 Goldau info@infochroma.ch www.infochroma.ch
solchen Dosierpumpe besonders komfortabel. Wer mehrere betreibt, kann heute mit einer extra Softwarefunktion sogar Konfigurationen von einer auf die anderen Pumpen übertragen. Das spart Zeit und reduziert Fehlerquellen.
SDD GmbH
CH-6365 Kehrsiten info@sdd-pumpen.ch www.sdd-pumpen.ch
Ca+2, Ba+2, Mn+2, Sr+2, Li+, Mg+2, K+ und Na+. Zu den gängigen Eluenten für die Anwendung in der Ionenchromatographie, die von IV vertrieben werden, gehören Natriumcarbonat, Natriumbicarbonat, Kaliumhydroxid und Methansulfonsäure. Beratung und Vertrieb dieser Standards im deutschsprachigen Raum übernimmt die Firma Spetec in Erding.
Spetec GmbH D-85435 Erding info@spetec.de www.spetec.de

ANTRIEBSTECHNIK





Ihr Spezialist für Anlagen und Prüfmittel in der ZfP www.helling.de

Helling GmbH Spökerdamm 2 D-25436 Heidgraben Tel.: +49 4122 922-0 info@helling.de



FAULHABER SA Croglio · Switzerland Tel. + 41 91 611 31 00 www.faulhaber.com
ABSPERRKLAPPEN FÜR DIE CHEMISCHE INDUSTRIE

ABSPERRKLAPPEN FÜR DIE CHEMISCHE INDUSTRIE



Rötzmattweg 105

CH-4600 Olten Tel. +41 (0)62 207 10 10
IEP Technologies GmbH info.iep.ch@hoerbiger.com - www.ieptechnologies.com

ABWASSERBEHANDLUNG ABWASSERBEHANDLUNG

Ihr Partner für individuelle Abwasserbehandlung FLONEX AG sales@flonex.ch CH-4127 Birsfelden www.flonex.ch Sternenfeldstrasse 14 Tel. +41 61 975 80 00

ALLGEMEINE LABORMESSUND ANALYSEGERÄTETITRATION

Metrohm Schweiz AG Industriestrasse 13 CH-4800 Zofingen
Schweiz AG

Telefon +41 62 745 28 28

Telefax +41 62 745 28 00
E-Mail info@metrohm.ch www.metrohm.ch


ANALYTIK UND ÖKOTOXIKOLOGIE
ANALYTIK UND ÖKOTOXIKOLOGIE
Ihr Auftragsforschungslabor in Witterswil.
IES Ltd
Benkenstrasse 260 4108 Witterswil
Tel. + 41 (0)61 705 10 31 info@ies-ltd.ch www.ies-ltd.ch
ANLAGEN- UND APPARATEBAU
ANLAGEN- UND APPARATEBAU

Industrie Neuhof 30 3422 Kirchberg
Anlagenbau AG


Rohrleitungsbau AG

APPARATE-, ANLAGENUND MASCHINENBAU

APPARATE-, ANLAGENUND MASCHINENBAU





Theodorstr. 10 | D-70469 Stuttgart Tel +49 711 897-0 | Fax +49 711 897-3999 info@coperion.com | www.coperion.com

APPARATEBAU ANLAGEN- UND APPARATEBAU








Rohrleitungsbau AG Anlagenbau – Apparatebau

Helblingstrasse 10 4852 Rothrist Telefon 062 785 15 15 info@fischer-rohrleitungsbau.ch www.fischer-rohrleitungsbau.ch
ANLAGEN- UND APPARATEBAU




ARMATUREN





ASEPTISCHE VENTILE


Tel. +41 34 447 70 00 Fax +41 34 447 70 07 info@anlagenbau.ch www.anlagenbau.ch
Ihr Partner für ProzesstechnikANLAGEN- UND APPARATEBAU

Helblingstrasse 10 4852 Rothrist
GEMÜ Vertriebs AG Schweiz Telefon: 041 799 05 55 E-Mail: vertriebsag@gemue.ch · www.gemue.ch
AUFTRAGSANALYSEN
Anlagenbau – Apparatebau
Telefon 062 785 15 15 info@fischer-rohrleitungsbau.ch www.fischer-rohrleitungsbau.ch ANLAGEN- UND APPARATEBAU




ANTRIEBSTECHNIK ANTRIEBSTECHNIK



Elektromotorenwerk
Brienz AG
Mattenweg 1 CH-3855 Brienz Tel. +41 (0)33 952 24 24 www.emwb.ch



AUFTRAGSANALYSEN
In Grosswiesen 14 8044 Gockhausen/Zürich Tel 044 881 20 10 www emott ch / info@emott ch











CHROMATOGRAPHIESÄULEN
Swit erland
eS v n g
Gewerbestrasse 10 CH-4450 Sissach
Tel. +41 61 971 83 44 Fax +41 61 971 83 45 info@sebio.ch www.sebio.ch




DÜSEN DÜSEN
DICHTUNGEN
DICHTUNGEN
liquitec AG
Industrie Neuhof 54 CH-3422 Kirchberg

T +41 55 450 83 00
F +41 55 450 83 01



info@liquitec.ch www.liquitec.ch
DIENSTLEISTUNGEN
DIENSTLEISTUNGEN

DACHSER Spedition AG Regional Offi ce Switzerland Althardstrasse 355 CH-8105 Regensdorf Phone +41 (0)44 8721 100 dachser.regensdorf@dachser.com dachser.ch


Spraying Systems Switzerland AG Eichenstrasse 6 · 8808 Pfäffikon Tel. +41 55 410 10 60 info.ch@spray.com · www.spray.com/de-ch
ERP-SOFTWARE ERP-SOFTWARE


casymir schweiz ag Fabrikmattenweg 11 CH-4144 Arlesheim www.casymir.ch kontakt@casymir.ch Tel. +41 61 716 92 22



DIENSTLEISTUNGEN

Weidkamp 180 DE-45356 Essen
Technical Laboratory Services Europe GmbH & Co. KG
Tel. +49 201 8619 130 Fax +49 201 8619 231 info@teclabs.de www.teclabs.de
Herstellerübergreifender Service für HPLC und GC
DISPENSER / PIPETTEN
DISPENSER / PIPETTEN
Socorex Isba S A • Champ-Colomb 7a • 1024 Ecublens socorex@socorex.com • www.socorex.com
DOSIERPUMPEN PUMPEN


ABSPERRKLAPPEN FÜR DIE CHEMISCHE INDUSTRIE
EXPLOSIONSSCHUTZ




Rötzmattweg 105 CH-4600 Olten Tel. +41 (0)62 207 10 10
IEP Technologies GmbH info.iep.ch@hoerbiger.com - www.ieptechnologies.com

EXPLOSIONSSCHUTZ, EX-GERÄTE (ATEX) PROZESSAUTOMATION

Längfeldweg 116 · CH-2504 Biel/Bienne Telefon +41 32 374 76 76 · Telefax +41 32 374 76 78 info@ch.pepperl-fuchs.com · www.pepperl-fuchs.ch
FABRIKPLANUNG

Rte du Pra Rond 4 CH-1785 Cressier / FR Tél. +41 26 674 93 00 Fax +41 26 674 93 02 Internet: www.iwaki.ch E-mail: info@iwaki.ch DOSIERPUMPEN

KNF Neuberger GmbH Business Unit Lab PUMPEN

Alter Weg 3 DE-79112 Freiburg
Tel. +49 (0) 7664 5909 0 backoffice.lab@knf.com www.knf.com

Pumpen | Ersatzteile | Instandhaltung www.rototec.ch
Luzernstrasse 224C| CH-3078 Richigen +41 31 838 40 00 | info@rototec.ch

Prozesse – Anlagen – Fabriken Konzepte – Planung – Realisierung www.assco.ch ∙ info@assco.ch
FARBMESSUNG (FLÜSSIGKEITEN)
FARBMESSUNG (FLÜSSIGKEITEN)
FARBMESSUNG (FLÜSSIGKEITEN)



• Photometer • Messgeräte • Reagenzien

FILTER FILTER

Bachmannweg 21 CH-8046 Zürich T. +41 44 377 66 66 info@bopp.ch www.bopp.com


FILTER

Sefiltec AG · Separation- und Filtertechnik Engineering Haldenstrasse 11 · CH-8181 Höri · Tel. +41 43 411 44 77 Fax +41 43 411 44 78 · info@sefiltec.com · www.sefiltec.com

Trenntechnik Siebe + Filter Metallgewebe
FILTERPATRONEN FILTERPATRONEN
TECmetall 5436 Würenlos T +41 44 400 12 80 info@tecmetall.ch www.Lochblech.ch www.shopmetall.ch


iFIL AG
Industriestrasse 16 CH-4703 Kestenholz www.ifil.eu.com info@ifil.eu.com

FLÜSSIGKEITSPUMPEN DOSIERPUMPEN

KNF Neuberger GmbH Business Unit Lab
Alter Weg 3 DE-79112 Freiburg Tel. +49 (0) 7664 5909 0 backoffice.lab@knf.com www.knf.com
FÜLLSTAND FLUORESZENZ-SPEKTROSKOPIE

Aquasant Messtechnik AG T +41 61 935 5000|www.aquasant.com
GASE / GASVERSORGUNG GASE/GASVERSORGUNG

Hach Lange GmbH Rorschacherstr. 30 a 9424 Rheineck Tel. 084 855 66 99 Fax 071 886 91 66 www.ch.hach.com

FIBEROPTIKSCHAUGLASLEUCHTEN
INNOVATIV, NACHHALTIG, FLEXIBEL!
H. Lüdi + Co. AG Moosäckerstrasse 86 8105 Regensdorf P +41 44 843 30 50 E sales@hlag.ch W www.hlag.ch

FIBEROPTIKSCHAUGLASLEUCHTEN

PROCESS ILLUMINATION AND OBSERVATION SWISS EXCELLENCE
Hagmattstrasse 19 CH–4123
GASGEMISCHE, SPEZIALGASEGASGEMISCHE, SPEZIALGASE
Messer Schweiz AG Seonerstrasse 75 5600 Lenzburg
Tel. +41 62 886 41 41 · info@messer.ch · www.messer.ch


Industrie ogistik
Maschinentransporte
Kranarbeiten
De- und Remontagen
Schwertransporte
Schwergutlager


Kälte- und Klimaanlagen
Ostringstrasse 16 4702 Oensingen
Tel. +41 62 388 06 06 Fax +41 62 388 06 01 kaelte@pava.ch www.pava.ch
LABOR- / MEDIKAMENTENUND BLUTKÜHLSCHRÄNKE

Wir vertreiben und bieten Service für Laborschränke der folgenden Marke:
HETTICH AG | 8806 Bäch SZ | +41 44 786 80 20 sales@hettich.ch | www.hettich.ch Succursale Suisse Romande (Canton de Vaud) Tél. +41 44 786 80 26
LOGISTIK
LOGISTIK

DACHSER Spedition AG Regional Offi ce Switzerland Althardstrasse 355 CH-8105 Regensdorf Phone +41 (0)44 8721 100 dachser.regensdorf@dachser.com dachser.ch



MEMBRANPUMPEN DOSIERPUMPEN

KNF Neuberger GmbH Business Unit Lab PUMPEN

Alter Weg 3 DE-79112 Freiburg
Tel. +49 (0) 7664 5909 0 backoffice.lab@knf.com www.knf.com

Rte du Pra Rond 4 CH-1785 Cressier / FR Tél. +41 26 674 93 00 Fax +41 26 674 93 02 Internet: www.iwaki.ch E-mail: info@iwaki.ch


MESSTECHNIK MESSTECHNIK

KOMPRESSOREN 100% ÖLFREI
KOMPRESSOREN 100% ÖLFREI


KAESER Kompressoren AG
KREISELPUMPEN PUMPEN

Grossäckerstrasse 15 8105 Regensdorf Tel. +41 44 871 63 63 Fax +41 44 871 63 90 info.swiss@kaeser.com www.kaeser.com


Rte du Pra Rond 4 CH-1785 Cressier / FR Tél. +41 26 674 93 00 Fax +41 26 674 93 02 Internet: www.iwaki.ch E-mail: info@iwaki.ch


KÜHL- UND TIEFKÜHLCONTAINER
KÜHL- UND TIEFKÜHLCONTAINER
AUCH FÜR ZERTIFIZIERTE PROZESSE MIT INTEGRALER DOKUMENTATION, +41 41 420 45 41 gabler-container.ch
LABORBAU / LABOREINRICHTUNGEN GASE/GASVERSORGUNG
INNOVATIV, NACHHALTIG, FLEXIBEL!
LABORBEDARF
committed to science
Ihr Vollversorger für Laborbedarf & Laborgeräte LABORBEDARF LABORBEDARF

LOHNABFÜLLUNG
LOHNABFÜLLUNG
Industrie Allmend 36 4629 Fulenbach +41 62 387 74 35 printsupplies@fischerpapier.ch
LOHNABFÜLLUNG LOHNABFÜLLUNG

Inserat_FiP_ChemieExtra_60x22_DE.indd 1


Mischwerk Trockenmischungen Flüssigmischungen www.mmb-baldegg.ch

MAGNETPUMPEN PUMPEN


H. Lüdi + Co. AG Moosäckerstrasse 86 8105 Regensdorf
P +41 44 843 30 50 E sales@hlag.ch W www.hlag.ch
HUBERLAB. AG Industriestrasse 123 CH-4147 Aesch T +41 61 717 99 77 info@huberlab.ch www.huberlab.ch
VEGA Messtechnik AG Barzloostrasse 2 · 8330 Pfäffikon ZH www.vega.com · info.ch@vega.com
MIKROBIOLOGIE MIKROBIOLOGIE
Gewerbestrasse 10 CH-4450 Sissach
10.01.20 11:19

Rte du Pra Rond 4 CH-1785 Cressier / FR Tél. +41 26 674 93 00 Fax +41 26 674 93 02 Internet: www.iwaki.ch E-mail: info@iwaki.ch


DICHTUNGEN
MAGNETRÜHRER
liquitec AG
Industrie Neuhof 54 CH-3422 Kirchberg

T +41 55 450 83 00 F +41 55 450 83 01



info@liquitec.ch www.liquitec.ch
MASSENSPEKTROMETRIE CHROMATOGRAPHIESÄULEN

Tel. +41 31 972 31 52 Fax +41 31 971 46 43 info@msp.ch www.msp.ch

MEMBRANEN MEMBRANEN



Track-etched (PC/PET) membranes, coated (Au, Al) for: -Particle analysis (Pharmaceuticals & Microplastics) -Asbestos analysis (VDI 3492) www.i3membrane.de lab@i3membrane.de

PAPIER- UND MEMBRAN FILTRATION CHROMATOGRAPHIESÄULEN
Gewerbestrasse 10 CH-4450 Sissach Tel. +41 61 971 83 44 Fax +41 61 971 83 45 info@sebio.ch www.sebio.ch vreS n g Sc encein Switzerland PIPETTENKALIBRATIONEN PIPETTENKALIBRATIONEN


Wartung, Reparatur und Kalibration Ihrer Pipetten und anderen Volumenmessgeräten Akkreditiertes Kalibrierlabor Labor Service GmbH Eichwiesstrasse 2 CH-8645 Rapperswil-Jona info@laborservice.ch Tel. +41 (0)55 211 18 68 www.laborservice.ch


Aquasant Messtechnik AG T +41 61 935 5000|www.aquasant.com

PROZESSAUTOMATION PROZESSAUTOMATION
Längfeldweg 116 · CH-2504 Biel/Bienne Telefon +41 32 374 76 76 · Telefax +41 32 374 76 78 info@ch.pepperl-fuchs.com · www.pepperl-fuchs.ch
RÜHRTECHNIK RÜHRTECHNIK

Anlagenbau AG Ihr Partner für Prozesstechnik
Industrie Neuhof 30 3422 Kirchberg


Tel. +41 34 447 70 00 Fax +41 34 447 70 07 info@anlagenbau.ch www.anlagenbau.ch
SCHAUGLASARMATUREN FIBEROPTIKSCHAUGLASLEUCHTEN

PUMPEN
CH-4314 Zeiningen • infoo@almatechnik-tdf.ch • ww w.almatec hnik-tdf.ch
PUMPEN PUMPEN


PROCESS ILLUMINATION AND OBSERVATION
SWISS EXCELLENCE SINCE 1936
www.maxmuller.com info.ch@maxmuller.com +41 61 487 92 92
Hagmattstrasse 19 CH–4123 Allschwil SWITZERLAND
SCHAUGLASLEUCHTEN FIBEROPTIKSCHAUGLASLEUCHTEN

Pumpen Rührwerke
4153 Reinach BL Tel. +41 61 711 66 36 alowag@alowag.ch www.alowag.ch PUMPEN




PROCESS ILLUMINATION AND OBSERVATION
SWISS EXCELLENCE SINCE 1936
www.maxmuller.com info.ch@maxmuller.com +41 61 487 92 92
Hagmattstrasse 19 CH–4123 Allschwil SWITZERLAND
FIBEROPTIKSCHAUGLASLEUCHTEN

SCHEIBENWISCHER FÜR SCHAUGLÄSER

Rte du Pra Rond 4 CH-1785 Cressier / FR Tél. +41 26 674 93 00 Fax +41 26 674 93 02 Internet: www.iwaki.ch E-mail: info@iwaki.ch PUMPEN


Pumpen | Ersatzteile | Instandhaltung www.rototec.ch
Luzernstrasse 224C| CH-3078 Richigen +41 31 838 40 00 | info@rototec.ch PUMPEN



AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER


PROCESS ILLUMINATION AND OBSERVATION
SWISS EXCELLENCE SINCE 1936
ARMATUREN
www.maxmuller.com info.ch@maxmuller.com +41 61 487 92 92
Hagmattstrasse 19 CH–4123 Allschwil
liquitec AG

SDD GmbH Spichermatt 8 CH-6365 Kehrsiten +41 41 612 17 60 info@sdd-pumpen.ch www.sdd-pumpen.ch



ROTATIONSVERDAMPFER DOSIERPUMPEN

Alter Weg 3 DE-79112 Freiburg
Tel. +49 (0) 7664 5909 0 backoffice.lab@knf.com www.knf.com KNF Neuberger GmbH Business Unit Lab
RÜHRTECHNIK PUMPEN



Pumpen Rührwerke
4153 Reinach BL Tel. +41 61 711 66 36 alowag@alowag.ch www.alowag.ch
Industrie Neuhof 54 CH-3422 Kirchberg

T +41 55 450 83 00 F +41 55 450 83 01



info@liquitec.ch www.liquitec.ch
SICHERHEITSSCHRÄNKE NACH EN 14470-1/-2

SICHERHEITSSCHRÄNKE NACH EN 14470-1/-2


asecos Schweiz AG Sicherheit und Umweltschutz
asecos Schweiz AG Sicherheit und Umweltschutz


Gewerbe Brunnmatt 5, CH-6264 Pfaffnau
Gewerbe Brunnmatt 5, CH-6264 Pfaffnau Telefon 062 754 04 57, Fax 062 754 04 58
Telefon 062 754 04 57, Fax 062 754 04 58 info@asecos.ch, www.asecos.ch
SINGLE-USE

TECHNISCHE GLASBLÄSEREI / LABORFACHHANDEL

TECHNISCHE GLASBLÄSEREI / LABORFACHHANDEL
● Technische Glasbläserei
● Reparaturen
● Spezialanfertigungen
● Laborfachhandel
LabWare
Lab Instruments
Liquid Handling
Glaswaren www.glasmechanik.ch info@glasmechanik.ch
TEMPERATURMESSTECHNIK TEMPERATURMESSTECHNIK
Thermocontrol GmbH
Riedstrasse 14, 8953 Dietikon
Tel. +41 (0)44 740 49 00 Fax +41 (0)44 740 49 55 info@thermocontrol.ch www.thermocontrol.ch

TEMPERIERSYSTEME
TEMPERIERSYSTEME

JULABO GmbH

Gerhard-Juchheim-Strasse 1 77960 Seelbach / Germany










Tel. +49 (0) 7823 51-0 · info.de@julabo.com · www.julabo.com

TOC-ANALYSATOR TOC-ANALYSATOR

TOC und TNb Wasser- und Feststoffanalytik für Labor- und Online-Anwendungen TOC-ANALYSATOR


Nünningstrasse 22–24 D-45141 Essen
Tel. +49 (0) 201 722 390 Fax +49 (0) 201 722 391 essen@dimatec.de www.dimatec.de

Elementar Analysensysteme GmbH Elementar-Straße 1 D-63505 Langenselbold Tel. +49 6184 9393 – 0 info@elementar.com www.elementar.com
TRENNSCHICHTENMESSGERÄTE FLUORESZENZ-SPEKTROSKOPIE

Aquasant Messtechnik AG
T +41 61 935 5000|www.aquasant.com




TRÜBUNGSMESSUNG FLUORESZENZ-SPEKTROSKOPIE

TRÜBUNGSMESSUNG
Aquasant Messtechnik AG T +41 61 935 5000|www.aquasant.com
FARBMESSUNG (FLÜSSIGKEITEN)


• Photometer • Messgeräte • Reagenzien
Hach Lange GmbH

Rorschacherstr. 30 a 9424 Rheineck Tel. 084 855 66 99 Fax 071 886 91 66 www.ch.hach.com

ÜBERFÜLLSICHERUNG FLUORESZENZ-SPEKTROSKOPIE

Aquasant Messtechnik AG T +41 61 935 5000|www.aquasant.com
UV-LEUCHTEN UV-LEUCHTEN
P T M T LT R T V T U T

liquitec AG
WASSERANALYSEGERÄTE TOC-ANALYSATOR

Nünningstrasse 22–24 D-45141 Essen



Ihr Spezialist für Anlagen und Prüfmittel in der ZfP D Leuchten www.helling.de U LED-





VAKUUMPUMPEN DOSIERPUMPEN

KNF Neuberger GmbH Business Unit Lab

Helling GmbH Spökerdamm 2 D-25436 Heidgraben Tel.: +49 4122 922-0 info@helling.de

Alter Weg 3
DE-79112 Freiburg
Tel. +49 (0) 7664 5909 0 backoffice.lab@knf.com www.knf.com
VAKUUMPUMPSTÄNDE DOSIERPUMPEN

KNF Neuberger GmbH Business Unit Lab
Alter Weg 3 DE-79112 Freiburg
Tel. +49 (0) 7664 5909 0 backoffice.lab@knf.com www.knf.com

Industrie Neuhof 54 CH-3422 Kirchberg
T +41 55 450 83 00 F +41 55 450 83 01

GEMÜ Vertriebs AG Schweiz Telefon: 041 799 05 55 E-Mail: vertriebsag@gemue.ch · www.gemue.ch info@liquitec.ch www.liquitec.ch


WÄRME- UND TROCKENSCHRÄNKE

WÄRME- UND TROCKENSCHRÄNKE
Wir vertreiben und bieten Service für Wärme- & Trockenschränke der folgenden Marke:

Will & Hahnenstein GmbH D-57562 Herdorf
Tel. +49 2744 9317 0 Fax +49 2744 9317 17
info@will-hahnenstein.de www.will-hahnenstein.de

TOC und TNb Wasser- und Feststoffanalytik für Labor- und Online-Anwendungen
Tel. +49 (0) 201 722 390 Fax +49 (0) 201 722 391 essen@dimatec.de www.dimatec.de

ZAHNRADPUMPEN
ZAHNRADPUMPEN

Maag Pump Systems AG Aspstrasse 12 CH-8154 Oberglatt Telefon +41 44 278 82 00 welcome@maag.com www.maag.com
ZENTRIFUGEN ZENTRIFUGEN
Wir vertreiben und bieten Service für Zentrifugen der folgenden Marke:


Produktionsprozesse müssen vor allem sicher, zuverlässig und effizient sein. Mit unserer Messtechnik für Füllstand und Druck bekommen Sie genau das. Langlebige Sensoren und präzise Messwerte machen Ihre Arbeit smarter. Und Ihr Leben nachhaltig einfacher.
Alles wird möglich. Mit VEGA
