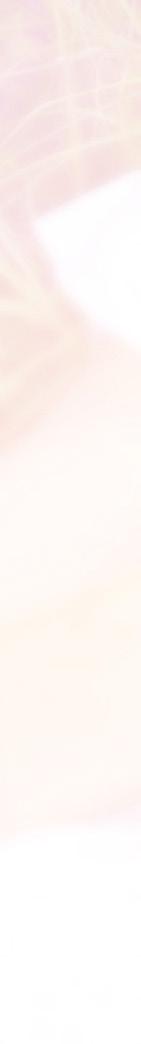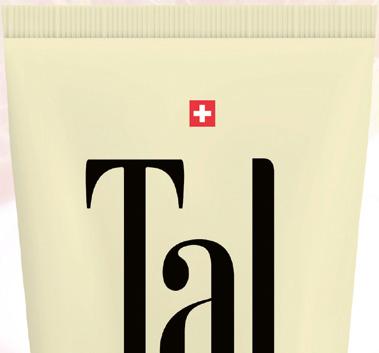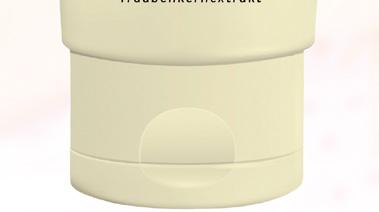natürlich Bewusst

Letzte Reise
Es wird Zeit für eine neue Sterbekultur
Mundhygiene
Mehr als nur Zähneputzen
Buntes Essen
Wie Farben unseren Appetit beeinflussen
Heilfarne
Wirksames Mittel gegen Angstzustände
Schmerzen
Was sie uns lehren können







Letzte Reise
Es wird Zeit für eine neue Sterbekultur
Mundhygiene
Mehr als nur Zähneputzen
Buntes Essen
Wie Farben unseren Appetit beeinflussen
Heilfarne
Wirksames Mittel gegen Angstzustände
Schmerzen
Was sie uns lehren können





Liebe Leserin, lieber Leser
Sexualität ist eine wunderbare Blume, ein Geschenk der Natur an uns alle, bei dem es sich immer wieder lohnt, tabufrei genau hinzuschauen. Wer das achtsam angeht, stellt schnell fest: Sexualität ist weit mehr als das übliche Rein-Raus-Ding, um das auf Tinder und Pornokanälen ein viel zu grosses Theater gemacht wird.
Achtsam und neugierig gelebte Sexualität ist für mich gleichbedeutend mit befreiter Lebensfreude. Und sie ist ein herrlich heilsamer Kontrast zur weltweit hochgehaltenen Corona-Pandemie, die viele Menschen in Angst vor dem Leben erstarren lässt, denn: Ganzheitliche Sexualität verbindet unser Innerstes mit unserem Körper und in einer Beziehung vereint sie sich mit dem Herzen und den körperlichen und seelischen Tiefen unseres Gegenübers. Mit anderen Worten: Sexualität macht uns lebendig, überwindet Alltagsängste und lässt uns einfühlsam, sensibel, verletzlich und gleichzeitig stark werden.


Achtsame Sexualität, um die es im Artikel ab Seite 36 geht, hat deshalb sehr viel mit Liebe, Lust, und Gesundheit zu tun, aber bestimmt nichts mit Porno. Lassen Sie sich also mit ruhigem Gewissen und so schamlos wie möglich darauf ein. Es ist nie zu spät, sich selber und seinen Partner oder seine Partnerin neu zu entdecken.
Herzlich, Ihr


















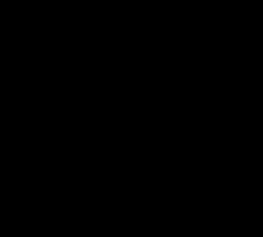


gesund sein
10 Tod und Abschied
Beerdigungen müssen nicht traurig, trist und trostlos sein. Einblick in lebensfrohe Sterbekulturen.
16 Mundhygiene


gesund werden
Wieso Zähneputzen das Risiko für Herzinfarkt mindert.
19 Pilzheilkunde
Wer von der Mykotherapie profitieren kann.
20 Viele, viele bunte . . .
Wie Farben unser Essverhalten beeinflussen – und wie wir uns das zunutze machen können.
26 Sabine über . . . Kürbiskerne.
28 Leserberatung
Nerven, Zähne, Knochen.
03 Editorial | 06 Leben und heilen | 35 Liebesschule | 47 Gedankensplitter | 50 Staunen und wissen | 61 Hin und weg | 62 Neu und gut | 63 Leserbriefe | 64 Rätsel | 65 Vorschau | 66 Eva begegnet 54
32 Wolfs Heilpflanze
Die Hirschzunge verkörpert Licht, Liebe und Hoffnung.
36 Sex und Achtsamkeit
Körperliche Leidenschaft und die gelassene Wahrnehmung dessen, was ist – wie bereichert das unser Liebesleben?
40 Blut
Wissenwertes über unseren Lebenssaft.
42 Schmerz
Wessen Leid wird ernst genommen? Wer erfährt Linderung? Eine Spurensuche.
draussen sein
54 Totholz
Wie die Grundlage neuen Lebens für mehr Vielfalt im Garten sorgt.
58 Remo Vetter
Vom Glück der kalten Tage.
mit dem 7x7® KräuterTee einzigartig im Geschmack mit der Kraft von 49 Kräutern frei von Aromastoffen & Zusätzen für ein starkes Immunsystem
pur für Deine Säure-Basen-Balance


Jentschura (Schweiz) AG · 8806 Bäch/SZ www.jentschura-shop.ch


Eine mediterrane Kost mit reichlich Olivenöl, Getreide, Obst und Gemüse kann insbesondere bei aktuellen und ehemaligen Rauchern einer entzündlichen Gelenkerkrankung vorbeugen. Dies zeigt eine aktuelle Studie aus Frankreich. Frühere Studien haben bereits eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen im Zusammenhang mit der Mittelmeerküche belegt. krea
gewusst
« Da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. »
Voltaire (1694–1778)
Grippeimpfung
Jeden Herbst wird eine Werbekampagne für die jährliche Grippeimpfung lanciert. Doch ausgerechnet den «Risikopersonen» nützt sie wenig. Das berichtet die medizinische Fachzeitschrift «Pharma-Kritik», die unabhängig ist von Behörden und Pharmaindustrie. Die Impfung beeinflusse wenig oder gar nicht
● das Risiko von Hospitalisationen;
● die Absenzen bei der Arbeit;
● Grippe-Komplikationen;
● die Sterblichkeit.
Weiter heisst es: «Trotz einem immer höheren Durchimpfungsgrad der Bevölkerung konnte die gesamte Grippesterblichkeit nicht in relevantem Masse reduziert werden. (...) Es gibt keine verlässlichen Daten, welche ein Impfobligatorium für Angestellte im Gesundheitswesen rechtfertigen würde.»
Zu ähnlichen Schlüssen waren das CochraneZentrum und die Gesundheitsabteilung der deutschen Stiftung Warentest gekommen. Im Informationsmaterial des BAG findet man keine dieser unabhängigen Beurteilungen –vielleicht, weil diese Informationen dem Ziel entgegenstünden, die Impfbeteiligung zu erhöhen. infosperber.ch/krea

Forscher vermuten, dass bis zu 50 Prozent der Menschen reaktive T-Zellen haben, die auf das «neuartige Coronavirus» reagieren. Darauf deuten Blutproben hin, die bereits 2015 entnommen und nun erneut untersucht wurden. Damit scheint festzustehen, dass die T-Zellen, die als sogenannte Gedächtniszellen des Immunsystems fungieren, schon vor fünf Jahren Kontakt zum Erreger hatten. Es sei deshalb plausibel, dass bereits eine weit verbreitete Immunität gegen das Coronavirus bestehe. Das berichtet das Fachblatt «British Medical Journal (BMJ)». krea


Die beste Verteidigung
Das Immunsystem entscheidet darüber, ob ein Mensch krank wird oder gesund bleibt. Doch wie stärkt man das Immunsystem und wieso erkranken immer mehr Menschen an Autoimmunerkrankungen? Worin liegt der Erfolg der Immuntherapie? Und welche Rolle spielt das Mikrobiom? Pulitzer-Preisträger Matt Richtel schreibt über dieses aktuelle und wichtige Thema zwar verständlich und mit Humor – doch für ein Sachbuch oft zu blumig und ausschweifend. Hätte er die Essenz herausgeschält und den Umfang auf die Hälfte gekürzt, wäre dem Leser sehr gedient gewesen.
Matt Richtel «Starke Abwehr. Unser Immunsystem – ein medizinisches Wunder und seine Grenzen», HarperCollins 2019, ca. Fr. 33.–
Psychopharmka
Psychopharmaka wie Leponex, Remeron oder Seroquel können massiv Übergewicht verursachen. Das belastet die Betroffenen psychisch und erhöht das Risiko für Herzkrankheiten und Diabetes, berichtet der Gesundheitstipp. krea


Diagnostik
Augencheck deckt
Krankheiten auf
Augenärzte finden bei einer Routineuntersuchung häufig erste Hinweise auf Krankheiten, die man zunächst nicht mit dem Auge in Verbindung bringt. Weisen beispielsweise schon 50-Jährige ringförmige Fettablagerungen am Rand der Hornhaut auf, kann das Herzinfarkt-Risiko erhöht sein. Nicht zuletzt erlauben Untersuchungen der Netzhaut Rückschlüsse auf den Zustand der Blutgefässe im gesamten Körper und können Anzeichen für Bluthochdruck oder eine Zuckerkrankheit sein. MM

Vitamin D
Schlaflos wegen Sonnenhormon ?
Wer nicht gut schläft, sollte testweise auf Vitamin-D-Präparate verzichten. Denn diese können zu Schlaflosigkeit führen, wie die WHO berichtet. krea

Fettleibigkeit
Magenoperation verhindert
Todesfälle
Stark übergewichtige Patienten mit Diabetes Typ 2 profitieren doppelt von einer Operation, die den Magen verkleinert: Sie nehmen ab und haben weniger Herz-Kreislauf-Probleme. So senken die Operationen die Sterblichkeit. Das zeigt eine Studie der Cleveland Clinic in den USA. krea

Bewegung
Am besten zu Fuss zur Arbeit
Teilweise oder ganz zur Arbeit zu laufen, ist ein effektives Fitnesstraining: Eine aktuelle US-Studie zeigt, dass Menschen, die aus beruflichen Gründen zu Fuss gehen, im Durchschnitt mehr als vier Stundenkilometer schneller unterwegs waren. Die Probanden berichteten über eine bessere Gesundheit als diejenigen, die hauptsächlich in der Freizeit – also nicht zweckgebunden – spazieren. MM

Wer trotz Knieprobleme häufig joggt, muss nicht mit einer verfrühten Arthrose rechnen. Zu diesem Schluss kommen Forscher der Universität Feinberg School of Medicine in Chicago. Die Wissenschaftler werteten Daten von über 1194 Teilnehmern aus. Der Grund: Durch die Bewegung saugen sich die Knorpel mit Gelenkflüssigkeit voll. Dadurch bilden sich wichtige Nährstoffe, die den Knorpel schützen. gesundheitstipp
Die meisten Viren können einem gesunden Menschen nichts anhaben; und auch gegen die gefährlicheren Varianten unter ihnen ist oft ein Kraut gewachsen. Sonnenhut z. B. hilft gegen das Herpes-simplexVirus und, wie nebenan berichtet, womöglich auch gegen das neuartige Coronavirus. Welches Naturheilmittel – von Artemisia annua bis Zink – bei welcher Viruserkrankung helfen kann und wie man auf natürliche Weise sein Immunsystem stärkt, wird in diesem kleinen Band leicht verständlich erklärt. Nach der Lektüre ist man kein Fachmann, hat aber ein probates Werkzeug zur Hand, um viralen Infektionen zumindest vorzubeugen.
Günther Heepen «Natürliche Virenkiller. Mit der Hilfe der Natur: Immunsystem stärken und Viruserkrankungen vorbeugen», Gräfe und Unzer 2020, ca. Fr. 19.–


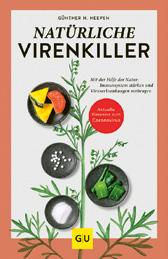
In der Petrischale ist das SonnenhutPräparat Echinaforce ein wahrer Coronakiller. Das berichtet das renommierte Labor Spiez. Die Tropfen sollen auch präventiv wirken, indem sie das Immunsystem stärken. Der Wirkstoff des Roten Sonnenhuts ist somit einer der weltweit einzigen, der nachweislich Coronaviren abtöten kann. Seit dieser Meldung boomt der Internethandel, teilweise werden Wucherpreise verlangt. Dabei ist das Naturpräparat als «Coronamedikament» nicht zugelassen, wie die Heilmittelbehörde Swissmedic betont. krea


CAS Wald, Landschaft & Gesundheit CAS Gartentherapie CAS Therapiegärten – Gestaltung & Management Start im März 2021
Sterben ist die grosse letzte Reise – ein Abenteuer, auf das man sich zeitlebens vorbereiten sollte. Dabei darf es durchaus auch fröhlich zu- und hergehen. So wie beim Abschied auch.
Text: Irène Elder Zumsteg Illustrationen: Lina Hodel
«Schau», sagte das kleine Mädchen auf der Beerdigung zu mir, und zeigte in den Himmel, «schau: Opa ist jetzt dort oben, wartet eine Weile und sucht sich dann wieder einen neuen Bauch aus.» So natürlich erkennt eine Fünfjährige das ewige Kommen, Gehen und Wiederkehren!
Doch dieses Bewusstsein für die Zyklen des Lebens ist in unserer Gesellschaft unterdrückt worden. Das war nicht immer so. Unsere Vorfahren, die Kelten, waren immer bereit für den Tod, diesen unausweichlichen Besucher, der zu einer bestimmten und unbekannten Stunde an die Türe klopft. Es gehörte gar zu manchen Bräuchen, sich sein Grab während Lebzeiten rituell vorzubereiten, und sich immer mal wieder bei seinem Grab hineinzusetzen, um sich mit Mutter Erde zu verbinden und den Geist reisen zu lassen.
Unser physischer Körper ist nichts anderes als ausgeliehene, belebte Erde: Er kommt von Mutter Erde und geht zu Mutter Erde zurück. Animiert wird er gemäss natürlichen kosmischen und irdischen Gesetzen von unsichtbaren und lichtvollen Schwingungen. Dieses grössere Mystische tritt beim Tod – dem Moment der Erleuchtung – aus dem Körper hinaus und setzt seine Reise fort. Doch weit weg von diesen Gegebenheiten hat sich ein Medizinkult mit einem Milliardenmarkt entwickelt, der ein langes Leben verspricht...
Särge fürs Leben
Allein, der Tod bleibt die einzige Garantie im Leben. Es ist wichtig, ihm bewusst zu begegnen und ihm seinen Raum zurückzugeben. Die abenteuerliche Reise der Seele am Lebensende wird in vielen Bildern und von Kultur zu Kultur anders ausgedrückt. Bei den Angelsachsen etwa schicken sie jemanden «auf die grossen, weiten Wasser». Wie schön, den Strom des Lebens mit dem kosmischen Ozean zu verbinden; dem Boot gar einen Stoss zu geben für die Überfahrt oder
eine Fährfrau zu bitten, die Abreisenden ans nächste Ufer der Existenz zu begleiten.
Die Sargkultur auf den britischen Inseln gefällt mir: Die Kreationen für den Übergang sind oft sehr bunt; da gibt es «Särge» in Form von Autos, Loks oder High Heels, andere sind aus Weide oder Seegras geflochten oder aus Recyclingpapier hergestellt. So manche haben den Sarg auch zeitlebens zu Hause stehen, zum Beispiel in Form eines Bücherregals, das nach dem Tod leicht zum Sarg umgebaut werden kann. Schlichtere Holzsärge sind oft bemalt von Angehörigen oder auch von dem, der die Überfahrt antritt, also vom Verstorbenen selbst. Es gibt in Britannien zahlreiche «coffin clubs», Sargclubs, die eine persönliche Vorbereitung für den eigenen Abschied ermöglichen.
Schmunzelnd sage ich manchmal, ich würde gerne auf den britischen Inseln sterben, weil die dortigen Särge so lebendig wirken. Ich habe zwar auch schon hier in der Schweiz einen Prototypen in Form eines Bootes getestet, den Freunde ausgeklügelt hatten. Dieser konnte bisher wegen der strikten Gesetzgebung jedoch nicht seriell hergestellt werden. Doch langsam machen sich auch in der Schweiz beschwingtere Ansätze bemerkbar – und Sargateliers öffnen ihre Türen.
Der letzte Wille
Nicht nur die Frage nach der Barke braucht Aufmerksamkeit. Es bleibt weiteres zu klären für die bald abreisende Seele wie auch für diejenigen, die noch länger hierbleiben: Wie verabschiedet man sich, so gut es eben geht? Wie kann man auch ohne passendes Boot in die grossen Gewässer der Ewigkeit kommen? Wer begleitet, wer singt und wiegt mich in die neue Dimension? Wie die Abschiedszeremonie gestalten? Was ist zu tun, wenn der Tod schmerzvoll, verwirrend oder plötzlich kommt? Es braucht wie bei der Geburt auch beim Sterben «Hebammen»: Fährfrauen, Seelenbegleiterinnen und Zeremonienmeisterinnen. Anleitungen für die verschiedenen Geschehen gibt es in

«Wer sich mit dem Tod beschäftigt, der stellt sich auch die entscheidenden Fragen des Lebens.»
C. Juliane Vieregge in «Lass uns über den Tod reden»

«Nicht weniger wichtig als die Vorbereitung auf unseren eigenen Tod ist es, anderen zu helfen, gut zu sterben.»
XIV. Dalai Lama
vielen Überlieferungen, Schriften sowie Toten- und Lebensbüchern.
Letztwillige Verfügungen sind ein wichtiges Instrument für viele Aspekte des Sterbens. Wer sich mit ihnen befasst, kann vieles klären und gefasster in eine allfällige Hospitalisierung oder schwierige Durchgänge gehen. Wer sich nicht damit auseinandersetzt, kann in eine seltsame Dynamik hineinkommen in unserer extremen Machbarkeits-Kultur. So erleben in der Schweiz etwa 75 Prozent der älteren Bevölkerung ein langsames und medizinisch verwaltetes Sterben über Jahre hinweg in einer Institution, worauf der unerschrockene italienische Professor für Palliativmedizin Gian Domenico Borasio seit langem hinweist. Mit seinem Buch «Über das Sterben» möchte er die Angst vor dem Tod nehmen. Ich habe es schon vielen Menschen in die Hand gedrückt. Borasio macht auch klar, wie wichtig die Seelenpflege ist. Wer sein Lebensende selbstbestimmt leben möchte, tut gut daran, sich mit den seelischen, zyklischen, rhythmischen, medizinischen, rechtlichen, materiellen und rituellen Aspekten vertraut zu machen. So wird würdevolles Sterben wieder möglich. Dazu braucht es intensives Hören und Zuhören. Werden wir also wieder still. Lassen wir zu, nicht alles zu wissen, sondern so manches nur zu erahnen. Erkennen wir unsere eigene Geschichte und nehmen wir unser Schicksal in die Hand. Und: Sitzen wir bei den Sterbenden, ohne sie auf ihrer Reise aufhalten zu wollen.
Eine alte Frau, die mich bat, bei ihr zu sitzen und sie auf der grossen Reise zu begleiten, ist eine meiner grössten Lehrmeisterinnen geworden. Sie sagte: «Ich habe den Rückruf gehört. Die Erde hat gebebt! Das ist das Zeichen für mich. Ich gehe. Ich gebe meinen Löffel ab.» Die Frau hörte auf zu essen, um sich vom Element Erde zu befreien; sie hörte auf zu trinken, um sich von der Essenz Wasser zu trennen; ihr Körper kühlte ab, als sie sich vom Element Feuer verabschiedete; schliesslich atmete sie ein letztes Mal aus, um das Element Luft loszulassen. So wie sie ihr irdisches Leben mit einem ersten Atemzug begonnen hatte, beendete sie es mit einem letzten Atemzug. Ihr Kreis hat sich über Wochen sehr langsam und behutsam geschlossen, manchmal unter Tränen und manchmal mit Gelächter. Einige Male, zusammen mit ihren Angehörigen, mussten wir ihr helfen, Fütterungsversuche des medizinischen Personals abzuwehren. Als sie sich schliesslich, wie wir es ausgemacht hatten, hinüberrudern lassen liess, hob sie ihre Hand und winkte nochmals sanft. Dann flutete Licht den Raum. Es ist spannend, sich vorzustellen, dass wir unseren Körper in Frieden ablegen können. Was hält uns davon ab, den Sarg für das Ende des Lebens und eine Geburt in eine andere Existenz vorzubereiten, so wie uns eine Wiege für das Ankommen auf dieser Erde bereitgestellt worden war? Haben wir vergessen, dass «gebären» und «Bahre» die gleiche Herkunft haben? Was hindert uns daran, ein Totenhemd zu nähen, als
wäre es ein Geburtskleid? Solche Beschäftigungen führen zum Wesentlichen. Sie helfen uns, bewusst zu verwirklichen, was in diesem Leben keinesfalls fehlen darf: beispielsweise eine Nacht unter der Milchstrasse oder einen Tag am Ufer eines smaragdfarbenen Flusses zu verbringen. Sie ermuntern, seine Wahrheiten auszudrücken: «Meine Tochter, ich möchte nicht sterben, ohne dir zu sagen, dass...» oder: «Mein Herzensschatz, ich möchte dir noch etwas zeigen, bevor ich gehe.»
Hand aufs Herz: Die besten Fragen in meinem Leben habe ich mir immer im Angesicht des Todes gestellt. Worauf warten wir also noch? //

Irène Elder Zumsteg wird als zeitgenössische Schamanin betrachtet, als Schwellenhüterin und Seelenbegleiterin. Mit uralten Heilkünsten erleichtert sie Durchgänge und Wandlungen im Leben, von der Wiege bis zur Bahre. Sie lebt mit den Rhythmen der Natur im Waadtländer Jura und führt Ateliers durch zum Thema Sterben und Tod. www.scriptame.net
44 Künstlerinnen und Künstler stellen ihre Werke zum Thema in drei Galerien* aus – von Allerheiligen bis Totensonntag. Vernissagen
Sonntag, 1. November, 14 Uhr Finissagen
Sonntag, 22. November
* « Büni Galerie Dotzige », Dotzigen «Kultur Mühle », Lyss «Galerie de Grandcour », Grandcour
Mehr Infos unter www.exposition-sterben-tod.ch
Phyllida Anam-Aire «Keltisches Totenbuch: Wachen mit den Sterbenden, die Toten auf ihrem Weg begleiten», Ennsthaler 2019, ca. Fr. 29.–Gian Domenico Borasio «Über das Sterben», C. H. Beck 2013, ca. Fr. 14.–Gian Domenico Borasio: «Selbstbestimmt sterben», C. H. Beck 2014, ca. Fr. 16.–C. Juliane Vieregge «Lass uns über den Tod reden», Ch. Links Verlag 2019, ca. Fr. 33.–
Links natuerlich-online.ch

Reisen stornierbar bis 90 Tage vor Abreise
Neu CoronaVersicherung

An den Ufern von Rhône und Saône zeigt Frankreichs Süden sein grünes Antlitz. Unberührte Naturparadiese wechseln sich ab mit moderner Gartenkunst, vielfältigen Landschaftsgärten und romantischen Oasen – fachkundig begleitet von Botaniker Kevin Nobs.

Excellence – kleine Schweizer Grandhotels
Die Excellence Rhône. Die eleganten Räumlichkeiten an Bord sorgen dafür, dass Sie sich sehr wohl fühlen werden. Alle 71 geräumigen Kabinen liegen aussen und sind komfortabel und luxuriös eingerichtet. Sie gehören zu den grössten Kabinen auf einem Flussschiff und verfügen über Dusche/WC, individuell regulierbare Klimaanlage/Heizung, Safe, Sat-TV, Haustelefon, Föhn, 220 V. Hauptrestaurant, Lounge mit Bar, Sonnendeck.
Tag 1 Schweiz > Avignon > Arles Busanreise nach Avignon.
Tag 2 Arles > Port St. Louis
In Arles begrüsst uns das Licht des Südens. Unser Spaziergang führt in den Jardin de la Maison de Santé, wo Van Gogh einst malte. Auf seinen Spuren schlendern wir am Amphitheater vorbei zum Stadtgarten Jardin d’Eté. Von der Stadt geht’s am Nachmittag ins Naturparadies Camargue. Im Ornithologischen Park Pont du Gau erleben Sie Flamingos in ihrem natürlichen Lebensraum und erfahren viel Wissenswertes über Natur- und Artenschutz.
Tag 3 Avignon
Heute unternehmen Sie eine botanische Zeitreise. Der Jardin Médiéval d’Uzès ist ein lebendiges Herbarium, in dem die grünen Schätze mittelalterlicher Heilkunst gedeihen. Nach der Mittagspause am römischen Aquädukt Pont du Gard geht’s zurück in die Gegenwart – in den exotischen Garten und Bambuswald La Bambouseraie en Cévennes.
Tag 4 La Voulte > Lyon
Ist das noch Garten oder schon Kunst? In den Gärten des Bildhauers Erik Borja verschmilzt das Grün mit




skulpturalen Details zum Gesamtkunstwerk. Zu den spektakulären Highlights zäheln der meditative Japangarten und ein mediterraner, auf Terrassen angelegter Hanggarten. Erstaunliches aus der Pflanzenwelt erfahren Sie am Nachmittag auch an Bord – beim Vortrag unseres botanischen Experten Kevin Nobs.
Tag 5 Lyon > Trévoux
Unser Stadtrundgang in Lyon führt in die grüne Oase der Gourmet-Metropole. Der Parc de la Tête d’Or entstand zur gleichen Zeit wie der New Yorker Central Park. Er ist das Werk der Gebrüder Denis und Eugène Bühler, zweier Landschaftsarchitekten mit Schweizer Wurzeln.
Tag 6 Trévoux > Chalon-sur-Saône
Adieu Rhône, Bonjour Saône! An neuen, grünen Ufern geht es flussaufwärts zum Château de Pizay. Den Schlossgarten entwarf der berühmte André Le Nôtre, oberster Gartenarchitekt des «Sonnenkönigs» Ludwigs XIV. und Schöpfer der Barockgärten in Versailles.
Tag 7 Chalon-sur-Saône
Im Jardin Géo-Botanique Georges Nouelle erleben Sie auf 1.3 Hektaren acht typische Landschaften der
Region: die Kalksteinküste der Chalonnaise, das Sumpfgebiet der Bresse, Weinberge, Wasserfälle, Steingärten, provenzalische Aroma- und Heilpflanzen und vieles mehr. Den Einheimischen folgen wir ans Ufer der Saône zu einem ihrer Lieblingsorte: dem Rosengarten Saint Nicolas, den wir in voller Blüte geniessen dürfen. La vie est belle!
Tag 8 Chalon-sur-Saône > Schweiz Busrückreise zu Ihrem Abreiseort.
inkl. An-/Rückreise und Vollpension an Bord
Reisedatum 2021 26.06.–03.07.
Preise pro Person
Kabinentyp
Botaniker & Pflanzenkundler Kevin Nobs
Wo Pflanzen wachsen und gedeihen, ist sein Zuhause. Schon früh erkundete der 28-jährige die Natur im heimischen Emmental. Den «Heilpflanzen an der Emme» widmete er auch seine prämierte Maturaarbeit und sein erstes Buch, das er 2012 als Student veröffentlichte. Seinen drei Studienfächern Pharmazie, Biologie und Germanistik widmet er sich noch heute. 2017 gründete er mit Gleichgesinnten das Unternehmen «Skepping» (Afrikaans für Kreation und Schöpfung). Ihr Ziel ist es, in Vorträgen, Kursen und Exkursionen das Umweltbewusstsein der Menschen zu schärfen. «Denn aus der Natur schöpfen wir Gesundheit, Wohlbefinden und Kreativität»

Sofortpreis mit beschränkter Verfügbarkeit
Unsere Leistungen
• Excellence Flussreise mit Vollpension an Bord
• An-/Rückreise mit Königsklasse-Luxusbus
• Mittelthurgau Fluss-Plus: Königsklasse-Luxusbus während der ganzen Reise
• Alle Besichtigungen gemäss Reiseprogramm
• Mittagessen in Pont du Gard
• Free WiFi an Bord
• Experten-Begleitung
• Mittelthurgau-Reiseleitung
Zuschläge
• Alleinbenützung Kabine Hauptdeck 0
• Alleinbenützung Kabine Mittel-/Oberdeck 895
• Klimaneutral reisen, Stiftung myclimate +1.25% Nicht inbegriffen
• Auftragspauschale pro Person 25
• Persönliche Auslagen und Getränke
• Trinkgeld
• Kombinierte Annullationskosten- und Extrarückreiseversicherung
Wählen Sie Ihren Abreiseort
06:10 Wil p, 06:35 Winterthur-Wiesendangen SBB
06:35 Basel SBB
06:50 Pratteln, Aquabasilea p 07:00 Zürich-Flughafen p, 07:00 Aarau SBB 08:00 Baden-Rütihof p, 09:00 Burgdorf p 11:45 Genf Flughafen

Mehr zu dieser Reise & Buchung
mittelthurgau.ch
Eine sorgfältige Mundhygiene kommt nicht nur Zähnen und Zahnfleisch zugute. Sie wirkt sich auch positiv auf den gesamten Körper aus. Naturheilkundliche Massnahmen können dabei helfen.

Die Mundhöhle ist, nebst der Scheide, wohl das komplexeste Biotop des menschlichen Körpers und ein wahres Schlaraffenland für Mikroben. Normalerweise halten sich nützliche und schädliche Mikroben gegenseitig in Schach. Doch eine zuckerreiche Ernährung, Stress, Rauchen, Alkoholkonsum, ein geschwächtes Immunsystem, die Einnahme von Medikamenten wie Antibiotika, Kortison oder Immunsuppressiva sowie Krankheiten wie Diabetes oder Krebs können das empfindliche Gleichgewicht der Mikroorganismen im Mund stören.
Die Folge: Der leicht basische pH-Wert des Speichels verschiebt sich in Richtung sauer. Davon profitieren Erreger, die der Mundgesundheit schaden. Werden diese nicht regelmässig entfernt, vermehren sie sich rasant und bilden mit Bestandteilen aus dem Speichel einen rauen, klebrigen Belag (Plaque) auf den Zähnen. Erhalten die darin enthaltenen Kariesbakterien weiterhin «Futter» in Form von Kohlenhydraten wie Stärke oder Zucker, entsteht Säure, die den Zahnschmelz angreift. Bildet sich im Spalt zwischen Zähnen und Zahnfleisch Plaque, können die Bakterien eine Zahnfleischentzündung (Gingivitis) auslösen. Bleibt diese unbehandelt, dringen die Erreger immer tiefer in das Zahnfleisch ein und führen zu einer Entzündung des Zahnhalteapparates (Parodontitis) mit Zahnfleischrückgang und Knochenschwund. Auch Umwelttoxine, die das Immunsystem schädigen, können Parodontitis verursachen. Im schlimmsten Fall kommt es zum Zahnausfall. Doch Zahnund Zahnfleischerkrankungen müssen nicht sein – in der Regel sind sie nur eine Folge mangelnder Mundhygiene.
Bleiben Karies und Parodontitis über einen längeren Zeitraum unbehandelt, breiten sich die Bakterien unter Umständen im ganzen Organismus aus. «Bakterien aus entzündlichen Parodontaltaschen können sich über das Blut fast überall im Körper verbreiten und an vorbelasteten Stellen, zum Beispiel den Herzklappen, zu Entzündungen führen», erklärt Urs Weilenmann, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Ganzheitliche Zahnmedizin.
Hinweise auf diese Tatsache lieferte eine Studie der japanischen Hiroshima-Universität. Hierfür hatten die Forscher 682 Personen nach ihrem Zahnputzverhalten befragt: Diejenigen, die ihre Zähne weniger als zweimal täglich zwei Minuten lang putzten, hatten ein dreifach höheres Risiko, an einem Herzinfarkt, an Herzversagen oder an einem Schlaganfall zu sterben als Probanden mit einer besseren Mundhygiene. Neben Herzerkrankungen und Schlaganfall stehen wohl auch Rheuma, Diabetes, Demenz, Unfruchtbarkeit und Nierenkrankheiten im Zusammenhang mit Keimen aus dem Mundraum.
Der eindeutige Beweis dafür, dass allein längeres Zähneputzen das Erkrankungsrisiko verringert, steht zwar noch aus – so ist es auch möglich, dass Menschen mit einer gründlichen Mundhygiene ohnehin gesundheitsbewusster leben –, unbestritten ist jedoch, dass sich eine sorgfältige Mundhygiene positiv auf die Zahngesundheit und den gesamten Organismus auswirkt. Folgende naturheilkundlichen Massnahmen können dabei helfen.
Kussmund – Schlaraffenland für Mikroben
Auf und im Menschen leben Myriaden winzigster Lebewesen: Auf jede unserer 100 Billionen Zellen kommen zehn Fremdlinge wie Bakterien, Milben, Amöben, Pilze. Die Mundhöhle – obschon der Speichel antibakterielle Substanzen enthält – ist eines der komplexesten Biotope des Körpers und ein wahres Schlaraffenland für Mikroben. Dank Feuchtigkeit und reich gedeckter Zunge und Zahnzwischenräume schwadern in jedem Milliliter Speichel Hunderttausende Amöben, Geisseltierchen, Hefen und bis zu einer Milliarde Bakterien. Im Vergleich dazu ist unser grösstes Organ, die Haut, geradezu bevölkerungsarm – obwohl auf den bis zu zwei Quadratmetern etwa so viele Bakterien und Pilze leben wie Menschen auf der Erde.
Die Hautflora wehrt schädliche Mikroorganismen ab und schützt uns so vor Krankheiten. Andere Mikroorganismen unterstützen uns bei der Verdauung, stellen dem Körper Vitamine und Spurenelemente zur Verfügung, trainieren das Immunsystem, manipulieren unsere Psyche und prägen über spezifische Körperdüfte unser Sozial und Sexualverhalten.
Apropos: Zur Zeit Goethes galten stark verlauste Herren als besonders potent – angeblich würden die Läuse schlechte Säfte absaugen. krea
Natürliche Mundwässer Herkömmliche antibakterielle Mundwässer können bei akuten Entzündungen kurzfristig sinnvoll sein. Langfristig stören sie jedoch die gesunde Mundflora, weil sie auch die nützlichen Bakterien abtöten. Milder wirken Kräutertinkturen aus Myrrhe, Salbei oder Kamille. Ein natürliches Mundwasser können Sie auch ganz einfach selbst herstellen: 1 TL Natron und 20 g Xylit (Birkenzucker, wirkt karieshemmend) in eine Glasflasche füllen, mit 250 ml lauwarmem Wasser auffüllen, 5 Tropfen ätherisches Minzöl dazugeben und kräftig schütteln. Spülung nach dem Zähneputzen verwenden.
Teespülungen Untersuchungen zeigen, dass einfache Mundspülungen mit Grüntee genauso wirksam vor Zahnbelag und Zahnfleischentzündung schützen wie Chlorhexidin. Blutwurz-, Eichenrinde- und Salbeitee wiederum können durch ihren Gerbstoffgehalt Zahnfleischentzündungen lindern. Auch Kamillentee wirkt beruhigend und entzündungshemmend. Alternative: Ein Wattestäbchen in Wasser tauchen, 1– 2 Tropfen ätherisches Nelkenöl draufträufeln und den betroffenen Zahn und das Zahnfleisch damit bestreichen.
Gewürzsamenmischung Das Kauen von Gewürzsamen wirkt gegen Mundgeruch und unterstützt gleichzeitig die Verdauung. Folgende Gewürzmischung hat sich bewährt: 2 Teile Anisfrüchte, 2 Teile Fenchelfrüchte, 1 Teil Kümmelfrüchte und 1 Teil Korianderfrüchte mischen und in eine kleine Dose füllen. Ein paar Samen zwischendurch oder nach den Mahlzeiten kauen.
Selbstgemachte Zahnpasta ohne Fluorid
2 bis 3 EL Kokosöl
1 EL Heilerde
1 EL Xylolith (optional)
1/2 TL Natron
2 bis 3 Tropfen Teebaumöl oder
5 bis 10 Tropfen Pfefferminzöl
1 Prise Zimt (optional)
Alles gut mischen und in einen Tiegel oder in ein anderes geeignetes Gefäss füllen. Nicht die Zahnbürste reintunken, sondern die Zahnpasta immer nur mit einem sauberen Löffel entnehmen. Das verlängert die Haltbarkeit deutlich. Die selbstgemachte Zahnpasta ist nicht nur gesund, sondern vermindert auch Abfall.
● Die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft empfiehlt, die Zähne mindestens zweimal, besser dreimal täglich für mindestens zwei Minuten zu putzen. Wer über Mittag keine Möglichkeit zum Zähneputzen hat, kann auf eine Spüllösung oder auf zahnschonende Kaugummis ausweichen.
● Am besten eignet sich eine weiche Zahnbürste. Eine harte reinigt nicht besser, kann aber das Zahnfleisch verletzen.
● Elektrische Zahnbürsten reinigen etwas besser als Handzahnbürsten, wobei man auch mit Letzteren eine gute Putzleistung erreichen kann. Bei allen Zahnbürsten gilt: Sobald sich die Borsten nach außen biegen, sollte man sie erneuern – spätestens jedoch nach drei Monaten.
● Fluoride in der Zahnpasta bieten zwar einen gewissen Schutz vor Karies, weil sie die Remineralisierungszeit verkürzen. Man kann aber gut auf fluoridfreie Produkte ausweichen, sie wirken ebenfalls. Vorsicht vor zu hohen Fluorkonzentrationen (vor allem bei Kindern)! Sie können wahrscheinlich die Darmflora negativ beeinträchtigen.
● Man kann die Zähne statt mit Zahnpasta auch mit dem Birkenzucker Xylitol, mit Natron oder Heilerde putzen. Xylitol verhindert Karies. Natron wirkt basisch, was gut für die Mundflora ist. Die antiseptische Heilerde kann Krankheitserreger abtöten und schädliche Bakterien oder Pilze sowie Ablagerungen schonend entfernen.
● Verwenden Sie für die Zahnzwischenräume täglich Zahnseide. Interdentalbürsten sind empfehlenswert, wenn sich das Zahnfleisch schon ein wenig zurückgezogen hat und die Zahnzwischenräume etwas grösser geworden sind. Praktisch für unterwegs sind spezielle Zahnhölzer.
● Zähne und Zahnfleisch ein- bis zweimal im Jahr kontrollieren lassen. Sinnvoll ist zusätzlich eine jährliche professionelle Zahnreinigung, um hartnäckige Beläge restlos zu entfernen.
Aloe-vera-Gel In der traditionellen Medizin wird die Echte Aloe (Aloe vera) unter anderem bei Wunden und Hautkrankheiten verwendet. Mehrere Studien belegen aber auch die Wirksamkeit bei Parodontose und Parodontitis sowie der Gesunderhaltung von Zähnen und Zahnfleisch. Auch bei kleinen Schleimhautentzündungen im Mundbereich (Aphten) ist Aloe vera einen Versuch wert. Hierzu etwas Gel 3-4-mal täglich auf die betroffenen Stellen geben.
Ölziehen
Der Körper scheidet über Haut, Haare und Schleimhäute Giftstoffe aus. Ölziehen mit Kokos-, Sesamoder Sonnenblumenöl kann helfen, Toxine an der Oberfläche zu entfernen. Daher ist das Ölziehen nicht nur gut für Zähne und Zahnfleisch, sondern auch für die Gesundheit des ganzen Körpers. Hierzu am besten morgens auf nüchternen Magen ca. 1 EL Öl etwa zehn Minuten lang im Mund bewegen und durch die Zähne ziehen; anschliessend ausspucken und im Müll entsorgen. Tipp: Auf gute Bio-Qualität des verwendeten Öls achten. Trotz positiver Effekte des Ölziehens auf regelmässiges Zähneputzen nicht verzichten!
Zungenreinigung
Die Zunge bietet mit ihrer rauen Oberfläche den idealen Tummelplatz für Bakterien. Entfernen kann man die Beläge mit speziellen Zungenbürsten oder -schabern. Ayurveda-Experten empfehlen bogenförmige Zungenschaber aus Kupfer oder Edelstahl. Morgens nach dem Aufstehen die Mundhöhle kurz mit warmem Wasser ausspülen, um sie zu befeuchten. Dann den Belag drei- bis viermal von hinten nach vorne vorsichtig mit leichtem Druck abschaben. Die Reinigung der Zunge kann gegen Mundgeruch helfen und das Geschmacksempfinden verbessern.
Homöopathika Der Einsatz homöopathischer Mittel orientiert sich an den individuellen Symptomen. Einige Mittel haben sich jedoch bei Zahn- und Mundproblemen besonders bewährt: Bei akuten Entzündungen mit klopfenden Schmerzen hilft Belladonna. Hepar sulfuris ist angezeigt bei eitrigen, entzündlichen Prozessen. Bei einer Zahnwurzelentzündung infolge von Karies ist Magnesium phosphoricum einen Versuch wert. Okoubaka eignet sich zur Entgiftung des Organismus, zum Beispiel zur unterstützenden Quecksilberausleitung.
Ernährung Wichtig ist eine möglichst zuckerarme gesunde Ernährung. Zum einen entzieht sie kariesfördernden Bakterien den Nährboden; zum anderen begünstigen Süssigkeiten, Fast Food und Fertigprodukte eine Übersäuerung des Körpers. Äpfel, Karotten und Co. liefern neben reichlich Vitaminen und Ballaststoffen wichtige Mineralstoffe für den Zahnschmelz, massieren beim gründlichen Kauen das Zahnfleisch und regen den Speichelfluss an. Nicht zuletzt unterstützt eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr mit viel Wasser und ungesüssten Kräutertees den Speichel in seiner Spülfunktion. //
● Buchtipps www.natuerlich-online.ch
Pilze aus europäischem Anbau
Viele hauptsächlich im Internet angebotene Pilzpräparate stammen aus China. Die Zucht- und Produktionsbedingungen entsprechen keinem europäischen Standard, da in China die Böden und Gewässer oft durch Pestizide und andere Chemikalien verseucht sind.
Wer sich für Mykotherapie-Kuren interessiert, sollte beim Kauf darauf achten, dass die Produkte biologisch in Europa angebaut und auch produziert wurden. Der etwas teurere Preis ist angesichts des kontrollierten Anbaus und der Qualität der Produkte gerechtfertigt.

DER IGELSTACHELBART gehört zu den heilkräftigen Pilzen in unseren Wäldern.
Die Pilzheilkunde war in Europa fast in Vergessenheit geraten. Mittlerweile hat die «Mykotherapie» in der Naturheilkunde aber wieder ihren festen Platz.
Pilze sind essbar, giftig oder – wie so vieles aus der Natur – auch heilend. Mykotherapie nennt sich die Pilzheilkunde, die sich aus Asien kommend wieder in Europa etabliert; hier wurde sie von heilkundigen Menschen mehrere Jahrhunderte lang richtiggehend vernachlässigt. Hildegard von Bingen zum Beispiel kannte sich mit Pilzen und deren Heilkräften zwar noch aus – aber das ist 800 Jahre her.
Ganz anders in China. Dort liess das Interesse der Ärzte an den Einsatzmöglichkeiten potenter Heilpilze nie nach. Pilze wie Reishi, Shiitake oder Maitake spielen deshalb in der Traditionellen Chinesischen Medizin TCM eine wichtige Rolle bei der Vorbeugung und der Behandlung verschiedenster Beschwerden und Krankheiten.
Gegen vieles ist ein Pilz gewachsen Präparate aus Heilpilzen werden hierzulande hauptsächlich unter dem Begriff „Vitalpilze“ vertrieben. Ihr Anwendungsgebiet ist breit: Angefangen bei chronischer Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und Konzentrationsschwäche beeinflussen Vitalpilze auch den Verlauf von Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes und Allergien positiv, können sogar als Begleit-
therapie bei Krebserkrankungen eingesetzt werden und stärken allgemein das Immunsystem. Und: Einige Pilze können gezielt für Entgiftungskuren eingesetzt werden. Eingenommen werden Heil-, respektive Vitalpilze meist in Form eines Pulvers oder Extraktes. Erfahrene Mykotherapeutinnen und -therapeuten raten von Extrakten aber eher ab, da bei dieser Herstellungsmethode nur einzelne Wirkstoffe aus den Pilzen gewonnen werden und so die ganze ursprüngliche Wirkstoffkombination verloren geht. Sie setzen bei Therapien deshalb lieber auf «Pulver vom ganzen Pilz».
Heilpilze aus dem heimischen Wald
Viele Heilpilze kommen aus Asien. Aber auch in unseren Wäldern wachsen Pilze mit Heilkraft. Der gewöhnliche Champignon (wirkt antibakteriell und stärkt das Immunsystem) gehört dazu, aber auch der Igelstachelbart (unterstützt das Verdauungssystem), das Judasohr (hemmt Entzündungen und Blutgerinnsel) oder der Schopftintling (senkt den Blutzuckerspiegel). Frisch gesammelt – und selbstverständlich kontrolliert – erfreuen diese Pilze nach dem erholsamen Waldspaziergang nicht nur den Magen, sondern fördern erst noch die Gesundheit. kel


Farben von Lebensmitteln beeinflussen unsere Sinne und so unser Essverhalten. Das weiss die Industrie für sich zu nutzen. Man kann die Macht der Farben aber auch konstruktiv einsetzen.
Text: Angela Bernetta
Wer über den Markt schlendert, sieht lokales, saisonales Gemüse und Obst in allen Formen und Farben. Gerne lässt man da entspannt die Sinne schweifen und gibt sich dem Gesehenen hin. Rund 70 Prozent aller Sinneseindrücke nimmt der Mensch über seine Augen wahr. Farben von Nahrungsmitteln wirken besonders stark auf den Sehsinn und beeinflussen uns nachweislich – sowohl positiv als auch negativ. So erscheint den meisten eine sattorange Aprikose um einiges begehrlicher als eine blassgelbe, schrumpelige. «Die Farbe lässt auf Qualität, Frische und Geschmack eines Lebensmittels schliessen», erläutert Martina Züfle, Ernährungsberaterin an der Klinik Hirslanden in Zürich. «Bei Obst und Gemüse weist ein satter Farbton auf einen hohen Anteil an sekundären Pflanzenstoffen hin, die als gesund und nährstoffreich gelten.»
Warme Farben wie Rot, Orange oder Gelb regen den Appetit an, sagen Ernährungsfachleute. Unternehmen wie die Migros wissen das gewinnbringend zu nutzen – und verwenden diese Farben nicht nur für das Firmenlogo. «Studien belegen, dass rote Lebensmittel häufig mit Süsse, grüne und gelbe mit Säure assoziiert werden», weiss Züfle. Vor Nahrungsmitteln mit der «falschen» Farbe schrecken wir instinktiv zurück. So lehnen die meisten blaue, schwarze oder violette Lebensmittel ab. Bereits unsere Vorfahren sollen einen Bogen um pflanzliche Produkte in diesen Farben gemacht hatten. Sie weisen auf Fäulnis oder gar Gifte hin.
Food- und Ernährungstrends können Farbpräferenzen allerdings verrücken: «Vor Kurzem lagen violette Gemüse und Kartoffeln im Trend», sagt die ernährungspsychologische Beraterin Nicole Heuberger. «Violette Naturprodukte weisen einen hohen Anteil an Anthocyane auf. Diese sekundären Pflanzenstoffe gelten als besonders gesund, was viele ihre Abneigung gegenüber dunkelfarbenen Nahrungsmitteln offenbar überwinden liess.»
Farbe und Geschmack
Farbassoziationen bilden sich beim Menschen früh aus. «Wir lernen von klein auf über die Farbe auf Reife, Zustand und Geschmack unserer Nahrung zu schliessen», sagt Heuberger. Welche Speisen und Getränke wir letztlich mögen, ist auch der Familie und dem Kulturkreis geschuldet, in denen wir aufwachsen. Laut Ernährungsberaterin Martina Züfle belegen diverse Studien, dass kognitive Prozesse wie beispielsweise erlernte Farbassoziationen unsere Geschmackserwartung an ein Lebensmittel, aber auch den Geschmackseindruck beeinflussen: «Sehen wir Essbares, sucht unser Gehirn nach einer Übereinstimmung zwischen Farbe und Geschmack. So wurde beispielsweise bei Testpersonen, die einen gelben Fruchtsaft vorgesetzt bekamen, mehrheitlich die Erwartung nach Zitronengeschmack geweckt.»
Geschmackserwartung und -eindruck lassen sich also mit der «richtigen» Farbe manipulieren. Im Rahmen eines viel beachteten Experiments am Deutschen

Auch die Farbe des Essgeschirrs beeinflusst unser Essverhalten. Blaues Geschirr beispielsweise soll den Appetit hemmen. Die Farbe Blau habe eine entspannende Wirkung, erklären Ernährungspsychologen, folglich esse man langsamer, was früher zu einem Sättigungsgefühl führe. Gelb und Rot hingegen gelten als Farben, die den Appetit und Verzehr anregen. Wissenschaftler der Universität Oxford haben jedoch kürzlich herausgefunden, dass auch rotes Geschirr den Hunger bremsen kann. Dies deshalb, so die Forscher, da man die Farbe Rot in der Regel mit Gefahr assoziiere. Und die typische Reaktion bei Gefahr ist Flucht – ans Essen denkt da keiner mehr. Weisse Teller hingegen verstärken den Geschmack – und damit zumeist den Appetit. «Solche Erkenntnisse können durchaus miteinbezogen werden, wenn man abnehmen möchte», sagt Martina Züfle, Ernährungsberaterin an der Klinik Hirslanden in Zürich.
Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke setzte man Testpersonen geschmacksneutrales Naturjoghurt vor. Eine Portion war mit roter Lebensmittelfarbe versetzt, die andere blieb naturbelassen. Es zeigte sich, dass die Probanden das rotgefärbte Joghurt im Gegensatz zum Weissen als fruchtiger und süsser empfanden – obwohl beide geschmacklich gleich waren. Geschmeckt haben die Probanden also ein nicht vorhandenes Aroma, das durch die Farbe vorgetäuscht worden war. Mit Farbe kann demnach der Zuckerzusatz kompensiert werden – ein Befund, der dazu genutzt werden kann, den eigenen Zuckerkonsum zu senken: Es gibt systematische Untersuchungen, dass man zehn Prozent Zuckerzusatz einsparen kann, wenn man Lebensmittel einfärbt. Besonders Rot und ein dunkles Orange lassen Lebensmittel süsser erscheinen. Eine derartige Täuschung ist laut Kathrin Ohla, Psychologin am Deutschen Institut für Ernährungsforschung, aber nur in einem bestimmten Rahmen möglich; zudem müsse die Farbe zu dem Geschmack passen, den man verstärken wolle: «Man macht nicht aus Zitronen Bonbons. Wenn etwas besonders sauer oder bitter ist, kann man an Farbe zusetzen, was man will. Dann wird man sich nicht täuschen lassen.» Eine Farbveränderung müsse ausserdem sinnvoll für das jeweilige Produkt sein. Rote Farbe sei beispielsweise nur mit süssem, fruchtigem,
gegebenenfalls auch mit herbem Geschmack kompatibel, jedoch nicht mit salzigem oder bitterem. Die optische Wahrnehmung beim Schmecken ist laut Ohla besonders ausgeprägt, weil der Geschmackseindruck allein zu wenig objektbezogen ist. Wenn man also etwas Süsses oder Salziges schmecke, wisse man noch nicht, was es sein könnte.
Die Lebensmittelindustrie setzt bei der Vermarktung ihrer Produkte ganz gezielt auf Farben. Fade Produkte wie Reis oder Teigwaren stecken findige Marketingfachleute gerne in rote, gelbe oder orange Verpackungen, was den Kaufanreiz erhöhen soll. Farbexperimente unter Marktbedingungen können allerdings trotz aufwendiger Werbekampagnen risikoreich sein. Dies musste die US-amerikanische Coca-Cola Company vor Jahren erfahren. Das Unternehmen brachte eine farblose, zuckerfreie, wie Zitronenlimonade aussehende Cola mit dem Namen «Tab Clear» auf den amerikanischen, australischen und englischen Markt. Das Getränk floppte, da die Verbraucher die charakteristische Farbe der amerikanischen Nationalbrause vermissten.
Da unser Sehsinn meist über Lust oder Frust entscheidet, werden Produkte in den Supermärkten gerne ins rechte Licht gerückt. So ist die Fleischtheke oft in rotes Licht getaucht, was Haxen, Würste und Co. frischer und saftiger wirken lässt. Starkes Blaulicht hingegen hat eine abschreckende Wirkung. Vor allem Fleisch könne nicht verzehrt werden, wenn es blau angeleuchtet werde, weiss Ohla. Denn so werde die Assoziation erweckt, dass es vergammelt sei. Die Reaktion: Ekel. «Stimmt die reale Färbung des Essens nicht mit der erwarteten überein, so erzeugt dies beim Betrachter eine Aversion.» Auch Obst und Gemüse werden deshalb passend ausgeleuchtet, sodass die Farben satt und strahlend erscheinen, was dem Konsumenten Frische, Qualität und Aroma vorgaukeln soll. Überdies hilft man vielerorts olfaktorisch nach. So wird beispielsweise der Duft von frischem Brot oder süssem Gebäck mit Aromastoffen angereichert, die den Konsumenten zum Kauf verführen sollen. Wer eine gesunde Ernährung anstrebt, sollte sich also nicht allein auf Düfte und Farben verlassen. Durch zu viel Fast Food, Fett, Zucker und Bewegungsmangel gibt es insgesamt eine völlig falsche Entwicklung in der Ernährung. Statt sich auf Tricks mit Farben zu kaprizieren, solle man sich also bewusst ernähren. Wenn Farben einen dabei unterstützen, umso besser. //
Warme Farben wie Rot, Orange oder Gelb regen

Farben auf dem Teller heben die Stimmung beim Essen. Doch wie kocht man farblich assortiert? Drei deutsche Designer stellen in einem gleichnamigen Kochbuch zwölf Farben in zwölf Menüs vor. Kochbegeisterte und Geniesser können mithilfe dieses Buches einkaufen, was der Markt an farbigen und saisonalen Produkten so hergibt: Im Sommer sind frisches Grün von Rucola und Minze angesagt, im Herbst eher sattes Orange von Kürbis oder Süsskartoffeln. Inspiration für das Kochbuch holte sich das Autoren-Trio aus Paul Austers Roman «Leviathan» (1992). Im Laufe der Geschichte entwickelte die Romanfigur Maria Turner einen Zwang, jeden Tag nur Essen in der gleichen Farbe zu verzehren. Die französischen Konzeptkünstlerin Sophie Calle nahm diese Eigenart ins reale Leben auf und ernährte sich täglich nur von Lebensmitteln in einer Farbe. Was als Spleen einer Künstlerin daherkommt, dürfte beim Lesen dieses Kochbuches ungeahnte Kreativität freisetzen.
● Tatjana Reimann, Caro Mantke, Tim Schober «12 Farben – 12 Menüs: Kochen nach Farben», Prestel 2018, ca. Fr. 29.–● Hans-Ulrich Grimm «Chemie im Essen. Lebensmittel-Zusatzstoffe. Wie sie wirken, warum sie schaden», Knaur Taschenbuch 2013, ca. Fr. 14.–
● Harald Braem «Die Macht der Farben», Wirtschaftsverlag 1985, ca. Fr. 14.–

Rezept aus dem Buch «UrDinkel Feste feiern» von Judith Gmür-Stalder. Erhältlich im Onlineshop auf www.urdinkel.ch oder per Telefon 034 409 37 38.
URDINKEL-PANCAKES
AUS DEM RACLETTEOFEN
für 16–20 Portionen
Vorbereiten: 30 Minuten
UrDinkel-Pancaketeig
250 g UrDinkel-Halbweissmehl oder UrDinkel-Halbweissmehl mit 20 % Schrot
½ TL Salz
3 EL Zucker
1 TL Backpulver
½ TL Natron
3 dl Milch oder Rahm
2 Eier
Butter oder Bratcreme, für die Pfännchen
3–4 Handvoll gemischte Beeren oder Früchte, je nach Saison, z. B. Aprikosen, Zwetschgen, Äpfel, Birnen, Melone, Kaki oder Trauben, in mundgerechten Stückchen. Statt frischem Obst kann man auch gefrorenes nehmen. Dieses vor dem Backen auftauen
1–2 EL Zucker
Garnitur
Hagel-, Puder- und Zimtzucker, Minze, Konfitüre, Schokoaufstrich oder Beerensauce. Pistazien oder Nüsse, gehackt, zum Bestreuen
Zubereitung
1. Für den Teig Mehl, Salz, Zucker, Backpulver und Natron mischen. Milch und Eier zugeben, zu einem glatten Teig rühren.
2. Raclettepfännchen mit wenig Butter oder Bratcreme einfetten. Früchte hineingeben, nach Belieben mit ein wenig Zucker bestreuen und mit etwas Teig bedecken. 5 bis 8 Minuten backen. Pancakes herausnehmen und nach Belieben garnieren. Warm geniessen.
Tipps
Pancakes aus dem Racletteofen sind eine süsse Überraschung. Jeder kann sein Pfännchen nach seinem Geschmack belegen, etwa mit bunten Marshmallows oder gefrorenen Beeren.
Pancaketeig mit Vanillezucker, Zimtpulver, Lebkuchengewürz, abgeriebener Bio-Orangenoder -Zitronenschale, Grand Marnier oder Kakao aromatisieren. Die Pancakes können auch in einer beschichteten Bratpfanne auf dem Herd gebacken werden. Nach Belieben mit Glace servieren. Anstelle frischer oder aufgetauter Früchte eignen sich auch Kompottfrüchte.















Traumfänger Nachtlicht
LED Nachtlicht mit Farbwechsel Steuerung bringt mystische Atmosphäre nicht nur ins Kinderzimmer Plexiglas Lichtplatte auf Kunststoffsockel. Lieferung inkl. Fernbedienung für 12 verschiedene Farben plus Weiss und zusätzliche Funktionen wie: Timer, automatischer Farbwechsel, Schlafmodus Helligkeit usw. Grösse ca. 14 x 7,5 x 27 cm, batteriebetrieben
Best.- Nr. 13190 200 BEA-Punkte + Fr. 28.—
Ü b e r 3 0 0 0 e i nm a l i g g ün st i g e A n g e b o te , auc h f ü r S i e , f i n d e n S i e unt e r w w w. b ea.s w i s s So funktioniert‘s Punkte von den unten aufgeführten Markenpartnern sammeln, an uns senden und auf Ihr BEA Punktekonto gutschreiben lassen. Punkte gibt es analog und digital (Smartphoto).
Garantiert keine Kontogebühren und Kaufverpflichtung. Sie können nur profitieren














Aus Vorgärten lachen uns grimmige Kürbisgesichter entgegen, auf dem Markt und in Bauernhofläden gibt es die grössten Beeren der Welt in allen Variationen zu kaufen. Herbstzeit ist Kürbiszeit und auf vielen Esstischen dampft öfters eine gelb-orange Suppe. Die Kürbiskerne landen zumeist im Müll oder auf dem Kompost. Das ist jammerschade, denn Kürbiskerne sind proteinreiche Snacks, die eine Vielfalt an wertvollen Inhaltsstoffen enthalten. Anstatt sie wegzuwerfen, sollte man sie rösten und als schmackhafte Beilage für Salate, Suppen oder Gemüsegerichte verwenden. Wer regelmässig Kürbiskerne knabbert, ist in der Regel gut versorgt mit Magnesium, Zink, Kupfer und Eisen: Schon 30 Gramm Kürbiskerne decken rund 15 Prozent des täglichen Zinkbedarfs, 20 Prozent des Eisenbedarfs sowie 30 Prozent des Kupfer- und Magnesiumbedarfs. Zudem enthalten die Kürbiskerne sekundäre Pflanzenstoffe, Phytoöstrogene, Beta-Carotin und ungesättigte Fettsäuren.
In der Naturheilkunde gehören die Kürbiskerne zum Behandlungskonzept einer Prostatavergrösserung. Die Prostata, auch Vorsteherdrüse genannt, ist etwa so gross wie eine Kastanie und umschliesst ring-
förmig die Harnröhre. Sie wandelt das männliche Geschlechtshormon Testosteron in Dihydrotestosteron (DHT) um, die biologisch aktivste Form von Testosteron. Es ist dieses Hormon, das vermutlich dafür verantwortlich ist, dass die Prostatadrüse im reiferen Alter wächst. Weil die Prostata die Harnröhre umschliesst, beeinträchtigt sie das Harnverhalten. Ist sie vergrössert, drückt die Prostata auf die Harnröhre und es dauert entsprechend länger, bis die Blase vollständig entleert ist. Gefährlich ist die Vergrösserung der Vorsteherdrüse nicht. Weil in einem fortgeschrittenen Stadium jedoch Harn in der Blase zurückbleibt, können sich darin Bakterien gut vermehren; folglich nimmt das Risiko für Harnwegsinfekte zu.
Im Kürbiskernöl und in den Kürbiskernen stecken sehr viele wertvolle Phytosterole, die sich günstig auf diese Problematik auswirken. Die Phytosterole hemmen die Aktivität eines Enzyms (5-alpha-Reduktase), das Testosteron in DHT umwandelt und entsprechend den DHT-Spiegel erhöht. Je höher der DHT-Wert ist, desto mehr vergrössert sich die Prostata (und auch die Haare fallen schneller aus). Wird die Umwandlung in DHT mithilfe von Kürbiskernöl oder Kürbiskernen gebremst, kann sich die Prostata erholen (oft wird auch der genetisch bedingte Haarausfall gestoppt). Kürbiskerne können daher einer gutartigen Prostatavergrösserung (BPH) vorbeugen und bestehende Beschwerden deutlich lindern.
Ab einem Alter von 45 Jahren sollten Kürbiskerne deshalb regelmässig gegessen werden. Das gilt übrigens nicht nur für die männliche Bevölkerung.

GESUNDER SNACK | Bei Reizdarm und Prostatavergrösserung sollte man öfters Kürbiskerne essen. Sie sind auch eine wertvolle Proteinquelle.
Kürbisfleisch und -kerne enthalten unter anderem die Mineralstoffe Kalium, Zink, Eisen, Kalzium und Selen sowie die Vitamine B, C und E. Wirkstoffe wie Phytosterine und Salicylsäure wirken entzündungs- und wundhemmend sowie harntreibend und entwässernd. Die Kerne (und auch das Kürbiskernöl) wird vor allem gegen Blasenschwäche und Prostataleiden, aber auch bei Magen- und Darmerkrankungen sowie Herz- und Nierenleiden eingesetzt. Eine Kur mit Kürbiskernen muss mehrere Monate dauern; man isst dreimal täglich ein bis zwei gehäufte Esslöffel.
Das Fruchtfleisch ist reich an Carotinoiden, die der Körper in Vitamin A umbaut. Dieses sorgt für eine schöne Haut und bindet freie Radikale. Ausserdem enthält das Fruchtfleisch Kieselsäure, die für straffes Bindegewebe und feste Nägel sorgt. krea
Denn die Kerne sind auch eine äusserst wertvolle Proteinquelle, die sich als Fleischersatz und Nahrungsergänzung eignet, weil sie vom Körper sehr gut verwertet werden. Gerade im dritten Lebensabschnitt braucht der Körper vermehrt Eiweisse, damit sich die Muskeln nicht zu stark abbauen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass ältere Menschen neben Fleisch und Käse weitere Proteinquellen finden, um ihren Bedarf zu decken.
Manche Kürbissorten haben eher harte Kerne, andere weiche. Grundsätzlich kann man von jedem Esskürbis die Kerne weiterverwerten; diejenigen mit weicher Schale eignen sich zum Einstieg jedoch besser. Probieren Sie es aus: Wenn Sie also das nächste Mal einen Hokkaidokürbis rüsten, geben Sie die Kerne samt Fruchtfleischresten in eine Schüssel Wasser und entfernen von Hand das Fruchtfleisch. Nehmen Sie dann die so vorgereinigten Kerne aus dem Wasser, legen sie auf ein Küchentuch und rubbeln die Kerne mit dem Tuch trocken, bis der Rest des Fruchtfleisches weg ist. Jetzt mit Öl und Salz vermischen, auf ein Backofenblech legen und bei Ober- und Unterhitze etwa 20 Minuten rösten. Selbstverständlich sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt, wenn es um das Würzen der Kürbiskerne geht. Probieren Sie doch auch mal eine süsse Varianten mit Zucker und Zimt. Aber bitte nicht übertreiben: 100 Gramm Kürbiskerne haben einen Nährwert von rund 500 Kalorien und fast 50 Gramm Fett. Immerhin besteht dieses zur Hälfte aus ungesättigten Fettsäuren, die den Cholesterinspiegel senken und die Abwehrreaktionen der Körperzellen stärken.
Kürbisse ziehen viele Pestizide aus dem Boden und speichern sie in den ölhaltigen Kernen. Beim Kauf von Kürbiskernen und Kürbiskernöl ist es deshalb besonders wichtig, auf biologische Qualität zu achten. Offenbar stammt das beste Kürbiskernöl aus der österreichischen Steiermark. Dort ist der Ölkürbis heimisch, dessen Öl in der Steiermark einen vergleichsweisen Stellenwert hat wie in Italien das Olivenöl. Das kräftig-nussige Aroma des Kürbiskernöls verfeinert Kürbissuppen und Salatsaucen, eignet sich zur Abrundung von Frischkäse oder auch einfach so zum Brot. Aufgrund des hohen Anteils von mehrfach ungesättigten Fettsäuren sollte man es nur kalt verwenden. Im Gegensatz zu anderen Herstellungsverfahren werden beim steirischen Kürbisöl die Kürbiskerne vor der Verarbeitung nicht geröstet, sondern kalt gepresst.
Nun wünsche ich viel Freude beim Ausprobieren neuer Kürbisrezepte. Der orange Riese und seine Verwandten können nämlich noch viel mehr, als in Gärten herumgeistern und als Suppe genossen werden. //
* Sabine Hurni ist dipl. Drogistin HF und Naturheilpraktikerin, betreibt eine eigene Gesundheitspraxis, schreibt als freie Autorin für «natürlich», gibt Lu-Jong-Kurse und setzt sich kritisch mit Alltagsthemen, Schulmedizin, Pharmaindustrie und Functional Food auseinander.
Selbstheilungskräfte stärken

Die Selbstheilkraft ist für den Menschen eine sehr wertvolle Angelegenheit – gerade in diesen Zeiten, wo uns vor allem Angst vor dem Virus gemacht wird, ohne auf die Rolle und Möglichkeiten der Stärkung des Immunsystems hinzuweisen. Dabei schadet Angst der Körperabwehr! Ich versuche mich nicht von dieser Angst verunsichern zu lassen, esse ausgewogen und gesund, bewege mich viel an der frischen Luft und fühle mich soweit fit und gesund. Doch die Grippesaison ist da – und damit sicher bald auch die «Schnuddernase». Nun habe ich gelesen, dass es das Immunsystem stärken soll, wenn man bei zäher Verschleimung im Hals etwas Schleim hinunterschluckt. Was meinen Sie dazu ? A. K., St. Gallen
Sie meinen, den Schleim herunterschlucken um wie bei der Eigenurintherapie das Immunsystem zu aktivieren? Nun, ich glaube nicht, dass das hilfreich ist. Husten und Schnupfen sind immer auch Reinigungsprozesse des Körpers. Man soll diese Sekrete fliessen lassen und ausspucken, anstatt sie zu unterdrücken oder festzuhalten. Insofern sehe ich die Selbstheilung bei Husten eher darin, dass wir dem Körper dabei helfen, all das loszulassen, was er nicht mehr braucht. Mit Hilfe von Autosuggestion kann man den Prozess zum Beispiel unterstützen, indem Sie sich sagen:
«Mein Hals wird freier und freier». Oder: «Der Schleim löst sich mehr und mehr». Der passende Satz sollte mehrmals täglich zehn Mal wiederholt werden. Leichtes Klopfen auf dem Brustbein und am Rücken unterstützt den Heilungsprozess. Gerade im Anfangsstadium funktionieren solche Methoden gut. Halsschmerzen bringe ich auf diese Weise meistens weg.
Sind die Bronchien jedoch richtig verschleimt, sollte man die körpereigenen Heilprozesse mit einem pflanzlichen oder homöopathischen Heilmittel unterstützen. Es gibt sicher spirituell sehr geübte Menschen, die allein aus der Botschaft, die ihnen der Körper mit der Art der Erkrankung gibt, ihr eigenes System ohne Heilmittel gesunden lassen können. Aber unsereins stärkt den Körper am besten von beiden Seiten her: mit positiven Gedanken und guten Heilmitteln. Ich kann Efeu sehr empfehlen als Schleimlöser. Einreibungen von Brust und Rücken mit verdünntem Thymian-, Ravintsara- oder Eukalyptusöl sind auch sehr gut. Wichtig ist es überdies, dass Sie warm essen, warm trinken, z. B. warmes Ingwerwasser oder Ingwertee mit Zitrone, und sich warm anziehen. So kann der Schleim quasi schmelzen, wie man es im Ayurveda oder in der TCM ausdrückt.
Nervenschmerzen
Ich leide unter den Folgen einer Gürtelrose im Gesicht. Trotz Schmerzklinik und Medikamenten sind die Nervenschmerzen immer noch da, zum Teil fast unerträglich. Was kann ich dagegen tun?
H. R., Winterthur
Fangen Sie an, mit Öl zu arbeiten; am besten mit Johanniskrautöl, auch Rotöl genannt. Es beruhigt sehr stark die Nerven. Am besten massieren Sie jeden Abend Gesicht und Nacken mit dem Öl ein. Das ist sehr wohltuend.
Essen Sie ausserdem möglichst oft warme und gekochte Mahlzeiten und versuchen Sie auch, warm zu trinken. Regelmässige, warme Mahlzeiten beruhigen das Nervenkostüm sehr effektiv. Kennen Sie CBD-Hanf-Öl? Es hilft ebenfalls sehr gut bei Nervenschmerzen und wäre durchaus ein Versuch wert. Sie erhalten das Öl in vielen Drogerien und Apotheken. Wenn Sie so nicht weiterkommen, könnte Ihnen eine homöopathische Behandlung helfen. Aconitum ist zum Beispiel ein sehr gutes Nervenmittel, aber es gibt bestimmt noch andere. So weit zum eher körperlichen Aspekt.
Sie haben sich bereits sehr intensiv mit Ihrer Krankheit auseinandergesetzt. Das ist sehr gut. Nun ist es wichtig, dass Sie sich mit der Gesundheit verbinden! Wenn eine Krankheit nicht weggehen will, ist es häufig so, dass es nicht daran liegt, dass man das richtige Heilmittel noch nicht gefunden hat, sondern daran, dass man am falschen Ort sucht. Jede Krankheit respektive jedes Beschwerdebild will uns etwas zeigen. Solange wir die anstehenden Schritte noch nicht sehen und deshalb nicht entsprechend reagieren, kann die Krankheit nicht weggehen – weil sie uns ja an etwas Bestimmtes erinnern möchte.
Nehmen Sie sich also sehr viel Zeit für sich selbst! Im hektischen Alltag kann man den Ruf des Herzens schlecht hören. Gönnen Sie sich deshalb sehr viel Ruhe. Fühlen und eruieren Sie, welche Wünsche, Träume und Ziele Sie in Ihrem dritten Lebensabschnitt verfolgen möchten. Das können auch innere, spirituelle Themen sein, zumal das Alter die Zeit der Weisheit ist. Und holen Sie sich, wenn nötig, Hilfe in einem Coaching oder Ähnlichem.
Zähneknirschen
Meine erwachsenen Kinder leiden an starkem Zähneknirschen in der Nacht und tragen eine Zahnschiene. Meine Tochter liess sich Botox in den Kiefer spritzen, um die Verhärtung aufzulockern. Damit ist die Ursache aber nicht behoben. Ihr Zahnarzt empfahl Meditation. Von welchem Körperteil aus kommt das Zähneknirschen? Wo liegt die Ursache ? Was empfehlen Sie ? R. R., Zug
Das starke Zusammenbeissen der Zähne in der Nacht ist oft die Folge eines enormen Drucks, den man sich im Leben auferlegt. Ehrgeiz, hohe Ansprüche und Perfektion fördern das Zähneknirschen. Meines Erachtens liegt hier das Grundproblem. Der Zahnarzt Ihrer Kinder lag also sicher nicht verkehrt mit der Idee der Meditation. Ich würde eine bewegte Form der Meditation vorschlagen, Yoga-Nidra zum Beispiel oder Hatha-Yoga mit Fokus auf Entspannung. Der Kiefer wird auch als kleines Becken bezeichnet. Um den Kiefer zu lösen, müssen wir bei der Beweglichkeit der Hüfte ansetzen. Das heisst: häufig im Schneidersitz sitzen, jeden Morgen den Sonnengruss ausüben und Übungen machen für die Hüften. Oder einfach wie die Inder ruhen: auf den Füssen sitzen, Fersen flach am Boden, Oberkörper zwischen den Knien. Es wäre sicher auch hilfreich, die Kiefer- und Nackenmuskulatur mittels Osteopathie oder Craniosakraltherapie ins Lot zu bringen. Bei dieser Gelegenheit wird oft auch die Hüfte mobilisiert, was mir sehr wichtig scheint. Ich würde zudem abends vor dem Schlafengehen Gesicht und Nacken mit einem Arnikaöl massieren und auf möglichst flachen Kissen liegen. Die meisten Kissen sind viel zu hoch. Der Rücken aber sollte möglichst flach liegen, damit sich die Wirbelsäule entspannen kann. Wir sollten darauf hinarbeiten, ohne Kissen schlafen zu können.
Ich musste mich verschiedenen MRI unterziehen. Nun vernehme ich, dass sich das dabei verwendete Kontrastmittel Gadolinium

Das Johanniskraut (Hypericum perforatum) mag es sonnig und warm. Es wächst auf Brachwiesen, in Kiesgruben oder an Wegrändern. Die symmetrisch aufgebauten, goldgelben Blüten erinnern an kleine Sonnen oder Windräder. Die strahlenartigen Staubfäden und Staubbeutel verstärken diesen Eindruck.
So hilft Johanniskraut: Johanniskraut ist eine wichtige Nervenpflanze. Sie stabilisiert und harmonisiert die Psyche bei leichten Depressionen, Ängsten und Unruhe. Zudem heilt sie Nervenverletzungen auf körperlicher Ebene nach operativen Eingriffen, hilft bei Nervenentzündungen und leichten Verbrennungen.
Wie anwenden: Wenn im Winter das fehlende Tageslicht die Stimmung drückt, kann ein Tee oder ein Johanniskrautpräparat die Energie und Lebensfreude zurückbringen. Beides darf mehrmals täglich eingenommen werden. Äusserlich wendet man das Johanniskraut als Ölzubereitung an. Ölige Zubereitungen sind generell sehr wirksam bei Gelenkschmerzen, da sie das Gelenk und die Sehnen gut schmieren.
Tipps gegen Winterdepressionen
● Ab nach draussen: Auch wenn es neblig und verhangen ist, scheint die Sonne. Gehen Sie über Mittag oder am frühen Nachmittag mindestens für 30 Minuten spazieren.
● Schlafen: Wenn die Natur im Winter zur Ruhe kommt, dürfen auch wir ruhiger werden. Der Winter ist die Zeit der Stille, der Ruhe und des Rückzugs.
● Ernährung: Farbenfrohes Essen erhellt das Gemüt. Verwenden Sie rotes, grünes, gelbes und blaues Gemüse, wenn Sie ihre Mahlzeiten zubereiten.
La Gomera/Kanaren
Das abgeschiedene ökologische Paradies für Familien, Seminare und Individual-Urlauber Hotel Finca El Cabrito, Tel. +34 922 145 005, www.elcabrito.es, info@elcabrito.es

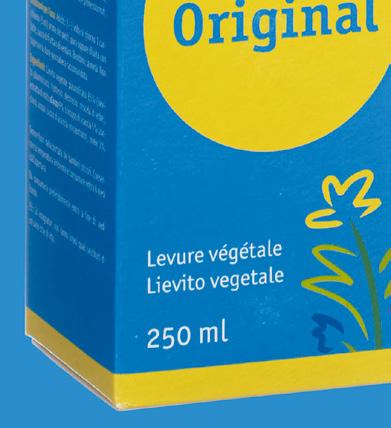
18.55
Strath | Original liquid 250 ml Art. 907088
Vitalität für Sie und gut für die Natur Gewinnen Sie eines von zehn Vitalitätspaketen im Wert von CHF 150.– und erfahren Sie mehr, wie Sie Ihren Alltag für sich und die Natur bewusster gestalten können auf brack.ch/natuerlich-leben WETTBEWERB
Preise inkl. MwSt., Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise sind reguläre BRACK.CH-Verkaufspreise vom 6. Oktober 2020. BRACK.CH AG | 5506 Mägenwil | brack.ch | info@brack.ch | /brack.ch brackch


Info-Abend: 25. Jan.

Info-Abend: 19. Jan.
«Ihr Aus- und Weiterbildungsinstitut IKP: wissenschaftlich –praxisbezogen – anerkannt.»
Neu: Finanzierung Ihrer Ausbildung durch Bundesbeiträge Mit Option zum eidg. Diplom
3 Jahre, ASCA u. SGfB-anerk Körperzentrierte/r Psychologische/r Berater/in IKP Psychosoziale Beratungskompetenz kombiniert mit Körperarbeit (Erleben und Erfahren über den Körper), Entspannungsübungen, Sinnfindung und Ressourcenstärkung. Dipl. Paar- und Familienberater/in IKP Ganzheitliche systemische und psychosoziale Beratung sowie Coaching-Tools rund um Beziehungen. 3 Jahre, SGfB-anerk.
Beide Weiterbildungen können mit einem eidg. Diplom abgeschlossen werden.
IKP Institut, Zürich und Bern
Fasten. Gesundheit. Auszeit.
Seit 30 Jahren anerkannt

Wo Sie statt Meerblick mehr Blick haben.
Im Kurhaus St. Otmar blicken Sie aus dem Fenster und sehen mehr als Meer. Bewusst wahrnehmen, weil Fasten Ihre Sinne schärft. Bewusst erleben, weil Sie Zeit haben zum Sein. Fastenkuren in St. Otmar – Ihre Mehrzeit
Kurhaus St. Otmar · 6353 Weggis · www.kurhaus-st-otmar.ch
im ganzen Körper verteilt und über Jahre hinaus nachweisbar bleibt, ja sogar krank machen kann. Gibt es Möglichkeiten, diese Schwermetalle aus dem Körper auszuleiten? Was wäre im Vorfeld eines weiteren MRI präventiv zu tun? A. H., Bern
Die Kontrastmittel bei der Magnetresonanztomografie (MRI) sind Fluch und Segen zugleich. Man sieht mit den Kontrastmitteln einen Tumor besser, dafür muss man in Kauf nehmen, dass das Kontrastmittel gewisse Risiken birgt. Wie so oft gilt auch hier das gesunde Abwägen, überspitzt gesagt: Welches Risiko bringt mich eher ins Grab – der übersehene Tumor oder das gespritzte Schwermetall? Wenn die MRI bei Ihnen also aufgrund einer ernsthaften Erkrankung gemacht werden mussten, war es das Risiko sicher wert.
Wenn man dem Körper helfen möchte, Stoffwechselendprodukte, Medikamente oder andere Substanzen loszuwerden, sollte man sämtliche Entgiftungsorgane anregen, also Leber, Niere, Darm, Haut und Lymphsystem. Lassen Sie sich in der Drogerie einen Tee mischen, der verschiedene Heilpflanzen enthält, die dies bewirken können. Sehr effektvoll sind zudem Spgagyrik-Mischungen (SpargyrikSprays), weil in dieser Form nicht nur Heilpflanzen, sondern auch homöopathische Heilmittel eingesetzt werden können.
Vor jedem MRI sollte man abwägen, ob es wirklich nötig ist. In den meisten Fällen geben die Resultate nur die Gewissheit, dass keine ernstere Erkrankung vorliegt. Das Problem, zum Beispiel der Schmerz, ist damit jedoch nicht behoben. Trotzdem haben immer weniger Menschen die Geduld, einfach mal abzuwarten. Wir wollen sofort wissen, was los ist, und vergessen dabei die angeborene Körperintelligenz, die uns wertvolle Informationen liefert, wenn wir nur geduldig hinhören und vertrauen würden.
Knochen stärken
Ich hatte vor einem Jahr einen Unfall und musste mehrmals operiert werden. Mittlerweile habe ich ein künstliches Hüftgelenk. Was könnte ich für eine bessere Heilung
der Knochen unternehmen? Ich nehme eine Nahrungsergänzung, D3, K2 und Magnesium, und ernähre mich vielseitig mit Milchprodukten und wenig Fleisch und Fisch. V. S., Zürich
Sie sollten Ihr Bein jeden Tag mit Wallwurzsalbe einschmieren. Wallwurz ist ein sehr guter Knochenheiler. Ich würde Ihnen sogar empfehlen, die Tinktur davon in Form einer spagyrischen Mischung einzunehmen. Am besten lassen Sie sich in einer Drogerie eine Spagyrik-Mischung zubereiten, die unter anderem auch Wallwurz enthält.
Achten Sie darauf, dass Sie täglich viel Grünes essen. Salate, Krautstil, Spinat, Petersilie (ein ausgezeichneter Kalziumlieferant!) und Wildkräuter wie Löwenzahn oder Brennnessel enthalten neben essenziellen Mineralien und Vitaminen wertvolle Bitterstoffe, die den Stoffwechsel anregen und die Heilung unterstützen. Ich würde Ihnen zudem empfehlen, dass Sie ein natürliches Kalzium-Präparat einnehmen, z. B. Aufbaukalk, Kieselsäure oder ein Rotalgenpräparat. Diese Präparate wirken basisch auf den Körper und unterstützen die Kalziumaufnahme. In der Milch ist das Kalzium leider sehr stark gebunden, sodass der Körper Mühe hat, das Mineral gut zu verwerten. Besser ist es bei Hartkäse. Ein Stück Sprinz oder Parmesan können Sie täglich essen. Und streuen Sie Sesamsamen über den Salat und knabbern Sie häufig Mandeln. Ganz wichtig ist auch, viel stilles Wasser oder Tee zu trinken –sonst gelangen all die guten Nährstoffe nicht an die Orte des Geschehens. Auch sind tägliche Spaziergänge sehr zu empfehlen, mindestens 30 Minuten, wenn das schmerzfrei geht. Die Knochen brauchen einen gewissen Widerstand, damit sie wieder stark werden.
Sabine Hurni, Drogistin, Naturheilpraktikerin und Ayurveda-Expertin, beantwortet Ihre Fragen zu Gesundheits- und Ernährungsthemen persönlich und ganzheitlich. sabine.hurni@chmedia.ch oder «natürlich», Leserberatung, Neumattstr. 1, 5001 Aarau. www.natuerlich-online.ch
Einer jener Begriffe, die in Zeiten der COVID-19-Pandemie ebenso pandemische Verbreitung erleben, ist «Solidarität». Staat und Medien appellieren an das individuelle Handeln und fordern Solidarität. Händewaschen, Abstandhalten, Maskierung, Isolierung – während zu Beginn der Krise die vom Bundesrat erlassenen Massnahmen grossen Zuspruch erfahren haben, sind die Gegenstimmen und Rufe nach persönlicher Freiheit schnell lauter geworden. Mit Erfolg: So dürfen wir wieder zum Coiffeur und ins Restaurant.
Die neuen Freiheiten gelten aber nicht für alle: Wer einer Risikogruppe angehört, sollte sich weiterhin besonders schützen. Das ist richtig, denn sie sind besonders gefährdet, könnte man argumentieren. Ja, sie haben ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf von COVID-19. Aber seien wir uns bewusst: Das Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken, ist für Angehörige der Risikogruppen nicht höher als für den Rest der Bevölkerung. Es hängt von unserem Verhalten, unserer Interaktionen und Umgebung ab.
Aus Patientensicht steht im Vordergrund, dass die medizinische Versorgung der Bevölkerung unter allen Umständen sichergestellt ist. Dazu braucht es Solidarität von jedem Einzelnen: Denn was wir jetzt tun und wie wir uns verhalten, bestimmt über Leben und Freiheit eines Teils der Bevölkerung. Seien wir solidarisch, denn wir alle haben die gleichen grundlegenden Rechte. Susanne Gedamke, Präsidentin des Gönnervereins
Mehr zum Thema Patientenrecht unter Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz, www.spo.ch Telefonische Beratung via Hotline 0900 567 047, Fr. 2.90/Min. Im Rahmen der SPO-Mitgliedschaft erhalten Sie diese Beratung unentgeltlich (044 252 54 22)

Die Hirschzunge liebt kühle, feuchte Schluchten, Felsspalten und altes Gemäuer. Wer sie als Heilmittel einsetzen möchte, sollte das Streifenfarngewächs im Garten pflanzen. Denn in freier Natur steht die Hirschzunge unter Schutz.
Text: Steven Wolf
In den lichtarmen Monaten wird der Wald zu einem grünen Pfad der Magie. Ich liebe es, in dieser Zeit frohen Herzens durch die Wälder zu schreiten. Manchmal, wenn es ganz still wird, höre ich dabei das Raunen der Ahnen. Der Wald nimmt uns im späten Herbst tröstend in die Arme und mit ihm seine immergrünen Bewohner. An nassen, schattigen Standorten und in düster anmutenden Schluchten treffe ich auf meinen Streifzügen den Hirschzungenfarn (Asplenium scolopendrium) an. Mit seiner grünen, glatten Zunge unterscheidet er sich klar von anderen Farmarten, die in der Regel gefiederte Blattwedel aufweisen. Der Hirschzungenfarm, schlicht auch Hirschzunge oder auch Hirschfarn genannt, wächst oft an Orten von bezauberndem, geheimnisvollem, leicht düstererem Charakter. Er gedeiht selbst bei nur 20 Prozent Tageslicht prächtig. In der Pflanzensymbolik bedeutet das, dass eine starke Lichtaufnahme vorhanden ist. Deshalb gehört die Hirschzunge zu den Pflanzen, die das Licht der Liebe und Hoffnung in der Tiefe der Dunkelheit verkörpern.
Der meditative Zugang
Ein äusserst schöner Weg, sich einer Pflanze zu öffnen, ist die Meditation. Die Hirschzunge haben wir in einer Gruppenmeditation erforscht, die Erkenntnisse zusammengetragen und dabei erkannt, dass sie eines der ältesten Farne der grossen Mutter Erde ist. Gleichzeitig spürten wir eine enge Verbundenheit mit dem Herrn des Waldes, dem grünen wilden Mann, dem männlichen Teil der Natur. Das heisst, dass der Hirschzungenfarn die Kraft des Urschamanen respektive des Heilers in uns selbst und die Kraft der äusseren Natur verkörpert. Durch die dunklen Schluchten blickt er tief in unser Seelenleben. Das Wesen der Hirschzunge fordert dazu auf, sich in seiner ganzen Tiefe berühren zu lassen, sich seiner Seele
hinzugeben und zu entfalten. Echter Wandel wirkt aus dem Innern heraus. Immer wieder gilt es zu prüfen, was wirklich ist und was nur Schall und Rauch. Die Konzentration, die Schau nach innen, tief in sich hinein sollte jetzt geschehen, immer wieder. Doch wir suchen die Kraft der Veränderung und des Wandels im Chaos allzu oft in der Aussenwelt. Dabei vergessen wir, dass das Zentrum des Geschehens tief in uns liegt. Die Kraft der Veränderung ist still. In sich ruhend. Machtvoll.
Die immergrüne Kraft der Hirschzunge ist verbunden mit der Flamme des Feuers, das nie erlischt: dem inneren Licht der Erde. Wenn wir es schaffen, in uns einen Raum der Stille zu kreieren, verlieren wir uns nicht im Aktivismus. Im Gegenteil werden wir fähig, im Moment zu ruhen, egal was passiert. Haben wir diesen inneren Raum der Stille gefunden, können wir ihn immer wieder betreten und uns auf ihn fokussieren. Es geht darum, die innere Stabilität bewusst zu fördern. Zum Beispiel, indem jeder für sich selbst in seinem Zentrum die reine Liebe der Christusenergie erkennt – eine Liebe, die nicht wertet und urteilt.
Das Wesen der Hirschzunge bringt die Freiheit des Atmens, der Gedanken und des Handels zurück. Wenn man es noch nicht fühlen kann, bittet einem die
* Steven Wolf hat schon als Kind von seiner Grossmutter altes Pflanzenwissen gelernt und weiss um die Kraft der Natur mit all ihren sichtbaren und unsichtbaren Wesen. Er lebt in Escholzmatt, wo er zusammen mit seiner Partnerin ganzheitliche Pflanzenkurse für interessierte Menschen durchführt. Im Lochweidli steht dafür eine eigens gebaute Schuljurte. www.pflanzechreis.ch

MEDITATIONSLEHRER | Die Hirschzunge verkörpert das Licht der Liebe und Hoffnung in der Dunkelheit; sie fordert einem auf, die innere Stille zu suchen. Die Blätter wirken schleimlösend, hustenlindernd und entzündungshemmend, verstärken die Lungenleistung, regulieren den Lymphfluss und können bei Asthma, Husten und Menstruationsstörungen helfen. Die Hirschzunge steht unter Naturschutz und darf nicht in der Natur geerntet werden! Man kann sie aber in einer Wildstauden-Gärtnerei kaufen und im Garten oder auf dem Balkon kultivieren.

Hirschzungenpulverkur
Zur Heilung bei Lungenleiden verwendet man das Pulver für eine Kur in ansteigenden Dosen über sechs Wochen. Man kann es in Apotheken kaufen oder selbst machen. So gehts:
1. Von Mai bis September vom eigenen (!) Bestand einige junge Blätter, an deren Blattunterseite keine Sporen vorhanden sind, ernten und zum Trocknen an einen luftigen Ort aufhängen. Man kann auch jetzt im Oktober noch ernten, doch normalerweise ist Ende September Samhain-Ernteverbot.
2. Sobald sie vollständig getrocknet sind, die Blätter pulverisieren, z. B. im Mixer oder Mörser.
3. Das Pulver der getrockneten Blätter wird traditionell aus der Hand geleckt. Ich finde diese urtümlich-urchige Art der Einnahme sehr schön, weil dadurch der älteste Teil des Gehirns, das Reptilienhirn, angesprochen wird.
Je nach Intensität der Schmerzen wird das Hirschzungenpulver mehrmals täglich eingenommen. Bei akuten Notfallsituationen kann man jede Stunde einen Teelöffel einnehmen, mehr nicht. In der Regel reichen zwei bis drei Messerspitzen drei Mal täglich vor und nach dem Essen.
Die Kur dauert vier bis sechs Wochen. Man beginnt mit kleinen Dosen und steigert allmählich die Einnahmemenge. Konkret: in der ersten Woche dreimal täglich eine Messerspitze, in der zweiten Woche zwei Messerspitzen und so weiter. In der sechsten Woche wieder auf zwei Messerspitzen reduzieren. Danach sollte man eine vierwöchige Pause einhalten. Diesem Intervall folgend kann man das Hirschfarnpulver ein halbes Jahr lang einnehmen, bis die Beschwerden abgeklungen sind.
Bei akuten Zuständen kann man einen Tag lang jede Stunde einen Teelöffel voll einnehmen. Das ist zugleich die Höchstdosis.
«Die Hirschzunge gehörte zu den sechs wichtigsten abendländischen Pflanzen zur Lebensverlängerung.»
Hirschzunge, sich auf den Weg zu machen, um in der tiefsten inneren Stille das eigene Licht zu erkennen. Nach Schock, Trauma oder Mobbing verkrampft sich oft die Atemmuskulatur. Mit dem Steifwerden der Muskulatur findet auch eine Einengung des Herzens, der Gedanken und der Psyche statt. Dadurch stellt sich ein Röhrenblick ein und man ist nicht mehr offen für prozessorientierte Lösungen oder alternative Möglichkeiten. So wird das eigene Wachstum eingeschränkt und die Veränderung bleibt auf der Strecke. Das nennt man den Todstellreflex. Mit der Unterstützung des Urschamanen der Pflanzenwelt, der Hirschzunge, können wir diesen lösen.
Die Hirschzunge hatte einst eine grosse Bedeutung als pflanzliches Heilmittel: Es gehörte zu den sechs wichtigsten abendländischen Pflanzen zur Lebensverlängerung. Die Besonderheit des Pulvers der Hirschzunge liegt in seiner raschen Wirkung und dem breiten Anwendungsspektrum. Man setzt es als Sofortmassnahme bei Schock und verschiedenen Schmerzgeschehen ein, ebenso nach Operationen, Gehirnerschütterungen oder Angstzuständen. Hier wirkt es entkrampfend auf Körper, Geist und Seele. Hirschzungenpulver ist auch eine schnelle Hilfe bei periodisch auftretenden Schmerzen, chronischen Entzündungen, Kopfschmerzen, Migräne, Muskel-, Rücken-, Gelenk- und Brustschmerzen. Geschätzt wird auch die adstringierende, entzündungshemmende Wirkung auf die Schleimhäute sowie der auswurffördernde und schleimlösende Effekt bei Husten. Das Hirschzungenelixier wiederum ist eines der besten Lebermittel. Oft wird vergessen, dass die Leber bei fast allen chronischen Erkrankungen mitbehandelt werden sollte, besonders bei chronischen Lungenerkrankungen wie Asthma oder Allergien. Hirschzungenelixier kann man selbst machen (Rezepte gibt es im Internet) oder, wie das Pulver, in Apotheken kaufen.
Mit der Hirschzunge und etwas Geduld heilt so manche Krankheit oft vollständig aus. Man kann die Heilpflanze aber auch vorbeugend nehmen. Sie unterstützt die Ausleitung über das Lymphsystem, stärkt sämtliche Drüsenfunktionen der Bauchspeichel- und Schilddrüse, der Leber-Gallenblase und der Milz und befreit so den Körper von Lebensmittelzusätzen und Giftstoffen. //
E s gibt wahrscheinlich nichts Schöneres im Leben, als einen anderen Menschen bedingungslos zu bejahen. Und es ist absolut frei: Mein «Ja» ist meine Entscheidung. Niemand kann mich dazu zwingen, niemand kann mich davon abhalten. Es beinhaltet keinen Vertrag und keine Forderung nach Gegenseitigkeit. Niemand verlangt von mir, mein «Ja» auf die Menschen zu beschränken, die umgekehrt auch mich bejahen. Ich kann auch Dritte in mein «Ja» einbeziehen, ohne meinem Geliebten untreu zu werden.
M ein bedingungsloses «Ja» zu einem Menschen bedeutet: Ich sehe sein eigentliches Wesen und bleibe ihm treu. Und zwar auch dann, wenn er es selbst nicht sieht. Selbst wenn er sein Wesen verbirgt, vernachlässigt oder sogar verrät.
Was aber passiert, wenn ich selbst Fehler mache? Wenn ich meinem eigenen Wesen untreu werde, weil mich alte Verletzungen, Faulheit, Angst, Machtspiele oder Gewohnheit davon abhalten? Kann ich mich selbst dann noch bejahen? Da kommen wir an eine schwierige Stelle. Mir jedenfalls gelingt das meistens nicht.
Wir lehnen uns ab, wenn wir Fehler machen. Und deshalb gehen wir davon aus, dass andere uns dann auch ablehnen. Ergo beginnen wir, unsere Fehler zu verbergen, zu überspielen oder vor uns und anderen zu rechtfertigen. Das ist das grosse Beziehungstheater: Wir spielen uns etwas vor – gerade da, wo es heilsam wäre, uns offen und verletzlich zu zeigen. Wir kapseln Bereiche in unserem Leben ein und lassen niemanden mehr hineinschauen, meistens noch nicht mal uns selbst. Verdrängung nennt man das. Es sind hartnäckige heimliche Angewohnheiten und tiefe Schmerzpunkte, von denen wir glauben, wir könnten sie einander nicht zumuten. So bildet sich jenes gepanzerte Bollwerk, das wir gemeinhin Charakter oder Persönlichkeit nennen. Vor was aber soll es uns schützen? Vor der Liebe.
K ürzlich war ich bei der Hochzeit zweier Männer. Eines ihrer Eheversprechen hat mich berührt, ich zitiere es aus meiner Erinnerung: «Ich kann nicht immer in meiner vollen Kraft sein. Aber ich verspreche, mich an den Stellen, wo ich Fehler mache, bemühe, deine Liebe wahrzunehmen.»
K önnen wir anderen erlauben, uns auch dann zu lieben, wenn wir uns selbst nicht lieben können? Können wir einander dort vertrauensvoll zeigen, wo wir uns selbst ablehnen? Das ist eine Schlüsselfrage. An diesen Stellen fühlt sich die Liebe von anderen seltsam an. Wie ein Geschenk, das wir nicht zurückgeben können. Wenn wir aber auch dazu ein «Ja» finden, beginnt etwas zu heilen, was lange verletzt war. Jetzt könnte eine heilsame Beziehung beginnen – ob zum Liebespartner, zum besten Freund oder zwischen Eltern und Kindern.
Dazu brauchen wir nicht nur das bedingungslose «Ja» des anderen; wir brauchen manchmal auch sein «Nein»: als liebevolle und achtsame Korrektur und Orientierung. Nur dann können wir sein «Ja» auch akzeptieren und daran glauben. Es lohnt sich, die Zeit zu nehmen und die richtige Situation zu schaffen, wo wir es in aller Tiefe geben und hören können, das «Ja» wie das «Nein».
D ieses Nein der Liebe sagt: Ich sehe dein eigentliches Wesen und liebe es. Ich sehe auch, wann und wo du von diesem Wesen abweichst. Ich will dir an dieser Stelle ein Zeichen geben, damit du die Abweichung angstfrei wahrnehmen und ändern kannst. Ich werde zusammen mit dir darum ringen, dass dein wahres Wesen über alle Schatten und Verfälschungen siegt. Das ist für mich gemeint mit: «in guten und in schlechten Zeiten». //

● Leila Dregger ist Journalistin und Buchautorin (u. a. «Frau-Sein allein genügt nicht», Edition Zeitpunkt). Sie begeistert sich für gemeinschaftliche Lebensformen und lebt seit 16 Jahren in Tamera, Portugal, wo sie beim Verlag Meiga und der Globalen Liebesschule mitarbeitet.


Guter Sex will gelernt sein.
Mit Geduld. Achtsamkeit und gefühlvollem Erforschen können wir unser volles sexuelles Potenzial entwickeln.
Text: Lioba Schneemann
Sexualität ist komplex und facettenreich. Und guter Sex fällt uns nicht einfach so in den Schoss! Erfüllende Sexualität und das Erleben von Begehren setzt die Kenntnis des eigenen Körpers und seiner Reaktionen sowie seiner eigenen sexuellen Persönlichkeit voraus. Der Körper und das Geschlecht sollten «bewohnt» werden. In Kontakt mit unseren sexuellen Bedürfnissen, Wünschen und Gefühlen zu sein, ist auch hierbei von zentraler Bedeutung. «Ich treffe immer wieder auf Menschen, die sich dieser scheinbar banalen Tatsache nicht bewusst zu sein scheinen. Die Konsequenz ist, dass sich bestimmte Gewohnheiten und Körperhaltungen verfestigen, die für ein lustvolles Sexualleben nicht förderlich sind», sagt die bekannte Sexualtherapeutin Susanna-Sitari Rescio.
Wir lernen beim Sex, uns mit unserem Körper auszudrücken und mit ihm und über ihn zu kommunizieren. Neben dem angeborenen Erregungsreflex – das Genital reagiert auf bestimmte Reize mit verstärkter Durchblutung – hat jeder Mensch einen einigen Erregungsmodus erlernt. Wird der oder die eine durch hohe Körperspannung, Druck, «Dirty Talk» oder Sextoys erregt, stehen andere eher auf zärtliche Berührungen mit Federn und Tüchern oder auf Rollenspiele.
Gemäss Rescio haben viele Menschen mit Sexualproblemen oft einen eingeschränkten Erregungsmodus erlernt: «Die Erregung wird mit einer hohen Anspannung aufgebaut, der Höhepunkt relativ schnell und durch mechanische Bewegungen erreicht – das ist ein Modus, in dem weniger Genuss möglich ist.» Was lustvoller Sex hingegen brauche, sei Zeit und Spiel mit den Ressourcen des Körpers. Verspielte Bewegung statt Verspannung. «Der Orgasmus ist dabei nicht immer ein Muss.»
Das volle Potenzial kosten
Ein Modus mit vielen Variationen wie verschiedenen intimen Berührungsqualitäten, Bewegungen im Becken, Brustbereich und Kopf, dynamischer Spannung statt Verspannung und einer tieferen Bauchatmung ist auch «partnerkompatibler». Männer, die einen mechanischen Modus gelernt haben, können sehr effektiv zum Höhepunkt kommen; Frauen in diesen Modi haben es meist schwerer, durch den/die Partner/-in zum Höhepunkt zu kommen. Rescio betont: «Wenn wir unseren Modus erweitern, ist der Fokus nicht mehr nur auf den Höhepunkt gerichtet, sondern auf eine lustvolle Reise zwischen dem Erregungs- und dem Orgasmusreflex.»
Aber auch dann, wenn Männer und Frauen einen Orgasmus erleben, erforschen sie meistens nicht ihr ganzes sexuelles Potenzial. Die Ressourcen des Körpers bleiben oftmals unentdeckt. Dass der Sex mit der Zeit bestenfalls «öde» und mechanisch wird oder derart unbefriedigend, dass man sich trennt – Sex ist immer noch ein Hauptgrund für Trennungen –, scheint nur eine logische Konsequenz zu sein. Rescio: «Das Ziel in meiner Arbeit ist es, Menschen zu unterstützen, das ganze Potenzial ihres Körpers zu entdecken und alle Ressourcen zu nutzen. Das eigene sexuelle Profil wird klarer, der Horizont erweitert. Aus einer veränderten inneren Position entspringt dann zudem die Sicherheit, selbst bestimmen zu können.»


« Über unsere Gefühle kommen wir in Kontakt mit unseren Wünschen und Bedürfnissen. »
Wenn die Lust erblüht
Sich beim Sex mehr zu bewegen, die Anspannung aufzuweichen, den Atem fliessen zu lassen und die Rhythmen der Bewegungen und der Berührungen zu variieren – all dies können Schlüssel sein, um «die Blüte der eigenen Lust zum Erblühen zu bringen», wie Rescio es ausdrückt. Eine liebevolle und wertfreie Wahrnehmung dessen, was momentan da ist, sei hierfür eine wichtige Voraussetzung. Sie macht mit Klienten deshalb diverse Achtsamkeitsübungen, die die Wahrnehmung für den eigenen Körper verbessern; zu Hause forschen die Klienten dann weiter. Die Übungen reichen von Atem-Wahrnehmungsübungen, Körperreisen, der Wahrnehmung von Gedanken und ihrer jeweiligen Wirkung auf den Körper, der Körperhaltung und ihrer Bedeutung sowie der Wahrnehmung von Körperspannung bis hin zu regelmässiger Selbstbefriedigung.
Achtsamer Sex heisst erst einmal, wirklich zu erfahren, was im Moment in Geist, Körper und Seele passiert, und zwar, ohne dies zu bewerten. Das Bewerten geschieht automatisch, denn oft «funktioniert» unser Körper nicht in der Art, wie wir es wollen, oder die sexuelle Begegnung ist nicht so, wie wir es uns erträumt haben. Hilfreich ist es dann, mit einer möglichst wohlwollenden Haltung sich selbst gegenüber zu versuchen, anzunehmen, was ist, anstatt zu hadern oder sich vorzustellen, was sein könnte. Es geht dabei stets um die Qualität der Wahrnehmung des Moments, indem der Geist sich auf das, was gerade passiert, fokussiert. Das Denken lässt so langsam nach und ein wertfreies Fühlen kann entstehen.

« Die Genitalien sind der Resonanzboden des Gehirns. »
Arthur Schopenhauer (1788–1860)
Immer schön langsam
Sexualität ist ein Lernprozess. Die achtsame Wahrnehmung hilft, aufzuspüren, was einer erfüllteren Sexualität im Wege steht. Somit hält Achtsamkeit ein weiteres Geschenk bereit, nämlich die Möglichkeit, etwas zu verändern. «Achtsamkeit ist nicht einfach passive Hingabe und Akzeptanz, sondern ein innerer Zustand höchst gelassener Wachsamkeit, die uns erlaubt, in jeder Situation die richtige Entscheidung zu treffen. Das kann bedeuten, die Dinge so zu lassen, wie sie sind, oder aber etwas daran zu ändern», sagt Rescio. Ein weiterer Rat ist, dem Gegenüber mit einer «ergebnisoffenen Absicht» zu begegnen: «Ich komme mit einem Wunsch, der mir klar ist und den ich transparent mache. Das Gegenüber kann sich darauf einstellen. Jedoch bleibt es offen, wie wir die Begegnung gestalten oder wie sie endet.»
Achtsamkeit beim Sex zu lernen, heisst vor allem auch, sich Zeit zu nehmen; den Rhythmus zu verlangsamen. Diese Entschleunigung hilft, unsere Gefühle wahrzunehmen, denn sie brauchen Zeit, um spürbar zu werden. Über unsere Gefühle – nicht mit Denken – kommen wir in Kontakt mit unseren Wünschen und Bedürfnissen und können sie schliesslich erfüllen.
Ein grösseres Zeitfenster entsteht zwischen Reiz und Reaktion, was es dem Menschen erlaubt, Neues auszuprobieren. Mit mehr Übung erkennt man schneller den eigenen Zustand – und kann mit verschiedenen Rhythmen sowie Tempi spielen. Ausserdem braucht ein Körper, der sich viele Jahre lang an Schnelligkeit und Anspannung gewöhnt hat, ausreichend Zeit und Geduld für ein «Reset».
All das erfordert Mut: Mut, sich selbst zu entdecken, sich seiner innigsten Wünsche, der Glaubensmuster und Scham bewusst zu werden, und Mut, dies dann auch dem Partner respektive der Partnerin zu offenbaren. Wesentlich in Partnerschaft und Sexualität, so Susanna-Sitari Rescio, sei es, zu sprechen. Jedoch spricht die Sexualtherapeutin lieber vom «Verführen»: «Ich nutze meine Verführungskünste, um dich für mein Projekt – Sex oder etwas anderes – zu überzeugen. Und zwar so, dass du Lust hast, mit mir dieses Projekt zu ermöglichen.» //

Achtsamer Sex – das Becken fühlen
Eine Basisübung in Sachen «Achtsamer Sex» besteht in der bewussten Wahrnehmung der Beckenregion. Als Einstimmung können wir mit einem sogenannten Bodyscan anfangen. Dabei spüren wir den ganzen Körper über verschiedene Sinnesempfindungen wie Wärme, Kühle, Druck, Kitzel und Ähnliches. Anschliessend verweilen wir mit unserer Aufmerksamkeit beim Becken. So gehts:
● Setzen Sie sich auf einen Stuhl, am besten auf die Kante, sodass Sie Ihre Beine gut spüren können.
● Legen Sie Ihre Hände auf die Hüfte und erfühlen Sie die gesamte Knochenstruktur des Beckens. Verweilen Sie einige Atemzüge lang: Erfühlen Sie dabei die Hüftknochen links und rechts, hinten das Darmbein, auch links und rechts, wandern Sie dann Richtung Pofalte. Kehren Sie zurück zu den Hüftknochen und wandern Sie mit Ihren Fingern nach unten zu Kreuz und Schambein.
● Stehen Sie nun auf und trommeln Sie mit Ihren Fingern einige Minuten lang über den ganzen eben abgetasteten Bereich.
● Halten Sie inne und spüren Sie der Wirkung nach. Wie hat sich Ihre Wahrnehmung verändert?
● Fangen Sie nun an, das Becken in alle Richtungen zu bewegen.
● Stellen Sie dann die Füsse weiter auseinander, beugen Sie Ihre Knie und setzen Sie die Bewegung des Beckens einige Minuten lang fort.
● Halten Sie inne und spüren Sie der Wirkung nach. Wie hat sich Ihre Wahrnehmung nun verändert ?
Susanna Sitari Rescio « Sex und Achtsamkeit. Sexualität, die das ganze Leben berührt » Kamphausen 2014, ca. Fr. 22.–
Susanna Sitari Rescio «Sinnliche Intimität» Kamphausen 2020, ca. Fr. 26.–
Diana Richardson «Slow Sex. Zeit finden für die Liebe» Integral 2011, ca. Fr. 28.–
Barry Long
«Sexuelle Liebe auf göttliche Weise» MB Verlag 2004, ca. Fr. 25.–
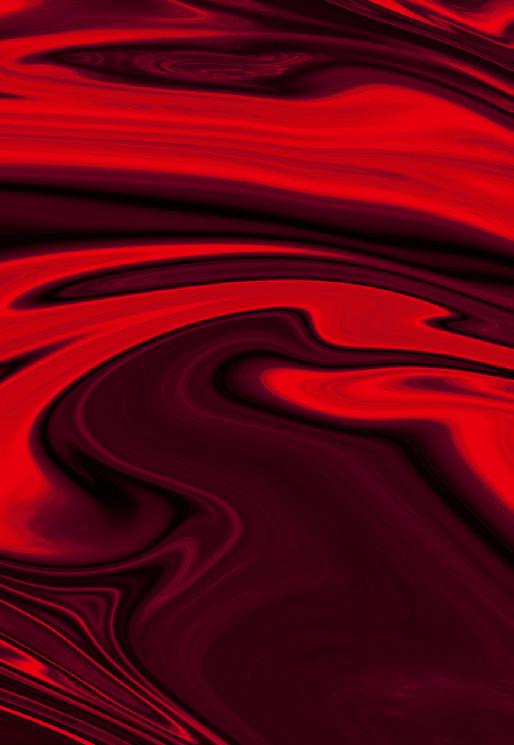



Wer Blut spendet, rettet Leben. Doch in den letzten zehn Jahren sind die Spenden um fast ein Viertel zurückgegangen. Die Blutspende SRK Schweiz ist die einzige Organisation im Land, die Blutspenden organisieren darf. Das Bundesamt für Gesundheit und die Heilmittelbehörde Swissmedic übernehmen die Kontrolle.
Pro Spende wird 450 Milliliter Blut entnommen ( ˆ= 1 Beutel ). Rund 250 000 bis 300 000 Beutel verkauft die SRK pro Jahr an Spitäler und Pharmafirmen. Ein Beutel Blut spült der Organisation gut 170 Franken in die Kasse. Damit deckt sie die Kosten für Beschaffung, Labortests, Verwaltung und Marketing. Sie erwirtschaften keinen Gewinn. Die Pharmafirmen schon: indem sie das Blut zu teuren Medikamenten veredeln. Wer den Lebenssaft spendet, tut das vor allem aus Solidarität: Für Blutspenden zahlt das SRK nichts. Spender haben trotzdem einen Benefit: Studien zeigen, dass regelmässige Blutspenden (alle acht Wochen) den Bluthochdruck nachhaltig regulieren.
Vier bis sechs Liter Blut pulsieren durch die Adern eines Erwachsenen, acht Prozent des Körpergewichts. Es gibt zwei hintereinander geschaltete Kreisläufe, den grossen Blutkreislauf (Körperkreislauf) und den kleinen Blutkreislauf (Lungenkreislauf).
Das Blut bringt Sauerstoff und Nährstoffe zu den Körperzellen und transportiert Abfallprodukte wie CO2 ab. Es verschliesst Wunden, greift Erreger an, hält warm. Und es verrät unseren Lebensstil: Rauchen wir ? Dann findet sich viel Fibrinogen, ein Stoff, der das Blut klumpiger macht. Wir lieben Chips und Burger ? Triglycerin und Cholesterin zeigen es an. Antikörper warnen vor Darmentzündungen oder Rheuma. Und Krebsfrüherkennung, vorgeburtliche Diagnostik und die Erforschung des Alterungsprozesses mittels Blutanalysen stehen vor einem Durchbruch. Zeit, sich dem roten Lebenselixier zu widmen.
Text: Andreas Krebs

Was dem Blut gefällt
● Randen enthalten Eisen und Folsäure – beides ist wichtig für die Blutbildung. Auch rote Früchte sind gut fürs Blut.
● Zimt senkt nach einer US Studie den Blutzucker und verbessert die Cholesterinwerte. Ein Gramm pro Tag genügt.
● Die Gundelrebe wirkt reinigend auf Blut und Lymphe.
● Auch Fasten befreit das Blut von Toxinen.
● Sauerstoff ins Blut bringen mit viel Bewegung an der frischen Luft, reichlich Stosslüften, loser Kleidung, guter Körperhaltung, mehr lachen, richtiger Bauchatmung.
● Ein gesunder Lebensstil: auf das Rauchen verzichten, Bauchumfang und Gewicht unter Kontrolle halten oder bringen, Blutdruck, Blutfett und Blutzuckerwerte regelmässig messen und bei Bedarf verbessern, viel Gemüse und Früchte essen.
Was dem Blut missfällt
● Rauchen verengt die Gefässe und behindert die Zirkulation.
● Beim Sitzen wird oft der Blutdurchfluss in den Beinen behindert – es drohen Thrombose und Lungenembolie.
● (Stille) Entzündunge n und grosse Kälte senken den Blutdruck, das Blut erreicht dann nicht mehr alle Gefässe.
● Fettes Essen erzeugt Cholesterin, das sich an den Gefässwänden ablagern und die Arterien verstopfen kann. Es drohen Herzinfarkt und Schlaganfall.
Kostenlose Ratgeber auf www.swissheart.ch

In der Schweiz hat schätzungsweise jeder vierte Erwachsene einen erhöhten
Blutdruck – das sind rund 1,5 Mio. Menschen. Bluthochdruck spürt man nicht, er verursacht keine Beschwerden und dennoch können die Auswirkungen fatal sein: Hirnschlag, Herzinfarkt, Angina Pectoris, Herzschwäche (Herzinsuffizienz), Durchblutungsstörungen in den Beinen oder Nierenschäden drohen. Andererseits lässt sich mit optimalen Werten das Risiko eines Schlaganfalls um 60 Prozent verringern. Als normal gelten Werte von 120–129 zu 80–84; eine behandlungsbedürftige Hypertonie fängt laut WHO bei 140–159 zu 90–99 an. «natürlich» Leserberaterin Sabine Hurni empfiehlt bei Bluthochdruck Misteltinktur. «Die Mistel hilft, Druck und Spannungszustände in den Blutgefässen auszugleichen», erläutert Hurni. «Bei Bluthochdruck ist es auch wichtig, dass man täglich genug trinkt, salzige Speisen wie Wurstwaren und Fertiggerichte sowie Kaffee möglichst vermeidet, sich viel bewegt und einen guten Umgang mit Stress findet.» Das Wichtigste aber sei der Verzicht auf Zigaretten.


Blutverlust, Mangel und Nierenerkrankungen, Hormonstörungen, aber auch eine Schwangerschaft kann zu Blutarmut führen, im Jargon Anämie genannt. Typische Symptome sind leichte Ermüdbarkeit, Luftnot besonders bei körperlicher Belastung und häufig auch Kopfschmerzen. Die Eisenmangelanämie ist mit einem Anteil von 80 % die häufigste Form der Anämie; betroffen sind vor allem Frauen. Besonders bei Vegetariern kann ein Vitamin B Mangel Grund für die Anämie sein. Liegt die Ursache in einer nicht ausreichenden Blutbildung durch genetisch bedingte Defekte, kann eine Stammzellspende Heilung oder Linderung schaffen.

Es ist weder Einbildung noch Ausrede: Manche Menschen können kein Blut sehen, ja manche noch nicht einmal das Wort «Blut» hören, ohne dass es ihnen schlecht wird. Wissenschaftler nennen die krankhafte Angst vor Blut «Hemaphobie». Betroffenen wird schwindelig, übel, heiss und kalt, sie zittern, fühlen Atemnot oder fallen gar in Ohnmacht. Die Ursachen sind unklar.
ür die rote Farbe unseres Blutes ist der Farbstoff Hämoglobin verantwortlich. Alle Wirbeltiere, also auch wir Menschen, einige Würmer, Egel und Schnecken haben rotes Blut. Einige im Meer lebende Ringelwürmer hingegen haben violettes Blut; Tintenfische, manche Schnecken, Spinnentiere, einige Krebse und Muscheln haben blaues, Borstenwürmer grünes, Heuschrecken weisses und viele andere wirbellose Tiere farbloses Blut. Als «blaublütig» werden Menschen bezeichnet, die von adeligen Familien abstammen bzw. der Aristokratie angehören.

Blut besteht zu etwa 55 % aus einer klaren, gelblichen Flüssigkeit, dem Blutplasma. Der Rest sind feste Bestandteile, die Blutzellen: Rote Blutkörperchen (Erythrozyten, 42,8 %) übernehmen den Transport von Sauerstoff ins Gewebe, weisse Blutkörperchen (Leukozyten, 0,07 %) wehren Krankheitskeime ab und die Blutplättchen (Thrombozyten, 2,13 %) verschliessen Wunden. Gebildet werden die Blutzellen von den Blutstammzellen im roten Knochenmark.
Das Blutplasma besteht zu 91 % aus Wasser, in dem Salze, Mineralien, Kohlenhydrate und Fette gelöst sind, sowie aus etwa 120 verschiedenen Proteinen (Eiweisse). Diese Proteine und ihre lebenswichtigen Funktionen sind der Grund für die grosse Bedeutung des Plasmas in der modernen Medizin. Eine synthetische Alternative gibt es nicht. Derzeit werden vermehrt Spender gesucht, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus Antikörper gebildet haben. Ihr Blutplasma soll schwer erkrankten Covid Patienten verabreicht werden, um den Infektionsverlauf zu stoppen.

Wer Immundefekte oder eine lebensbedrohliche Blutkrankheit wie Leukämie hat, dem hilft oft nur eine Blutstammzellspende. Zuerst wird innerhalb der Familie ein passender Spender gesucht und oft gefunden. Kommt es zur Suche nach unverwandten Spendern kann auch heute noch für einen von vier Patienten kein passender Spender gefunden werden.
Die Erfolgsaussichten einer Transplantation von Blutstammzellen sind umso besser, je exakter die Gewebemerkmale des Spenders mit jenen des Patienten übereinstimmt. Je mehr Spender registriert sind, umso grösser ist folglich die Chance für Kranke auf Genesung. Deshalb ist die weltweite Vernetzung von zentraler Bedeutung: Es gibt über 100 internationale Register. Weltweit sind gut 38 Mio. Spender gelistet, im Schweizer Register knapp 160 000. Diese werden erst im konkreten Bedarfsfall zur Spende aufgeboten. In der Schweiz erfolgten letztes Jahr 264 Transplantationen mit verwandten (111) und nichtverwandten (153) Spendern.
Gesucht werden weitere potenzielle Spender, insbesondere Männer unter 30 Jahren. Auch sind finanzielle Spenden gefragt: Jede neue Registrierung kostet Blutspenden SRK Schweiz 140 Franken. Dieser Betrag wird weder von der öffentlichen Hand noch durch Versicherungen übernommen.
Weitere Informationen sowie Onlineregistrierung auf www.blutspende.ch

Schmerzen sagen uns nicht nur etwas über den Zustand von Körper und Geist. Sie spiegeln auch Gesellschaftsstrukturen wider. Denn es geht bei Schmerzen immer auch um Fragen wie: Wessen Leid wird gehört und ernst genommen? Wer erfährt Linderung und wer nicht?
Text: Ümit Yoker
Sicher haben Sie sich auch schon den Zeh am Türrahmen oder Tischbein gestossen. Erinnern Sie sich an den durchdringenden Schmerz? Für einen Moment rückte er alles andere in den Hintergrund. So mächtig ist der Schmerz und dennoch oft schwer zu erfassen. Denn Schmerzen sind nicht einfach nur eine naturgegebene Reaktion auf Verletzungen, wie die britische Historikerin Joanna Bourke in ihrem Buch «The Story of Pain: From Prayer to Painkillers» schreibt. Schmerzen seien viel mehr als ein physiologischer Prozess und entstünden erst im Austausch mit der Umwelt.
Wie sehr etwas wehtut, hängt demnach nicht nur davon ab, ob das Knie blutet oder der Knöchel anschwillt. Es hat auch damit zu tun, ob Mami gerade zuschaut, wenn das Kind vom Velo fällt; ob wir uns auf einem Schlachtfeld befinden oder auf den letzten Metern vor dem Ziel eines Marathons. Das geht so weit, dass Menschen Schmerzen in Gliedern spüren, die sie gar nicht mehr haben. Wir reden dann von Phantomschmerzen. Dabei sind die Schmerzen sehr real. Wobei ein gebrochenes Herz oft länger und heftiger wehtut, als ein gebrochenes oder verlorenes Bein. Obwohl Schmerzen also schwer einzuschätzen sind und das Schmerzempfinden sehr individuell ist, gibt es eine Definition, auf die sich die Fachwelt geeinigt hat: «Schmerz ist ein unangenehmes Sinnesoder Gefühlserlebnis, das mit einer aktuellen oder potenziellen Gewebeschädigung einhergeht, oder mit Begriffen einer solchen Schädigung beschrieben wird.» Diese Beschreibung der Internationalen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes (IASP) ist die gebräuchlichste heute. Sie fusst auf der Gate Control
Theory aus den 1960er-Jahren: Die Schmerzwahrnehmung des Menschen wird dabei nicht nur von physiologischen, sondern auch von affektiven, kognitiven und motivationalen Prozessen beeinflusst.
Eine Botschaft Gottes?
Woher kommen Schmerzen? Haben sie einen Zweck? Diese Fragen haben sich die Menschen im Lauf der Geschichte immer wieder gestellt. Mal machten sie die Ursache in Körpersäften fest, die aus dem Gleichgewicht geraten waren; mal suchten sie die Antwort in der Aktivität bestimmter Gehirnareale. Kaum eine Vorstellung aber hielt sich länger als die Idee, dass Schmerzen eine Botschaft von Gott seien. Jahrhundertelang wurde dem Menschen erklärt: Schmerzen sind eine Konsequenz von Sünde; Schmerzen weisen den Weg zur Tugendhaftigkeit. Mitgefühl durfte deshalb selten erwarten, wer sich wand und krümmte. Leiden galt es, still zu erdulden, ja, sogar zu begrüssen, um am Ende als geläuterter Mensch daraus hervorzutreten.
Im Jahr 1846 geriet die Deutungshoheit der Religion jedoch heftig ins Wanken. Zum ersten Mal setzten Mediziner Chloroform – und im Jahr darauf auch Äther – bei Operationen und Geburten ein. Die Wirkung dieser neuen Betäubungsmittel war ungleich potenter respektive die Handhabung einfacher als frühere Methoden der Schmerzlinderung mit Alkohol, Opium oder Weidenrinde.
Wenn aber Schmerzen so einfach aus der Welt geschafft werden konnten, waren sie dann wirklich Gottes Nachricht? Warum durfte Wilhelm ebenso auf Linderung zählen wie Johann, obwohl Wilhelm doch nur jeden dritten Sonntag die Kirche besuchte? Nicht mehr mit Bewunderung, sondern mit Unverständnis musste nun rechnen, wer weiterhin passiv litt. Zu dieser Auffassung hatte auch die Aufklärung wesentlich beigetragen: Erst sie hatte das Streben des Menschen nach Glück und Zufriedenheit – und damit einem Leben ohne Schmerzen – zu einem legitimen Ziel gemacht.
Die Vorstellung, sich vollkommen bewusstlos unters Messer zu legen, bereitete vielen Menschen dennoch Unbehagen. Griff man bei kleineren Beschwerden ohne Bedenken zu Pillen, Pasten und Tröpfchen, zog es manch einer vor, bei Operationen weiterhin auf Anästhetika zu verzichten. Nicht nur fürchtete man bei starken Schmerzmitteln gesundheitliche Risiken und Nebenwirkungen und nicht zuletzt Gewöhnung und Abhängigkeit. Es trieb die Menschen auch weiterhin die Frage um: Erfüllen Schmerzen einen Zweck? Schmerzen, so vermutete man, seien ernstzunehmende Warnsignale, die zur Heilung beitrugen.
Zucker fürs Baby Mediziner verzichteten bisweilen auch aus einem anderen Grund auf Anästhetika: Sie gingen schlicht davon aus, dass manche Menschen weniger oder kei-

gefragt: emmanuel coradi *
«Schmerzfrei ist ein sehr ehrgeiziges Ziel»
Emmanuel Coradi, wie hat sich die Schmerzlinderung in den letzten Jahrzehnten verändert ?
Eine adäquate Schmerzbehandlung hat einen viel grösseren Stellenwert als früher. Gerade chronische Schmerzen werden heute rascher erkannt und die Schwelle für spezialisierte Angebote ist gesunken. Es ist ein grösseres Bewusstsein dafür da, dass Schmerzen kein isoliertes Phänomen sind, sondern kognitive oder psychosoziale Faktoren ebenso eine Rolle spielen: Wer seine Stelle verloren hat, erlebt Schmerzen anders als jemand, der gerade viel Glück hat im Leben.
Wie wird das Ausmass von Schmerzen erhoben ?
Dem Betroffenen zuzuhören, ist die Basis jeder Schmerzbehandlung. Schliesslich werden dieselben Zustände von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich bewertet. Trotzdem ist auch eine gewisse Messbarkeit von Schmerzen wünschenswert, etwa mit Skalen. Individuelle Faktoren wirken aber auch hierbei mit.
Trotz unzähliger Möglichkeiten der Schmerzlinderung scheinen Menschen heute nicht weniger zu leiden. Täuscht dieser Eindruck ?
Das ist sehr schwierig zu beantworten. Der Leidensdruck dürfte in den meisten Fällen immer noch derselbe sein wie vor hundert Jahren, doch lassen Betroffene ihre Schmerzen meist rascher behandeln als früher. Chronische Schmerzen sind heute jedoch sicher häufiger anzutreffen. Das hat vor allem demografische Gründe. Das Risiko einer Arthrose im Rücken oder anderer Leiden ist im Alter schlicht grösser. Und auch wenn chronische Schmerzpatienten heute rascher an Spezialisten verwiesen werden, ist der Anteil insgesamt immer noch sehr klein.
Ist absolute Schmerzfreiheit überhaupt möglich ?
Schmerzfreiheit ist ein sehr ehrgeiziges Ziel. Ab einem gewissen Alter sind manche Beschwerden einfach erwartbar. Schmerzmediziner arbeiten in erster Linie darauf hin, die Lebensqualität eines Menschen zu verbessern und Leiden zu mindern, und nicht notwendigerweise daran, Schmerzen vollständig zu beseitigen. Können wir chronische Schmerzen um 50 bis 70 Prozent reduzieren, haben wir oft schon viel erreicht. Es geht bei der Bewertung von Schmerzen immer auch um die Frage, wie sehr sie unseren Alltag einschränken.
Interview: Ümit Yoker
* Dr. med. Emmanuel Coradi ist Facharzt für Anästhesiologie und Schmerzspezialist. Er leitet gemeinsam mit PD Dr. med. Konrad Maurer das Institut für Interventionelle Schmerzmedizin in Zürich.
nen Schmerz empfanden. So erhielten Babys noch bis in die 1980er-Jahre (!) bei chirurgischen Eingriffen kaum Schmerzlinderung, wie die Historikerin Bourke schreibt. «Ein Lutscher in etwas Zuckerwasser getaucht reicht zur Beruhigung des Babys meistens aus», zitiert sie aus einem Fachbuch für Chirurgie von 1938. Seine weitgehende Schmerzunempfindlichkeit, so lautete die gängige Argumentation, schütze das Neugeborene vor den Strapazen des Geburtsprozesses. Nicht nur Säuglingen wurde das Schmerzempfinden weitgehend abgesprochen. Viele Mediziner vertraten auch die Ansicht, dass Schwarze weniger Leid verspüren würden als Weisse. Solche Thesen eigneten sich nicht zufällig bestens dazu, um Sklavenarbeit zu rechtfertigen und die Gefahren auf den Plantagen nicht allzu ernst zu nehmen. Gleichzeitig attestierte man im England des ausgehenden 19. Jahrhunderts anderen Minderheiten wie Juden oder Türken übertriebene Schmerzempfindlichkeit und Wehleidigkeit. Dem Widerspruch in dieser Argumentation begegnete man mit dem Verweis auf den Unterschied zwischen Schmerzwahrnehmung und Schmerzreaktion. Dem weissen, kultivierten Mann wurde entsprechend nicht nur besondere Empfindsamkeit zugesprochen, sondern auch ausserordentliche Willensstärke und Tapferkeit. Damit leide er zwar stärker als alle anderen –kontrolliere aber auch seine Gefühle besser.
Bleibt die Frage: Warum klagen heute allen Schmerzmitteln zum Trotz noch immer so viele Menschen über Schmerzen? Liegt es daran – wie man schon Mitte des 19. Jahrhunderts fürchtete – dass mit effizienteren Betäubungsmethoden auch die Bereitschaft zunimmt, schmerzhafte Eingriffe durchzuführen? Es fehle medizinischem Personal nach wie vor häufig an ausreichendem Wissen über Schmerzlinderung, schreibt Bourke, und Schmerzmittel würden oft falsch eingesetzt oder zu spät verabreicht. Gerade etwa bei chronischen Schmerzen ist ausserdem noch immer unklar, wie eine effektive Linderung überhaupt aussieht. Dazu kommen unterschiedliche Auffassungen darüber, wie viele Schmerzen man jemandem zumuten darf: Geht es darum, Leiden zu verringern oder ganz zu beseitigen? Schmerzen werden aber auch aus Sorge um den Patienten unzureichend gelindert: Die Behandlung kann unerwünschte Nebenwirkungen haben, grosse gesundheitliche Risiken mit sich bringen oder eine korrekte Diagnose erschweren.
Es sind auch hier oftmals Kinder, Frauen und Alte, Minderheiten und Menschen mit wenig Geld und wenig Bildung, deren Schmerzen unzureichend behandelt werden. Sie müssen damit rechnen, dass man ihnen die Kompetenz abspricht, das eigene Befinden korrekt einzuschätzen; dass man ihnen Übertreibung vorwirft, ihre Beschwerden kleinredet oder sie gar als Simulanten abstempelt. Das passiert vor allem, wenn die Ärzte keine körperliche Ursache für die Schmer-

« Ein gebrochenes Herz tut oft länger und heftiger weh, als ein gebrochenes Bein. »
zen finden – und ist für Betroffene enorm belastend. Übrigens werden Frauen gemäss einer aktuellen Studie generell nicht nur weniger und ineffektivere Schmerzmittel gegeben als Männern. Es dauert auch länger, bis sie an spezialisierte Schmerzkliniken verwiesen werden.
Manchmal seien es aber auch die Schmerzpatienten selbst, die die Möglichkeiten der Linderung nicht ausschöpften, hält Bourke fest. Gründe dafür: Angst vor gesundheitlichen Risiken und einschneidenden Nebenwirkungen durch die Medikamente, vor Gewöhnung und Abhängigkeit – aber auch die Vorstellung, dass Schmerzen den Charakter stärken.
Würden eine bessere Ausbildung des medizinischen Personals und besseres Management die Schmerzlinderung gerechter machen? Die Historikerin Bourke zweifelt, dass dies ausreichen würde: «Solange nicht jede Stimme dasselbe Gewicht hat, werden auch nicht alle Beschwerden gleich erhört.» Schmerzen zu behandeln, setzt voraus, dass wir den Beschreibungen des Gegenübers Glauben schenken und ohne absolute Beweise auskommen. Denn Schmerzen sind letztlich das, was wir als solche empfinden. //
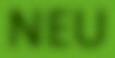

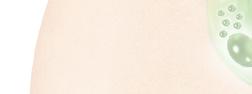


berufsbegleitende Ausbildung in Tanztherapie

Einführungsseminar 19.–21. Februar 2021
Anerkennungen CH (Artecura), D (BTD), EU (EADMT)
Institut am See fürTanztherapie
Uttwilerstrasse 26
CH-8593 Kesswil Telefon +41 71 460 17 81 info @ tanztherapie-am-see.ch www.tanztherapie-am-see.ch

Schule für Sterbe- und Trauerbegleitung
Berufsbegleitende ein- oder zweistufige Ausbildung mit namhaften Gastdozenten:
inserat_natuerlich_90x64.indd 8
05.10.20 12:47 Sabine Hurni Praxis für westliche und fernöstliche Naturheilkunde
Schartentrottenstr. 9 5400 Baden
056 209 01 88 079 750 49 66 info@sabinehurni.ch www.sabinehurni.ch

«Lass Nahrung deine Medizin sein!» Gesundheitsberatungen und Ayurveda Kochkurse

Anouk Claes, Rosanna Abbruzzese, Dolly Röschli, Kurt Nägeli, Antoinette Bärtsch, Pete Kaupp, Renate von Ballmoos, Marcel Briand, Karin Jana Beck, Nel Houtman, Kokopelli Guadarrama, u.a.
Nächster Ausbildungsbeginn: Samstag, 27. März 2021
«Die Tränen der Freude und der Trauer fliessen aus derselben Quelle»
Zentrum Jemanja Ifangstrasse 3, Maugwil 9552 Bronschhofen
Telefon 071 911 03 67 info@jemanja.ch www.jemanja.ch

Dieses Gemälde ist eine Delikatesse.
Kleinstes birgt Feinstes. Kerne, Samen und Körner von Biofarm sind echte Kraftpakete. In den genussvollen Winzlingen unserer Schweizer Bio-Felder steckt Grossartiges. Ob Kürbis, Lein, Raps, Senf oder Sonnenblume, sie alle liefern erstaunlich wertvolle und nahrhafte Inhaltsstoffe. Ihre Einsatzmöglichkeiten sind riesig: knusprig, nussig, würzig, rassig.


Gestern dampfte wieder eine wunderbare Kürbissuppe in den Terrinen unseres Lassalle-Hauses. Und eine wahre Kürbis-Prozession ist in diesen Tagen vor dem kleinen Mäuerchen des Gewächshauses zu entdecken. Die Gärtnerinnen und Gärtner haben gigantisch grosse und unscheinbar kleine, elegant geschwungene und leicht verdrückte Exemplare aufgereiht. Ein sehr fruchtbares Jahr geht auf den Feldern unseres Lassalle-Hauses zu Ende. Dieser Erntesegen lässt mich nachdenken über den Unterschied zwischen der Fruchtbarkeit der Natur und dem Leistungsdenken unserer modernen Gesellschaft.
Gegen ein gesundes Leistungsdenken ist nichts einzuwenden. Aber unsere Gesellschaft und Wirtschaft wird fast ausschliesslich von diesem Leistungsdenken gesteuert. Das erleben wir im LassalleHaus tagtäglich: Die grösste Herausforderung für die Menschen, die in unser Zentrum für Spiritualität kommen, ist dieses Leistungsdenken. Egal, ob die Menschen versuchen, in die östliche oder christliche Meditation hineinzufinden. Sie kommen mit dem Vorsatz: Jetzt habe ich mir extra ein Wochenende Zeit genommen. Wenn ich jetzt in die Kapelle gehe oder mich auf das Kissen setze, dann muss es sofort still um mich und in mir sein. Es müssen gleich Erfahrungen des Friedens kommen.
Aber dem ist leider nicht so. Solche Erfahrungen von innerer Freiheit zeigen sich sachte; sie brauchen Zeit. Nicht noch mehr Druck. Zuerst kommt vielleicht der verdrängte Ärger der vergangenen Woche
● Kurse im Lassalle-Haus
Zen, Traumarbeit und luzides Träumen
mit Peter Widmer
8. bis 13. November
Gott ist im Kommen –Adventsmeditation
Mit Monika und Helen Renz
27. bis 29. November
Entscheidungen geistlich begleiten
Weiterbildung in Geistlicher Begleitung
Mit Stefan Kiechle SJ Bruno Brantschen SJ 27. bis 29. November
Auszeit zur rechten Zeit Durch Innehalten zum Neugestalten
Mit Lorenz Ruckstahl 26. November bis 4. Dezember
Infos und Anmeldung : Telefon 041 757 14 14 info@lassalle-haus.org www.lassalle-haus.org
hoch. Den gilt es zunächst auszuhalten und loszulassen, bevor Stille und Frieden sich einstellen können. Wachstum, auch spirituelles Wachstum braucht nun mal seine Zeit.
Weiter braucht Wachstum eine Haltung der Aufmerksamkeit und des Vertrauens. Das erleben wir auch in unseren Beziehungen. Wenn wir unseren Kontakten Aufmerksamkeit schenken, wenn wir verbunden bleiben, dann können unsere Beziehungen und Freundschaften wachsen. Das gilt für die Freundschaft mit den Menschen in unserem Umfeld ebenso wie für unsere Freundschaft mit der Welt und mit der Schöpfung – das gilt auch für die Freundschaft mit dem Geheimnis dieser Welt, das wir Christen Gott nennen. Die Religionen haben unterschiedliche Bilder für diese Verbundenheit. In der christlichen Tradition ist es das Bild des Weinstocks und der Reben.
Schliesslich hat Wachstum ein eigenes Schönheitsideal – ein Gedanke, den unser Ordensgründer Ignatius uns mitgegeben hat und über den ich gern sinniere, wenn ich die Prozession der Kürbisse auf meinem abendlichen Spaziergang betrachte. Jeder ist ein Original. Wie langweilig erscheinen mir da die polierten Äpfel, die uns fast wie geklont in den Ladenregalen entgegengrinsen. Dann doch lieber ein verwachsener, knorrig aussehender Kürbis, der im Suppentopf herrlich schmeckt! //

Das Lassalle-Haus in Edlibach ist ein von Jesuiten geführtes interreligiöses, spirituelles Zentrum mit einem breiten Kursangebot, das von Zen-Meditation über Natur seminare bis zu klassischen Exerzitien reicht. Für «natürlich» schreiben der Jesuit Tobias Karcher und die Pfarrerin Noa Zenger abwechselnd die Kolumne Gedankensplitter.
* Tobias Karcher (58) ist Jesuit und Direktor des LassalleHauses Bad Schönbrunn, Bildungszentrum der Jesuiten in Edlibach im Kanton Zug.

Narben können Energien blockieren und Schmerzen und andere Beschwerden verursachen. Mithilfe der Akupunktur lassen sie sich auf sanfte Art entstören.
Text: Catherine Stalder
Narben sind sichtbare Spuren eines gelebten Lebens: Ein unachtsamer Schnitt mit dem Messer oder ein Kaiserschnitt bei der Geburt können die tieferen Schichten der Haut so sehr schädigen, dass neue Hautzellen die Wunde oft nicht vollends reparieren können. Stattdessen entsteht faserreiches Ersatzgewebe. Meist hinterlassen Narben nur hauchdünne, kaum spürbare Linien. Doch manchmal verursachen die gewölbten, harten Narbenstrukturen Schmerzen, Juckreiz oder Spannungsgefühle. Dies, weil Narben wichtige Energieleitbahnen im Körper stören oder blockieren können und weil die Hautfasern von der Verletzung in die Tiefe wachsen. Mithilfe von Akupunktur, einer ganzheitlichen Methode der Alternativmedizin, lassen sich die Narben auf sanfte Art entstören.
Störfelder erkennen
Bildlich gesprochen verhält sich eine Narbe ähnlich wie ein Staudamm: Sie hindert die Lebensenergie daran, im Körper frei zu fliessen. Da das faserreiche, unelastische Gewebe einer Narbe die Energie begrenzt weiterleitet, entsteht um die Narbe ein Energiestau. Folglich sind gewisse Areale im Körper energetisch unterversorgt, was

Sanasearch ist die grösste Schweizer Therapeuten-Buchungsplattform. Mit über 20 000 qualifizierten Therapeuten aus den Bereichen Psychotherapie, Massage, Komplementärtherapie, Alternativmedizin, Ernährungsberatung und vielen mehr, finden Therapiesuchende mit nur wenigen Klicks die passende Fachperson. www.sanasearch.ch
sich mit der Zeit negativ auf den gesamten Organismus auswirken kann. Behindert ein sogenanntes Störfeld wie die Narbe die komplexen Regulationsmechanismen, Organinteraktionen oder Muskelfunktionsketten, kann dies zu akuten Beschwerden führen.
Ein Therapeut kann an unterschiedlichen Faktoren erkennen, ob eine Narbe das innere Gleichgewicht des Körpers belastet: reagiert die Narbe bei Wetterwechsel, ist sie druckempfindlich, hypersensibel oder taub? Ist das Narbengewebe wulstig, hart, eingezogen oder zeigt es farbliche Veränderungen? Sind stechende oder ziehende Schmerzen zu spüren – nicht nur an, sondern auch um die Narbe? Beschwerden wie Rauschen in den Ohren, eine gereizte Blase oder Gelenkschmerzen, die scheinbar nichts mit einer Narbe zu tun haben, können ebenso in Zusammenhang mit einem durch Narben gestörten Energiekreislauf stehen. Nicht ausgeschlossen sind zudem vegetative oder seelische Beschwerden wie depressive Verstimmungen, Antriebslosigkeit oder Schlafstörungen. Eine Narbe kann auch erst nach Jahren Beschwerden verursachen, was das Erkennen eines Zusammenhangs zwischen Symptom und einer Narbe als Störfeld nicht immer einfach macht.
Blockaden mit Nadeln lösen
Die Akupunktur hat ihren Ursprung in der Traditionellen Chinesischen Medizin und beruht auf Jahrtausende altem Wissen. Mithilfe der Akupunktur können belastende Narben entstört und Energieblockaden gelöst werden. Die hauchdünnen Nadeln, die bei einer Therapie eingesetzt werden, unterstützen den harmonischen Fluss der Lebensenergie «Qi» und des Blutes, was den körpereigenen Heilungsprozess anregt und beschleunigt. Mit geschulten Handgriffen setzt der Akupunkteur bei der Narbenentstörung die Nadeln auf ganz bestimmte Akupunkturpunkte, die auf den Energieleitbahnen liegen. Der sanfte Reiz aktiviert jene betroffene Energieleitbahn, welche in Verbindung mit den gestörten Organen oder den Organbereichen steht. Bei der Akupunktur wird also nicht das erkrankte Organ direkt behandelt, sondern der Kanal der Lebensenergie, der sogenannte Meridian, oder der Akupunkturpunkt, dem das Organ zugeordnet ist. Verschiedene Reaktionen wie ein Kribbeln oder die Wahrnehmung von Wärme, Kälte, Druck oder Ziehen können bei der Stimulierung wahrgenommen werden – und oft eine baldige Besserung des Wohlbefindens schon nach wenigen Sitzungen. //

patientenfrage an: catherine stalder *
«Können
Narben Kopfschmerzen auslösen ?»
Vor einem Jahr hatte ich eine Operation am Blinddarm. Seither belasten mich immer heftiger werdende Kopfschmerzen. Eine Bekannte hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass dies mit meiner Narbe zusammenhängen könnte. Was ist Ihre Meinung dazu?
Anne-Katrin Bach, 42 Jahre
Möglicherweise ist das Narbengewebe vom Operationsschnitt nach innen gewachsen und engt einen Teil Ihres Darmes ein, sodass der Darminhalt nicht richtig vorwärts gedrückt werden kann. Die umliegenden Ablagerungen im Darm können dadurch zunehmen und Beschwerden wie Kopfschmerzen verursachen. Der Schnitt der Blinddarm-Operation bewirkt ausserdem einen Unterbruch in der betroffenen Leitbahn. Diese Störung kann zu einem lokalen Stau führen, der sich ebenfalls auf die verbundenen Organe auswirkt und damit die Kopfschmerzen auslösen kann. Ihre Bekannte könnte demnach mit Ihrer Annahme richtigliegen. Eine Narbenentstörung mit Akupunktur könnte Ihre Leiden lindern.
* Catherine Stalder ist diplomierte Therapeutin der Traditionellen Chinesischen Medizin und auf die Behandlung von Narbengewebe spezialisiert. Die Behandlungstechnik beruht auf einer speziellen Akupunktur-Methode und ist absolut schmerzfrei. Termine bei Catherine Stalder können über www.sanasearch.ch gebucht werden.
wusst

Gekochte Eier lassen sich nicht einfacher schälen, wenn man sie mit möglichst kaltem Wasser abschreckt. Darauf sollte man laut
K-Tipp ohnehin verzichten: «Denn dabei zieht sich die Eierschale zusammen, wodurch viele Keime ins Ei gelangen können. Das zeigten Versuche des Bundesamts für Gesundheit.
Solche Eier lassen sich nur noch wenige Tage lagern. Langsam abgekühlte Eier hingegen bleiben rund einen Monat haltbar.» k-tipp

Hirntumore
Pestizide in Verdacht
Eine Studie des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin der Uni Bern zeigt: In den landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten Zürcher Weinland und Berner Seeland gibt es auffällig viele Krebsfälle – allein im Kanton Zürich 39 Prozent mehr Hirntumore bei Kindern als im Durchschnitt der ganzen Schweiz. Ursache könnten Pestizide sein, berichtete jüngst der Gesundheitstipp. krea

« Man sieht oft etwas hundert Mal, tausend Mal, ehe man es zum allerersten Mal wirklich sieht. »
Christian Morgenstern (1871–1914)
Stress
Ausgeschlafen ist man weniger anfällig
Eine zu kurze Nachtruhe vergrössert die Stressreaktion am nächsten Tag. Dadurch reagieren unausgeschlafene Menschen selbst auf schöne Ereignisse weniger mit positiven Emotionen. Das gilt insbesondere für Menschen mit chronischen Erkrankungen. Das haben US-Forscher herausgefunden. Dagegen waren Menschen mit chronischen Erkrankungen signifikant weniger stressanfällig, wenn sie länger schlafen konnten. MM
Blutgefässe
Brokkoli schützt vor Ablagerungen

Der regelmässige Verzehr von Gemüse kann helfen, das Fortschreiten einer Blutgefässerkrankung zu verhindern: Eine im «British Journal of Nutrition» veröffentlichte Untersuchung ergab, dass ältere Frauen mit einem höheren
Verzehr von Kreuzblütlern wie Brokkoli, Rosenkohl und Kohl (täglich mehr als 45 Gramm) nur halb so oft an einer Anreicherungen von Kalzium in der Aorta leiden. Die Anhäufung von Fett- und Kalziumablagerungen ist die Hauptursache für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Möglicherweise hemmt das in Kreuzblütlern reichlich vorkommende Vitamin K den Verkalkungsprozess in den Blutgefässen. MM

Vulkanausbrüche haben in den letzten zweitausend Jahren noch deutlich mehr zu natürlichen Temperaturschwankungen beigetragen als bisher angenommen. Das zeigt eine Studie mit Beteiligung der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL. Grosse Vulkanausbrüche können die globalen Durchschnittstemperaturen um Bruchteile von Grad Celsius senken. Der Hauptfaktor ist die Menge an Schwefel, die während des Ausbruchs freigesetzt wird und in die Stratosphäre
gelangt. Dort bildet sie winzige Partikel, die einen Teil des Sonnenlichts daran hindern, die Oberfläche zu erreichen. Dies kann zu kürzeren Wachstumsperioden und kühleren Temperaturen führen, was wiederum geringere Ernten zur Folge hat. Diese Klimaveränderungen haben möglicherweise frühere gesellschaftliche und wirtschaftliche Umwälzungen beeinflusst. Die Forschenden betonen jedoch, dass ihre Resultate nicht bedeuten, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel weniger gravierend sei. wsl.ch

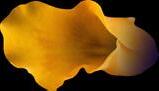
jetzt entdecken HIN







Wer durch die riesige bunte Blume ins Stapferhaus tritt, blickt zuerst tief in den menschlichen Körper und landet bei Zellen, Chromosomen und Hormonen. Sobald sich die nächsten Türen öffnen, zeigt sich: Geschlecht ist weit mehr als Biologie. Es ist Kultur und Gesellschaft, Erziehung und Vorbilder, Geschichte und Gegenwart, Lust und Frust. So entdecken die Besucherinnen und Besucher sich selbst und das Geschlecht in all seinen Facetten. Sie üben sich im geschlechtsspezifischen Posieren und erfahren, dass Frauen in der Steinzeit jagten und warum Männer früher Stöckelschuhe trugen. Es geht um Rollen und Arbeit, um Macht und Ordnung, um Schönheitsideale und um Sexualität. Die Ausstellung schafft einen sinnlichen, inspirierenden Raum für die spielerische Auseinandersetzung mit dem heissen Thema – humorvoll und poetisch. Ausstellung «Geschlecht. Jetzt entdecken»
1.11.2020– 31.10.2021
Stapferhaus, Lenzburg (AG)
Öffnungszeiten Ausstellung und Bistro Di.–So. 9–17 Uhr
Do. 9–20 Uhr
www.stapferhaus.ch

Leoniden – Sternschnuppenschauer
Einen der schönsten Sternschnuppenschauer verkörpern die Leoniden, die jedes Jahr Mitte November auf die Erde niederprasseln. Sie treten vom 10. bis 23. November gehäuft auf. Das Maximum wird am 17. November in den frühen Morgenstunden erwartet, da die Erde in dieser Zeit die Umlaufbahn und damit die Reste der Staubwolken des Kometenschweifes Tempel Tuttle durchquert. Die Leoniden sind mit rund 250 000 Kilometern pro Stunde ausserordentlich schnell und scheinen alle von einem Punkt auszustrahlen, der sich im Sternbild Löwe befindet – daher der Name «Leoniden». Obwohl es nur Millimeter grosse Körnchen sind, die in die Erdatmosphäre eintauchen, werden sie bei dieser hohen Geschwindigkeit von der Reibung in der Lufthülle bis zur Weissglut aufgeheizt und erscheinen folglich als Sternschnuppen, die eine helle Leuchtspur hinterlassen.
Möglicherweise lohnt es sich, eine Wunschliste anzulegen. Denn nach Volksglauben darf man sich beim Anblick einer Sternschnuppe etwas wünschen. Da im November gerade in klaren Nächten oft Nebel im Flachland liegt, ist eine Beobachtungsposition in der Höhe von Vorteil. Ebenso sollte der Beobachtungsort dunkel sein, ohne störenden Lichtquellen, die den Himmel aufhellen. Da am 15. November Neumond ist, sind diesbezüglich die Bedingungen optimal.
Andreas Walker

Archäologie
Unsere Vorfahren waren keine
Im heutigen Nord- und Mitteleuropa können die meisten Menschen auch als Erwachsene den Milchzucker Laktose verdauen. Bei unseren Vorfahren, die ungefähr im Jahr 1200 vor Christus auf dem ältesten bekannten Schlachtfeld Europas am Fluss Tollense im heutigen Mecklenburg-Vorpommern gestorben sind, war das jedoch nicht der Fall. Das konnten Forscher nun zeigen, indem sie das Erbgut aus den Knochen der Gefallenen untersuchten. Demnach hat sich die Genvariante, die für die Laktosetoleranz verantwortlich ist, innerhalb weniger Jahrtausende in Europa verbreitet. wissenschaft.de

Der Steinkauz wäre als Brutvogel hierzulande beinahe ausgestorben. Seit einigen Jahren wird er mit grossem Aufwand von BirdLife Schweiz und zahlreichen Partnern gefördert. Mit Erfolg: 2020 wurden 149 rufende Männchen gezählt, rund dreimal mehr als vor 20 Jahren. Die Bestandserholung zeigt: Artenförderung funktioniert, wenn Behörden, Naturschutzorganisationen und Landwirte mit finanzieller Unterstützung zusammenarbeiten. krea
Liebe ist die Revolution
«G enau diesem Zweck zu dienen, sind wir hier: der vollständigen Neugestaltung der Zivilisation», schreibt Kulturphilosoph Charles Eisenstein. Doch trotz bester Absichten führe politischer Aktivismus, wie er von den Anhängern von Fridays for Future, Extinction Rebellions und anderen Bewegungen praktiziert wird, zu «mehr desselben», warnt er in seiner Streitschrift. Es ist gleichsam ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, politisches Engagement neu zu denken und fühlen und Wut in Liebe zu verwandeln. Denn: «Liebe ist die Revolution.» Was das konkret bedeutet, sollten nicht nur Aktivisten verinnerlichen.
Charles Eisenstein
« Wut, Mut, Liebe ! Politischer Aktivismus und die echte Rebellion », Europa Verlag 2020, ca. Fr. 10.–
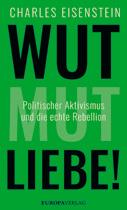

Er habe ein böses, schlimmes, frevelhaftes Buch geschrieben, sagte Herman Melville über seinen 1851 erschienenen Roman «MobyDick», der rasch in Vergessenheit geriet. Erst Jahrzehnte nach seinem Tod wurde das Werk, in dem erstmals ein Tier literarischer Titelheld ist, in den Rang der Weltliteratur erhoben. Doch verstanden hat es bis heute kaum einer. Aber «man kann Moby Dick ja auch mit Vergnügen lesen, ohne all dieses Wissen. Die Bibel, die Zahlen, die Namen, Ismael, Ahab, all das», sagt der junge Journalist in der hier besprochenen Adaption, und er hat recht! Ein besonderes Vergnügen bereitet auch die literarisch wie zeichnerisch hervorragende Graphic Novel, in der der blinde Hass von Kapitän Ahab auf den weissen Wal förmlich spürbar ist.
Isaac Wens, Sylvain Venayre « Auf der Suche nach Moby Dick », Knesebeck 2020, ca. Fr. 40.–
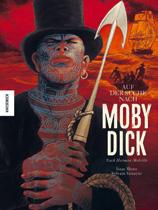
Langeweile
Leere ist gesund fürs Hirn
Wer sein Gehirn gesund und fit halten möchte, sollte sich von Zeit zu Zeit langweilen. Laut Neurowissenschaftlern hat Langeweile mehrere Vorteile: Sie kann soziale Beziehungen verbessern, fördert die Kreativität und kann die allgemeine Gehirngesundheit verbessern. Doch was, wenn die Langeweile kaum auszuhalten ist? Ein Ansatz besteht darin, das Gehirn so umzuschulen, dass es diese weniger aufregenden und vielleicht langweiligen Zeiten geniessen kann. Ja, das geht ! krea

Fata Morgana über dem Bodensee
Eine besonders bizarre Naturerscheinung sind die Luftspiegelungen oder Fata Morganas, die vor allem in den heissen Wüstengebieten zu beobachten sind. Wenn der Boden durch die Sonnenstrahlung extrem aufgeheizt wird, entstehen über dem Boden mehrere Luftschichten mit verschiedenen Temperaturen. Dadurch werden die Lichtstrahlen umgelenkt. Dies führt zu Spiegelungen und damit zur Wahrnehmung von Gegenständen an Orten, wo sie in Wirklichkeit gar nicht vorhanden sind – eine Fata Morgana wird sichtbar. Oft werden Dinge von irgendeinem Ort unter dem Horizont als Zerrbild in der flirrend heissen Luft an einem anderen Ort sichtbar.
Die gleichen Effekte können auch in polaren Regionen über warmem Meerwasser oder in kalten Tagen über warmen Seen beobachtet werden. Im Bild verursachen der warme Bodensee und die darüber liegende Kaltluft eine Luftspiegelung. So erscheinen am deutschen Ufer die Häuser wie durch einen Zerrspiegel gesehen und werden zum Teil umgekehrt gespiegelt. Besonders gut sichtbar ist dieser Effekt in der Bildmitte, wo das Dach der Kirche sowohl normal als auch umgekehrt erscheint.
Das Bild entstand in Rorschach nach einer starken Abkühlung.
Andreas Walker

Es ist eine stille Tragödie: Totholz, eines der wertvollsten und artenreichsten Habitate, ja Grundlage für neues Leben, ist selten geworden. Ein Plädoyer für mehr «Unordnung» in Gärten und Wäldern.
Text: Eva Rosenfelder

Ein Viertel aller im Wald lebenden
Tier-, Pilz- und Pflanzenarten ist auf Totholz angewiesen, um zu überleben. ●
Der Tod gehört zum Kreislauf der Natur. Wie weit entfernt ist davon unsere «ewig-junge» Gesellschaft, in der alles Abgestorbene sogleich verbannt und weggeräumt wird. Im natürlichen Geschehen aber wird, was tot oder am Absterben ist, unmerklich gewandelt. Alles hat seine Zeit und seinen Sinn. So wird jeder tote Baum kostbare Nahrung und Kinderstube: Etwa ein Viertel aller im Wald lebenden Tier-, Pilzund Pflanzenarten ist auf Totholz angewiesen, um zu überleben. In der Schweiz sind das allein etwa 2700 Gross pilze, 150 Flechten- und 1700 Käferarten. Hinzu kommen grössere Tiere wie Spechte, Siebenschläfer, Fledermäuse usw., aber auch Ameisen, Wildbienen etc. Insgesamt, so schätzt man, sind mindestens 5000 Tierarten auf den Lebensraum Totholz angewiesen. Und jede zweite junge Fichte im Gebirgswald wächst auf vermodernden Baumstämmen heran. Überlässt man einen Baum ganz seinem Lebenszyklus, ohne ihn zu fällen, so stirbt er irgendwann zuerst teilweise und dann als Ganzes ab. Doch dieser Tod ist noch lange nicht das Ende, im Gegenteil. Nun wird das abgestorbene Holz erst recht zum Lebensraum: Während sich Pilze vom toten Holz ernähren, legen Wildbienen und andere Insekten ihre Eier darin ab, Vögel, Igel, Mäuse und andere Säugetiere wiederum ernähren sich von den Eiern, Larven und adulten Insekten – der tote Baum ermöglicht also Leben in vollen Zügen.
Das leise Sterben
Nach dem Absterben des Holzes beginnt eine Besiedelung mit Tausenden von verschiedenen Arten, die sich zum Beispiel bei der Eiche über Jahrhunderte hinziehen kann. Doch so wie Menschen heute oft nicht mehr eines natürlichen
Die Eiche gilt als die «artenreichste» Baumart. Sie beherbergt ungefähr 650 holzbewohnende Käferarten, während es auf der Buche «nur» 240 und auf der Fichte gerade mal 60 Käferarten sind. Da manche Arten nur in einer bestimmten Baumart vorkommen, ist auch in Sachen Totholz Vielfalt gefragt.
Eine abgestorbene Buche bietet in den ersten beiden Jahren etwa für den Schrot-Zangenbock (Rhagium mordax ) ideale Entwicklungsbedingungen. Dieselbe Buche ist für den Balkenschröter (Dorcus parallelipipedus), eine Hirschkäferart, erst Jahre später, wenn der Zersetzungsprozess bereits fortgeschritten ist, eine optimal nutzbare Ressource. Ein reiches Totholzangebot ist aber nicht Garant f ür eine vielf ältige Käfergemeinschaft. Licht und Besonnung spielen eine ebenso wichtige Rolle. Eine Untersuchung im Arlesheimer Wald nahe Basel zeigte, dass das Totholz- oder das Blütenangebot alleine keine Erhöhung der Käfervielfalt zur Folge hatte. Totholz und Blüten kombiniert, ergaben hingegen eine Verdoppelung der Anzahl Arten der Roten Liste. Die Erklärung dafür: Viele Bock- und Prachtkäfer fressen sich als Larve durch Totholz. Nach der Entwicklung zum adulten Käfer stehen dann aber oft Blütenpollen und Nektar zuoberst auf der Speisekarte – und oft werden sogar ganz bestimmte Blütenfarben bevorzugt . Der Eichen-Parchtkäfer zum Beispiel liebt gelbe Blüten, egal ob Hahnenfuss, Löwenzahn oder Habichtskraut.
Quelle: www.adriennefrei.ch

Wer zu wenig eigenes Schnittholz hat, besorgt sich bei Förstern, Landwirten etc. Wurzelstöcke, gefällte Obstbäume (im Herbst oder früh im Jahr wird geschnitten). Auch Schwemmholz ist eine Möglichkeit (z. B. nach Hochwasser bei Stauwehren nachfragen). Besonders Wurzelstöcke und Schwemmholz sind nicht nur wertvoller Lebensraum, sondern auch sehr dekorativ. Je nach Standort sind es gute Sonnenplätze für Eidechsen und Schmetterlinge, während Wurzelhohlräume, egal ob im Schatten oder an der Sonne, von verschiedensten Tieren als Versteck genutzt werden.
Totholzzaun Das Grundgerüst für einen Totholzzaun geben zwei Pfostenreihen vor, die in den Boden geschlagen oder eingegraben werden. Sie geben die gewünschte Breite des Zauns vor. Mit der Breite steigt der ökologische Wert, aber auch der Materialbedarf, der oft unterschätzt wird. Den Raum zwischen den Pfosten gilt es zu füllen mit Ästen, Zweigen, Heckenschnittgut, Schilf, Wurzeln, Weihnachtsbäumen etc. Durch Verrottungsprozesse sackt der Haufen nach und nach zusammen, so ist immer wieder neues Material gefragt – das im besten Fall direkt aus dem eigenen Garten stammt (natürliche Kreisläufe).
Holzstapel, die man zum Verrotten stehen lässt, sind eine einfache Methode, mit der sich grössere Mengen an Totholz im Garten integrieren lassen. Am besten verwendet man dafür verschiedene einheimische Baumarten. Eine dicke Schicht Holzschnitzel und Erde dienen als Feuchtigkeitsspeicher. So finden Pilze optimale Wachstumsbedingungen und das Modern kann losgehen.
Schnitzelwege Einen Weg (z. B. Labyrinth-Weg) oder Platz ca. 30 Zentimeter tief ausheben und mit LaubholzSchnitzeln auffüllen. Wenn die Schnitzel mit der Zeit verrotten, bieten sie vielen Insekten Lebensraum. Senkt sich der Boden ab, können neue Schnitzel ausgebracht werden. Allzu viel aber kann den Boden sauer machen, sodass Lebewesen langfristig verschwinden.
Alte und tote Bäume sollten – sofern sie kein Sicherheitsrisiko darstellen – unbedingt stehengelassen werden. Sollte dies nicht möglich sein, ist es eine gute Variante, den Baum als sogenannte Hochstubbe oder Torso zu kappen. Dabei bleibt zumindest der Stamm stehen. So können selbst gekappte Baumveteranen noch über viele Jahre einen wertvollen ökologischen Beitrag leisten.

Todes sterben können, so lässt man auch den Bäumen respektive dem Wald keine Zeit mehr dafür. Denn Holz war und ist vor allem auch ein Wirtschaftszweig, war es doch bis weit ins 20. Jahrhundert ein zentraler Bau-, Brenn- und Werkstoff. Infolgedessen wurde die Waldnutzung in einem Ausmass intensiviert, in dem auch der letzte Rest Holz weggeräumt und nichts mehr auf dem Waldboden liegengelassen wurde. Damit verloren nicht nur viele Tierarten – darunter unzählige Nützlinge – ihren Lebensraum, auch gingen dem Wald kostbare Nährstoffe verloren.
Heute ist fast die Hälfte aller holzbewohnenden Käferarten (sogenannte Xylobionten) gefährdet. Dies, obwohl die Menge an Totholz in den Schweizer Wäldern seit der Umstellung auf Öl als Brennstoff kontinuierlich zugenommen hat und es heute doppelt so viel Totholz im Wald gibt wie noch vor 30 Jahren. Dazu beigetragen haben auch die Orkane Vivian (1990) und Lothar (1999) sowie die mangelnde Rentabilität der Holzernte in vielen Regionen. Ebenso haben anhaltenden Dürreperioden in den letzten Jahren viele Bäume absterben lassen. Und nicht zuletzt ist immer mehr Waldbesitzern die Wichtigkeit von Totholz durchaus bewusst.
Dennoch mangelt es nach wie vor sogenannten Biotopoder Habitatbäumen. Damit werden Bäume bezeichnet, die besondere Lebensräume (Biotope, Habitate) für andere Lebewesen bieten; oft handelt es sich um sehr alte, teilweise bereits absterbende oder tote Bäume. Selten geworden sind auch stehende oder liegende dicke, besonnte tote Baumstämme sowie Holz in fortgeschrittenen Abbaustadien. Im Wirtschaftswald werden Bäume nach wie vor lange vor dem «Greisenalter» gefällt: Eine Weisstanne kann 500 bis 600 Jahre alt werden, wird aber meistens bereits mit 90 bis 130 Jahren «geerntet».
Alte Bäume, lichte Auen und Laubwälder in tiefen Lagen, gestufte Waldränder, hochstämmige Kastanien und
Im Wirtschaftswald werden Bäume nach wie vor lange vor dem
«Greisenalter» gefällt. ●
Obstbäume – auf diese heutzutage selten gewordenen Lebensräume sind die 118 einheimischen Holzkäferarten angewiesen, die auf der Roten Liste stehen. Genauso wie Hunderte ihrer Artgenossen, die mangels Kapazität noch nicht einmal erfasst werden konnten und in aller Stille aussterben.
Der Anblick eines geräumten Waldes ist für uns so normal geworden, dass wir herumliegendes Totholz als unordentlich empfinden. Wie wenig hat unser künstliches Ordnungsgefühl doch zu tun mit der unglaublichen biologischen Vielfalt, die sich durch die tiefergreifende Ordnung der Natur stets erneuert – und mit ihren perfekten Kreisläufen immer wieder neues Leben erzeugt.
Was bereits im Wald das ästhetische Gefühl mancher erholungsuchender Menschen stört, ist diesen erst recht im Garten ein Dorn im Auge. Hier, wo noch immer der Rasenmäher das Sagen hat, wo regelmässig geschnitten, «Unkraut» getilgt, gewerkt und geputzt wird, bis alles blitzblank aussieht – jedoch unzählige Lebensräume von Kleinlebewesen, Vögeln und Säugetieren verschwunden sind. Doch gerade im Garten, auf dem Vorplatz oder sogar auf dem Balkon kann jeder und jede Einzelne viel bewirken und höchst persönlich beitragen zu mehr Artenvielfalt.
Totholz ist besonders dann hilfreich, wenn auch der restliche Garten möglichst naturnah gestaltet wird, mit Stein- und Asthaufen, Wasserstellen, verwilderten Winkeln, heimischen Wildsträuchern und möglichst lange blühenden Wildpflanzen (beim Kauf Bio vorziehen, denn viele Pflanzen aus dem Supermarkt sind heute mit für Kleinlebewesen höchst giftigen Pestiziden versetzt). Je mehr solche naturnahen Gärten entstehen, desto besser funktioniert die Vernetzung dieser Kleintierparadiese untereinander. Ein dichtes Netz ermöglicht es den verschiedenen Tier- und Pflanzenarten, zu wandern und sich auszubreiten.
Totholz ist dabei immer gefragt. Anstatt Äste und Zweige also sogleich diensteifrig in der Grünabfuhr zu entsorgen, schichte man sie besser lose zu einem Asthaufen auf. Laubhölzer wie Eiche, Buche oder Obstbäume beherbergen generell mehr Arten als Nadelhölzer; dicke und lange (mindestens 1,5 m) Äste geben mehr her als dünne. Doch grundsätzlich ist es die Vielfalt an verschiedensten Möglichkeiten, die am meisten bewirkt. Ob stehend oder liegend, ob an feuchten schattigen Stellen, wo es schnell modrig wird, oder an trockenen Plätzen: Immer finden sich schon in Kürze die entsprechenden Tierarten ein, die genau diesen Lebensraum suchen. Und so wuselt es meist schon bald im Totholz, dass es eine Freude ist! //
Werner David
«Lebensraum Totholz. Gestaltung und Naturschutz im Garten», Pala Verlag 2020, ca. Fr. 21.–
Volker Binner
«Lebensraum Baum. Auf Entdeckungsreise in der faszinierenden Welt zwischen Wurzel und Krone », BLV 2019, ca. 35.–

Die besten Gesundheitstipps auf Video
Das Beste aus der Naturheilkunde nicht nur im «natürlich», sondern als Video auch auf Facebook, Instagram und auf unserer Website. Monat für Monat präsentieren Ihnen dort die «natürlich»-Leserberaterin Sabine Hurni und Chefredaktor Markus Kellenberger saisonale und alltagstaugliche Gesundheitstipps.
Kurz, prägnant und leicht verständlich erklären Ihnen die beiden direkt aus dem Garten von Schloss Wildegg, welche Naturheilmittel am besten gegen allerlei Beschwerden wie Allergien helfen. Sabine Hurni weiss, wie man die verschiedenen Kräuter und Heilmittel richtig anwendet, und zeigt im Video anschaulich, wie einfach das geht.
Die «natürlich»-Videos mit den besten Tipps aus der Naturheilkunde finden Sie auf Facebook, Instagram und auf der «natürlich»-Website.
@natuerlich_ch
facebook.com/natuerlichonline
www.natuerlich-online.ch

Erleben Sie auf Schloss Wildegg einen Hauch adligen Lebensstil. Prächtige Gärten und ein Museum mit sprechenden Schlossbewohnern entführen Sie in den Barock.
Schloss Wildegg, Effingerweg 6, 5103 Möriken-Wildegg www.museumaargau.ch/schloss-wildegg

Wenn die Tage kürzer werden und kälter, wenn die Blätter fallen und es stiller wird in der Natur, dann kann Melancholie den Menschen befallen. Doch dank Bewegung, frischer Luft und Sonnenlicht empfinden viele gerade in den dunkleren Wintermonaten Glücksmomente bei der Arbeit im Garten und auf der Terrasse.
Text: Frances Vetter

frances und remo vetter*
Nebelschwaden wecken in diesen Tagen oftmals malerische Stimmungen. Es gilt nun, solange das Wetter hält, den Garten, die Terrasse und Balkonkästen aufzuräumen. Verschiedene Winterkohlsorten wie Rosen-, Rot- und Weisskohl, Blumenkohl und der unverwüstliche und besonders vitaminreiche Federkohl sind jetzt erntereif. Auch frisches Wurzelgemüse wie Rüben, Pastinaken, Knollensellerie, Steckrüben, Endivie, Winterportulak, Feldsalat und, je nach Witterung, Kopfsalat und Rucola ernten wir in diesen Tagen.
Damit uns der Frost kein Schnippchen schlägt, lagern wir Wurzelgemüse in Mieten, wie Remo es von seinem Grossvater gelernt hat. Dazu wird an einem trockenen, geschützten Ort eine 20 bis 30 Zentimeter dicke Schicht sauberes, trockenes Stroh ausgebreitet und das Gemüse darauf pyramidenförmig aufgeschichtet. Das Ganze wird mit einer Schicht sauberem Stroh und etwa 20 Zentimeter Erde abgedeckt. Zur Sicherheit legen wir unter und auf die Miete ein engmaschiges Gitternetz, damit sich keine Nagetiere über das Gemüse hermachen. Wenn mit sehr kaltem Wetter zu rechnen ist, kann die Miete mit zusätzlichem Stroh oder mit Planen oder Vlies abgedeckt werden. Auf diese Weise sind Wurzelgemüse wie Karotten, Kartoffeln und Rote Beete lange lagerbar. Es sei an dieser Stelle gesagt, dass Frost häufiger unser Verbündeter ist als unser Feind. Wieso? Frost unterdrückt Krankheiten, setzt Schädlingen wie Käfern, Raupen, Schnecken und Mäusen zu, macht Schadorganismen wie Pilzen den Garaus und reinigt die Luft. Die zu erwartenden eisigen Temperaturen im November und Dezember brechen den Boden auf und machen ihn hart, sodass wir gut darauf arbeiten können, ohne die
Erde zu verdichten. Wenn wir im Garten etwas umgestalten wollen, greifen wir also am besten zur Schaufel, sobald das Thermometer für einige Tage unter die Nullgradgrenze sinkt.
Fit
Gerade jetzt in der dunklen, kalten Jahreszeit ist es umso wichtiger, sich möglichst viel in der freien Natur aufzuhalten, sei es auf Feld und Wiese, im Wald oder im Garten. Bewegung, frische Luft, Sonnenlicht, eine gute vitamin- und mineralstoffreiche Ernährung, ausreichend Schlaf und die Stärkung des Immunsystems sind zentrale Aspekte, damit wir gesund durch den Winter kommen. Deshalb möchten wir an dieser Stelle dem Meerrettich speziell Beachtung schenken. Denn die «Heilpflanze des Jahres 2021» stärkt den ganzen menschlichen Organismus.
Traditionell erntet man Meerrettich von Oktober bis Januar, wobei die Haupterntezeit November ist. Im Garten kann man die winterharten Wurzeln an frostfreien Tagen den ganzen Winter über aus dem Beet holen. Dazu hebt man sie mit der Grabgabel aus der Erde, dreht die Blätter und bürstet die anhaftende Erde ab. Ausser der Verwendung in der Küche wird das Wurzelgemüse als Heilmittel bei Verdauungsbeschwerden, hartnäckigem Bronchialhusten und Lungenleiden eingesetzt, ebenso bei Harnwegsinfektionen und, als Wickel, bei Kopfweh, Migräne und Verspannungen der Nackenmuskulatur. Nicht ohne Grund also wird Meerrettich auch als «Antibiotikum der Bauern» bezeichnet – und tatsächlich konnte eine antivirale und antibakterielle Wirkung des Meerrettichs inzwischen nachgewiesen werden. Die kalorienarme Knolle enthält die wertvollen Mineralstoffe Kalium für Muskeln, Nerven und die Verdauung, Calcium für
den Knochenaufbau, Natrium zur Regulierung des Wasserhaushaltes und Magnesium, das gesund für Herz und Kreislauf ist; ausserdem ist sie reich an den Vitaminen B1, B2 und B6. Durch die Schärfe werden Magensaft und Gallensäure angeregt und damit der Appetit gesteigert. Gut bewährt hat sich die Pflanze ausserdem gegen Entzündungen. Neben dem Roten Sonnenhut (Echinacea purpurea) halten Remo und ich den Meerrettich für eine der wichtigsten Pflanzen, um das Immunsystem zu stärken.
Winterschutz und -schnitt
Nicht nur der menschliche Körper, auch der Garten braucht Schutz im Winter. Dabei kommt es auf den richtigen Zeitpunkt an: Es gilt, die Pflanzen nicht zu früh einzupacken, weil hin und wieder sogar im November zweistellige Tagestemperaturen erreicht werden und es den Gartenpflanzen dann zu warm würde. Vereinzelte Nachtfröste schaden den meisten Pflanzen nicht. Erst wenn der Wetterbericht Dauerfröste ankündigt, handeln Remo und ich und packen die Pflanzen ein. Wenn wir unsere Stauden und Rosen dick mit Laub einpacken, überstehen sie den Winter besser.
Sobald alle frostgefährdeten Pflanzen im Garten und auf der Terrasse geschützt, die Wasserleitungen und Regentonnen entleert und die Pflanzungen der wurzelnackten Gewächse getätigt sind, können wir es ruhiger angehen. Dann sinnieren wir über die Frage: Sollen wir die ausdauernden Pflanzen schon jetzt zurückschneiden oder doch erst im Frühjahr? Hier scheiden sich die Geister: Schneiden oder stehen lassen ? Wir denken, dass es auf verschiedene As-
* Frances und Remo Vetter sind als freischaffende Gartengestalter, Referenten und Buchautoren unterwegs.

● Lauch, Feder- und Rosenkohl anhäufeln. Möglichst erst nach den ersten Frösten ernten, denn danach schmecken sie milder.
● Winterportulak, Feldsalat und Winterspinat gedeihen in geschützten Lagen auch in Balkonkistchen: In 1–2 cm tiefe Rillen säen. Nach dem Auflaufen die Sämlinge auf 2–3 cm Abstand ausdünnen.
● Im Kräutergarten Salbei, Minze, Zitronenverbene und Stevia stark zurückschneiden und die abgeschnittenen Blätter trocknen. Stevia und Zitronenverbene sind nicht winterhart; sie können in einem kühlen Raum überwintern, z. B. im Keller oder in der Garage.
● Wärmeliebende Kübelpflanzen, die Frost nicht ertragen, ins Winterquartier zügeln.
● Zimmerpflanzen wie Orchideen und Birkenfeige (Ficus benjamina) in Fensternähe platzieren.
● Amaryllis eintopfen.
● Balkon- und Fensterkistchen mit Herbstschmuck und winterharten Gewächsen bepflanzen.
● Frühlingsblüher setzen und die letzten Blumenzwiebeln für die Frühlingsblüte in Garten und Balkongefässe stecken.
● Herbstdünger für den Rasen zählt zu den wichtigsten Pflegemassnahmen, um diesen winterfest zu machen. Gegen Ende November steht der letzte Mähtermin an. Stellen Sie den Rasenmäher dazu etwas höher ein als üblich: Fünf Zentimeter Schnitthöhe sollten nicht unterschritten werden. Moos und Laub abrechen und kompostieren.
● Laub auf Wegen und Rasenflächen zusammenrechen, unter Sträuchern aber liegen lassen. Da bietet es den Wurzeln Kälteschutz und Kleintieren Lebensraum.
● Frost gefährdete Wasserleitungen und -becken entleeren. Teiche winterfest einrichten und Laub abfischen, Ziergräser und Schilf sehen lassen.
● Gartengeräte pflegen, Tongefässe vor Frost schützen, Nistkästen reinigen.
pekte wie Klima, Art der Bepflanzung und Gartengrösse ankommt. Wer wie wir in einer im Winter oft schneereichen Gegend lebt, wird kaum in den optischen Genuss zart eingepuderter Samenstände kommen, weil diese unter Schneebergen begraben sind. Wer einen grossen Garten hat, wird allein aus Zeitgründen mit dem Ausputzen der Stauden schon im Herbst beginnen. Unser Credo lautet aber: Möglichst viele Pflanzen über den Winter stehen lassen, damit die Insekten und Vögel Nahrung und Unterschlupf finden.
Ab- respektive zurückschneiden sollte man im Herbst alle Stauden, deren Laub oder Samenstände nach Frosteinbruch matschig und unansehnlich werden. Solche Pflanzen werden auch gerne von Schnecken als Unterschlupf aufgesucht. Darum schneiden wir Pfefferminze, Liebstöckel, Zitronenmelisse, Oregano, Johanniskraut und Pflanzen wie Funkien, Sonnenhut und Herbstanemonen stark zurück. Ungeschnitten hingegen schicken wir die Gräser in den Winter. Für sie geht die Gefahr in der kalten Jahreszeit hauptsächlich von der Feuchtigkeit aus, die in die Mitte, also ins Herz des Horstes, dringt und das Gras zum Faulen bringt. Deshalb empfehlen wir, die Wedel mittelhoher und hoher Gräser mit einem Strick zusammenzubinden, damit von oben nicht zu viel Feuchtigkeit eindringt.
Ein Sprichwort sagt, ein Apfelbaum gedeiht am besten, wenn man ihn so schneidet, dass eine Taube durch seine Krone hindurchfliegen kann. Das will heissen, dass die Krone offen und lichtdurchlässig sein soll. Äpfel- und auch Birnbäume werden während der Ruhezeit zwischen November und Februar geschnitten. Zunächst ist es wichtig, alles tote, kranke und beschädigte Holz zu entfernen. Dann schneiden wir aus, was sich kreuzt, aneinander reibt oder zu dicht steht. Und dann gilt es, die Fruchtbildung für das kommende Jahr anzuregen: Zu lange Triebe sind einzukürzen, altes Holz ist zu entfernen.
Die Baumkrone soll, wie erwähnt, offen sein, damit die Luft dort gut zirkulieren und Licht einfallen kann. Deshalb werden Äste, die zur Kronenmitte hin wachsen, abgesägt, und zwar dort, wo sie vom Hauptstamm abzweigen. Zu lange Zweige kürzen wir auf die Hälfte oder ein Drittel ein, und zwar immer bis zu
einem Seitentrieb, der nach aussen gerichtet ist. Auch gilt es, alte erschöpfte Äste und Triebe zu entfernen, die sich an Rändern früherer Schnittstellen gebildet haben.
Alle Sägeschnitte sollen schräg abwärts verlaufen, damit Regenwasser gut abfliessen kann und die Schnittwunden nicht faulen. Säge, Garten- und Baumschere müssen scharf und sauber sein, damit der Baum nicht beschädigt oder Krankheiten übertragen werden. Vor und nach dem Einsatz reinigen wir die Sägeblätter mit Alkohol oder flammen sie kurz ab; danach reiben wir sie mit etwas Öl ein, damit sie nicht rosten. Die Klingen der Gartenschere reiben wir mit Stahlwolle ab, um Verschmutzung und Infektionsüberträger zu entfernen, und ölen sie danach ebenfalls. Robuste Arbeitshandschuhe schützen die Finger.
Wir pflanzen im Spätherbst auch wurzelnackte Bäume und Sträucher. Der Boden hat die Restwärme des Sommers gespeichert und mit genügend reifem Kompost und einer leichten Mistgabe versehen, wachsen die Gehölze vor dem Wintereinbruch gut an.
Wir pflanzen kleine Apfelbäumchen in ein grosses Loch, in dem der Unterboden genügend gelockert wurde, und arbeiten Kompost und Stallmist ein. Vorgängig stellen wir das Gehölz in die Grube und platzieren einen Pfahl an der Wind- und Wetterseite, um den Stamm künftig zu schützen. Nun nehmen wir das Bäumchen wieder heraus. Die Wurzeln werden etwas angeschnitten; sie müssen gut durchfeuchtet sein. Deshalb stellen wir das Bäumchen vorgängig einige Stunden in einen Wassereimer, damit die Wurzeln das Wasser aufsaugen können. Wenn die Wurzeln gekappt sind, schlägt Remo den Pfahl fest ein, stellt das Bäumchen wieder ins Loch, füllt dieses mit gutem Kompost und bindet den Stamm mit Baumbändern an den Pfahl. Das neu gepflanzte Bäumchen muss gut eingewässert und die Baumscheibe unkrautfrei gehalten werden. Zu diesem Zweck haben sich Kokosmatten sehr gut bewährt. Auch ältere Obstbäume bekommen im Spätherbst eine Kompostgabe. Und wenn es die Zeit zulässt, machen wir bei ihnen einen Lehm-Kalk-Stammanstrich, um Frostschäden und das Eindringen von Schädlingen einzudämmen. //
Ruhe finden
Verbessertes Lebensgefühl – Happiness
Entdecken Sie Ihre Gesundheit neu, indem Sie das med. Autogene Training erlernen. Durch die Regulation von Gefühlen und Gedanken sowie die verbesserte Körperwahrnehmung entwickelt sich Ihre Gesundheit in einem ganz neuen Licht. Ein Lebensgefühl, das zu Glücksmomenten führt. Melden Sie sich jetzt an. Bei Bedarf werden auch Onlinekurse durchgeführt. www.relax-care.ch

Dem Stress begegnen
Stress. Mich nicht.
Schwierige Situationen in Familie und Beruf können Dauerstress auslösen und am Ende in einer Depression oder im Burn-out enden. Der Zertifikatslehrgang «Stressberatung und Stressmanagement IKP» vermittelt in fünf Tagen das nötige Wissen und die Fähigkeit, mit dem eigenen Stress umzugehen und Stressbetroffene darin zu unterstützen, ihre Stressbelastungen in den Griff zu bekommen, sie zu reduzieren und Resilienz aufzubauen.
Fortbildungsbeginn 15.04.2021 www.ikp-therapien.com (Rubrik Fortbildung)

Supervision Kompakt
Kreativ und praxisnah erfahren Sie die praktische Anwendung von Supervisions-Tools im Einzel- und Gruppensetting. Sie lernen, einen Blick für das Ganze zu bekommen. Erkennen, worum es wirklich geht, und üben, komplexe Situationen abzubilden und zu vertiefen. Statt Symptome zu verschieben, wird mit Klienten eine stimmige und nachhaltige Entwicklung in Gang gesetzt.
Start 5. März 2021
www.lika.ch/
supervision-kompakt-lehrgang
LIKA GmbH, 5233 Stilli b. Brugg, Telefon 056 441 87 38

Die Anwendung von Heilpflanzen bei Beschwerden oder für den Erhalt der Gesundheit ist tief in unserer Heiltradition verwurzelt. Ihr Einsatz ist auch heute noch aktuell und bietet eine wirksame und sanfte Möglichkeit, sich aktiv für sein eigenes Wohlergehen einzusetzen.
Workshop Samstag, 28. November 2020, 9 bis 16.30 Uhr. Wir sind im Herzen von Zürich, unweit der Europaallee und dem Hauptbahnhof. NHK Institut, Militärstrasse 90, Zürich
Mehr Infos und Anmeldung unter www.nhk.ch/campus/alle-startdaten
Telefon 043 499 92 82

Die Trommel ruft
Dieses Seminar gibt Einblick in Praktiken, Denkweisen und in die Philosophie des südafrikanischen Schamanismus der Matuela Tradition. Der Dozent baut Brücken zu unseren westlich orientierten Heilsystemen und zeigt indigene Wege zur Ganzheitserfahrung auf.
Workshop Samstag, 5. Dezember und Sonntag, 6. Dezember 2020, 9 bis 17 Uhr. Mehr Infos und Anmeldung unter www.nhk.ch/campus/alle-startdaten
Telefon 043 499 92 82

Wohltuende Wickel und Kompressen für den Hausgebrauch
Das Wissen um die Wickel und Kompressen stammt aus alten Zeiten. Diese leisteten gute Dienste bei der Bewältigung von Krankheiten – und tun es immer noch oder wieder. Besuchen Sie den Vortrag von Tom Moser am Dienstag, 24. November, um 19 Uhr bei der Paramed AG, Haldenstrasse 1, 6340 Baar. Eintritt frei.
Anmeldung erbeten: www.paramed.ch
E-Mail: events@paramed.ch
Telefon 032 626 31 26
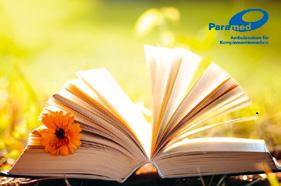

Hygiene
Baumwoll-SilberGesichtsmaske.
Durch die hohe Selbstreinigungskraft kann die Samina Tutela Baumwoll-SilberGesichtsmaske problemlos einige Tage hintereinander getragen werden. Der hohe Silberanteil ist für die Vernichtung von Bakterien und Viren ausschlaggebend. Waschbar bei 60 Grad.
Bestellen unter https://drink.samina-night.com/

Inspiration
Wandbilder für pures
Wohlbefinden
Die Inspirationen erfolgen aus der Natur, der heiligen Geometrie und Feng-Shui. Kraftsymbole und Farbpaletten werden bewusst abgestimmt und in die Gestaltung eingeflochten. Das perfekte Wandbild für Ihr Zuhause oder Ihre Praxis. www.anima-pura.ch

Trockene Haut? Ausschlag? Juckreiz?
Die Omida Cardiospermum-N-Salbe enthält den Wirkstoff der Heilpflanze Cardiospermum halicacabum (Ballonrebe), die sich als sanfte Alternative zu Kortison bewährt hat. Sie mildert den Juckreiz und hemmt Entzündungen. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. www.omida.ch

Nachhaltig und modern Kneipp erscheint in neuem Design
Die Verpackung der Kneipp Produkte wird nachhaltiger, frischer und moderner. Doch keine Sorge, an der bewährten Qualität der Produkte hat sich nichts geändert. Überzeugen Sie sich selbst. www.kneipp.swiss

Taschenapotheke Homöopathie für die Hosentasche
Die Taschenapotheke von OMIDA beinhaltet eine passende Auswahl verschiedener homöopathischer Einzelmittel für den Alltag. Erhältlich in Apotheken und Drogerien. Dies sind zugelassene Arzneimittel. Lesen Sie die Angaben auf der Packung. www.omida.ch
Gesundheit
Für das Immunsystem
Lactibiane Immuno enthält Vitamin C und D, beide tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Wie bei allen Lactibiane-Produkten sind auch im Lactibiane Immuno nur qualitätsgeprüfte Milchsäurebakterien enthalten, die bedenkenlos eingenommen werden dürfen. Sie sind vermehrungsfähig und haften aktiv an der Darmwand an. Täglich eine Lutschtablette zwischen den Mahlzeiten nehmen. Erhältlich in Apotheken und Drogerien. www.phytolis.ch

Gesund schlafen
Betten aus Naturmaterialien «allnatura» bietet ökologische Produkte hoher Qualität zu fairem Preis. Alles bei «allnatura» ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Alle Rohstoffe der Produkte werden regelmässig auf Schadstoffe geprüft. www.allnatura.ch

Corona: Verstand einschalten «natürlich» 10-20
Wissen
Sie, ich merke je länger je mehr, dass ich mit meinen Auffassungen nicht mehr so richtig in diese verrückte Welt gehöre. Ich fühle mich manchmal auf verlorenem Posten –und das macht einsam.
Deshalb ist es immer wieder ein Aufsteller, wenn mir Zeilen in die Hände kommen, in denen ich spüre, dass ich mit meinen Gedanken nicht allein bin. Herzlichen Dank für Ihren Mut auf der Suche nach Objektivität und Wahrheit. Katharina Gessler, Ottenbach
Corona: «Fürchtest du dich noch oder weisst du schon ?»
«natürlich» 03-20
Abstand – Isolation – und wie weiter?
Es ist eine verrückte Zeit. Praktisch alle bis anhin geltenden Regeln werden über den Haufen geworfen. Der Grund ist ein Virus, noch viel kleiner als die Bakterien, er ist nicht so recht zu fassen. Die Bakterien kann man noch mit einem Mikroskop sehen, die Viren sind dazu viel zu klein (Anm. d. Red.: Influenza angeblich 120 Nanometer, Corona max. 160 nm). Die Auswirkungen eines Befalls können aber erheblich sein, eine direkte Bekämpfung ist schwierig.
Alle Lebewesen auf der Erde, auch der Mensch, haben ein Immunsystem entwickelt, das solcherlei Störenfriede im Schach hält. Der Mensch hat allerdings Lebensgewohnheiten entwickelt, die dieses Immunsystem schwächen. So können sich Ansteckungen ausbreiten und damit sogenannte Pandemien auslösen, wie jetzt gerade. Das Wehklagen ist gross und das Immunsystem entsprechend geschwächt, sodass auch ansonsten gesunde Menschen krank werden.
Gefragt wäre also etwas mehr Zuversicht und vor allem die Stärkung des Immunsystems. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Eines der wichtigsten Instrumente in dieser Hinsicht ist ein vernünftiger Lebenswandel – aber das
Briefe an «natürlich»
Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik sind willkommen. Die Leserbriefe müssen mit der vollständigen Adresse versehen sein. Die Redaktion behält sich vor, Briefe zu kürzen. Schicken Sie Ihren Brief per E-Mail, Post oder Fax an: leserbriefe@natuerlich-online.ch oder: «natürlich», Leserbriefe, Neumattstr. 1, 5001 Aarau, Fax 058 200 56 51
ist nicht so cool heute, wo Fun und Sex wichtiger sind. Dann gibt es auch Anleitungen aus dem Ayurveda, also weit über tausend Jahre altes Wissen, sogenannte Energiemedizin – das wird aber heute meist als Hokuspokus abgetan. Die Menschheit wird auch diese Pandemie überleben, aber vielleicht müssen wir einige lieb gewordene Gewohnheiten überdenken. Zum Beispiel die vielen, ausgelassenen Feste mit exzessivem Drogen- und Alkoholkonsum, das Rauchen, der zunehmende Stress und die aus den USA importieren Essgewohnheiten mit viel Fast Food und Fett. Eines bin ich mir sicher: Die momentane Situation mit Abstand, Desinfektion und möglichst wenig Kontakten entspricht dem Menschen nicht. Der Mensch ist ein soziales Wesen! Menschlicher Kontakt ist lebenswichtig; Säuglinge können sterben, wenn ihnen dieser fehlt. Bei Erwachsenen tritt dieses Schicksal nicht sofort ein, aber auch sie leiden unter der Isolation. Hanspeter Jörg, Frauenfeld
Corona: 1716
«natürlich» 09-20
Endlich einmal in den Medien eine kurze und ehrliche Zusammenstellung der tiefen Zahlen zu Corona! Der Bundesrat kann uns vor dem Sterben nicht schützen – das Leben endet mit dem Tod. Unser Sterben ist mit der Geburt besiegelt.
Marcel und Susi Aregger, Rheinau
Corona: Editorial
«natürlich» 09-20
Soeben habe ich Ihr Editorial gelesen. Betreffend der Corona-Pandemie schreiben Sie: «Sie ärgert mich täglich, weil sie mit uns Menschen etwas macht, das weit über die von ihr verursachte Krankheit hinausgeht (...).» Sie sprechen mir damit von der Seele. Bitte, wenn Sie in irgendeiner Weise Einfluss haben und helfen können, diesen Irrsinn zu stoppen, tun Sie es. Besten Dank für Ihre vernünftige Sichtweise und Ihr Engagement in dieser Hinsicht.
Erika Ohl-Spielmann, per E-Mail
Heftbeilagen
«natürlich» 09-20
M uss denn die Reklame immer über einen Artikel eingeklebt sein, wo sie womöglich beim Herausnehmen ein Loch reisst? Gopfertori!
Bernadette Bissig, Flüelen
Ich bin seit mehr als 20 Jahren Abonnement des «natürlich». Ich ärgere mich zusehends an den immer häufiger eingeklebten Werbebroschüren. Reisse ich sie raus, kann ich die Artikel nicht mehr lesen wegen herausgerissener Zeilen.
Sehr mühsam. Ich zahle einen Abopreis, um Ihr Heft zu lesen und nicht unnütze Werbung zu konsumieren. Ich überlege mir, das Abo zu kündigen.
Michael Estermann, Beromünster
Antwort
Liebe Leserin, lieber Leser
Z u Recht haben sich viele von Ihnen in den letzten Monaten über beigeklebte Broschüren im «natürlich» geärgert. In vielen Fällen war die Leimspur zu lang und zu dick, sodass sich die Prospekte kaum, ohne Schaden zu hinterlassen, aus dem Magazin entfernen liessen. Dafür entschuldigen wir uns.
Da das «natürlich » auch künftig zu einem guten Teil von Werbung lebt, werden wir immer wieder einzelne Broschüren auf Wunsch der Kundschaft einkleben müssen. Damit sich diese aber besser aus dem Heft lösen lassen, haben wir mit der Druckerei vereinbart, dass die dafür benötigte Leimspur deutlich kürzer und auch weniger dick aufgetragen wird. Mit etwas Feingefühl und Geduld sollten sich die Broschüren ab sofort also entfernen lassen, ohne gleich ganze Seiten zu zerreissen.
Wir vom «natürlich» hätten – wie viele von Ihnen – am liebsten ein völlig werbefreies Magazin. Leider ist das nicht möglich, denn ein grosser Teil unserer Einnahmen, ohne die wir weder den Druck unseres Heftes noch die Löhne für alle Beteiligten zahlen könnten, kommt aus der Werbung. Wir sind uns dessen bewusst und halten trotzdem an unserer Haltung fest: Werbung muss sein – aber unsere redaktionelle Unabhängigkeit ist nicht käuflich!
Den Ärger mit den eingeklebten Broschüren können wir Ihnen in Zukunft also nicht ganz ersparen. Wir von der Redaktion «natürlich» bitten Sie deshalb um Verständnis. Markus Kellenberger
Lösung des Rätsels aus dem Heft 10-2020
Gesucht war: Vogelkirsche


Jetzt ist es Zeit sich für die kalte Jahreszeit zu rüsten! zellavie.ch
Wettbewerbstalon
Vorname Name
Strasse PLZ / Ort
Lösung
Und so spielen Sie mit:
Senden Sie den Talon mit der Lösung und Ihrer Adresse an: CH Regionalmedien AG, «natürlich», Neumattstrasse 1, 5001 Aarau. Schneller gehts via Internet: www.natuerlich-online.ch/raetsel
Teilnahmebedingungen:
Einsendeschluss ist der 20. November 2020. Die Gewinner werden direkt benachrichtigt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Über diese Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Gewinnen Sie!

2 x Zellavie Wintersonne im Gesamtwert von Fr. 83.–.
Bewusst gesund leben
40. Jahrgang 2020, ISSN 2234-9103
Erscheint 10-mal jährlich
Druckauflage: 22 000 Exemplare
Verbreitete Auflage: 14 820 Exemplare (WEMF/KS beglaubigt 2020)
Leserschaft: 92 000 (MACH Basic 2020-2)
Kontakt: Alle Mitarbeiter erreichen Sie unter vorname.name@chmedia.ch www.natuerlich-online.ch
Herausgeber und Verlag
CH Regionalmedien AG, Neumattstrasse 1 CH-5001 Aarau
Tel. +41 58 200 58 58, Fax +41 58 200 56 61
Geschäftsführer Publishing Roland Kühne
Geschäftsführer Fachmedien
Thomas Walliser
Verlagsleitung
Michael Sprecher
Redaktionsadresse «natürlich»
Postfach, CH-5001 Aarau
Tel. +41 58 200 56 50, Fax +41 58 200 56 44
Chefredaktor
Markus Kellenberger
Redaktionsteam
Andreas Krebs, Sabine Hurni (Leserberatung)
Autoren
Angela Bernetta, Leila Dregger, Tobias Karcher, Stella Cornelius Koch, Eva Rosenfelder, Lioba Schneemann, Catherine Stalder, Frances Vetter, Andreas Walker, Steven Wolf, Ümit Yoker, Irène Elder Zumsteg
Grafik/Layout
Joel Habermacher, Levin Röthlisberger Fredi Frank
Copyright Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung durch den Verlag. Für unverlangte Einsendungen wird jegliche Haftung abgelehnt.
Anzeigenleitung
Dino Coluccia, Tel. +41 58 200 56 52
Anzeigenadministration
Corinne Dätwiler, Tel. +41 58 200 56 16
Leitung Werbemarkt
Jean-Orphée Reuter, Tel. +41 58 200 54 46
Leitung Marketing
Mylena Wiser, Tel. +41 58 200 56 02
Mediadaten unter www.natuerlich-online.ch/werbung
Aboverwaltung
abo@natuerlich-online.ch
Tel. +41 58 200 55 62
Druck
Vogt-Schild Druck AG, CH-4552 Derendingen
Ein Produkt der CH Media AG
CEO: Axel Wüstmann www.chmedia.ch
Abonnieren und bewusst gesund leben
Einzelverkaufspreis Fr. 9.80
Abonnement 1 Jahr Fr. 86.–
Abonnement 2 Jahre Fr. 150.–
Preise inkl. MwSt.


Psychische Erkrankungen sind zu einer Art Volksseuche geworden. Die Coronakrise befeuert diese Entwicklung. Was tun ?
Covid-19. Was wir wissen und was nicht, nüchtern betrachtet. Oligotherapie. Wie kleinste Mengen von Spurenelementen dem Körper helfen, gestörte Stoffwechselfunktionen wieder zu normalisieren. Zitrusfrüchte.
Wie die Exoten unser Immunsystem stärken und was es beim Kauf und bei der Verarbeitung zu beachten gilt. Datteln. Das «Brot der Wüste» verleiht verschiedensten, auch deftigen Speisen eine natürliche Süsse und gilt als gesunder Snack. Doch kann das sein bei dem hohen Zuckeranteil ?
Magische Weihnachten. Die Heilkraft uralter Mythen und Bräuche. Wirtschaftswachstum. Weiter bis zum Kollaps oder gibt es praktikable Alternativen ?




www.natuerlich-online.ch/abo-service
«natürlich» 12-20 erscheint am 26. November 2020
Kontakt /Aboservice: Telefon 058 200 55 62 oder abo@natuerlich-online.ch, www.natuerlich-online.ch

Frank Brunke
Ausser Glücklichsein gibt es ja nichts . . .
Über ein Jahrzehnt ist es her, seit Frank Brunke konfrontiert wurde mit der Diagnose «Hirntumor». Orangengross war das Gewächs, das sein ganzes Leben durcheinanderwarf. Der Naturgärtner und Pflanzenfotograf, der stets Beschäftigte, der unersättlich Interessierte, nie Ruhende –plötzlich stillgelegt in seinem Tun.
Hatte er sich vorerst noch geweigert, sich den Chirurgen anzuvertrauen, ganz auf die Naturheilkunst gesetzt, so liessen ihn zunehmende Schmerzen nach langem inneren Ringen nachgeben. «Der Tumor jedoch konnte lediglich verkleinert werden. Das Gehen wurde schwieriger», erinnert sich der Vater von vier Töchtern. Die geliebte Gartengestaltung musste er aufgeben. Wunderbare Gärten nach dem Abbild der Natur hatte er erschaffen.
Danach konzentriert er sich aufs Fotografieren, auf das «wahrhaftige Abbilden» der geliebten Pflanzen, auf das «Schauen» hinter die sichtbaren Erscheinungen – auf das «Wesenhafte». Ungezählte Stunden hat er in der Welt der Pflanzen verbracht, mit der Kamera wartend, bis sich ihm im Licht der Sonne und der feinen Bewegung einer Blüte oder eines Blattes das «Sein» dieser oder jener Art offenbarte. Mitgebracht von diesen Exkursionen hat er Bilder von berührender Schönheit. Doch auch hier bremste ihn das Schicksal: Der Krebs gab keine Ruhe.
Rund ein Dutzend chirurgischer Eingriffe an seinem Gehirn hat Frank Bruke hinter sich. «Während einer riskanten zehnstündigen OP hatte ich ein Nahtoderlebnis», berichtet er. «Es war das Liebevollste, was ich je erlebt habe: reine Liebe.» Seither sei die Schwelle zwischen hier und dort, zwischen Leben und Tod, durchlässig; er wandere zwischen
diesen Räumen hin und her. «Vor allem aber habe ich keine Furcht mehr vor dem Tod. Ich habe Vertrauen in diese reine Liebe. Und ich erwarte Heilung, weil ich weiss, dass sie da ist. Und wo Heilung ist, wirkt immer etwas Heiliges.»
«Der Tod, der ist einfach da», fährt er fort. «Ich sehe meine Aufgabe darin, mit ihm zu leben – ohne Furcht. Steht nicht hinter all unserem Handeln letztlich diese tiefe Angst vor dem Tod?» Heilung sei eine Entwicklung, die weit in die Zukunft reichen könne. «Wann sie eintritt, wissen wir nicht. Doch die Möglichkeit zur Heilung ist immer da. Erst, wenn wir uns der Angst stellen und der Liebe widmen, kann Heilung geschehen. Im Vertrauen in diese Liebe liegt das Heilige in uns. Hier können wir wirksam werden.»
Nicht nur sein Gehvermögen hat er ganz verloren, auch sein Sehfeld wurde immer mehr eingeschränkt. Die Schulmedizin hat ihn längst aufgegeben: «Ich bin ein ‹No-Man›», sagt er, «aber das ist mir egal. Auch ich habe die Schulmedizin aufgegeben.» Fast blind, komplett immobil, oft für Stunden allein im Bett hat sich sein Zeitempfinden komplett verändert: «Stunden sind längst keine Stunden mehr. Sie sind weite Räume, die keine Zeit beinhalten. Ich übe mich darin, nichts mehr zu müssen. Komplett frei zu sein.»
Mit seiner Familie lebt Frank Brunke abgelegen auf einem Allgäuer Hügel, dort, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen: «Das ist gut so», sagt er, obwohl sämtliche Pflegedienste den Ort nur reduziert anfahren. «Heilung, das kann nur innere Heilung sein», sinniert er: «Vielleicht halte ich noch zwei Jahre durch, vielleicht werde ich wieder ganz gesund. In mir ist dieser Glaube ans Heil sein; da ist eine unglaubliche Kraft.» Auch wenn in seinem Umfeld, ja, selbst in seiner Familie, der Glaube an die Krankheit grösser sei – «in mir ist ein Wille wirksam, der ganz woandershin deutet. Und da gehe ich lang, da suche ich».
Eine Begleiterin ist ihm dabei die Stinkende Nieswurz, ein Hahnenfussgewächs, das ihm als Knirps auf den Waldspaziergängen mit seiner geliebten Oma erstmals begegnet war: «Diese Verwandte der Christrose war die erste Pflanze in meinem Leben, die ich in ihren Eigenschaften unvermittelt ‹schaute›, ohne zu wissen. Ich empfand sie als sehr giftig. Erst viel später konnte ich diese Eindrücke bewusst nachvollziehen.» Es ist diese Pflanze, Helleborus foetidus, die er heute in homöopathischer Dosierung einnimmt: «Sie weckt in mir meine Urkraft. Ich fühle mich durch sie unglaublich bestärkt und vertraue ganz ihrer Kraft.»
Seine Krankheit sieht er als Läuterung. «Es gibt etwas, von dem ich zu viel habe, eine Unbelehrbarkeit gegenüber dem Göttlichen, Respektlosigkeit...» Die Krankheit schenke ihm Erkenntnis, sie sei eine Lehre – vielleicht bis hin zur Meisterschaft. Doch dazu gehöre auch, dass er bezahlen müsse: «Mit Lebensgefühlen. Ich muss für die Erkenntnis leiden, Opfer bringen. Doch ist es ein Opfer, das ich bewusst ins Leben bringen will. Vielleicht, um demütig zu werden.» //
● Eva Rosenfelder ist Autorin/ Journalistin BR und schreibt für verschiedene Schweizer Medien. In einer fortlaufenden Serie trifft sie für «natürlich» natur-heil-kundige Menschen.
Wasser machte mir Arbeit.
Mutter Bernardina Wasser machte mich krank.
Grossmutter Manuela

Trinkwasser sichern, Gesundheit fördern, Frauen stärken. So verändern Menschen mit Ihrer Unterstützung ihr Leben.
Sauberes Wasser ist Leben. Spenden Sie jetzt: helvetas.org
Unterstützt
Wasser macht mir keine Sorgen.
Tochter Janeth, 13, Bolivien
Partner für echte Veränderung