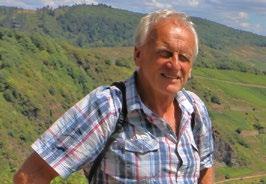natürlich Bewusst

Immunsystem
Warum nicht jede Impfung Sinn macht
Sanfte Kräfte
Wie Homöopathie, Spagyrik und Bachblüten wirken
Heilfasten
Mit der richtigen Methode zum Erfolg
Kinderschreck
Und plötzlich ist Spinat en vogue


Immunsystem
Warum nicht jede Impfung Sinn macht
Sanfte Kräfte
Wie Homöopathie, Spagyrik und Bachblüten wirken
Heilfasten
Mit der richtigen Methode zum Erfolg
Kinderschreck
Und plötzlich ist Spinat en vogue
Milzkraut
Schlüssel zum wahren Selbst

IN BADEN-RÜTIHOF
DO 26.–SA 28.03.20, 08.30–17.00 UHR
• MESSE-SONDERANGEBOTE
• SPANNENDE REISEPRÄSENTATIONEN
• WETTBEWERBE
GRATIS-BUS ZUM FERIENFEST
WWW.TWERENBOLD.CH
ê Schwimmendes Schweizer Grandhotel «Excellence Queen» ê Fahrspass mit E-Bike oder Tourenvelo
1. Tag: Schweiz – Würzburg Anreise nach Würzburg und geführter Stadtrundgang. Einschiffung.
2. Tag: Würzburg – Gemünden – Karlstadt Heute starten wir unsere erste Velofahrt flussabwärts entlang dem Main. Vorbei an der Mündung der fränkischen Saale geht es weiter, stetig von lieblichen Weinbergen begleitet, nach Gemünden. (Velostrecke ca. 45 km)
3. Tag: Wertheim – Freudenberg Entlang dem Main schlängelt sich unser Veloweg von der historischen Stadt Wertheim bis nach Freudenberg. (Velostrecke ca. 25 km)
4. Tag: Rüdesheim – Boppard – Koblenz Heute entdecken wir die landschaftlichen Höhepunkt dieser Reise – das romantische Mittelrhein-
tal. Wir fahren vorbei an malerischen Burgen und Weinorten und passieren die sagenumwobene Loreley. (Velostrecke gemütlich: ca. 45 km / vital: ca. 65 km)
5. Tag: Koblenz – Treis-Karden – Cochem Wir verlassen das Deutsche Eck und fahren durch das liebliche Moseltal. Wir radeln das letzte Stück auf dem Mosel-Radweg bis nach Cochem. (Velostrecke gemütlich: ca. 50 km / vital: ca. 70 km)
6. Tag: Zell an der Mosel – Bernkastel-Kues Kurze Busfahrt nach Zell an der Mosel und Etappenstart ins romantische Städtchen Traben-Trarbach. Unser Radtag endet in Bernkastel-Kues, einer malerischen alten Stadt. (Velostrecke ca. 40 km)
7. Tag: Trier – Schweiz
Nach dem Frühstück Ausschiffung in Trier. Auf einer Stadtbesichtigung erleben wir die über 2000-jährige Residenzstadt mehrerer römischer Kaiser. Danach Rückfahrt in die Schweiz.
Schiffsbeschrieb: www.twerenbold.ch/iafmose

Nicht inbegriffen: Annullationskosten- & Assistance-Versicherung. Auftragspauschale von CHF 20.– entfällt bei Online-Buchung.
*KATALOG-PREIS: Zuschlag 10% auf den Sofort-Preis, bei starker Nachfrage und 1 Monat vor Abreise.
VELO | SCHIFFSREISEN
7 Tage ab CHF 1990
REISEDATEN 2020
1: 02.06.–08.06. Di-Mo
2: 20.07.–26.07. Mo-So
3: 13.08.–19.08. Do-Mi
4: 06.09.–12.09. So-Sa
UNSERE LEISTUNGEN
● Fahrt im Komfortklasse-Bus mit Veloanhänger
● Flussreise in gebuchter Kabinenkategorie
● 6 x Vollpension an Bord z.T. Picknick-Lunch
● Velo- & Touristikausflüge gem. Programm
● Twerenbold Veloshirt
● Erfahrene Veloreiseleitung & Reisechauffeur
PRO PERSON IN CHF Katalogpreis* Sofortpreis 2-Bett-Kabine
Hauptdeck 2210 1990 Mitteldeck 2480 2230
Oberdeck 2700 2430 Zuschläge
2-Bett-Kabine zur Alleinbenutzung:
Hauptdeck / Mittel- & Oberdeck 0 / 795 Mietvelos inkl. Service & Reinigung:
– Tourenvelo / Elektrovelo 140 / 245
ABFAHRTSORTE
Abfahrtsorte mit Mietvelo Burgdorf p, Basel, Pratteln p, Aarau, Baden-Rütihof p, Zürich-Flughafen p, Wil p
Abfahrtsorte mit eigenem Velo Baden-Rütihof p, Zürich-Flughafen p, Wil p
Online buchen und CHF 20.– sparen. Buchungscode: iafmose

Liebe Leserin, lieber Leser
Stehen Sie Impfungen kritisch gegenüber? Gehören Sie zu jenen Menschen, die aus Sicht vieler Ärzte fahrlässig die Gesundheit anderer gefährden und die Ausrottung von Krankheiten wie beispielsweise den Masern verhindern ? Jedes Jahr flackern kleine Masernepidemien auf – und jedes Jahr ist es dasselbe: Impfgegner und Impfbefürworter schenken sich nichts.
Unser Redaktor Andreas Krebs, der sich in diesem «natürlich» ab Seite 10 mit dem Thema Impfen befasst, ist voll in diese Mühle geraten. Noch während er den Artikel schrieb, erkrankten seine beiden Kinder – es gibt manchmal seltsame Zufälle – an Masern. Wie er und seine Familie damit umgegangen sind, lesen Sie in seinem Bericht. Die Kinder sind übrigens wieder ganz gesund.
Unbestritten ist: Impfungen können Leben retten – sie können aber auch das Gegenteil bewirken: Impfungen können schwere gesundheitliche Folgeschäden auslösen. Zum Glück passiert das nur selten.
Unbestritten ist auch: An jeder Impfung und an jedem neuen Impfstoff verdienen Pharmaindustrie und Ärzte viel Geld – und mit jedem Coronavirus (darüber lesen Sie ab Seite 16) und jeder Grippewelle wird es noch mehr.
Herzlich, Ihr






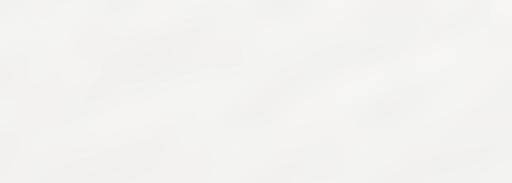

Kinder sind anders. Deshalb sind wir es auch. Kinder benötigen eine andere Betreuung, andere Therapien, Medikamente und Geräte als Erwachsene. Die Zusatzkosten dafür bleiben oft ungedeckt. Damit wir unseren jungen Patienten weiterhin eine bestmögliche Behandlung bieten können, braucht es Menschen wie Sie. Danke, dass Sie das Kinderspital Zürich heute mit einer Spende unterstützen. Spendenkonto 87-51900-2


gesund sein
10 Impf-Epidemie
Impfungen sind sicher, heisst es gebetsmühlenartig. Doch stimmt das wirklich?
16 Coronavirus
Was steckt hinter den Schreckensnachrichten?
18 Wahres Sein erlangen


gesund werden
38 Wolfs Heilpflanze
Das Milzkraut legt unsere verborgenen Fähigkeiten offen.
42 Homöopathie & Co.
Was unterscheidet Globuli von Bachblüten und spagyrischen Arzneien? Und wem hilft was?
46 Pollenalarm!
Wie Allergiker sich jetzt noch schützen können.
50 Heilpflanzensäfte
Kurze Übersicht der wichtigsten Frühjahrssäfte.




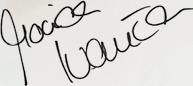




Auch Menschen, die nicht religiös-spirituell sind, können Erleuchtung erfahren.
22 Heilfasten
Nur gesund, wenn man es richtig macht.
26 Spinatvariationen
Popeye würde Augen machen.
32 Sabine Hurni über . . . starke Knochen.
34 Leserberatung
Von Glaukom bis Natron.
draussen sein
56 Remo Vetter
Endlich beginnt die Gartensaison. Was jetzt zu tun und was zu lassen ist.
60 Fit fürs Gärtnern
Die besten Dehnübungen, um Verletzungen und Schmerzen vorzubeugen.


Eine gesunde Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Getreide, Olivenöl, Nüssen und Fisch kann einen Hörverlust im Alter verhindern und das Fortschreiten von Schwerhörigkeit verzögern. Das berichten US-Forscher des Brigham and Women’s Hospitals. Über einen Zeitraum von drei Jahren untersuchten sie das Hörvermögen von 3000 Probandinnen. Ergebnis: Frauen, die sich gesund ernährten, hatten ein wesentlich geringeres Risiko für einen Rückgang des Hörvermögens in mitt leren und hohen Frequenzbereichen. Der Unterschied betrug bis zu 25 Prozent. krea gewusst

1,26
Statistik

Medikamentenkonsum deutlich gestiegen
Das Bundesamt für Statistik hat interessante Zahlen zum Thema Medikamentenkonsum veröffentlicht: 1992 haben 38 % der Bevölkerung ab 15 Jahren innert einer Woche mindestens ein Medikament eingenommen. 2017 waren es bereits 50 %. Dabei griffen Frauen (55 %) häufiger zum Blister als Männer (45 %). Schmerzmittel führten die Liste der eingenommenen Medikamente mit 24 % an – eine Verdoppelung zu 1992. Stark erhöht hat sich auch die Einnahme von Blutdruck und Cholesterinsenkern; im Jahr 2017 griffen 16 % der Bevölkerung darauf zurück. Bundesamt für Statistik
Dies zeigt eine Studie der Chinese Academy of Medical Sciences, für die die Forscher die Trinkgewohnheiten von 100 000 Menschen ausgewertet haben. Demnach kann mit einem gesünderen und längeren Leben rechnen, wer pro Woche mindestens drei Tassen Tee trinkt. Besonders gilt das für grünen Tee. Laut den Forschern senkt regelmässiges Teetrinken das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Todesfälle. Gewohnheitsmässige Teetrinker erkrankten im Mittel 1,41 Jahre später an einer koronaren Herzkrankheit und einem Schlaganfall. Ihre Lebenserwartung war zudem 1,26 Jahre höher als bei jenen, die selten oder gar keinen Tee tranken. aerztezeitung.de
Wer glaubt, keine Zeit für seine körperliche Ertüchtigung zu haben, wird früher oder später Zeit zum Kranksein haben müssen.
XChinesische Weisheit

Angststörung
Bei einer Angststörung ist eine vollständige Genesung möglich – selbst noch nach vielen Jahren. Eine wichtige Rolle spielt dabei soziale Unterstützung, denken Wissenschaftler der Universität Toronto. Sie hatten in einer landesweit repräsentativen Stichprobe 2128 Bewohner Kanadas untersucht, die irgendwann in ihrem Leben an einer generalisierten Angststörung gelitten hatten. Probanden mit mindestens einer Vertrauensperson berichteten dreimal häufiger über eine ausgezeichnete psychische Gesundheit als diejenigen ohne emotionale Unterstützung. Zudem hatten Teilnehmer mit religiösen oder spirituellen Überzeugungen eine um 36 Prozent höhere Heilungschance als diejenigen ohne Glauben. MM
Bluthochdruck
Ein Achtsamkeitstraining kann helfen, den Lebensstil zu verbessern und den Blutdruck zu senken. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie am Achtsamkeitszentrum der Brown’s School of Public Health. Die Forscher hatten für 43 Bluthochdruck-Patienten ein neunwöchiges, massgeschneidertes achtsamkeitsbasiertes Blutdrucksenkungsprogramm entwickelt. Dieses zielte darauf ab, die Aufmerksamkeitskontrolle, die Emotionsregulation und das Bewusstsein für gesunde Gewohnheiten zu erhöhen. Tatsächlich verbesserten sich nach dem Training die Selbstregulierungsfähigkeiten und Blutdruckwerte deutlich. MM

Ältere Menschen, die aufgrund eines diagnostizierten Hörverlusts ein Hörgerät erhalten, haben laut einer Studie der University of Michigan in den folgenden drei Jahren ein geringeres Risiko, erstmals an Demenz (–18 %), Depressionen oder Angststörungen (je 11 %) zu erkranken. Zusätzlich sinkt im Vergleich zu Menschen, bei denen der Hörverlust nicht behandelt wird, auch das Risiko von Verletzungen durch Stürze (–13 %). pd
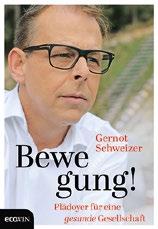
H● Gernot Schweizer «Bewegung ! Plädoyer für eine gesunde Gesellschaft»
Ecowin 2019 ca. Fr. 35.–
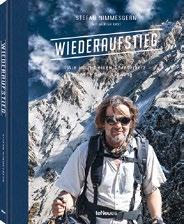
● Stefan Nimmesgern «Wiederaufstieg. Wie ich mit einem Spenderherz neue Gipfel bezwang» teNeues 2019 ca. Fr. 38.–
altungsschäden, Übergewicht, körperliche Probleme vieler Art und zahlreiche Krankheiten können auf eins zurückgeführt werden: Bewegungsmangel, der oft schon in der frühesten Kindheit beginnt und sich im Berufsleben noch akzentuiert. Mit verheerenden Folgen: Die Lebenserwartung der heutigen europäischen Gesellschaft sinkt erstmals, nachdem sie jahrzehntelang gestiegen ist. Ein patentes Rezept dagegen: ein aktives, bewegungsreiches Leben von klein auf bis ins hohe Alter. Gernot Schweizer, einer der wichtigsten europäischen Experten für Haltungsschäden, zeigt wie es geht – lustvoll und ohne es zu übertreiben (etwa beim Sport). Sein aufrüttelndes Buch ist vor allem auch ein flammendes Plädoyer dafür, (wieder) Eigenverantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Unbedingt lesens- und verschenkenswert. krea
So viele Abenteuer, solch fantastische Bilder – und diese Lebensgeschichte: ein wundervolles Buch, das Mut macht, auch nach schwerer Krankheit weiter seine Lebensziele zu ver
Der Fotograf und Bergsteiger Stefan Nimmesgern war Abenteurer durch und durch. Doch dann machte das Herz nicht mehr mit: starkes Vorhofflimmern, undichte Herzklappen, Herzinsuffizi enz. Er bekam ein Spenderherz – und mit ihm neuen Lebensmut. Schon zwei Jahre nach der Transplantation durch querte er das Dolgo-Gebiet in Nepal. Seither ist er immer wieder auf Expedi tionen in Afrika unterwegs und hat neben dem Kilimandscharo drei Fünf tausender bestiegen. Das Buch vereint eindrucksvolle Bergfotografien mit einer eindrucksvollen Lebens geschichte, die zeigt, was möglich ist, wenn man nur den Mut aufbringt, das Leben zu lieben und zu leben.

Lebensstil
Waldbaden gegen Krebs?
Intensive Waldspaziergänge erhöhen die Anzahl krebsbekämpfender Proteine im Körper. Der Effekt hält mehr als eine Woche nach dem Spaziergang an. Das haben japanische Wissenschaftler entdeckt. Sie schickten die Studienteilnehmer auf einen dreitägigen Waldurlaub und testeten täglich deren Blut. Schon am ersten Tag, nach einem zweistündigen Aufenthalt im Wald, hatte sich die Anzahl der «Killerzellen» um die Hälfte erhöht. Am zweiten Tag standen zwei ausgiebige Spaziergänge an, danach enthielt das Blut sogar noch mehr Killerzellen, darunter auch viele krebsbekämpfende Proteine. Sieben Tage nach diesem naturnahen

Schmerzmittel
Schmerzmittel wie Paracetamol gehören zu den meistverkauften Medikamenten. Die französische Heilmittelbehörde verlangt jetzt einen Warnhinweis auf den Verpackungen. Grund: Eine Überdosis kann zu lebensgefährlichen Leberschäden führen. Dasselbe kann Menschen passieren, die eine Allergie gegen Paracetamol haben. Der Wirkstoff ist u. a. enthalten in Acetalgin, Dafalgan und Panadol. Auch einige Grippemittel enthalten Paracetamol. Gesundheitstipp
Übergewicht
Nüsse essen lohnt sich

Nüsse haben viele Kalorien. Trotzdem sind sie gut für Menschen mit Übergewicht. Das zeigt eine Studie der Universität Harvard in Boston mit 145 000 Teilnehmern: Wer täglich eine Handvoll Nüsse ass, nahm weniger zu als jene, die auf Nüsse verzichteten – den ungesättigten Fettsäuren und vielen Ballast stoffen sei Dank. Am besten seien Pistazien, Hasel- und Baumnüsse. Eine Studie der Universität München zeigte zudem, dass eine Handvoll Baumnüsse pro Tag den Cholesterinspiegel senkt. Medical Tribune

App
Die Heilpflanzen spriessen wieder. Doch ist das nun ein blutreinigender Bärlauch oder ein giftiges Maiglöckchen? Oder gar eine Herbstzeitlose? Gift- oder Heilkraut – die einfach zu bedienende, lehrreiche App Flora incognita hilft bei der Bestimmung von Pflanzen. Zwei Fotos genügen – eines von der Blüte, eines von einem Blatt – und die App nennt den Namen. 4800 Pflanzen sind bereits erfasst. Für Android und iOS, gratis
Pharmagelder
Seit Anfang Jahr dürfen Ärzte sich nicht mehr von Pharmavertretern zu üppigen Essen einladen lassen. Auch teure Geschenke müssen sie ablehnen. Die neue Vorschrift im Heilmittelgesetz soll
verhindern, dass Pharmakonzerne Mediziner bei der Verschreibung von Medikamenten beeinflussen. Ob auch Ihr Arzt Geld von der Pharmaindustrie erhält, erfahren Sie auf www.pharmagelder.ch krea
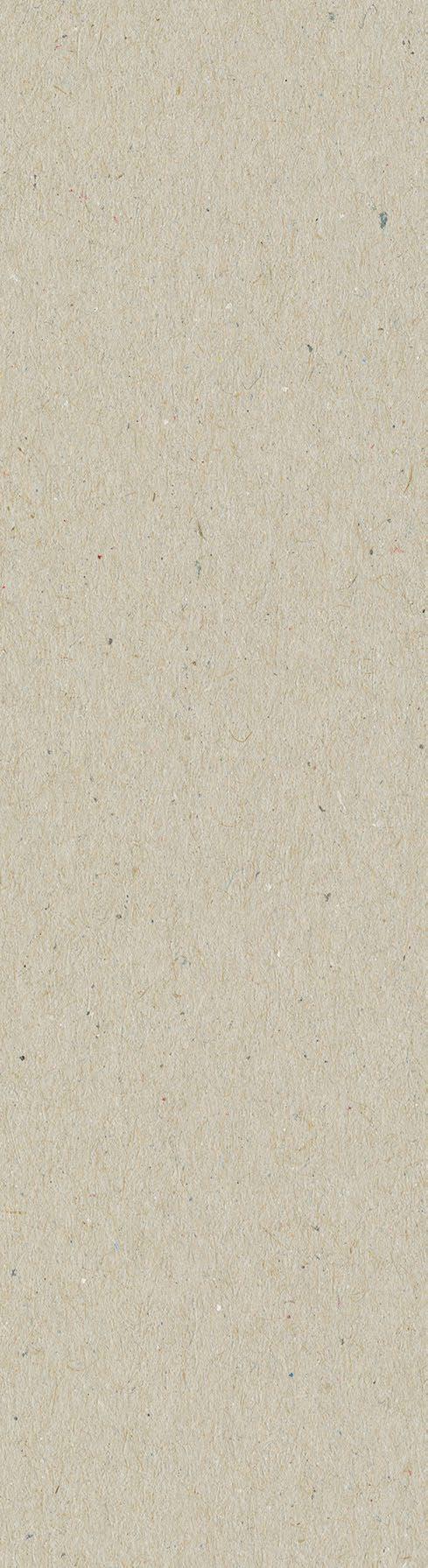

Mit Deutschland führt ein weiteres Land die Masernimpfpflicht ein. Und auch die Schweiz will die Masern dauerhaft ausrotten. Doch macht das Sinn? Und welchen Preis müssen wir für die ganze Impferei bezahlen?
Text: Andreas Krebs
Per 1. März gilt in Deutschland das «Masernschutzgesetz» (MSG). Kinder müssen nun zwangsgeimpft werden. Allerdings nicht nur gegen Masern, sondern gleich auch noch gegen Mumps und Röteln. Denn anders als in der Schweiz steht in Deutschland ein Monoimpfstoff nicht zur Verfügung. Das Gesetz auf den Weg gebracht hat Gesundheitsminister und Pharmalobbyist Jens Spahn (siehe www.lobbypedia.de). Dabei hat er glatt gelogen:
1. behauptet er, dass die Impfraten sinken. Dabei nehmen sie gerade bei der Masernimpfung seit Jahren zu, wie die Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigen. In 2017 haben bei der Einschulung 97,1 % der Kinder eine, und knapp 92,8 % zwei Masernimpfungen erhalten. Die WHO fordert eine Durchimpfung mit zwei Dosen von mindestens 95 %. Dies sei Voraussetzung für die Masernelimination.
2. behauptete Spahn, würden die Masernfälle zunehmen. Auch hier trifft das Gegenteil zu: in Deutschland – und auch in der Schweiz – nehmen die Masernfälle seit Jahrzehnten ab respektive halten sich auf tiefem Niveau. Korrekt ist, dass die Masernfallzahlen von Jahr zu Jahr beträchtlich schwanken können: Auf ein schwaches Jahr folgt in der Regel ein starkes Jahr und umgekehrt.
3. so Spahn, seien Masern sehr gefährlich. Richtig ist: Masernviren sind hoch ansteckend und die Erkrankung kann einen schweren oder gar tödlichen Verlauf nehmen. Doch das ist in Mitteleuropa äusserst selten. In der Schweiz etwa sind seit 1997 elf Menschen infolge einer Masernerkrankung gestorben; davon vier Kinder und ein Jugendlicher. Von den Erwachsenen war mindestens einer gegen Masern geimpft und einer (70) litt an Krebs. Bei uns stirbt also etwa alle zwei Jahre ein Mensch infolge einer Masernerkrankung – etwa gleich viele wie durch Blitzschlag. Nun kann man Tote nicht gegeneinander
Masernimpfungen enthalten abgeschwächte Lebendviren. Diese lösen eine abgeschwächte Immunreaktion aus. Rund 85 % sind nach einer Impfung immun; mit zwei Impfdosen kann man die Quote je nach Impfstoff und Zeitpunkt der Verabreichung auf rund 98 % steigern. Die sogenannten Impfversager (!) können trotz Impfung erkranken und andere mit dem Virus anstecken. Es ist also fraglich, ob man mit Impfkampagnen die Masern ausrotten kann.
abwägen. Man muss Zahlen aber einordnen können: Verkehrsunfälle fordern 400 Opfer pro Jahr; an vermeidbaren (!) Behandlungsfehlern sterben in Schweizer Spitälern jedes Jahr etwa 2500 Menschen.
Schweiz hat Masern « im Griff » Wie Deutschland will auch die Schweiz die Masern dauerhaft eliminieren. Dieses Ziel hätte zunächst bis ins Jahr 2000, dann per Ende 2015 erreicht sein sollen. Doch es gibt immer wieder Ausbrüche. Meist nur kleine: schweizweit wurden 2018 49 Masernfälle gemeldet, letztes Jahr 223. «Wir haben die Masern im Griff», sagt Mark Witschi, Leiter Sektion Impfempfehlung und Bekämpfungsmassnahmen beim Bundesamt für Gesundheit (BAG). Bei den Kindern sei die angestrebte Durchimpfung praktisch erreicht. Mindestens 95 Prozent aller nach 1963 Geborenen sollen zweimal gegen Masern geimpft sein, so der Bund, der sich auf die Empfehlung der WHO beruft. Bei den Älteren geht man davon aus, dass sie die Masern durchgemacht haben und deshalb immun sind.
«Das Problem sind die jungen Erwachsenen», sagt Witschi. «Viele wissen gar nicht, dass sie nicht immun sind.» Von ihnen gehe eine erhebliche Gefahr aus: Sie können Menschen anstecken, die sich nicht impfen lassen können, etwa Schwangere und Säuglinge. Und für die seien Masern besonders gefährlich. Überhaupt seien Masern alles andere als harmlos, betont Witschi. Die Impfung hingegen sei sicher: «In der Schweiz liegen nach Jahrzehnten der Masern- und MMR-Impfung keine Todesfälle aufgrund der Impfung vor.» Auch schwere Nebenwirkungen seien höchst selten. «Es gibt etwa eine Meldung pro Jahr.»
Das könnte auch am System liegen. Denn im Bundesland Baden-Württemberg (11 Mio. Einwohner) zum Beispiel werden jedes Jahr 20 bis 50 neue Anträge auf Anerkennung eines Impfschadens gestellt. 463 Fälle

« Eine Impfpflicht könnte auch den Eindruck erwecken, dass die sachlichen Argumente doch nicht so gut sind. »
Prof. Lothar H. Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts

«Viren sind nicht nur Feinde, sondern können auch Freunde sein», sagt der Tübinger Onkologe Ulrich Lauer. «Onkolytische Viren wie Masernimpfviren können sogar Tumorzellen direkt zerstören.» Das Phänomen hat man auch bei Wildmasern beobachtet. Lauer zählt zu den Pionieren der Virotherapie und hat zusammen mit Wissenschaftlern des Max Planck Instituts für Biochemie ein Viro
therapeutikum auf Grundlage von Masernimpfviren entwickelt. In der zweiten Jahreshälfte wird es erstmals an Krebspatienten getestet. Mit den Resultaten dieser Prüfung ist in zwei Jahren zu rechnen. Lauer erhofft sich durch die Virotherapie über die direkte Tumorzell Zerstörung hinaus auch eine dauerhafte Aktivierung des Immunsystems gegen die zu bekämpfenden Tumorzellen.
wurden bisher anerkannt. Die Geschädigten haben 2018 gut 17,1 Millionen Euro Entschädigung erhalten. Es gibt sie eben doch, die Impfnebenwirkungen –bis hin zum Tod: Beim deutschen Paul-Ehrlich-Institut (PEI) wurden seit dem Jahr 2000 alleine nach Masernimpfung 55 dauerhafte Schäden und 32 Todesfälle registriert. Dabei beträgt die Dunkelziffer bei diesen Meldungen laut der Fachzeitschrift Bundesgesundheitsblatt mindestens 95 Prozent ! Es könne deshalb «keine Aussage über die Häufigkeit bestimmter unerwünschter Reaktionen gemacht werden». Kritiker vermuten, dass man zum «Schutz des Impfgedankens» Nebenwirkungen nicht anerkennen will. Zum Vergleich: Seit Beginn der Meldepflicht 2001 bis 2018 wurden in Deutschland acht Todesfälle aufgrund von Masern registriert. Allerdings wurden auch sehr viel mehr Menschen geimpft als masernkrank.
Trotzdem: Die Sicherheit der MMR-Impfstoffe ist nicht gewährleistet. Zu diesem Schluss kommt auch das unabhängige Netzwerk Cochrane in der bis heute umfangreichsten Übersichtsarbeit.
Aber bestimmt sind die Masern viel gefährlicher; Impfungen das kleinere Übel. Oder? Wie gesagt, Masern können tödlich sein: Weltweit sind 2018 etwa 140 000 Menschen an den Folgen einer Maserninfektion gestorben; fast die Hälfte davon in den vier afrikanischen Staaten Kongo, Liberia, Madagaskar und Somalia. Schwere Masernverläufe scheinen mit Krieg, schlechter Hygiene (Wasser!) sowie Unter- und Mangelernährung zusammenzuhängen; insbesondere ein Vitamin-A-Mangel gilt als problematisch. Die WHO
●
Buchtipps, Links und weitere Infos rund ums Thema Impfen: www.natuerlich-online.ch
propagiert deshalb seit Jahrzehnten die hochdosierte Gabe von Vitamin A, um schwere Masernverläufe zu verhindern. Auch Vitamin C unterstützt, wie bei allen Infektionskrankheiten, den Heilungsprozess. Fiebersenker, Hustenblocker, Antibiotika und andere Medikamente, die das Immunsystem belasten, erhöhen hingegen das Risiko für Komplikationen.
Diese «häufigen und teilweise lebensbedrohlichen Komplikationen» infolge der Masern werden uns medial ständig um die Ohren gehauen. Dabei ist das Risiko überschaubar: Laut BAG kommt es bei 1,9 Prozent der Fälle zu einer Lungen- und bei 1,6 Prozent zu einer Mittelohrenentzündung. Beide Leiden heilen bei uns in aller Regel folgenlos aus. Wie die Masern selbst. Meist tödlich ist hingegen die subakut sklerosierende Panenzephalitis (SSPE). Sie tritt im Durchschnitt sieben Jahre nach einer Masernerkrankung auf und betrifft vor allem Menschen, die als Säugling daran erkrankt sind – und zwar etwa 1 von 1000 bis 3300. In der Schweiz wären das etwa alle 20 Jahre ein Fall.
Das Milieu
Soll ich mein Kind nun impfen oder nicht? Würden nicht nur die Masern, sondern auch Pest und Cholera wieder wüten, wenn wir aufhörten mit dem Impfen? Wohl kaum. Denn die Rückgänge der Krankheitsfälle und Sterberaten gehen nicht auf die Impfkampagnen zurück. Das zeigt sich bei den Masern sehr deutlich. 1900 forderten sie im Deutschen Reich 13 000 Todesopfer. 1963, in der BRD, noch 140. Das war vor Einführung der allerersten Masernimpfung. 1980, als die grossen Impfkampagnen lanciert wurden, starben in Deutschland sechs Menschen am Masernvirus. Es ist offensichtlich: Nicht die Impfung, sondern die verbesserten Lebensumstände sind für die geringe Sterberate verantwortlich. Dadurch wurden die einst lebensbedrohlichen Masern zu einer vergleichsweise harmlosen Krankheit. «Ein Phänomen», sagt der deutsche Arzt und Impfkritiker Gerhard Buchwald, «das auch auf viele andere Infektionskrankheiten zutrifft».
Tatsächlich: Die meisten Krankheiten, gegen die wir heute impfen, spielen bei uns keine Rolle mehr. Trotzdem wird kräftig die Werbetrommel gerührt. Und die Impfempfehlungen respektive im Falle Deutschlands Gesetze spülen Millionen in die Pharmakassen.
Dabei sind die Masern für uns ja offensichtlich gar nicht so gefährlich. Doch wie sieht es mit den Impfstoffen aus? Die Zulassungshürden sind deutlich niedriger als für andere Arzneimittel. Das macht schon mal stutzig. Wobei man so einen Impfstoff natürlich schnell auf den Markt bringen muss – bevor die
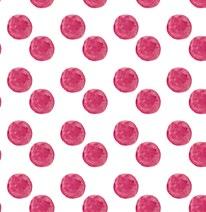
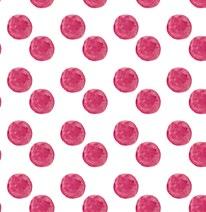
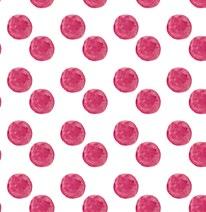



CHARAKTERISTISCH | Sobald der typische Masernausschlag kräftig erscheint, nimmt das Komplikationsrisiko ab.
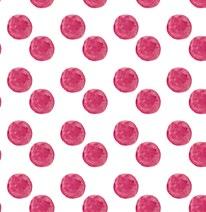
Auch wenn Masern selten geworden sind und oft als gefährlich dargestellt werden – wenn das eigene Kind an Masern erkrankt, ist das kein Grund zur Panik. „natürlich“-Redaktor Andreas Krebs weiss das aus eigener Erfahrung.
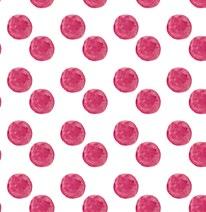
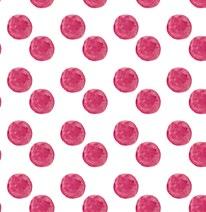
E s begann Ende Januar mit typischen Erkältungssymptomen: gerötete Augen, Schnupfnase, Husten; nichts Wildes. Nach ein paar Tagen kam hohes Fieber dazu. Am Tag darauf brachen die typischen Masernflecken aus; zuerst am Kopf, dann breiteten sie sich wie ein fallendes Nachthemd über den ganzen Körper aus. Zuerst bei Jeremias (9). Am Sonntag früh. Bei Amira (11) war es am Sonntagabend so weit. Am Montag bestätigte unsere Kinderärztin den Verdacht: Masern. Sie rühmte den massiven Ausschlag – «wenn die Viren über die Haut ausgeschieden werden, befallen sie nicht die Hirnhäute» – und verschrieb uns Pulsatilla für den Ausschlag und Apis Belladonna gegen das Fieber und die Schwellungen. «Das beste Heilmittel», sagte sie, «sind die Eltern.»
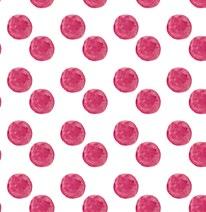
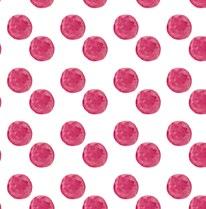
D ie sind gefordert. Sie müssen sich ein, zwei Wochen lang intensiv um die Kinder kümmern können. Dem Arbeitgeber sei Dank konnte ich in dieser Zeit zu Hause arbeiten. Es ist eine anspruchsvolle Zeit, in der die Eltern zusammenhalten und den Kindern Vertrauen vermitteln sollen. Dieses Vertrauen haben wir. Nach ausführlicher Recherche zu den Themen Masern und Impfen sowie einer Nutzen-Risiko-Abwägung basierend auf der Familienanamnese haben wir uns bewusst gegen das Impfen entschieden. Wir haben Vertrauen in das Leben und in die Selbstheilungskräfte unserer Kinder. Es gibt keinen Grund zur Panik: Masern sind bei ansonsten gesunden Kindern in aller Regel unproblematisch. Aber sie sind für die Kinder sehr anstrengend. Sie brauchen neben der Zuwendung sehr viel Ruhe.


A m Sonntag und Montag siechten Amira und Jeremias richtiggehend dahin; tagsüber auf dem Sofa, nachts im Bett. Sie waren extrem lichtempfindlich, assen kaum und tranken auch nur wenig. Sie husteten bellend und hatten Durchfall. Es ging ihnen richtig schlecht. Wir sassen bei ihnen, lasen Märchen vor; sie schliefen oder hörten Hörbücher. Doch hauptsächlich kämpften sie gegen das Virus. Mit Fieber, jedoch nicht sehr hohem. Der Schlaf war unruhig. Dann waren sie wieder wach und lagen still da. Im Banne der Krankheit. Es war eindrücklich und bereichernd, sie dabei zu beobachten und bestmöglich zu unterstützen. Jeremias nahm das Leid ohne Klage hin, so wie es auch die Mama hinnehmen würde. Amira hingegen, ganz der Papa, jammerte und wimmerte: «Warum gerade ich? Ojeoje, ich Ärmste!» Aber beide machten es gut. Beeindruckend gut. Und das sagten wir ihnen auch immer wieder. Noch ein, zwei Tage, sagten wir, dann habt ihr das Gröbste überstanden.



A m Dienstag ging es Jeremias schon etwas besser. Er sagte zwar immer noch nichts, und war tagsüber sichtlich mit dem Virus am Kämpfen, aber der Ausschlag klang schon ab. Als er dann gegen Abend auf einmal vor dem Kühlschrank stand, war klar: Der Bub hat das Schlimmste überstanden. Amira hingegen litt noch immer, konnte aber endlich wieder besser schlafen.
A m Mittwoch wachte Jeremias auf und lechzte nach einem Wassereis. Das gab es dann auch, und Salzstängeli und sogar etwas Reis assen beide. Jeremias fläzte zwar noch den ganzen Tag auf dem Sofa, war aber wieder deutlich munterer. Amira hingegen war immer noch lichtempfindlich und erschöpft. Doch als am Abend Jeremias von Schnitzel schwärmte, die er sich für den nächsten Tag wünschte, weckte das auch bei ihr den Appetit – oder die Sehnsucht: nach Spätzle mit Sauce.


A m Donnerstag waren unsere Kinder endgültig über dem Berg; und am Freitag auch nicht mehr ansteckend. Es braucht nach den Masern allerdings seine Zeit, bis die Abwehrkräfte wieder hochgefahren sind; vier bis sechs Wochen heisst es. Amira und Jeremias sind nun ein Leben lang immun gegen Masern. Das, bin ich überzeugt, ist der bessere und gesündere Schutz, als der durch die Impfung. Aber das muss jeder für sich abwägen.
Eltern sind in erster Linie für das körperliche und das seelische Wohl ihrer Kinder verantwortlich. Wer seine Kinder jedoch nicht impft, hat auch eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Wie viele andere Krankheiten können Masern insbesondere für Säuglinge und immungeschwächte Menschen gefährlich sein.
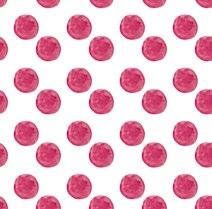
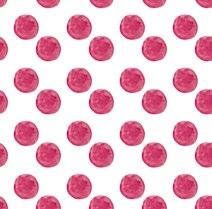
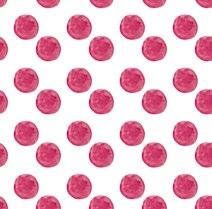
Bei einem Masernverdacht muss der Arzt deshalb vorab telefonisch informiert werden, damit er vorbeugende Massnahmen treffen kann.

Masernpatienten dürfen bis zum Abklingen des Ausschlages (drei bis vier Tage nach dessen Auftreten) nicht mit gefährdeten Menschen in Kontakt kommen.
Das Problem: Ansteckend sind die Masernkranken schon bis zu fünf Tage vor Ausbruch des Ausschlags. Wenn in der Umgebung Fälle bekannt sind, sind Grippesymptome und vor allem gerötete Augen ein früher Warnhinweis. Sie treten meist schon auf, bevor der Erkrankte ansteckend ist.

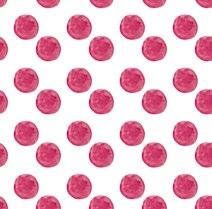
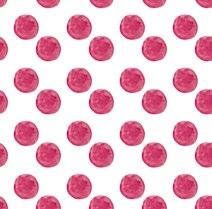

Impfungen schützen vor Krankheiten. Und schwere Nebenwirkungen sind zum Glück selten. Trotzdem sind Impfstoffe keineswegs risikolos. Das Risiko nimmt zu, wenn man innert kurzer Zeit mehrere Impfstoffe verabreicht. Was gerade bei Babys der Fall ist. Andererseits sind Babys durch gewisse Krankheiten auch besonders gefährdet. Was also tun ? Vor jeder Impfung sollte, basierend auf der Familienanamnese, eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung vorgenommen werden; idealerweise mit dem Hausarzt oder einem erfahrenen Homöopathen. Nicht geimpft werden darf, wenn dadurch gesundheitliche Schäden drohen, z. B. bei Gendefek-
ten, Immunschwäche, akuten Erkrankungen oder einer Allergie gegen einen Inhaltsstoff. Wird dann trotzdem geimpft, besteht die Gefahr eines lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schocks. Generell gilt: nur so viel wie unbedingt nötig und so spät wie möglich impfen. Idealerweise impft man sein Kind nicht schon im ersten Lebensjahr. Denn in diesem entwickeln sich Gehirn und Immunsystem prägend. Eltern nehmen durch den Verzicht auf empfohlene Impfungen das Risiko der Erkrankung für ihr Kind bewusst in Kauf. Wer sich dafür entscheidet, sollte sich nach einem Kinderarzt umsehen, der sie in dieser Haltung unterstützt.
Coronaepidemie schon vorbei ist . Langzeitstudien werden nicht gefordert. Der gängige vierfach Impfstoff (MMRV) Priorix-Tetra von GSK etwa wurde «an mehr als 4000 Kindern im Alter von 9 bis 27 Monaten» getestet. Die Ergebnisse wurden jedoch lediglich «bis zu 42 Tage nach der Impfung aktiv erfasst».
Als Probanden kommen übrigens nur gesunde Menschen ohne Allergien oder sonstige Beschwerden infrage. Das ist ein Selektionsbias, der schon öfters zu schweren Nebenwirkungen geführt haben dürfte – bis zum tödlichen anaphylaktischen Schock.
Doch zunächst ein anderer Schocker: Wer die Impfung überlebt, wird vielleicht unfruchtbar. Aber das ist Spekulation. Man weiss es nicht. In der ausführlichen Fachinformation heisst es kurz und knapp: «Reproduktionsstudien an Tieren wurden nicht durchgeführt. Es wurde nicht untersucht, ob der Impfstoff möglicherweise die Fertilität beeinträchtigt.» Auch wird bei Impfstoffen keine Angabe der Pharmakokinetik verlangt; d. h. es muss nicht untersucht
PRO & CONTRA
« Impfungen können Allergien und Autoimmunerkrankungen auslösen. »

werden, was der Körper mit dem Impfstoff tut – und wie er ihn wieder loswird. Das wäre aber gerade in Bezug auf das Aluminium interessant, das in vielen Impfstoffen enthalten ist. Darauf kommen wir zurück. Doch führen wir uns zuerst die Zutatenliste zu Gemüte. Allen Eltern, die vor der Impfentscheidung stehen, sei die Lektüre der Fachinformationen der Impfstoffhersteller ans Herz gelegt. Verlangen Sie beim Arzt eine Kopie davon. Und studieren Sie sie mit gesundem Menschenverstand und dem Baby im Arm.
Die meisten Impfstoffe für Menschen sind heute frei von Quecksilber. Masernimpfstoffe enthalten in der Regel auch kein Aluminium. Aber Zellen von Hühnerembryos und mensch lichen Lungen (andere Impfstoffe enthalten Affennieren, Pferdeserum und menschliche Föten!), zudem Spuren von Antibiotika und grosse Mengen Sorbitol. Dieser Süssstoff ist möglicherweise krebserregend. Das Zeugs spritzt der Arzt intramuskuläre oder tief subkutan in das Baby. Auch krebserregendes Formaldehyd, das in vielen Impfstoffen enthalten ist. Und Allergene wie Gelatine, Laktose oder Erdnussöl. Für Allergiker kann das tödlich sein. Und dann die berüchtigten Adjuvantien: Wirkstoffe zur Verstärkung der Immunreaktion. Viele Impfungen würden ohne sie gar nicht wirken! Früher hat man dafür meist Quecksilberverbindungen verwendet; heute vor allem Aluminiumverbindungen.
Da hat man wohl den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben. Denn selbst in kleinsten Mengen versetzt Aluminium das Immunsystem in einen extremen Alarmzustand. «Aluminium aus Impfstoffen kann bei vorbelasteten Menschen eine Kettenreaktion im Immunsystem auslösen, die zu einer Autoimmunerkrankung auswachsen kann», sagt einer der führenden Autoimmunologen, Yehuda Shoenfeld, Leiter des Zentrums für Autoimmunerkrankungen am Sheba Medical Center der Universität Tel Aviv. Er ist überzeugt: «Aluminium aus Impfstoffen kann Autoimmunerkrankungen triggern.»
Impfpflicht erfüllt – Kind tot Doch für wen sind Impfungen potenziell problematisch? Shoenfeld führt vier Gruppen von besonders gefährdeten Menschen auf:
1. Menschen, bei denen es bereits früher einmal zu einer Autoimmunreaktion nach einer Impfung gekommen ist.
2. Jeder, der unter einer Autoimmunerkrankung leidet beziehungsweise gelitten hat. Impfstoffe mit Lebendviren (z. B. MMR) sind für Betroffene wegen der Gefahr einer unkontrollierten Virenreplikation generell kontraindiziert.
3. Menschen mit bekannten allergischen Reaktionen auf einen Inhaltsstoff der Impfung. Auch wenn er nur in Spuren enthalten ist.
4. Menschen mit einer erhöhten Gefahr für eine Autoimmunreaktion, z. B. wenn in der Familie Autoimmunerkrankungen vorkommen. Aluminium ist neurotoxisch; es kann das Nervensystem schädigen. Wird das Leichtmetall oral aufgenommen, verbleibt höchstens ein Prozent im Organismus. Der Rest wird über den Magen-Darm-Trakt ausgeschieden. Trotzdem warnt das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung vor Alufolie (siehe S. 52)!
Laut dem Neuropathologen Romain Gherardi von der Universität Paris-Est kann «durch Impfungen appliziertes Aluminium länger als 15 Jahre im Körper bleiben. Und niemand weiss genau, was es dort anstellt. Man weiss nicht einmal, ob es überhaupt jemals ausgeschieden wird». Am meisten beunruhige die Beweglichkeit oder «Translokation» des Aluminiums im Körper. Experten sprechen von einer langsamen Wanderung in Organe wie Lunge und Gehirn. Dort könne Aluminium Entzündungen aktivieren und womöglich Alzheimer auslösen oder begünstigen. Trotz diesem schaurigen Verdacht wird fast jedem Bewohner unseres Planeten Aluminium injiziert.
Auch wenn es extrem selten passiert: Jeder Mensch kann mit einem anaphylaktischen Schock auf eine Impfung reagieren. So dürften die «versehentlichen Todesfälle» zustande kommen, von denen in den Fachinformationen der gängigen MMR-Impfstoffe
Früher waren Masern eine klassische Kinderkrankheit. Das hat sich im Zuge des Impfens geändert: Heute erkranken mehr Erwachsene als Kinder an Masern. Das ist wegen des höheren Komplikationsrisikos ungünstig. Besonders gefährdet sind Säuglinge. Das Risiko ist gestiegen. Denn anders als natürliche Masern bieten Impfungen keinen guten Nestschutz. Weil der Impftiter mit den Jahren nachlässt. Die USSeuchenbehörde vermutet, dass bis zur Hälfte der geimpften Erwachsenen nicht mehr immun ist.
gewarnt wird: «Versehentlich» war das Kind Allergiker und hätte nicht geimpft werden dürfen. Das Problem: eine Allergie oder eine Immunschwäche wird oft lange übersehen. Und anaphylaktische Reaktionen treten auch bei Menschen ohne bekannte Risikofaktoren auf. Mit den gegenwärtigen diagnostischen Methoden können sie nicht vorhergesagt werden.
Trotz all dem ist Shoenfeld, wie viele seiner Kollegen, nicht grundsätzlich gegen das Impfen. Er betont aber, dass man die potenziellen Vorteile gegen mögliche Gefahren abwägen muss.
Weniger impfen, mehr Gesundheit?
Folgt man dem offiziellen Schweizerischen Impfplan, werden dem Baby bis zu seinem ersten Geburtstag 17 Einzeldosen verimpft. 17! Zuweilen mehrere Impfstoffe aufs Mal – ein Minenfeld gefährlicher Interaktionen: Wechselwirkungen sind nicht erforscht. Der Feldversuch läuft. Seit drei Jahrzehnten. Seither nehmen die Allergien zu. Zufall? Es gibt plausible Gründe dafür wie dagegen; die Studienlage ist unklar. Bis zum zweiten Geburtstag sollen Kinder 26-mal (!) gegen acht Krankheiten geimpft worden sein. Das kann, sagen viele Kinderärzte, die Gesundheit gefährden und die seelische Reifung verhindern. Rudolf Steiner sprach sogar von «Seelenmord»: «Er (der Mensch) wird (durch die Impfung) konstitutionell materialistisch, er kann sich nicht mehr erheben zum Geistigen.» Das sei das Bedenkliche bei der Impfung. Es sei nicht sinnvoll, Kinder vor allen Krankheiten zu schützen, sagen Immunologen. Denn Infekte sind notwendig, damit sich ein stabiles Abwehrsystem aufbauen kann. Durch akute, entzündliche Erkrankungen wird das Immunsystem des Kindes gestärkt und Allergien oder Autoimmunerkrankungen treten später seltener auf; eventuell sinkt sogar das Krebsrisiko. Und häufig werden deutliche Entwicklungsschübe beobachtet.
Vielleicht sind die Masern ja so eine Art sinnvolle biologische Massnahme von Mutter Natur. Und wir pfuschen da mal wieder rein, in das perfekte Werk Gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht. //

GEHYPTE GEFAHR ? |
Die Sterberate des Coronavirus liegt bei nur etwa 2,5 %. Am 17.2. (11 Uhr) waren 71800 Ansteckungen gemeldet. 11 200 Menschen haben sich erholt. Verstorben sind 1775 fast ausnahmslos alte Menschen, davon zwei ausserhalb Chinas.

Die Schreckensmeldungen aus China reissen nicht ab: Bis Mitte Februar hat das Coronavirus im Reich der Mitte bereits über tausend Menschen getötet. Doch was ist schlimmer: das Virus oder die Angst davor?
Text: Peter Andres
A ngst und Schrecken verbreitet das Coronavirus. Jeden Tag bricht eine neue Hiobsbotschaft über uns herein. In China sollen schon weit über tausend Menschen gestorben sein, ganze Landstriche sind unter Quarantäne; zu uns ist das Virus auch schon gekommen, es droht eine neue Pandemie, also eine weltweite Epidemie! Schutz gibt es noch nicht, denn das Virus mutiert schnell und ist aggressiv. Weltweit befürchtet man eine Todeswelle, die jener der mittelalterlichen Pest gleichen könnte. Die Situation ist sehr ernst! So das offizielle Narrativ.
So ein Medienbericht erzeugt natürlich Angst, vielleicht sogar Panik. Denn so wie es aussieht, kann man der Bedrohung kaum entfliehen. Wohin mit der Angst? Beten? Hoffen? Ausharren, bis der lösende Impfstoff zugelassen ist?
A ngst hat sehr negative Auswirkungen, wenn sie zum ständigen Begleiter wird. Sie schliesst das Hirn kurz und schaltet es auf Überlebensmodus. Ältere Hirnteile
(z. B. Stammhirn) geben den Ton an und legen höhere Funktionen (z. B. die vordere Hirnrinde) lahm. Diese Dauerhemmung erzeugt chronischen Stress, der nicht nur ein selbstbestimmtes und glückliches Leben erschwert, sondern krank und depressiv macht.
Werfen wir einen Blick auf vergangene ähnliche Hysterien: Im Jahr 2002 drohte eine Epidemie durch das West-Nil-Virus; im Jahr darauf übernahm das SARSVirus die Rolle des Schreckgespenstes. 2005 bedrohte das Vogelgrippe-Virus die Menschheit. 2009 das SchweinegrippeVirus. 2014 kam Ebola, 2016 Zika. In keinem einzigen dieser Fälle traten die apokalyptischen Vorhersagen der Behörden ein, was nicht etwa daran lag, dass die Menschen sich impfen liessen. Haben wir einfach nur Glück gehabt?
Dass hinter jeder Virusbedrohung auch finanzielle Interessen stehen, dürfte auf der Hand liegen. Virenbedrohungen sind ein lukratives Geschäft. Wer sein Ge-
schäft versteht, kann Epidemien sogar vorhersagen. So haben Bill Gates und Verbündete letztes Jahr zu «Übungszwecken» ein Pandemie-Szenario simuliert.
Auslöser war ausgerechnet ein fiktives Coronavirus . Es wurde mit 33 bis 65 Millionen Toten weltweit gerechnet !
Übrigens: Zusammen mit seiner Frau hat der Multimilliardär die Bill & Melinda Gates Foundation gegründet, die sich weltweit an Impfkampagnen beteiligt –und auch daran verdient.
D ie Sache ist faul. Wie faul, zeigt ein Beispiel, das ich ausgerechnet aus einem «Angst-Buch» mit Erlaubnis des Autors leicht verändert wiedergebe (Rainer Schneider: «Wege aus der Angst»): «Laut WHO erkranken jährlich weltweit etwa eine Milliarde Menschen an Influenza, wovon 500 000 sterben. Damit stirbt jede Minute ein Mensch an der Grippe. Diese Sterberate nennt man Influenza-Grundrauschen und sie ist das zu erwartende (‹normale›) Mass erregerbedingter Erkrankungen. Im April 2009 berichteten 50 DPA-Meldungen über vierzig bestätigte Fälle einer äusserst aggressiven Schweinegrippe, die sich laut Vorhersagen unkontrolliert ausbreiten würde. Schon einen Tag später gab die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC Entwarnung. Die WHO sprach von einer Pandemie und erhöhte die Stufe von 4 auf 5, verzeichnete aber zeitgleich einen Rückgang der Fälle. Obwohl man weiterhin von einer Pandemie sprach, waren in den USA zu diesem Zeitpunkt lediglich 149 bestätigte Schweinegrippe-Fälle registriert, von denen einer tödlich verlief. Postwendend wurden 1,5 Millionen Dollar für die Produktion des berühmt-berüchtigten Impfstoffs Tamiflu® bereitgestellt, dessen Monopol beim Patentinhaber Roche lag. Obwohl immer mehr Tests eingesetzt wurden, sanken die Raten der Erkrankungen weiter. Dessen ungeachtet erhöhte die WHO die Pandemiestufe im Juni 2009 auf 6, verkündete aber gleichwohl, dass die Todesfolgen als sehr gering einzustufen wären. [ ] Während bei einem Influenza-Grundrauschen alleine pro Tag 2,7 Millionen Neuerkrankungen zu erwarten sind, belief sich diese Zahl bei der Schweinegrippe auf 500 pro Tag. Die ‹Pandemie› hingegen hielt nur ganze zwei Monate an, ohne dass dabei die Zahl der Erkrankungen durch die Behandlung mit dem Impfstoff sank, die Gensequenz des Virus sauber isoliert oder dessen Ansteckung eindeutig nachgewiesen worden wäre.»
Dieses Beispiel verdeutlicht, dass solche Virenmeldungen die Menschen zwar in Angst und Schrecken versetzen, die Viren selbst aber verhältnismässig keine wirklich ernst zu nehmende gesundheitliche Gefahr darstellten. Vielleicht hatte der amerikanische Komiker Bob Hope ja recht, als er sagte: «Virus ist ein lateinisches Wort, welches Ärzte verwenden, wenn sie sagen wollen: ‹Ich weiss es auch nicht›.» Ich möchte nicht zynisch oder herzlos erscheinen. Es werden Bilder von Menschen gezeigt, die aufgrund des Befalls mit dem Coronavirus wie Fliegen tot umfallen. Wenn das so ist, ist es eine Tragödie. Aber wem kann man nach all den beschriebenen Erfahrungen noch trauen? Und wie soll man nach all den Lügen, Übertreibungen und Falschmeldungen Ursache und Wirkung zusammenbringen? Im Sinne der eigenen Psychohygiene nehme ich solche Ungereimtheiten als Anlass zur Gelassenheit.
Denn eines darf man nicht unterschätzen: Informationen können sehr wirkmächtig sein. Sie schaffen Realität, wie sich z. B. an den beeindruckenden medizinischen Befunden zum Placebo- und Noceboeffekt zeigen lässt. Informationen können heilen oder krank machen!
E s gehört zum Naturell des Menschen, anderen mit scheinbar höherem Status und mehr Wissen einen Vertrauensvorschuss zu geben und deren Rat zu befolgen. Noch immer hat zum Beispiel das Fernsehen mit seinen Protagonisten einen grossen Stellenwert bei der Meinungsbildung. Selbst ein bewusster und aufgeklärter Mensch ist vor Manipulationen nicht gefeit. Medien nutzen ganz gezielt das sogenannte «predictive programming» (mehr oder weniger subtile Wiederholungen und versteckte Nachrichten), um uns in eine ganz bestimmte Erwartungshaltung zu bringen. In der Psychologie nennt man das Priming, was die Formung der Informationsverarbeitung durch bestimmte Auslösereize bedeutet. Kurz: Wer ständig Virus hört, denkt irgendwann Virus.
D ie meisten Menschen sorgen sich um ihre Gesundheit, um Frieden und Zukunft. Das macht sie empfänglich für angstauslösende Informationen. Auch bzw. weil Existenzangst rudimentär ist, sollte man genau prüfen, ob man selbst wirklich davon betroffen ist. Oder ob es bloss eingeredete, diffuse Ängste sind, die uns den Schlaf rauben.
Nomen est omen, heisst es ja so schön: Corona ist Lateinisch und heisst Krone oder Kranz. Die heilige Corona, eine Märtyrerin aus dem 2. Jh., ist Patronin der Schatzgräber und des Geldes. Das passt doch! Man muss die Existenz des Coronavirus gar nicht leugnen, um die offiziellen Darstellungen zu enttarnen und die potenziellen versteckten Agenden zu verstehen. Im Jahr 2014 haben Frankreich und China ein biotechnisches Forschungslabor für hochinfektiöse Viren in Wuhan errichtet. Genau dort hat die Epidemie ihren Anfang genommen. Wuhan ist auch die erste Provinz mit flächendeckender 5G-Abdeckung. Alles nur Zufall? Interessant ist auch, dass es Patente für Coronaviren gibt. Die wurden angemeldet, bevor das Virus nun ausbrach. Ein Impfstoff ist in China schon patentiert, bei uns hingegen noch nicht zugelassen. Nur: Impfstoffe erhöhen bestenfalls die Anzahl der Antikörper, was jedoch nicht mit einem Schutz gegen ein Virus gleichgesetzt werden darf. Und wenn wir schon beim Thema sind: Warum werden flüchtigen Viren so viel Bedeutung beigemessen, der erschreckenden Beweislage zu den verheerenden, definitiv pandemischen Effekten von 5 G und Elektrosmog hingegen nicht?
I n Zeiten der Unsicherheit und diffusen Virusangst hilft mir Humor, um die Dinge in die richtige Perspektive zu rücken. Ich zitiere mit Erlaubnis des Autors oben genannten Angst-Buches erneut einen Passus daraus, der die Thematik wunderbar aufs Korn nimmt:
«Vor einiger Zeit hatte ich zu diesem Thema eine amüsante Foto-Persiflage im Internet gefunden, die das Thema sehr treffend auf den Punkt brachte. Auf dem Boden lag, etwas melodramatisch dargestellt, der dahingeschiedene Frosch Kermit aus der Sesamstrasse. Darunter folgender Titel: Internationaler Schauspieler stirbt an Schweinegrippe und wir wissen alle, wer ihn angesteckt hat.» //
Der Autor
Peter Andres ist CEO von SwissMedtechSolutions AG in Winterthur sowie Gründer der AC Blue Planet GmbH in Konstanz.
Er arbeitet im Bereich Informationsmedizin und schreibt über verschiedene Themen im Gesundheitsbereich.
Mehr Infos unter www.vita-system8.de
Im Vokabular der Spiritualität nimmt der Begriff Erleuchtung einen prominenten Platz ein. Er steht für das Überwinden des Egos und eine Verschmelzung mit dem Göttlichen. Oft sind wir der Erleuchtung näher, als wir denken.
Text: Fabrice Müller Illustrationen: Lina Hodel
Kein Blitz. Kein helles Licht. Keine göttliche Erscheinung. Viele Menschen haben laut Hans-Walter Hoppensack, ehemaliger reformierter Pfarrer in Mollis (GL) und Zen-Lehrer am Lassalle-Haus in Edlibach (ZG), falsche Vorstellungen von der Erleuchtung. «Sie glauben, dass man wie aus dem heiteren Himmel erleuchtet wird und danach allwissend ist.» Doch dem sei nicht so. Vielmehr zeige sich die Erleuchtung als ein längerer Prozess mit diversen Erleuchtungserfahrungen im Leben eines Menschen – ein Prozess, der sich nur bedingt steuern lässt.
Bei Hans-Walter Hoppensack passierte es während einer Zen-Meditation. «Plötzlich erkennt man die Dinge, die uns umgeben und prägen, von einer anderen Seite. Mir wurde bewusst, wie alles zusammengehört, alles eins ist und aus der gleichen Quelle stammt. Das Eine begegnet sich selbst im Andern.» Der 63-jährige Schüler des Jesuiten und Zen-Meisters Niklaus Brantschen vom Lassalle-Haus interessierte sich schon seit Jahren für die mystische Gotteserfahrung. Weil die evangelisch-reformierte Kirche dazu keine Antworten geben konnte, entschied er sich, den Weg des Zen zu gehen und diesen zusammen mit dem christlichen Glauben zu leben.
Seit etwas mehr als 15 Jahren praktiziert Kelsang Chogdrub den buddhistischen Glauben. Seit zehn Jahren wirkt er als buddhistischer Mönch. Zuerst in Holland, wo der heute 38-Jährige aufgewachsen ist. Seit eineinhalb Jahren lebt er in der Schweiz und lehrt am Kadampa Meditationszentrum in Zürich. Im traditionellen orangen Gewand gekleidet, empfängt er uns im Meditationszentrum und führt uns in den grosszügigen Gebetsraum, wo täglich meditiert und gebetet wird; auch Vorträge über den Buddhismus und
die Erleuchtung werden hier gehalten. Auch Kelsang Chogdrub versteht diese als Prozess: als Entwicklung, die man als Mensch Schritt für Schritt geht – wie bei einer Bergwanderung, wo der Gipfel zunächst vielleicht noch unerreichbar weit entfernt scheint, mit jedem Schritt aber näher und näher kommt. «Ist man auf dem Weg zur Erleuchtung», sagt er, «fühlt es sich an wie eine Befreiung von inneren Zwängen, negativen Gedanken und Gefühlen.»
Pilgerfahrt des Ego-Bewusstseins
Es gibt verschiedene Definitionen und Erklärungsmodelle rund um das Phänomen der Erleuchtung. Die einen sehen darin einen Zustand der Seele, die mit der Erleuchtung nicht mehr von anderen Lebewesen wie auch vom Universum und der alles beinhaltenden Leere – dem Nirvana – als getrennt erfahren wird. Häufig wird dabei auch von der Verschmelzung mit der einen Wirklichkeit gesprochen, die keine Abgrenzung geschweige denn Isolierung mehr zulässt. Es ist ein Bewusstsein des All-Eins-Seins. Diese Erkenntnis der Einheit aller Dinge zieht sich wie ein roter Faden durch alle spirituellen und mystischen Lehren der Welt: Ein wesentliches Merkmal der Erleuchtung wird darin gesehen, dass man sich selbst in allen Dingen, und alle Dinge in sich selbst erkennt.
«Erleuchtung» kann auch verstanden werden als die Vervollkommnung des Menschen im Gottesbewusstsein. Somit erfüllt sich die Sehnsucht und Absicht unserer Seele, zu uns selbst heimzukehren. Auf der metaphorischen Ebene kann die Erleuchtung als letzter Schritt auf einer Pilgerfahrt des EgoBewusstseins bezeichnet werden. Sinn ist es, jeden Moment dieser Reise bis zum letzten Augenblick zu erfahren.
« Den Weg der Erleuchtung kennenlernen und meistern heisst, sein wahres Selbst kennenlernen und meistern. Sein wahres Selbst kennenlernen und meistern heisst, sich selbst vergessen. Sich selbst vergessen heisst, mit dem ganzen Universum eins sein. »
Dogen
Der buddhistische Mönch Kelsang Chogdrub sieht in der Erleuchtung eine Art Befreiung des Menschen von seinem Leiden, das sich in Form von negativen Mustern wie Ignoranz, Egoismus, Verblendung usw. manifestiere. Für Hans-Walter Hoppensack steht «Erleuchtung» für die Erkenntnis, dass auf der Ebene des Wesens «Niemand» da ist, wo wir «Jemanden» vermuten. «Man spricht in der Mystik in diesem Zusammenhang auch vom «Ich-Tod›», ergänzt der Theologe und Zen-Meister.
Der griechische Philosoph Platon beschäftigte sich in seinem sogenannten «siebten Brief» mit dem Begriff Erleuchtung. Erleuchtung entstehe, so Platon, indem man Benennungen, Wahrnehmungen, Erklärungen und Ansichten solange aneinander «reibe», bis Einsicht über das jeweilige Thema aufleuchte. Platon hat diesem Aufleuchten einen «feurigen» Charakter attestiert, bei dem die Seele erhellt werde. Mit dieser Erklärung hat der Schüler Sokrates die religiöse Basis für die Erleuchtung geschaffen.
Den Kopf knacken
Die Hirnforschung spricht bei «Erwachten» von einem Rückfall in eine frühe Stufe kindlicher Naivität. Er-
■ Atem begleiten (mit Zählen der Atemzüge bis 10).
■ Einfach nur still sitzen.
■ Sitzen mit dem Fokus auf der sinnlichen Wahrnehmung von dem, was jetzt ist.
■ Wahrnehmen, was ist, besonders im Moment der Atempause nach dem Ein- resp. Ausatmen.
■ Sitzen mit der Frage: «Wer bin ich in meiner unmittelbaren Erfahrung ?»
■ Sitzen mit der Frage: «Wer bin ich ohne meine Geschichte ?»
Quelle: Lassalle-Haus
● Links www.lassalle-haus.org www.kadampa.ch
● Buchtipps
Anssi
«Vom Ego zur Erleuchtung» Kamphausen 2019, ca. Fr. 24.–
Alberto Villoldo
«Das erleuchtete Gehirn: Mit Schamanismus und Neurowissenschaft das Geheimnis gesunder Zellen entdecken» Goldmann 2011, ca. Fr. 22.–
Ulrich Warnke
«Quantenphilosophie und Interwelt: Der Zugang zur verborgenen Essenz des menschlichen Wesens» Scorpio 2013, ca. Fr. 20.–
wachen gilt als Vorstufe der Erleuchtung. Die grossen indischen Yogis kennen bis zu sieben Stufen, die das Bewusstsein erklimmen kann. Beim Erwachen empfindet sich der oder die Erwachte als reines «Selbst», das zwar in einem physischen Körper lebt, sich jedoch nicht mehr mit diesem identifiziert; ebenso wenig mit dem Verstand oder den Gefühlen, ja nicht einmal mehr mit seinem Namen. In der Psychiatrie nennt man dieses Phänomen Cotard-Syndrom – eine psychische Erkrankung mit schizophrenen Wahnvorstellungen und affektiven Psychosen.
Der deutsch-kanadische Erwachte Eckhart Tolle beschreibt das wache Selbst als einen «Zustand innerer Weite». Diese Weite könne entstehen, wenn Emotionen und Gedankenmaschine still werden. Dann bestehe die Chance für das Selbst, als reines Bewusstsein zu erwachen. Man sei dann ganz in der Wahrnehmung, unabhängig von Gedanken und Emotionen. Dafür mit überwältigenden Gefühlen von Liebe, Freiheit und Entspannung. «Das Ich wird als Konstrukt erkannt», erklärt Hans-Walter Hoppensack. «An und für sich gibt es nur das Eine, Unendliche, Göttliche. Und man nimmt sich selber nicht mehr so wichtig.» Der Zen-Meister gibt jedoch zu bedenken, dass sich der Charakter eines Menschen trotz Erleuchtungserfahrung nicht unbedingt verändert.
Meditation
Viele Wege führen zur Erleuchtung. Diesen Eindruck hat man jedenfalls angesichts der unzähligen Ratgeber und Berichte zum Thema. Doch nach der Lektüre steht man oft mit mehr offenen Fragen als Antworten da. Auch mit Schweinebraten und Bier, ja mit einem gänzlich unspirituellen Lebenswandel bestehe durchaus die Möglichkeit, erleuchtet zu werden, meint zum Beispiel Tanja Braid in ihrem Blog «Was ist Erleuchtung».
Bekannt sind indes andere Geschichten. Die Bibel etwa berichtet von 40 Tagen, die Jesus in der Wüste verbrachte. Buddha lebte sechs Jahre lang in Askese; und dann wandte er sich der Meditation zu. Der Rückzug in die Einsamkeit, die Meditation und Stille und mitunter auch die Askese – sie gelten als Königsweg zur Erleuchtung. Das kommt nicht von ungefähr: In der Stille begegnet die Seele sich selbst; losgelöst von Gedanken und Einflüssen, die von aussen auf den Menschen einwirken. «Der Erleuchtung ist es egal, wie man sie erlangt», lautet ein Buchtitel. Hans-Walter Hoppensack stimmt dem grundsätzlich zwar zu. «Doch der Weg über die Spiritualität und die Meditation scheint mir ein zuverlässiger Weg zu sein.»
Auch für Kelsang Chogdrub ist die Meditation ein zentraler Akt, um seinen Geist zu schulen. «In der Meditation wird unser Geist mit den Tugenden vertraut, die uns der Erleuchtung näherbringen.» Erleuchtung gehe einher mit der Erlangung des inneren Friedens, betont er. Und dieser wiederum könne nur erreicht werden, wenn der Mensch bereit und motiviert sei, diesen Weg auf sich zu nehmen. «Oft suchen
wir die Quellen des Glücks im Aussen. Im Buddhismus sind wir überzeugt, dass wir diese Qualitäten nur in uns selbst finden», sagt der Mönch. Wichtig sei auch, nicht mit falschen Erwartungen in den spirituellen Prozess einzusteigen. Manche Menschen reagierten ungeduldig und enttäuscht, wenn sich eine Erleuchtungserfahrung nicht früh genug bemerkbar mache. Es brauche aber Geduld und Ausdauer.
Näher, als wir denken
«Mit jedem Schritt, den wir auf diesem Weg gehen, kommen wir dem Ziel näher. Doch wir müssen manchmal auch Rückschläge in Kauf nehmen», gibt Kelsang Chogdrub zu bedenken. Manche glaubten, eine Erleuchtungserfahrung sei für sie unerreichbar. «Dabei ist die Erleuchtung meist gar nicht so weit von uns entfernt, wie wir glauben. Durch das konstante Dranbleiben werden wir bei jedem Schritt aufs Neue erleuchtet. Zudem stellen wir fest, wie durch unsere Geduld und das Mitgefühl zu anderen Menschen die negativen Aspekte wie etwa Wut oder Eifersucht aus unserem Geist verschwinden.»
Alles nur ausgedacht? Matthias Pöhm, Rhetorikund Kommunikationstrainer sowie Autor des Buches «Erleuchtet aber keine Ahnung» äussert sich kritisch – manchmal auch ziemlich populistisch und reisserisch – über Menschen, die sich öffentlich als erleuchtet bezeichnen und eine Anhängerschaft um sich bilden. «Erleuchtete haben dieses eine Erlebnis gehabt, da sind sie echt, aber wenn man deren gepredigte Lehren auf die Waagschale der Substanz legt, dann erkennt man Glaube und nicht Wissen.» Erleuchtung allein führe nicht zur Brillanz, betont Pöhm. Oft würden von selbst ernannten Erleuchteten «Unfug» gelehrt, unanwendbare oder nebulöse Anweisungen verbreitet und Übungen gemacht, die nur Scheinerfolg bringen. Hinzu komme, dass bei den Anhängern von Erleuchteten, die sich prominent in der Öffentlichkeit zeigen, eine Überhöhung stattfinde. «Sie glauben, dass der Guru ein Sprachrohr Gottes ist. Diese Unfehlbarkeitsprojektion der Sucher fühlt sich für den Erleuchteten sagenhaft gut an.» Was sein Ego stärke – nicht gerade ein Zeichen der Erleuchtung. Ausserdem gebe es viele Menschen, die zwar in einem Moment Erleuchtung erleben, dann aber wieder in ihr altes, spaltendes Bewusstsein des Fremdwahrnehmungs-Ichs zurückfallen. «Problematisch wird es, wenn Erleuchtete das Lehren begonnen haben und mittendrin ihren Erleuchtungszustand verlieren. Die meisten halten ihre Schüler darüber im Unklaren und spielen weiter den Erleuchteten», schreibt Pöhm.
Hans-Walter Hoppensack kennt das: «Eine Erleuchtung birgt die Gefahr, grössenwahnsinnig zu werden und abzuheben. Dann wird es zu einer Ego-Geschichte, die nichts mehr mit dem Wesen der Erleuchtung zu tun hat», sagt er. «Echte Erleuchtete umgeben sich nicht mit einer Aura eines Gurus. Vielmehr zeichnen sie sich durch eine gewisse Bescheidenheit aus.» //
Im Christentum geht man laut den Schriften des numidischen Kirchenlehrers Augustinus von Hippo (354–430 n. Chr.) davon aus, dass der Mensch nur Wissen erlangen kann, weil Gott ihn erleuchtet. Ohne das Licht Gottes könne der Mensch nichts erkennen. In den katholischen Ostkirchen ist die individuelle Erleuchtung unter den orthodoxen Mönchen ein wichtiges Ziel. Im Neuen Testament werden dem Menschen mit der Erleuchtung Wahrheit, Erkenntnis und Wissen über Zukünftiges durch den Heiligen Geist eingehaucht. Zudem erinnere dieser den «erleuchteten» Menschen an alles, was Jesus gesagt und gelehrt habe. Der Zustand der Erleuchtung wird als Zustand des EinsSeins mit Gott verstanden. Die Taufe mit dem Wasser als geistige Geburt soll eine erstmalige kleine Erkenntnis des wahren Selbst symbolisieren.
■ Buddhismus
Im Buddhismus wird Erleuchtung als das innere Licht der Weisheit, das dauerhaft frei von allen fehlerhaften Erscheinungen ist. Das Licht hat die Aufgabe und Funktion, jedem einzelnen Lebewesen jeden Tag geistigen Frieden zu schenken. Erleuchtung wird erlangt, indem man alle groben wie subtilen Verblendungen (negative Geisteszustände wie Wut, Eifersucht, Unwissenheit) im eigenen Geist ausmerzt. Im Mahayana Buddhismus wird die Erleuchtung zur Befreiung aller Lebewesen angestrebt, im Hinayana Buddhismus für die eigene Befreiung.
■ Hinduismus
Im hinduistischen «Jnana Yoga» steht der Begriff «Jnana» für höheres Wissen. Dieses beinhaltet die endgültige Erkenntnis der Einheit zwischen Atman, der individuellen Seele, und Brahman, dem absoluten Bewusstsein, auch Weltseele genannt. Ziel ist die Erlösung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten. Im «Raja Yoga» wird die höchste Stufe «Samadhi» genannt: die völlige Ruhe des Geistes.
■ Islam
Als Vertreter der mystischen Strömung des Islams verfolgen die «Sufis» das oberste Ziel, Gott so nahe wie möglich zu kommen und dabei die eigenen Wünsche hinter sich zu lassen. Die Liebe sei es, die den Sufi zu Gott führt. Der Suchende strebt danach, bereits in diesem Leben die Wahrheit zu erfahren und nicht erst auf das Jenseits zu warten. Die Sufis versuchen, die Triebe der niederen Seele bzw. des tyrannischen Egos so zu bekämpfen, dass sie in positive Eigenschaften umgeformt werden. Auf diese Weise kann man einzelne Stationen durchlaufen; die höchste Stufe ist jene der «reinen Seele».
Quelle: www.deacademic.com

Heilfasten ist gesund und dient der spirituellen Entwicklung. Doch was passiert beim Fasten? Und was muss man beachten, damit der Essensverzicht nicht gefährlich wird? Denn dies sei einem bewusst: Ganz ohne ist Fasten nicht.
Text: Marion Kaden

ist ein uraltes Verfahren nicht nur zur spirituellen Entwicklung, sondern vor allem auch zur Gesundheitspflege. Forschungen der letzten zwanzig Jahre zeigen, warum Fasten funktioniert, was dabei passiert und wie die «richtige» Art des gesundheitspflegenden Fastens aussehen sollte. Am beeindruckendsten ist wohl die Einsicht, dass der «zeitlich begrenzte, freiwillige Nahrungsverzicht» der wohl wichtigste «Jungbrunnen» ist, der das Leben auf gesunde und natürliche Weise verlängern hilft. Menschen und viele Tiere können ohne Schaden kürzer oder länger ohne Nahrung auskommen, also fasten. Diese vererbte, natürliche Fähigkeit hat sich während der Evolution als Anpassung an Nahrungsmangel-Phasen entwickelt. Das «Fasten-Programm» wird aktiviert, wenn der Nachschub von Energie und Nährstoffen (Ausnahme Wasser) deutlich verringert ist. Diese Stoffwechsel-Umschaltung auf «Sparflamme» erfolgt ohne jede Gefahr für Leib, Leben oder Gesundheit. Im Gegenteil: Sind wir im Fastenmodus,
steigern sich viele unserer Fähigkeiten: Wir werden wacher, aufmerksamer, empfindsamer, leistungsoder ausdauerfähiger. Der biologische Sinn ist offensichtlich: Um Nahrungsmangel zu besiegen, müssen wir besser funktionieren als sonst. Andernfalls droht der Tod durch Verhungern.
Das Fett schmilzt Wie lange gesunde Erwachsene fasten, ist sehr unterschiedlich. Beim alleinigen heimischen Fasten dauert dieses etwa zwischen einem und sieben Tagen; bei ge übten Fastern länger. Beim Fasten unter ärztlicher Begleitung in einer Kureinrichtung kann es 7, 14, ja sogar bis zu 21 Tage dauern. Es gibt gut belegte Fallgeschichten, bei denen Menschen 40 Tage und länger gefastet und dies gesund überstanden haben. Aber Achtung: Solch extrem lange Fastenzeiten können gefährlich sein! Und: Menschen mit akuten und chronischen Erkrankungen sollten grundsätzlich nur ärztlich begleitet fasten!
Eine moderne, bedenkenlose Form des Fasten ist das Kurzzeitfasten, auch als Intervallfasten bekannt. Dabei wird ein- bis zweimal pro Woche für jeweils einen Tag gefastet –dies aber über Wochen und Monate, ja Jahre hinweg. Doch was passiert da mit uns, beim Fasten?
Normalerweise gewinnt unser Stoffwechsel seine lebensnotwendige Energie primär aus Glukose («Zucker», Kohlenhydrate). Beim Fasten versiegt diese Energiequelle und der Körper nutzt zunehmend die im Fettgewebe gespeicherte Energie. Dieser alternative Stoffwechselzustand wird «Ketose» genannt. Die Ketose beginnt beim gesunden Erwachsenen unter idealen Bedingungen etwa 16 Stunden nach Fastenbeginn. Ideal bedeutet, dass der Darm leer ist und keine Kohlenhydrate mehr liefern kann.
«Ich kann keinen einzigen Tag ohne Essen leben, mich quält sonst ein schrecklicher Hunger!» ist ein häufiger Einwand gegen das Fasten. Das, was da quält, ist jedoch kein Hunger. Den kennen wir in der westlichen Welt fast überhaupt nicht mehr. Was da quält, ist Appetit gepaart mit tiefsitzenden Essens-Gewohnheiten und Angst vor dem Unbekannten – nämlich der Freiheit, die uns das Fasten schenkt. Der Antirauchen-Papst Allen Carr sagte: «Die Sklaverei gegen diese Freiheit einzutauschen, ist ein so freudiges Gefühl, wie wenn Sie eine Welt voll schwarzer Schatten hinter sich lassen und in die Sonne hinaustreten.»

❞
Ziel des Heilfastens ist die körperliche, geistige und seelische Umstimmung des Menschen.
Beim Heilfasten wird dieser Zustand durch intensive Darmentleerung erreicht. Die Fastenlehrer der Neuzeit (u. a. Dr. Guillaume Guelpa und Dr. Otto Buchinger) haben dafür vor allem das Abführmittel Glaubersalz (Natriumsulfat, Karlsbader Salz) verwendet. Nach dem Trinken von ein bis zwei Litern einer wässrigen Glaubersalzlösung kommt es nach wenigen Stunden zu einer stark abführenden Wirkung, manchmal auch schneller. Dies wird beim Fasten in Kureinrichtungen oft noch durch Darmeinläufe, Bauchmassagen oder das Trinken kleiner Mengen Glaubersalzlösung während der Fastenkur ergänzt.
Abführen ist nicht zwingend nötig
Die alten Fastenärzte glaubten, dass die intensive Darmreinigung («Entschlackung») Ursache der Umschaltung auf Ketose sei. Das ist jedoch nicht richtig. Das kräftige Abführen beim Heilfasten ist nur dann wichtig, wenn zusätzlich zum Fasten auch Entgiftung oder Entschlackung des Organismus angestrebt wird. Die Umschaltung auf Ketose tritt ansonsten bereits nach eintä gigem Fasten auf, ganz ohne jedes künstliche Abführen. Das ist doch beruhigend. Denn diese moderne Einsicht bedeutet: Mit dem wohl wichtigsten bekannten Präventions- und Therapieverfahren überhaupt ist auch eine einfache und wirksam Selbstbehandlung zu Hause möglich.
Das stationäre Heilfasten hat aber selbstverständlich seine Berechtigung. Es gibt viele gute medizinische gesundheitliche Gründe, zur Kur zu gehen, alleine schon wegen all der anderen gesund-
heitsfördernden Massnahmen, die es dort gibt: das geistig-seelische Rahmenprogramm, der Gesundheitspflege-Kurs oder einfach wegen der Natur oder der sozialen Kontakte mit gesundheitsinteressierten Gleichgesinnten.
Doch auch das Fasten in heimischer Umgebung hat seine Vorteile: Es ist einfach umzusetzen und extrem kostengünstig; und es motiviert, gesunde Änderungen des Lebensstils umzusetzen (Ernährung, Schlafgewohnheiten, Sport usw.).
Das Heilfasten ist ein höchst persönliches Ereignis. Denn jeder Mensch erlebt diese Zeit anders. Mitunter zeigen sich seelisch-geistige «Krisen», die je nach Anlage, Leiden und Schicksal zum Teil hohe Ansprüche an den Betreffenden stellen und besonders angesprochen werden wollen. Entsprechend sollte jedes Heilfasten individuell gestaltet und den jeweiligen geistig-seelisch-körperlichen Bedürfnissen angepasst werden. Anfänger, die sich «Tage ohne Essen» fast nicht vorstellen können, dürfen erste Erfahrungen mit einem oder ein paar wenigen Tagen machen. Dabei stellen viele erstaunt fest, wie leicht und befreiend «Nicht-Essen» sein kann. Langjährig erfahrenen Fastern gelingt es sogar, Heilfasten in den Berufsalltag einzubinden. Doch ist dies eine besondere Herausforderung, die sehr genau überlegt und nur Erfahrenen überlassen werden sollte. Da ist das Intervall-Fasten, zwar auch eine Herausforderung, doch bedeutend einfacher umzusetzen. Für die meisten Menschen ist für das Heilfasten eine Auszeit unbedingt empfehlenswert. Denn ob nun kurz- oder langzeitig angelegt: Die Methode darf keinesfalls unterschätzt werden.
Heilfasten kann alleine, in Gruppen oder in Kureinrichtungen durchgeführt werden. Manche Menschen ziehen das alleinige Heilfasten vor und nutzen häusliche, bekannte Ressourcen, um so am besten den eigenen Bedürfnissen und Rhythmen nachzugehen. Bei Unsicherheiten bieten erfahrene Fastenberater oder Therapeuten tolle Angebote an. Gemeinsame Treffen in Fastengruppen etwa werden ergänzt durch tägliche Wanderungen. Die Bewegung in der Natur hilft dem gesamten Organismus, wieder ins Lot zu kommen. Zudem wird die Natur beim Fasten bewusster und intensiver erlebt, was seelisch-geistige Impulse setzen
kann. Gleiches gilt für Musik. Im Gruppengespräch wiederum können eigene eingefahrene Verhaltens-, Essoder sonstige Gewohnheiten in den Fokus gelangen und überdacht werden – nicht zuletzt der Umgang mit (digitalen) Medien. Denn: Heilfasten kann nur dann seine tief greifende Wirkung entfalten, ähnlich wie bei religiös bedingtem Fasten, wenn die bisherige Lebensweise unterbrochen wird.
❞
Getrunken wird nur Wasser. Schon hierdurch verändern sich nach 24 Stunden Gewicht, Blutdruck, Atmung und Puls

Ziel des Heilfastens ist die körperliche, geistige und seelische Umstimmung. Die Zeitdauer wird ganz nach innerlichen Bedürfnissen und Wünschen festgelegt, auch nach ärztlicher Beratung. Wichtig ist jedoch immer der eindeutige Entschluss dazu – egal ob drei oder 30 Tage gefastet wird. Hinzu kommen idealerweise zwei einleitende Obsttage und das ungemein wichtige Fastenbrechen danach. Während der Obsttage dürfen beliebige Mengen Obst gegessen werden. Getrunken wird nur Wasser. Schon hierdurch verändern sich nach 24 Stunden Gewicht, Blutdruck, Atmung und Puls. Am dritten Tag werden bei einer Heilfasten-Kur meist Abführmittel empfohlen. Drastisch wirkende Abführmittel können allerdings zu Bauchgrimmen führen. Den aufgeregten Darm kann dann Pfefferminztee beruhigen, sowie Wärme und Ruhe. Bei länger anhaltendem Heilfasten stellt sich häufig Verstopfung ein. Tägliche, warme Einläufe (alles nur Übungssache!) bieten Abhilfe und regen zudem die Stoffwechseltätigkeiten weiter an. Auch ein Glas Glaubersalzlösung tagsüber getrunken hilft gegen drohende Verstopfung, ebenso Bauchmassagen. Im Laufe von Entgiftung und Entschlackung kommt es zu vermehrtem Schwitzen und starkem Körperoder Mundgeruch. Tägliche Duschen und intensivierte Zahn- und Zungenpflege wirken dagegen.
Der Geist ist auf einmal hellwach Welch heilsame und kraftvolle Veränderungen das Fasten nicht nur körperlich auslöst, zeigt sich auch an der häufigen Schlaflosigkeit (während des Fastens niemals Schlaftabletten nehmen!), die von erfahrenen Fastern aber positiv gewertet wird: Der Geist ist hellwach, schöpferische Ideen sprudeln; ebenso ist die Seelentätigkeit stark erregt. Alter Ärger, Groll, aussergewöhnliche Lebensfreude können ins Bewusstsein rücken: Meist sind es Themen, die schon lange einmal «bearbeitet» werden wollten und quasi «schichtweise» abgetragen werden. Für die Betrachtung, die Würdigung all dieser Gefühle und Gedanken braucht es Zeit, Geduld und liebevolle Selbstannahme.
Es gibt viele Fasten-Hilfsmittel aus der Naturheilkunde: Licht (Sonnenbäder) zum Beispiel, reichlich Bewegung an der frischen Luft möglichst im Grünen,
ausreichender (Naturzeit-)Schlaf, bewusste, bauchbetonte Atmung. Die Haut als Teil des ausscheidenden Stoffwechsels kann sich während einer kräftigen Entgiftung verändern. Liebevolle, leichte Bürstenmassagen, warme Bäder, wechselwarme Duschen (wer es mag und verträgt), kräftiges Frottieren mit anschliessenden Einreibungen mit duftenden Heilpflanzen-Ölen (keine synthetischen Duftstoffe nehmen) sind die Mittel der Wahl. Das Fastenbrechen ist für viele Menschen der oft schwierigste Teil des Heilfastens. Am ersten Tag wird zum Beispiel nur ein Apfel gegessen. Langsam und pedantisch durchgekaut. Alle Geschmacksnerven sind aktiviert – und wollen mehr. Etwas Disziplin ist da schon nötig, um nun nicht all das tagelang Vermisste haltlos in sich hineinzustopfen. Ein Teller Kartoffelsuppe mit Kräutern bewusst genossen zeigt, welche Geschmacksvielfalt sich in so einem einfachen Gericht vereinigen kann. Auch beim Fastenbrechen können sich Bauchkneifen, verstärkte Darmwinde oder gelegentliche Unpässlichkeiten einstellen: Die Darmflora stellt sich so auf ein neues, gesünderes Gleichgewicht ein. //

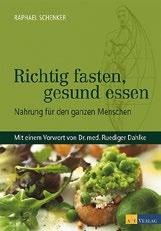

●
Raphael Schenker «Richtig fasten, gesund essen», AT Verlag 2013, ca. Fr. 24.–
Lydia Reutter «Heilfasten nach Hildegard von Bingen», AT Verlag 2006, ca. Fr. 27.–
Spinat ist gesund. Das wissen wir schon lange. Aber erst in den letzten Jahren hat er sich zum vielseitigen KüchenLiebling gemausert.
Text: Vera Sohmer
Vorbei sind die Zeiten, in denen Spinat hauptsächlich aufgetaut und zerhackt auf den Teller kam – als graugrüner, mit Streuwürze versetzter Brei. Heute darf das Blattgemüse zeigen, was es alles kann. Ist es zart, wie jetzt im Frühling, mundet es roh in den verschiedensten Salat-Variationen und in grünen Säften. Spinat macht sich zudem gut auf Wähen, Pizzen und Fladenbroten, besonders wenn er sich in Gesellschaft mit Feta oder Ziegenkäse befindet.
Im Vegi-Restaurant Tibits geht Spinat sogar interkontinentale Verbindungen ein. Beliebt ist er hier zu Dal, dem indischen Gericht aus Hülsenfrüchten. Und neu kommt er als japanische Beilage Gomaae aufs Büffet – blanchiert und mit Sesam garniert. «Diese Geschmackskombination ist einfach und doch überraschend», sagt Tibits-Mitarbeiterin Claire Honegger.
Mit Wurzel oder gefroren?
Reichlich Gelegenheit also, schlechte Erinnerungen zu tilgen und etwas Neues auszuprobieren. Wurzelspinat zum Beispiel. Hier werden die Blätter nicht, wie sonst üblich, einzeln abgeschnitten. Geerntet wird die ganze Pflanze samt Wurzelhals. So bleibt das Gemüse länger haltbar – im Kühlschrank in ein feuchtes Tuch eingeschlagen bis zu zwei Wochen. «Wurzelspinat ist kräftiger im Biss als Blattspinat», sagt Valérie Sauter von der Juckerfarm. Auf deren Feldern in Rafz ZH gedeiht er auf rund 30 Aren. Eine Alternative für all jene, denen frischer Blattspinat zu schnell verdirbt, die sich mit tiefgekühlter Ware aber
nicht recht anfreunden können. Wer sich dennoch für Letzteres entscheidet, wählt am besten ein Produkt ohne Rahm und Zusatzstoffe. Tiefgefrorener Spinat, heisst es, kann manchmal sogar die bessere Wahl sein. Zumindest dann, wenn frischer Spinat schlecht gelagert wurde. Denn dann gehen die wertvollen Inhaltsstoffe schnell verloren.
Als heimisches Superfood wird Spinat heute gerne vermarktet. Tatsächlich ist seine Liste an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen beachtlich, auch wenn der Eisengehalt nicht so hoch ist wie lange Zeit behauptet wurde. Das Blattgemüse ist aber unter anderem reich an Betacarotin, Kalium, Calcium, den Vitaminen A und C sowie Folat.
Der Eisenirrtum hat sich inzwischen herumgesprochen. Hartnäckig hingegen hält sich die Behauptung, Spinat dürfe wegen sich bildender giftiger Stoffe nicht aufgewärmt werden. Falsch, sagen Ernährungsfachleute. Lagert man Spinat nach dem Kochen oder Blanchieren sofort kühl, ist das Aufwärmen unbedenklich. Abgesehen davon schmeckt frisch zubereiteter Spinat aber einfach besser.
Sehr schmackhaft sind übrigens auch Wildkräuter, die besonders nährstoffreich sind und sich als Spinat-Alternativen verwenden lassen. Wer jetzt durch die Natur streift, findet unter anderem Bärlauch, Brennnessel und Giersch. Wichtig dabei: Sich vergewissern, dass man die richtigen Kräuter sammelt und sie vor der Zubereitung waschen.

KRÄFTIG | Beim sogenannten Wurzelspinat wird die ganze Pflanze samt Wurzelhals geerntet. So behalten die Blätter einen kräftigeren Biss. Und Popeye hatte übrigens schon recht: Spinat verleiht Kraft, denn er enthält das Hormon Ecdysteron, das den Muskelaufbau fördert.






























Kinder und Spinat: Ein bisschen mogeln ist erlaubt
Alles «wäh»: Kindern grünes Gemüse wie Spinat vorzusetzen, bleibt oft ein erfolgloser Versuch. Aber Eltern sollten nicht verzweifeln – zwischen zwei und fünf Jahren haben fast alle Kinder eine Neophobie: Sie lehnen neue Ess waren grundsätzlich ab. Dies nicht etwa aus Trotz, sondern weil sich ein Schutzmechanismus aus Urzeiten meldet. Früher musste der Nachwuchs in freier Natur rasch lernen, giftige von ungiftigen Lebensmitteln zu unterscheiden. Bitter, und das ist viel Grünzeugs, signalisiert Gefahr; süss Schmeckendes hingegen ist praktisch immer geniessbar. Die Liebe für Süsses ist zudem angeboren: bereits Fruchtwasser und Muttermilch haben einen süsslichen Geschmack. Mit Kohlenhydraten wähnen sich die Kleinen ebenfalls auf der sicheren Seite. Kein Wunder, benötigt es für Pizzateig und Pommes kaum elterliche Überzeugungskraft. Für «Grünzeug» hingegen schon. Und gerade auf Spinat mit seinen Bitterstoffen reagieren viele Kinder mit Abneigung. Was also tun?
Verschmähtes immer wieder anbieten – in kurzen Abständen, kleinen Portionen und auf spielerische Art –, ist da eine gute Strategie. Kinder, sagen Ernährungsexperten, müssen ein Lebensmittel bis zu 15 Mal probieren, ehe sie sich an den neuen Geschmack gewöhnt haben. Dabei ist mogeln erlaubt: Eltern können den Spinat im Strudelteig verstecken, ihn pürieren und – pflanzlichen – Rahm beigeben, das macht ihn milder im Geschmack. Er lassen sich auch Fruchtstückchen beimischen – Spinatblätter fallen, ausser farblich, in einem Smoothie mit Bananen und Äpfeln nicht weiter auf.
Wichtig dabei: Ausdauernd bleiben und das Kind zu nichts zwingen. Und: Mit gutem Beispiel vorangehen. Greifen auch Mama und Papa zum Spinat, sind die Chancen grösser, dass es ihnen die Kinder gleichtun.
« Kinder müssen ein Lebensmittel bis zu
15 Mal probieren, bis sie den neuen Geschmack kennen. »

Der clevere Konsumtipp
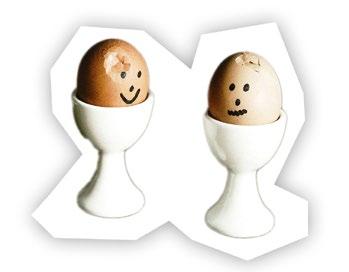
Ei, Ei, Ei – wie steht es um dein CO 2?
Eierfärben und «Eiertütschen» sind zweifelsohne beliebte Traditionen. Und so steigt um Ostern der Schweizer Eierkonsum um rund 20 Prozent. Viele färben die Eier schon ein, zwei Wochen vor Ostern, dieses Jahr also gegen Ende März. Doch schauen wir zuerst einmal genauer hin.
Vielen Menschen ist das Tierwohl wichtig. Daher wurde 1992 die Käfighaltung in der Schweiz verboten. Dennoch braucht so ein Ei ganz schön viel Ressourcen. Mitgezählt werden dabei das Import-Futter der Hennen, das nicht direkt von uns Menschen verzehrt, sondern erst vom Huhn verstoffwechselt wird. Dieser Umweg kostet wertvolle Kalorien. Hingegen kommt Getreide, das direkt gegessen wird, vollständig der menschlichen Ernährung zugute. Mitgezählt wird auch die Vergasung männlicher Küken – drei Millionen müssen in der Schweiz pro Jahr sterben! Auch die Stallpflege sowie die Mistverarbeitung mit dem anfallenden Ammoniak werden miteingerechnet.
So kommt schliesslich ein einziges Ei (60 g) auf satte 160 g CO2 ! Gleich viel CO2 verursacht knapp ein halbes Kilogramm (490 g) Müesli mit Haferflocken, Äpfeln, Hafermilch, Leinsamen und Baumnüssen. So ein Müesli ist ungemein gesund und viel nahrhafter als ein Ei. Einfärben können Sie das Müesli auch in allen Farben. Nur «tütschen», das geht halt nicht damit.
Weitere Informationen unter www.clever-konsumieren.ch
GRÜNES URDINKELKERNOTTO
für 4 Personen
1 Zwiebel, fein gehackt
2 Knoblauchzehen, gepresst
Butter zum Dämpfen
250 g UrDinkel-Kernotto
1 dl Weisswein oder Gemüsebouillon
ca. 7 dl Gemüsebouillon
100 g zarter Blattspinat
1 Handvoll gemischte Kräuter, z.B. Thymian, Kerbel und Giersch
1 dl Rahm
Salz, Pfeffer
100 g Crème fraîche und Kräuter zum Garnieren
Zubereitung
1 Zwiebel und Knoblauch in der Butter andämpfen. Kernotto kurz mitdünsten. Mit Wein und/oder Bouillon ablöschen, dann einkochen. Bouillon dazu giessen, unter gelegentlichem Rühren bei kleiner Hitze 25–30 Minuten kochen, dann nachquellen lassen
2 Spinat, Kräuter und Rahm im Mixer fein pürieren, unter das Kernotto mischen, heiss werden lassen und in vorgewärmte Schalen geben, Crème fraîche darauf geben, garnieren und sofort servieren
Tipp
Nach Belieben mit gedämpften Spinat- oder Wildkräuterblättchen ergänzen. Zusätzlich in Dampf erhitzte geräucherte Forellenstücke darauf servieren. Nach Belieben mit geriebenem Käse verfeinern
Die Meinung, dass Spinat viel Eisen enthalte, beruht auf einem Messfehler aus dem 19. Jahrhundert. Spinat ist aber trotzdem gesund. Und er schmeckt. Ihnen nicht?
Dann versuchen Sie es doch mal mit diesen Varianten:

Weitere Rezepte unter www.urdinkel.ch

URDINKEL-SPINATBLUMEN
für ca. 12 Stück
Zubereitung: ca. 45 Minuten
Quellen lassen: ca. 30 Minuten
Backen: ca. 25 Minuten
1 Ausstecher 12 cm ∅
Spritzbeutel mit glatter Tülle
ca. 600 g UrDinkel-Butterblätterteig
Füllung
150 g Blattspinat
250 g Ricotta
50 g UrDinkel-Paniermehl
1 Knoblauchzehe, gepresst
1 TL fein gehackter Thymian
1 Ei
Salz und Pfeffer
1 Eigelb
1 EL Milch
2 EL Sonnenblumenkerne, nach Belieben
Zubereitung
Blätterteig auf wenig Mehl 3 mm dick ausrollen. 24 Rondellen ausstechen, kühl stellen.
Füllung: Blattspinat im Cutter oder von Hand hacken, restliche Zutaten zugeben und verrühren, würzen. Zugedeckt 30 Minuten quellen lassen.
Spinatfüllung in einen Spritzbeutel mit glatter Tülle füllen, ringförmig auf die Hälfte der Teigrondellen spritzen. Eigelb mit Milch verrühren, Teigränder und Teigmitte mit Eigelb bestreichen, Teigdeckel etwas grösser ausziehen und darauflegen, dabei die Teigmitten gut zusammendrücken, mit Eigelb bestreichen. Jede Teigrondelle 8- bis 10-mal einschneiden, sodass die Mitte ganz bleibt, Teigteile aufstellen, so dass die Füllung nach oben schaut. Teigmitten mit Sonnenblumenkernen bestreuen.
Spinatblumen in der Mitte in den auf 200 °C vorgeheizten Ofen schieben und 20 bis 25 Minuten backen. Heiss, lauwarm oder auch ausgekühlt servieren.
Das Rezept stammt aus dem Buch «UrDinkel – Alles vom Blech» von Judith Gmür-Stalder.
Dieses ist im Online-Shop auf www.urdinkel.ch oder per Telefon 034 409 37 38 erhältlich.

In Zusammenhang mit starken Knochen denkt man eher an Kalzium, Vitamin D und Vitamin K2 als an ballaststoffreiches Essen. Inzwischen ist jedoch bekannt, dass die faserreiche Pflanzennahrung für die Gesundheit der Knochen eine zentrale Bedeutung hat. Das konnte ein Forscherteam der Universität Erlangen (D) aufzeigen.
Die Pflanzenfasern dienen also nicht nur der Gesunderhaltung des Darms und der Erhöhung des Darmvolumens. Gewisse Ballaststoffe werden mithilfe von Darmbakterien fermentiert und in kurzkettige Fettsäuren umgewandelt. Diese nähren die Darmschleimhaut, schmieren die Gelenke und verzögern, laut Studie, den Knochenabbau. Wenn man bedenkt, dass allein in der Schweiz rund 400 000 Menschen von einer Osteoporose betroffen sind, mehrheitlich Frauen, sind solche Erkenntnisse Gold wert. Die schleichende Knochenkrankheit, bei der allmählich die Knochendichte und somit die Knochenstabilität abnimmt, verunsichert die Betroffenen enorm. Nicht zuletzt deshalb, weil sehr viel Angst aufgebaut wird und viele Behandlungsformen unbefriedigend sind. Auf der Suche nach alternativen Behandlungsformen finden die Betroffenen keine Unterstützung von den behandelnden Ärzten – im Gegenteil: Der Mahnfinger wird oft erst recht in die Höhe gestreckt.
Die Forscher der Universität Erlangen konnten nun aufzeigen, dass die Ursache für die Erkrankung nicht ausschliesslich beim fehlenden Kalzium oder dem veränderten Hormonsystem nach den Wechseljahren zu suchen ist, sondern auch im Darm. Wobei
hier zwei Faktoren elementar sind: Eine gesunde Darmflora, die aus vielen verschiedenen Bakterienarten besteht, und eben die unverdaulichen Pflanzenfasern, besser bekannt unter dem Begriff Ballaststoffe.
Lange ging man davon aus, dass Ballaststoffe vollkommen unverdaubar seien. Inzwischen ist jedoch gut belegt, dass die Darmbakterien einen Teil der pflanzlichen Nahrungsfasern durchaus so zerlegen können, dass die einzelnen Bestandteile über die Darmwand in den Blutkreislauf und von dort in die Gelenke und Knochen gelangen. Dabei entstehen kurzkettige Fettsäuren, die dem Körper Energie liefern, die Darmbewegung anregen und entzündungshemmend wirken. Diese Fettsäuren (Propionsäure) konnten in einer erhöhten Konzentration unter anderem im Knochenmark nachgewiesen werden. Dort bewirkten sie, dass sich die Zahl der knochenabbauenden Zellen verringerte und sich damit auch der Knochenabbau deutlich verlangsamte. Die Entzündungen verringern sich und die Knochen werden fester.
Zentral bei diesem Vorgang sind die wasserlöslichen Ballaststoffe, zu denen Pektin, Guar, BetaGlucan, Psyllium und Inulin gehören. Sie bilden zusammen mit Wasser eine Art Gel, beeinflussen den Blutzucker- und Cholesterinspiegel im Blut positiv und dienen den Darmbakterien als willkommene Nahrung. Wasserlösliche Ballaststoffe werden mithilfe von Darmbakterien fermentiert. Dabei entstehen neben geruchlosen Gasen auch die kurzkettigen Fettsäuren. Wasserlösliche Ballaststoffe findet man in Obstschalen von Äpfeln oder Quitten, Leinsamen, Hafer, Gerste und Haferkleie, in Flohsamenschalen,

KRAFTNAHRUNG | Wir sollten täglich viel Grünzeugs essen, denn das stärkt nicht nur Darm und Immunsystem, sondern auch die Knochen.
Artischocken, Topinamburknollen, Rotalgen, AgarAgar sowie Chicorée. Zu den wasserunlöslichen Pflanzenfasern gehören die Zellulose und Lignin, welche pro Gramm bis zu sechzig Milliliter Wasser binden können. Aufgrund ihrer Quellfähigkeit sind sie für die Gesundheit des Darms und des gesamten Verdauungstrakts wichtig. Man nimmt sie auf mit dem Konsum von Blattgemüse, Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten, Flohsamenschalen und Weizenkleie.
30 Gramm Nahrungsfasern sollten wir täglich essen. Das ist nur mit viel Gemüse zu schaffen, ergänzt mit Beeren, Früchten und Trockenfrüchten, Nüssen und Ölsaaten wie Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Mohn, Sesam, Leinsamen oder Kokosraspel; auch Linsen, Bohnen, Kartoffeln und Vollkornprodukte sind wichtige Lieferanten von Ballaststoffen. Und natürlich Wildpflanzen wie Löwenzahn, Bärlauch, Gänseblümchen oder Labkraut, die ja schon spriessen. Wer einen empfindlichen Magen hat, sollte die Menge an Pflanzenfasern schrittweise erhöhen, sonst ist das Verdauungssystem überfordert und reagiert mit Blähungen und Unwohlsein. Die faserreiche Kost sollte man nach und nach in den Speiseplan einbauen. Das ist viel besser, als hauptsächlich Brot, Teigwaren und Fleisch zu essen und dafür jeden Abend einen Esslöffel quellende Nahrungsergänzungen wie Metamucil, Lein- oder Flohsamen zu schlucken. Das wäre zwar besser als nichts, aber nicht die Lösung, da die auf einmal eingenommenen Ballaststoffe auch sehr viele Mineralstoffe binden und ausschwemmen. Auf die Länge ist das nicht förderlich. Man muss also zum «Pflanzenfresser» werden.
Alexa Leonie Meyer, Ibrahim Elmadfa «Vielkönner Ballaststoffe: Fitter Darm, starkes Immunsystem, Topfigur», Gräfe & Unzer 2018, ca. Fr. 23.–
Und so gehts: Geniessen Sie jetzt im Frühling möglichst oft Wildkräuter, Chicorée und Artischocken. Reichern Sie das Frühstück mit Leinsamen an und ersetzen Sie Teigwaren und Reis durch Gerstengetreide. Nehmen Sie im nächsten Winter Topinamburknollen in Ihren Speiseplan auf. Sie können das Wurzelgemüse gut im Garten oder im Topf auf dem Balkon ziehen und so laufend frisch ernten – die Pflanze sieht ähnlich aus wie eine Sonnenblume (sie gehört auch zur gleichen Gattung), wuchert aber mitunter stark. Und essen Sie täglich pektinhaltige Beeren und Früchte wie ungeschälte Äpfel, Heidelbeeren, Johannisbeeren und Stachelbeeren. Um generell die Ballaststoffdichte zu erhöhen, können Salate mit Kernen angereichert und im Reis Sesam mitgekocht werden. Geniessen Sie öfters ein Hafermüesli zum Frühstück oder auch mal zum Abendessen und knabbern Sie zwischendurch Rohkost oder Studentenfutter. Und vergessen Sie dabei das Trinken nicht! Ballaststoffe müssen im Darm quellen können.
Sie sehen, es ist gar nicht so schwierig, die Ballaststoffmenge zu erhöhen. Aber: Man muss je nach bisherigen Essgewohnheiten die Komfortzone verlassen, sich auf Neues einlassen und den Zähnen ihre Hauptaufgabe zurückgeben: das Kauen der Nahrung. Denn das stärkt, wie wir nun wissen, nicht nur Darm und Immunsystem – sondern auch Zähne und Knochen. //
* Sabine Hurni ist dipl. Drogistin HF und Naturheilpraktikerin, betreibt eine eigene Gesundheitspraxis, schreibt als freie Autorin für «natürlich», gibt Lu-Jong-Kurse und setzt sich kritisch mit Alltagsthemen, Schulmedizin, Pharmaindustrie und Functional Food auseinander.

Mein Partner, 43 Jahre alt, hat seit zehn Monaten einen Tennisarm rechts. Nun beginnen die gleichen Symptome auch links. Er arbeitet körperlich bei jedem Wetter draussen. Die Schmerzen schränken ihn ein und er nimmt im Moment für zehn Tage entzündungshemmende Schmerzmittel ein. Akupunktur, Chiropraktik, Salben und Co. haben leider nichts gebracht. Haben Sie eine Idee ? L. S., St. Gallen
Die besten Erfahrungen beim Tennisellenbogen mache ich mit Schröpfen. Und zwar direkt auf dem Muskel unterhalb des Ellenbogens. Meistens sind auch der ganze Unterarm und die Daumenwurzel komplett verspannt. Es würde Ihrem Partner bestimmt guttun, wenn er einen Masseur findet, bei dem er sich die Arme mal richtig durchmassieren lassen kann. Dazu kommt das Dehnen. Gute Dehnungsübungen finden Sie im Internet unter den entsprechenden Stichworten. Diese Dehnungen sollte er auch später, wenn die Sehnenentzündung verheilt ist, regelmässig machen. Insbesondere weil er vermutlich eher einseitige Bewegungen verrichten muss. Zur Arbeit sollte er ein Stützband am oberen Unterarm tragen, um die Sehne zu schonen.
Ausserdem kann sich Ihr Partner in der Drogerie ein Schwefelbad, Bademeersalz, Johanniskrautöl und eine Packung Traumeel-Tabletten kaufen. In den nächsten zehn Tagen soll er täglich ein Armbad nehmen in lauwarmem Schwefel-Meersalz-Wasser. Danach die Arme kräftig einmassieren mit dem Johanniskrautöl und ein warmes Shirt und/oder Wollstulpen anziehen. Die homöopathischen Traumeel-Tabletten kann er mehrmals täglich einnehmen.
Bei solchen chronischen Beschwerden lohnt es sich übrigens auch, mit den Ellenbogen zu kommunizieren und sich selber Fragen zu stellen: Was beschäftigte mich, als die Beschwerden begonnen haben? Muss ich etwas loslassen, eine Entscheidung treffen, handeln? Denn selbst ein mechanisches Problem wie eine entzündete Ellenbogensehne ist selten eine ausschliesslich körperliche Angelegenheit, sondern oft nur ein Warnzeichen für seelische Konflikte.
Johanniskrautöl.
Ich nehme wegen Krämpfen in den Beinen regelmässig ein Basenmittel ein, das mir in der Physiotherapie verschrieben wurde. Seit ich das Pulver zusammen mit Wasser zum Mittagessen trinke, liegt mir jedoch das Essen schwer auf. Auf leeren Magen mag ich es nicht einnehmen. Was tun ?
S. S., Thun
I n vielen Basenmitteln befindet sich Natron. Natron bindet Säuren sehr effizient. Aber eben nicht nur die überschüssigen Säuren, die im Bindegewebe abgelagert sind, sondern auch die Magensäure. Günstige Medikamente gegen Magenbrennen enthalten allesamt Natron. Wenn Sie das Präparat zum Essen nehmen, unterbinden Sie dadurch einen wichtigen Verdauungsprozess. Die Nahrung wird im Magen erst richtig zersetzt, wenn sich nach einer gewissen Zeit die Säure wieder gebildet hat. In einem nicht-sauren Magenmilieu wird nichts zersetzt. Mit anderen Worten: Sie löschen das Feuer, bevor die Wurst gar ist. Das ist nicht der Sinn der Sache. Nehmen Sie das Basenmittel abends vor dem Schlafengehen ein. Dann ist der Magen schon leer und muss nichts mehr verdauen. Morgens nach dem Aufstehen sollten Sie nüchtern eine Tasse warmes Wasser mit einem Schuss Zitronensaft oder natur-
trübem Apfelessig trinken. Ich denke nämlich, dass Sie eher zu wenig als zu viel Magensäure haben.
Es gibt auch Basenpulver ohne Natron, zum Beispiel Basica. Dieses wirkt erst im Darm. Ansonsten kann man den Körper auch mit Heilerde, Klinoptilolith, Gerstengras oder mit Schüsslersalzen entsäuern – stets kombiniert mit einer Ernährung, die reich an Pflanzenfasern (Ballaststoffen) ist (siehe auch S. 32). Es gibt übrigens ein homöopathisches Kombinationsmittel gegen Wadenkrämpfe. Es heisst Krampex und kann über den Fachhandel (Drogerie und Apotheke) bezogen werden.

Rohe Kartoffeln
Ich habe gehört, dass man viermal im Jahr jeweils an fünf Tagen eine rohe Kartoffel essen soll, um den Körper zu entgiften. Stimmt das ? Z. K., Oberasbach
Ich kenne diese Kur nicht und kann Ihnen deshalb auch keine genaue Anleitung dazu geben. Es kann aber gut sein, dass die rohe Kartoffelkur ein altes Hausmittel ist, das seine Berechtigung hat.
Falls Sie die Kur machen, sollten Sie nur junge Kartoffeln nehmen und diese schälen. So entfernen Sie den grössten Teil des Alkaloids Solanin. Als Alternative zu rohen Kartoffeln könnten Sie auch Kartoffelsaft trinken oder die Kartoffeln im Salzwasser fermentieren. Dadurch entsteht Milchsäure, was wiederum für den Darm sehr gesund ist.
Grundsätzlich ist es sehr sinnvoll, dem Körper immer wieder die Gelegenheit der Entsagung und der Entgiftung zu geben. Nur schon ein grosses Glas warmes Wasser am Morgen wirkt sanft reinigend. Ebenso Essenspausen von bis zu fünf Stunden. Nach fünf Stunden erlischt das Verdauungsfeuer. Deshalb sollte man morgens immer mit etwas Warmem starten, z. B. einem Glas
warmem Wasser, damit die Verdauung langsam wieder aktiviert wird. Beim Intervallfasten ist das umso wichtiger: Wer 12 oder sogar 16 Stunden nichts isst, beginnt optimalerweise mit einer Suppe oder trinkt während der Fastenstunden viel warmes Wasser oder Ingwerwasser, um den Stoffwechsel aktiv zu halten.
Besonders gut zur Entgiftung eignet sich auch sämtliches Grünzeugs, vor allem Wildkräuter, die ja nun wieder spriessen (siehe auch S. 42): Bereiten Sie sich im Frühling täglich einen grünen Saft zu mit Kräutern aus der Natur, wenig Früchten sowie grünen Salatund Gemüseblättern. Auch Heilpflanzentinkturen aus Löwenzahn oder Brennnessel sind ideale Begleiter für eine reinigende und energetisierende Frühjahrskur.
Glaukom
Was kann ich machen gegen einen erhöhten Augeninnendruck?
A.K., Biel
Vonseiten der klassischen Naturheilkunde gibt es meines Wissens keine Behandlungsmöglichkeiten, um den erhöhten Augeninnendruck zu reduzieren. Die Homöopathie könnte allenfalls helfen oder die Augenakupunktur. Von einem Leser habe ich zudem folgenden Hinweis erhalten: Er hat im Buch von Hans-Gottfried Schmidt «So erhält die Natur die Sehkraft» gelesen, dass nicht nur Aufregung, Überanstrengung und Rauchen den Augendruck erhöhen können, sondern dass das Glaukom auch eine Eiweissspeicherkrankheit sei. Um zu verhindern, dass sich Eiweisse in den Augen einlagern und um den Körper von überflüssigem und krankmachendem, abgelagertem Eiweiss zu befreien und die Eiweissspeicher zu entleeren, gäbe es nur einen Weg: Während zwei bis drei Monaten keinerlei tierisches Eiweiss zu essen. Erlaubt sind weiterhin Eiweisse aus Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen.
Ich kann diesen Ansatz nur unterstützen. In den dünnen Blutgefässen der Augen und der Ohren sammeln sich Ablagerungen an, die der Körper fast nicht mehr loswird. Deshalb ist es so wichtig, dass wir den Kopf täglich mit einer Naturbürste richtig kräftig
offeriert von Zehnder Group Schweiz AG

Schon früh im Jahr beginnt für viele die Heuschnupfen-Zeit. Vom Wind werden die Pollen in nahezu jeden Winkel transportiert. Um sich zumindest in den Wohnräumen vor Pollen zu schützen, ist eine kontrollierte Raumlüftung die effektivste und komfortabelste Lösung. Die Aussenluft wird mit Hilfe spezieller Pollen- und Feinstaubfilter im Lüftungsgerät gereinigt und somit die Belastung der Raumluft durch Pollen und andere Schadstoffe stark reduziert. Die Lüftungsanlage sorgt automatisch auch bei geschlossenen Fenstern für eine kontinuierliche, sauerstoffreiche Frischluftzufuhr. Ist noch keine Wohnraumlüftung vorhanden, sind Einzelraumlüftungen eine kostengünstige Alternative: Auch sie sorgen für einen steten staub- und pollenfreien Luftaustausch.
Im Handel sind Luftreinigungsgeräte erhältlich, die die Raumluft umwälzen und dadurch reinigen. Der Nachteil: Die verbrauchte Luft bleibt weiterhin im Raum. Auch am Fenster befestigte Pollengitter halten einen grossen Teil der Pollen draussen. Ihre Feinmaschigkeit verringert jedoch die Luftzirkulation und es dringt weniger Licht ein.
Mehr zur pollenfreien Raumluft erfahren Sie unter www.zehnder-systems.ch/de/schutzvor-pollen-und-staub





La Gomera/Kanaren
Das abgeschiedene ökologische Paradies für Familien, Seminare und Individual-Urlauber. Hotel Finca El Cabrito, Tel. +34 922 145 005, www.elcabrito.es, info@elcabrito.es
362318_bearbeitet.qxp 19.3.2009 16:50 U

www.fastenwandern.ch


Wo Sie statt Meerblick mehr Blick haben.
Im Kurhaus St. Otmar blicken Sie aus dem Fenster und sehen mehr als Meer. Bewusst wahrnehmen, weil Fasten Ihre Sinne schärft. Bewusst erleben, weil Sie Zeit haben zum Sein. Fastenkuren in St. Otmar – Ihre Mehrzeit
Kurhaus St. Otmar · 6353 Weggis · www.kurhaus-st-otmar.ch
Sass da Grüm – Ort der Kraft Es gibt Orte, von denen eine spürbare positive Kraft ausgeht. Solch ein Ort ist die Sass da Grüm. Baubiologisches Hotel, Bio-Knospen-Küche, Massagen, Meditationen, schönes Wandergebiet, autofrei, traumhafte Lage. Hier können Sie Energie tanken. Verlangen Sie kostenlos Unterlagen.
Hotel Sass da Grüm CH-6575 San Nazzaro Tel. 091 785 21 71 www.sassdagruem.ch
Schule für Sterbe- und Trauerbegleitung
Berufsbegleitende ein- oder zweistufige Ausbildung mit namhaften Gastdozenten:
Anouk Claes, Peter Goldman, Rosanna Abbruzzese, Dolly Röschli, Kurt Nägeli, Annette Kaiser, Antoinette Bärtsch, Renate von Ballmoos, Marcel Briand, Karin Jana Beck, Nel Houtman, Kokopelli Guadarrama, Marie-Therese Schibig, u. a.
Nächster Ausbildungsbeginn: Samstag, 28. März 2020
«Die Tränen der Freude und der Trauer fliessen aus derselben Quelle»
Zentrum Jemanja Ifangstrasse 3, Maugwil 9552 Bronschhofen Telefon 071 911 03 67 info@jemanja.ch www.jemanja.ch










bürsten. Das regt die Durchblutung an und hilft dem Organismus, die Ablagerungen durch den erhöhten Blutfluss auch wieder loszuwerden.

Rachenmandeln
Meine Tochter (18) hatte sechs Monate lang Hals- und Ohrenschmerzen. Eine Abklärung beim Spezialisten ergab, dass ihre Rachenmandeln vergrössert sind. Der Arzt möchte sie entfernen, was meine Tochter nicht will. Was kann sie tun, um die Operation zu umgehen ?
I. S., Ligerz
Wenn Ihre Tochter seit einem halben Jahr Halsschmerzen hat, hat sie vermutlich bereits die ganze Palette an Halsweh-Präparaten ausprobiert. Um die Situation generell zu entschärfen, ist es wichtig, dass die Atmung über die Nase erfolgt (siehe «natürlich» 01-02/20). Das heisst: einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund und/oder die Nase. Bei der Mundatmung kühlt der Rachenraum stark ab, besonders nachts, wenn vielleicht sogar das Fenster geöffnet ist oder auch beim Joggen im Kühlen.
Es gibt einige sehr effektive homöopathische Heilmittel, die auf die Rachenmandeln wirken und an die Wurzel des Problems gehen können. Das wäre sicher einen Versuch wert, falls ihre Tochter einen Zugang zur Homöopathie hat. Hier ist es wichtig, eine erfahrene Fachperson aufzusuchen, die nicht nur die Symptome, sondern auch den Menschen gut erfassen kann.
Gegen die Ohrenschmerzen könnte sie je einen Tropfen 100 Prozent natürliches ätherisches Lavendelöl in Aroma-Therapie-Qualität auf Wattebäuschchen tröpfeln und diese in die Ohren stecken und mindestens 20 Minuten drin lassen. Dies sollte sie dreimal täglich wiederholen.
Was die Ernährung betrifft, so würde ich die Milch aus dem Speiseplan streichen und auch bei den weiteren Milchprodukten zurückhaltend sein – und beobachten, ob sie gut verdaut werden können. Oft hängen chronische Erkältungen mit einer Laktoseintoleranz zusammen.
Gibt es natürliche Mittel, mit denen man Aspirin Cardio ersetzen könnte?
M. M., Zürich
Wenn Sie die Frage so formulieren, muss ich sie klar mit nein beantworten. Es kommt zu sehr darauf an, weshalb das Aspirin Cardio eingenommen wird und was damit erreicht werden möchte. Es wäre je nach Erkrankung fahrlässig, das Aspirin wegzulassen und stattdessen täglich rohen Knoblauch zu essen. Aber Knoblauch ist grundsätzlich ein guter Blutverdünner, ebenso Ginkgo biloba. Die beiden Heilpflanzen verbessern die Fliessfähigkeit des Blutes und regen die Blutzirkulation an. Insbesondere die feinen Gefässsysteme im Gehirn und in den Ohren profitieren davon. Das heisst aber nicht, dass man sie anstelle eines Blutverdünners einnehmen kann, wenn ein solcher verschrieben wurde! Sie müssten einen solchen Wechsel mit Ihrem Hausarzt absprechen. Wenn Sie unsicher sind, ob das Aspirin Cardio das richtige Medikament für Sie ist, wäre es sinnvoll, ihr gesundheitliches Thema mit einem Heilpraktiker oder Homöopathen zu besprechen.

Sabine Hurni, Drogistin, Naturheilpraktikerin und Ayurveda-Expertin, beantwortet Ihre Fragen zu Gesundheits- und Ernährungsthemen persönlich und ganzheitlich. sabine.hurni@chmedia.ch oder «natürlich», Leserberatung, Neumattstr. 1, 5001 Aarau. www.natuerlich-online.ch
Wie viel Macht braucht der Patient ?
Der Patient steht im Zentrum des Gesundheitswesens – zumindest sollte es so sein. Und wer sich im Zentrum eines Systems befindet, sollte in einem bestimmten Ausmass Einfluss oder Macht ausüben können. Doch wie viel Einfluss hat der Patient? Und wie viel braucht er?
Macht, verstanden als die «Gesamtheit der Mittel und Kräfte, die jemandem oder einer Sache andern gegenüber zur Verfügung stehen», haben im derzeitigen Schweizer Gesundheitswesen vor allem Leistungserbringer, Krankenkassen und die öffentliche Hand. Im Verhältnis zu diesen Akteuren ist die Liste der Mittel und Kräfte von Patienten derzeit noch sehr kurz, genauer gesagt: nicht existent. Es gibt keine solche Liste.
Warum hat der Patient eine derart marginale Machtposition, wo er doch im Zentrum stehen sollte? Die Ohnmacht des Patienten drückt sich schon über die Wortherkunft aus: Gemäss dem Lateinischen «patiens» leidet, erduldet und erträgt der Patient. Diese Bedeutung ist bemerkenswert, kommt dem Patienten doch somit per definitionem eine passive Rolle zu: Er lässt über sich ergehen, was letzten Endes andere bestimmen. Patienten haben seit jeher diesen Platz in unserer Gesellschaft, wenngleich sich das Rollenverständnis seit Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelt und die Patientenrolle sich zunehmend emanzipiert hat – zunächst in Bezug auf die Informationshoheit und dann immer stärker auch im Behandlungsprozess. Die Emanzipation des Patienten hat sich jedoch nicht gleichförmig mit seiner Machtposition im Gesundheitssystem entwickelt: Diese Entwicklung steht noch aus. Es wird Zeit, dass der Patient so viel Einfluss nehmen kann, wie ihm in seiner zentralen Position auch zusteht.
Susanne Gedamke, Präsidentin des Gönnervereins
Mehr zum Thema Patientenrecht unter Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz, www.spo.ch
Telefonische Beratung via Hotline 0900 567 047, Fr. 2.90/Min. Im Rahmen der SPO-Mitgliedschaft erhalten Sie diese Beratung unentgeltlich (044 252 54 22).

Keine Pflanze passt so gut zum Frühlingsanfang wie das bittere Milzkraut. Es stärkt die Milz und hilft, verborgene Fähigkeiten zu erkennen und auszuleben.
Text: Steven Wolf
Die Frühlingsgötter bringen uns die Sonne, das Licht, die Wärme und das Leben zurück. Endlich stehen der Tag und die Nacht, das Licht und die Dunkelheit, das Männliche und das Weibliche wieder in einem harmonischen Gleichgewicht zueinander. Wobei das Licht zunehmend an Kraft und Stärke gewinnt. Das Wasser im aufgetauten Boden beginnt zu fliessen, für die Bauern startet die Zeit des Aussäens und auch in der Natur spriessen die Kräuter. Die Zeit des Wachstums und der Fruchtbarkeit ist angebrochen. Die Zeit der Frühlingsgefühle, des Verliebtseins und der Zuversicht. Pessimismus und Trübsal haben nun keinen Platz mehr im Alltag.
Auf meinen Streifzügen durch den frühlingshaften Wald begegne ich an einem feuchten Standort dem eigenartig leuchtenden, grün-gelben Teppich, zu dem sich das Goldmilzkraut (Chrysosplenium alternifolium) ausbreitet. Das bodennahe Frühlingswesen, auch Wechselblättriges Milzkraut genannt, gehört zur Familie der Steinbrechgewächse. Es liebt feuchte, wasser-, nährstoff- und humusreiche Lehmböden und blüht von März bis Mai. Das Goldmilzkraut ist eng verbunden mit den Elementen Wasser und Erde, und den damit verbundenen Elementarwesen.
Elementarwesen sind in der Regel nicht sichtbare, von einigen Menschen jedoch wahrnehmbare Naturenergien, die den Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde zugeordnet sind. Bei der Erde sind es die Zwerge und Gnomen; beim Wasser die Nixen, Nymphen und Undinen. Das Element Wasser ist der Inbegriff des Lebensflusses und vornehmlich ein Ausdruck weiblicher Energien. Die kraftvollen, weiblichen Wasserwesen erlebe ich fast immer als anmutige, zierliche Gestalten mit bezaubernder Ausstrahlung.
Zum Wasser gehören die starken Gefühle wie zum Beispiel Liebe. Bestimmt kennst du die Geschichten der Seefahrer, die Wasserfeen, Meerjungfrauen und Sirenen begegnen. Oder die Sagen über fischähnliche Frauen, die die Gabe besitzen, mit ihrem Gesang die Menschen, vor allem die Männer, zu locken und zu betören; sie in die Tiefe zu ziehen, zu ertränken und sich deren Seelen zu bemächtigen. All das spiegelt die Angst vor dem tiefen Wasser und dem Unbekannten. Diese Wesen des Wassers beleben in uns die weiblichen Aspekte und sprechen unsere Gefühlswelt an. Wenn in den Legenden von Männern die Rede ist, die von Frauen ins Wasser und somit ins Verderben gelockt wurden, verweist dies nicht auf deren grauenvolle Absichten gegenüber Männern. Es spiegelt vielmehr die Angst, sich in Emotionen und Gefühlen zu verlieren. Dieser Teilaspekt des Milzkrauts kann sich wunderbar ergänzend zu den Themen der Eberesche auswirken (siehe «natürlich» 10-19).
Das Milzkraut gehört zu den Boten des Frühlings und trägt dessen Kraft mitten in unser Herz, sodass sich Lebenslust, Frühlingsgefühle, Vertrauen und Mut breit machen. Die herz- respektive nierenförmigen Blätter, die gelben Blüten und die sehr einfache, fast unscheinbare Blütenausprägung sowie der bittere
* Steven Wolf hat schon als Kind von seiner Grossmutter altes Pflanzenwissen gelernt und weiss um die Kraft der Natur mit all ihren sichtbaren und unsichtbaren Wesen. Er lebt im Jurtendorf in Luthernbad, wo er zusammen mit seiner Partnerin ganzheitliche Pflanzenkurse für interessierte Menschen durchführt. www.pflanzechreis.ch

FRÜHJAHRSKUR | Das Milzkraut hat einen Bezug zu den Organen Milz, Leber und Galle, aber auch zu den Nieren, zur Lunge und zum Blut. Es wirkt belebend, entgiftend und wassertreibend und kann bei Nierenleiden, Blasenkatarrhen und Viruserkrankungen helfen.
Geschmack weisen auf die Organe Milz, Leber und Galle hin. Man erkennt auch einen Bezug zu den Nieren, zum Blut sowie zur Verdauung und Lunge. Daher verwende ich das Kraut im Frühling als belebendes, entgiftendes, wassertreibendes Pflanzenheilmittel. Es hilft auch bei Nierenleiden, Blasenkatarrhen und Viruserkrankungen.
Die Milz ist unser grösstes lymphatisches Organ. Ich bezeichne sie als Gral des Lebens, weil sie so lebensbejahend daherkommt: Die Milz ist das Aufnahmeorgan für die Lebensenergie und verteilt diese über die Lymphflüssigkeit im ganzen Körper. Sie dient als Blutfilter und beseitigt alte, verformte oder beschädigte rote Blutkörperchen. Eine gesunde Milz steigert in hohem Masse das Immunsystem und macht es widerstandsfähig gegenüber Viren und Tumorzellen. Bei einer geschwächten Milzfunktion kommt es oft zu Sauerstoffmangelerscheinungen und Anzeichen einer Blutarmut. Die Betroffenen fühlen sich energielos, kalt und ohne Reserve. Auch für das Verdauen von Emotionen ist die Milz zuständig. In diesem Organ sitzen die gute Laune und die Melancholie. Während Lebensfreude die Milz stärkt, können bittere Zustände des Herzens und negative Gedanken die Milz in ihrer Funktion schwächen oder sogar schädigen.
Nach der Blütezeit können wir eine einzigartige Wandlung der einfachen Blüten mitverfolgen, die Bildung des Grals: Die Blüten verwandeln sich in einen Kelch aus offenen Schalen, in deren Mitte sich die Samen befinden. In dieser Symbolik erkenne ich das Zeichen der Gebärmutter. Bei Regen werden die Samen von den herabfallenden Lebenstropfen befruchtet und später aus dem Kelch in die Luft geschleudert. Auf dem fruchtbaren Boden bilden sie dann eine neue Pflanze. Das Gralskraut ist im Frühling nur kurze Zeit sichtbar, bevor es sich wieder ins Erdreich zurückzieht. Es reichert sich in dieser kurzen Zeit mit genügend kosmischer Lebensenergie an, die es in den Wurzeln und den Rhizomhärchen zu speichern vermag. Neben der entgiftenden Wirkung harmonisiert das Milzkraut das Energiezentrum im Beckenraum, das sogenannte Wurzel- oder Sexualchakra. Es ist der Sitz des Ursprungs, der Gefühle und Emotionen und der Lebenslust. Auch die göttliche Schaffenskraft und die Kreativität entspringen dem Beckenraum. Das Milzkraut lässt diese Energien besser fliessen und verbindet energetisch das Herz mit dem Unterleib. Im Kontakt mit dem Wesen des Milzkrauts eröffnet sich mir ein Tor zu meinen verborgenen Schätzen und Fähigkeiten. Daher verwende ich das Milzkraut, um Fähigkeiten zu fördern, die in mir schlummern und ausgelebt werden möchten.
Frühlingstrank aus Milzkrautpulver
Zu hoch dosiert kann das Milzkraut Sodbrennen auslösen. Das Kraut ist jedoch derart bitter, dass kaum Gefahr der Überdosierung besteht. Man nimmt das Milzkraut vorzugsweise als verriebene Pulvermischung ein. Für dessen Herstellung benötigen wir zehn Gramm Birkenzucker (Xylit) und drei bis fünf
frische Blütenköpfchen. Das Xylit wird im Mörser zu einem feinen Pulver gerieben. Dann geben wir die frischen Blütenköpfchen dazu und verreiben diese mit dem Xylitpulver. Mit dieser Mischung können wir diverse Getränke verfeinern. Die Menge reicht für zwei Liter Flüssigkeit und ist für den Sofortverzehr gedacht. Im Frühling, während der kurzen Blütezeit des Milzkrauts, kann man dieses Getränk vier Wochen lang täglich einnehmen. Am besten bereitet man es jeden Tag frisch zu. Man kann aber auch grössere Mengen pulverisieren und einfrieren. Auf diese Weise bleiben Wildpflanzen lange frisch. Es lohnt sich, während der Einnahmedauer den inneren Fokus auf seine Lebenswünsche zu richten. Dadurch verstärkt sich die Kraft des Milzkrauts und die Pläne lassen sich leichter umsetzen. //
gutzu wissen

Unsere beiden heimischen Milzkräuter (Wechselblättriges und Gegenblättriges Milzkraut) sind leicht giftig. Sie haben, je nach Standort und Besonnung, milde oder auch recht bittere, fleischige Blätter. Fein geschnitten können sie in kleinen Mengen Salaten beigegeben werden oder man verwendet sie zusammen mit anderen Kräutern als Füllung für Teigtaschen oder als Würzbeigabe in Quark etc.
Die Ärzte des Mittelalters verwendeten die Milzkräuter wegen ihrer milzförmigen Blätter nach der Signaturlehre bei Erkrankungen der Milz. Jedoch wurde bis heute kein wirksamer Stoff gefunden, der bei Milzbeschwerden angezeigt wäre. Die Homöopathie und anthroposophische Medizin nutzt das Wechselblätterige Milzkraut (Chrysosplenium alternifolium) zur Blutbildung und bei Leukämie sowie als Entgiftungsmittel, das bei der Ausleitung von Schwermetallen (Amalgam) hilfreich sein kann.
Das bei uns häufige Wechselblättrige Milzkraut wird auch Butterblume, Eierkraut, Goldmilz oder Goldveilchen genannt. Man findet es vor allem in feuchten Laubwäldern, wo viele kleine Quellen entspringen. Es hat einen dreikantigen Stängel; seine wechselständigen, tief gekerbten Laubblätter erinnern ein wenig an die Blätter des Gundermanns. Beim sehr ähnlichen Gegenblättrigen Milzkraut (Chrysosplenium oppositifolium) stehen die Laubblätter immer direkt gegenüber, sie sind also gegenständig angeordnet.

«Die Natur ist die beste Apotheke», wusste schon Sebastian Kneipp. Machen wir sie uns doch zunutze. Was es beim Sammeln von Heilkräutern zu beachten gibt.
Jetzt treiben sie wieder aus, die Wildkräuter. Wir müssen sie nur ernten! Eine bessere Vitalstoffquelle gibt es nicht. Brennnesselblätter zum Beispiel enthalten doppelt so viel Vitamin C wie Zitronensaft. Und ganz allgemein liefern uns Bärlauch, Giersch und Co. weit mehr wertvolle Inhaltsstoffe als gezüchtetes Gemüse – und das kostenlos. Lecker schmecken Wildkräuter im Salat, als Suppe oder Smoothie. Man kann mit ihnen aber auch kreativ kochen. Schliesslich soll die Nahrung unsere Medizin sein, wie Hippokrates postulierte. Allerdings gilt es beim Sammeln, einige einfache Regeln zu beachten. Geeignet sind Plätze, die nicht intensiv landwirtschaftlich genutzt werden, etwa Wiesen, Brachland, Hecken, Bachufer, Wälder und natürlich der eigene Garten. Und natürlich sollte man nur Kräuter sammeln, die man sicher bestimmen kann. Dabei helfen Bestimmungsbücher oder Kräuterwanderungen und -kurse. Die ungefähren Erntezeiten sind aus Sammelkalendern ersichtlich.
Rücksichtsvoll sammeln Kräuter werden nur bei schönem Wetter gesammelt, nachdem es drei, vier Tage vorher trocken gewesen ist, damit die Pflanzen möglichst gehaltvoll und aromatisch sind. Insbesondere für





Pflanzen mit ätherischen Ölen gilt: je mehr Sonne – desto mehr Aroma und Heilwirkung. Man sammelt mit grösster Sorgfalt und höchstem Respekt – sodass anschliessend nicht zu erkennen ist, dass gesammelt wurde. Blüten, Blätter und Triebe werden mit einem scharfen Messer, einer Schere oder behutsam von Hand von kräftigen, gesunden Pflanzen gekappt. Wer Wurzeln ausgräbt, gibt ein Stück dem Boden zurück und verschliesst das Loch sorgfältig.
Angst vor dem gefährlichen Fuchsbandwurm brauchen Kräutersammler übrigens nicht haben. Es gibt keine Hinweise auf die Übertragung durch den Verzehr von Wildpflanzen. Als grösste Gefahrenquelle für Fuchsbandwurminfektionen gilt das Schmusen mit Haustieren. Händewaschen ist die beste Prävention.
Die gute
Doch zurück zu unseren Köstlichkeiten. Wurzeln werden gewaschen, Kräuter nur wenn sie sichtbar dreckig sind. Sämtliche Pflanzenteile werden am besten frisch verwendet, da bei der Trocknung Wirkstoffe verloren gehen. Getrocknet werden sie nur, um einen Vorrat für die Zeit anzulegen, in der es keine frischen Kräuter gibt. Dazu diese zu kleinen Büscheln zusammenbinden und aufhängen oder in einer dünnen Schicht auf einem Leinentuch ausbreiten. Der Trockenplatz soll schattig, dunkel und luftig sein. Sind die Kräuter trocken, werden sie zerkleinert. Die Blätter aber nicht zu klein zerreiben, da sich sonst die ätherischen Öle allzu leicht verflüchtigen. Die getrockneten, zerkleinerten Pflanzen werden locker in gut verschliessbare Gläser gefüllt, mit Namen und Erntedatum versehen und dunkel gelagert. Die Kräuter verlieren nach etwa ein bis zwei Jahren die Wirkung und sollten dann erneuert werden. Alte Kräuterreste können für Bäder, Kräuterkissen oder Räuchermischungen verwendet werden.
Darauf sollten Sie beim Sammeln achten:
✿ nur Pflanzen sammeln, die Sie kennen –ein guter Pflanzenführer hilft dabei.
✿ am besten frühmorgens taufrisch sammeln.
✿ respektvoll ernten und zwar nur so viele Pflanzen, wie man essen kann.
✿ nicht querfeldein durch fremde Wiesen streifen.
✿ nicht an Wildwechseln und an Orten sammeln, wo sich viele Menschen und Hunde aufhalten oder wo gedüngt wird.
✿ Pflanzen möglichst frisch verwenden. Gut waschen, aber nicht im Wasser liegen lassen, da sonst wertvolle Vitamine und Mineralstoffe verloren gehen. krea








alternative Medizin eine innere Reise
Selbstverwirklichung


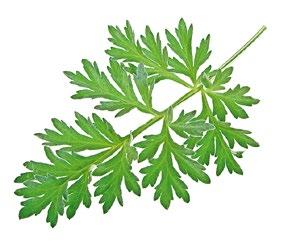








Homöopathie, Spagyrik und Bachblüten gehören zu den beliebtesten alternativen Heilmethoden. Doch wirkt hier mehr als bloss der Placebo-Effekt ?
Text: Lioba Schneemann
Alternativmedizin ist en vogue. Auch Menschen mit schweren Erkrankungen nutzen zunehmend die Angebote der Komplementärmedizin. Homöopathie, Spagyrik und Bachblüten sind drei bekannte und besonders beliebte Methoden, wobei die Homöopathie der Star unter ihnen ist. Jedoch stehen viele Menschen und insbesondere schulmedizinisch ausgebildete Ärzte diesen Therapien skeptisch bis ablehnend gegenüber. Nichts als Placebo, sagen sie. Andere wiederum sind von der Wirkung überzeugt, sei es aus eigener Erfahrung, insbesondere mit Kindern und Tieren, oder durch Berichte von Kollegen und Freunden.
Die Arzneimittel der hier vorgestellten Methoden sollen auf «feinstofflicher Ebene» eine Schwingung oder Information beinhalten, die nicht primär körperlich, sondern vor allem auf Geist und Seele wirkt. Der durch diese Information gesetzte Heilimpuls soll die Selbstheilungskräfte anregen. Da die Komplementärmedizin keine «chemischen Stoffe» einsetze, die dem Körper ihre Wirkung aufzwingen, sondern solche, die einen natürlichen Prozess anstossen, sei die Behandlung genauer abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten, sagen die Befürworter der sanften Methoden. Komplementärmedizin, sagen sie, behandle den Mensch seelisch und körperlich in seiner Ganzheit; ausserdem sammelten sich keine belastenden Rückstände im Körper an. Nebenwirkungen treten in der Regel keine auf, abgesehen von einer allfälligen Erstverschlimmerung, die als Effektivität der Behandlung gedeutet wird.
Interessant ist die Risikowahrnehmung von Patienten und Medizinern. So zeigte eine norwegische Studie aus dem Jahr 2015, dass Nutzer von Komplementärmedizin die konventionelle Medizin aufgrund eigener Erfahrungen mit schwerwiegenden Nebenwirkungen als potenziell risikobehaftet einschätzten. Die Komplementärmedizin hingegen wurde als sicher und natürlich wahrgenommen. Ärzte ohne Erfahrung in Komplementärmedizin hingegen schätzten die alternativen Methoden aufgrund der fehlenden wissenschaftlichen Evidenz zu Nutzen und Sicherheit als risikoreich ein. Die befragten Ärzte sahen ein Risiko auch darin, dass Nutzer von Komplementärmedizin eine dringend nötige konventionelle Behandlung verzögern oder ganz ablehnen könnten. Für sie sind Bachblüten und Co. keine Alternativen, sondern höchstens Ergänzungen zu wissenschaftlich begründeten Methoden der Medizin.
Vor allem harmlosere und unproblematische Erkrankungen lassen sich aber durchaus gut ausschliesslich mit Globuli und Co. behandeln. Doch welche Methode eignet sich für was und für wen? Im Folgenden erfahren Sie mehr über Homöopathie, Spagyrik und Bachblüten, über deren Philosophien und Wirkungsweisen sowie die Anwendungsmöglichkeiten und ihre Grenzen.

Der deutsche Apotheker und Arzt Samuel Hahnemann (1755–1843) entdeckte Ende des 18. Jahrhunderts, dass die gegen Malaria wirksame Chinarinde beim Menschen ähnliche Symptome hervorrief wie die Seuche selbst. Daraufhin entwickelte er die Homöopathie, die auf dem Ähnlichkeits- oder Simileprinzip beruht: «similia similibus curentur» («Ähnliches möge durch Ähnliches geheilt werden»). Für die Behandlung eines Kranken wird demnach eine Arznei benötigt, die beim Gesunden ähnliche Beschwerden auslöst. Die tatsächliche Erkrankung wird durch eine künstlich erzeugte Erkrankung «überlagert», was die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert.
Die Heilmittel werden aus Pflanzen, Mineralien und tierischen Substanzen gewonnen. Diese werden verdünnt und geschüttelt («dynamisiert» respektive «potenziert»). Danach wird ein neutraler Träger (meist Zuckergranulat) mit dem potenzierten Heilmittel getränkt. Homöopathische Mittel gibt es aber auch in Form von Tabletten und Tropfen.
Das Potenzieren ist eines der Fundamente der Homöopathie. Dazu wird die Urtinktur stark verdünnt und geschüttelt. Eine C1-Potenz (hundertfach verdünnt) entsteht zum Beispiel, indem man einen Tropfen der Urtinktur mit 99 Tropfen einer Alkohol-Wasser-Lösung mischt und auf eine spezielle, ritualisierte Weise schüttelt: das Fläschchen mit den 100 Tropfen schlägt man zehnmal kräftig auf eine elastische Unterlage. Nimmt man nun 1 Tropfen der C1-Potenz und verdünnt diesen mit 99 Tropfen Alkohol-Wasser-Lösung und schüttelt die Mischung wiederum zehnmal, erhält man eine C2-Potenz (zehntausendfach verdünnt). Wiederholt man diesen Vorgang insgesamt 30 Mal, erhält man eine C30-Potenz (decillionfach verdünnt) usw. Die Herstellung hoher Potenzstufen ist mit einem grossen Zeitaufwand verbunden.
Tiefpotenzen unterhalb C2 können noch Arzneisubstanzen in einer Menge enthalten, die pharmakologische Wirkungen entfalten kann. Sie sind teilweise rezeptpflichtig. Oberhalb von C3 bis C4 sind pharmakologische Wirkungen nach heutigem Wissenstand nicht mehr möglich, obwohl noch Arzneisubstanzen vorhanden sind. Ab C12 (quadrillionfach verdünnt) –der sogenannten Avogadogrenze – ist mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Wirkstoffmolekül mehr enthalten. Homöopathen gehen davon aus, dass dann nur noch die Information des Heilmittels wirkt.
Rund tausend homöopathische Mittel stehen zur Verfügung. Sie werden zur Behandlung von Alltagsbeschwerden ebenso wie bei chronischen Erkrankungen eingesetzt. Bei akuten Erkrankungen helfen sie aber nur, wenn der Körper noch über eine ausreichende Reaktionsfähigkeit verfügt. Gute Erfahrungen mit Homöopathie wurden unter anderem gemacht bei Schlafstörungen, Ängsten und Depressionen, Migräne, Menstruationsstörungen, Asthma, Allergien, Ekzemen und auch bei zu hohem oder zu niedrigem Blutdruck. Entzündliche Erkrankungen ohne Organveränderungen wie Nasennebenhöhleninfekte, Blasenentzündungen oder entzündliche Darmerkrankungen werden ebenfalls homöopathisch behandelt. Mit viel Eigenverantwortung des Patienten seien auch Arteriosklerose, Diabetes und Fettsucht homöopathisch behandelbar, sagen erfahrene Homöopathen. Grundsätzlich haben der Lebensstil sowie die persönliche Einstellung und Psyche des Patienten einen wesentlichen Einfluss auf den Heilerfolg. Dies gilt indes nicht nur für die Homöopathie und andere naturheilkundliche Methoden, sondern auch für die Methoden der Schulmedizin.
Kritik: Eine Metastudie von der Universität Bern (2005), wo 110 Homöopathie-Studien ausgewertet wurden, konnte keinen Unterschied zwischen einer Behandlung mit Placebo und einer Behandlung mit Globuli feststellen. Kritiker vermuten, dass die eingehende Anamnese und die intensive Beziehung zwischen Patient und Homöopath der ausschlaggebende Faktor für den Therapieerfolg sein könnte. Schon Thure von Uexküll, der Begründer der Psychosomatik, bezeichnete den Arzt als «das am häufigsten verwendete Medikament».
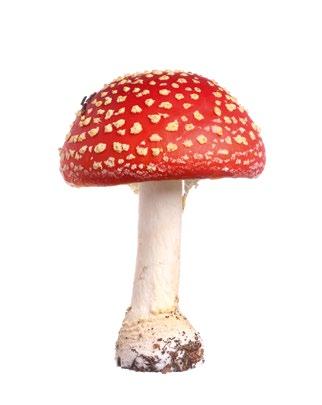
Spagyrik (aus dem Griechischen spao «(heraus-) ziehen, trennen» und ageiro «vereinigen, zusammenführen») ist ein altes, ganzheitliches Naturheilverfahren. Es soll den Körper mithilfe von speziell verarbeiteten Heilpflanzen zur Selbstheilung anregen. Die Wirkstoffe der Spagyrik werden ausschliesslich aus Pflanzen gewonnen und sind daher zu 100 % natürliche Arzneimittel. Durch die vielen einzelnen Wirkstoffe ist es möglich, für jeden Patienten eine individuelle und auf ihn zugeschnittene Mischung zu kreieren. Spagyrische Mittel haben keine Nebenwirkungen und sind gut verträglich, auch für Kinder und Tiere.
Das älteste Herstellungsverfahren ist dasjenige nach Carl-Friedrich Zimpel (1801–1879). Er entwickelte auf Basis der Alchemie die Aufbereitung pflanzlicher, mineralischer und tierischer Substanzen. Ein anderer berühmter Spagyriker war Alexander von Bernus (1880–1965), ein Freund und Anhänger Rudolf Steiners und der Okkultistin Helena Petrovna Blavatsky.
Samuel Hahnemann
«Organon der Heilkunst. Neufassung mit Systematik und Glossar von Josef M. Schmidt», Urban & Fischer Verlag 2014, ca. Fr. 40.–
Markus Wiesenauer, Suzann Kirschner-Brouns «Homöopathie – Das grosse Handbuch», Gräfe und Unzer Verlag 2007, ca. Fr. 450.–
Für spagyrische Essenzen werden ausschliesslich Heilpflanzen verwendet. Die Herstellung ist aufwendig: handverlesene, gereinigte und zerkleinerte Heilpflanzen werden zunächst vergoren, damit sich Giftstoffe abbauen und nur die heilenden Substanzen der Pflanzen übrig bleiben. Danach destilliert man die Flüssigkeit (Maische); die Destillate trennt man in Fraktionen auf. Die verbleibenden festen Pflanzenteile werden zu Asche verbrannt; aus dieser löst man die Mineralsalze der Pflanze heraus. Zum Schluss werden diese mit den Destillaten wieder zusammengefügt – so erhält man die sogenannten Urtinkturen. Diese enthalten gemäss spagyrischem Verständnis die kräftigsten Pflanzensubstanzen in veredelter Form und sollen heilkräftiger sein als die Heilpflanzen selbst.
Spagyrische Essenzen gibt es als Tropfen, Sprays, Salben und als Einzel- oder Komplexmittel. Sie werden ebenso als eigenständige wie auch als begleitende Therapie eingesetzt, etwa zur Organstärkung und Entgiftung. Angewendet werden sie bei einer Vielzahl von chronischen und akuten Erkrankungen, etwa bei Aphten, Erkältungen, Heuschnupfen, Halsschmerzen, Unruhe und Nervosität, Wechseljahr- und Menstruations beschwerden sowie Prostata- und Magen-Darm-Beschwerden. Auch Infekte im Bereich der Nasennebenhöhlen und Harnwege sollen gut damit behandelt werden können. Bei herkömmlichen Therapien oder Antibiotika-Einsatz können spagyrische Mittel Nebenwirkungen mindern. Durch das individuelle Zusammenmischen und das sehr breite Sortiment können auch Spezialfälle behandelt werden, etwa die Angst vor Spinnen oder, bei Tieren, jene vor Feuerwerk.
Kritik: Die Wirksamkeit von Spagyrik ist wissenschaftlich nicht belegt. Viele schreiben ihr «nur»den Placebo-Effekt zu. Erfahrungsmediziner hingegen sind von einer darüber hinausgehenden Wirkung überzeugt.

Vor 80 Jahren entwickelte der englische Arzt, Bakteriologe und Homöopath Edward Bach (1886–1936) die Bachblütentherapie. Die Theorie ist, dass die in Blüten gebundene Energie eine regulierende Wirkung auf psychische Zustände von Menschen habe. Mittels Bachblüten soll die Seele harmonisiert und eine Entfaltung und Stabilität der Persönlichkeit erreicht werden. Körperliche Beschwerden, so war Bach überzeugt, sind Ausdruck einer Disharmonie im Körper
und vor allem seelischen Ursprungs. Seines Erachtens ist Krankheit «im Wesentlichen das Ergebnis eines Konflikts zwischen Seele und Verstand». Bach fand in Wales 37 Pflanzen mit einer «höheren Schwingung». Für jeden Seelenzustand des Menschen sei eine seiner Blütenessenzen hilfreich. Eine Kombination aus fünf Einzelessenzen soll als Notfallmedikament bei seelischen Krisen helfen («RescueTropfen»).
Um die Seeleninformationen (Essenz) der Pflanze aus ihrem physischen Körper, der Blüte, zu lösen, kommt entweder die Sonnen- oder die Kochmethode zur Anwendung. Erstere wird bei den im Frühjahr und Sommer blühenden Pflanzen genutzt: Die Blüten werden in reines Wasser gelegt und einige Stunden in der Sonne stehen gelassen; das «Blütenwasser» wird danach mit etwas Alkohol haltbar gemacht. Diese Muttertinktur liefert die Basis der Vorratsflaschen.
Bei der Kochmethode werden Blüten von Bäumen und Sträuchern verwendet, die blühen, wenn die Sonne nicht ihre volle Stärke erreicht, also im frühen Frühjahr, späten Spätjahr oder im Winter. Hier werden die Blüten möglichst nahe des Standorts, an dem sie gediehen sind, eine halbe Stunde lang in wenig Wasser gekocht und danach mehrfach gefiltert. Der Wasserauszug wird mit einer gleich grossen Menge Alkohol versetzt und schliesslich im Verhältnis 1 : 240 mit Wasser verdünnt.
Bachblüten werden meist begleitend zu anderen Therapien angewandt, etwa bei der Behandlung akuter und chronischer Erkrankungen. Dabei können sie den Heilungsprozess fördern. Alleine angewandt bieten die Bachblüten Hilfe für den Alltag, etwa bei Einschlafbeschwerden, Prüfungsangst und anderen Sorgen. Es gibt fertige Mischungen wie die «RescueTropfen» für Ängste und Notfallsituationen oder die «Rescue-Nacht-Tropfen» für das Einschlafen.
Kritik: Eine feinstoffliche Schwingung von Blüten, die auf das Wasser übertragen werden, ist nach wissenschaftlichen Kriterien nicht nachweisbar. Mehrere Studien haben keine bessere Wirksamkeit der Bachblüten gezeigt als Placebo. Und: Die Einteilung aller Leiden in 38 Gemütszustände habe moralisierenden Charakter, sei willkürlich und unbegründet, urteilt Edzard Ernst, emeritierter Professor für Alternativmedizin an der englischen Universität Exeter. Die Pflanzenauswahl Edward Bachs sei zufällig und lasse sich ebenso wenig wie die rituelle Herstellung wissenschaftlich begründen. Nach einem Urteil des Hamburger Oberlandesgerichts gelten Bachblüten-Präparate mangels «hinreichend nachweisbarer pharmakologischer Wirkung» nicht als Arznei-, sondern als Lebensmittel. //

Die ersten spriessenden Knospen kündigen endlich den Frühling an. Doch nicht alle freut das: Rund 20 Prozent aller Schweizer reagieren mit Heuschnupfen auf den Pollenflug. Dagegen gibt es natürliche Hilfen.
Text: Anja Huber
Es juckt und kribbelt in den Haaren, die Augen tränen, die Nase läuft, Niesattacken suchen einen heim, man fühlt sich dumpf und schlapp. Alle Jahre wieder leiden rund 1,2 Millionen Menschen in der Schweiz unter einer Pollenallergie (Pollinosis). Und immer mehr Menschen sind betroffen. Der wahrscheinliche Grund: unser moderner Lebensstil. Das viele drinnen Sitzen und die ungesunde, zu üppige Ernährung schwächen unser Immunsystem. Doch auch das Klima steht unter Verdacht: Mit der Erwärmung finden neue Pollen den Weg zu uns, wo sie sich mit Feinstaub, Mikroplastik und Mikrogummi vermengen. Nicht zuletzt produzieren Pflanzen unter Umweltstress nachgewiesenermassen aggressivere Pollen – und die treffen auf durch Dauerstress geschwächte menschliche Immunsysteme. Und so reagieren immer mehr Menschen allergisch auf an sich harmlose Pollen. Heuschnupfen ist mittlerweile die häufigste Allergie in Europa, gefolgt von allergischem Asthma. Das kommt nicht von ungefähr.
Die Leiden sind hausgemacht: Wir leben übertrieben sauber, gleichzeitig nehmen die Umweltbelastungen zu. Weil sich unser Immunsystem kaum mehr mit krankmachenden Keimen auseinandersetzen muss, stürzt sich die Körperabwehr auf Harmloses, so postuliert es die sogenannte «Hygiene-Hypothese». Sie wird u. a. durch die berühmte «Bauernhof-Studie» gestützt: Demnach leiden Kinder, die auf Bauernhöfen aufwachsen, viel seltener unter Heuschnupfen und allergischem Asthma als andere Kinder. Die Forscher schreiben der mikrobiellen Auseinandersetzung mit Dreck, Staub und Pollen im Kuhstall eine wichtige Rolle beim Schutz vor Allergien zu. Das ist besonders interessant für Kinder, deren Eltern selbst Allergiker sind. Denn als gesichert gilt, dass Allergien auch erblich bedingt sind: Leiden beide Eltern unter einer Allergie, steigt das Erkrankungsrisiko für deren Kinder auf 80 Prozent. Ist nur ein Elternteil Allergiker, liegt das Risiko bei 50 Prozent.
heuschnupfen | gesund werden
Auch die Luftverschmutzung trägt zur Zunahme von Allergien bei: Forscher der Technischen Universität München konnten zeigen, dass Pollen und andere eiweisshaltige Partikel in der Luft durch Stickoxide und Ozon derart verändert werden, dass sie leichter Allergien hervorrufen können. Stickoxide und Ozon sind Komponenten des verkehrsbedingten Sommersmogs. Auch in der Schweiz wird darüber geforscht: «Unsere Studien haben gezeigt, dass die Schadstoffbelastung ein zusätzlicher Reizfaktor für das kindliche Asthma ist und sich die Symptome verschlechtern», sagt Charlotte Braun-Fahrländer, Professorin für Epidemiologie und Public Health am Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut in Basel. Sie leitet die vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) implementierte SCARPOL-Studie über Luftschadstoffbelastung und Atemwegserkrankungen bei Kindern.
Die Schulmedizin hat Allergien bislang wenig entgegenzusetzen: Kortison oder Antihistaminika können lediglich kurzfristig die Symptome lindern, haben jedoch teilweise heftige Nebenwirkungen. Einzige Therapie, die bei der Ursache bestimmter Allergien ansetzt, ist eine «Hyposensibilisierung», auch «Spezifische Immuntherapie» genannt. Sie wird bei Heuschnupfen und allergischem Asthma eingesetzt, ebenso bei Allergien gegen Hausstaub, Tierhaare, Pilzsporen und Insektengift. Dabei wird das Allergen in steigender Dosis alle paar Wochen unter die Haut gespritzt (subkutane Immuntherapie, SCIT) oder täglich eingenommen (sublinguale Immuntherapie, SLIT). Das Immunsystem gewöhnt sich so allmählich an den reizenden Stoff. Bestenfalls verschwindet die Allergie ganz. Allerdings sollte eine Hyposensibilisierung gegen Heuschnupfen in der pollenfreien Zeit gestartet werden, also im Herbst, und es braucht Geduld: Sie dauert meist drei bis fünf Jahre.
Für eine Hyposensibilisierung ist es jetzt zu spät. Die Pollen von Bäumen, Sträuchern und Gräsern fliegen längst. Schon im Februar, wenn Hasel und Erle ausschlagen, geht es los. Von Mai bis Juli bereiten dann vor allem Gräserblüten Probleme. Die Blüte eines einzigen Grashalms enthält rund vier Millionen Blütenpollen! Erst ab September ist mit einer gewissen Entspannung zu rechnen. Doch bis in den Oktober hinein sind Brennnessel, Spitzwegerich und die hoch allergene Beifuss-Ambrosie immer noch aktiv. Eine lange Leidenszeit für Betroffene – vor allem, wenn sie auf mehrere Pollen allergisch reagieren.
Den Pollen entkommen
Der beste natürliche Schutz gegen Pollen ist, sie möglichst zu meiden. Ein Blick in die Tageszeitung oder auf eine Pollen-App hilft abzuschätzen, ob aktuell viele allergieauslösende Pollen in der Luft sind (siehe dazu auch S. 48). Ist der Pollenflug besonders stark, bleiben Betroffene am besten drinnen. Bei Autofahrten schützen spezielle Luftfilter vor dem Eindringen der Pollen. Vor dem Zubettgehen sollte man die Haare waschen, denn dort setzen sich die feinen Pollen besonders gut fest. Dasselbe gilt für Kleider, diese also nie im Schlafzimmer ablegen, sondern bis zur Wäsche am besten luftdicht verstauen und sie während der Pollensaison nicht im Freien trocknen. Das Bettzeug sollte öfters gewechselt werden, ist doch ein erholsamer Schlaf entscheidend für Gesundheit und Wohlbefinden.
Um die Nasenschleimhäute von Pollen zu säubern, kann man Salzspülungen durchführen; dafür gibt es spezielle «Nasenduschen». Auch ein Dampfbad mit Kochsalzlösung oder Meerwasser-Nasensprays lindern den Juckreiz in der Nase. Generell sollte man viel Wasser trinken, um die Schleimhäute feucht zu halten und so diese natürliche «Pollenbarriere» zu stärken.
Wer besonders Probleme mit den Augen hat, sollte in der Allergiesaison bei Aufenthalten im Freien eine grosse Brille tragen. Auf Kontaktlinsen verzichtet man am besten. Jucken die Augen dennoch, hilft es, sie mit Wasser zu spülen. Auch ein kalt-feuchter Lappen auf den Augen lindert den Juckreiz.
Endlich wieder einmal entspannt durchatmen – das gelingt dank kluger Freizeitplanung: in den Bergen, in Höhlen und am Meer ist die Pollenbelastung deutlich geringer.
Die Raumluft rein halten Richtiges Lüften ist für Heuschnupfen-Geplagte eine Herausforderung. Denn während ihrer Leidenszeit sollten sie dann lüften, wenn am wenigsten Pollen in der Luft schweben. Dies ist je nach Wohnort unterschiedlich: In der Stadt ist die Pollenkonzentration meist abends am höchsten. Hier also am besten morgens nach dem Aufstehen kräftig lüften und die Fenster abends und nachts geschlossen halten. Auf dem Land hingegen ist der Pollenflug meist morgens am

Bei plötzlichem und heftigem Auftreten der typischen Symptome, insbesondere aber bei Anschwellen der Zunge, Schluckbeschwerden, Atemnot, Schwindel und Schwächegefühl sowie bei Herz-Kreislauf-Problemen und grossflächigem Ausschlag sollte man sofort den Notarzt (144) rufen. Denn schwere Reaktionen können in einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock münden.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass weltweit rund jeder vierte bis fünfte Mensch unter Heuschnupfen leidet. In der Schweiz sind rund drei Millionen Menschen Allergiker, eine Million davon leiden an Heuschnupfen. Das verursacht Kosten von einer Milliarde Franken pro Jahr, etwa für berufliche Fehltage und Krankenkassenleistungen. In der Regel übernehmen die Krankenkassen die Kosten für Allergietests und Hyposensibilisierungen sowie für verschreibungspflichtige Medikamente. Anders sieht es oft bei alternativmedizinischen Behandlungen aus, ausser man hat eine entsprechende Zusatzversicherung. Auch die Kosten für freiverkäufliche Heilmittel werden meist nicht übernommen. Aber: Nachfragen lohnt sich.

MeteoSchweiz leistet mit der Echtzeiterfassung von Pollen Pionierarbeit. Gleichzeitig sind die Allergiker aufgerufen, ihre Daten zur Verfügung zu stellen – auch zum eigenen Nutzen. Ihre Symptome können sie auf der gratis App «Ally Science» eingeben. Die anonymisierten Daten fliessen in die schweizweit grösste Pollenstudie, die das Universitätsspital Zürich gemeinsam mit der Berner Fachhochschule durchführt. Die Studie soll helfen, eine Plattform für Umweltepidemiologie sowie Pollen-Frühwarnsystem aufzubauen. Teil davon ist auch MeteoSchweiz, das gerade daran ist, ein automatisches Echtzeit-Pollenmessnetz für die ganze Schweiz aufzubauen. Damit wird die Schweiz zur Pionierin in Sachen Pollenwarnsystem. Die Daten von MeteoSchweiz sollen mit der «Ally Science»-App verknüpft und für die Patientenberatung benutzt werden können. www.allyscience.ch
intensivsten. Deswegen sollten Betroffene hier erst kurz vor dem Zubettgehen für Durchzug sorgen. Pollenschutzgitter können die Pollen zusätzlich aus der Wohnung fernhalten. Zudem ist während der Heizperiode auf angemessene Luftbefeuchtung zu achten, damit die Schleimhäute widerstandsfähiger sind.
Ein ideales Raumklima fördert also Wohlbefinden und Gesundheit. Doch «frische Luft» ist heute nicht mehr selbstverständlich: Gut 40 Prozent der Schweizer Bevölkerung –rund drei Millionen Menschen – leben in dicht besiedelten Gebieten oder an stark befahrenen Strassen. Sie atmen regelmässig gesundheitsschädigenden Feinstaub ein. Wer sich daheim eine Feinstaub- und Pollen-freie Zone schaffen möchte, kann dies mit modernen Lüftungssystemen erreichen: «Schon unsere Standardfilter halten bis zu 95 Prozent der Pollen ab», erklärt Peter Mamie, Leiter der Zehnder Academy in Gränichen (AG), die auf komfortable Wohnraumlüftungen spezialisiert ist. «Aus unserer Erfahrung reicht das bei 99 Prozent der Allergiker schon aus, um daheim frei von Symptomen zu sein. Aber man muss das von Fall zu Fall anschauen, um massgeschneiderte Lösungen zu schaffen.» Durch weitere Filter lasse sich ein nahezu hundertprozentiger Schutz vor Feinstaub und Pollen erreichen. Ausserdem ermöglichten moderne Lüftungssysteme mit Feuchterückgewinnung eine angenehme Luftfeuchtigkeit in Innenräumen und trage so zu einer guten Raumluftqualität und zum Wohlbefinden der Bewohner bei.
Ganzheitliche Hilfe erfordert Geduld
Wer alternativmedizinische Hilfe sucht, dem sei insbesondere die Akupunktur empfohlen. Zuerst aber sollte man den Körper entgiften. Denn toxische Metalle im Körper wie Amalgam haben einen negativen Einfluss auf unser Immunsystem und können allergische Symptome befeuern. Dasselbe gilt für unausgewogene Ernährung, Vitalstoffmangel und chronischen Stress. So reichen komplementärmedizinische Therapien denn auch von Schwermetall-
Ausleitung über Ernährungsberatung und Entspannungsübungen bis hin zu einer Sanierung des Darm-Milieus. Auch Bioresonanz-Therapie und Homöopathie können hilfreich sein. Dabei achte man stets auf die seriöse Zertifizierung der Therapeuten.
Geduld brauchen Patienten allerdings auch bei solcherlei Behandlungen: Bis erste Therapieerfolge spürbar sind, vergehen mindestens zwei Monate. Nach zwei bis drei Saisons Behandlung sind dann aber rund 70 Prozent der Heuschnupfen-Patienten symptomfrei.
Wer erstmal sich selbst Linderung verschaffen möchte, kann es mit Homöopathie versuchen. Zwar gelingen Erfolge mit dieser Heilkunst am besten, wenn sie von einem erfahrenen Homöopathen angeleitet wird – gerade wenn man das Leiden nicht nur symptomatisch behandeln will. Doch Selbstversuche mit geringen Potenzen (z. B. D 6 oder D12) können sich als chemiefreie Alternative zu Kortison oder Antihistaminika durchaus lohnen. Euphrasia (Augentrost) etwa hilft bei tränenden Augen; Sinapis nigra (Schwarzer Senf) lindert Niesreiz und Apis (Honigbiene) wirkt Schleimhautschwellungen entgegen. Cinnabaris (Zinnober) wiederum unterstützt die Schleimlösung und Luffa operculata (Kürbisschwämmchen) lindert Schnupfen. Gegen Heuschnupfen-Symptome im Allgemeinen hat sich Galphimia glauca (Kleiner Goldregen) bewährt. Insbesondere in Tiefpotenzen (z. B. D 6) angewandt, sei dessen Wirkung mit der von herkömmlichen Antihistaminika vergleichbar, berichtet die deutsche Carstens-Stiftung, die Naturheilkunde und Homöopathie wissenschaftlich erforscht. Optimal sei es, die Einnahme der Homöopathika sechs bis acht Wochen vor Beginn «seiner» Pollenflug-Saison zu starten. So stünden die Chancen nicht schlecht, den Frühling und Sommer unbeschwert zu geniessen. //
●
● Aruna M. Siewert «Natürliche Anti-Allergika. Schnell symptomfrei mit Supermitteln aus der Natur », GU 2020, ca. Fr. 20.–
● Simone Philipp «Alternative Therapien bei Allergien. Asthma, Heuschnupfen, Unverträglichkeiten, Neurodermitis uvm. », Freya 2020, ca. Fr. 26.–
● Links
● Alles Wissenswerte rund um Allergien erhalten Betroffene bei der Stiftung aha! Allergiezentrum Schweiz in Bern. aha!infoline: 031 359 90 50, E-Mail: info@aha.ch, www.aha.ch
● Pollen-Prognose für die Schweiz: www.pollenundallergie.ch oder www.meteoschweiz.ch. Hilfreich ist auch die App «Pollen-News» der Stiftung aha!.
● Die Schadstoff-Belastung der Aussenluft kann abgefragt werden beim Bundesamt für Umwelt (Bafu): http://www.bafu.admin.ch/
● Ausführliche Informationen zum Thema komfortable und gesunde Wohnraumlüftung findet man bei der Zehnder Group Schweiz AG. www.zehnder-systems.ch
«L iebe ist das Erleben des anderen in der eigenen Seele», schrieb Rudolf Steiner. Für mich ist dies eine der schönsten Aussagen, die ich über die Liebe gehört habe. Ja, dafür leben wir! Diese völlige Öffnung für einen anderen Menschen – um die zu finden, reisen wir um die ganze Welt. Aber was geschieht da? Wann erleben wir einen anderen Menschen tatsächlich in unserer Seele?
E s sind oft stille Momente, fernab des Alltags, wo wir solches erleben, zum Beispiel unter dem Sternenhimmel oder auf einem Berggipfel. Die geliebte Person muss dafür nicht unbedingt anwesend sein. Allein der Gedanke an sie, an ihre Stimme, ihren Gang, ihren Blick «erinnert» uns, dringt in unser Inneres, erzeugt ein Glühen, eine Süsse, ein Verlangen der Seele. Ich habe einen bärenstarken Kerl erlebt, der schluchzend sein Auto rechts ran fuhr, weil ihn die Stimme einer Sängerin im Radio so tief berührt hatte.
D as ist Liebe? Oh ja! Das ist ein Aspekt der Liebe. Wir haben in solch einem Moment die Schönheit eines anderen Menschen wirklich gesehen. Und vor dieser Schönheit stehen wir oft hilflos da. Wir möchten ihr irgendwie dienen, ihr nah sein. Denn wir haben in ihr den Himmel entdeckt. Den Himmel auf Erden. Und dann ist dieser Himmel wieder weg. Ganz plötzlich hat uns die Erde wieder. Wir sind wieder «vernünftig» und sagen: Ich war blind vor Liebe. Ich habe gar nicht gesehen, wer dieser Mensch wirklich ist. Wie langweilig, alltäglich, normal. Ich habe projiziert, aber jetzt bin ich wieder vernünftig.
A ll denen, die so denken, möchte ich zurufen: Nein, ihr wart nicht blind! Ihr wart zum ersten Mal sehend. Mit den Augen der Liebe habt ihr beim anderen die Wahrheit gesehen. Alle anderen sind blind, aber nicht die Liebenden. Mit den Augen der Liebe sehen wir den Menschen wirklich – jenseits von all den Kompromissen, Enttäuschungen oder sonstigen Verkrümmungen,
« Liebe ist das Erleben des anderen in der eigenen Seele. »
Rudolf Steiner
die wir alle in diesem unperfekten Leben durchlaufen haben. Mit den Augen der Liebe sehen wir an- und ineinander einen Himmel, den es tatsächlich gibt. Doch wir haben nicht gelernt, in diesem Himmel zu leben. Wir haben nicht gelernt, ihn auf die Erde zu holen.
H immlische Momente der Liebe sind ein Geschenk. Auch in den allerbesten Beziehungen sind sie nicht von Dauer. Und dann kommt unsere eigentliche Aufgabe: Dem, was wir mit den Augen der Liebe gesehen haben, treu zu bleiben. Auch wenn der oder die Geliebte mit mir streitet, vorwurfsvoll, alltäglich, gewöhnlich oder dumm ist. Es gilt: die eigentliche Schönheit, die wir einmal im Anderen gesehen haben, im eigenen Inneren zu bewahren und immer wieder zu erinnern und wecken. Das ist für mich die zweite Stufe der Liebe. Sie besteht in den tausend kleinen, täglichen Entscheidungen, in Gesprächen, in der Versöhnung, im Neuanfang und darin, etwas von Herzen für den anderen zu tun, ohne jegliche Erwartung.
D ie Sehnsucht nach den Himmelsmomenten aber bleibt. Was können wir dafür tun? Mein Vorschlag: Üben wir es. Heute. Und morgen. So viel und so oft wir können. Wo immer wir können, mit jedem, der uns vor die Nase kommt. Es kann die Busfahrerin sein, die wir nicht mehr nur als Ausübende einer Funktion wahrnehmen, sondern als Frau, als liebenswürdiger Mensch. Oder die Kollegen, den Kellner, die Frau, die mir gerade den Parkplatz vor der Nase weggeschnappt hat. Oder auch der langjährige Partner. Jeder einzelne Mensch trägt diese Schönheit in sich, die nur mit den Augen der Liebe sichtbar wird. Entdecken Sie diese Schönheit! Wenn es beim Kellner nicht gelingt, versuchen Sie es bei der Busfahrerin. Und stellen Sie sich für einen Moment vor, wie die Welt aussehen würde, wenn sich alle Menschen gegenseitig so wahrnehmen. Arbeiten wir daran! Damit wir endlich den Himmel auf Erden verwirklichen. //

● Leila Dregger ist Journalistin und Buchautorin (u. a. «Frau-Sein allein genügt nicht», Edition Zeitpunkt). Sie begeistert sich für gemeinschaftliche Lebensformen und lebt seit 16 Jahren in Tamera, Portugal, wo sie beim Verlag Meiga und der Globalen Liebesschule mitarbeitet.
offeriert von omida.ch

Die Pollensaison steht vor der Tür !
Allergische Reaktionen durch die verschiedensten Pflanzenpollen sind leider sehr häufig und belastend.
Der Erfolg bei der Vorbeugung und bei der Behandlung von Pollen-Allergie mit Dr. Schüssler Salzen ist oft verblüffend.
Das Schüssler «Allergie-Trio» mit den Salzen Nr. 2, 6 und 10 drängt sich für die Vorbeugung geradezu auf. Sinnvollerweise nimmt man diese drei Schüssler-Salze schon zwei bis drei Monate vor dem Beginn der Beschwerden. Dabei wirkt das Salz Nr. 2 Calcium phosphoricum ähnlich wie «Kalzium» antiallergisch, die Nr. 6 Kalium sulfuricum unterstützt den Zellstoffwechsel und den Zellschutz und die Nr. 10 Natrium sulfuricum entlastet das Immunsystem. Je zehn Tabletten einmal täglich in einem Glas Wasser werden zur Vorbeugung empfohlen. Bei bekannten starken Reaktionen kann das Trio mit dem Salz Nr. 23 Natrium bicarbonicum und mit der Nr. 24 Arsenum jodatum zusätzlich unterstützt werden.
Das «Allergie-Trio» kann übrigens bei allen Arten von Allergien eingesetzt werden.
Ist die Nase bereits am Laufen oder tränen die Augen, lassen sich die akuten Beschwerden mit der Nr. 3 Ferrum phosphoricum und der Nr. 8 Natrium chloratum lindern. Je zehn Tabletten in einem halben Glas Wasser mehrmals täglich trinken.
Dr. Schüssler Salze sind nebenwirkungsfrei und können problemlos mit anderen Medikamenten kombiniert werden, zum Beispiel mit Antiallergika, wenn die Symptome besonders stark sind.
Mehr Infos zu den
Dr. Schüssler Salzen finden Sie unter www.schuesslerwissen.ch

Heilpflanzensäfte bieten eine einfache und wirkungsvolle Möglichkeit, um fit und gesund ins Frühjahr zu starten. Frischpflanzenpresssäfte sind besonders wirkungsvoll, um den Stoffwechsel anzuregen und den Körper mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen, da hier alle Inhaltsstoffe der Pflanze enthalten sind, darunter Alkaloide, Gerb- und Bitterstoffe sowie ätherische Öle. Ausserdem eignet sich eine Kur mit Heilpflanzensäften auch prima zur Unterstützung einer Diät.
Frischpflanzenpresssäfte kann man pur oder als Mischung in Apotheken und Reformhäusern kaufen. Man nimmt sie am besten zweimal täglich über mehrere Wochen ein. Um die Ausscheidung und Entschlackung zu fördern, sollte zusätzlich viel Wasser oder Tee getrunken werden. Folgende Pflanzensäfte sind besonders empfehlenswert:
Artischockensaft
Bewährtes Mittel zur Anregung der Leber- und Gallentätigkeit sowie zur Senkung des Cholesterinspiegels. Regt zudem den Fettstoffwechsel an.
Birkensaft
Lindert Harnwegsinfekte und rheumatische Beschwerden. Wegen seiner «durchspülenden» Wirkung besonders gut geeignet für eine Frühjahrskur.
Brennnesselsaft
Der Saft aus Kraut und Wurzel hilft gegen (Frühjahrs-)Müdigkeit und Stress. Zudem sorgt er für eine reine, glatte Haut.
Brunnenkressesaft
Reinigt das Blut und wirkt anregend auf Verdauungsdrüsen, Darm, Leber und Galle. Das enthaltene Jod regt zudem den Grundumsatz an, das Vitamin C stärkt die Abwehr.
Löwenzahnsaft
Ist (vor allem in Kombination mit Sellerie- und Brennnesselsaft) besonders geeignet für eine Ausscheidungs- und Entschlackungskur. Die Bitterstoffe regen Leber, Galle, Magen und Bauchspeicheldrüse an.
Zinnkrautsaft
Enthält besonders viel pflanzliche Kieselsäure. Diese entwässert und kräftigt die Körperstruktur, strafft die Haut und kräftigt Haare und Nägel. Ausserdem regt Zinnkraut die Nierentätigkeit an. MM
●

Vergangenen Monat hatte ich wieder einmal die Möglichkeit, das Kunstmuseum Alte Pinakothek in München zu besuchen. Unter seinen Schätzen ist es das Selbstbildnis von Albrecht Dürer, das mich immer wieder fasziniert. Er malte es um 1500, zu Beginn der Neuzeit. Dürer wagte es, sich selbst zu porträtieren, wie man davor nur Christus darstellte. In selbstbewusster Pose, von Angesicht zu Angesicht mit dem Betrachter, scheint er diesen mit scharfem Blick herauszufordern. Der Pose entspricht seine Inschrift: «Ich, Albrecht Dürer».
Persönliche Freiheit und Selbstbewusstsein ist für die Philosophie und die Kunst der Neuzeit ein zentrales Thema. Freiheit als wesentliche menschliche Gegebenheit – und immer wieder auch als Aufgabe. In diesem Sinn war Ignatius von Loyola (1491–1556), Ordensgründer der Jesuiten, der Zeit ebenfalls weit voraus. Für ihn war es selbstverständlich, dass jede und jeder von uns seinen je eigenen Lebensweg finden kann und finden muss. Und so versucht er mit bestimmten Übungen und Anleitungen, den Einzelnen auf seinem Weg zu begleiten. Gleich zu Beginn seiner geistlichen Übungen lädt Ignatius uns ein, das Leben in innerer Freiheit Revue passieren zu lassen. Der Mensch solle dabei weder Gesundheit noch Krankheit, weder Armut noch Reichtum, weder Erfolg noch Scheitern vorziehen. Also weder das eine noch das andere bevorzugen.
Dies ist erklärungsbedürftig. Sicher ist Ignatius nicht weltfremd gewesen. Die Gesundheit seiner Ordensmitglieder war ihm ein hohes Gut. Er scheute keine Arztkosten und liess Landhäuser errichten, die
Kurse im Lassalle-Haus
Bewegte und bewegende
Bilder
Filme mit anderen Augen sehen
6. bis 8. März Fr. 18.30–So. 13.30 Uhr
Frühlingsfasten
Gesundheitlich bewusst, spirituell motiviert, sozial engagiert
15. bis 29. März
29. März bis 5. April
So. 17–So. 9 Uhr
Alleluia – gregorianische Gesänge
Die Freude am Singen wiederentdecken
27. bis 29. März
Fr. 18.30–So. 13.30 Uhr
Nada-Yoga Die heilende Kraft der eigenen Stimme 3. bis 5. April Fr. 18.30–So. 13.30 Uhr
Infos und Anmeldung : Telefon 041 757 14 14 info@lassalle-haus.org www.lassalle-haus.org
den Jesuiten als Erholung dienen. Gesundheit und in der Folge auch Anerkennung und Erfolg sind für ihn durchaus erstrebenswert. Doch je nach Lebenssituation kann uns auch einmal Krankheit oder Scheitern zugemutet werden. Da braucht es Einsicht darin, was wir ändern können, aber auch was wir tragen oder ertragen müssen. Und es braucht die Weitsicht, den langen Atem, um durch Krisen hindurch sein Lebensziel nicht aus den Augen zu verlieren.
Auch in Managementtheorien steht das Thema der Freiheit in Zentrum. Otto Scharmer etwa, Dozent an der renommierten Universität MIT in Boston, hebt in seiner Theorie hervor, dass die Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft so rasant sind, dass wir nicht einfach Vergangenes reproduzieren oder wiederholen können. Es braucht die Freiheit, Überkommenes loszulassen, um neue Antworten und Ideen zu finden. Wir sind viel zu sehr versucht, von Problemen oder Aufgaben, die wir antreffen, eine gerade Linie zur Lösung zu ziehen. Pragmatisch. Mit vertrauten Lösungsansätzen. Doch mit solch einer Vorgehensweise werden wir kaum einen Schritt vorankommen, so Scharmer. Zunächst einmal gilt es, Altbekanntes loszulassen, um den Schreibtisch und den Kopf frei zu bekommen und sich auf die Zukunft auszurichten. Wir sind eingeladen als einzelne, aber auch als Team, uns mit all unseren Sinnen für die Zukunft zu öffnen.
Wo tun sich für mich neue Türen auf? Wo wird es nicht eng, sondern im Gegenteil: Wo weitet sich der Weg? Fragen wie diese sind wichtig. Denn mit einer Vision, die mich beflügelt, kann ich auch steinige Wege unter die Füsse nehmen.

Das Lassalle-Haus in Edlibach ist ein von Jesuiten geführtes interreligiöses, spirituelles Zentrum mit einem breiten Kursangebot, das von Zen-Meditation über Naturseminare bis zu klassischen Exerzitien reicht. Für «natürlich» schreiben der Jesuit Tobias Karcher und die Pfarrerin Noa Zenger abwechselnd die Kolumne Gedankensplitter».
* Tobias Karcher (58) ist Jesuit und Direktor des LassalleHauses Bad Schönbrunn, Bildungszentrum der Jesuiten in Edlibach im Kanton Zug.

gewusst
Nicht nur zu wenig, sondern auch zu viel Schlaf ist problematisch: Wer im Durchschnitt mehr als neun Stunden schläft, hat ein grösseres Risiko, an Herz-Kreislauf-Krankheiten zu sterben. Auch Diabetes und Depressionen treten häufiger auf, wenn man lange schläft. Allerdings variiert der Schlafbedarf von Mensch zu Mensch stark. krea
Abfallvermeidung
Bienenwachstücher liegen im Trend. Sie vermeiden Müll und sind eine sinnvolle Alter native zu Alu- oder Frischhaltefolie, um Lebensmittel einzuwickeln oder Speisen abzudecken. Doch im Umgang mit den wachsgetränkten Tüchern aus Baumwollstoff gibt es einiges zu beachten. So dürfen die Tücher nur mit lauwarmem Wasser gereinigt werden, nicht mit heissem, da sonst die Wachsschicht schmilzt. Und dann bestünde ein Hygienerisiko, etwa wenn die Tücher in Kontakt mit keimbelasteten Lebensmitteln kommen. Für rohes Fleisch und Fisch sind Bienenwachstücher aber sowieso nicht geeignet. Allgemein gilt: Stoff und Wachs sollten frei von Pestizidrückständen sein; und bei gefärbten Stoffen ist Vorsicht angesagt. Im Zweifelsfall sollte man die Tücher nur zum Abdecken von Gefässen verwenden. Das gilt insbesondere für selbst gebastelte Bienenwachstücher. MM
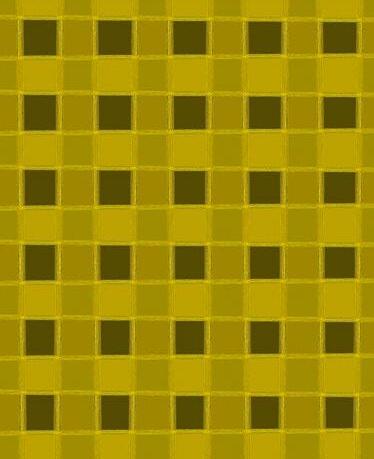

Abfallvermeidung II
Lebensmittel nicht in Alufolie packen
Alufolien und -schalen sind nicht nur für die Umwelt schlecht, sie geben auch bedenkliche Mengen Aluminium ab. Und dieses belastet den Körper stark. Das zeigt eine aktuelle Studie aus Deutschland. Das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung rät deshalb davon ab, Lebensmittel mit Alufolie einzuwickeln. Das gelte vor allem für saure, salzige und heisse Speisen. Zu viel Aluminium stört bei Kindern die Entwicklung von Hirn und Motorik und kann langfristig Nieren, Leber und Knochen schädigen. Gesundheitstipp
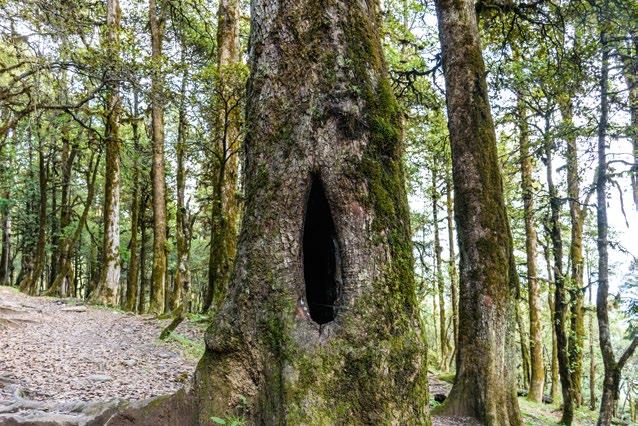
Artenvielfalt
Habitatbäume schützen
Nur die ältesten und dicksten Bäume weisen eine grosse Anzahl und Vielfalt von Mikrohabitaten auf. Zahlreiche Organismen leben darin. Darum ist es sinnvoll, Bäume zu schützen, die solche speziellen Lebensräume aufweisen. «Sogenannte Habitatbäume sind eine Schlüsselkomponente der Waldbiodiversität», schreibt die eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL. Sie seien für Tausende von spezialisierten Lebewesen unentbehrlich (siehe auch S. 66). Ein neues WSL-Merkblatt erklärt, wie man Habitatbäume erkennt, schützt und fördert. Das ergänzende PDF «Habitatbäume kennen, schützen und fördern» kann kostenlos heruntergeladen werden auf www.wsl.ch. krea
buchtipp

An ihren Rinden sollt ihr sie erkennen
Die Rinde ist für jeden Baum nicht nur überlebenswichtig, sondern zugleich ein ganzjähriges Erkennungsmerkmal. Dieses Bestimmungsbuch führt systematisch zu unseren 70 häufigsten Baumarten und stellt ihre entscheidenden Rindenmerkmale anhand von detailgetreuen Fotos vor. Zusätzlich vermittelt es viel Wissenswertes und Spannendes über die Schutz- und Versorgungsfunktion der Rinde; und es stellt die jeweiligen Baumarten mit ihren Besonderheiten ausführlich vor. Ein Gewinn sowohl für naturverbundene Laien wie für fortgeschrittene Baumkenner.
Margot Spohn, Roland Spohn «Die Rinden unserer Bäume. Die 70 häufigsten Arten entdecken, bestimmen und verstehen», Quelle & Meyer 2020, ca. Fr. 38.–
kann man statt mit Kaffeetrinken auch mit Spazierengehen. Denn wie Koffein verbessert Bewegung bestimmte Aspekte der Kognition, etwa die Aufmerksamkeit und Wachsamkeit. Laut kanadischen Forschern der University of Western Ontario entspricht diesbezüglich ein zwanzigminütiger, zügiger Spaziergang einer Tasse Kaffee. Das verbessert insbesondere das Arbeitsgedächtnis. Dieses ermöglicht es uns, Informationen vorübergehend zu speichern und später auch wieder abzurufen, also zum Beispiel Gegenstände auf einer Einkaufsliste. Die Studienautoren halten Bewegung als Mittel zur Gedächtnissteigerung für eine gute Alternative zu Koffein – insbesondere für Menschen, die keinen Kaffee vertragen oder den Konsum aus gesundheitlichen oder anderen Gründen einschränken wollen oder müssen. MM

Einfach wandern
Elektronische Wanderkarten versprechen viele Vorteile. Doch manche Apps führen einem in die Irre. Und in den Bergen gibt es oft kein Internet. Deshalb sollte die App die Möglichkeit bieten, dass man die Karte aufs Handy laden und offline nutzen kann. Nicht zuletzt ist zu bedenken, dass manche Apps viel Strom verbrauchen und Smartphones bei tiefen Temperaturen aussteigen können. Deshalb gehört eine Papierkarte trotz App in den Rucksack. Empfehlenswerte Wander-Apps sind z. B. Schweiz Mobil (Jahresabo Fr. 35.–) und Bergfex (Jahresabo ab Fr. 7,50). Für Android und iOS, Grundangebote gratis

Viele alpine Regionen haben ein Problem: In der Nebensaison gibt es hohe Leerstände und wenig Einnahmen. Das will das Projekt «Alpine Sabbatical» ändern. Mit den Langzeitaufenthalten für Sabbatical-Gäste sollen natürliche Ressourcen geschont und vorhandene Leerstände genutzt werden; zudem soll das Projekt die Weiterentwicklung sowie die Prävention und Gesundheit der Gäste fördern. In der Region Prättigau liegt dabei der Schwerpunkt auf Burnout-Prävention und Gesundheitsvorsorge. Die Surselva bietet Programme für Rentner, Berufspausierende und urbane Aussteiger an, z. B. Sprachkurse in Rätoromanisch, Alp- und Bergwaldeinsätze oder das Erlernen regionaler Handwerkstechniken. Die Idee dahinter: Mehr als bloss Tourist sein, Teil der lokalen Gemeinschaft werden und einen Beitrag zum Umweltschutz und Gemeinwohl leisten. www.alpinesabbatical.ch

Um den Frühlingsanfang sind die Planeten Mars, Jupiter und Saturn am Morgenhimmel recht auffällig, da sie sich ziemlich nahe kommen und dann einige Wochen lang in der Morgendämmerung ihre Stellungen wechseln: Zuerst kommt es am 20. März zur Begegnung von Mars und Jupiter; wenige Tage später kommen sich Mars und Saturn näher. Am 31. März und 1. April stehen sie sich am nächsten. Für den besonderen Anblick dieses Planetentrios ist ein tiefer Horizont im Südosten ebenso Voraussetzung wie frühes Aufstehen.
Die Helligkeit der Planeten am Morgenhimmel täuscht allerdings gewaltig: Obwohl Jupiter und Saturn von diesem Trio am hellsten leuchten, sind sie am weitesten von der Erde entfernt. Es sind jedoch die grössten Planeten unseres Sonnensystems, und dementsprechend haben sie eine grosse Leuchtkraft. Jupiter ist etwa elfmal, Saturn etwa neunmal grösser als die Erde. Diese beiden Planeten werden auch « Gasriesen » genannt, da ihr Hauptanteil aus einer mächtigen Atmosphäre besteht und sie wahrscheinlich keine feste Oberfläche haben. Der erdähnliche Mars hingegen, er steht uns von diesem Planetentrio am nächsten, hat eine feste Oberfläche. Er ist nur etwa halb so gross wie die Erde und dementsprechend leuchtschwach. Andreas Walker
Elektrosmog
22 Krebsforscher und Biologen aus 13 Ländern werfen dem führenden Elektrosmog-Experten des Bundes, Prof. Martin Röösli, «wissenschaftliches Fehlverhalten» und «Interessenkonflikte» vor. In einem offenen Brief fordern sie Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga auf, in Erwägung zu ziehen, ihn «von seinen Aufgaben als objektiver Experte auf dem Gebiet gesundheitlicher Auswirkungen von Hochfrequenzstrahlung und elektromagne tischen Feldern zu entbinden». Die Begründung: Weder Laien noch Politiker könnten sich in der komplexen wissenschaftlichen Diskussion rund um das Thema Elektrosmog ein eigenes zuverlässiges Bild der Sachlage machen. Deshalb seien Experten wie Martin Röösli so entscheidend. Und deshalb sei es auch so wichtig, dass bei Experten in öffentlichem Auftrag «keine derart offensichtlichen Interessenkonflikte oder Voreingenommenheit bestehen, wie es bei Martin Röösli der Fall ist», schreiben die Wissenschaftler in ihrem Brief. zeitpunkt.ch
Das Klima und der Wald
Holzlieferant, Sehnsuchtsort, Sorgenkind und Hoffnungsträger in Zeiten des Klimawandels – der Wald hat viele Facetten. Und facettenreich sind die Wälder unserer Erde – von den Nadelwäldern des hohen Nordens bis zu den Regenwäldern der Tropen: Dieser Band vereinigt sie alle. Er ist nicht nur eine Augenweide, sondern zeigt auch die komplexen Zusammenhänge zwischen Wald, Natur und Klima auf. Leider kann sich der Autor der Klimahysterie nicht verweigern. So ist für ihn z. B. der Wolf nicht mehr bloss ein faszinierendes Raubtier, das, wie jedes andere Lebewesen, einfach so seine Lebensberechtigung hat, sondern der Wolf gilt neuerdings vor allem als «Klimaschützer». Denn er jagt ja schliesslich klimaschädliche Elche . Auch wenn man nicht immer die Meinung des Autors teilt: Dem Biologen ist ein sehr schöner und vor allem auch lehrreicher Bild-Text-Band gelungen.
Gunther Willinger «Wälder unserer Erde. Wie das Klima den Wald formt», teNeues 2019, ca. Fr. 70.–
buchtipp


Wenn die Strahlen der Sonne oder des Mondes durch eine dünne Wolkenschicht mit gleichmässig grossen Wassertröpfchen scheinen, entstehen durch die Beugung des Lichts farbige Ringe um Sonne oder Mond. Besonders schöne Beugungserscheinungen entstehen, wenn die Wolkentröpfchen eine bestimmte Grösse haben und gleichmässig verteilt sind. Daraus entstehen Erscheinungen wie die Farbkränze (Halos oder Koronas). Je nach Grösse der Wolkentröpfchen verändert sich der Radius der einzelnen Ringe. Besonders schön erscheinen die farbigen Ringe bei gleicher Tropfengrösse.
Je weiter sie von der Lichtquelle entfernt sind, desto schwächer werden sie. Je kleiner die Wolkentröpfchen, desto grösser die Kränze. Wenn die Tropfen gleichmässig gross sind, sind die Kränze schön geformt und weisen klare Farben auf. Die schönsten Farbkränze sieht man vor allem um den ziemlich vollen Mond, obwohl die Erscheinung rein von der Wahrscheinlichkeit her weit häufiger um die Sonne zu beobachten wäre. Das Sonnenlicht ist jedoch so grell, dass die Farbenpracht dieser Kränze in der blendenden Lichtflut untergeht. Betrachtet man jedoch das Umfeld der Sonne mit einer Sonnenbrille oder als Spiegelbild in einer stillen Wasseroberfläche, werden die Farben wieder sichtbar.
Andreas Walker

Die ersten warmen Frühlingstage und die überwinterten
Frühjahrsblüher erfreuen unser Herz. Wenn der Boden trocken ist und einige schöne Tage angesagt sind, lassen wir alles stehen und liegen und geben uns voll der Gartenarbeit hin.
Text: Frances Vetter
Für unsere Grosseltern war es noch selbstverständlich, im Garten auch ein grosses Gemüsebeet anzulegen. Später wurden insbesondere Schrebergärtner eher belächelt. Doch das hat sich in den letzten Jahren grundlegend geändert. Wir haben eine regelrechte Renaissance des privaten Gemüsegartens erlebt. Kein Wunder: Gesunde Ernährung und das Achten auf qualitativ hochwertige Produkte veranlassen immer mehr junge Menschen, zumindest einen Teil des benötigten Gemüses, Kräuter und Obst selbst anzubauen. Moderne Eltern möchten ihren Kindern zeigen, wo das Essen herkommt und was es braucht, bis ein Salatkopf oder Erdbeeren in der Küche landen. Knackige Karotten, zarte Frühkartoffeln und verschiedenfarbige Tomaten frisch aus dem Beet geerntet – für viele bedeutet der eigene Gemüsegarten ein grosses Stück Lebensqualität.
Erste Frühlingsarbeiten
Im Frühling gibt es für Gärtner viel zu tun. Die ersten Beikräuter spriessen; die
meisten kommen weg, manche lassen wir aber auch bewusst stehen. Denn viele sogenannte Unkräuter sind bei näherer Betrachtung nicht nur wunderbare Bienen-, sondern auch prächtige Augenweiden. Gehölze und Rosen müssen geschnitten, zu gross gewordene Stauden geteilt und Beete abgeräumt werden. Danach bringen wir Dünger und Kompost auf den Beeten aus und erneuern die Rinden- und anderen Mulchschichten.
Dann sind die Gemüsebeete soweit vorbereitet. Aber Geduld ist gefragt: Bodenfrost sollte nicht mehr vorhanden sein, will man direkt in den Garten aussäen. Spinat, Salat und Radieschen gehören zu den ersten Gemüsepflanzen, die wir im Frühbeet aussäen. Gleichzeitig ziehen wir einige Pflanzen im Gewächshaus vor. So können wir sie beizeiten in den Garten setzen, sobald keine Frostgefahr mehr besteht.
Der März bietet sich an, um Gehölze zu vermehren. Kräftige Äste von Liguster, Forsythien, Buchsbaum und Weiden stellen wir zur Wurzelbildung in Wasser-
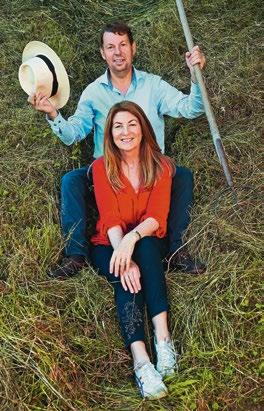
* Frances und Remo Vetter sind als freischaffende Gartengestalter, Referenten und Buchautoren unterwegs.
Nutzgarten
● Bei günstiger Witterung den Gartenboden für die Kulturen vorbereiten: Kompost und Mist einarbeiten, Unkraut jäten, Gründüngung säen.
● Auf vorbereitete, abgetrocknete Beete Spinat, Puffbohnen, Kefen, Mark- und Auskernerbsen säen sowie Steckzwiebeln und Knoblauch stecken.
● In milden Lagen Karotten, Radieschen, Rettiche und Kohlrabi säen.
● Im frostfreien Gewächshaus oder Zimmer-Treibhaus gibt es viel zu säen, z. B. Auberginen, Kohlarten, Paprika, Tomaten sowie Salate, Lauch und Zwiebeln.
● Kräuter umpflanzen, teilen und säen, z. B. Schnittlauch und Petersilie.
● Auf der Fensterbank Kresse und Sprossen ziehen (siehe «natürlich» 01/02-20).
● An frostfreien Tagen Beerensträucher auslichten.
Ziergarten
● Winterschutz entfernen und dürre Staudengräser bis zum Boden zurückschneiden. Der Winterschnitt ist jetzt, vor dem grossen Austreiben, abzuschliessen.
● Frostverträgliche Sommerblumen direkt in frisch gelockerte und gejätete Erde säen, z. B. Mohn, Phacelia, Liebeshain-, Korn-, Spiegelei- und Ringelblumen.
● Im frostfreien Gewächshaus oder Zimmertreibhaus weiter aussäen, z. B. DuftWicken, Impatiens, Leberbalsam, Nelken, Petunien, Salbei, Sonnenhut und Verbenen.
● Manche mehrjährigen Stauden wie Kokardenblume, Mädchenauge, oder Stockrosen und Bartnelken blühen bereits im ersten Sommer, wenn sie jetzt gesät werden.
● Kaltkeimer, z. B. Edelweiss, Eisenhut, Enzian, Küchenschelle oder Trollblumen, säen.
● Lücken im Garten und in Kübeln auf dem Balkon mit Frühlingsblühern, Gehölzen und Stauden bepflanzen.
● Balkon- und Kübelpflanzen aus dem Winterquartier holen, zurückschneiden, umtopfen und kühl sowie hell aufstellen.


gefässe ein. Die überwinterten Fuchsien und Geranien müssen stark zurückgeschnitten werden, bevor wir sie in neue Erde pflanzen. Ins Freie kommen sie aber erst nach den Eisheiligen.
Rasen oder Naturwiese?
Wer seinen Rasen liebt, der pflegt ihn, besagt ein Sprichwort. Bereits bei der Planung und dem Anlegen der Rasenfläche gibt es einiges zu beachten. Regelmässiges Mähen und Düngen des Rasens ist notwendig. Auch das Befreien von Unkraut gehört dazu. Die relativ zeitintensive Pflege ist unerlässlich, um auch nach Jahren noch Freude an grünen, dichten Rasenflächen haben zu können. Als Alternative zu kurz gestutzten Rasen und von uns bevorzugt, hat eine verhältnismässig pflegeleichte Naturwiese ihren ganz besonderen Reiz. Wir finden, zumindest ein Teil der Gartenfläche sollte den Insekten zuliebe als Naturwiese verbleiben, denn nektarreiche Wildblumen sorgen dafür, dass sich Bestäuber wie Bienen, Hummeln und Schwebefliegen sowie andere nützliche Insekten im Garten niederlassen. Ein grosser Insektenbestand ist beim Gärtnern unerlässlich. Denn so manche Insekten vertilgen Schädlinge, die Rosen und Sträucher befallen, und die umhergaukelnden, bunten Schmetterlinge erfreuen unsere Herzen.
Unkraut unter Kontrolle
Erfahrene Gärtner wissen, dass sich die Gartenpflege durch einfache Tricks enorm erleichtern lässt und die Pflegeintensität eines Gartens mit einfachen Massnahmen auf ein gesundes Mass reduziert werden kann. Zum Beispiel die Unkrautbekämpfung. Um das Wachstum der unliebsamen Begleitkräuter einzudämmen, hilft es, eine gute Schicht Rindenmulch anzubringen. Aber Achtung, nicht alle Zier- und Gartenpflanzen mögen dies, denn der Boden könnte übersäuert werden. Im Gemüsebeet empfehlen wir daher regelmässiges und «proaktives» Kratzen mit der Pendelhacke, um das Unkraut erst gar nicht aufkommen zu lassen. Ebenfalls nützlich, um lästiges Unkrautjäten zu minimieren, sind Bodendecker. Wer einen eigenen Garten unterhält, wird bisweilen auch mit ungebetenen Gästen zurechtkommen müssen. So beinhaltet die Gartenpflege auch oft das Bekämpfen von Schädlingen und Krankheiten (mehr dazu weiter unten). Das Ziel jedes Gärtners sollte es jedoch aus unserer Sicht immer sein, möglichst schonende und umweltverträgliche Schädlingsbekämpfungsmethoden anzuwenden, um Nützlinge im Garten nicht zu gefährden. Denn vom Regenwurm über den Schmetterling bis zum Igel – nützliche Gartentiere und Helfer
leisten einen wesentlichen Beitrag zu einem funktionierenden Ökosystem.
Das « Schwarze Gold » Abfälle entstehen in jedem Garten. Ob Laub im Herbst, alte Zweige und Äste von Bäumen und Sträuchern, Grasabfälle, oder alte und abgestorbene Pflanzen – es wäre schade, all die guten Nährstoffe zu entsorgen. Die Kompostierung von Garten- und Küchenabfällen gehört zum natürlichen Kreislauf der Vegetation. Und um es gleich vorweg zu nehmen, guter Kompost riecht nicht modrig oder unangenehm, sondern duftet nach Wald. Bei der Verwertung von Abfällen aus dem Garten und der Küche müssen jedoch einige wichtige Punkte berücksichtigt werden. Auf keinen Fall dürfen gekochte Essensreste oder Fleisch auf den Kompost, denn sie würden dort nur verfaulen und unerwünschte vierbeinige Gäste anziehen. Eine gute Durchlüftung, regelmässiges Umsetzen und genügend Feuchtigkeit sind die wichtigsten Voraussetzungen für eine gute Komposterde.
« Moderne Eltern möchten ihren Kindern zeigen, wo das Essen herkommt und was es braucht, bis ein Salatkopf oder Erdbeeren in der Küche landen. » ●
Die Düngewirkung des Komposts ist allgemein bekannt und macht sich in Form von gesundem Pflanzenwachstum bemerkbar. Auf den ersten Blick könnte man meinen, die Kompostierung wäre eine unangenehme Arbeit, bei der man mit «Abfällen» und unangenehmen Ge-
rüchen konfrontiert wird. Wer aber gelernt hat, den Wert des «Schwarzen Goldes» zu schätzen, wird mit Begeisterung seinen Kompost hegen, der ja wichtige Nährstoffe für die Pflanzen liefert.
Auch Kinder kann man für die wundersame Verwandlung vom muffigen Abfall zum duftenden Humus begeistern. Bauen Sie doch mit Ihren Kindern oder Enkeln ein kleines Kompostgestell. So können sie gemeinsam die Umwandlungsprozesse aus nächster Nähe beobachten.
Ein üppig blühender Blumen- und Gemüsegarten ist das Ziel eines jeden Gärtners. Doch nicht immer stimmen Wunsch und Wirklichkeit überein. Schuld sind oftmals ungeliebte Gäste wie Blattläuse, Werren, Wühlmäuse oder Maulwürfe. Auch Moos, Unkraut und Mehltau vermiesen so manchem die Freude am Gärtnern. Schädlinge und Krankheiten schmälern nicht nur Ernteerträge, sie lassen den Garten auch optisch weitaus weniger ansprechend wirken. Ein wichtiges Thema ist daher der Pflanzenschutz im Garten. Dieser umfasst sowohl eine gute Sortenwahl wie auch die Vorbeugung vor Schädlingen und Krankheiten durch Nützlinge und Pflanzenstärkungsmittel.

Natürlich kann man auch erst reagieren, wenn die Schädlinge oder Krankheiten schon da sind. Doch Vorbeugung ist für uns das A und O. Will man einen Befall weitgehend ausschliessen, ist eine frühzeitige Behandlung ratsam. Falsche und übertriebene Vorsichtsmassnahmen können jedoch schnell zu gegenteiligen Effekten führen. Gegen einen Befall von Schädlingen ist, wie schon erwähnt, das Fördern von Nützlingen ratsam. Marienkäfer und Ohrwürmer fressen beispielsweise mit Vorliebe Blattläuse. Oft helfen auch alte Hausmittel. Gegen leichten Läusebefall etwa wirkt ein Knoblauchsud; auch Brennnesseljauche kann helfen, ebenso eine Seifenlauge, die auf die betroffenen Blätter gesprüht wird. Je früher der Befall erkannt wird, desto besser sind die Chancen, mit solcherlei sanften Hausmitteln gute Ergebnisse zu erzielen. //
Joachim Mayer, Franz-Xaver Treml «Biodünger. Pflanzen natürlich pflegen und stärken», Kosmos 2017, ca. Fr. 23.–

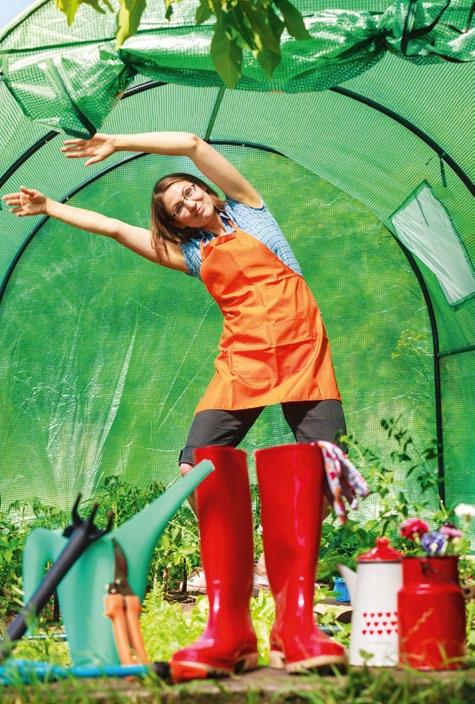
Gärtner können es kaum erwarten und stürzen sich im Frühjahr regelrecht in die Gartenarbeit. Doch Obacht, seien Sie nicht zu ungestüm: gezielte Dehnübungen vor und nach dem Pflanzen oder Umgraben können Verletzungen und Schmerzen vorbeugen.
Die Deutsch-Amerikanische Gesellschaft für Chiropraktik rät Gärtnern – ähnlich wie Sportlern – zu einem Warm-up und Cool-down vor respektive nach der Gartenarbeit. Dies könne nicht nur Verletzungen und Schmerzen vorbeugen, sondern auch bestehende Beschwerden wirksam lindern. Wichtig sei zudem die richtige Körperhaltung beim Gärtnern. Das heisst: Statt den Rücken zu beugen, lieber hinknien und Bewegungen so oft wie möglich abwechseln, um die Muskeln und den Körper im Gleichgewicht zu halten.
Folgende vier Stretching-Übungen eignen sich für Hobbygärtner besonders gut. Wichtig: Bei den Übungen langsam und rhythmisch ein- und ausatmen. Und: Den Körper nur so weit dehnen, wie es noch angenehm ist. Ein leichtes Ziehen soll man spüren, die Übungen sollten aber niemals zu schmerzhaft sein.
3. Trizeps-Dehnung
Oberschenkel-Dehnung
Strecken Sie im Stehen ein Bein nach vorne, und stützen Sie Ihre Ferse auf eine Stufe. Dann lehnen Sie sich nach vorne, bis Sie eine Dehnung in der Rückseite des Oberschenkels oder des Kniesehnenmuskels spüren. Halten Sie diese Position für 30 bis 60 Sekunden. Dann lockern. Die Übung ein weiteres Mal ausführen. Dann dasselbe mit dem anderen Bein wiederholen.
2.
« Nach dem Himmel greifen »
Strecken Sie Ihre Arme über den Kopf gerade nach oben. Verflechten Sie nun Ihre Finger ineinander. Die Handinnenflächen zeigen nach oben. Dehnen Sie sich für 15 bis 30 Sekunden zuerst zur rechten und dann zur linken Seite. Wiederholen Sie diese Übung dreimal.
4.
Stellen Sie sich aufrecht hin. Das Kinn ist leicht in Richtung Brust geneigt. Nun den rechten Arm anheben, hinter den Kopf führen und mit den Fingern die linke Schulter berühren. Platzieren Sie die Hand des anderen Arms auf den Ellbogen und ziehen Sie den rechten Arm leicht zur linken Seite, bis Sie eine Dehnung im Trizeps spüren. 30 bis 60 Sekunden halten und auf der anderen Seite wiederholen.
« Den besten Freund umarmen »
Wickeln Sie Ihre Arme um sich selbst. Drehen Sie sich nun langsam zur rechten Seite, bis Sie eine Dehnung spüren. Dabei bleibt die Wirbelsäule aufrecht. Halten Sie die Position 10 bis 20 Sekunden lang. Dann lockern und danach zur linken Seite dehnen. Wiederholen Sie die Übung zwei- bis dreimal. dagc.ch/krea

Einfach nur sein!
Auszeit in der Casa Santo Stefano Sich etwas Gutes tun, abschalten und Ruhe finden in gepflegter Einfachheit und historischem Ambiente.
Eine Auswahl aus unserem Kursprogramm 2020
8.3.–14.3. Fasten und Yogawoche 14.3.–20.3. Fasten und Yogawoche 22.3.–27.3. Yoga und Wanderferien 27.3.–29.3. DetoxYogaweekend
29.3.–4.4. Fasten und Yogawoche 18.4.–24.4. Yoga und Wanderferien 9.5.–10.5. Wildkräuterkurs
10.5.–15.5. Yoga und Pilates 24.5.–28.5. Yogaretreat 28.5.–1.6. Yoga und Hike an Pfingsten Infos und weitere Ferienangebote: Casa Santo Stefano, Miglieglia Telefon 091 609 19 35 www.casa-santo-stefano.ch

Weiterbildung
Lehrgang Elektrobiologie
Start der Ausbildung: 28./29.April 2020. Lehrstoffe: Energieverläufe, Elektrosmog, elektrische und elektromagnetische Felder, Messungen im Innen und Aussenbereich, Handystrahlen 5 G, erfolgreiche Abschirmungen vornehmen können, was ist die Gefahr für unsere Gesundheit? Erholsamer Schlaf ! Was bedeutet das alles für unser Lebenselixier Wasser? Und was bedeutet es für unser Körperwasser? Entscheidende Zusammenhänge naturwissenschaftlich auf dem neusten Stand erklärt.
Telefon 041 914 11 00 www.spini.ch
Weiterbildung
IIPB Institut für Integrative Psychologie
Das IIPB bietet Fortbildungen, Vorträge und Kurse an, aktuell mit folgenden Themen: Stressmanagement, Lernen durch Beziehungen, Arbeit mit Träumen, Psychologie und Spiritualität, Systeme der Psychologie. Alle Angebote haben einen ganzheitlichen Ansatz und sind lösungs und ressourcenorientiert.
Neu im Programm: Stressmanagement und Stärkung des Selbst. Stress führt oft zu Überforderung, Angst, Erschöpfung oder Krankheit. Dieser Kurs versucht Lösungen dazu aufzuzeigen. Er soll helfen, mögliche Ressourcen zu erschliessen und Strategien für einen gesundheitsförderlichen Umgang mit «Stress» kennen zu lernen.
Leitung: Barbara Henke MA. Weitere Infos: www.iipb.ch

Die Trommel ruft Wolfgang Fasser pflegt seit 1981 eine intensive Verbindung zu Lesotho in Südafrika und ist ein erfahrener Kenner der traditionellen Medizin des kleinen Bergkönigreiches. Dieses Seminar gibt Einblick in Praktiken, Denkweisen und Philosophie des südafrikanischen Schamanismus der Matuela Tradition. Der Dozent baut Brücken zu unseren westlich orientierten Heilsystemen und zeigt indigene Wege zur Ganzheitserfahrung auf.
Workshop:
So. 8. 3. und Mo. 9. 3. 2020, 9 bis 17 Uhr
Infos und Anmeldung unter Telefon 043 499 92 82
NHK Institut, Militärstrasse 90, Zürich
www.nhk.ch/campus/alle-startdaten

Mein Stern im Osten
Die alten Kulturen legten grössten Wert auf den Stern im Osten, der zur Geburtszeit seinen Aufgang hatte. Sie waren überzeugt, dass seine Symbolik viel über den Menschen aussagt. Die Mythologie und Symbolik von 40 Sternen am Himmelsäquator werden vorgestellt. Welches ist mein Stern des Anfangs? Die Antwort kann für uns eine Sternstunde sein, denn « jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben ».
Workshop: Fr. 27. 3. 2020 9 bis 17 Uhr Infos und Anmeldung unter Telefon 043 499 92 82 NHK Institut, Militärstrasse 90, Zürich www.nhk.ch/campus/alle-startdaten

Lebenskraft 2020
Vom 26. bis 29. März findet in der Messe Zürich die « Lebenskraft 2020 » statt. Die Messe für Bewusstsein, Gesundheit und Heilung lässt Sie in die Welt des achtsamen Bewusstseins eintauchen mit transformierende Workshops und vielen wertvollen Hinweisen für Gesundheit, Körper, Geist und Seele. Rund 150 Ausstellende mit ihren eigenen Begleitprogrammen mit rund 100 kostenfreien Veranstaltungen geben Ihnen neue Impulse für ein ganzheitliches Leben.
Mehr Infos und Öffnungszeiten www.lebenskraft.ch
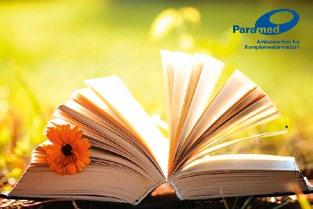
Diagnostik Parcours
Zungen-, Puls-, Irisdiagnose und Dunkelfeldmikroskopie
Lernen Sie verschiedene Diagnostikmöglichkeiten der Europäischen Naturheilkunde TEN und der Traditionellen Chinesischen Medizin TCM kennen. Eine Kurzdiagnostik mit Erklärung dauert ca. 15 Minuten. Machen Sie den Parcours am 18. März von 13 bis 17 Uhr bei der Paramed, Haldenstrasse 1, 6340 Baar. Eintritt frei. Anmeldung erbeten:
Telefon 032 626 31 26 oder
E-Mail: events@paramed.ch www.paramed.ch
Weitere Daten: 24. 6., 23. 9., 11. 11. 2020

Auszeit und Fasten
Wo Sie statt Meerblick mehr Blick haben
Im Kurhaus St. Otmar blicken Sie aus dem Fenster und sehen mehr als Meer. Ihre Augen schweifen über ein Postkartenpanorama. Bewusst wahrnehmen, weil Fasten Ihre Sinne schärft. Bewusst erleben, weil Sie Zeit haben zum Sein. Bewusst entspannen, weil wir für Ihr Wohl sorgen. Fastenwochen sind Balsam. Für Körper und Seele. Fastenkuren im St. Otmar – Ihre persönliche Mehrzeit.
Kurhaus St. Otmar, Weggis
Maya und Beat Bachmann-Krapf
Telefon 041 390 30 01
info@kurhaus-st-otmar.ch www.kurhaus-st-otmar.ch

Wohltuend
Juckreiz? Ausschlag? Allergie?
Hautbeschwerden wie allergische Ausschläge sind unangenehm. Die OMIDA Cardiospermum-Creme wirkt juckreizstillend und entzündungshemmend. Die fettarme Creme eignet sich auch zur Behandlung von Neurodermitis. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. www.omida.ch
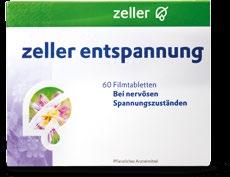
Nervös und angespannt?
In Phasen erhöhter Belastung kann der Körper mit Nervosität oder Anspannung reagieren. zeller entspannung enthält Passionsblume, Baldrian, Melisse und Pestwurz, wirkt beruhigend, lindert Nervosität und Unruhezustände. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. www.zellerag.ch

Für die Frau
Wechseljahre:
Du entscheidest! cimifemin® neo lindert zuverlässig Hitzewallungen ohne östrogene Wirkung. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. www.zellerag.ch
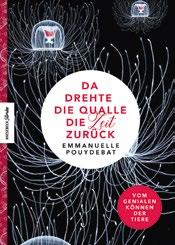
Aufruf zum Staunen
Die Tierwelt ist voller Wunder, Magie und Kuriositäten. Wussten Sie zum Beispiel, dass Insekten Blumen pflücken, Quallen sich verjüngen und tote Frösche wieder auferstehen können? 36 aussergewöhnliche Tiere aus aller Welt werden in diesem kunstvoll gestalteten Buch vorgestellt. So kurze wie kurzweilige Geschichten erzählen anhand neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse über ihre oft unerklärlichen und immer staunenswerten Fähigkeiten. Emmanuelle Pouydebat «Da drehte die Qualle die Zeit zurück», Knesebeck 2019, ca. Fr. 38.–


Aufbauend
Gestresst? Müde?
Formag ist ein gut verträgliches Magnesium aus dem Toten Meer, mit Vitamin B6 und Taurin. Erhältlich als Tabletten oder neu als Stick mit natürlichem Orangenaroma und für Kinder mit natürlichem Erdbeeraroma. Magnesium und Vitamin B6 tragen zu einer normalen Funktion des Nervensystems und zur Verringerung von Müdigkeit bei. Taurin und Vitamin B6 fördern die Aufnahme und Retention von Magnesium im Körper. Erhältliche in Apotheken und Drogerien. www.phytolis.ch
Lösung des Rätsels aus dem Heft 01/02-2020
Gesucht war: Umarmung
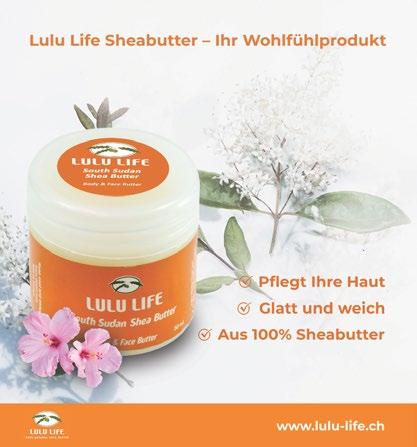
Wir offerieren dieses Geschenkset an 5 Personen:
Gewinnen Sie:
1 Geschenkset mit afrikanischem Stoffmuster von Lulu Life gefüllt mit je 1 x Körper Gesichtscrème, Körperpeeling, Badesalz, Lippenbalsam und Körperseife. Duftnote Wahl. Gesamtwert Fr. 45.70.
Wir offerieren dieses Geschenkset an 5 Personen:
Gewinnen Sie:
Vorname Name
Strasse PLZ / Ort
Lösung
Und so spielen Sie mit:
Senden Sie den Talon mit der Lösung und Ihrer Adresse an: CH Regionalmedien AG, «natürlich», Neumattstrasse 1, 5001 Aarau. Schneller gehts via Internet: www.natuerlich-online.ch/raetsel
Teilnahmebedingungen:
Einsendeschluss ist der 23. März 2020. Die Gewinner werden direkt benachrichtigt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Über diese Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Gewinnen Sie!
1 Geschenkset mit afrikanischem Stoffmuster von Lulu Life gefüllt Gesichtscrème, Körperpeeling, Badesalz, Lippenbalsam und Körperseife. Wahl. Gesamtwert Fr. 45.70.


5 × ein Geschenkset mit afrikanischem Stoffmuster, gefüllt mit Wohlfühlprodukten von Lulu Life im Wert von je Fr. 45.70.
führung

Pflanzen auf Scheinen
Pflanzen sind seit jeher eng mit dem Menschen verbunden. Ohne Pflanzen würden wir gar nicht existieren. Und so verwundert es nicht, dass es Pflanzen in vielen Ländern auf Banknoten geschafft haben. Die Acker-Kratzdistel zum Beispiel ist auf zahlreichen Münzen Grossbritanniens zu finden. Welche Pflanzen sonst noch Münzen und Banknoten zieren, erfährt man an der kostenlosen Führung «Ohne Moos nix los» im Botanischen Garten Bern.
Ohne Moos nix los Mittwoch, 18. März von 18–19 Uhr Sonntag, 22. März von 14–15 Uhr Infos unter www.boga.unibe.ch
buchvernissage

Ist der Baum im Traum ein Baum oder ein Traum?
Mit «Dazwischen» hat der Ethiker Thomas Gröbly aus Baden (AG) seinen zweiten Gedichtband veröffentlicht. Seine Texte kreisen um die grossen Themen wie Leben, Leiden, Tod und Liebe. Gröbly durchleuchtet unsere Beziehungen zu Menschen und Tieren, zur Natur und zum bedrohten Planeten Erde – mal ernst, mal witzig, mal sarkastisch oder absurd, aber immer liebevoll. Die Vernissage wird umrahmt vom bekannten Jazzmusiker Tony Renold am Schlagzeug.
Trommelpoesie und Lesung
ThiK – Theater im Kornhaus Baden
Sonntag 1. März, 17 Uhr www.thik.ch
Weitere Termine:
Sonntag 8. März, 17 Uhr, Kulturstall Biohof Fondli, Dietikon
Sonntag 22. März, 17 Uhr, Filmbäckerei Rüti ZH
Sonntag 3. Mai, 15 Uhr, Hof Narr Hinteregg
Freitag 29. Mai, 19.15 Uhr, Kulturhaus Odeon Brugg Buchbestellung und weitere Informationen unter: www.ethik-labor.ch/aktuelles
treffen

Das Leben ist ganzheitlich «netzwerkeins» ist ein Projekt mit der Idee, Menschen zusammenzubringen, die sich für eine zeitgemässe, reflektierte Spiritualität, für persönliche Weiterentwicklung und für verantwortungsvolles Handeln in Alltag und Gesellschaft interessieren. Eine Möglichkeit mehr darüber zu erfahren, sind die integralen Impuls-Abende. Zwei Stunden wird dabei ein Thema von den verschiedensten Seiten beleuchtet; es werden Sichtweisen und Gedanken ausgetauscht zu den Themen Umwelt, Zusammenleben, Spiritualität, Philosophie und Bewusstsein.
Integrale impuls-Abende
Jeden 1. Mittwoch im Monat 19.30–21.30 Uhr. Nächster Termin: 4. März zum Thema: «Kann Wissenschaft moralische Werte bestimmen?»
SELA Zentrum, Köniz (BE), www.sela.info Weitere Informationen unter www.netzwerkeins.ch
ausstellung

Fakten rund ums Ei
Frisch geschlüpfte Bibeli und Brutkästen: Das Naturmuseum St. Gallen widmet dem Ei erneut eine Ausstellung. Die Küken sind die Hauptattraktion der detailreichen Schau, die sich speziell an Kinder richtet und entsprechend konzipiert ist. Sie erfahren auch einiges über kuriose Tiere wie Schnabeltier und Schnabeligel. Es sind die einzigen Säugetiere auf der Welt, die Eier legen. Speziell ist auch, wie Schnabeltiere ihren Nachwuchs säugen: Die Weibchen «schwitzen» die Milch aus der Haut, die Jungen schlecken sie dann gierig ab.
Sonderausstellung «Allerlei rund ums Ei» Naturmuseum St. Gallen
17. März bis 10. Mai 2020
Weitere Infos unter www.naturmuseumsg.ch
Bewusst gesund leben
40. Jahrgang 2020, ISSN 2234-9103
Erscheint 10-mal jährlich
Druckauflage: 22 000 Exemplare
Verbreitete Auflage: 16 672 Exemplare
(WEMF/KS beglaubigt 2019)
Leserschaft: 94 000 (MACH Basic 2019-2)
Kontakt: Alle Mitarbeiter erreichen Sie unter vorname.name@chmedia.ch www.natuerlich-online.ch
Herausgeber und Verlag
CH Regionalmedien AG, Neumattstrasse 1
CH-5001 Aarau
Tel. +41 58 200 58 58, Fax +41 58 200 56 61
Geschäftsführer Publishing
Jürg Weber
Geschäftsführer Fachmedien
Thomas Walliser
Verlagsleitung
Michael Sprecher
Redaktionsadresse «natürlich»
Postfach, CH-5001 Aarau
Tel. +41 58 200 56 50, Fax +41 58 200 56 44
Chefredaktor
Markus Kellenberger
Redaktionsteam
Andreas Krebs, Sabine Hurni (Leserberatung)
Autoren
Peter Andres, Leila Dregger, Anja Huber, Marion Kaden, Tobias Karcher, Fabrice Müller, Eva Rosenfelder, Lioba Schneemann, Vera Sohmer, Frances Vetter, Andreas Walker, Steven Wolf
Grafik/Layout
Janine Strebel, Joel Habermacher, Fredi Frank
Copyright Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung durch den Verlag. Für unverlangte Einsendungen wird jegliche Haftung abgelehnt.
Anzeigenleitung
Dino Coluccia, Tel. +41 58 200 56 52
Anzeigenadministration
Corinne Dätwiler, Tel. +41 58 200 56 16
Leitung Werbemarkt
Jean-Orphée Reuter, Tel. +41 58 200 54 46
Leitung Marketing
Mylena Wiser, Tel. +41 58 200 56 02
Mediadaten unter www.natuerlich-online.ch/werbung
Aboverwaltung
abo@natuerlich-online.ch
Tel. +41 58 200 55 62
Druck
Vogt-Schild Druck AG, CH-4552 Derendingen
Ein Produkt der CH Media AG
CEO: Axel Wüstmann www.chmedia.ch
Abonnieren und bewusst gesund leben
Einzelverkaufspreis Fr. 9.80
Abonnement 1 Jahr Fr. 86.–
Abonnement 2 Jahre Fr. 150.–


Schnarchen und Schlafapnoe. Wie Sie wieder ruhig durchschlafen und zu Kräften kommen. Eigenbluttherapie. Wie die Behandlung mit dem eigenen Blut funktioniert und wem sie helfen kann. Zahnspange. Kaum ein Kind kommt um den Gartenhag im Mund herum. Doch macht das überhaupt Sinn, wer profitiert davon und welche Alternativen gibt es?
Seelenklänge. Manche Instrumente berühren uns tief mit ihren Schwingungen und Tönen und wecken unsere spirituelle Sehnsucht. «natürlich» stellt drei von ihnen vor. Schoggi. Schokolade soll nicht nur glücklich machen, sondern auch aphrodisierend wirken und die Leistung und Durchblutung steigern. Wir haben den Test gemacht. Eschensterben. Und auch den Fichten geht es schlecht. Wie schlimm ist die Situation und was kann man dagegen tun?




Preise inkl. MwSt. www.natuerlich-online.ch/abo-service
«natürlich» 04-20 erscheint am 26. März 2020
Kontakt /Aboservice: Telefon 058 200 55 62 oder abo@natuerlich-online.ch, www.natuerlich-online.ch

Adrienne Frei Borkenkäfer sind faszinierend schön
Die Leidenschaft begann unverhofft. Als Adrienne Frei im Verlauf ihres Studiums als Forstingenieurin die Xylobionten, die im Holz lebenden Käfer, genauer kennenlernte, ging für sie die Tür zu einer neuen Welt auf: «Ich betrachtete einen Borkenkäfer unter der Lupe und war tief berührt von seiner Schönheit. Als ‹Forstschädling› werden Borkenkäfer beschimpft, dabei sind von den ca. 120 verschiedenen Borkenkäferarten nur ein paar wenige ungünstig für die Bäume.» Neben den Borkenkäfern gibt es in der Schweiz Hunderte andere Xylobionten. Fasziniert von deren Vielfalt und Schönheit hat sich Adrienne Frei seither den im Holz lebenden Käfern mit Haut und Haar verschrieben.
« K äfer werden übersehen oder als ‹grusig› empfunden und zertrampelt; bestenfalls werden sie als nützliches Glied in der Nahrungskette verstanden», sagt sie, «doch Käfer sind viel mehr!» Nicht nur, dass sie hochinteressant und wunderschön seien, was sich bei vielen aufgrund ihrer Winzigkeit von 0,5 Zentimetern und kleiner allerdings oft erst unter der Lupe offenbare. «Viele Käferarten sind wichtige Zeiger für den ökologischen Wert eines Waldes. Jede Baumart besitzt ihre eigene Käfergemeinschaft», weiss die gebürtige Sarnerin. «Von den knapp 6700 in der Schweiz vorkommenden bekannten Käferarten leben zirka ein Fünftel zwingend im und am Holz oder in Holzpilzen.»
Gerade diese Arten seien besonders bedroht, hätten aber absolut keine Lobby: «Nur vier von 74 Käferfamilien, deren Arten sich im und am Holz entwickeln, sind für die Rote Liste untersucht worden.»
A lt- und Totholz spielt eine zentrale Rolle nicht nur für Xylobionten, sondern auch für viele andere Insekten, für Vögel und Säugetiere wie Siebenschläfer, für Flechten, Moose und Pilze. Es brauche nicht nur liegendes Holz, sondern vor allem stehende tote Bäume, Astabbruchstellen und Baumhöhlen, erklärt Frei. Gerade die «Urwald-Reliktarten» unter den holzbewohnenden Käfern, die sich über sehr lange Zeiträume gemeinsam mit alten Bäumen entwickeln konnten, seien bedroht. «Leider gibt es immer weniger solche Biotope. Die modernen Auftragsförster haben oft keine festen Reviere mehr und sind vor allem forstwirtschaftlich orientiert.» Da fehle es an Zeit, sich um die feinen Zusammenhänge in diesem faszinierenden Mikrokosmos zu kümmern – zu beobachten und zu verstehen. «Wenn aber nur Ökonomie und Holzwert zählen, wird es schwierig für die Käfer und für viele anderen Lebewesen», sagt die 40-Jährige, deren Lebensweg sie tief in den Wald und in das Holz geführt hat. Doch es sei nicht einfach zu erklären, welchen Wert ein paar Käfer im Ökosystem haben, wenn zum Beispiel eine schöne, alte Eiche, die man fällt, ein paar Tausend Franken einbringe.
« K äfer sind sehr scheu und flink. Schon die kleinste Erschütterung lässt sie Reissaus nehmen und nicht mehr auftauchen», erklärt Frei. Meist seien die Käfer ab April/Mai, wenn es wieder wärmer wird, zunächst an son nigen Tagen um die Mittagszeit unterwegs. Dann ist auch die Käfer-Expertin mit ihren Utensilien auf der Suche nach Arten im Totholz: Sie beklopft abgestorbene Stämme und Äste, inspiziert Holzpilze und lugt unter Rindenstücke von liegenden Stämmen, wo sie die Wunder der kleinen Welt entdeckt – etwa eine seltene Nagekäferart, die an der Eichenborke hinter Spinnennetzen lebt. Oder sie lauscht den quietschenden Geräuschen, die manche Bockkäfer zwischen ihren Flügeln und dem Halsschild erzeugen. Inventarisierung von Totholzkäfern, wissenschaftliche Begleitung von Arten- und Biotopschutzkonzepten, Erstellen ökologischer Gutachten, Bewertungen und Erfolgskontrollen, aber auch Wissensvermittlung in Kursen und auf Exkursionen für Forstpersonal und naturinteressierte Menschen – das alles gehört zu den Aufgaben der freiberuflichen Fachfrau, die sich selber immer wieder Raum nimmt, um «nur» zu sein.
« Die Natur bleibt ein Geheimnis», betont sie. Nach ihrem Studium hat Frei mehrere Jahre in einer Waldspielgruppe gearbeitet; bis heute befasst sie sich intensiv mit Wildnis-Pädagogik. «Die Wildnis lehrt mich immer wieder, dass ich trotz vielen Jahren Studium niemals alles verstehen werde», sagt sie demütig. «Wir Menschen nehmen uns viel zu wichtig.»
www.adriennefrei.ch
●
Eva Rosenfelder ist Autorin/ Journalistin BR und schreibt für verschiedene Schweizer Medien. In einer fortlaufenden Serie trifft sie für «natürlich» natur-heil-kundige Menschen.