Ehrenpreis
Allheilmittel am Wegesrand

Sommergarten
Über den Zaun hinaus denken
Teigwaren
Glutenfreie
Pasta-Alternativen
Stadtgeiss
Biodiversität in unseren Städten
Schwämme
Heilsam bei Herpes und Tumoren

Ehrenpreis
Allheilmittel am Wegesrand

Sommergarten
Über den Zaun hinaus denken
Teigwaren
Glutenfreie
Pasta-Alternativen
Stadtgeiss
Biodiversität in unseren Städten
Schwämme
Heilsam bei Herpes und Tumoren
Mit Zen Lebenskrisen besser meistern

Weil es natürlich ist, der Umwelt und ihren Ressourcen Sorge zu tragen. Hier und überall auf der Welt.
Weil es richtig ist, respektvoll und achtsam mit der Natur und ihren Produkten umzugehen und nachhaltig zu handeln.
Weil es gut ist, sich selbst etwas Gutes zu tun und das Beste der Natur mit gutem Gewissen zu geniessen.

Liebe Leserin, lieber Leser
Wie geht es Ihnen nach diesen ausserordentlichen Monaten? Welche Spuren hat der Lockdown bei Ihnen hinterlassen?
In meinem Bekanntenkreis gehen die Meinungen darüber weit auseinander. Erleichterung ist bei den einen zu spüren, dass alles bald wieder «normal» ist, Bedauern bei anderen, dass bald alles wieder «normal» ist.
«Und der Mensch heisst Mensch, weil er vergisst, weil er ver drängt», singt Herbert Grönemeyer. Nun, ich hoffe sehr, dass wir nach dieser Erfahrung mit Corona nicht alles wieder vergessen und verdrängen. Insbesondere nicht, dass uns Menschen neben der Bewältigung der Pandemie noch andere grosse Aufgaben bevorstehen, die ebenfalls gelöst werden müssen – und die drängender sind als die Frage, ob wir mög lichst bald wieder am Strand liegen dürfen.

Mit dem verabschiedeten CO2-Gesetz hat unser Parlament ein Zeichen gesetzt und die Klimadebatte wieder in den Fokus gerückt. Das ist ein kleiner Schritt in eine umweltfreundli chere Zukunft, allerdings formiert sich – wir leben schliess lich in einer Demokratie – bereits auch Widerstand dagegen, dass Fliegen und Autofahren in Zukunft teurer werden sollen. Ich bin gespannt, ob sich die Klimajugend nochmals formiert und weiterhin für ihre Forderungen einsteht. Meine Unter stützung hat sie, auch wenn das bedeuten mag, dass ich des wegen meine von unbegrenzter Mobilität und ebensolchem Konsum geprägte Komfortzone verlassen muss. Denn wer vergisst und verdrängt, den holt die Wirklichkeit früher oder später wieder ein.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer voller schönen Begegnungen mit Menschen, die Sie lieben.
Herzlich, Ihr






















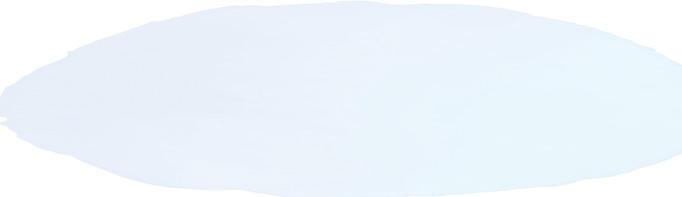







gesund werden
34 Wolfs Heilpflanze
Der Echte Ehrenpreis galt einst als «Heil aller Schäden».
38 Musik statt Pillen
10 Zen im Alltag
Zen ist populär, auch bei uns. «natürlich» erklärt, welche Lehre dahinter steht und wer von der Praxis profitiert.
14 Vitamin B12
Ein Mangel des «Nervenvitamins» kann gravierende Folgen haben. Wie man dem vorbeugt.
18 Klostermedizin
Das Heilwissen der Nonnen und Mönche in der Moderne.
22 Glutenfreie Teigwaren
Noch kein Genuss.
28 Sabine über . . . Chili & Co.
30 Leserberatung
Von Würmern im Darm und Sonnencremes auf der Haut.
Wie Töne und Frequenzen unser Leben bereichern und Körper, Geist und Seele heilen.
42 Befreit atmen
Viele Menschen atmen nur oberflächlich. Das kann zu vielerlei Problemen führen.
44 Apotheke der Meere
Naturschwämme bergen ein riesiges medizinisches Potenzial in sich – und damit die Gefahr der Ausbeutung.
draussen sein
54 Lebenswerte Städte
Warum es sich für Gärtner lohnt, über den eigenen Gartenzaun hinaus zu blicken. gesund sein
Je bunter und artenreicher eine Stadt, umso lebenswerter. Stimmt die These? Ein Augenschein in Zürich.
58 Vetter

gewusst
Wer an Osteoporose leidet, sollte sich erst recht bewegen. Besonders geeignet sind Sportarten, die die Muskeln kräftigen, aber ein kleines Risiko für Stürze haben, Wandern etwa, Pilates oder Tanzen. Betroffene sollten die Sportart wählen, die ihnen am meisten Freude bereitet. Zusätzlich sollten sie möglichst täglich Übungen machen, die Gleichgewicht und Kraft trainieren. Vieles lässt sich in den Alltag einbauen – z. B. kann man auf einem Bein stehend Zähne putzen. Das schult die Koordination, verleiht Sicherheit und stärkt Muskeln und Knochen. krea
Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind im vergangenen Jahr durch gewollte Schwangerschaftsabbrüche 42 Millionen Ungeborene getötet worden – das entspricht etwa 115 000 Abtreibungen pro Tag oder 1,33 pro Sekunde ! Damit sind Abtreibungen mit grossem Abstand die Haupttodesursache, weit vor Infektions- und Alterserkrankungen sowie Verkehrsunfällen. worldometers.info/abortions

Mundhygiene
Gegen Schmerzen und Zahnfleischschwund
Gegen entzündetes Zahnfleisch und Zahnausfall helfen elektrische Zahnbürsten besonders gut. Zu diesem Schluss kommen Forscher der Universität Greifswald (D) im «Journal of Clinical Periodontology». Um Zahnfleischschwund vorzubeugen, sollte man weiche Bürsten bevorzugen und Zahnseide benutzen. Bei Zahn- und Kieferschmerzen kann man seine Zähne mit Natriumhydrogencarbonat («Natron») putzen; das wirkt mitunter Wunder und sorgt auch gleich für eine gesunde, basische Mundflora. Gut für die Mundhygiene ist auch das allmorgendliche Ölziehen. Und auch eine gesunde, nährstoffreiche und zuckerarme Ernährung wirkt sich positiv auf Zähne und Zahnfleisch aus.
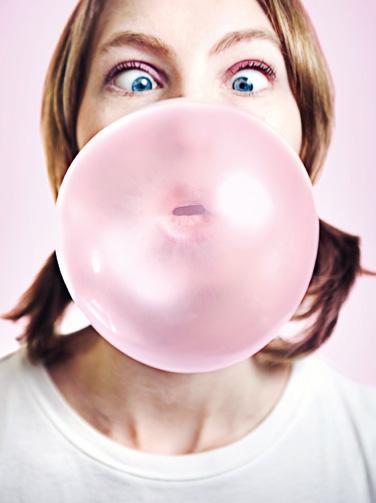
Wer oft zuckerfreie Kaugummis kaut, senkt das Risiko für Karies um fast einen Drittel. Das fanden Forscher des King’s College London heraus, die zwölf entsprechende Studien analysierten. Der vermehrte Speichelfluss vermindere den Zahnbelag, so das Fazit. Künstliche Süssstoffe wie Xylit oder Sorbitol würden zudem Bakterien abtöten. Die Kaugummis sind aber kein Ersatz für eine gute Mundhygiene. Dazu zählen Ölziehen, Zähneputzen und Zahnseide. Gesundheitstipp
Migräne
Das Üben von Achtsamkeit kann bei Migräne eine wirksame und nebenwirkungsfreie Behandlungsalternative zu Medikamenten sein. Das stellten US-Forscher von der University of Maryland School of Dentistry fest. In der Studie erhielten die Probanden entweder eine wochenlange Schulung in Achtsamkeitsbasierter Stressreduktion (MBSR) oder einen massgeschneiderten Kurs zur Stressbewältigung bei Kopfschmerzen. Die Forscher fanden heraus, dass die MBSR praktizierenden Teilnehmer im Vergleich zu denjenigen mit einer Schulung zur Stressbewältigung weniger Kopfschmerztage und Beeinträchtigungen aufwiesen. Nach Angabe der Studienautoren sind die Ergebnisse vergleichbar mit dem üblicherweise zur Migräneprophylaxe eingesetzten Wirkstoff Valproinsäure. MM

Ohne Wissen um die Gesundheit ist Glück eine Illusion. ( . . . ) Wer sich selbst gesund macht, kennt das Gesetz des Wandels. Deshalb kann er Schwierigkeiten überwinden.
Er kann Krankheit in Gesundheit verwandeln, Traurigkeit in Freude und Feind in Freund. Er ist ein freier Mensch.
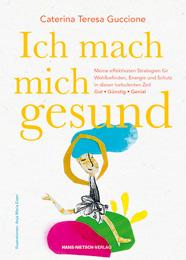
Tipps
Für Menschen, die Selbstverantwortung über ihre Gesundheit übernehmen wollen, ist dieses Buch eine schier unerschöpfliche Fundgrube. Zahlreiche bewährte und günstige Mittel und Anwendung, die sich zur Selbstbehandlung eignen, werden darin kompetent, unterhaltsam und leicht verständlich vorgestellt: von pflanzlichen Antibiotika über das geweberegenerierende DMSO, den MegaEntzündungshemmer MSM und den Sauerstoffbooster Wasserstoffperoxid bis zum Entgiftungswunder Zeolith. Ein besonderes Augenmerk legt die Autorin auf die Stärkung des Immunsystems und Aktivierung der Selbstheilungskräfte, etwa mit Bürsten, Waschen und Wippen. Mit zahlreichen Hinweisen auf Bücher, DVDs und Websites.
Caterina Teresa Guccione «Ich mach mich gesund» Hans-Nietsch-Verlag 2020, ca. Fr. 30.–

e mehr Ballaststoffe man isst, desto geringer ist das Risiko für Schlaganfälle. Dies legt eine grosse Studie von Forschern der Universität Oxford in England nahe. Sie hatten über 400 000 Berichte aus knapp 13 Jahren ausgewertet. Ballaststoffe kommen in pflanzlichen Lebensmitteln vor. Wildkräuter, Obst und Gemüse enthalten zudem Kalium und Magnesium, die den Blutdruck senken. Auch in Mandeln, Hasel- und anderen Nüssen hat es, neben wertvollen Fetten und Mineralien, viele Ballaststoffe. Ernährungsmediziner empfehlen deshalb, täglich eine Handvoll davon zu essen. Ballaststoffe halten auch den Darm fit. Bei extrem ballaststoffarmer Kost bauen die Darmbakterien die Schleimschicht des Dickdarms ab, um die darin enthaltenen Polysaccharide als Nahrung zu nutzen. Das macht den Darm anfälliger für Infektionen und chronisch entzündliche Darmerkrankungen. gesundheitstipp/krea
Gesucht
Gesucht
MitgründerInnen Naturheilklinik Schwerpunkt Burnout. Motto: Wär nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt es nie erblicken. (Goethe)
Gesucht: Klinikärztin oder –arzt Ort: ev Südschweiz Richtlinien: Essen, Schlafen (ev PatientInnenzimmer mit CabrioletZimmerdecke), Therapien, etc. finden im Freien statt. Medikamente: möglichst keine stoffliche. Küche: vegetarisch, teilweise vegan, KlinikGarten. Hotelbetrieb: keiner. Niemand lässt sich ausschliesslich bedienen, sondern alle helfen nach ihren Möglichkeiten im Betrieb mit. Ich (Biologin und Yogalehrerin) freue mich über eure Reaktionen. Verena Merlo vera.merlo@bluemail.ch

Hilfe beim Abspecken
Intervallfasten ist eine gute Methode, um abzunehmen. Die App BodyFast Intervallfasten bietet in der Gratisversion elf verschiedene Fastenpläne und zeigt, neben interessanten Infos, wann Fastenzeit ist und wann wieder gegessen werden darf. Damit ist man gut bedient; das teure Abo ist nicht nötig. Man muss sich auch nicht registrieren und kann die App offline verwenden.
Für Android und iOS, gratis




Durch Zen können wir uns vollkommen auf den Augenblick konzentrieren und Stress abbauen. Doch wie integriert man die buddhistische Meditationslehre in den Alltag? Eine Spurensuche im Reich der Stille.
Text: Fabrice Müller
Midlife Crisis, Scheidung, Firmenverlust:
Der Schreinermeister Kurt André Meier erlebte vor zehn Jahren einen Tiefschlag nach dem anderen. Durch den Wunsch, mehr Ruhe, Struktur, Disziplin und Konzentration auf das Wesentliche sowie Kreativität ins Leben zu bringen, stiess er über eine Bekannte auf die Zen-Meditation. Die erste Begegnung mit den Zen-Ritualen erlebte Meier, der sich seit vielen Jahren mit Yoga, Daoismus und Buddhismus beschäftigt, im Lassalle-Haus in Bad Schönbrunn in Edlibach (ZG), nur wenige Minuten vom Atelier des Schreiners entfernt. Das von Jesuiten geleitete Bildungshaus bietet die Möglichkeit, sich ganz der Übung der Zen-Meditation hinzugeben und die fernöstliche Praxis mit dem eigenen christlichen Glauben zu verbinden. In regelmässigen Meditationskursen werden die Teilnehmer in das Zazen (Za=sitzen, Zen=Meditation) eingeführt. «Ich erlebte die Zen-Einführung als grosse Wohltat», erinnert sich Meier, der früher eine Schreinerei mit mehreren Angestellten leitete. «Ich genoss es, dass im Zendo, dem Meditationsraum, alles klar und vorgeschrieben ist. Für einmal nichts entscheiden zu müssen, ist für mich wunderbar.»
Als Leiterin der Zen-Tage am Lassalle-Haus begleitet Ursula Popp viele Menschen, die sich für den Weg in die Zen-Meditation entschieden haben. «Seit vielen Jahren nimmt das Interesse an Zen zu. Viele Menschen verspüren ein spirituelles Verlangen, während sie sich gleichzeitig von den Kirchen immer weniger angesprochen fühlen. Zen bietet ihnen eine neue spirituelle Heimat.» Zen gilt als spiritueller Weg, ist aber keine Religion, betont Popp: «Im Gegensatz zur Kirche kommt Zen ohne Hierarchien aus und ist religionsneutral.»
Die gelernte Buchhändlerin und TCM-Ärztin beschäftigt sich seit bald 40 Jahren mit der Zen-Meditation. Als Schülerin und Assistentin des Jesuiten und Zen-Meisters Niklaus Brantschen, der sie zur Zen Assistenz-Lehrerin, zur sogenannten Hoshi, ernannt hat, gibt Ursula Popp, die 20 Jahre in den USA arbeitete und eine TCM-Schule leitete, seit 2018 am Lassalle-Haus Zen-Meditations- und Fastenkurse sowie Seminare im Bereich Alter und Weisheit.
Indische Wurzeln
Zen geniesst in der westlichen Welt eine hohe Popularität, nachdem die Lehre ab Mitte des letzten Jahrhunderts erstmals von Japan nach Europa und in die USA «exportiert» wurde. Zu den ersten Menschen aus
Europa, die sich mit Zen beschäftigten, gehören die Jesuiten Hugo Enomiya Lassalle aus Deutschland, der als junger Missionar 1929 nach Japan geschickt wurde, und der Schweizer Zen-Meister der White Plum Sangha-Linie Niklaus Brantschen, der das Lassalle-Haus bis 2001 leitete.
Ursprünglich stammt Zen aus Indien, von wo aus es in China und später im ganzen ostasiatischen Raum, inklusive Japan, verbreitet wurde. Das reine Zen wurde um 1200 in Japan neu entdeckt und wieder praktiziert. Nach einer Legende begann die Geschichte des Zen, als Shakyamuni Buddha vor einer grossen Schülerschar auf dem Geierberg sprach. Als Symbol für seine Lehre, den Dharma, hielt er schweigend eine Blüte in die Höhe. Ausser seinem Schüler Kashyapa verstand niemand diese Geste. Kashyapa aber lächelte glückselig, denn durch diese einfache Geste seines Meisters war er zur Erleuchtung gelangt.
Was aber bedeutet Zen? Welche Lehre steht dahinter? «Zen ist die Übung der Meditation», bringt es Ursula Popp auf den Punkt. Gemeint ist damit die Sammlung des Geistes und die meditative Versenkung. In dieser sind alle dualistischen Unterscheidungen wie Ich und Du oder wahr und falsch aufgehoben. Unter «Zazen» wiederum versteht man Meditation im Sitzen, wo die Gedanken einer tiefen Stille weichen können. Zen ist – so Popp – eine körperliche Übung, bei der es darum geht, zu lernen, in der Gegenwart zu sein. «Unser Geist hüpft von der Vergangenheit in die Zukunft und wieder zurück. Dabei überspringt er die Gegenwart, das Hier und Jetzt.» Ziel des Zen sei es, in der Gegenwart zu bleiben und den Fokus auf den Moment zu richten – zum Beispiel auf das Zwitschern der Vögel im Garten, auf den Wind oder auf unseren Atem – und dabei zu erfahren, wie wir Menschen und das Leben als Ganzes funktionieren.
Dieser Weg des Zen sei eine bewusste Entscheidung, betont die Hoshi. «Wir entscheiden uns dafür, das Heft selber in die Hand zu nehmen und nicht unseren sich wild drehenden Gedanken zu überlassen.» Die starke Präsenz der Gedanken, die wir fortwährend unbewusst kreieren und quasi Selbstläufer sind, habe einen grossen Einfluss auf unser Fühlen und Handeln. Das repetitive Muster vieler Gedanken beschäftigt sich mit Ängsten und Sorgen, die die Vergangenheit oder Zukunft betreffen – es ist ein Kreisen ausserhalb des Lebens im Jetzt. Dabei bleiben wir in der Fantasie, ohne Bezug zum Moment. Deshalb sei es

« Zen hat Ruhe, Einfachheit und Klarheit in mein Leben gebracht. »
Kurt
André Meier, Schreinermeister
die Absicht im Zazen, die Gedanken, die uns ständig begleiten, wie Wolken am Himmel vorüberziehen zu lassen, ohne uns mit ihnen zu identifizieren, so Popp.
Die Gedanken loslassen
Täglich 25 bis 30 Minuten meditieren – auf einem Meditationskissen oder -schemel oder auch auf einem Stuhl, jedoch ohne anzulehnen.
Richten Sie sich dafür einen bestimmten, ruhigen Platz ein, wo sie regelmässig ungestört praktizieren können.
Beide Füsse auf den Boden, den Kopf im 45-GradWinkel nach unten geneigt.
Kommen Sie zur Ruhe, beobachten Sie Ihren Atem, die Geräusche um Sie herum; lassen Sie die Gedanken vorbeiziehen, ohne ihnen Aufmerksamkeit zu schenken.
Bleiben Sie im Hier und Jetzt; wenn Sie in Gedanken abdriften, ist das nicht schlimm. Ärgern Sie sich nicht, kehren Sie einfach zurück ins Hier und Jetzt.
Erwarten Sie nichts.
Bleiben Sie auch im Alltag achtsam; hören Sie auf Ihre innere Stimme und auf Ihr Körpergefühl. Sie werden bald erfahren, dass das immer leichter fällt. Übung macht den Meister.
Wie wäre es anstelle eines Wellness-Tages einmal mit einem Achtsamkeits-Tag? Der Morgen beginnt mit einer Meditation vor dem Frühstück. Sie verzichten auf Medien und anderen Ablenkungen.
Machen Sie während des Tages zwei oder drei längere Spaziergänge, am besten in einem Park oder im Wald. Atmen Sie dabei ganz bewusst und bewegen Sie sich liebevoll und achtsam.
Lesen Sie ein inspirierendes Buch oder schreiben Sie einen Brief an eine Freundin oder einen Freund.
Beschliessen Sie Ihren Tag der Achtsamkeit mit einer Sitzmeditation.
Nichts leichter als das? Weit gefehlt! Aller Anfang ist schwer – das gilt besonders für die Zen-Meditation. Der Kopf ist ständig voller Gedanken und die verhindern, dass der Geist zur Ruhe kommt. Dabei sollte man sich doch entspannen und an nichts denken. An gar nichts. Das ist sehr viel leichter gesagt als getan. Und dann die Körperhaltung: mit geradem Rücken auf einem Meditationskissen oder -schemel sitzend, die Augen im 45-Grad-Winkel nach unten gerichtet. Die Hände in der Mudra-Haltung: Die linke Hand liegt in der rechten, die Daumenspitzen berühren sich.
Regelmässig dreht die Meditationsleiterin ihre Runden und hält uns einen Stock an den Rücken, um das Finden einer guten Haltung zu unterstützen. Besonders am Anfang bedeutet diese Haltung für die Beinmuskulatur eine Umstellung – oftmals begleitet durch Muskelkater. Es braucht Konzentration, um auf den Körper, auf die Atmung zu achten und sich weder von Gedanken noch Gefühlen ablenken zu lassen, sondern im Körper wie im Geist ruhig und still zu werden. Eine Meditationseinheit beginnt mit drei Gongschlägen und endet mit einem. Zwei Gongschläge künden den Wechsel von der Sitz- in die Gehmeditation an.
Die Integration der Zen-Meditation in den Alltag ist eine weitere Herausforderung. «Damit verbunden ist ein bewusster Entscheid, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde zu meditieren und sich ganz auf den Moment zu konzentrieren», empfiehlt Ursula Popp. Dies setze eine gewisse Portion an Selbstdisziplin voraus. «Am Anfang begegnen wir manchen inneren Widerständen; Ermüdungserscheinungen können sich einstellen. Wer sich für Zen entscheiden will, sollte diesen Weg konsequent gehen und sich dafür Zeit nehmen.» Ein guter Zeitpunkt für die Meditation sei der Wechsel von der Nacht in den Tag oder vom Tag in die Nacht. «Am Morgen beispielsweise befinden wir uns nach dem Aufstehen noch in einer Art Zwi-
« Zen kommt ohne Hierarchien aus und ist religionsneutral. »
Ursula Popp, Leiterin Zen-Tage
schenwelt, also in einem weichen Zustand, der für Meditationen sehr fruchtbar ist», erklärt Popp. «Die Meditation wird so zu einem Ritual wie das Zähneputzen.» Nach 21 Tagen habe sich das Ritual eingeschliffen, zeigen Untersuchungen.
Kurt André Meier meditiert zweimal täglich jeweils eine halbe Stunde am Morgen und Abend für sich und dreimal wöchentlich je ein bis anderthalb Stunden in der Zen-Hausgruppe im Lassalle-Haus. «Es braucht den festen Willen, Zen in das Leben zu integrieren», sagt er. «Konkret bedeutet das für mich, abends früher ins Bett zu gehen und am Morgen eine halbe Stunde früher aufzustehen.» Ausserdem besucht er zweimal pro Jahr einen Meditationskurs. Dies sei ebenfalls wichtig, betont Ursula Popp, denn das gemeinsame Meditieren unter Anleitung einer Lehrperson helfe der Motivation und dem Überwinden von Schwierigkeiten. Zudem falle das Meditieren in der Gruppe vielen wesentlich leichter.
Mitgefühl und Klarheit
Wenn Zen zum festen Bestandteil im Alltag wird, sorgt dies laut Ursula Popp für mehr Gelassenheit und eine innere Zentrierung. «Zen hilft, mehr bei sich selber zu sein und sich bewusst zu werden, was einem guttut und was nicht.» Dies erleichtere einem im Alltag, die




richtigen Entscheidungen zu treffen und in stressigen Momenten nicht die Ruhe zu verlieren. Doch Zen geht noch weiter: «Im Zen erfahren wir, was Leben in seinen verschiedenen Dimensionen wirklich ist. Dies hilft, Dinge zu hinterfragen und die Welt in ganz neuer Weise zu erleben – so wie sie in der letzten Tiefe ist.» Durch die Begegnung mit der grossen Leere, die sich in allen Dingen offenbare, liege die grosse Freiheit, der grosse Friede, ist sie überzeugt. «Das wiederum führt zu Mitgefühl.»
«Zen», sagt Kurt André Meier, «hat mehr Ruhe, Einfachheit und Klarheit in mein Leben gebracht.»
Zudem sei er gegenüber sich und anderen Menschen achtsamer geworden. «Meine Vorstellung, dass sich dank Zen die Probleme im Leben verringern, hat sich zwar zerschlagen. Doch durch die höhere Achtsamkeit nehme ich gewisse Dinge viel früher wahr und kann Probleme früher erkennen.» So ist Zen für den Schreiner zu einem festen Bestandteil seines Lebens geworden. «Es gehört für mich zum Leben wie der Atem. Ich möchte Zen bis zum letzten Tag meines Lebens praktizieren.» //
● Links
Lassalle Haus: www.lassalle-haus.org
Meditationsverzeichnis: www.schweiz-in-stille.ch
Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Damit der menschliche Körper harmonisch funktioniert, ist er auf zahlreiche wichtige Stoffe angewiesen. Einer dieser Stoffe ist Vitamin B12. Paradoxerweise führten erst schwerwiegende Krankheiten aufgrund von Vitamin-B12-Mangel auf die Spur dieses lebenswichtigen Stoffes: 1912 beschäftigte sich der polnische Biochemiker Casimir Funk intensiv mit der Isolierung des Wirkstoffs gegen die Vitaminmangelkrankheit Beri-Beri. Diese neue Krankheit trat in Japan und Java auf, nachdem man in diesen Ländern europäische Reisschälmaschinen eingeführt hatte. Bei Beri-Beri wurde bald eine Mangelerscheinung vermutet; unbehandelt führte sie in kurzer Zeit zu akutem Herzversagen und damit zum Tod. Deshalb kam der japanische Arzt Takai Kanehiro auf die Idee, dem Reis die entfernte Reiskleie wieder zuzuführen, womit er die Krankheit tatsächlich heilen konnte. Casimir Funk isolierte aus der Reiskleie einen Stoff und die Analyse zeigte, dass es sich dabei um eine stickstoffhaltige Verbindung handelte, ein sogenanntes Amin. Deshalb schlug Funk zur Benennung dieses Stoffes das Kunstwort «Vitamin» vor, das zusammengesetzt war aus Vita (das Leben) und Amin. 1913 gelang es dem amerikanischen Biochemiker Elmer McCollum, das fettlösliche Retinol (Vitamin A1, ein fettlösliches, essenzielles Vitamin) zu isolieren. Schliesslich führte McCollum 1916 die Kategorisierung von Vitaminen nach Buchstaben ein, in der er Retinol als «fat-soluble factor A» (fettlöslicher Faktor A) bezeichnete. Zudem benannte er einen ähnlich essenziellen Stoff, den er aus Weizen- und Reiskleie extrahiert hatte, als «water-soluble factor B» (wasserlöslicher Faktor B). 1920 wurden die Begriffe «factor A» und «factor B» zu Vitamin A und Vitamin B umbenannt. McCollum konnte später zeigen, dass Vitamin B keine einzelne Komponente ist, sondern einen ganzen Vitamin-Komplex darstellt.
Anfang der 1920er-Jahre entdeckte der US-amerikanische Pathologe George H. Whipple, dass Hunde, die an bösartiger Blutarmut litten, durch Fütterung mit roher Leber von dieser sonst tödlich verlaufenden Krankheit geheilt werden konnten. Im Jahre 1928 gelang es dem Chemiker Edwin Cohn, einen Extrakt aus der Leber zu isolieren, der sich in Studien 50- bis 100-mal so positiv auf den Heilungsprozess auswirkte als gewöhnliche Leberprodukte. Damit hatte man das erste anwendbare Vitamin-B12-Präparat entdeckt. Für die Anfangsstudien, die den Weg zu einer Behandlung des Vitamin-B12-Mangels aufzeigten, erhielten die drei US-Amerikaner George H. Whipple (Pathologe), George R. Minot (Internist) und William P. Murphy (Mediziner) im Jahre 1934 den Nobelpreis.
Schliesslich gelang 1948 sowohl einem Team amerikanischer Biochemiker um Karl A. Folkers als auch einem britischen Forscherteam um den Chemiker E. Lester Smith die Isolierung von Vitamin B12 in kristalliner Form. Noch im gleichen Jahr wurde Vitamin B12 in Milchpulver, in Rindfleischextrakt und Flüssigkulturen verschiedener Bakteriengattungen nachgewiesen. Die genaue chemische Struktur der Vitamin-B12-Moleküle konnte aber erst im Jahre 1956 mittels moderner Technik erforscht werden: Die britische Biochemikerin Dorothy Crowford Hodgkin und ihr Team entschlüsselten die Moleküle mithilfe von
Vitamin B12 ist ein sehr wichtiger Stoff für unser Nervensystem, die Blutbildung und für andere Prozesse im Körper. Ein Mangel kann lange unentdeckt bleiben und schwere Schäden verur sachen.
Text: Andreas Walker Illustration: Lina Hodel
kristallografischen Datensätzen, wofür sie u. a. 1964 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wurde.
Der Ansatz, Vitamin B12 in grossen Mengen durch Bakterienkulturen zu produzieren, stammt aus den 1950er-Jahren und bildet gleichzeitig den Grundstein für die moderne Form der Behandlung des Vitamin-B12-Mangels.
Wie man einem Mangel vorbeugt
Vitamin B12 ist an vielen wichtigen Prozessen im menschlichen Körper beteiligt. Es wird gebraucht für den Aufbau von Hormonen und Neurotransmittern, den Schutz der Nervenstränge in Rückenmark und Gehirn und den Abbau von Homocystein (Aminosäure, die als Zwischenprodukt im Stoffwechsel des Menschen entsteht und nicht durch die Nahrung aufgenommen wird). Zellen sind ebenso auf kleine Mengen von Vitamin B12 angewiesen, um optimal funktionieren zu können. Auch ist es an der Zellteilung und Blutbildung sowie der Synthese von DNA beteiligt.
Bei so vielen wichtigen Funktionen von Vitamin B12 kann man sich leicht vorstellen, dass ein Mangel gravierende Folgen haben kann. Ein zusätzliches Problem bei Vitamin-B12-Mangel ist, dass man ihn häufig nicht rechtzeitig bemerkt. Er entsteht oft erst nach Jahren, weil

« Auch Meeresalgen und Gerstengras sind gute Vitamin-B12-Lieferanten. »
Vitamin B12 in ausreichender Menge in der Leber gespeichert ist. Ein weiteres Problem zeigt sich darin, dass die Symptome dieses Mangels auch auf andere körperliche Beschwerden hinweisen könnten.
Vitamin B12 wird auch zur Bildung der roten Blutkörperchen benötigt, die u. a. für den Sauerstofftransport zuständig sind. Kann nicht genügend Vitamin B12 vom Organismus aufgenommen werden, kann dies zu Blutarmut (Anämie) führen.
Ist der Vitamin-B12-Mangel schliesslich gravierend, kann er sich neben Blutarmut auch in neurologischen und psychiatrischen Symptomen bemerkbar machen, die möglicherweise unumkehrbar werden. Die körperlichen und psychischen Störungen, die ein Vitamin-B12-Mangel verursacht, umfasst viele Symptome wie Müdigkeit, Schwäche, Blässe, Durchfall, Darmschäden, Appetitlosigkeit, Entzündungen der Zunge und der Mundschleimhaut, Mundwinkelrhagaden, Konzentrationsschwäche, Gedächtnisstörungen, Demenz, Psychosen, krankhafte Empfindung im Versorgungsgebiet eines Hautnervs, die sich meist als Kribbeln, «Ameisenlaufen», Pelzigkeit, Taubsein, Prickeln, Jucken, Schwellungsgefühl und Kälte- oder Wärmeempfindung bemerkbar machen. Ebenso auftreten können Muskelschwäche, teilweise Lähmungen, Gangstörungen und Reizbarkeit bis hin zu depressiven Verstimmungen. Lange und schwerwiegende Mängel können zu einer fortschreitenden Demyelinisierung von Nerven führen. Dabei wird die Isolationsschicht der Nervenleitungen beschädigt, was zu gravierenden Fehlfunktionen führt.
Quellen von Vitamin B12
Wird das Vitamin B12 mit der Nahrung aufgenommen, ist es an Proteine gebunden und wird im Magen durch die Magensäure daraus herausgelöst. Damit es vom Körper aufgenommen werden kann, muss B12 an ein bestimmtes Transporteiweiss gekoppelt werden, das von der Magenschleimhaut gebildet wird. Es handelt sich dabei um den «intrinsischen Faktor», der von der Magenschleimhaut gebildet wird. Erst in dieser Verbindung kann das Vitamin B12 im unteren Dünndarm vom Körper schliesslich aufgenommen werden.
Menschen, die unter einer chronischen Magenschleimhautentzündung (Gastritis), einem Befall mit Helicobacter pylori oder einer Darmentzündung wie Morbus Crohn leiden, fehlen ausreichende Mengen dieses Transporteiweisses. Deshalb treten chronische Magen- und Darmerkrankungen fast immer mit Vitamin-B12-Mangel auf. Ein Vitamin-B12-Mangel ist ohne Blut- oder Urinuntersuchung schwierig zu diagnostizieren.
Vitamin B12 ist vor allem in tierischen Eiweissquellen wie Fleisch, Leber, Niere, Fisch, Austern, Milch, Milchprodukten und Eigelb enthalten. Der Tagesbedarf von Vitamin B12 beträgt für Jugendliche und Erwachsene 3 Mikrogramm pro Tag (Schwangere 3,5 Mikrogramm, Stillende 4 Mikrogramm pro Tag). In der Regel ist dieser Bedarf einfach zu decken, denn bei einer für westliche Industrienationen typischen Ernährung werden täglich etwa 3 bis 30 Mikrogramm Vitamin B12 aufgenommen. Risikofaktoren, die den Vitamin-B12-Mangel begünstigen, sind eine vegetarische Ernährung, Alkoholismus, das Alter und chronische Erkrankungen des Verdauungstrakts wie oben beschrieben.
« Lange und schwerwiegende Mängel können zu einer fortschreitenden Entmarkung von Nerven führen. »
Cobalamine sind chemische Verbindungen, die in allen Lebewesen vorkommen und auch als Vitamin-B12Gruppe bezeichnet werden. Vitamin B12 ist ein wasserlösliches Vitamin der B-Gruppe, das Cobalt (Co) als Zentralatom enthält. Es wurde erst im Jahr 1948 entdeckt und wird von Bakterien hergestellt. Das Molekül ist sehr komplex, deshalb werden für die künstliche Herstellung Bakterien gezüchtet, die das Vitamin B12 produzieren.
Therapeutisch wird Vitamin B12 in der Regel in Form von Cyanocobalamin (C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P) supplementiert. Dabei handelt es sich um einen Arzneistoff, der pharmakologisch inaktiv ist und erst durch einen Umwandlungsschritt im Körper in die eigentliche Wirkform überführt wird, die im Körper zur aktiven Form metabolisiert wird. Zur Behandlung von VitaminB12-Mangel wird das Vitamin intramuskulär gespritzt oder in Form von Tabletten eingenommen.
Oft werden veganen Nahrungsmitteln Spuren von B12 zugeschrieben, etwa Sauerkraut, fermentierten Sojaprodukten, Shiitake-Pilzen sowie Wurzel- und Knollengemüse. Allerdings reichen die darin enthaltenen sehr geringen Mengen zur Bedarfsdeckung nicht aus. Zudem gehen die Meinungen auseinander, ob das darin enthaltene Vitamin B12 überhaupt in einer für den Menschen verfügbaren Form vorliegt. Auch Meeresalgen sollen gute Vitamin-B12-Lieferanten sein. Allerdings stellt nach aktuellem Forschungsstand lediglich Chlorella eine pflanzliche Quelle für Vitamin B12 dar. Auch Bierhefetabletten und das Strath-Aufbaumittel enthalten Vitamin B12 und Gerstengras ist sogar ein eigentliches Vitamin B12-Kraftpaket. //




























































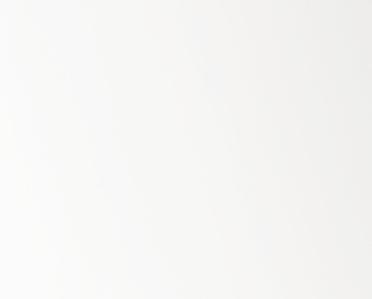






Einst lag das medizinische Wissen in den Händen von Nonnen und Mönchen. Was können wir heute lernen von der traditionellen Klostermedizin?
Text: Lioba Schneemann

«Auch die Ehre des Fenchels sei hier nicht verschwiegen; er hebt sich kräftig im Spross, und er streckt zur Seite die Arme der Zweige, sowohl sehr süssen Geschmacks als auch süssen Geruches. Nützen soll er den Augen, wenn sie Schatten trügend befallen, und sein Same, mit Milch einer Ziege getrunken, lockere, so sagt man, die Blähung des Magens und fördere lösend alsbald den zaudernden Gang der lange verstopften Verdauung. Ferner vertreibt die Wurzel des Fenchels, vermischt mit dem Weine getrunken, den keuchenden Husten.»
Walahfrid Strabo, Benediktiner, Dichter, Botaniker, Diplomat und von 838 bis 849 Abt des Klosters Reichenau, lobt in seinem Lehrgedicht «Hortulus» den Fenchel in den höchsten Tönen. Zu Recht! Fenchel wird heute noch in der Pflanzenheilkunde häufig und erfolgreich verwendet, sei es zur Förderung der Muttermilchbildung oder bei Magenproblemen und diversen anderen Beschwerden.
24 Gartengewächse hat Strabo in seinem bekannten Werk nach Form, Farbe, Duft, Geschmack und Ertrag aufgeführt und ihre jeweilige Heilkraft beschrieben. Zu den Heilpflanzen gehörten unter anderem heute noch bekannte Vertreter wie Salbei, Wermut, Schlafmohn, Liebstöckel, Kerbel, Flohkraut, Rettich und Minze. Strabos Werk – wie auch andere mittelalterliche Schriften (siehe Seite 21) – zeigen, dass das medizinische Wissen der Nonnen und Mönche sehr gut entwickelt war. «Die wesentliche Leistung von Autoren wie Hildegard von Bingen oder etwas früher Heinrich von Huntingdon in England, war es, Pflanzen zu beschreiben, die von den mediterranen Autoren der Antike noch nicht berücksichtigt worden waren», sagt Tobias Niedenthal von der Forscher-
gruppe Klostermedizin der deutschen Universität Würzburg. So seien im Mittelalter erstmals die Ringelblume oder der Echte Lavendel medizinisch beschrieben worden.
Andorn hilft bei Lungenkrankheiten
Eine wichtige, aber heute fast vergessene Pflanze war von der Antike bis zur Neuzeit der Andorn. Zwar ist er noch als Arzneipflanze anerkannt, fristet jedoch ein Schattendasein. Aufgrund seiner historischen Bedeutung und der umfangreichen Dokumentation seiner Wirkungen hat ihn der «Studienkreis Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde» an der Universität Würzburg zur Arzneipflanze des Jahres 2018 gekürt. Der Andorn enthält kräftige Bitter- und Gerbstoffe und wurde vor allem bei Lungenerkrankungen und hartnäckigem Husten eingesetzt, aber auch bei Brüchen, Verstauchungen, Krämpfen und Erkrankungen der Sehnen. Hildegard von Bingen empfiehlt eine Abkochung von Andorn, Fenchel und Dill mit Wein gegen starken Husten.
In allen einschlägigen Werken bis ins 18. Jahrhundert hinein werden zudem auch Ohrenschmerzen und Probleme bei der Geburt sowie Menstruationsbeschwerden unter den Indikationen angeführt. Im 19. Jahrhundert konzentrierte sich die Anwendung auf die schleimlösende Wirkung in den Atemwegen und auf Verdauungsprobleme. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts diskutierte man in Frankreich sogar eine Wirkung bei Malaria. Tobias Niedenthal: «Erforscht wird heute auch die schmerzlindernde, genauer antinozizeptive Wirkung, etwa im Vergleich zu Diclofenac und Acetylsalicylsäure, kurz ASS.» Andornprodukte gibt es als Tropfen und Presssaft. Andorn ist übrigens auch eines der 13 Kräuter in den Ricola-Bonbons.
Heilziest, Galgant und Zitwer
Ein weiteres Beispiel von einst wichtigen Arzneipflanzen ist der Heilziest, auch Echte Betonie geheissen. Er ist heute als Heilmittel nicht mehr anerkannt, kann jedoch als Lebensmittel genutzt werden. «Die Betonie war die ‹Modedroge› im Mittelalter, ähnlich wie heute Kurkuma», weiss Niedenthal. Heilziest sei so etwas wie das «Aspirin des Mittelalters» gewesen und wurde

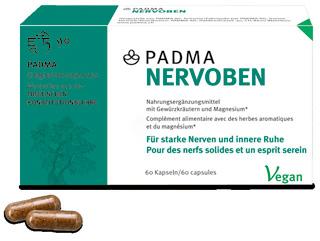

Magnesium trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei.

als Mittel bei Kopfschmerzen verwendet. Aber auch bei Lungenverschleimungen, Sodbrennen, Gicht, Nervenschwäche, Katarrhen sowie Blasen- und Nierensteinen soll er geholfen haben. Denkbar, so Niedenthal, sei auch die Verwendung als Adstringens. «Der Heilziest könnte für viele Beschwerden potenziell genutzt werden», ist er überzeugt, «aber das wurde bisher nie wissenschaftlich untersucht.»
Die Ingwergewächse Galgant und der mit Kurkuma eng verwandte Zitwer, um weitere Beispiele zu nennen, waren im Mittelalter auch bei uns wichtige Arzneien. Galgant ist heute als Thai- oder Siam-Ingwer bekannt und wird oft und reichlich in der asiatischen Küche verwendet. Im 12. Jahrhundert soll die Wurzel auch in Europa so beliebt gewesen sein, dass ihre Fälschung ein lukratives Geschäft war.
Über den Zitwer schrieb Hildegard von Bingen, dass er mässig warm sei und eine grosse Wirkkraft in sich habe. Sie empfahl die scharfe Wurzel bei Zittern, übermässigem Speichelfluss, Kopfschmerzen und Magenleiden. Die allgemeine Klosterheilkunde empfahl Zitwer vor allem bei Magen-Darm-Beschwerden sowie bei Atemwegserkrankungen und Erkältungen. Unter vielen weiteren Indikationen fanden sich Pest, Leberleiden, Augentrübung, Zahnweh und, entsprechend seiner heissen Qualität, Impotenz.
Für pflanzliche Arzneimittel werden heute in Europa etwa 250 Pflanzen genutzt. Dabei gibt es sehr viel mehr teilweise äusserst wirksame Heilpflanzen. Doch viel Wissen darüber geriet in Vergessenheit. Die Gründe dafür sind laut Niedenthal vielfältig: «Nicht wenige Anwendungen gingen nach dem Aufkommen der Universitäten in das über, was man Volksheilkunde oder Hausmittel nennen könnte. Bei vielen Leiden gibt es inzwischen bessere Alternativen als Heilpflanzen. Und einige Pflanzen sind auch zu gefährlich für den Einsatz als Vielstoffgemisch.»
Im Vergleich zu Einzelstoffen bieten Vielstoffgemische handkehrum auch wesentliche Vorteile. Das zeigt sich bei der eminent wichtigen Suche nach pflanzlichen Antiinfektiva, die bei leichteren Infektionskrankheiten eine Alternative zu den klassischen
Antibiotika sein können. Gerade weil Antibiotika nur über einen einzelnen Wirkmechanismus verfügen, kommt es leicht zu Resistenzen. Die Gefahr sei bei Vielstoffgemischen deutlich weniger gross, betont Niedenthal. Und: «Pflanzliche Vielstoffgemische wirken in der Regel auch nicht nur singulär gegen bestimmte Bakterien wie Antibiotika, sondern auch gegen einige Pilze und Viren. Gerade das macht sie so interessant für die Behandlung leichter bis mittelschwerer Infektionen.» //

« Jede Krankheit ist heilbar – aber nicht jeder Patient.»
Hildegard von Bingen, 1098–1179

Klostergärten – die Wurzeln unserer
Mit der Klostermedizin ist eine medizinhistorische Epoche gemeint, deren Blütezeit in der Zeit vom 8. bis 12. Jahrhundert lag. In dieser Zeit lag die medizinische Versorgung in den Händen von Mönchen und Nonnen: Medizin war Handwerk und angewandte Theologie zugleich; ausserhalb der Klöster gab es keine medizinische Ausbildung.
Benedikt von Nursia sowie Cassiodor, der Gründer des Benediktiner Ordens, und Isidor von Sevilla legten im 6. und 7. Jahrhundert die Basis der Klosterheilkunde. Eine weitere Grundlage war die Naturenzyklopädie des antiken Naturforschers Plinius des Älteren (23–79 n. Chr.). Benedikts Regel, dass die «Sorge für die Kranken die wichtigste Aufgabe der Mönche» sei, etablierte sich. Die Caritas (Barmherzigkeit) legte den Boden für eine systematische Medizin, die Klosterheilkunde. Klostergärten wurden angelegt,


Info-Abend: 24. Aug.
«Ihr Aus- und Weiterbildungsinstitut IKP: wissenschaftlich –praxisbezogen – anerkannt.»
Neu: Finanzierung Ihrer Ausbildung durch Bundesbeiträge Mit Option zum eidg. Diplom
Körperzentrierte/r Psychologische/r Berater/in IKP
spezifische Pflanzen erforscht. Berühmtestes Werk ist das Lehrgedicht «Hortulus» des Benediktinerabts und Beraters der karolingischen Könige Walahfrid Strabo (808–849 n. Chr.), der darin 24 Pflanzen von Ambrosia über Frauenminze bis Wermut und deren medizinische Anwendung beschreibt. Etwa zeitgleich wurde medizinisches Wissen im «Lorscher Arzneibuch» des Klosters Lorsch (Worms) niedergeschrieben. Im 11. Jahrhundert verfasste der Mönch Odo de Meung ein Standardwerk der Kräuterheilkunde, «Macer floridus», das in Europa Verbreitung fand.
Die Klosterapotheken erlebten vor allem im Barock eine Blütezeit; nach der Säkularisation war es damit vorbei, unter anderem, weil im 12. Jahrhundert Geistlichen die Ausübung der Heilkunde verboten wurde und die Berufe des Arztes und des Apothekers getrennt wurden.
Info-Abend: 18. Aug. 3 Jahre, ASCA u. SGfB-anerk
Psychosoziale Beratungskompetenz kombiniert mit Körperarbeit (Erleben und Erfahren über den Körper), Entspannungsübungen, Sinnfindung und Ressourcenstärkung.

Dipl. Paar- und Familienberater/in IKP
Ganzheitliche systemische und psychosoziale Beratung sowie Coaching-Tools rund um Beziehungen. 3 Jahre, SGfB-anerk.
Beide Weiterbildungen können mit einem eidg. Diplom abgeschlossen werden. IKP Institut, Zürich und Bern
Seit 30 Jahren anerkannt
362318_bearbeitet.qxp 19.3.2009 16:50 U
Sass da Grüm – Ort der Kraft
Es gibt Orte, von denen eine spürbare positive Kraft ausgeht. Solch ein Ort ist die Sass da Grüm. Baubiologisches Hotel, Bio-Knospen-Küche, Massagen, Meditationen, schönes Wandergebiet, autofrei, traumhafte Lage. Hier können Sie Energie tanken. Verlangen Sie kostenlos Unterlagen. Hotel Sass da Grüm CH-6575 San Nazzaro Tel. 091 785 21 71 www.sassdagruem.ch
Fasten. Gesundheit. Auszeit.

Wo Sie statt Meerblick mehr Blick haben.
Im Kurhaus St. Otmar blicken Sie aus dem Fenster und sehen mehr als Meer. Bewusst wahrnehmen, weil Fasten Ihre Sinne schärft. Bewusst erleben, weil Sie Zeit haben zum Sein. Fastenkuren in St. Otmar – Ihre Mehrzeit
Kurhaus St. Otmar · 6353 Weggis · www.kurhaus-st-otmar.ch

Wer Weizenmehl meiden möchte oder muss, findet immer mehr Pasta-Alternativen, etwa aus
Dinkel oder Hülsenfrüchten. Eine Degustation zeigt: Keine Wahl überzeugt so richtig.
Text: Vera Sohmer
Farfalle, Makkaroni, Spaghetti? Oder doch mal wieder Hörnli, Spätzli oder Knöpfle? Vor dem Teigwaren-Regal hatte man schon immer die Qual der Wahl. Zumindest, was Form und Grösse angeht. Die Grundzutaten hingegen sind seit jeher die gleichen: Pasta besteht in der Regel aus Hartweizengriess oder Weizenmehl, auch als VollkornVariante, und manchmal sind noch Eier mit dabei.
Inzwischen ist aber auch die Auswahl an Zutaten vielfältiger geworden. Seit Hülsenfrüchte wegen ihres Proteingehalts im Trend liegen, werden daraus immer mehr Lebensmittel hergestellt, auch Pasta. «Aktuell sind diese Produkte eher noch in einer Nische zu Hause», sagt Coop-Sprecher Patrick Häfliger. Der Anteil am gesamten Pasta-Sortiment liege im einstelligen Prozentbereich. Die Nachfrage nehme aber stetig zu.
Teigwaren aus Hülsenfrüchten werden als lange sättigende sowie ballast- und nährstoffreiche Quelle für Vegetarier und Veganerinnen ebenso beworben wie als geeignetes Lebensmittel bei Zöliakie. Die Unverträglichkeit auf Gluten, das Klebereiweiss in verschiedenen Getreidesorten, hat vor allem Weizen in Verruf gebracht. Und damit auch grosse Produzenten auf den Plan gerufen, Alternativen ins Sortiment zu nehmen – und teurer zu verkaufen als «normale» Pasta.
Geschmack gut, Konsistenz fragwürdig
Was als neues «Geschmackserlebnis» angepriesen wird, ist aber nicht immer überzeugend und meist zumindest gewöhnungsbedürftig. Beim Testessen am heimischen Tisch scheiden sich die Geister an den
Casarecce aus Kichererbsen: Die einen finden die gezwirbelten Nudeln ganz in Ordnung und können sich mit dem süsslichen Aroma schnell anfreunden; die anderen bemängeln den metallischen Nachgeschmack, der sich auch mit einer pikanten Bolognese kaum übertünchen lässt und noch lange im Mund haften bleibt.
Ähnlich verhält es sich bei den Rigatoni aus schwarzen Bohnen. Hinzu kommt hier eine garstige Konsistenz – so muss es sich anfühlen, Holzfaser zu zerkauen . . . Immerhin findet sich auf der Verpackung ein passendes Rezept: Die dunklen Nudelröhrchen lassen sich als Salat anrichten, zusammen mit Tomatenstückchen, Jalapenos (scharfen Paprikaschoten) Mangowürfelchen, Knoblauch, Koriander und Olivenöl. So wird die widerspenstige Ware tatsächlich gefügiger.
Angenehmer in Geschmack und Konsistenz sind die Penne aus gelben Linsen sowie die Fusilli aus grünen Erbsen. Die Eigenaromen der Zutaten sind herauszuschmecken, halten sich aber dezent zurück. Diese Nudeln sind zwar mehliger als jene aus Weizen oder anderem Getreide; aber immerhin weniger trocken als die Variante aus Bohnen. Und sie haben einen guten Biss. Zur mit Gemüsewürfelchen verfeinerten Tomatensauce schmecken die Linsen- und ErbsenNudeln ganz passabel. Daran, sind wir uns einig, könnte man sich wohl gewöhnen.
Fazit der Degustation: Auch wenn Teigwaren aus Hülsenfrüchten mehr gesunde Nährstoffe liefern als jene aus Weizenmehl, lassen sie den Feinschmecker etwas unzufrieden zurück. An original italienische
La Gomera/Kanaren
Das abgeschiedene ökologische Paradies für Familien, Seminare und Individual-Urlauber Hotel Finca El Cabrito, Tel. +34 922 145 005, www.elcabrito.es, info@elcabrito.es









Liegenschaftsverkauf.ch mit Herz persönlich – freundlich 062 77 505 85, Matthias Frutig ganze Schweiz, Sternschnuppen GmbH

Energetische Methode nach Master Choa Kok Sui
Seminare für
• Gesundheit und Wohlbefinden
• Energetische Unterstützung für Geschäfts- und Privatbereich
• Bewusstseins- und Persönlichkeitsentfaltung
Nächstes Basis-Seminar: www.pranichealing.ch


seit 1994 in der Schweiz













❞
An original italienische Pasta reicht nichts heran. ❞
Pasta reicht eben nichts heran. Vor allem dann nicht, wenn man das Glück hat, Selbstproduziertes aufgetischt zu bekommen.
Wieso überhaupt verarbeiten?
Dass Ernährungsgesellschaften ein Loblied auf Hülsenfrüchte singen und dazu aufrufen, aus deren Vielfalt zu schöpfen und mehr davon zu verzehren, ist nachvollziehbar. Und auch aus ökologischer Sicht gibt es gute Argumente für Hülsenfrüchte: «Die Herstellung tierischer Produkte belastet die Umwelt mehr», sagt etwa Corinna Gyssler vom WWF Schweiz. Nachhaltiger sei es deshalb, bei der Eiweiss-Zufuhr vermehrt auf pflanzliche Quellen zu setzen.
Die Frage stellt sich aber, warum aus Linsen oder Bohnen zuerst Pasta hergestellt werden müssen. Ist es nicht sinnvoller, Hülsenfrüchte unverarbeitet zu geniessen, alleine oder zusammen mit – selbstgemachter – Getreide-Pasta? Zumal es dem Körper mit derlei Kombinationen besser gelingt, pflanzliches Eiweiss zu verwerten. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Ragout aus roten Linsen zu Nudeln aus Dinkel, Einkorn, Emmer oder Roggen? Wer es rustikaler mag, kann das volle Korn wählen. Aber Achtung: Weil auch diese Getreidesorten Gluten enthalten, sollte man sie bei Zöliakie strikt meiden.
Unbedenklich bei Glutenunverträglichkeit sind hingegen Nudeln aus dem Pseudogetreide Quinoa. Es lohnt sich der Blick auf die Verpackung, denn es kann anderes Mehl beigemischt sein. Wer dazu wiederum eine Alternative sucht, kann auf den heimischen Buchweizen zurückgreifen. Denn der steht der als Superfood vermarkteten Quinoa in nichts nach. //

Glutenfreie Nudeln aus der asiatischen Küche
Glasnudeln aus Mungo- oder Sojabohnen-Stärke oder Nudeln aus Reismehl zählen zu den klassischen Zutaten in der asiatischen Küche. Sobanudeln sind ebenfalls beliebt. Die japanische Spezialität wird aus Buchweizen hergestellt. Als kalorien- und kohlenhydratarmer Ersatz zu Getreide-Teigwaren gelten KonjakNudeln, auch Shirataki-Nudeln genannt. Sie bestehen aus dem Wurzel-Mehl der asiatischen Konjak-Pflanze, auch als Teufelszunge oder Tränenbaum bekannt. Wegen ihrer weichen und glitschigen Konsistenz sind die Nudeln nicht jedermanns Sache. Immerhin, der unangenehme Geruch verschwindet beim Abspülen und Kochen ... Ebenfalls arm an Kalorien und Kohlenhydraten sind Kelp-Nudeln aus Seetang. Sie sind knusprig und schmecken nahezu neutral. Ein bisschen gummiartig sind Teigwaren aus Edamame, grünen Sojabohnen. Die nussige, leicht süssliche Note passt aber gut zu einer cremigen, hellen Sauce und zartem Gemüse.
Achtung: Bei Glutenunverträglichkeit auf die Zutatenliste achten! Oft wird den an sich glutenfreien Produkten Weizen beigemischt.
UrDinkel-Teigwaren sind eine bekömmliche Alternative zu herkömmlicher Pasta. Für Menschen mit Zöliakie sind sie aber nicht geeignet. Die können diese Rezepte aber auch geniessen –zum Beispiel mit Amaranth, Sorghum, Tapioka oder «alternativen Teigwaren», wie ab Seite 22 präsentiert.
URDINKEL-PENNESALAT
für 4 Personen
Zubereiten: ca. 40 Minuten
Salat
250 g UrDinkel-Penne
Salz
ca. 300 g bunte Cherrytomaten, halbiert
100 g Himbeeren, halbiert
1 Bundzwiebel, in Ringen geschnitten
Sauce
75 g Himbeeren
1 EL Honigsenf
1 TL Rohzucker
2 EL Rotweinessig
3 EL Orangensaft
3 EL Oliven- oder Rapsöl
2–3 EL Tomaten- oder Traubenkernöl
2–3 EL Gemüsebrühe
Salz
frisch gemahlener Pfeffer
einige essbare Blüten, z. B. ungespritzte Rosenblütenblätter
Zubereitung
1 Penne in reichlich Salzwasser al dente kochen, abgiessen, kalt abschrecken.
2 Für die Sauce alle Zutaten fein mixen, würzen.
3 Für den Salat alle Zutaten auf Teller verteilen, mit der Sauce beträufeln. Mit Blütenblättern garnieren.
Tipp
Himbeeren durch Mandeln oder Nüsse ersetzen.

Rezept aus dem «UrDinkel Kochbuch» von Judith Gmür-Stalder.
Dieses ist im Online-Shop auf www.urdinkel.ch oder per Telefon 034 409 37 38 erhältlich.

Rezept aus dem Buch «UrDinkel Pasta» von Judith Gmür-Stalder. Dieses ist im Online-Shop auf www.urdinkel.ch oder per Telefon 034 409 37 38 erhältlich.
URDINKEL-SPAGHETTI MIT LINSEN-KNOBLAUCH-PESTO
für 4 Personen
Zubereitungszeit: ca. 35 Minuten
Linsen-Knoblauch-Pesto
100 g rote Linsen
2–3 Knoblauchzehen, in Scheiben
1 EL Rapsöl zum Dämpfen
1 rote Peperoni, klein gewürfelt
ca. 1,5 dl Gemüsebouillon
1/2 Bund Basilikum oder Petersilie, fein geschnitten
Salz, Pfeffer aus der Mühle
3–4 Esslöffel Rapsöl
UrDinkel-Spaghetti
400 g UrDinkel-Spaghetti
Salzwasser
Petersilie oder Basilikum zum Garnieren
Sbrinz AOP, frisch gerieben
Zubereitung
1 Für das Pesto die Linsen in siedendem Wasser 12–15 Minuten kochen, abgiessen, heiss abspülen und gut abtropfen lassen. Knoblauch im Rapsöl andämpfen. Peperoni kurz mit dämpfen. Mit der Bouillon ablöschen. Linsen und Kräuter beifügen, würzen. Mit dem Rapsöl mischen.
2 UrDinkel-Spaghetti in siedendem Salzwasser al dente kochen, abgiessen, gut abtropfen lassen.
3 UrDinkel-Spaghetti mit der Sauce mischen, auf vorgewärmte Teller verteilen, garnieren und mit Sbrinz servieren.

Das schweisstreibende Thaicurry unter Palmen, die scharfe Harissasauce inmitten des bunten Treibens eines Suks oder die feurige Pasta all’arrabiata auf einer Piazza in Italien werden wir dieses Jahr wohl eher nicht geniessen. Wir müssen also selber zur Chilischote greifen, wenn wir die exotische Schärfe kosten wollen. Das lohnt sich alleweil, denn die scharfe Verwandte der Peperoni, die Chilischote, ist ein derart gesundes Würzmittel, dass es auch bei uns viel häufiger auf den Teller kommen sollte. Gerade im Sommer, wenn der Stoffwechsel bei den heissen Temperaturen eher träge und die Verdauungskraft schwach ist, können scharfe Gewürze Schwung in den Organismus bringen. Zum Beispiel indem man Sommersalate, Grilladen und Dipsaucen mit frischen Chilischoten anreichert.
Durch Gastarbeiter sind Chilischoten, so wie viele andere Gemüsesorten, in den 1950er-Jahren bei uns bekannt geworden. Ursprünglich stammen Chilis aus Süd- und Mittelamerika. Inzwischen sind über den ganzen Erdball hinweg zahlreiche Sorten entstanden, die sich je nach Region unterscheiden. Vor allem Indien, Thailand, Mexiko, Nigeria und Sizilien
sind bekannt für ihre fruchtigscharfen Schoten, die meist von Hand geerntet und an der Sonne getrocknet werden. Die sogenannten Peperoncini, die man oft frisch isst, sind in der Regel mild oder mittelscharf und können mit ihrem fruchtigen Geschmack scharfsüsse Akzente schaffen und so zahlreiche Gerichte verfeinern.
Chilis für Einsteiger kann man im Grossverteiler kaufen; bedeutend vielfältigere Angebote und schärfere Chilis gibt es auf dem Wochenmarkt. Wer es noch differenzierter mag, zieht am besten auf dem Balkon seine eigenen Chilis.
Ihre typische Schärfe verdanken die Chilis dem Capsaicin. Je mehr davon in der Schote enthalten ist, desto schärfer wird die Frucht. Gemüsepaprika enthalten kein Capsaicin, auch die grossen, blassgrünen Peperoni aus der Türkei oder aus Italien sind sehr mild und befinden sich auf der sogenannten SvovilleSkala bei 1. Diese Skala wurde 1912 von einem Pharmakologen entwickelt, der die scharfen Lebensmittel so stark verdünnte, bis keine Schärfe mehr wahrnehmbar war. Die Skala reicht von 1:1 Milliliter bis 1:16 Millionen Milliliter (= 16 000 Liter). Dort, zuoberst auf der Skala, befindet sich das reine Capsaicin. Da jeder Mensch unterschiedlich auf Schärfe reagiert, ist die Skala sicher nicht verabsolutierbar. Man kann aber immerhin sagen, dass, wenn die Gemüsepaprika bei 0–10 liegt, die Tabasco-Sauce bei 5000 und Sambal bei maximal 10 000. Die «Dragon’s Breath»-Chilis, die verdünnt mit 2,5 Millionen Milliliter Wasser noch scharf schmecken, sind dann wohl nur für jene geeignet, deren Geschmacksknospen auf der Zunge bereits vollkommen abgestumpft sind.

In der Heilkunde findet man die Scharfmacher in wärmenden Salben und Wärmepflastern gegen rheumatische Beschwerden. Das Einreiben der scharfen Substanzen regt die Durchblutung an, löst Verspannungen und lindert Muskelschmerzen. Es gibt sogar Forschungsstudien, die der Chilischote ein krebshemmendes Potenzial zuschreiben. Die Forschungsgruppe fand heraus, dass Capsaicin in den Energiestoffwechsel der Krebszelle eingreift und bestimmte Proteine bindet – dadurch stirbt die mutierte Zelle ab. Da gesunde Zellen unversehrt bleiben, ist Capsaicin ein vielversprechendes und nebenwirkungsarmes Heilmittel in der Krebstherapie.
Auch auf das Herz und die Blutgefässe wirkt sich Chili günstig aus: Durch die erhöhte Blutzirkulation kann die Einnahme von Capsaicin zur Reduktion von Cholesterinablagerungen in den Blutgefässen beitragen, generell die Durchblutung und Nährstoffzufuhr in den Organen fördern und die Aufspaltung von Fetten im Darm begünstigen. Das wiederum hilft bei der Ausscheidung von Cholesterin. Eine kräftig gewürzte Ernährung erhöht zudem ganz generell den Stoffwechsel, kurbelt die Fett- und Kalorienverbrennung an und lässt die Pfunde purzeln, was das Herz zusätzlich entlastet. Dazu kommt, das Capsaicin das Wachstum von Bakterien hemmt und Glückshormone ausschüttet.
Wer scharfes Essen liebt , hat also gute Chancen, gesünder und glücklicher zu leben als jene, die sich mit Pfeffer, Salz und Aromat begnügen. Es lohnt sich also, im Bereich des Zumutbaren mit Chili und Co. zu experimentieren. Auch hier gilt natürlich: nicht übertreiben!
SCHARF / Auf Wochenmärkten gibt es oft eine grosse Auswahl an Chili. Man kann sie aber auch leicht selber ziehen. Die scharfen «Früchte» –botanisch gesehen sind es Beeren – wirken durchblutungsfördernd, schmerzstillend, entzündungshemmend und stoffwechselanregend.
Wenn die Schärfe der Chili auf der Zunge ein leichtes Brennen auslöst, reagieren Verdauungstrakt und Stoffwechsel reflektorisch auf diesen feinen Reiz. Die Körpertemperatur erhöht sich, die Verdauung wird aktiviert und wir beginnen zu schwitzen. Es reicht vollkommen, wenn man dem Körper den scharfen Reiz in mehreren kleinen Dosen zumutet. Das bringt viel mehr als feuerspeiende Münder, Schweissperlen auf der Stirn und rote Köpfe. Solche Überdosierungen wären besonders jetzt in den Sommermonaten sehr belastend für den Körper und keinesfalls für jeden Menschentyp geeignet!
Sollte es doch einmal des Guten zu viel sein, weil Sie vielleicht eine harmlos scheinende Chilischote falsch eingeschätzt haben, sollten Sie auf keinen Fall Wasser trinken. Besser ist es, das Feuer im Mund mit Joghurt, Brot, etwas Butter oder einem Stück Käse zu löschen. Und noch ein Tipp für die «Anfänger» in der Verarbeitung von Chilis: Niemals in den Augen reiben, nachdem man Chilis entkernt, geschnitten oder zerbrochen hat! Es ist die Hölle. Das gilt besonders für Kontaktlinsenträger. Waschen Sie die Hände mit Seife, vermeiden Sie es, sich mit den Fingern ins Gesicht zu greifen; tragen Sie allenfalls Handschuhe beim Verarbeiten von Chilis. //
* Sabine Hurni ist dipl. Drogistin HF und Naturheilpraktikerin, betreibt eine eigene Gesundheitspraxis, schreibt als freie Autorin für «natürlich», gibt Lu-Jong-Kurse und setzt sich kritisch mit Alltagsthemen, Schulmedizin, Pharmaindustrie und Functional Food auseinander.

Sonnencreme
Sind Sonnencremes für die Haut bedenkenlos? Ich nehme ab und zu ein kurzes Sonnenbad ohne Schutzcremes, da ich den Eindruck habe, diese trocknen meine Haut aus. M. K., Airolo
Mit dem Sonnenschutz ist es wie mit den Medikamenten: So wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Wenn Sie den ganzen Tag in den Bergen wandern, ist ein guter Sonnenschutz zwingend notwendig. Ebenso am Strand. Ob Sie sich mit einem Hut, adäquater Kleidung, einem Sonnenschirm oder einer Sonnencreme vor der Sonne schützen, ist Ihnen überlassen. Die Haut muss einfach geschützt sein.
Abraten möchte ich vom täglichen Gebrauch von UV-Filtern in Tagescremen. Das ist Unsinn. Mit einem kurzen Sonnenbad wie Sie es beschreiben, verhalten Sie sich genau richtig: Kurze Sonnenbäder in regelmässigen Abständen sind für die Haut viel besser als die jährliche, zweiwöchige Sonnenintensivkur am Strand.
Die Sonnencreme-Industrie macht zurzeit grosse Fortschritte. Es gibt Produkte, die für Mensch und Umwelt wirklich gut verträglich sind. Das Schweizerprodukt «Ultrasun» zum Beispiel erfüllt in Sachen Sonnencreme höchste Ansprüche. Im Fachhandel und im Reformhaus gibt es viele weitere Marken von Herstellern, die ihre Verantwortung wahrnehmen, insbesondere im Bereich der Naturkosmetik.
Was halten Sie von der Urintherapie? In vielen Gesichtscremes ist der Stoff Urea, also Harnstoff enthalten. Warum nicht gleich Urin verwenden? A. W., Langnau
Es spricht grundsätzlich nichts dagegen, abends ein Fussbad zu machen mit einem Schuss Eigenurin. Da es ein Ausscheidungsprodukt unseres Körpers ist, ekeln sich viele Leute davor. Doch gerade bei Hautausschlägen, Neurodermitis oder Psoriasis können Wickel oder Abreibungen mit Eigenurin sehr hilfreich sein. Bei der äusserlichen Anwendung ist unser Ekelgefühl unbegründet. Es ist auch nicht so, dass man danach stinkt, als hätte man sich in die Hose gemacht. Für die Hauttherapie lässt man den Eigenurin 20 Minuten einwirken und wäscht die Haut danach mit klarem Wasser ab. Ein Selbstversuch lohnt sich also alleweil! Vielleicht mit einem vertrauten, ehrlichen Menschen an der Seite, der Ihnen eine Rückmeldung betreffend Uringeruch geben kann.
Starke Menstruation
Ich habe sehr starke Menstruationsblutungen und Gallensteine. Wegen der starken Blutung ist mein Eisenspiegel eher tief. Gibt es eine Teemischung, die für das Eisen und die Galle gut ist ? Kann es sein, dass der Grüntee die Eisenaufnahme behindert ? Ich trinke ihn jeweils nach dem Mittagessen. B. L., Sion
Ich würde Ihnen empfehlen, bei der Menstruation anzusetzen. Also nicht in erster Linie den Eisenverlust zu therapieren, sondern den Hormonhaushalt. Dies mit dem Ziel, dass die Blutung nicht mehr ganz so stark ist.
Ein sehr gutes Kraut zur Linderung einer zu starken Blutung ist die Schafgarbe. Übrigens ist sie auch DIE Heilpflanze bei Gallensteinen. Trinken Sie doch am besten täglich zwei bis drei
Schafgarbentee.

Tassen von diesem Tee; eine davon nach der Hauptmahlzeit. Während der Menstruation darf es ruhig auch mehr sein. Im Weiteren habe ich sehr gute Erfahrungen mit der Gemmotinktur Himbeere gemacht. Gemmotinkturen werden aus den Triebspitzen frischer Pflanzen gewonnen. Die Himbeere wirkt sehr gut auf die Hormonsituation. Es ist ein Spray, den Sie morgens und abends in den Mund sprühen können. Sie bekommen ihn in der Drogerie. Für das Eisen würde ich Ihnen empfehlen, mit Kräutertabletten die Blutbildung zu unterstützen. Oft basieren diese auf der Brennnessel, einer sehr eisenreichen Heilpflanze.
Der Grüntee kann die Eisenaufnahme tatsächlich beeinträchtigen, jedoch nur, wenn Sie ihn unmittelbar zu den Mahlzeiten trinken. Hier unbedingt mindestens eine Stunde Pause einhalten. Bestimmt würde es auch etwas bringen, wenn Sie mit Akupunktur oder Fussreflexzonentherapie
den Energiefluss wieder ins Lot bringen. Falls Ihre Tochter mit einem Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist, würde ich unbedingt die Narbe entstören lassen. Das funktioniert sehr gut über die Fussreflexzonentherapie.
Kann ich die Aufnahme des Vitamins B12 verbessern ? Ich bin Vegetarierin und mein B12-Wert ist eher niedrig, obwohl ich Milchprodukte esse. Kann es sein, dass ich das Vitamin nicht gut aufnehme ?
B. H., Lengnau
Genau wie die Nasenschleimhaut oder die Augen muss auch die Darmschleimhaut feucht sein, um die Funktionsfähigkeit zu wahren. Ist die Darmschleimhaut eher trocken, was mit zunehmendem Alter öfters vorkommen kann, hat es zur Folge, dass gewisse Nährstoffe über die Darmschleimhaut nicht mehr gut aufgenommen werden können. Neben der Einnahme von B-Vitaminen wäre es wichtig, dass Sie die Darmschleimhaut mit Ihrer Ernährungsweise gut pflegen. Starten Sie mit einem Präparat, das die Darmflora aufbaut. Dieses nehmen Sie zwei bis drei Wochen lang ein. Sparen Sie nicht beim Öl und bei den Fetten. Kochen Sie mit Ghee (reine Bratbutter), geben Sie Olivenöl über die Speisen und essen Sie trockene Speisen wie Brot und Kräcker nur mit Aufstrich. Täglich eine Handvoll Mandeln, Sonnenblumenkerne, Leinsamen (gut kauen und danach ein Glas Wasser trinken) oder Kürbiskerne liefern gesunde Fette, die dem Darm guttun. Für die Darmgesundheit sind auch Sauerkraut, Nori- und ChlorellaAlgen wichtig. Diese Lebensmittel sind

Trockenes Brot besser mit Aufstrich essen.
Die magensaftresistente Kapsel löst sich gezielt im Darm.


Gaspan® –bei Blähungen, Druck- und Völlegefühl in der Bauchgegend mit leichten Krämpfen.
9 Hilft bei Verdauungsbeschwerden
9 Pflanzlich aus Pfefferminzund Kümmelöl
9 Gut verträglich Blähungen? Völlegefühl? Bauchkrämpfe?
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage.
Arbeitsbedingungen an Spitälern – eine Gefahr für Patientinnen und Patienten ?
Die Corona-Pandemie hat bewirkt, dass die anspruchsvolle Arbeit von medizinischem und pflegerischem Personal mehr beachtet und auch mehr geschätzt wird. Und dies zu Recht: Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger arbeiten häufig unter kritischen Bedingungen, manchmal sogar unter dem Radar des Arbeitsgesetzes. Der Spardruck im Gesundheitswesen und die damit verbundenen Kostensenkungsmassnahmen setzen nicht nur die Entscheidungsträger im Gesundheitswesen, sondern auch das Fachpersonal in eine Stresssituation. In einer Umfrage des Verbands der Schweizerischen Assistenz- und Oberärzte aus dem Frühjahr 2020 gibt jeder zweite Befragte an, in den letzten zwei Jahren Gefährdungen durch übermüdete Ärzte erlebt zu haben.
Die beschriebene Situation hat auch Konsequenzen für Patientinnen und Patienten: Medizinische und betreuerische Leistungen von gestressten Fachpersonen bergen eine erhöhte Gefahr, nicht in der gewohnten Qualität erbracht zu werden. So viel ist klar: Die hohe Qualität in Schweizer Spitälern ist nur mit guten Arbeitsbedingungen möglich. Es bleibt zu hoffen, dass die CoronaPandemie ein erneutes Schlaglicht auf diese Entwicklung geworfen hat. Susanne Gedamke, Präsidentin des Gönnervereins
Mehr zum Thema Patientenrecht unter Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz, www.spo.ch Telefonische Beratung via Hotline 0900 567 047, Fr. 2.90/Min. Im Rahmen der SPO-Mitgliedschaft erhalten Sie diese Beratung unentgeltlich (044 252 54 22).
ausserdem gute Vitamin-B12-Lieferanten auf pflanzlicher Basis. Denn nur weil Sie vegetarisch leben, muss der B12-Spiegel nicht zwingend tief sein. Auch im Vollfett-Käse, Joghurt und in Eiern ist reichlich Vitamin B12 enthalten. Problematischer ist die Versorgung bei Menschen, die sich über längere Zeit vegan ernähren.
Wie kann man aus ayurvedischer Sicht Maden- resp. Fadenwürmer im Darm bekämpfen ? Mein achtjähriger Sohn und meine Frau sind mit Würmern befallen. Meine Frau stillt noch. T. M., Urnäsch
Um den Wurmzyklus zu durchbrechen, ist die Hygiene das A und O. Sie sollten alle die Fingernägel sehr kurz halten und täglich mit einer Bürste und Seife schrubben; ebenso die Hände regelmässig gut putzen. Über Nacht können die beiden enge Unterhosen tragen, die man jeweils mit dem Kochwäsche-Programm wäscht. Wenn immer möglich: nicht kratzen, da auf diese Weise die Wurmeier an die Finger und ins Gesicht gelangen.
Im Ayurveda werden Wurmerkrankungen mit Bitterstoffen behandelt. Zu den bittersten Gewürzen zählen Bockshornkleesamen und Kurkuma. Ihr Sohn und Ihre Frau können drei Mal täglich fünf Bockshornkleesamen schlucken – nicht kauen, da sie sehr hart sind –, am besten zusammen mit einer Tasse warmem Kurkumawasser. Bockshornklee fördert gleichzeitig die Milchbildung bei Ihrer Frau. Bei uns kennt man Wermut und Enzian als Antiwurmmittel. Es sind die beiden bittersten Heilpflanzen überhaupt und Ihr Sohn wird sich weigern,

auch nur einen Schluck von so einem Tee zu trinken. Deshalb würde ich bei ihm eher auf ein Glas Karottensaft, morgens nüchtern getrunken, und rohe Karotten setzen, die er täglich essen sollte. Dies über zwei bis drei Wochen hinweg.
Wenn Sie damit keinen Erfolg haben, wäre es angezeigt, beim Kinderarzt oder in der Apotheke ein Wurmmedikament zu holen.
Trockene Scheide
Seit den Wechseljahren ist meine Scheide sehr trocken und meine Nägel sind brüchig und splittern. Hormone möchte ich nicht nehmen. Was habe ich für andere Möglichkeiten ? P. K., Nyon
Wenn nach den Wechseljahren das Östrogen fehlt, leiden viele Frauen an einer trockenen Scheide. Dadurch wird die Schleimhaut dünner und empfindlicher. Zum Schutz der Haut ist es wichtig, dass Sie den Intimbereich täglich mit einem guten Öl pflegen; geeignet sind Pflanzenöle wie Mandel-, Oliven- oder Sesamöl ohne Zusätze. Auch eine Fettsalbe, zum Beispiel Bepanthen, erfüllt diesen Zweck. Probieren Sie aus, was für Sie angenehmer ist. Sehr wohltuend ist es auch, wenn Sie einen Tampon mit Öl aufsaugen und diesen über Nacht einführen.
Zur Stärkung der Nägel schwören viele Frauen auf die Mineralsalzkombination Nr. 1 (Calcium fluoratum) und Nr. 11 (Silicea) der Mineralsalze nach Dr. Schüssler. Sie sorgen für Elastizität und Feuchtigkeit. Auch die Nägel werden mit den Mineralsalzen stärker. Gute Erfahrungen mache ich auch mit den Hirsana-Kapseln. Sie enthalten Hirseöl, Biotin, Pantothensäure, Vitamin E und weitere Nährstoffe, die für Haare und Nägel sehr wichtig sind. Die Pantothensäure befeuchtet zudem den Körper. Das Präparat könnte Ihnen in vieler Hinsicht guttun.
Damit Sie auch über die Ernährung Feuchtigkeit in den Körper bringen, wäre es gut, wenn Sie eher gekochte Speisen zu sich nehmen, Suppen und Saucen, aber auch saftige Früchte und stark wasserhaltiges Obst wie Gurken. Sie dürfen durchaus etwas grosszügig sein mit den Fetten, sofern Sie gesunde, pflanzliche Fette oder reines Ghee

Mandelöl.
(ayurvedische Bratbutter) verwenden. Die Fette kommen bei vielen Leuten zu kurz. Sie sind aber wichtig, um die Darmschleimhaut zu befeuchten und die fettlöslichen Vitamine gut aufnehmen zu können. Man muss den Körper deshalb täglich innerlich mit gesunden Fetten schmieren. Sie können zum Beispiel abends einen Teelöffel Leinöl mit etwas warmem Wasser trinken, vor dem Zubettgehen. Das ist übrigens auch ein wunderbares Hilfsmittel bei Verstopfung.
Schwitzen
Ich (65) habe mehrmals pro Tag und auch in der Nacht Schweissausbrüche. Meine Werte sind alle normal, ich bin nicht gestresst und esse gesund. Was könnte Linderung verschaffen ?
M. M., Wohlen
Das Schwitzen kann sehr viele Ursachen haben: ein letzter Schub der Wechseljahre, ein Ungleichgewicht im Säure-Basen-Haushalt, zu viel erhitzende Lebensmittel, Stress oder auch eine organische Ursache. Wenn sich nichts verändert, wäre eine Untersuchung beim Hausarzt sicherlich sinnvoll.
Bis dahin kann ich Ihnen Folgendes empfehlen: Verzichten Sie beim Essen auf zu Saures, Salziges und sehr Scharfes (Chili); auch den Kaffeekonsum sollten sie zumindest ein bisschen reduzieren.
Zur Regulation der Schweissproduktion haben sich die beiden Schüsslersalze Nr. 8 und Nr. 11 bewährt. Lösen Sie dreimal täglich je zwei Tabletten
davon in etwas warmem Wasser auf und trinken Sie dieses dann. Ausserdem könnten Sie täglich zwei Tassen Salbeitee trinken. Salbei ist ein sehr gutes Heilmittel gegen übermässiges Schwitzen. Falls das Schwitzen noch mit den Wechseljahren zusammenhängt, ist Cimicifuga, die Traubensilberkerze, die Heilpflanze der Wahl.

Sabine Hurni, Drogistin, Naturheilpraktikerin und Ayurveda-Expertin, beantwortet Ihre Fragen zu Gesundheits- und Ernährungsthemen persönlich und ganzheitlich. sabine.hurni@chmedia.ch oder «natürlich», Leserberatung, Neumattstr. 1, 5001 Aarau. www.natuerlich-online.ch




Ehret und preiset das einzig wahre Heilmittel, die vera unica medicina ! So hoch verehrt der Ehrenpreis früher war, wird das Pflänzchen heute fast nur noch von achtsamen Spaziergängern gepriesen, welche das schöne Wegerichgewächs am Wegrand entdecken.
Text: Steven Wolf
Die himmelblauen Ehrenpreisblüten leuchten bezaubernd schön in Rasenflächen und Wiesen. Weltweit gibt es über 450 Arten der Pflanzengattung Ehrenpreis (Veronica). Hierzulande kennen viele die gängigeren Arten wie zum Beispiel den Gamander- (V. chamaedrys) und Acker-Ehrenpreis (V. agrestis) oder den Efeu-Ehrenpreis (V. hederifolia). Diese Arten verwandeln den Boden über weite Flächen hinweg in ein blaues Meer; sie holen, sinnbildlich gesprochen, mit ihren unzähligen zierlichen Blüten den Himmel auf die Erde. Weniger bekannt ist der Echte Ehrenpreis (Veronica officinalis), der auch Wald-Ehrenpreis genannt wird und in einem hellen blaulila Ton blüht. Bei unseren Vorfahren galt dieser als sehr wichtiges und heiliges Kraut, das als Grundheilkraut, Heil aller Welt oder auch Heil aller Schäden bezeichnet wurde. Das kommt nicht von ungefähr, kam der Echte Ehrenpreis doch bei sehr vielen Beschwerden zum Einsatz.
Noch vor nicht allzu langer Zeit ordnete man den Ehrenpreis den Braunwurzgewächsen (Scrophulariaceae) zu; heute zählt er zur Familie der Wegerichgewächse (Plantaginaceae). Er mag windgeschützte Standorte, ist sommerwärmeliebend und bevorzugt nährstoffreiche, lehmhaltige Böden. Sein Wesen ist relativ nässescheu und es verabscheut gedüngten Boden. Der Echte Ehrenpreis ist deshalb vorwiegend in trockenen, lichten Wäldern, an Waldrändern, abgeholzten Flächen, Hecken und an Wegrändern zu finden.
Das Pflanzenwesen wahrnehmen
Einen grossen Teil seines Lebens verbringt der Ehrenpreis in unmittelbarer Nähe zu Mutter Erde: Die zarte Pflanze wächst nicht in die Höhe, sondern bildet mit ihren schlängelnden, oberirdischen Ausläufern, die sich immer wieder neu verwurzeln, regelrechte
Blütenkissen. Seine Ausläufer und die grünlichen, fast silbriggrauen Blätter sind auffallend weich behaart. Die Laubblätter sind eher breit, eiförmig, gegenständig angeordnet und am Rand leicht gesägt. Erst in der Blütenzeit, von Mitte Mai bis Ende August, streckt sich der Ehrenpreis zum Himmel hoch und beginnt aufzustängeln. So kann er eine Höhe von 10 bis 15 Zentimeter erreichen. Die Blüten wachsen, wie Trauben, an einer Rispe und meist nur im oberen Drittel der Pflanze. Sie bestehen aus vier Kelchblättern, die in zarten Blau-Violett-Lila-Tönen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Wenn ich mich hinsetze, um die feinstoffliche Ebene eines Pflanzenwesens während einer meditativen Kontaktaufnahme auf mich wirken zu lassen, nehme ich den Ehrenpreis als ein schlangen- und drachenähnliches Wesen wahr. Es bewegt sich schlängelnd und meinen Körper umwindend von den Füssen her aufwärts in Richtung Kopf, um in meinem Kopf seine volle Blütenkraft zu entfalten. Dabei nehme ich eine angenehme Reduzierung der Wärme in meinem ganzen Körper wahr, vor allem in meinem Haupt. Ich beginne mich zu entspannen. Die Gedanken und die Welt um mich herum werden still. Dann durchdringt ein leises Raunen, ein zärtliches Flüstern meine Wahrnehmung. Die Atmung wird tief und ich beginne loszulassen. Nach und nach stellt sich ein
* Steven Wolf hat schon als Kind von seiner Grossmutter altes Pflanzenwissen gelernt und weiss um die Kraft der Natur mit all ihren sichtbaren und unsichtbaren Wesen. Er lebt im Jurtendorf in Luthernbad, wo er zusammen mit seiner Partnerin ganzheitliche Pflanzenkurse für interessierte Menschen durchführt. www.pflanzechreis.ch
wolfs heilpflanze | gesund werden

ALLERWELTSHEIL | Der Echte Ehrenpreis ist eine äusserst vielseitige Heilpflanze. Er soll sogar vor Flüchen und Behexung schützen. Und Teemischungen verleiht er eine harmonische Note.
| Lore ad quas dolore volles sitecea tibusa volupid ipsumque aut aci ventem netur sequi.

Schule für Sterbeund Trauerbegleitung

Berufsbegleitende ein- oder zweistufige Ausbildung mit namhaften Gastdozenten:
Anouk Claes, Rosanna Abbruzzese, Dolly Röschli, Kurt Nägeli, Antoinette Bärtsch, Pete Kaupp, Renate von Ballmoos, Marcel Briand, Karin Jana Beck, Nel Houtman, Kokopelli Guadarrama, u.a.

● Für eine Tasse Tee braucht es zwei Teelöffel Ehrenpreis: einfach mit kochendem Wasser übergiessen und 5 Minuten ziehen lassen. Dreimal täglich je eine 1 Tasse davon trinken. Das treibt den Harn und den Schweiss, wirkt blutreinigend und senkt die Blutcholesterinwerte.
● Für einen Umschlag ein Baumwolltuch in Ehrenpreistee tränken und dann auf die Wunden oder Hautausschläge legen. Dies hilft gegen Entzündungen und Verletzungen.
● Einen starken Tee kann man auch als Mundspülung und Gurgelmittel nutzen. Das hilft bei Zahnfleischbeschwerden, Entzündungen und Mandelerkrankungen.
● Ein besonders wirksamer Tee gegen Hautjucken im Alter besteht aus Ehrenpreis, Baldrianwurzel und Holunderblüten in gleichen Teilen. Ein Esslöffel dieser Mischung mit einer Tasse Wasser in der Pfanne kurz aufkochen und danach 15 bis 20 Minuten ziehen lassen. Täglich zwei bis drei Tassen trinken.
Die Baldrianwurzel beruhigt die Nerven und die Zellen der Haut, was die Reduktion von Juckreiz unterstützt.
● Alle Arten des Ehrenpreises sind essbar und eignen sich für die Wildkräuterküche. Dazu sammle man das blühende Kraut für Salate und Suppen. Getrocknet und grob zerkleinert dient es als herb aromatisches Würzmittel.

GamanderEhrenpreis.
Nächster Ausbildungsbeginn: Samstag, 27. März 2021
«Die Tränen der Freude und der Trauer fliessen aus derselben Quelle»

Zentrum Jemanja
Ifangstrasse 3, Maugwil 9552 Bronschhofen Telefon 071 911 03 67 info@jemanja.ch www.jemanja.ch
Gefühl der Ruhe ein. Zufriedenheit und das Gefühl von tiefer Verbundenheit erfüllen mich. Ich fühle mich Ganz. Die Freiheit, die Grenzenlosigkeit des Himmels ist plötzlich zum Greifen nah.
Ein älterer Name des Echten Ehrenpreises lautet «Grindheil». Das kann man in zweierlei Hinsicht deuten: Zum einen, dass der Ehrenpreis bei Kopfschmerzen eingesetzt wurde – die kühlen Farbtöne der Blüten deuten auf eine beruhigende, erfrischende und entspannende Wirkung der Kopfregion hin. Die Heilpflanze eignet sich also für Menschen, die viel geistige Arbeit verrichten müssen oder bei Nervosität, Schwindel und Schwermut infolge von geistiger Überanstrengung. Sogar bei Gedächtnislücken und zur Stärkung des Erinnerungsvermögens kann ich den «Grindheil» einsetzen. Zum anderen bedeutet «Grind» auch Schorf oder Kruste. Und tatsächlich wirkt der Ehrenpreis innerlich und äusserlich hervorragend bei Milchschorf von Babys. Ebenso bei chronischen Hautleiden wie Ekzemen, Neurodermitis, Schuppenflechte, Krätze, Altersjucken oder Akne. Und auch bei Verbrennungen und entzündeten Wunden verschafft «Grindheil» Linderung.
Ehrenpreis ist mit seiner flächigen Ausbreitung ein wunderbarer Bodendecker. Diese Wuchsart, gepaart mit den zarten, ja schon fast hinfälligen Blüten, signalisiert mir Schutz und Grenzen, was hervorragend passt zur Haut. Und da die Haut ein Spiegel unserer Gefühlswelt ist, verwende ich den Ehrenpreis sehr gerne bei Hautproblemen mit emotionalem Hintergrund.
In seiner deutlichen Blattausprägung und der feinen Behaarung wiederum erkenne ich seine lungenstärkende Wirkung. Das bestätigt die Laboranalyse: Der Echte Ehrenpreis enthält viel Aucubin. Dieser sekundäre Pflanzenstoff wirkt stark antibakteriell, entzündungshemmend und reizmildernd. Daher nutze ich den Ehrenpreis gerne bei einer Sommergrippe mit Erkältungsbeschwerden, wie Husten, Katarrh oder Verschleimung der Atemwege. Auch Menschen, die empfindlich auf Schimmelpilzsporen reagieren, können von der Wirkung des Ehrenpreis profitieren.
In seinem schlängelnden Wuchs mit unzähligen Ausläufern erkenne ich zudem ein vermittelndes, verbindendes Prinzip: den Götterboten Merkur. Aber da ist noch mehr versteckt im nicht sichtbaren Bereich, denn einer seiner weiteren Namen, Allerweltsheil, weist mich auf die höhere Oktave des Merkurs hin –quasi auf sein höheres Selbst, den Planeten Chiron. Ihm sind Dünndarm, Stoffwechsel und Unterleib zugeordnet – Unterleibsbeschwerden, Verdauungsstörungen und Darmentzündungen sind sein Gebiet. Chiron werden allgemein Pflanzen zugeordnet, die fast alles heilen können, so wie eben der Echte Ehrenpreis.
Die Kraft des Ausgleichs
Diese dem Ehrenpreis innewohnende Kraft kann mich rasch ins Gleichgewicht bringen. Sie hilft mir, das Energiezentrum zwischen den Augenbrauen, das dritte Auge, weiter zu öffnen, meine Sinne zu schärfen und meine Beobachtungsgabe immer präziser werden zu lassen, um mich noch tiefer mit meiner inneren Göttlichkeit zu verbinden. Auf der psychischen Ebene wirkt der Ehrenpreis der Tendenz entgegen, sich mit selbstkritischen, ständig nörgelnden Gedanken und destruktiven Energien zu belasten. In der alten Volksheilkunde gehörte der Ehrenpreis denn auch zu den «Beschreikräutern». Damit sind Pflanzen gemeint, die gegen das Verfluchen und Verhexen schützen.
Wenn sich schlimme Vorahnungen im Kopf festsetzen oder mich ein Schaudern erfasst als Vorbote eines Übels, kann es helfen, in aller Ruhe durchzuatmen und einen Tee aus Ehrenpreis zu trinken. Dieses wunderbare Pflanzenwesen hilft mir, mich von negativen Gedanken und bösen Geistern abzugrenzen und mich wieder selbst zu spüren. Es hilft auch, meine eigenen Gefühle von den Gefühlen anderer klar zu unterscheiden. Es geht darum, mich frei zu machen vom Urteil anderer und meinen eigenen Weg zu gehen. Wenn jeder eine eigene, stabile emotionale Haltung erlangt, ist ein Leben in Gemeinschaft besser lebbar.
Der Ehrenpreis ist allgemein ein wunderbarer Verbinder und rundet viele Teemischungen, Ölauszüge, Tinkturen, Bachblüten und Wildkräutergerichte ab. Auch solche, die nicht wirklich harmonieren. Die stärkste Heilkraft übrigens besitzen jene Ehrenpreispflanzen, die unter Eichen wachsen. Mit etwas Glück kann man dort sogar einige der seltenen, ausschliesslich weiss blühenden Exemplare finden. //



Unsere Lieblingsmusik lässt uns leicht und beschwingt fühlen, entspannt unsere Sinne, weckt Erinnerungen und nährt die Seele; sie schenkt uns Glücksgefühle, lässt uns tanzen und jauchzen. Musik kann aber noch viel mehr. Sie kann heilen.
Text: Carmelina Bonanno


MUSIK wirkt heilend und aktivierend auf betagte Menschen und Frühgeborene.
« Wenn man wissen möchte, ob ein Königreich gut regiert ist, ob seine Moral gut oder schlecht ist, liefert die Qualität seiner Musik die Antwort. »
Konfuzius, 551–470 v. Chr.
Eine leichte Schwingung vibriert durch den Körper; die Augen sind geschlossen, warme Klänge durchdringen Raum und Sinne. Einige Menschen liegen unter dem Piano, andere wiederum sitzen meditativ auf der Bühne und im Publikum. Sie lauschen fasziniert der 432 Herz Translational Music des weltbekannten Zellbiologen und Musikers Emiliano Toso. Körper und Gesichtszüge entspannen sich immer mehr, viele sind emotional berührt, haben Tränen in den Augen.
Toso spielt seine Musik mit akustischen Instrumenten, die auf 432 Hz gestimmt sind. Diese Frequenz soll die Synchronisation beider Gehirnhälften stimulieren, besonders Entspannungszustände fördern, Stress redu zieren und die Konzentrationsfähigkeit und Kreativität steigern (siehe Box rechts). «Normalerweise hören wir Musik, die sich auf der Frequenz von 440 Herz bewegt. Diese ist leicht verschieden von der universellen Sprache des Körpers und der Natur. Auf 432 Herz gestimmte Musik ist im Einklang mit dem Puls der Erde und reflektiert die Gesetzmässigkeiten und die Harmonie der Natur.»
Tosos Musik wird von vielen Krankenhäusern, Gesundheits- und Meditationszentren genutzt, ebenso von Künstlern aller Art zur Förderung ihrer Kreativität. Wer Tosos Musik hört, erfährt Entspannung und Stille von Geist und Körper. Sie soll den Kontakt mit unserer tiefsten, spirituellsten Essenz bis in die Zellebene erleichtern.
Musik in der Intensivstation
In seinen Studien untersucht Toso die Beziehung zwischen Musik und Zellen sowie die biophysikalischen Effekte wie Wohlergehen und Heilung im Körper. «Wer meine Konzerte in 432 Hz hört, fühlt sich sofort zu Hause und im Einklang mit den Frequenzen, die wir in der Natur antreffen. Wenn wir an unserer Gesundheit arbeiten wollen, ist es wichtig, dass wir in der gleichen Sprache sprechen wie die Natur», sagt er. «Wenn ich spiele, spiele ich mit der Intention der Liebe. Ich glaube, die Liebe ist eine der stärksten Vibrationen, die zur Heilung beitragen.»
Auch in einigen Schweizer Krankenhäusern wird die heilende Kraft der Musik erfolgreich über alle Fachbereiche hinweg angewendet. Wie z. B. in der Neonatologie
432 Hertz – die Frequenz für eine harmonische Welt
Damit sie miteinander harmonieren, werden in der Musik alle Instrumente auf die gleiche Frequenz, d. h. Tonhöhe gestimmt. Diese wird in Hertz (Hz) gemessen (Anzahl Schwingungen pro Sekunde). Den Referenzton nennt man Kammerton oder auch Stimm- und Normalton. Vor 1939 war er auf 432 Hz gestimmt. Die grossen Komponisten wie Beethoven, Brahms, Haydn, Händel oder Mozart haben ihre Werke für diese Tonlage geschrieben.
Schon die Sumerer, Hebräer und alten Ägypter sollen ihre Instrumente nach dem Kammerton 432 Hz gestimmt haben. Und auch Pythagoras verwendete diesen Referenzton, der deshalb auch als «pythagoreische Sexte» bezeichnet wird. 432 Hz gilt als natürliche Tonfrequenz, die mit dem Menschen, der Natur und dem Kosmos in Ein-Klang schwingt.
1939, unmittelbar vor dem 2. Weltkrieg, wurde bei einer
int. Konferenz in London der Kammerton in vielen Ländern auf 440 Hz festgelegt. In deutschen und österreichischen Sinfonieorchestern ist jedoch sogar 443 Hz üblich, in der Schweiz 442 Hz. Damit ist der moderne Kammerton etwa ¼ Ton höher als der ursprüngliche. Kritiker sagen, diese modernen Frequenzen seien unharmonisch und würden die Aggressivität fördern. Immer wieder haben Musiker, etwa John Lennon oder Luciano Pavarotti, dafür plädiert, den Kammerton wieder auf 432 Hz zu setzen. Der Unterschied ist beträchtlich, das kann jeder selbst hören, z. B. auf YouTube (432 Hz eingeben). Zunächst hört sich die umgestimmte Musik falsch an; das ist wohl der Gewohnheit geschuldet. Denn viele Menschen berichten, dass sie mit 432 Hz-Musik besser entspannen können und eine 432-Hz-Stimmgabel eine besonders heilsame Schwingung habe. krea

Musik statt Medikamente?
Seit Urzeiten wird Musik von vielen Völkern zu Heilzwecken genutzt. Die positiven Effekte auf das psychische und physische Wohlbefinden sind in vielen Studien wissenschaftlich belegt: Musik reduziert Stress, fördert Kreativität und Konzentration, entspannt bei medizinischen Eingriffen und lindert z. B. Depressionen. Die Zeitschrift Nature berichtet über die Veränderung der Biochemie des Körpers, wenn Menschen Musik mit bestimmten Eigenschaften hören, wie z. B. den Anstieg des «Glückshormons» Oxytocin oder auch Dopamin. Diese sind für unser Wohlbefinden verantwortlich.
Wo finde ich einen Therapeuten?
Eine Therapeutenliste findet sich auf der Webseite des Schweizerischen Fachverbandes für Musiktherapie (SFMT) www.musictherapy.ch
Wer trägt die Kosten?
Die Kostenübernahme durch die Krankenkassen wird unterschiedlich gehandhabt; es empfiehlt sich eine Abklärung bei der jeweiligen Krankenkasse. Viele Krankenhäuser bieten Musiktherapie ohne zusätzliche Kosten an.

am Universitätsspital Zürich (USZ). Das Licht in der Intensivstation für Frühgeborene ist gedämmt, die Stimmung wirkt ruhig, nur durch regelmässiges Piepsen unterbrochen. Bei jedem Inkubator steht ein Liegestuhl, bei Bedarf können die Eltern einen Vorhang ziehen, damit sie mehr Privatsphäre haben.
Ab der 25. bis zur 27. Schwangerschaftswoche nimmt das Kind im Mutterleib Klang und Stimmen wahr. Deshalb reagiert das Neugeborene sehr oft auf die ihm bereits vertraute Stimme der Mama. «Im Mutterleib hören die Kinder den Herzschlag und das Rauschen vom Blut der Mutter. Man nimmt an, dass diese optimale Sinneswelt im Mutterleib zu einer optimalen Entwicklung im Hirn der Kinder führt. Da setzt die Musiktherapie an», sagt die Musiktherapeutin Friederike Haslbeck. Musik, Klang und Sprache fördern die Hirnentwicklung und sind die Voraussetzung, um kommunizieren und sprechen zu lernen.
Von der Wiege bis zur Bahre
Friederike Haslbeck gehört zu den Pionierinnen der wissenschaftlichen Forschung von Musiktherapie in Europa. Ihre jüngste Studie im USZ belegt, dass sich die Entwicklung des Gehirns der Kinder mit Musiktherapie stark verbessert und einen signifikanten Unterschied zu Kindern ohne Musiktherapie aufweist. Dazu gehören vor allem Gehirnregionen, die für Konzentration, Koordination und Gefühlskontrolle ausschlaggebend sind. Sie sagt: «Die Musik entsteht in der Beziehung. Die Mutter singt für ihr Baby nicht nur zur Beruhigung, sondern auch um Nähe, Sicherheit und Geborgenheit zu spenden.»
Haslbeck singt für die Frühgeborenen gemeinsam mit den Eltern oder auch alleine, wenn die Eltern nicht anwesend sein können. Die Musiktherapie dauert in der Regel 20 bis 30 Minuten und findet zwei bis drei Mal pro Woche statt. Oft begleitet Haslbeck ihre Lieder mit den zarten Klängen des Monochords, einem einfachen Saiteninstrument. «Musik kann eine Brücke bilden und Emotionen auffangen. Gerade Eltern, die ein Frühgeborenes haben, trauern oft um die verkürzte Schwangerschaft. Die Mütter haben das Kind oft nicht einmal gespürt im Bauch. Da ist es wichtig, dass wir die Eltern in ihrer Elternrolle stärken und die Bindung zum Kind unterstützen.»
Zellavie® Frühstücksmüesli Rezeptvorschlag:
Für 1 Person
1–2 EL Haferflocken
10g Zellavie® Bio-Leinsamenr
1/2 KL Kurkuma
1/2 KL Zimt
1 Prise Vanillepulver
1 Prise Nelkenpulver
1 Apfel, in Stücke geschnitten 1dl Milch, nach belieben
Haferflocken, Leinsamen, Gewürze und Apfel-Stücke mit Milch vermischen. Besprinkeln mit Samen, Kernen, Nüssen, Rosinen, Cranberries nach Lust und Laune und geniessen.

10 g Zellavie® Bio-Leinsamen decken Ihren täglichen Bedarf an Omega-3-Fettsäuren Bestellen unter : www.zellavie.ch
« Mit Musik kannst du alles vergessen – oder dich an alles erinnern. » Fatima Urbano
Auch immer mehr Alters- und Pflegeheime setzen auf Musiktherapie, vor allem bei Demenzkranken. «Die Musik hilft uns, mit den Bewohnern in Verbindung zu treten. Im leichten Anfangsstadium der Demenz wird durch Klänge und Gesänge die Sprachfähigkeit gefördert und versucht, diese so lange wie möglich zu erhalten.» sagt Fatima Urbano, Leiterin soziale Betreuung der SAWIA Alterswohnungen in Zürich. Bei Menschen mit fortgeschrittener Demenz dämmt die Musik zudem gewisse typische Verhaltensweisen wie Unruhe, Unsicherheit oder Stress ein, beruhigt und entspannt. «In sehr weit fortgeschrittenen Demenzfällen ermöglicht die Musik es uns, uns den Menschen anzunähern. Denn Demenzkranke verlieren die Fähigkeit zu kommunizieren, ihre Wünsche und Bedürfnisse mitteilen zu können. Die Musik erlaubt uns eine Türe zu öffnen und einen Zugang zu diesen Menschen zu finden.» Insbesondere auch das gemeinsame Singen von altbekannten Liedern hat einen gesundheitsfördernden Effekt, wirkt sich positiv auf die Herzfrequenz und die Atmung aus, fördert die Stimmung und das Rhythmusgefühl. Mit dem Spielen von Instrumenten wie Rasseln, Xylophon oder Trommel wird die Feinmotorik gefördert und das Bewusstsein geschärft, dass Hände und Füsse bewegt werden können.
Bei Hirnschlag und Demenz
Eine finnische Studie aus dem Jahr 2010 zeigt, dass Schlaganfallpatienten, die die Sprachfähigkeit verloren hatten, durch Musiktherapie besser genasen. Andere wissenschaftliche Forschungen belegten, dass die Patienten die Sprache schneller wiedererlangen, indem sie lernen zu singen, bevor sie versuchen zu sprechen. Dies beruht auf der Tatsache, dass die Sprachfunktionen in der linken Gehirnhälfte und Musik in der rechten Gehirnhälfte verarbeitet wird. Daher ist trotz Sprachverlust das Summen oder Singen immer noch möglich. Ist die Sprachfähigkeit durch einen Schlaganfall oder eine Hirnverletzung verloren gegangen, kann die rechte Gehirnhälfte trainiert werden, diese Funktionen zu übernehmen.
Demenzkranke verlieren nach und nach das Sprachund Erinnerungsvermögen. Zuerst wird das Kurzzeitgedächtnis beeinträchtigt; das Langzeitgedächtnis bleibt länger erhalten und die Musikerinnerung ist die letzte, die
man verliert. Daher ist trotz Demenz sogar das Erlernen eines Instrumentes möglich. «Menschen können vergessen, was vor 30 Sekunden passiert ist, aber ohne Zweifel können sie sich an die erste Kommunion erinnern», sagt Fatima Urban. «Einmal habe ich mit einer Frau gearbeitet, die kein Wort sprach, sich an nichts mehr erinnern konnte, auch nicht an ihre eigenen Kinder. Ich spielte ein bekanntes Lied vor und die Frau begann zu singen, intonierte, vokalisierte – sie erinnerte sich! Nur mit Singen konnten wir mit ihr kommunizieren – und sie ihre Emotionen ausdrücken.
Musik weckt aber nicht nur Erinnerungen, sie beeinflusst auch unsere Stimmung. Fast jeder von uns hört täglich Musik. Je nachdem wie wir uns fühlen, wählen wir ein bestimmtes Lied oder die Art der Musik. Unsere Stimmung kann sich schlagartig ändern, unsere Laune sich heben, Frust kann abreagiert werden, wir erfahren Entspannung, oder finden sogar Trost in einer bestimmten Melodie.
Doch was steckt genau dahinter? Die Musik-Streaming-Plattform Deezer wollte es wissen: Sie beauftragte die britische Akademie für Klangtherapie herauszufinden, ob es eine optimale tägliche «Dosierung» und Art von Musik gibt, die den Menschen hilft gesund zu bleiben. Die Forschungsergebnisse zeigten, dass nur schon etwa 13 Minuten täglich Musik hören – ausgewählt je nach Stimmung – für unser Wohlbefinden ausreichen. Wir sollten also unsere Musik je nach Laune zusammenstellen und uns täglich kleine musikalische Pausen gönnen. //
Wolfgang Zeitler «Auditive Musiktherapie – Heilsames Musikhören, mit Erfahrungsberichten und Musikbeispielen», Tredition 2016, ca. Fr. 65.–
Friederike B. Haslbeck «Wiegenlieder für die Kleinsten. Ausgewählte Lieder von Eltern für Eltern frühgeborener Kinder», amia musica 2018. Das Büchlein kann auf https://amiamusica.ch/wiegenlieder/ für Fr. 15.– bestellt werden.
Weil Ihnen Natürlichkeit beim Wohnen so wichtig ist wie sonst im Leben.
Casafair ist der Verband für verantwortungsbewusste und weitsichtige Wohneigentümer*innen, ökologisches Bauen und gesundes Wohnen. www.casafair.ch
Jetzt Mitglied werden!


Bei Stress, inneren Konflikten oder unterdrückten Emotionen schenken wir dem Atem häufig zu wenig Aufmerksamkeit und er gerät aus dem Takt. Findet der Atem längerfristig nicht in seinen Rhythmus zurück, kann es zu unangenehmen Symptomen kommen, wie verminderte Leistungsfähigkeit oder Verdauungsbeschwerden.
Text: Evelyne Kernen
Hauptakteur in der Atemfunktion ist das Zwerchfell. Der scheibenförmige Muskel liegt unterhalb der Lunge zwischen der Brust- und Bauchhöhle und steht mit den meisten lebenswichtigen Organen im direkten Austausch. Für die ruhige und tiefe Bauchatmung (Zwerchfellatmung) ist er unabdingbar.
Mit der Einatmung wird Sauerstoff aufgenommen, der grösste Teil der wichtigen Stoffwechselenergie für die Organe. Mit der Ausatmung wird das Stoffwechselabfallprodukt, das Kohlendioxid, wieder abgegeben. Die Leistungsfähigkeit unseres Körpers hängt ganz wesentlich von diesem Austauschprozess ab. Der Atem passt seinen Rhythmus unweigerlich jeder Belastung an: Schnelleres Gehen oder das Tragen von schweren Lasten hat unmittelbar eine tiefere Atmung zur Folge. Sobald wir zur Ruhe kommen, beruhigt sich auch der Atem wieder. Unsere Atmung ist also sehr flexibel.
Das Anpassen der Atmung an die körperliche Aktivität ist das eine; der Atem reagiert aber auch sen-

Online die besten Therapeutinnen und Therapeuten finden
Sanasearch.ch ist die grösste Online-Plattform für die private Therapeutinnen- und Therapeutensuche im Bereich Naturheilkunde. Neben persönlichen Sprech- und Behandlungsterminen bieten viele Mitglieder von Sanasearch.ch auch Videokonsultationen an. www.sanasearch.ch
sibel auf alle Dinge, die rund um und mit uns geschehen. Wir atmen im Alltag also nicht den ganzen Tag entspannt in den Bauch; bei Anspannung und Ängsten geht der Atem schneller und flacher. Mit der Entspannung wird der Atem wieder langsamer und tiefer. Das ist gut so, denn der ideale Atem ist der variable Atem, der sich den Lebenssituationen immer wieder flexibel anpasst. Aber was, wenn die flache Atmung nicht mehr zu ihrer Tiefe und der Mensch damit nicht mehr zum Wohlbefinden zurückfindet?
Wenn der Atem ausser Takt gerät, kann die Atemtherapie helfen. Im Erstgespräch sind nicht nur die primären, das heisst vom Klienten selber genannten Symptome wichtig; auch das Atemmuster, Spannungs-, Haltungs- und Bewegungsbilder der Klienten, der Klang ihrer Stimme sowie ihre Befindlichkeiten werden beobachtet. Oftmals behindern Fehlspannungen in den Muskeln die Atmung und die Fehlatmung fixiert wiederum die Spannung – ein Teufelskreis, aus dem die Atemtherapie helfen kann.
Das Therapieangebot ist vielseitig und wird während der Behandlung dem Beschwerdebild immer wieder angepasst. Bei stressbedingten Symptomen sind Entspannungs- und Zentrierungsübungen wichtig. Diese können mittels Atem- und Bewegungsübungen induziert werden. Die Atembehandlung ist eine behutsame, gezielte Art der Körpertherapie und wird meistens über der Kleidung angewendet. Ohne direkt in das Atemgeschehen einzugreifen, wird die Atembewegung des Klienten durch Berührung, Dehnung und Bewegung sanft gelenkt. Das Ziel der Behandlung ist eine ausgeglichene Wohlspannung und ein frei fliessender Atem. Unterstützend dabei ist die Sensibilisierung für das Körperempfinden. Atemfülle und -flexibilität sorgen für frischen Schwung und mehr Energie für den Alltag und das Üben eines Ruheatems lässt schneller und besser in die Entspannung kommen. Beides ist wichtig für einen gut funktionierenden Organismus und für das persönliche Wohlbefinden. Den Ruheatem kann man überall und jederzeit anwenden. Bewusstes langsames Aus- und Einatmen ist eine simple Übung mit effizientem Erholungseffekt. // www.atempraxis-kernen.ch

« Der Atem kommt nicht zur Ruhe
»
In letzter Zeit fällt mir auf, dass ich unter Zeitdruck hektisch atme. Dazu fühle ich ein Kribbeln in den Fingern und manchmal ist mir auch schwindlig. Jetzt tritt das neu auch in entspannten Situationen auf. Was stimmt mit meiner Atmung nicht?
Marina Ackermann, 53 Jahre
Das klingt im ersten Moment nach akuter Hyperventilation, also einer Überatmung als Stressreaktion. In der Atemtherapie lernen Sie Atemübungen kennen, die regulierend und beruhigend wirken. Die Atembehandlung wirkt ausgleichend und reduziert Stresssymptome. Als erste Massnahme empfehle ich Ihnen, in der Akutsituation jeweils beide Hände gewölbt vor Mund und Nase zu halten und gegen Ihre Hände ein- und auszuatmen. In der Regel beruhigen sich die Symptome innerhalb kurzer Zeit.
* Evelyne Kernen ist eidg. dipl. Atemtherapeutin und Mitgründerin des Atemfachverbandes Schweiz (AFS) und therapiert seit dem Jahr 2002 in ihrer eigenen Praxis in Baden (AG) und ist Ausbildungsleiterin an der Fachschule LIKA in Stilli. Sie ist Teil des Schweizer Therapeutennetzwerks Sanasearch.ch. Das Online-Netzwerk vereint qualifizierte Therapeuten im Gesundheitsbereich und hilft aktiv bei der Suche nach dem passenden Therapeuten in der Nähe via Live-Chat. Termine bei Evelyne Kernen können über natuerlich@sanasearch.ch, www.natuerlich-online.ch oder direkt auf www.sanasearch.ch gebucht werden.

Wir schätzen Naturschwämme für die Hautpflege. In den Stoikern der Ozeane schlummert aber auch ein vielversprechendes medizinisches Potenzial –und damit die Gefahr der Ausbeutung.
Text: Gundula Madeleine Tegtmeyer
Schwämme sind lebende Fossilien, vermutlich die direkten Nachfahren des ersten Urtiers, des Urmetazoons, aus dem sich alle höheren Lebewesen entwickelt haben. Schwämme sind also ein evolutionäres Erfolgsmodell – mit verblüffenden Eigenschaften. Schon vor 700 Millionen Jahren lebten sie in allen Weltmeeren. Wobei Ur-Schwämme noch aus eigenem Antrieb über den Meeresboden laufen konnten. Im Laufe der Evolutionsgeschichte wurden sie sesshaft; heute leben sie sessil, das heisst am Meeresboden festgewachsen, wo sie vor sich hin strudeln, tagaus tagein, und dies mit einer erstaunlichen Lebensdauer von bis zu mehreren Tausend Jahren. Wer festsitzt, muss clevere Überlebensstrategien entwickeln. So können Schwämme nicht aktiv nach Nahrung suchen; diese muss also zu ihnen kommen. Immerhin: In gemässigten Breiten und kühleren Meeren wedeln sich Schwämme mittels bewimperter Zellen
« Schwämme sind die Bauplangeber für viele biotechnische Prozesse. »
Werner E. G. Müller, Molekularbiologe


Dabei werden Zellkomplexe an der Oberfläche des Mutterindividuums abgeschnürt und es entstehen Tochterindividuen. Manche spült es weg und sie werden an einem anderen Ort sesshaft. Andere wachsen am Mutterorganismus weiter, so entstehen Kolonien.
aktiv Wasser zu; daraus filtert der Schwamm winzige Nahrungspartikel wie Plankton und Bakterien. In tropischen Gewässern ernähren sich Schwämme von den Stoffwechselprodukten ihrer Lebenspartner – Algen oder Bakterien –, mit denen sie hoch spezialisierte synergetische Gemeinschaften eingehen.
Die wissenschaftliche Klassifizierung des Schwammes ist Porifera ferre, was «porentragend» bedeutet und sie treffend beschreibt: Schwämme sind Tiere, die aus feinen, wasserdurchlässigen Poren bestehen. Ihr Gewebe besteht aus Zellen, die auch einzeln überlebensfähig sind. Zusammen leisten sie eine koordinierte Arbeitsteilung und dies, obwohl Schwämme weder Gehirn, Nervenzellen noch Organe oder Muskeln haben (siehe S. 46). Schwämme sind asexuell; sie vermehren sich durch einen Prozess, der Knospung oder Sprossung genannt wird.
Wer wie Schwämme nicht vor natürlichen Frassfeinden und unerwünschten Eindringlingen fliehen kann, muss raffinierte Verteidigungsstrategien entwickeln. Schwämme setzen dabei auf die chemische Keule. Sie produzieren unter anderem hochwirksame antibiotische Stoffe, die Bakterien daran hindern, ihre Aussenhaut zu überwuchern. Es sind archaische Stoffwechselfunktionen, die da wirken. Tatsächlich laufen in Schwämmen mehr Stoffwechselprozesse ab als in jedem anderen Lebewesen. Hier setzt die pharmakologische Schwamm-Forschung an.
Es sind also ihre vielen verschiedenen Substanzen, ihr chemischer Schutzcocktail, der die Schwämme für die Medikamentenforschung interessant macht. Wissenschaftler versuchen diese Substanzen nachzubauen. Der Fundus ist riesig, denn jeder Schwamm bildet spezifische Gemeinschaften mit bestimmten Mikroorganismen. Aus dieser für jeden Schwamm einzigartigen Symbiose resultiert eine Vielzahl bioaktiver Stoffe; darunter Stoffe, die Tumore am Wachsen hindern. So wurde beispielsweise der
Wirkstoff Eribulin aus dem Schwamm Halichondria okadai im Labor nachgebaut. Seit 2011 ist Eribulin unter dem Handelsnamen Halaven © zur Behandlung von lokal fortgeschrittenem metastasierendem Brustkrebs zugelassen.
«Schwämme sind die Bauplangeber für viele biotechnische Prozesse», resümiert Molekularbiologe Werner E. G. Müller, Pionier auf dem Gebiet der Schwammforschung und Professor beim Institut für Physiologische Chemie der Universitätsmedizin Mainz. In den 1990er-Jahren gelang es ihm, die Erbanlage der Schwämme zu entschlüsseln. Seinen ersten wissenschaftlichen Coup landete er indes bereits 1977: In Zusammenarbeit mit anderen Forschern war es ihm gelungen, das Molekül Ara-A aus dem karibischen Schwamm Cryptotethya crypta zu isolieren – ein Molekül, das die Erbgutvermehrung des Herpes-Krankheitserregers lahmlegt.
Aktuell forscht Müller an Polyphosphaten. Diese kommen im menschlichen Körper nur geringfügig vor, in Schwämmen hingegen reichlich, erklärt er. «Das ist ein interessanter Aspekt für die regenerative Medizin.» Untersuchungen haben gezeigt, dass Wunden mithilfe von Polyphosphaten aus Schwämmen besser heilen. Und weil biochemisches Polyphosphat nicht toxisch ist, eignet es sich sogar für Diabeteswunden. Polyphosphate unterstützen aber nicht nur die Regeneration der Haut, sondern auch die von Zähnen, Knochen und Knorpel.
Da Schwämme ihre Abwehrstoffe nur in geringen Dosen abgeben, ist der Nachbau der Natursubstanzen im Labor eine wesentliche Bedingung für die industrielle Produktion – und unabdingbar, damit die Weltmeere nicht noch weiter ausgebeutet werden.
Auch der tropische Schwamm Theonella swinhoei birgt ein grosses Arsenal an hochbioaktiven Substanzen. «Diese Stoffe werden momentan näher untersucht und analysiert», berichtet Schwammexperte Peter Schupp, Professor an der Universität Oldenburg. Rege Schwämme wie T. swinhoei oder Cryptotethya crypto sind laut Schupp besonders für die Krebs-, aber auch für die Antimalariaforschung interessant. Theonella swinhoei bezeichnet er gar als «Superschwamm». «Wir haben in ihm verschiedene bioaktive Stoffe entdeckt und einige isoliert, darunter tumorhemmende, antimikrobielle, antivirale und zytotoxische Verbindungen.» Letzteres sind Substanzen, die Zellen und Gewebe schädigen. Die Produzenten der bioaktiven Stoffe sind übrigens nicht die Schwämme selbst, sondern die Bakterien, mit denen die Schwämme in Symbiose leben. Ob die Stoffe von T. swinhoei tatsächlich als Anti-Krebsmittel beim Menschen infrage kommen, wird derzeit analysiert. «Es gibt noch keine zugelassenen Medikamente, aber klinische Studien an Patienten», sagt Schupp zum aktuellen Stand der Forschung. Er sieht zudem hinsichtlich der Antibiotika-Forschung in den Schwämmen ein vielversprechendes Potenzial. Zu
Koralle oder Schwamm?
Korallen sehen zwar aus wie Pflanzen, sind aber am Untergrund festgewachsene, koloniebildende Nesseltiere, wobei die meisten der mehr als 5000 bekannten Korallen zu den Blumentieren zählen. Nesseltiere sind Gewebetiere und besitzen als solche echtes Gewebe und Organe. Wenn viele Korallen dicht gedrängt gedeihen, spricht man oft auch von Korallengärten. Man unterscheidet unter anderem zwischen Weich- und Steinkorallen.

Letztere bilden durch Einlagerungen von Kalk Skelette, durch die Korallenbänke oder -riffe entstehen, da das tote Skelettmaterial fortwährend von lebendigem Gewebe überwuchert wird. So haben Korallen über viele Millionen Jahre das grösste Bauwerk der Welt erschaffen: das Great Barrier Reef vor der Küste Australiens.
Schwämme sind noch einfacher gebaut als Korallen: Sie bilden einen Tierstamm
innerhalb der Gewebelosen. Im Unterschied zu den Gewebetieren haben die Gewebelosen keine Organe. Heute sind über 7500 Schwammarten bekannt. Sie leben wie Korallen festsitzend, bevorzugt auf Hartboden; sie können aber auch Überzüge auf Pflanzen oder Muschel- und Schneckenschalen bilden. Schwämme und Korallen kommunizieren über ihren Stoffwechsel miteinander. krea
« Wunden heilen mithilfe von Polyphosphaten aus Schwämmen besser. »

seinem Bedauern zieht die Pharmaindustrie bislang nicht mit und argumentiert, Erreger seien schnell antibiotikaresistent. Schupp vermutet indes, dass auch ökonomische Gründe der Pharmakonzerne eine Rolle spielen, denn die Entwicklung von neuen Antibiotikastoffen ist kostenintensiv. «Der Nachbau von komplexen Schwammstoffen und Schwammbakterien, die Antibiotika produzieren, ist eine enorme wissenschaft liche Herausforderung», sagt er. «Schnelle Erfolge sind nicht zu erwarten.» Erfolge aber schon. Denn die Weltmeere bedecken 70 Prozent unseres Planeten und bislang wurden nur etwa fünf Prozent erforscht. Auf dem Meeresboden schlummern also noch viele Rätsel und Geheimnisse, denen Meeresbiologen und Biochemiker auf den Grund gehen. //

«Wenn mir das Leben langweilig vorkommt …
… lausche ich dem Rascheln im Gras. Spannend, was man dabei alles hört!»
Ein Tipp von David F., blind
Wir Blinden helfen gerne, wenn wir können. Bitte helfen Sie uns auch. www.szb.ch Spenden: PK 90-1170-7
S ie versalzt jede Harmonie, jedes Vertrauen, jedes Glück. Sie ist die Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft – und doch gilt sie als Beweis für Liebe. Wer den oder die Liebste stärker an sich binden will, zieht oft an den Strippen der Eifersucht, flirtet hier und dort, erhöht den eigenen Marktwert und schaut zu, wie das Blut des geliebten Menschen in Wallung gerät. Dann weiss sie oder er: Ich bin ihm oder ihr wichtig. Sie oder er gehört mir. Aber mal ehrlich: Wollen Sie in so einer Partnerschaft leben?
E ifersucht gehört so wenig zur Liebe wie Asthma zu einer gesunden Atmung. Denn im Zustand der Eifersucht bin ich alles andere als liebend – ich bin voller Wut, Selbstmitleid und Rachegedanken. Allerdings sind auch diejenigen unter uns, die die Eifersucht als Glücksverderber entlarvt haben, selten immun dagegen. Die Angst, den geliebten Menschen zu verlieren, kriecht uns in die Knochen und kühlt unsere Herzen aus. Schliesslich kennen wir Verlust von klein auf; wir alle haben einmal jemanden verloren, den wir von ganzem Herzen geliebt haben, und dieser Schmerz war unerträglich. Das wollen wir nie wieder erleben. Deshalb wollen wir irgendwie sichergehen, dass dieser Partner bei uns bleibt. Eifersucht ist da nicht nur ein Leiden, sondern auch ein Mittel, dem anderen permanent ein schlechtes Gewissen zu machen. «Wo kommst du her? Was hast du so lange im Büro gemacht? Warum hast du dieser Frau/diesem Mann hinterhergeschaut?» So wird aus der Liebes affäre ein Gefängnis. Es gibt Paare, die trotzdem zusammenbleiben – aber die Liebe kommt meistens unter die Räder.
„ Eifersucht gehört so wenig zur Liebe wie Asthma zum Atmen.“
D och wie kommen wir raus aus der zerstörerischen Eifersuchtsspirale? Durch Treue! Und zwar als Erstes die Treue zu uns selbst. Obsessive Eifersucht ist oft ein Zeichen dafür, dass wir uns von unseren eigenen Lebensimpulsen abgeschnitten haben: Niemand kann uns lieben, wenn wir nicht wir selbst sind. Das spüren wir und schieben dem anderen dafür die Schuld in die Schuhe. Bei starker Eifersucht sollten wir uns also selbst fragen: Wer bin ich? Was liebe ich wirklich? Und was will ich im Leben? Darüber hinaus meine ich die Treue zu dem, was wir im Anderen lieben. Haben wir nicht einmal sein Wesen geliebt, seine Freiheit, seine Lebendigkeit? Und wollen wir die nun tatsächlich einsperren und kontrollieren?
S abine Lichtenfels, die Gründerin der Liebesschule von Tamera, schreibt: «Treue ist Vertrauen: Man vertraut einander, weil man weiss, dass der andere einen nicht belügt. Man lässt sich in der Treue auch nicht beirren durch Fehltritte des anderen. Man ist herzlich gern bereit zur Vergebung, wenn der Irrtum eingesehen wird. Treue ist ein aktives Ja zum Partner: Mit diesem Menschen will ich ein gemeinsames Leben führen, ich will ihn nicht belügen, ich will ihn unterstützen und seiner Entwicklung dienen, so gut ich kann. Ich will täglich neu meine Nachlässigkeiten ihm gegenüber erkennen und überwinden, will mit ihm ein sexuelles Leben führen, das nicht der Alltäglichkeit anheimfällt. Ich will dafür sorgen, dass genügend Spannung und gelegentlicher Abstand in unserer Beziehung bleibt, um uns immer wieder von Neuem begegnen zu können. Ich möchte die wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben mit ihm zusammen treffen, und ich bin im Grunde meiner Seele davon überzeugt, dass wir nie auseinandergehen.» So spricht die Stimme der Treue, wenn sie aus freier Liebe spricht. Meine Antwort auf die Verlustangst ist einfach: Ich verlasse nicht mehr! //

● Leila Dregger ist Journalistin und Buchautorin ( u. a. «Frau-Sein allein genügt nicht», Edition Zeitpunkt ). Sie begeistert sich für gemeinschaftliche Lebensformen und lebt seit 16 Jahren in Tamera, Portugal, wo sie beim Verlag Meiga und der Globalen Liebesschule mitarbeitet.
Holen Sie sich neue Impulse an den Seminaren des Forum für Komplementärmedizin
Holen Sie sich neue Impulse an den Seminaren des Forum für Komplementärmedizin
Weiterbildung mit Spass und Inspiration!




Weiterbildung mit Spass und Inspiration
Achtsamkeit und mentales Training
DO | 22. August 2019
8800 Thalwil
Wer öfters unter Sodbrennen leidet, sollte am besten süsse, fettreiche und scharfe Speisen meiden oder einschränken. «natürlich» sagt, was sonst noch hilft.
• Gut essen
Wer zu Sodbrennen neigt, sollte süsse, fettreiche und scharf gewürzte Speisen meiden. Lässt sich dies (etwa bei einer Einladung) nicht vermeiden: Schaffen Sie eine «magenfreundliche» Grundlage, indem Sie vorher etwas Pellkartoffeln, Pasta oder Joghurt essen. Tipp für zwischendurch: Ein Glas Wasser trinken oder ein Stück trockenes Brot kauen – das «entschärft» die Säure. Auch ein eiweissreiches Dessert wie Quark oder Joghurt hilft, die Magensäure zu neutralisieren.
• Wenig Alkohol und Koffein
Meiden Sie insbesondere gesüsste alkoholische Getränke wie Likör oder Punsch, da diese die Magensäureproduktion erhöhen. Statt zu schwarzem Kaffee lieber zu Cappuccino oder Latte Macchiato greifen.
• Bequeme Kleidung
Enge Hosen, Röcke und Gürtel können Druck auf den Bauchbereich ausüben, den Mageninhalt nach oben drücken und so Sodbrennen verstärken.
Daher möglichst lockere Kleidung oder solche mit hohem Stretch-Anteil tragen.
• Richtig liegen
Stellen Sie das Kopfteil des Bettes 10 bis 15 Zentimeter höher. Dadurch kann die Magensäure nicht so leicht in die Speiseröhre zurückfliessen. Oder: Legen Sie sich auf die linke Seite. Studien belegen, dass der «Säureangriff» beim Liegen auf der rechten Seite länger dauert.
• Was gegen Brennen und Aufstossen hilft
Bei akuten Beschwerden können säurehemmende Mittel (Antazida) helfen. Entsprechende Präparate sind rezeptfrei in Apotheken erhältlich.
Wichtig: Antazida sollten nicht länger als drei Tage hintereinander eingenommen werden.
Eine Alternative zu Medikamenten bieten Heilpflanzen mit krampflösender Wirkung wie Kümmel, Fenchel und Anis. Auch das Trinken von Wasser mit Natron wirkt entsäuernd.
Diabetes, Demenz, Eisenmangel und Fettstoffwechsel
MO | 26. August 2019
Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise und erweitern Sie dabei Ihren persönlichen und beruflichen Horizont.
4600 Olten
Bei Schleimhautreizungen sind Leinsamen ein gutes Mittel. Am besten zwei- bis dreimal täglich 1 EL ganze Leinsamen mit Wasser einnehmen.
Bei Völlegefühl können Extrakte aus Kreuzkümmel oder Artischocken die Fettverdauung anregen und die Verdauung entlasten. Entsprechende Präparate sind rezeptfrei in Apotheken erhältlich.
Die Wirkung positiver und lösungsorientierter Sprache
Unser Seminarangebot umfasst verschiedene Bereiche von Alltag und Gesundheit.
DI | 27. August 2019
8800 Thalwil
Interessiert?
Auch Akupressur beruhigt den Magen: Finger auf den Daumenballen legen und Richtung Daumen gehen. Den Magenpunkt mindestens 30 Sekunden kräftig drücken. MM
Koreanische Handtherapie
DO | 29. August 2019
4600 Olten
Mehr Informationen und den Anmeldelink finden Sie auf der Website: www.forum-cam.ch
Interessiert?
Mehr Informationen und den Anmeldelink finden Sie auf der Website: www.forum-cam.ch



Die auferlegten Einschränkungen in diesem Frühjahr, diese unfreiwillige Entschleunigung, hatte nebst Schwierigem und Tragischem durchaus auch Befreiendes – und ich mache mir nun Gedanken über selbst gewählte Grenzen. Denn ich bin überzeugt: Grenzen können heilsam sein.
Dass der Mensch seine Grenzen kennt, ist nicht nur heilsam für ihn selbst – unser Planet konnte in der Zeit der Flug- und Mobilitäts-Abstinenz wieder atmen. Unsere Erde und wir Menschen brauchen frische Luft; frische, gute, pure Luft aber gibt es in unseren Tagen nur, wenn wir uns begrenzen. Vielleicht ist es wieder Zeit für ein altes Wort: Askese. Ich meine damit nicht eine auferlegte Selbstkasteiung; vielmehr eine Einfachheit, die eine Zuwendung zum Leben ermöglicht, die uns bewegt und ergreift – und uns damit in eine grössere innere Freiheit führt.
Diese innere Freiheit hat damit zu tun, dass ich immer besser weiss, wer ich wirklich bin und den Mut habe, mich nicht anzupassen. Muss ich denn auch das grosse Auto fahren oder auf Bali und in Alaska Selfies knipsen, nur weil alle es tun? Nichtanpassung bedeutet Entscheidung zum Eigenen, und damit zum Wesentlichen. Das scheint mir gerade für die heutige Zeit ein zentrales Merkmal zu sein, das uns gemeinsam weiterbringt.
Kurse im Lassalle-Haus
Zen, Traumarbeit und luzides Träumen
Meditieren und Klarträumen erlernen
19. bis 24. Juli
So. 18.30–Fr. 13.00 Uhr
Der Weg der Meditation im Yoga
Mit Yoga in die Stille gehen
24. bis 26. Juli
Fr. 18.30–So. 13.30 Uhr
Auszeit zur rechten Zeit
Innehalten und Neugestalten
30. Juli bis 7. August
Do. 18.30–Fr. 16.00 Uhr
Jüdische Meditation
Kabbala und chassidische Gesänge entdecken
11. bis 14. August
Di. 18.30–Fr. 13.00 Uhr
Das Buch Jona:
Einst war Gesellschaft gleichbedeutend mit Grenzen: Klassengrenzen, Geschlechtergrenzen, Grenzen zwischen Milieus, Berufen usw. Heute scheint die Gesellschaft keine Grenzen mehr zu kennen. Gesellschaft ist ein Spielfeld der tausend Möglichkeiten, einer schier unendlichen Freiheit. Gerade dies jedoch kann wiederum Diktat und Begrenzung werden. Immer könnte noch etwas Besseres kommen – dieses Offenhalten lässt den Menschen an der Oberfläche kleben, er verliert sich und dreht sich um sich selbst.
Sich entscheiden und auch bescheiden führt vom Vielen zum Wenigen, vom Belanglosen zum Wesentlichen. «Entschieden leben» möchte ich es nennen oder «beglückende Begrenzung». Entschieden auch im Umgang mit den kleinen Dingen, das gibt im Alltag kleinen, beglückenden Freiheiten Raum. Oft hat es mit Annehmen dessen zu tun, was gerade ist, auch wenn es zunächst nichts Gutes verheisst.
Letzthin musste ich unfreiwillig zwei Stunden auf eine Gruppe warten. Ich ärgerte mich, versuchte mir einzureden, dass es gar nicht so schlimm sei, begann mich abzulenken. Untergründig jedoch blieb der Ärger. Erst als ich mich entschieden hatte, auf einer Parkbank sitzend das kleine Schicksal des Wartens anzunehmen, eröffnete sich mir ganz leise Zufriedenheit – ja, eine kleine Freiheit. //.
Tod, Auferstehung und was dazwischen geschieht Bibel spirituell gelesen: eine jüdisch-christliche Begegnung
14. bis 16. August
Fr. 18.30–So. 13.30
Infos und Anmeldung : Telefon 041 757 14 14 info@lassalle-haus.org www.lassalle-haus.org

Das Lassalle-Haus in Edlibach ist ein von Jesuiten geführtes interreligiöses, spirituelles Zentrum mit einem breiten Kursangebot, das von Zen-Meditation über Natur seminare bis zu klassischen Exerzitien reicht. Für «natürlich» schreiben der Jesuit Tobias Karcher und die Pfarrerin Noa Zenger abwechselnd die Kolumne «Gedankensplitter».
* Noa Zenger (44) ist reformierte Pfarrerin. Sie wohnt und arbeitet im Lassalle-Haus Bad Schönbrunn, dem Bildungszentrum der Jesuiten in Edlibach ZG.
gewusst

Zahlreiche Studien haben nachgewiesen, dass häufige Aufenthalte in der Natur die Gesundheit fördern, etwa, indem sie stressabbauend wirken. Das hilft z. B. bei der Vorbeugung von Herz- und Kreislaufkrankheiten. Nun zeigt eine neue, von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL geleitete Studie: Je artenreicher der Garten, desto grösser ist dessen Erholungswert für den Gärtner oder die Gärtnerin. Vor allem Familiengärten leisten einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit von Stadtbewohnern. Sie sind auch wichtige Lebensräume und Verbreitungskorridore für wilde Tiere und Pflanzen. Das Fazit der Forscher: «Stadtgärten sollten einen festen Bestandteil der grünen Infrastruktur von Städten sein.» wsl.ch

Sommerzeit ist Gewitterzeit. Blitze bieten ein spektakuläres Schauspiel; sie sind jedoch durchaus auch gefährlich: In einem Blitz treten innert Sekundenbruchteilen Stromstärken auf, die im Durchschnitt 20–30 Millionen Volt und 20 000 Ampere betragen (normale Steckdose: 250 Volt, 10 Ampere). Dieser Starkstrom erhitzt die den Blitz umgebende Luft schlagartig auf circa 30 000 Grad Celsius. Dabei dehnt sich die Luft explosionsartig mit einem lauten Knall aus: Es donnert. Der Blitz kann einige Kilometer lang sein. Deshalb erreicht der Schall aus entfernteren (oberen) Teilen des Blitzes einen bestimmten Punkt später als aus dem nahen (unteren) Teil, was ein ausgedehntes Rollen des Donners zur Folge hat. Um die Entfernung zu schätzen, zähle man die Sekunden zwischen Blitz und Donner und multipliziere sie mit 333. Das Ergebnis entspricht dem Abstand des Gewitters in Metern.
Eine Bauernregel sagt: «Vor Eichen sollst du weichen, die Buchen sollst du suchen». Allerdings sollte man diesem Ratschlag auf keinen Fall Folge leisten, denn Bäume sowie andere hoch aufragende Gegenstände sollten bei einem Gewitter gemieden werden! Denn es besteht gerade dort eine grosse Gefahr, dass der Blitz einschlägt. Auch das Baden oder Surfen in Gewitternähe ist gefährlich, denn wie man auf dem Bild deutlich erkennen kann, schlägt der Blitz auch immer wieder in Gewässer ein. In einem Auto hingegen ist man vor Blitzen geschützt, da die Metallkarosserie den Blitz bei einem Einschlag aussen herum in die Erde ableitet (Faradaykäfig). Allerdings sollten das Dach und die Fenster geschlossen sein. Andreas Walker

In importiertem Obst und Gemüse finden sich Rückstände zahlreicher bei uns verbotener Pflanzenschutzgifte. Das zeigt eine Analyse der Nichtregierungsorganisation «Public Eye». Demnach sind mehr als zehn Prozent der Proben betroffen: 220 von 1940. Bei vielen der nachgewiesenen Rückstände handelt es sich um Pestizide, «die bei langfristiger Exposition selbst bei niedrigen
Dosen verheerende Auswirkungen auf die Gesundheit haben können», erklärt Public Eye. Mehrere der gefundenen
Pestizid-Rückstände sind Wirkstoffe, die auch vom Basler Agrochemiekonzern Syngenta exportiert werden. So zum Beispiel das am häufigsten nachgewiesene Nervengift Profenofos. «Public Eye» spricht von einer inakzeptablen
Doppelmoral: «Wenn ein Land Pestizide wegen ihrer Gefährlichkeit verbietet, sollte es weder seinen Unternehmen erlauben, diese zu exportieren, noch die Einfuhr von damit hergestellten Lebensmitteln zulassen.» infosperber.ch
Grüntee
Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass bestimmte Darmmikroben allergische Immunreaktionen und somit auch Nahrungsmittelallergien hervorrufen können. Grüntee kann diesen Prozess positiv beeinflussen, wie Forscher der japanischen Shinshu-Universität herausgefunden haben. Grüntee könnte somit ähnlich wie Kefir oder Sauerkraut probiotisch wirken und die Darmflora positiv beeinflussen. krea


Austern, Hirn, Zunge, Insekten oder Froschschenkel –widern Sie solche Nahrungsmittel an? Was geht im Gehirn vor, wenn wir uns ekeln? Welche Funktion hat Ekel bei der Herausbildung kultureller Identität? Und warum dreht sich die Abneigung meist um Fleisch? Die neue Sonderausstellung der Nestlé-Stiftung – «Beurk! Yuck! Igitt! The food we love to hate» – beleuchtet unser nicht immer stringentes Verhältnis zum Essen. Die Ausstellung bietet eine interaktive und praktische Geschmackserfahrung des Ekligen, Stinkenden, Hässlichen, Muffigen, Schleimigen und Unbekannten. Wie weit gehen Sie an der «Verkostungsbar der anderen Art», um Ihren Ekel zu überwinden ?
● Sonderausstellung
«Beurk! Yuck! Igitt! The food we love to hate» bis März 2021
Alimentarium, Ernährungsmuseum in Vevey www.alimentarium.org

Umstrittene «Satelliten-Autobahn»
Wer in einer klaren Nacht den Himmel beobachtet, kann kurz vor oder nach der Dämmerung helle Punkte sehen, die sich zügig bewegen. Es sind Satelliten, die in grosser Höhe noch von der Sonne beschienen werden, während auf der Erdoberfläche bereits die Nacht hereingebrochen ist. Dies ist an sich nichts Besonderes, kreisen doch unzählige Satelliten um die Erde. Neu ist die Tatsache, dass seit Ende Mai 2019 Dutzende von Satelliten, einer Perlenkette gleich, in einer Linie hintereinander ihre Bahnen am Himmel ziehen. Es handelt sich dabei um die Starlink-Satelliten.
Starlink ist ein vom US-Raumfahrtunternehmen
SpaceX von Elon Musk (investierte 2004 in den Fahrzeughersteller Tesla) und Gwynne Shotwell geplantes weltumspannendes Satellitennetzwerk. Es soll ab Ende 2020 den schnellen Internetzugang zuerst in Nordamerika, 2021 dann fast weltweit ermöglichen. Zurzeit befinden sich mehrere Hundert Starlink-Satelliten in einer Erdumlaufbahn.
Insgesamt bestehen bis zum Jahr 2027 befristete Genehmigungen für den Start von maximal 11 927 Satelliten sowie Anträge von SpaceX für nochmals bis zu 30 000 Satelliten.
42 000 Satelliten entsprechen etwa der fünffachen Menge aller von 1957 (seit Sputnik 1) bis 2019 gestarteten Satelliten.
Es verwundert denn auch nicht, dass immer mehr Kritik gegen dieses Projekt laut wird. 42 000 Satelli-
Das Bild zeigt die Leuchtspur (Mitte oben) von Starlink 6 am Abend des 24. April über dem Bodensee (Standort Rorschacherberg, SG). Es sind 60 Satelliten, die am 22. April 2020 in Cape Canaveral, Florida, gestartet wurden und alle in einer Linie hintereinander über dem Nachthimmel ihre Bahnen ziehen. In der Bildmitte: die Venus als brillanter Abendstern.
ten sind eine Menge Weltraumschrott, wenn sie ausgedient haben. Dies sollte jedoch kein Problem sein, denn die Starlink-Satelliten verfügen über genügend Treibstoffreserven, um sie am Ende ihrer Nutzungsdauer wieder aus der Umlaufbahn zu entfernen. Bei den rund 9000 für niedrige Umlaufbahnen vorgesehenen Satelliten reicht bereits die atmosphärische Reibung, um sie nach einem Ausfall der Steuerung innerhalb von fünf Jahren zurück auf die Erde stürzen zu lassen, damit sie in der Atmosphäre verglühen.
Die Astronomen sind trotzdem wenig begeistert von dieser Riesenmenge an Satelliten. Schon die Lichtverschmutzung der Städte hat dazu geführt, dass mehr als zwei Drittel der Amerikaner und mehr als die Hälfte der Europäer die Milchstrasse nicht mehr sehen können. Und nun sollen Abertausende wandernde Lichtpunkte die astronomischen Beobachtungen zusätzlich stören. Deshalb versucht SpaceX die Strahlkraft seiner Satelliten durch eine neue Bauweise deutlich zu reduzieren. Allerdings muss man auch zugeben: Die Beobachtung ist gerade nach einem Start von 60 Satelliten jeweils sehr faszinierend, da sie sich am Anfang noch in einer sehr tiefen Umlaufbahn befinden und deshalb noch deutlich heller leuchten.
Unter folgendem Link können jeweils die Zeiten der Überflüge (nach geografischer Position) abgerufen werden: www.findstarlink.com Andreas Walker

Hofläden
Beim Bauern ists günstiger
Beim Bauern bekommt man regionale und saisonale Lebensmittel nicht nur frischer, sondern auch deutlich günstiger als im Supermarkt. Äpfel etwa kosten meist weniger als die Hälfte, bei Gemüse, Eiern und Fleisch zahlt man in der Regel rund ein Drittel weniger. Auf der neuen Internetplattform vomhof.ch des Schweizer Bauernverbandes kann man gezielt nach Bauern in der Umgebung und ihren Produkten suchen. Rund 1800 Betriebe aus der ganzen Schweiz sind verzeichnet. k-tipp

Farben, Formen, Wuchs und Blütenbildungen einzelner Pflanzen korrespondieren mit menschlichen Gefühlen: Ja, nicht nur in der Menschenwelt, sondern auch in der Pflanzenwelt zeigen sich seelische Haltungen und Gebärden. Zu dieser Erkenntnis kam der deutsche Biologe und Anthroposoph Ernst-Michael Kranich (1929–2007). Bei der kurzweiligen Lektüre seiner «Skizze einer physiognomischen Naturerkenntnis» entsteht und verfestigt sich die Erkenntnis einer Welt, in der Mensch und Natur innerlich zusammengehören.
Ernst-Michael Kranich «Pflanzen als Bilder der Seele», Freies Geistesleben 2020, ca. Fr. 30.–.






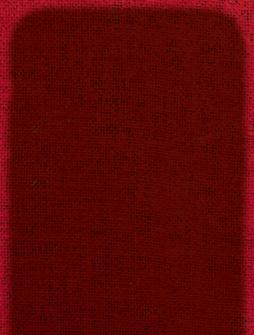




























































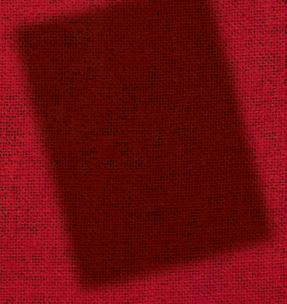












Städte sind nicht nur Anziehungspunkte für die unterschiedlichsten Menschen von nah und fern. Auch die Vielfalt der Tiere und Pflanzen ist im urbanen Raum besonders gross. Ein Augenschein auf der Ziegenwiese in Zürich-Seebach.
Text: Veronica Bonilla
«Ich wollte die Wiese in einen Ort verwandeln, wo Kinder wild, Erwachsene entspannt und Ziegen glücklich sein können.»
Julia
Hofstetter
Ziegenhirtin, Biologin und Umweltpädagogin
Der Weissdorn blüht neben dem Ziegenstall und wenn seine Blüten auf den Boden fallen, ist alles weiss wie Schnee. Die Böschung dahinter beim Wasserschutzgebiet ist ein blaugrün wogendes Meer aus blühendem Wiesensalbei. Später hat dort der gelbe Klappertopf seinen Auftritt. Die Robinien sind sowieso da, wenn auch nicht richtig geliebt. Denn Robinien sind Neophyten, also nicht einheimische invasive Pflanzen. Sie werden als solche für den Artenrückgang verantwortlich gemacht, weil sie sich unkontrolliert verbreiten. Es wird aber auch berichtet, dass keine andere Laubholzart derart hohe Holzproduktionsleistungen erbringt wie die Robinie. Und die Bienen lieben deren besonders zuckerhaltigen Nektar. Trotzdem. Fremdes hat halt oft kein gutes Ansehen.
Doch auf der Wiese sind die Robinien kein Problem. «Die Geissen reduzieren sie innert Kürze», sagt Julia Hofstetter, Ziegenhirtin, Biologin und Umweltpädagogin. Die Geissen, Stiefelgeissen aus Göschenen, um genau zu sein, sind zu siebt am Grasen, fünf Weibchen, zwei Böcke. Wie kommen sie hier nach Zürich, mitten in die Stadt? Um das zu beantworten, müssen wir etwas ausholen.
Die Wiese ist ein Hektar unbebautes Land in Zürichs Norden. In den 1940er-Jahren war hier eine Kiesgrube. Bahntrassees wurden damals gebaut, für die man Kies brauchte, deshalb sieht das Gelände ein bisschen aus wie ein halbierter Topf: Nach vorne zur Bahnlinie ist es offen und flach, die Steilhänge dahinter vermitteln ein Gefühl der Geborgenheit. Mitten im Abhang liegt eine Reservequelle der Trinkwasserversorgung. Sie ist der Grund, dass die Wiese nicht verbaut werden darf. Rundherum die turbulente Nachbarschaft: ein Hochhaus, eine Kirche, Strassen und Wohnhäuser.
Lange Zeit war das Stück Land, das der Stadt gehört, zur Pacht ausgeschrieben. Die Leute, die vorher hier

Schafe hielten, waren alt geworden und konnten die Arbeit nicht mehr leisten, die eine solche Wiese macht. Julia Hofstetter hatte ebenfalls Respekt davor. Aber auch eine Idee: «Ich wollte die Wiese in einen Ort verwandeln, wo Kinder wild, Erwachsene entspannt und Ziegen glücklich sein können», schreibt sie im Buch «Stadtgeiss». Die Stiefelgeissen aus Göschenen zogen 2013 ein, in den ehemaligen Schafstall, der von tatkräftigen Händen renoviert und zum Ziegenstall umgebaut worden war. Lockten Kinder und Erwachsene auf die Wiese. Und dann ist alles schnell sehr bunt geworden.
Ein Netz für die Artenvielfalt
Die Stadt ist nicht nur eine Ansammlung von Häusern, Läden, Verkehrswegen, Fahrzeugen und Menschen. Auch wenn Landbewohner das manchmal meinen. Im Gegenteil: Die meisten Städte sind artenreicher als ihr Umland. Das ergaben zahlreiche Untersuchungen der letzten Jahre. In einer Studie von 2015 etwa haben zwei Forscherinnen des Instituts für Ökologie und Evolution der Universität Bern gezeigt, dass die Biodiversität von baumbewohnenden Insekten und Spinnen in Schweizer Städten gleich gross oder sogar grösser sein kann als im intensiv genutzten Agrarland. Entscheidend sei jedoch, dass das besiedelte Gebiet ausreichend Grünelemente enthalte. Die Käfer, Wanzen, Zikaden und Spinnen wimmeln und wuseln nämlich da besonders zahlreich, wo es in der Nähe kleine Gärten oder Bäume hat.
Städte tragen deshalb bezüglich Biodiversität eine besondere Verantwortung. Im Vergleich zum landwirtschaftlich geprägten Umland, das von Monokulturen dominiert ist, gelten städtische Lebensräume heute als Hotspots der Biodiversität. Hier gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensräume: Da sind die exakt geschnittenen Rasenflächen und von Profis gestalteten Grünanlagen mit ausgewählten, möglichst pflegeleichten Pflanzen. Aber auch wild wucherndes Grün auf unge-

Für Wildbienen ist die Stadt Zürich weder eine Betonwüste noch eine ökologische Einöde: 164 der in der Schweiz heimischen rund 600 Wildbienenarten kommen in Zürich vor. Dies haben Forscher der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL und von der Concordia Universität in Montreal, Kanada, herausgefunden. Damit konnten sie zeigen, dass das Wachstum der Stadtflächen zumindest bei diesen Tierarten nicht unbedingt zu einer Vereinheitlichung der Fauna mit einigen wenigen Arten führen muss, wie häufig befürchtet wird. Immerhin 25 bis 30 Wildbienenarten summen in einem durchschnittlichen Zürcher Haus- oder Schrebergarten, so die Forscher. «Die Stadt bietet vielfältige Lebensräume und die Wildbienen, die hier leben, scheinen gut an die Bedingungen angepasst zu sein.» www.wsl.ch
FUTTER | Früh blühende Blumen sind eine gute Bienenweide. Hier labt sich eine Rote Mauerbiene (Osmia bicornis) am Nektar, einer Traubenhyazinthe.
Der Kanton Zürich soll sich stärker als bisher für die Natur engagieren. Das fordert eine Initiative von BirdLife Zürich, Pro Natura, WWF Zürich, Aqua Viva und dem Fischereiverband Kanton Zürich. 27,5 Millionen Franken sollen zusätzlich zu den heutigen 27,5 Millionen jährlich in den Natur- und Heimatschutzfonds eingelegt werden. Für mehr Blumenwiesen, mehr Vielfalt im Wald und im Siedlungsraum, mehr und besseren Schutz für die Moore, mehr Gewässerrenaturierungen. Der Kantonsrat berät zurzeit einen Gegenvorschlag. www.natur initiative.ch

nutzten Bahnarealen, Einzelbäume am Strassenrand, unweit davon ganze Baumgruppen in grossflächigen Parks, alte und verwilderte Villengärten, verschiedenartigste Familiengärten und immer mehr Gemeinschaftsgärten mit experimentellem Charakter. Solche Orte «ersetzen heute Lebensräume, welche in der Natur- und Kulturlandschaft selten geworden oder gar verschwunden sind», schrieb die Eidgenössische Forschungsanstalt WSL im Bericht zur BiodiverCity-Studie von 2012.
Als Lebensraum für Tiere und Pflanzen fanden Städte jedoch lange Zeit keine Beachtung. Erst in den letzten Jahren hat sich die Stadtökologie als neue Forschungsdisziplin etabliert. «In Grossagglomerationen wie Wien, Frankfurt oder Zürich leben rund 20 000 verschiedene Organismen», zitiert das WSL eine Untersuchung. Wir Menschen sind also bei Weitem nicht die einzigen Lebewesen in der Stadt, auch wenn wir das manchmal vergessen. Wilde Möhren drängen durch die Ritzen des Fusswegs vor dem Wohnhaus, auf der Kiesinsel in der Limmat hockt ein Graureiher und hoch oben am Himmel zieht der Rotmilan seine Kreise.
2015 hat der Zürcher Tierökologe André Rey im Auftrag von Grün Stadt Zürich im Gebiet zwischen Hardturm und Hauptbahnhofshalle die Vielfalt der Reptilien, Amphibien, Tagfalter, Heuschrecken, Libellen und Wildbienen erfasst; ebenso besondere Brutvögel und Tiergruppen wie Leuchtkäfer, Nachtfalter, Ameisen und Wespen. Resultat: Er und sein Team konnten 171 Tierarten nachweisen, 47 davon mit spezialisierten Lebensraumansprüchen, die für die Biodiversität besonders wertvoll sind. Fast die Hälfte der Arten waren Wildbienen, wovon einige zu den seltenen und gefährdeten gehören.
Endlich im Dreck wühlen
In normalen Zeiten, wenn keine Viren uns zu Hausarrest zwingen, bietet die Umweltpädagogin Milena Fuchs ein offenes Wiesenatelier an. Und manchmal führt Julia Hofstetter auf der Ziegenwiese Workshops für Schulklassen durch. Mit den Stiefelgeissen holt sie die Schülerinnen und Schüler beim Schulhaus ab. Es sind wilde Spaziergänge und die Kinder brauchen Mut und Kraft, um die Ziegen zu halten. Unterwegs knabbern sie hier an einem Pflänzchen, dort entdecken sie etwas Essbares.
«In der Stadt wird die Artenvielfalt nicht erwartet», sagt die Pädagogin, «doch die Natur hält sich nicht an die Struktur des Menschen.» Auch die Stiefelgeissen wären in der Schweiz übrigens fast ausgestorben. Nur noch 27 weibliche und sieben männliche Stammtiere gab es Anfang der 1980er-Jahre, als Pro Specie Rara sich der Rasse und ihrem Erhalt annahm. Heute führt das Herdebuch gut tausend Tiere; neue Züchter für die robuste Rasse werden nach wie vor gesucht.


HABITATE | Ein Netz von naturnahen Gärten, Blühstreifen entlang von Strassen und Schienen, Hecken und kleinen Feuchtgebieten sind in urbanen Gegenden wichtige Elemente zur Förderung der Artenvielfalt.
Manche Kinder wollen den Stall ausmisten, arbeiten ausdauernd, lassen nicht locker, bis auch die letzte Schubkarrenfahrt zum Misthaufen erledigt ist. Andere bauen Ziegen aus Holz oder legen kleine Gärten an. «Viele Kinder dürfen heute nicht mehr dreckig werden», sagt Julia Hofstetter, «doch Dreck ist wichtig. Er ist der Anfang von allem.» In der Erde wühlen und grübeln, einen Regenwurm entdecken, ein paar Springschwänze, einen Tausendfüssler. Julia Hofstetter findet es wichtig, dass wir die Namen der Lebewesen in unserer Umgebung, der Insekten und Vögel, der Kräuter und Blumen kennen. «Erst wenn wir sie mit Namen ansprechen, tragen wir ihnen auch Sorge.»
Trotzdem reduziert sie ihre Workshops am liebsten aufs inhaltliche Minimum. Die Ziegenwiese soll ein Ort sein zum Durchatmen. Eine Pause im oft hektischen Alltag. Ganz ohne Botschaften oder ausformulierte Lernziele. Es gibt Kinder, die eine Weile brauchen, bis sie hier, ohne Animation, eine Beschäftigung finden. Doch irgendwann klappt es bei allen. «Das Schönste ist, dass die Kinder den ganzen Tag kein einziges Mal gestritten haben», sagt eine Lehrerin am Ende des Tages. Stadtnatur ist Lebensqualität, zu diesem Schluss kommt auch die BiodiverCity-Studie des WSL: «Grünräume bieten einen erholsamen Kontrast zur bebauten Umwelt, tragen zur mentalen Gesundheit und zur physischen Fitness bei und ermöglichen Begegnungen.» Doch die Artenvielfalt in der Stadt hat noch weitere bedeutende Funktionen: Sie ist in der warmen Jahreszeit wichtig für die Beschattung und Temperatur-Regulation der versiegelten Flächen und Gebäude. Sie trägt zur Reinigung der Luft bei und reichert sie mit Sauerstoff an. Und sie gestaltet und verschönert das Stadtbild. «Unsere verplante und überdesignte Stadt hat solche planlosen, wilden, gewachsenen Orte nötig», findet Ökologe André Rey. «Orte die offen und frei sind, wo sich etwas entwickeln kann. Solche Orte sind Orte für die Seele. Wir können es uns nicht leisten, sie zu verlieren.» //


Buchtipp
Julia Hofstetter «Stadtgeiss. Vom Leben mit Ziegen in der Stadt», AT-Verlag, Fr. 29.90


Die Coronakrise hat die Welt verändert, bis in den Garten hinein. Was das bedeutet ? Frances und Remo Vetter machen sich Gedanken über den eigenen Gartenzaun hinaus.
Remo und ich sind überzeugt davon, dass die umweltverträgliche Zukunft für viele von uns auch die Produktion eigener Nahrungsmittel mit sich bringen wird. Wir können dies erreichen, indem wir derzeit unproduktive und brachliegende Flächen und Gebiete nutzen, wie dies zum Beispiel nach dem 2. Weltkrieg in vielen Ländern der Fall war, auch in der Schweiz («Anbauschlacht» Plan Wahlen: «Trutz der Not durch Schweizerbrot»).
Erst vor Kurzem hat der Mensch in weiten Teilen der industriellen Welt aufgehört, sein Gemüse und seine Früchte selbst anzubauen und selbst oder im Austausch mit umliegenden Partnern und Freunden für Fleisch, Milch und Käse zu sorgen. An Stelle von Gemüsegärten wurden weltweit vielerorts Parks, Golfplätze, Rasenflächen und Vorgärten angelegt, die allmählich zu Statussymbolen wurden. Es war eine Art, dem Nachbarn zu sagen: «He, seht mal, wie wohlhabend wir sind! Wir müssen unser Land nicht nutzen, um unsere eigenen Lebensmittel anzubauen!» Und so gibt es heute in den USA circa 20 Millionen Hektaren ungenutzter Vorgärten und Parkflächen. Ein riesiges Potenzial!
In den vergangenen Jahrzehnten haben wir uns mehr und mehr von der Produktion unserer Nahrungs- und Lebensmittel abgekoppelt und sind von Industriebetrieben abhängig geworden. Die industriell produzierte Nahrung ist oft angereichert mit Stabilisatoren und anderen problematischen Zusatzstoffen (E-Nummern) und verunreinigt mit Hormonen und Agrarchemikalien. Seit einigen Jahren halten auch genetisch veränderte Organismen Einzug in unser Essen, Organismen, die in Laboratorien aus «lebensmittelähnlichen» Substanzen hergestellt werden.
Dieses System der Nahrungsmittelproduktion belastet, ja vergiftet nicht nur die Menschen, sondern auch die Nutztiere, das Land, das Wasser und die Luft. Im Laufe der Zeit hat dies zu einem allgemeinen Rückgang des körperlichen und emotionalen Wohlbefindens geführt – und zu einem dramatischen Verlust der Artenvielfalt. Ich denke, die weltweiten klimatischen Vorkommnisse und die Virus-Problematik der letzten Monate hat viele Menschen wachgerüttelt; und ich glaube, dass wir zu einem lokalen, nachhaltigen Leben zurückfinden werden – zum Beispiel, indem wir Gärten
anlegen und wieder vermehrt unsere eigenen gesunden Lebensmittel kultivieren und mit unseren Ressourcen schonender und bewusster umgehen. So können wir auch Abhängigkeiten reduzieren, was gerade für Krisenfälle wichtig ist.
Der Sommer ist für Remo und mich die Zeit, in der die Arbeit draussen so richtig Spass und Freude macht. Das Gärtnern ist angenehm, denn die anstrengenden Tätigkeiten wie das Vorbereiten der Beete, Säen und Pflanzen sind abgeschlossen. Wichtig ist, dass die Routinearbeiten nicht vernachlässigt werden. Das heisst: immer wieder jäten, beziehungsweise mit der Pendelhacke die Beete durchkratzen, um den Boden unkrautfrei zu halten und die Schädlinge im Auge zu behalten.
Die Gartenarbeit im Frühjahr hat sich gelohnt: Der Sommergarten überwältigt uns in diesen Tagen und Wochen mit Farben und Blüten, und wir geniessen die sonnigen Tage ausgiebig. Nachdem die gröbsten Pflanzarbeiten abgeschlossen sind, gilt es vor allem fleissig zu giessen, mässig zu düngen und ordentlich zu ernten: Das Obst wird reif, die Kräuter blühen und was der Gemüsegarten hergibt, füllt unseren Erntekorb Tag für Tag. So liefern uns Garten, Beete und Töpfe täglich eine bunte, vitaminreiche Auswahl Gaumenschmaus.
Das richtige Bewässern
Zu den wichtigsten Arbeiten an heissen Sommertagen gehört das Wässern der Pflanzen. Am besten giesst man frühmorgens, denn in der Mittags- und Nachmittagshitze verdunstet das Wasser sehr schnell; zudem können Wassertropfen auf den Blättern zu Verbrennungen führen, da sie Sonnenstrahlen wie ein Brennglas bündeln. Wir haben ausserdem festgestellt, dass es so auch zu weniger Schneckenbefall kommt, denn die Pflanzen haben den Tag über Gelegenheit abzutrocknen, bevor nach Sonnenuntergang die gefrässigen Plagegeister auftauchen, die von der Feuchtigkeit zusätzlich angezogen werden. Wer am Abend wässert, läuft also Gefahr, dass sich die Schnecken nachts hemmungslos über die Pflanzen hermachen. Das gilt besonders für Jungpflanzen, die man allenfalls mit einem Schneckenzaun oder einer übergestülpten Pet-Flasche

(nur nachts!) schützen kann. Jungpflanzen müssen auch häufiger gegossen werden, da sie noch keine starken und tiefen Wurzeln ausgebildet haben. Prinzipiell sollte man nur die Erde um die Pflanzen herum giessen und nicht die ganze Pflanze mit Wasser benetzen, da sich sonst Pilze rasch auf den Blättern ausbreiten können.
Das Mulchen ist ein fester und unverzichtbarer Bestandteil im Biogarten. Es unterstützt den Garten und den Gärtner in vielerlei Hinsicht. So schützt eine zwei, drei Zentimeter dicke Mulchschicht die Bodenoberfläche vor Regen, Sonne, Schnee, Frost und Erosion; der Boden trocknet im Sommer weniger schnell aus, folglich muss weniger gewässert werden, was zum einen Arbeit spart und zum anderen auch ein auch im Wasserschloss Schweiz nicht zu unterschätzender ökologischer Aspekt ist. Ausserdem verhindert die Mulchschicht die Unkrautbildung, denn ohne Licht und Luft gedeihen auch Unkräuter nicht. Wir verwenden als Mulchschicht hauptsächlich Rasenschnitt, gehäckselten Strauchschnitt, Gartenabfälle und gehäckseltes Laub. Aber Achtung: Die Mulchschicht darf nicht zu dicht und hoch sein, da es sonst zu Fäulnisbildung kommen kann! //
* Frances und Remo Vetter sind als freischaffende Gartengestalter, Referenten und Buchautoren unterwegs.

Nutzgarten
● Regelmässig Unkraut jäten und die Erde mit der Pendelhacke auflockern.
● Beete und Rabatten mulchen.
● Starkzehrer benötigen eine flüssige Düngung, am besten mit Brennnessel- und Beinwell-Auszügen. Zu den Starkzehrern gehören Tomaten, Kürbisse, Melonen, Gurken, Sellerie, alle Kohlarten, Gemüsepaprika, Spargel und Rhabarber.
● Lauch anhäufeln, damit er schöne weisse Schäfte entwickelt.
● Gurken bei Hitze regelmässig giessen. Zu trockener Boden verursacht Wachstumsstörungen und bittere Früchte!
● Tomaten: Seitentriebe regelmässig ausgeizen, so hat die Pflanze mehr Energie zur Fruchtbildung.
● Aussaat von Spätgemüse wie Spinat, Feldsalat, Knollenfenchel, Karotten, Randen.
● Wurzelgemüse regelmässig ausdünnen.
● Regelmässiges Ernten von Gurken und Zucchini erhöht den Ertrag.
● Kräuter ernten und konservieren.
● Kräuter vermehren.
● Kräuter regelmässig nachsäen.
● Sommerschnitt der Obstgehölze.
● Erdbeeren für das nächste Jahr pflanzen.
● Kompost wässern: um den Verrottungsprozess am Laufen zu halten, gelegentlich giessen.
● Regelmässiges Lüften im Gewächshaus, denn Hitzestau schadet den Pflanzen. Für Beschattung sorgen (Netze, weisser Anstrich, Schilfmatten).
● Frühkartoffeln ernten. Nach den Frühkartoffeln ist der Boden ideal für Erdbeeren als Folgekultur.
● Bei Salaten kann man jetzt aus dem Vollen schöpfen: Kopfsalat, Eissalat, Pflücksalat und Kräuter sind erntereif.
● Buschbohnen, Karotten, Rettiche, Frühlingszwiebeln, Schalotten, Perlzwiebeln, Gurken, Zucchini, Paprika, Neuseeländer Spinat und Mangold ernten.


Aussaaten
● In der ersten Juliwoche wird es Zeit für die letzte Aussaat von Buschbohnen.
● Karotten, Fenchel, Schnittsalat, Zuckerhutsalat, Winterrettich, Radieschen, Spinat und Randen für die Herbsternte säen.
● Ab Mitte Juli beginnt die Aussaat von Chinakohl und Pak Choi.
● Gegen Ende des Monats Frühlingszwiebeln säen.
Pflanzen
● Eissalat, Endivien, späte Kohlrabi, Grünkohl und Frühsorten von Wirsing und Blumenkohl.
Ziergarten
● Aussaat von zweijährigen Sommerblumen bis Ende des Monats.
● Narzissen teilen.
● Heckenschnitt.
● Stauden zurückschneiden und düngen.
● Rosen veredeln.
● Beete hacken und Unkraut entfernen.
● Sommerzwiebeln, Rosen und Pfingstrosen düngen.
● Verblühte Blüten von Sommerflieder entfernen.
● Herbstkrokuss e pflanzen.
● Schwertlilien pflanzen.
● Dahlien stützen.
● Rasen nicht zu kurz schneiden (ca. 5 –7 cm), so braucht er nicht so viel Wasser.
● Rasen bei längerer Trockenheit giessen.
● Formschnitt der Hecken.
● Kletterpflanzen an Kletterhilfen binden.

● Bei den Tomaten laufend alle Geiztriebe entfernen. Auch die unteren Blätter, die meist als erste von der Krautfäule befallen werden, entfernen. Eine letzte Düngung tut den Pflanzen gut.
● Die nächste Folge Pflücksalat und Chinakohl ist in den ersten Augusttagen fällig. Chinakohl direkt aufs Beet säen und später auf circa 30 cm Abstand vereinzeln. So gedeiht er besser, als wenn er umgepflanzt wird.
● Bis Mitte August sollten auch die Frühlingszwiebeln gesät sein. Sie liefern im zeitigen Frühjahr das erste essbare Grün und im Frühsommer weisse, milde Zwiebeln. Sinnvoll ist es, die Frühlingszwiebeln in Mischkultur mit Feldsalat anzusäen: Abstand der Zwiebelreihen 30 cm, dazwischen zwei bis drei Reihen Feldsalat.
● Radieschen können ebenfalls noch gesät werden. Sie eignen sich gut als Zwischenkultur. Im späten Sommer verwenden wir die schnellwüchsigen Sorten. Radieschen brauchen viel Sonne und sollten nur circa 1 cm tief gesät werden. Das Beet mit Vliesabdeckungen schützen, damit die Gemüsefliege keine wurmigen Radieschen beschert.
● In der ersten Monatshälfte werden auch die schwarzen Winterrettiche oder der Münchner Bierrettich gesät.
● Ab Mitte August Feldsalat und Spinat säen. Auf unkrautfreien Beeten, den Feldsalat breitwürfig aussäen, sonst in Reihen (zum Beispiel zwischen die Frühlingszwiebeln).
● Im August gesäte Petersilie keimt sehr zügig.
● Jetzt ist auch Zeit, die vorgezogenen Salate und Gemüse wie Endivien, Blumenkohl, Kohlrabi, Winterporree und Knollenfenchel ins Beet zu pflanzen.
● Gemüsebeet mulchen, um Feuchtigkeit im Boden zu halten.
● Auf freien Beeten, die wir nicht mehr bepflanzen Gründüngung aussäen z. B. Buchweizen, Senf, Lupine, Klee oder Phacelia.
● Kohlrabi regelmässig giessen. Bei zu langer Trockenheit und darauffolgenden Nassperioden durch Regen platzen die Knollen auf.
● Ab der zweiten Monatshälfte frühjahrsblühende Blumenzwiebeln stecken.
● Abgeblühte Stauden zurückschneiden.
● Lavendel nach der Blüte abschneiden.
● Verblühte Rosen abschneiden.
● Blumensamen sammeln.
● Robuste Sommerblumen für das nächste Jahr direkt ins Beet säen.

Abschalten
Ferien im Maggiatal
«Begib dich einmal im Jahr an einen Ort, an dem du noch nie gewesen bist.»
Entdecke die Casa Ambica und die fantastische Natur des Maggiatals. Ankommen, abschalten und zu sich finden. BioZmorge im Garten serviert, Relax pur ! Telefon 091 753 10 12 www.casa-ambica.ch

Gastseminar
Honig-Massage:
Detox für den Körper
Die Honigmassage ist ganz besonders geeignet für die Unterstützung der Entgiftung des Organismus. Gastseminar Dienstag, 6. Oktober 2020, 9 bis 16.30 Uhr im NHK Institut, Militärstrasse 90, Zürich. Infos und Anmeldung unter: Telefon 043 499 92 82 www.nhk.ch/campus/alle-startdaten

Im Herzen des Malcantone!
Die Casa Santo Stefano liegt in einem typischen Tessinerdorf inmitten einer wildromantischen Hügellandschaft mit Kastanienwäldern und Wasserfällen. Viele Yogaund Wanderangebote, zum Teil kombiniert mit wundervollen Massagen.
Neu: Auch als Individual-Themen Package buchbar.
19.7.–26.7. SommerYogaretreat
7.8.–9.8. Yogaweekend
9.8.–13.8. YogaflowIntensivtage
13.8.–16.8. Yogaretreat
19.8.–23.8. Yogaretreat
23.8.–28.8. Yogaretreat
20.9.–24.9. Yoga, Wandern und EBike
24.9.–27.9. Yogaretreat
27.9.–02.10. Yoga und Wanderferien
4.10.–10.10. Yoga und Wandern Infos und weitere Ferienangebote: Casa Santo Stefano, Miglieglia Telefon 091 609 19 35 www.casa-santo-stefano.ch

Kein Bock mehr auf Entfremdung?
Werde Körpertherapeut/-in – z. B. in Shiatsu, Craniosacral, TragerTherapie, EsalenMassage oder AyurvedaMassage. Kennenlerntage in der Nähe: seminare.kientalerhof.ch / kennenlernen
Kochworkshop
Immunstärkende Küche gibt Viren wenig Chancen
Nach der Pandemie ist vor der Pandemie –und mit der richtigen Küche stärken wir unser Immunsystem.
Kochworkshop jeweils am Donnerstag, 27. August 2020 und 3. September 2020 im NHK Institut, Militärstrasse 90, Zürich Infos und Anmeldung unter: Telefon 043 499 92 82 www.nhk.ch/campus/alle-startdaten

Studien belegen, dass psychosomatische Störungen mit Atemtherapie positiv beeinflusst werden. Das IKP Institut für Körperzentrierte Psychotherapie bietet seit über 30 Jahren die 3jährige, berufsbegleitende und von der OdA KT akkreditierte Ausbildung in Ganzheitlich-Integrativer Atemtherapie IKP an. Lernen Sie, mit der Atmung Körper und Psyche zu beeinflussen. Weiterführende Infos: www.ikp-therapien.com (Rubrik Lehrgänge)


Kaffeepause
Immer und überall
Eine flexible Kaffeepause zum Mitnehmen. Der feine Arabica Bio-Kaffee von Zellavie wird abfallfrei aus der ganzen Bohne hergestellt. Der Kaffee ist so fein vermahlen, Sie können ihn einfach kalt als Kaffee-Shot geniessen oder mit heissem Wasser aufrühren. Auch sehr lecker als Eiskaffee. www.zellavie.ch

Haarpflege
Basisches Gel zur Tiefenreinigung
SkalPuro ist das neue, innovative Kopfhautgel der Marke P. Jentschura für Frauen und Männer. Das hochwertige Naturkosmetik-Produkt überzeugt durch eine basische Tiefenreinigung und Entschlackung des Haarbodens. Es regeneriert intensiv und verleiht dem Haar Volumen und Spannkraft. www.p-jentschura.ch

Hautpflege
Lulu – die Perle aus Ostafrika
Lulu Life Körperpeeling, eine natürliche Kombination aus reiner Sheabutter und braunem Zucker. Sheabutter versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Zucker wirkt als Peeling. Ihre Haut wird weich und zart. www.lulu-life.ch

Gerötete, gereizte Augen?
Die Pollensaison ist für Menschen mit Heuschnupfen eine Qual. Die Augen brennen, sind gerötet und gereizt. Die OMIDA Euphrasia Augentropfen beinhalten den Auszug der Heilpflanze Euphrasia (Augentrost). Sie helfen, die unangenehmen Beschwerden zu lindern. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. www.omida.ch

Gesunde Gelenke
Selomida mobilisiert
Schmerzen die Gelenke, ist es nicht immer leicht, sich zu bewegen. Selomida Gelenke hilft bei Gelenkbeschwerden durch Abnutzungserscheinungen und fördert den Heilungsprozesses nach Verstauchungen sowie Knochenbrüchen. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. www.omida.ch

Verdauung
Gaspan besänftigt den Bauch
Gaspan hilft bei Blähungen, Druck- und Völlegefühl in der Bauchgegend mit leichten Krämpfen. Pflanzlich aus Pfefferminz- und Kümmelöl. Die magensaftresistente Kapsel
löst sich gezielt im Darm auf und hilft bei Verdauungsbeschwerden. Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. www.gaspan.ch

Reizdarm
Bakterien für eine gute Verdauung
Der Reizdarm ist eine chronische Krankheit. Lactibiane Plus enthält den mikrobiotischen Stamm Lactobacillus gasseri LA806. Mit seinem grossen Anhaftungsvermögen an den Zellen des Darms unterstützt er den Schutzfilm der Darmwand gegen pathogene Bakterien und Toxine. Ohne Konservierungsstoffe, Süssstoffe, Aromen, Laktose oder Gluten. Erhältlich in Apotheken und Drogerien. www.phytolis.ch

Gut schlafen
Wohltuender «Gute-NachtDrink»
Samina Night ist ein natürlicher und bahnbrechender Relax und Power Sleeping Drink ohne künstliches Melatonin. Erhalten Sie 10 Prozent Kennenlern-Rabatt mit Gutschein-Code: Natürlich drink.samina-night.com
Editorial
«natürlich» 05-2020
Danke für das gute Editorial. Ja, wir können alle nur hoffen – ja, die Hoffnung stirbt ja zuletzt, sagt man – dass wir Menschen aus dem Lockdown etwas lernen. Was mir bei allem Mitgefühl für die, die durch diese Krise leiden, zu denken gibt, ist genau das, was im Editorial angesprochen wird: Was ist doch alles möglich, wenn die selbst ernannte «Krone der Schöpfung» und dazu im sicheren, reichen Westen, selbst nun mit etwas Furchtbarem konfrontiert ist, und was ist auf einmal denkbar und wird prompt gemacht?
Ich weiss es nicht besser, und möchte keine Entscheidung treffen müssen, wie man mit solchen Krisen umgeht, aber, es stimmt mich traurig, weil wir seit über 30 Jahren wissen, was wir auf und mit unserer Erde anrichten. Aber: Keine (politische) Instanz will da etwas wirklich tun. Das ist die eigentliche Katastrophe – dass wir es einfach hinnehmen, dass bis jetzt bereits unzählige Insekten und Säugetiere wegen uns ausgestorben oder akut vom Aussterben bedroht sind. Dass wir immer noch eine Landwirtschaft betreiben mit Pestiziden und Raubbau, unsere Natur und uns vergiften, wir die Folgen kennen – und dieses Wissen nicht ausreicht, um endlich umzudenken.
Wir sind nicht das Mass aller Dinge. Diese anthropozentrische Sicht ist das Kernproblem. Wir sind schlichtweg die x-te Naturkatastrophe; es gab schon einige in der Erdgeschichte. Wenn wir wenigstens dazu stünden, wäre das zumindest ehrlich. Lioba Schneemann, Liestal
Zum Editorial möchte ich Ihnen gratulieren. Sie haben die Situation und die notwendigen Konsequenzen sehr gut beschrieben. Sie sprechen mir damit aus dem Herzen!
Hoffentlich werden Ihre Zeilen von vielen Menschen gelesen und sie machen sich auch ihre Gedanken. Leser Ihrer Zeitschrift sind sicher empfänglicher für Ihre Visionen als andere, wie leider auch das Beispiel des Parlaments zeigt, wo wieder in den alten Schemata gestritten wird und viele den alten Zustand wieder herbeisehnen und sich dafür einsetzen.
Aber Sie haben zu Recht geschrieben: Angst lähmt, Hoffnung weckt ungeahnte Kräfte. Alle, die eine Veränderung wünschen, können ihren kleinen oder grösseren Teil zu einer gerechteren, friedlicheren, solidarischeren und klima- und naturschützenden Erde beitragen. Ändern wir unser Verhalten und schliessen wir uns mit Menschen zusammen, die auf etwas Gutes hinarbeiten. Hans Frischknecht, per Mail
Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin über Ihr Editorial im natürlich 05-20. Was Sie dort geschrieben haben, kommt aus der Tiefe meines Herzens. Ich habe mich die letzte Zeit geärgert, weil nie eine kritische Stimme laut wurde, dass wir mit unserem ausbeuterischen, kapitalistischen Wirtschaftssystem, das so krisenanfällig ist, nicht weiterfahren dürfen. Wenn man bedenkt, dass so ein kleiner Virus die ganze Weltwirtschaft auf den Kopf stellt. Wo sind die klugen Köpfe, die Stellung beziehen und uns, wie der Coronavirus, den Spiegel vorhalten? Sepp Seitz, Burgdorf
Gerade hatte ich diesen Gedanken: Gibt es denn keine Zeitschrift mehr, die nicht von dem momentan alles beherrschenden Thema Corona berichtet oder was damit zusammenhängt – und schon flatterte die Mai-Ausgabe von «natürlich» ins Haus. Danke, dass Sie eine ganz «normale» Ausgabe gemacht haben – mit viel zum Thema Liebe drin.
Einzig mit dem Editorial haben Sie das Thema aufgenommen, und wie! Danke auch dafür. Sie erwähnen das Positive, das aus dieser verändernden Zeit hervorgeht und dass jede Krise auch eine Chance ist. Auch von Ihnen lese ich nun, dass wir einige Probleme nicht hätten, wäre das bedingungslose Grundeinkommen bereits eingeführt. Der ach so gekrönte Homo Sapiens ist nicht die Krönung, dies haben hoffentlich jetzt ein paar mehr festgestellt. Gerade fällt mir auf, dass das Zitat von Katharine Hepburn auf Seite 12 auch zum Thema passt: «Liebe ist nicht das, was man erwartet zu bekommen, sondern das, was man bereit ist zu geben.» So wollen wir es mit unserer Erde tun! Astrid Godat, per Mail
Die Leserbriefe müssen mit der vollständigen Adresse versehen sein. Die Redaktion behält sich vor, Briefe zu kürzen. Schicken Sie Ihren Brief per E-Mail, Post oder Fax an: leserbriefe@natuerlich-online.ch oder: «natürlich», Leserbriefe, Neumattstr. 1, 5001 Aarau, Fax 058 200 56 51
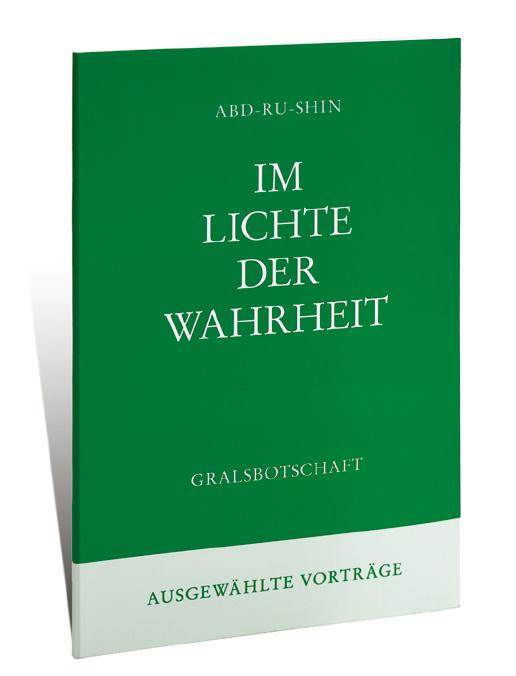


Lösung des Rätsels aus dem Heft 05-2020
Gesucht war: Bachblueten


Wettbewerbstalon
Vorname Name
Strasse PLZ / Ort
Lösung
Und so spielen Sie mit:
Senden Sie den Talon mit der Lösung und Ihrer Adresse an: CH Regionalmedien AG, «natürlich», Neumattstrasse 1, 5001 Aarau. Schneller gehts via Internet: www.natuerlich-online.ch/raetsel
Teilnahmebedingungen:
Einsendeschluss ist der 21. August 2020. Die Gewinner werden direkt benachrichtigt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Über diese Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Gewinnen Sie!

Eines von fünf Kneipp Goodbye-Stress-Sets im Wert von je Fr.45.–.
Bewusst gesund leben
40. Jahrgang 2020, ISSN 2234-9103
Erscheint 10-mal jährlich
Druckauflage: 22 000 Exemplare
Verbreitete Auflage: 16 672 Exemplare (WEMF/KS beglaubigt 2019)
Leserschaft: 94 000 (MACH Basic 2019-2)
Kontakt: Alle Mitarbeiter erreichen Sie unter vorname.name@chmedia.ch www.natuerlich-online.ch
Herausgeber und Verlag
CH Regionalmedien AG, Neumattstrasse 1
CH-5001 Aarau
Tel. +41 58 200 58 58, Fax +41 58 200 56 61
Geschäftsführer Publishing Jürg Weber
Geschäftsführer Fachmedien
Thomas Walliser
Verlagsleitung
Michael Sprecher
Redaktionsadresse «natürlich»
Postfach, CH-5001 Aarau
Tel. +41 58 200 56 50, Fax +41 58 200 56 44
Chefredaktor
Markus Kellenberger
Redaktionsteam
Andreas Krebs, Sabine Hurni (Leserberatung)
Autoren
Carmelina Bonanno, Veronica Bonilla, Leila Dregger, Evelyne Kernen, Fabrice Müller, Eva Rosenfelder, Lioba Schneemann, Vera Sohmer, Gundula Madeleine Tegtmeyer, Frances Vetter, Andreas Walker, Steven Wolf, Noa Zenger
Grafik/Layout
Janine Strebel, Joel Habermacher, Fredi Frank
Copyright Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung durch den Verlag. Für unverlangte Einsendungen wird jegliche Haftung abgelehnt.
Anzeigenleitung
Dino Coluccia, Tel. +41 58 200 56 52
Anzeigenadministration
Corinne Dätwiler, Tel. +41 58 200 56 16
Leitung Werbemarkt
Jean-Orphée Reuter, Tel. +41 58 200 54 46
Leitung Marketing
Mylena Wiser, Tel. +41 58 200 56 02
Mediadaten unter www.natuerlich-online.ch/werbung
Aboverwaltung abo@natuerlich-online.ch
Tel. +41 58 200 55 62
Druck
Vogt-Schild Druck AG, CH-4552 Derendingen
Ein Produkt der CH Media AG
CEO: Axel Wüstmann www.chmedia.ch
Abonnieren und bewusst gesund leben
Einzelverkaufspreis Fr. 9.80
Abonnement 1 Jahr Fr. 86.–


Atlaslogie. Ist der 1. Halswirbel («Atlas») blockiert, entstehen oft Schmerzen am ganzen Leib. Atlasologen können helfen, indem sie den Atlas in Schwingung und so die Wirbelsäule in ihre Statik zurückbringen. Klimakterium. Wie weise Frauen ihre Wechseljahre mit Gewinn erleben. Akupunktur. Worauf die Wirkung beruht und wem die Thearpie mit den Nadeln helfen kann. Handauflegen. Können durch blosses Auflegen der Hände an speziellen Punkten tatsächlich die Selbstheilungskräfte aktiviert werden ? Gopfridstutz und Potzhimmelgüegeli ! Der Malediktologe Roland Ris hält ein flammendes Plädoyer fürs kreative Fluchen. Filterkaffee. Die Kunst des Kaffeeaufbrühens wird zelebriert wie wohl nie zuvor. Doch wie kam es zur Renaissance des Kaffeefilters und wer profitiert davon ?




Abonnement 2 Jahre Fr. 150.–Preise inkl. MwSt. www.natuerlich-online.ch/abo-service
«natürlich» 09-20 erscheint am 27. August 2020
Kontakt /Aboservice: Telefon 058 200 55 62 oder abo@natuerlich-online.ch, www.natuerlich-online.ch

Cinzia Pipino Schön ist, wer nach seiner Natur lebt.
Wenn sie genüsslich Brotteig knetet oder einer Kundin in die Haare greift, spürt sie das Leben bis in die Fingerspitzen. «Ich brauche diese sinnliche Berührungen. Über sie erschliesst sich mir die Materie in ihrem ganzheitlichen Sein», sagt die gebürtige Italienerin Cinzia Pipino. Selbst eine sinnliche Erscheinung mit ihrer weissen Lockenpracht und den ausdrucksstarken Gesichtszügen, teilt die Sechzigjährige ihre Feinsinnigkeit nicht nur als Haarkünstlerin, Köchin und ab und zu als Catering-Frau, sondern auch bei ihren astrologischen Beratungen – und vermag dabei die Menschen auf verschiedene Weise zu berühren.
«Meine Grossmutter war Bäckerin, der Grossvater Lebensmittelhändler und Koch. Und wenn meine Mutter trotz ihrer strengen Arbeitstage für uns frische Nudeln machte, spürte ich ihre Liebe in jedem Bissen.» Wen wunderts, dass sie seit Jahren ihr Brot selber backt und aus einfachsten Nahrungsmitteln kulinarische Köstlichkeiten zaubert.
Dreimal im Leben folgte Cinzia Pipino – die in der Schweiz aufgewachsen ist – dem Ruf ihrer Wurzeln und liess alles hinter sich. Doch jedes Mal führte der Weg sie, teils unter sehr dramatischen Umständen, zurück in die Schweiz. Als ob die Spur ihrer Eltern, die einst notgedrungen die Abruzzen verlassen hatten, um hier eine Existenz aufzubauen, unverrückbar nachwirkte. Geblieben aber ist ihr die Leidenschaft zum Kochen: «Wie viel Wertschätzung man doch sich und anderen schenken kann, durch das, was man isst, und wie man mit Lebensmitteln umgeht.» Ihr Wunsch in einem sozialen Projekt
mitzuwirken, erfüllte sich in der Winterthurer Gassenküche Shalom, wo sie kocht und freiwillige Helferinnen anleitet. Achtsamkeit ist ihr Leitfaden in jedem Bereich.
« Haare sind ein Spiegel der Seele. Sie drücken unser Befinden aus, sie leiden und freuen sich mit uns», sagt die Frau mit den vollen, schönen grauen Haaren. Die in Färbemitteln, Bleich- und Dauerwellenwassern enthaltene Chemie verursachte ihr schon während ihrer Lehre als Coiffeuse gesundheitliche Probleme. «Es widerstrebte mir zunehmend, die Haare, unsere feinen ‹Antennen›, in eine künstliche Form zu pressen.» Der Schritt in die Selbstständigkeit und damit Selbstbestimmung war für die Alleinerziehende kein einfaches Unterfangen; doch es gelang: Sie erprobte bald spezielle Haarschneidetechniken: «Ich stellte fest, dass jedem Menschen seine Schönheit innewohnt, wenn er die richtige Form dafür findet, sie auszudrücken. Es ist einfach: Wenn innen und aussen in Harmonie sind, entfaltet sich die ganze Schönheit.»
Bei einer ganzheitlichen Haarbehandlung gibt es keinen Spiegel. Ohne jegliche Kontrolle gelingt es, in sich zu spüren. Wenn Cinzia Pipino in die Haare ihrer Kunden greift, nimmt sie den Menschen ganz wahr. Nach einem kurzen Gespräch beginnt sie mit langsamen Haarschnittbewegungen liebevoll zu arbeiten. Alle Haarspitzen sollen miteinander in Berührung kommen, erklärt sie, das bewirke einen feinen Energiefluss im ganzen Körper: «Dieses ‹Haarschnitt-Ritual› unterstützt beim Loslassen, Befreien und Reinigen, denn gerade in den Haaren bleibt vieles an Energien und Erlebnissen hängen.» Zudem sei das Ergebnis ein Haarschnitt, der lange nicht aus seiner Form falle und ohne «Föhn»-Styling und chemische Produkte auskomme. Kopfmassagen mit pflanzlichen Hydrolaten, Facial Harmony-Gesichtsmassagen sowie Deeksha, eine indischen Methode der Energieübertragung über die Hände, gehören ebenfalls zum Angebot der «Haarheilerin»: «Viele Menschen werden heute nur noch wenig berührt. Gerade für sie ist dies ein Geschenk.»
« Der Drang, meiner Natur entsprechend zu leben, forderte von mir immer wieder, mit Sicherheiten und Konventionen zu brechen und Neues zu wagen. Die Seele klopft eben immer wieder an.» Reisen nach Indien und längere Aufenthalte in einem Ashram führten sie mehr und mehr in ihre eigene Tiefe. Um die Wege der Seele in ihrer Komplexität zu erforschen, liess sie sich in psychologischer Astrologie ausbilden. «Seither befasse ich mich auch mit der ‹Werkzeugkiste›, die wir auf unseren Lebensweg bekommen haben. Welche Impulse braucht es, damit wir unser Potenzial erkennen und möglichst vielseitig einsetzen?»
Solche Prozesse zu begleiten, erfülle sie: «Vielleicht ist es ja meine Aufgabe, Menschen die vielseitige Botschaft der Schönheit zu überbringen.»
www.hair-art-balance.ch
●
Eva Rosenfelder ist Autorin/ Journalistin BR und schreibt für verschiedene Schweizer Medien. In einer fortlaufenden Serie trifft sie für «natürlich» natur-heil-kundige Menschen.
6er-Probierpaket «Sommer-Bioweine»
6er-Probierpaket «Sommer-Bioweine»
Concejo, Castilla y Léon
Concejo, Castilla y Léon
Burro Loco Rosado 2019
Burro Loco Rosado 2019
Ein herrlich fruchtiger Rosé! CHF 11.80 pro Flasche
Ein herrlich fruchtiger Rosé! CHF 11.80 pro Flasche
Sapientia, Rueda
Sapientia, Rueda
Verdejo Rueda 2018
Verdejo Rueda 2018
Genialer Weisswein. Gold Mondial Bruxelles. CHF 15.50 pro Flasche
Genialer Weisswein. Gold Mondial Bruxelles. CHF 15.50 pro Flasche
Gulfi, Sicilia





Gulfi, Sicilia
Nerojbleo, Nero d’Avola 2017
Nerojbleo, Nero d’Avola 2017
Vinous: «There is no better producer of Nero d’Avola». CHF 19.80 pro Flasche
Vinous: «There is no better producer of Nero d’Avola». CHF 19.80 pro Flasche
6er-Probierpaket nur CHF 79.00 (statt 94.20) inkl. Porto
6er-Probierpaket nur CHF 79.00 (statt 94.20) inkl. Porto


Das Plus für Natürlich-Leser: Sie sparen CHF 15.20 und profitieren von einer portofreien Lieferung.
Das Plus für Natürlich-Leser: Sie sparen CHF 15.20 und profitieren von einer portofreien Lieferung.
Bestellmöglichkeiten
amiata

Ob Südfrankreich, Sizilien oder Castilla y Leon - unsere Winzer verbindet ihre Passion für hochwertige Bioweine.

Ob Südfrankreich, Sizilien oder Castilla y Leon - unsere Winzer verbindet ihre Passion für hochwertige Bioweine.
Bestellmöglichkeiten
Online www.amiata.ch/nat
Online www.amiata.ch/nat
Telefon 071 250 10 15
Telefon 071 250 10 15
FILM
WWW.VELOPLUS.CH/
amiata
Langgasse 16, CH-9008 St. Gallen
Tel 071 250 10 15, Fax 071 250 10 18 info@amiata.ch, www.amiata.ch
Langgasse 16, CH-9008 St. Gallen
Tel 071 250 10 15, Fax 071 250 10 18 info@amiata.ch, www.amiata.ch
Hochwertige Bioweine von kleinen bis mittelgrossen Familienbetrieben sind die Passion von amiata. Seit vielen Jahren pflegen wir partnerschaftliche Kontakte zu Winzern, die ihre Reben mit besonderer Sorgfalt nach biologischen Richtlinien anbauen und im Keller auf sanften Ausbau setzen.
Hochwertige Bioweine von kleinen bis mittelgrossen Familienbetrieben sind die Passion von amiata. Seit vielen Jahren pflegen wir partnerschaftliche Kontakte zu Winzern, die ihre Reben mit besonderer Sorgfalt nach biologischen Richtlinien anbauen und im Keller auf sanften Ausbau setzen.


«MICH FASZINIERT, DASS KUNDEN DAS GLEICHE WOLLEN WIE ICH: SIE WOLLEN VELOFAHREN!»

Unsere Verkaufsberaterin Jacqueline steht als Synonym für Abenteuer. Ihre Erfahrung aus unzähligen Veloreisen ist einmalig und hilft Kunden bei der individuellen Beratung.












