
7 minute read
Update für die Bühne

Simon Stone mixt in seinen Arbeiten Hoch- und Populärkultur, klassische Fragestellungen mit aktuellem Zeitgeist. In seiner Inszenierung von Erich Wolfgang Korngolds Oper Die tote Stadt sagen sich Sigmund Freud und David Lynch gute Nacht. Dafür wird er gefeiert – aber auch kritisiert . Regiehoffnung oder Störenfried?
Bei der Bauprobe im Herbst vergangenen Jahres schlendert Simon Stone über die Bühne. Gemächlich, nicht hektisch. Flankiert von seiner Entourage umrundet er die kubisch aneinandergrenzenden, weißen Würfelräume, die er hat zusammenzimmern und möblieren lassen und die von Zeit zu Zeit grellfarbig beleuchtet werden. Ein bisschen Midcentury-Vintage-Chic trifft auf Kreuzberger Hipsterflair, mit einem Hauch Teeküchen-Charme. Und was der Volksmund Hund und Herrchen nachsagt, trifft mit etwas Fantasie auch auf Simon Stone und sein Bühnenbild zu: Sie ähneln sich irgendwie, je länger man schaut. Stones schmale Jeans legt sich über schwere Lederboots, darüber trägt er Hemd und Sakko – und sein wüstes Haar ist eine Sache für sich. Ein paar Finger stecken in dicken Silberringen, mit denen fährt er sich immer wieder durch die schulterlangen, braunen Strähnen. Würde man Teodor Currentzis mit Jonathan Meese und Jesus morphen, vielleicht käme am Ende Simon Stone raus.
Simon Stone bereitet hier sein Debüt an der Bayerischen Staatsoper vor. Er erarbeitet seine Baseler Inszenierung von Erich Wolfgang Korngolds Die tote Stadt neu. Es ist eine Produktion, die auch über die Schweiz hinaus mit Beifall überschüttet wurde. Die erste Opernregie des damals 32-Jährigen – und ein Erfolg mit Schnappatmungseffekt. Von „Regiehoffnung“ und „Regiegenie“ war danach die Rede, von einem „fulminanten“ und „hochemotionalen“ Saisonstart, den die damalige Operndirektorin Laura Berman wohl bereits vorausgesehen hatte: „Bring some Kleenex!“, empfahl sie damals auf Twitter vor der Premiere.
Was er selbst an dem Stück großartig findet? „Es hat so unglaublich viel Hoffnung“, sagt Simon Stone, kneift die klaren, blauen Augen zusammen und muss sich ein bisschen in seinem Enthusiasmus bremsen. „Es ist die Konfrontation mit den Leichen, die man im Keller hat. Mit den Sachen, die wir verdrängt haben – damit wir wieder frei sein können.“ Manchmal müsse man durch düstere Zeiten gehen, um am Ende wieder das Licht sehen zu können. Diesem Spannungsverhältnis der „dunklen Wahrheit“ spürt Stone nach.
Simon Stone gehört mittlerweile zur ersten Regieliga und wird auf den Bühnen dieser Welt gehandelt wie ein Weltklassetrainer im Fußball. Noch als Schauspielstudent gründete er seine erste Theatergruppe, das „Hayloft Project“, und produzierte mit ihr Stücke von Seneca bis Wedekind. Daraufhin übernahm er die Leitung des Belvoir Street Theatre in Sydney. Im Alter von 30 Jahren hatte er bereits ebenso viele Inszenierungen realisiert. Bislang war der heute 35-Jährige mit drei Inszenierungen zum renommierten Berliner Theatertreffen eingeladen, und die Kritikerumfrage von Theater heute schmückte seine Inszenierung von Drei Schwestern mit dem Titel „Stück des Jahres“. Sogar in Hollywood hat er den Fuß in der Tür: Für sein Kinodebüt The Turning im Jahr 2013 drehte er gemeinsam mit Cate Blanchett, 2015 adaptierte er mit The Daughter Ibsens Wildente, und sein vor Begeisterung völlig verdatterter Hauptdarsteller Geoffrey Rush brachte die Faszination wie folgt auf den Punkt: „Simon Stone ist ein Klassizist, aber frisch und lebendig.“
Diese frische Lebendigkeit hat paradoxerweise mit einem biographischen Knick zu tun: Der in Basel geborene Simon Stone ist sieben, als er mit seinen Eltern ins englische Cambridge zieht, und zwölf beim Ortswechsel der Familie nach Melbourne. Wenige Monate nach der Ankunft dort stirbt sein Vater an einem Herzinfarkt, und der junge Simon wächst fortan mit seiner Mutter, Großmutter und zwei Schwestern auf. Seither wuchert in ihm das Gefühl der Verpflichtung, der begrenzten Zeit auf Erden so viel wie möglich abzutrotzen. Früher bedeutete das, regelmäßig die Schule zu schwänzen, um stattdessen bändeweise Shakespeare zu inhalieren. Heute bedeutet es: inszenieren, inszenieren, inszenieren.
Simon Stone führte Regie in den Niederlanden (Medea, 2014), England (Yerma, 2016), Norwegen (Pelléas et Mélisande, 2017) und Frankreich (La Trilogie de la vengeance, 2019), sein Schaffensdrang ist enorm. Dabei ist er Wiederholungstäter. Immer wieder beschäftigt er sich mit denselben Stoffen. Das ist ungewöhnlich für einen so umtriebigen Regisseur und könnte leicht redundant wirken. Aber wie bei seinem Münchner Bühnenrundgang: Stone hastet nicht. Stattdessen bleibt er an den Themen dran, bohrt tiefer und tiefer. Er widmet sich den universalen Fragen, die er bei Ikonen der griechischen Antike (Euripides, Aristophanes, Aischylos) ebenso findet wie bei den neueren Spezialisten menschlicher Tragik (Tschechow, Strindberg, Ibsen), mit drängender, ja obsessiver Neugier: Warum bringt jemand seine Kinder um (Medea)? Welche Verblendungszusammenhänge treiben einen Menschen in die Enge (Hotel Strindberg)?
Wie bekämpft man das Empfinden von Verlorenheit, das Minderwertigkeitsgefühl und das Lächerliche (Drei Schwestern)? Und schließlich: Wie überlebt man den Tod eines geliebten Menschen (Die tote Stadt)?
In dem Komponisten Erich Wolfgang Korngold hat Simon Stone einen künstlerischen Verwandten gefunden. Im jungen Alter von 19 Jahren begann Korngold, seine Oper rund um Paul, der gefangen in der Trauer über den Tod seiner Frau lebt, zu komponieren. Ebenso ein Shootingstar wie Stone. Und auch das Dilemma zwischen Festhalten und Loslassen kennt der Regisseur. Unmittelbar nach dem Tod seines Vaters habe er viel von seiner Kindheitsstadt Basel geträumt, sagt Stone. In diesen Träumen spazierte er an der Hand seines Vaters durch die Straßen. Das ist das Tröstliche wie Tragische an Träumen: Sie machen Tote zwar wieder lebendig, aber eben nur bis zu dem Moment, in dem man die Augen aufmacht. Zurück in der Wirklichkeit wirkt der Verlust dann umso grausamer.
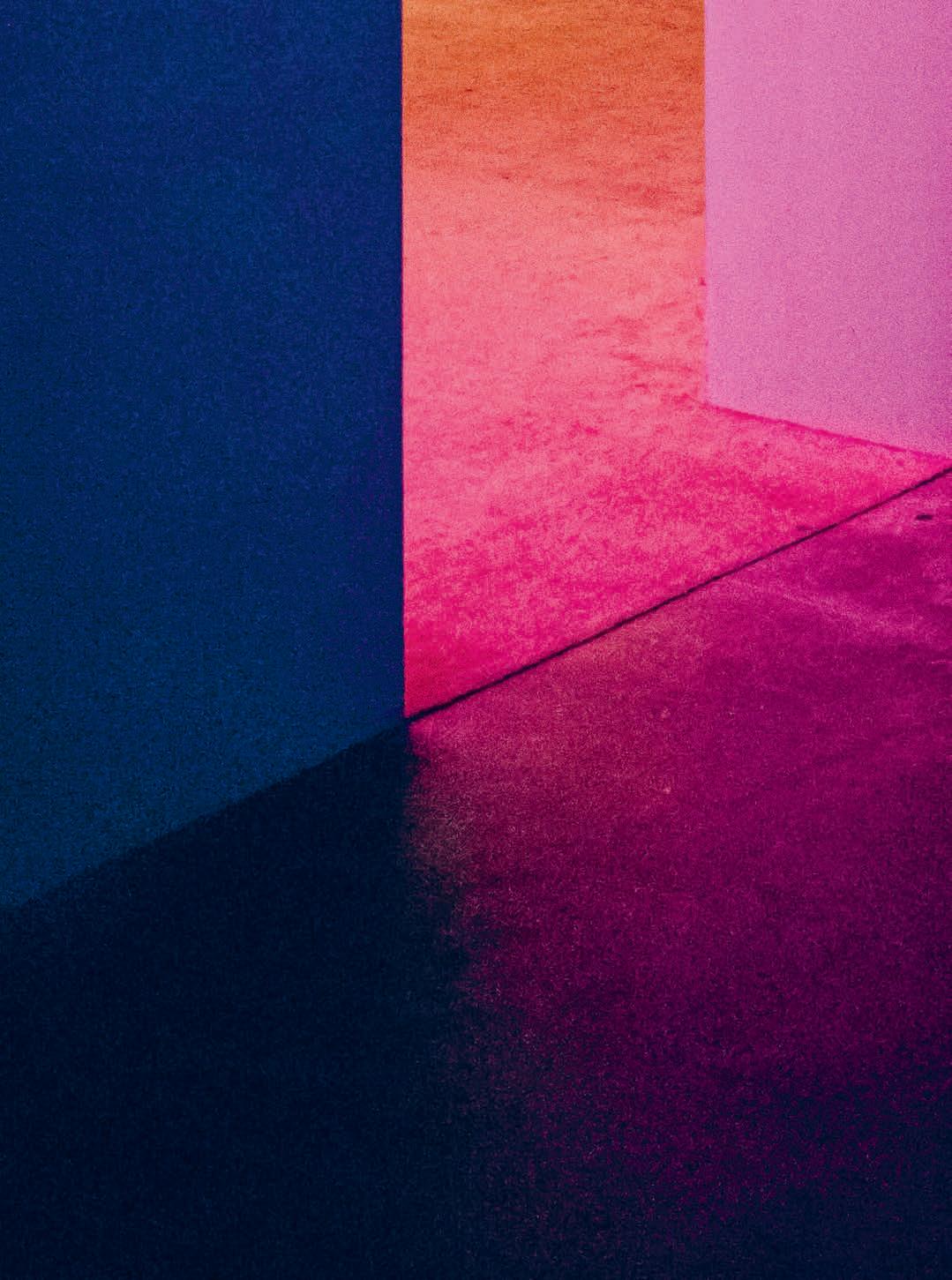
So sagen sich bei Simon Stones Toter Stadt Sigmund Freud und David Lynch gute Nacht. Ein idealer Fall. „Das ganze Stück ist für die Hauptfigur eine Konfrontation mit seinen Schuldgefühlen“, erklärt Stone mit seinem leicht australisch eingefärbten Deutsch. „Er verabschiedet sich von seiner toten Frau, aber auch von der Frau, in die er sich neu verliebt hat. Er ist darauf vorbereitet, allein zu leben, wirklich zu trauern.“ Diesem Oszillieren zwischen Psychoanalyse und Psychodrama, zwischen Trauer, Vision und Wahn begegnet Stone, wie er auch den übrigen Stoffen begegnet, mit denen er liebäugelt: Er überträgt sie ohne falsche Ehrfurcht ins Hier und Jetzt. Das nennt er „Überschreibung“: Ibsens Ehefrauen shoppen online, Tschechows Schwestern tindern und whatsappen. Und bei Korngolds trauerndem Paul hängen Filmplakate von Michelangelo Antonionis Blow Up und Jean-Luc Godards Pierrot le fou an den Wänden. Luigi Cherubinis Médée setzte er dagegen jüngst bei den Salzburger Festspielen in den Kontext der Migrationsdebatte und arbeitete das Motiv der Zurückweisung heraus. Nur landete Medea eben nicht in Korinth, sondern in Wien-Schwechat.
Stone mixt Hoch- und Populärkultur, klassische Fragestellungen mit aktuellem Zeitgeist, verbindet konträre Welten ganz unverkrampft mit lässigen Referenzen und füllt damit eine Lücke, die im Gegenwartstheater immer noch zu klaffen scheint. Dabei bringt er nicht einfach nur einen neuen Realismus auf die Bühne. Seine Inszenierungen gehen über reine Abbildungen hinaus, sie erzeugen Traum- und Angsträume, oft determiniert durch abstrakte Bühnenbilder wie etwa jenes von John Gabriel Borkman am Akademietheater Wien, das den maroden Haushalt der Bankiersfamilie in eine dicke, die unterkühlten Verhältnisse sichtbar machende Kunstschneelandschaft hüllte. Geisterhafte Bilder voll abgründiger Anschauung schuf er auch für Aribert Reimanns Lear in Salzburg 2017, den er in der Sturmnacht auf dem freien Feld, dem Wahnsinn nahe, einem flächendeckenden Sprühregen aussetzte.
Und dann ist da noch die Sache mit der Sprache: Kaum ein Regisseur macht sich zugleich als Autor derart radikal über Theaterliteratur her. Stones Umgang mit dem Sprachmaterial ist so frei wie seine wehende Mähne. Manchmal bleibt vom Ursprungstext kaum ein Satz erhalten.

SIMON STONE – Simon Stone, geboren in Basel, aufgewachsen in Cambridge und Melbourne, studierte an der Universität von Melbourne am Victorian College of the Arts. Mit seiner 2007 gegründeten Theatergruppe „The Hayloft Project“ adaptierte er Dramen, u. a. von Tschechow. Am B elvoir Street Theatre in Sydney realisierte er nach der Vorlage von Ibsen die Produktion The Wild Duck, die 2012 beim Ibsen-Festival in Oslo und 2013 bei den Wiener Festwochen sowie beim Holland Festival Amsterdam gastierte. 2015 drehte er auf der Grundlage desselben Dramas den Kinofilm The Daughter. Es folgten Inszenierungen am Theater Basel, an den Münchner Kammerspielen, am Burgtheater Wien und am Berliner Ensemble. Mit Die tote Stadt inszenierte er am Theater Basel 2016 das erste Mal Oper, 2017 folgte Aribert Reimanns Lear bei den Salzburger Festspielen, in diesem Sommer ebendort Médée von Luigi Cherubini.
Mit diesem Modus der freien Übertragung beziehungsweise Überschreibung polarisiert Stone. Die einen feiern ihn, weil er die Stücke von ihrer Patina befreit, sprechen von seiner Arbeit als „Produkt eines unheimlichen Muts“ (NZZ), sie gehe „unter die Haut“ (Deutschlandfunk), und so kehre das Drama auf die Bühne zurück (taz). Andere rümpfen angesichts der rigorosen Updatepraxis die Nase, sprechen von „wie hingerotzt wirkenden Dialogen“ (Der Standard), von „dümmlichen Wortspielen und vielen, viel zu vielen Kraftausdrücken“ (FAZ), von einem „verharmlosten und trivialisierten“ Stoff: Da hätte man „genauso gut ein x-beliebiges ZDF-Fernsehspiel einschalten können“ (Welt). Auf die Frage, warum er nicht konventioneller an die Sache herangehe, antwortet Stone mit einem nonchalanten Grinsen im Gesicht: „Andere Menschen machen das.“ So einfach. Und weiter: „Es interessiert mich nicht, wie etwas außerhalb bewertet wird. Die Zuschauer kommen und genießen, dass sie unterhalten und herausgefordert werden, über ihr Leben nachzudenken – das ist das Ziel der Kunst.“ Wie wertvoll das dann sei, könne jemand anderes entscheiden, in 100 oder 200 Jahren vielleicht. Simon Stone, der Regisseur der Generation Netflix. Derzeit dreht er ein Projekt für den Streamingdienst, Näheres dazu ist streng geheim, wie nicht anders zu erwarten, wenn man publikumswirksam einen Mythos schaffen will, noch bevor er da ist. Doch bei aller Populärkulturliebe gibt es im Theater etwas, das Netflix nicht hat, räumt Simon Stone ein: „Dass wir zusammensitzen. Dass wir gemeinsam Zeugen sind, was in unserer Gesellschaft stattfindet.“ Die soziale Komponente, das Moralische, erschließe sich erst in der Gemeinschaft. „Wir müssen kommunizieren“, sagt Stone. „Das fehlt uns im Moment, in Europa, in Amerika, überall auf der Welt – die Begegnung mit anderen Menschen.“ Und weil heute sowieso kein Mensch mehr in die Kirche gehe, hat Simon Stone eine Vision: das Theater, die Oper, die Bühne zum Tempel zu machen. Nicht mehr. Aber auch nicht weniger.
Margarete Affenzeller ist Theaterredakteurin und lebt in Wien. Nach dem Studium der Germanistik, Geschichte und Theaterwissenschaft arbeitet sie seit 1997 im Kulturressort der Tageszeitung Der Standard.
Sarah-Maria Deckert leitet die Redaktion von Max Joseph.
DIE TOTE STADT Oper in drei Bildern von Erich Wolfgang Korngold
Premiere am Montag, 18. November 2019, Nationaltheater





