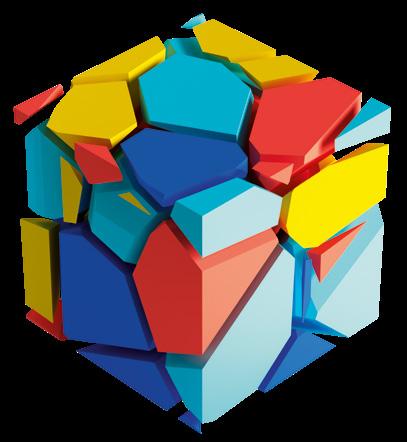Revolutionär Mozart, der


Stefan Gottfried & Concentus Musicus Wien
Mozart, der Revolutionär
Sonntag, 25. Juni 2023, 11:00 Uhr
Großer Saal, Brucknerhaus Linz
Saison 2022/23 – Sonntagsmatineen VI 6. von 6 Konzerten im Abonnement


Wolfgang Amadé Mozart (1756–1791)
Ouvertura und Quartetto aus der Opera buffa
Lo sposo deluso ossia La rivalità di tre donne per un solo amante (Der enttäuschte Bräutigam oder Die Rivalität dreier Frauen um einen einzigen Liebhaber), KV 430 (424a) (1783)
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 9
(„Jeunehomme“/„Jenamy“) Es-Dur, KV 271 (1776–77)
I Allegro
II Andantino
III Rondeau. Presto – Menuetto. Cantabile – Tempo primo
– Pause –
Wolfgang Amadé Mozart
Sinfonie Nr. 40 g-moll, KV 550 (1788, rev. 1791)
I Molto allegro
II Andante
III Menuetto. Allegretto – Trio
IV Allegro assai
Konzertende ca. 12:45
Besetzung
Magdalena Hallste | Bettina (Sopran)
Johannes Bamberger | Don Asdrubale (Tenor)
Christopher Willoughby | Pulcherio (Tenor)
Zacharías Galaviz Guerra | Bocconio Papparelli (Bariton)
Concentus Musicus Wien
Stefan Gottfried | Klavier & Dirigent
Stefan Gottfried spielt Mozarts Klavierkonzert auf einem Hammerflügel aus der Werkstatt von Robert Brown in Oberndorf, bei dem es sich um den Nachbau eines Originalinstruments von Michael Rosenberger handelt, das um 1805 in Wien entstand.
Mozart, der Revolutionär!
„KÖNNEN SIE IRGENDETWAS SEHEN?“
Am späten Nachmittag des 26. November 1922 standen der Ägyptologe Howard Carter und sein Finanzier, George Herbert, 5. Earl of Carnarvon, im sich westlich des antiken Theben erstreckenden Tal der Könige am Ende eines 16 Treppenstufen unter der Erde liegenden, absteigenden Korridors vor einer vermauerten, mit mehreren Siegeln versehenen Türblockierung. Nachdem ein kleines Loch hineingeschlagen worden war, entzündete Carter eine Kerze, die er vorsichtig durch die Öffnung hindurchsteckte, um die Luft des dahinterliegenden Raumes auf eventuell entweichende Faulgase zu prüfen. Ihr flackernder Schein erhellte die gut 28 Quadratmeter große Vorkammer des seit weit mehr als 3000 Jahren vor den Augen der Welt verborgenen Grabes des Pharaos Tutanchamun und darin die ersten jener 5398 Objekte, die schlagartig Licht ins Dunkel der Lebensumstände einer fernen Vergangenheit brachten und das Wissen über die Hochkultur des Alten Ägypten sowie die Vorstellungen von ihr revolutionierten, indem sie bisher nur aus Texten oder von bildlichen Darstellungen Bekanntes (be-)greifbar und damit aus bloßer Überlieferung sinnlich erfahrbare Realität machten. „Können Sie irgendetwas sehen?“, fragte Lord Carnarvon ungeduldig, worauf Carter mit seinem berühmt gewordenen Ausspruch antwortete: „Ja, wundervolle Dinge!“
MOZART, EIN REVOLUTIONÄR?
Wolfgang Amadé Mozart ist um seinen Weltruhm wahrlich nicht zu beneiden. Von der Nachwelt wahlweise zum „Wolferl“ verniedlicht oder zum „Götterliebling“ und „Musensohn“ hochstilisiert, im Zuge des Geniekults romantisiert und verklärt, wurden die Ecken und Kanten seiner Persönlichkeit so lange abgeschliffen, bis er rund genug war, um in die kleine süße Kugel zu passen, deren Siegeszug Mozart zum Bestandteil eines Markennamens machte. Heute verdient eine ganze Industrie, die unzählige Merchandisingprodukte und Mozart-Devotionalien auf den Markt wirft, ihr Geld mit dem vermeintlichen Popstar unter den klassischen Komponisten. Hat seine Kunst zwischen all den Klischees und inmitten von so viel Kommerz ohnehin schon keinen leichten Stand, wird sie von der breiten Öffentlichkeit erst recht nicht als revolutionär wahrgenommen. Was sollte an „Melodien für Millionen“ denn auch umstürzlerisch sein?
Der Schriftsteller Wolfgang Hildesheimer hat am Beginn seiner bekannten Mozart-Monographie 1977 die Bemühungen, schreibend eine Revision des Mozart-Bildes herbeizuführen, mit dem „Versuch einer Wiederherstellung, der Reinigung eines im Lauf der Jahrhunderte mehrfach übermalten Freskos“ verglichen und gleichsam seufzend hinzugefügt: „Das ist nicht immer einfach, denn die Unhaltbarkeit des Bildes steht meist im Gegensatz zur Haltbarkeit der Materialien, mit denen es übermalt ist.“ Noch weit schwerer wiegt allerdings, dass sich, wie Hildesheimer indirekt einräumen muss, das Instrument Sprache für das Vorhaben als letztlich untauglich erweist: „Zwar ist Mozarts Größe nicht meßbar, doch ist ihre Wirkung feststellbar; ihr Niederschlag als Interpretation, quantitativ überwältigend, bietet ein augenfälliges Beispiel des ewig Scheiternden: des Versuches, die überragende Gewalt des Werkes eines Menschen zu vermitteln, ihrer Eigenart und Einzigar tigkeit deutend beizukommen, ihr Geheimnis zu ergründen.“ Einen Ausweg aus dieser Sackgasse weisen einzig das Studium von Mozarts Musik und die unvoreingenommene Erforschung ihrer Entstehungsumstände, die als notwendige Vorarbeiten dienen für ihre auf den dabei gewonnenen Erkenntnissen basierende, in einem umfassenden Sinne historisch informierte Aufführung, die hörbar werden
Das Opernfragment Lo sposo deluso lässt, was sich der Beschreibung hartnäckig entzieht. Als Einladung hierzu versteht sich das Programm der heutigen Sonntagsmatinee, das am Beispiel dreier Werke ohrenfällig machen will, wie Mozart drei für ihn zentrale Gattungen, die Oper, das Klavierkonzert und die Sinfonie, revolutionierte, grundlegend erneuerte und nachhaltig veränderte.
REVOLUTION I: DIE OPER
Der Soziologe Norbert Elias hat den überragenden Stellenwert, den die Oper für Mozart besaß, in seiner wegweisenden, 1991 posthum veröffentlichten Untersuchung Mozart. Zur Soziologie eines Genies schlüssig als einen gewissermaßen natürlichen Reflex auf die ästhetischen Maßstäbe seiner Mitwelt gedeutet: „Unter den Musikwerken rangierte in der Wertskala der höfischen Gesellschaft die Oper am höchsten. Es lag auf der Linie dieser sozialen Bewertung, daß für Mozart das Komponieren von Opern die emotionale Bedeutung der höchsten persönlichen Sinnerfüllung hatte.“ Mit 21 musikdramatischen Werken hat Mozart zwischen 1767 und 1791 versucht, diese Erfüllung ebenso zu finden wie Anerkennung und gleichzeitig die Möglichkeiten einer Charakterisierung szenisch agierender Figuren im Rahmen eines von seiner Musik getragenen und durch sie angetriebenen Bühnengeschehens konsequent ausgelotet. „Dabei überschritt er“, wie Ulrich Schreiber ausgeführt hat, „in Expansion wie Intensität des musikdramatischen Gefüges die Grenzen des Genres und begründete so über den deutschsprachigen Raum hinaus den ersten zeitüberdauernden Kanon des Opernrepertoires.“
Aufgrund des großen und anhaltenden Erfolgs des am 16. Juli 1782 im Burgtheater uraufgeführten deutschen Singspiels Die Entführung aus dem Serail KV 384 regte der als „General-Spektakel-Direktor“ an der Spitze der Wiener Hoftheater stehende Franz Xaver Graf von Orsini-Rosenberg Mozart zur Komposition einer italienischen Opernkomödie an, wovon dieser seinen Vater Leopold am 21. Dezember des Jahres brieflich unterrichtete: „graf Rosenberg hat mich […] angeredet, ich möchte doch eine Welsche opera schreiben; – ich habe schon Commission gegeben um von italien die Neuesten opere buffe Bücheln zur Wahl zu bekommen, habe aber noch nichts erhalten.“ Die Suche nach
Unvollendete Erweiterung eines 1782/83 entstandenen Porträts Mozarts von seinem Schwager Joseph Lange, 1789
einem geeigneten Libretto gestaltete sich weitaus schwieriger als erhofft. Nachdem am 22. April 1783 mit der Erstaufführung der zweiten Fassung des Dramma giocoso La scuola de’ gelosi (Die Schule der Eifersüchtigen) von Antonio Salieri die italienische Oper wiedereröffnet worden war, klagte Mozart am 7. Mai in einem Brief an den Vater: „Nun hat die italienische opera Buffa alhier wider angefangen; und gefällt sehr. […] – ich habe leicht 100 – Ja wohl mehr bücheln durchgesehen –allein – ich habe fast kein einziges gefunden mit welchem ich zufrieden seÿn könnte; – wenigstens müsste da und dort vieles verändert werden. – und wenn sich schon ein dichter mit diesem abgeben will, so wird er vieleicht leichter ein ganz Neues machen.“ Hoffnungsvoll vermeldete er am 21. Juni: „[…] überdies erwarte ich heute 4 der Neuesten und besten opern bücheln von Italien, worunter doch eines seÿn wird, welches gut ist.“ Am 5. Juli konnte er schließlich nach Salzburg berichten: „es hat mir izt ein wälscher Poet hier ein buch gebracht, welches ich vielleicht nehmen werde, wenn er es nach meinem sinn zuschnizeln will.“

Mozart begann in der Folge mit der parallelen Arbeit an zwei Opernprojekten, dem Dramma giocoso per musica L’oca del Cairo (Die Gans von Kairo) KV 422 und der Opera buffa Lo sposo deluso ossia La rivalità di tre donne per un solo amante (Der enttäuschte Bräutigam oder Die Rivalität dreier Frauen um einen einzigen Liebhaber) KV 430 (424a), die beide Fragment blieben. Da Mozart den Autor des Textbuches zu L’oca del Cairo, Giambattista Varesco, der ihm von der Zusammenarbeit am Idomeneo KV 366 persönlich bekannt war, in den Briefen an seinen Vater Leopold namentlich nennt, ist die zuletzt zitierte Passage wohl auf Lo sposo deluso zu beziehen. Dass mit „wälscher Poet“ nun freilich Lorenzo Da Ponte gemeint sein soll, wie die Forschung lange Zeit beinahe einhellig gemutmaßt hat, erscheint schon allein durch den Umstand unwahrscheinlich, dass dessen Name in der Korrespondenz zu diesem Zeitpunkt bereits gefallen war. Im Brief vom 7. Mai 1783 teilte Mozart dem Vater nämlich mit: „wir haben hier einen gewissen abate da Ponte als Poeten.“ Trotzdem ist das Geraune, Da Ponte sei möglicherweise der Verfasser des Zweiakters Lo sposo deluso, bis in die jüngste Vergangenheit hinein zu vernehmen. Dabei hat Alessandra Campana schon 1989 in einem Aufsatz für das MozartJahrbuch nachgewiesen, dass es sich bei dem Mozart in Manuskriptform vorliegenden Libretto um eine Kopistenabschrift des Textbuches von Le donne rivali handelt, einem Intermezzo in zwei Teilen, das in der Vertonung von Domenico Cimarosa während der Karnevalssaison des Jahres 1780 im Teatro Valle in Rom uraufgeführt worden war, und zwar, dem damals geltenden päpstlichen Gesetz entsprechend, mit einer rein männlichen Besetzung, zu der zwei Soprankastraten gehörten, die als Transvestiten die beiden Frauenrollen verkörperten. Wer dessen Autor war, lässt sich nicht mehr mit Sicherheit ermitteln, der Librettodruck nennt jedenfalls keinen Namen. Campana hat mit guten Argumenten für eine Zuschreibung an den in Rom wirkenden Giuseppe Petrosellini plädiert, von dem vielleicht auch das Libretto zu La finta giardiniera (Die verstellte Gärtnerin) KV 196 stammt. In der von Mozart benutzten und mit diversen Eintragungen versehenen handschriftlichen Fassung des Textes zu Lo sposo deluso ist die Anzahl der Gesangspartien allerdings von fünf auf sieben erweitert und einige Szenen sind ganz oder
Das Opernfragment Lo sposo deluso Erste Seite der von Mozart benutzten und mit handschriftlichen Eintragungen versehenen Kopistenabschrift des Librettos zu Lo sposo deluso, 1783
teilweise ergänzt, wobei die Zusätze offenbar wiederum aus anderen Libretti zusammengestellt wurden, darunter demjenigen zum Intermezzo Il maestro di musica (Der Musikmeister), das nach Giovanni Battista Pergolesis frühem Tod fälschlicherweise als dessen Werk Verbreitung fand. Wer diese Bearbeitung vorgenommen hat, ist unklar, weshalb auch die Identität des von Mozart als „wälscher Poet“ bezeichneten Dichters letztlich im Dunkeln bleibt.

Das Opernfragment Lo sposo deluso
Die standardisierte, meist Sinfonia genannte italienische Ouvertüre des 18. Jahrhunderts war dreiteilig und wies grundsätzlich die Tempofolge schnell–langsam–schnell auf. Hatte Mozart schon zu La finta giardiniera, einem Dramma giocoso, das am 13. Jänner 1775 im Opernhaus am Salvatorplatz in München seine Premiere feierte, eine lediglich zweiteilige, aus einem Allegro molto in D-Dur und einem Andante grazioso in A-Dur bestehende Ouvertüre komponiert, um die folgende, zur Grundtonart D-Dur zurückkehrende Introduzione, ein Quintett, mit dem die erste Szene der Oper beginnt, als dritten Teil der Ouvertüre erscheinen zu lassen, ging er bei Lo sposo deluso noch einen Schritt weiter. Nach einem Allegro in D-Dur, dessen initiales, den von Pauken begleiteten Trompeten anvertrautes Thema durch seinen signal- und fanfarenartigen Charakter der funktionalen Zweckbestimmung einer Opernouvertüre, die „in der Erfüllung der Aufgabe des Ruhegebietens und des Aufhorchenlassens“ (Bärbel Pelker) besteht, geradezu mustergültig Rechnung trägt, geht diesmal der zweite, langsame Teil der Ouvertüre, ein ebenfalls in D-Dur stehendes Andante, unmittelbar in die erste Nummer der Oper, ein ausgedehntes Quartett in D-Dur, über, das zunächst wie eine verkürzte Reprise des einleitenden Allegros wirkt, aus dem im weiteren Verlauf sein gesamtes motivisches Material gewonnen wird, und zugleich die der Ouvertüre fehlende traditionelle Dreiteiligkeit (wieder-)herstellt. Dass Mozart selbst das Quartett, in dem die vier Singstimmen aufs Engste und Virtuoseste mit den Instrumentalstimmen verflochten sind, als dritten Teil der Ouvertüre betrachtete, geht nicht zuletzt aus dessen Tempoüberschrift hervor, die im Autograph „Primo tempo“ lautet und sich damit auf die erste Tempoanweisung innerhalb derselben musikalischen Nummer bezieht, in diesem Fall also das Allegro des Ouvertürenbeginns. Erstmals sind hier instrumentale Eröffnungsmusik und Anfangsszene einer Oper, zudem auf höchst kunstvolle Weise, zu einer formalen, thematischen und tonartlichen Einheit verschmolzen.
Die ihr gebührende Aufmerksamkeit hat diese Revolution, die in seinen späteren Bühnenwerken zu wiederholen Mozart wohlweislich vermied, jedoch bis heute nicht erfahren, weder beim Publikum, das kaum je gewillt war und ist, das Fragment als schöne Kunst zu betrachten,
noch im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen zur Geschichte des Musiktheaters. Im Gegenteil sprach ein ausgewiesener Experte wie Ulrich Schreiber im 1988 veröffentlichten ersten Band seines Standardwerks Opernführer für Fortgeschrittene Mozart das ‚Urheberrecht‘ an dieser Innovation sogar rundweg ab: „Obwohl die Ouvertüre direkt in das Eingangsquartett […] übergeht, haben wir es nicht mit einer Durchkomposition Mozarts zu tun: die Erfindung stammt vom Librettisten“ Einen Beleg für seine absurde Behauptung blieb Schreiber aus gutem Grund schuldig, da es schlicht keinen gibt.
Die für je zwei Flöten, Oboen, Fagotte, Hörner und Trompeten sowie Pauken und Streicher besetzte Ouvertüre hat Mozart bis auf einige Bläser- und Paukenstellen vollständig instrumentiert. Gleiches gilt für das Quartett, dessen Handlung rasch erzählt ist: In Livorno bereitet sich der alte, reiche Bocconio auf die Ankunft seiner jungen Braut, der edlen Römerin Eugenia, vor, wobei ihn seine schnippische Nichte Bettina sowie der in diese verliebte Offizier Don Asdrubale nicht gerade unterstützen und wofür ihn sein Freund Pulcherio sogar verlacht.
Im November 1797 fand in Prag ein von Mozarts Witwe Constanze organisiertes Konzert statt, in dem Ouvertüre und Quartett mit den komplettierten Orchesterstimmen – die Ergänzungen wurden von unbekannter Hand direkt in die autographe Partitur hineingeschrieben – ihre Uraufführung erlebten. Über diesen Anfang des Bühnenwerkes hinaus skizzierte Mozart noch eine Arie der Eugenia sowie eine des Pulcherio und stellte ein Terzett (Eugenia, Don Asdrubale, Bocconio) weitestgehend fertig, bevor er das Projekt gegen Ende des Jahres 1783 aus unbekannten Gründen aufgab. Bedenkenswert ist in diesem Zusammenhang die Hypothese seines Biographen Alfred Einstein, Mozart müsse „bereits nach der Beendigung dieser vier Stücke eingesehen haben, daß er so nicht weiterfahren könne, daß er mit seiner Idee des ‚Buffonesken‘ auf falschem Wege sei“. Ein Blick auf die Trias der Da-Ponte-Opern, an denen Mozart in den folgenden Jahren arbeitete, macht diese Vermutung durchaus plausibel, denn statt zeittypischen Buffa-Opern entstanden mit diesen zeitlosen Meisterwerken als Komödien verkleidete Tragödien.
REVOLUTION II: DAS KLAVIERKONZERT
Der Musikwissenschaftler Arnold Werner-Jensen hat Mozarts 21 vollendete, zwischen 1773 und 1791 entstandene Klavierkonzerte seine „größte Genietat“ genannt. Zwar habe er „im historischen Sinn diese Gattung gar nicht einmal konstituiert, denn es gab Vorläufer sowohl in der barocken Epoche mit J[ohann] S[ebastian] Bachs Cembalokonzerten wie unter Mozarts frühen Zeitgenossen des Sturm und Drang und der Empfindsamkeit, mit dem geliebten Vorbild Johann Christian Bach, mit [Georg Christoph] Wagenseil und anderen. Dennoch muß Mozart im eigentlichen Sinn als der Erfinder dieser Gattung gelten, denn er verlieh ihr alle wesentlichen Kennzeichen und Merkmale der Größe: Er schuf das klassische Formmodell des konzertierenden Sonatensatzes mit seinen zwei individuellen Expositionen und erhob es zur ständig variierten Norm; er erdachte dem Soloinstrument sein ganzes phantasievolles Repertoire an Spielfiguren und instrumententypischen Wendungen; er erweckte das Orchester vom stichwortliefernden und rahmenden Begleiter zum vielseitigen, selbstbewußten und, vor allem, symphonischen Partner; er fächerte das Orchester auf in all seine individuellen Instrumentalfarben und erhob besonders die Holzblasinstrumente zur Selbständigkeit und Gleichberechtigung; und nicht zuletzt stattete er die Gattung mit der ganzen ihm zu Gebote stehenden, einzigartigen emotionalen Vielfalt aus, die zuvor in der Musik unbekannt war.“ Die Emanzipation des Orchesterparts im Solokonzert ist mithin keineswegs, wie dies häufig behauptet wurde und wird, ein Verdienst Ludwig van Beethovens, weshalb denn auch Alfred Einstein befand, im Klavierkonzert habe „Mozart sozusagen das letzte Wort in der Verschmelzung des Konzertanten und des Sinfonischen gesagt, eine Verschmelzung zu einer höheren Einheit, über die kein ‚Fortschritt‘ möglich war, weil das Vollkommene eben vollkommen ist“
Das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 9 Es-Dur KV 271, im Dezember 1776 begonnen und im Jänner 1777 beendet, ein Werk also des noch nicht ganz 21-jährigen Mozart, ist nichts Geringeres als das erste bedeutende Klavierkonzert der Musikgeschichte. „Es steht“, darauf weist Alfred Einstein mit Recht hin, „in Mozarts Schaffen ebenso überraschend wie einzig da. Durch nichts in der Produk
tion des Jahres 1776 wird es angekündigt, denn das Divertimento [Nr. 10 („Erste Lodronische Nachtmusik“) FDur] K.V. 247 ist zwar ein Meisterwerk auf seinem Gebiet, aber eben nur eine fröhliche ‚Finalmusik‘. Dies aber ist eines der monumentalen Werke Mozarts, in denen er ganz er selber ist und sein Publikum nicht mehr durch Gefälligkeit und Entgegenkommen zu gewinnen sucht, sondern durch Originalität und Kühnheit. Er hat es nie übertroffen.“ Wie so viele seiner Werke, ist man geneigt hinzuzusetzen.
Populär wurde das Konzert unter dem Beinamen „Jeunehomme“, der allerdings, wie Michael Lorenz gezeigt hat, „ein reines Phantasieprodukt“ ist, „eine vollkommen willkürliche Erfindung, die aus einem massiven Irrtum der MozartForschung entstand, und an die sich das Publikum im 20. Jahrhundert gewöhnt hat“ Als Auftraggeberin des Konzerts nennt Mozart rückblickend in einem Brief vom 11. September 1778 aus Paris an seinen Vater „die jenomy“. Schon am 10. April des Jahres hatte er im Kontext der Erwähnung des bedeutenden französischen Tänzers und Choreographen Jean Georges Noverre – „beÿ dem ich speiss so oft ich will“ – in der Nachschrift zu einem Brief seiner Mutter an den Vater von dort nach Salzburg berichtet: „Mad:me jenomè ist auch hier.“ Leopold Mozart, der die Dame augenscheinlich kannte, trug seinem Sohn daraufhin am 20. April brieflich auf: „Mache von mir und der Nannerl unsere Empfehlung an […] Mr: und Md:me de Noverre, an Md:me genomai.“ Die beiden Mozart-Forscher Téodor de Wyzewa und Georges de Saint-Foix kreierten daraus, gestützt auf die kühne These, „jenomy“ sei die italianisierte Form eines französischen Namens, im zweiten Band ihrer 1912 publizierten Studie W.A. Mozart : sa vie musicale et son œuvre de l’enfance à la pleine maturité (1756–1777) die fiktive Figur der „Mlle Jeunehomme“, die sie im gleichen Atemzug zu einer „der berühmtesten Virtuosinnen ihrer Zeit“ erklärten. Mehr als 90 Jahre lang schien sich niemand daran zu stören, dass der Name einer, wie Christoph Wolff 1976 im Vorwort zum das Konzert KV 271 enthaltenden Band der Neuen Mozart-Ausgabe schrieb, „seinerzeit gepriesenen französischen Klaviervirtuosin“ in keiner einzigen historischen Quelle auftaucht und sich folglich auch kein Beleg für eine lobende Erwähnung ihres Spiels erbringen ließ. Eher als an
einen Fehler der eigenen Zunft war die Musikwissenschaft offenbar bereit, daran zu glauben, Mozart habe sein Konzert für ein Phantom komponiert, wie sich etwa an der 1994 erschienenen Ausgabe des von Stanley Sadie herausgegebenen The Grove concise dictionary of music ablesen lässt, in der es unter dem Lemma „Jeunehomme“ heißt: „[…] nothing is known of her and she may never have existed.“ Erst 2003 gelang Michael Lorenz „die Lösung des JeunehommeRätsels“. Er konnte die in den Mozart-Briefen des Jahres 1778 „jenomy“, „jenomè“ und „genomai“ genannte Person als Louise Victoire Jenamy identifizieren, die am 2. Jänner 1749 in Strasbourg geborene Tochter des als Schöpfer des modernen Tanzes geltenden Jean Georges Noverre, die 1767 mit ihrem Vater nach Wien kam, wo dieser bis 1774 als Ballettmeister tätig war, und dort 1768 den reichen Kaufmann Joseph Jenamy heiratete, dessen Familie aus Savoyen stammte. Mozart lernte die talentierte Pianistin wohl (spätestens) während seines Wien-Aufenthalts im Sommer 1773 kennen. Nur ein öffentlicher Auftritt der Jenamy konnte bisher nachgewiesen werden. Am 17. Februar 1773 fand in Wien ein Ball zugunsten Noverres statt, über den die Realzeitung der Wissenschaften, Künste und der Kommerzien das Folgende berichtete: „Den 17. Ball im Kärntnerthortheater zum Vortheile des Hrn. Noverre. Auf demselben gab er den gerächten Agamemnon, und einen großen heroischen und militarischen Contretanz mit einem großen Gefechte, beyde von seiner Erfindung. Seine Tochter spielte mit vieler Kunst und Leichtigkeit ein Concert auf dem Claviere.“ Falls Victoire Jenamy 1777 das für sie geschriebene Klavierkonzert persönlich in Salzburg abholte, tat sie das vermutlich auf der Reise zu ihren Eltern nach Paris, wohin Noverre 1775 von Königin Marie-Antoinette geholt worden war und wo es 1778 zum Wiedersehen mit Mozart kam. Zu ihrem Mann, der in Wien blieb, scheint sie nicht mehr zurückgekehrt zu sein. 1784 wurde die Ehe geschieden. Am 5. September 1812 starb Victoire Noverre, die wieder ihren Mädchennamen angenommen hatte, kinderlos in Clermont-Ferrand.
Revolutionäres ereignet sich in dem Konzert für „die jenomy“ schon gleich am Anfang des Kopfsatzes, denn in diesem Allegro antwortet das Klavier bereits im zweiten Takt entschlossen und forsch auf die
eröffnende markante Tuttifanfare des Orchesters. Erst nach einer Wiederholung dieses Frage-Antwort-Spiels setzt die eigentliche Orchesterexposition ein. Was fast ein spontanes Einspringen für die Bläser sein könnte, von denen ein solcher Nachsatz normalerweise zu spielen wäre, zeigt wie unter einem Brennglas das Wesen des konzertanten Prinzips: den Dialog zweier gleichberechtigter Partner. Einen so überrumpelnd-wagemutigen Auftakt zu einem Konzert hat Mozart nie wieder geschrieben. Und ähnlich innovativ geht es weiter, wenn das Klavier sich etwa vermittels eines hohen Trillers wie beiläufig und noch vor dem Beginn der Soloexposition ins musikalische Geschehen hineinschleicht, sich zwischendurch aber auch nicht zu schade ist, die 1. Oboe bei ihrem Solo mit bloßen Akkorden zu begleiten oder wenn in der Reprise der Spieß gleichsam herumgedreht und die Reihenfolge der ersten Takte dergestalt vertauscht wird, dass nun das Klavier die Fanfare intoniert, worauf das Orchester ihm mit dem Nachsatz antwortet, was beim zweiten Mal jedoch umgehend korrigiert wird, ganz so, als sei da ein peinlicher Fehler unterlaufen. Aber
Beginn der autographen Partitur von Mozarts Klavierkonzert Nr. 9 Es-Dur, 1776–77

nichts bleibt hier dem Zufall überlassen, nicht einmal in der Kadenz. Aus der Tatsache, dass zu diesem Konzert auskomponierte Kadenzen und zwei Eingänge für das Finale existieren, die meist sogar in mehreren Fassungen vorliegen, hat man auf ein gewisses Misstrauen schließen wollen, das Mozart den improvisatorischen Fähigkeiten der Auftraggeberin entgegengebracht habe, dabei aber übersehen, dass diese Kadenzen auf eine Weise in die Komposition eingeflochten sind, die sie zu einem integralen Bestandteil des Werkes macht. Sie dienen nicht länger der Zurschaustellung pianistischer Virtuosität, sondern stellen eine Fortsetzung der Durchführung mit hohen Anteilen motivisch-thematischer Arbeit dar. Ungewöhnlich, aber als eine Art Spiegelung des Beginns von bezwingender Logik ist auch, dass sich das Klavier nach der Kadenz noch einmal hören lässt, wodurch Anfang und Ende des Satzes zu einer gemeinsamen Angelegenheit von Soloinstrument und Orchester werden.
Im Wortsinne Ungeheuerliches geschieht dann im langsamen Satz, dem ersten in einer Moll-Tonart, den Mozart für ein Konzert komponiert und dem er das instrumentale Rezitativ einverleibt hat. Während die Tempoangabe Andantino durch das Diminutiv Hoffnungen auf rokokohafte Galanterie und neckische Tändelei wecken mag, reißt die in düsterem c-Moll stehende Musik einen Abgrund auf, in den hörend hineinzublicken erschaudern und an den Titel eines Gedichts von Gottfried Benn denken lässt: Hier ist kein Trost. Man kann nicht einmal mutmaßen, woher die nachgrade schockierende Ausdrucks- und Gefühlstiefe rühren, zu der Klagefiguren, schmerzlich getönte Dissonanzen und hochgespanntes Espressivo sich in dieser wie von Auflösung bedrohten Musik summieren, die permanent an der Grenze zum Verstummen entlangbalanciert, da das 18. Jahrhundert nichts auch nur annährend Vergleichbares kennt. Es ist in der Tat, wie Peter Gülke es formuliert hat, eine „Grenzgängerei“, mit der Mozart sich damals „am Rand einer Unmöglichkeit bewegte“. Der Satz beginnt mit einem rhetorisch eindringlichen Kanon zwischen den 1. und 2. Violinen, die beide con sordino spielen. Dieses erste Thema umfasst zwar 16 Takte, ist aber nicht aus zwei achttaktigen Perioden zusammengesetzt, sondern besteht aus 7 plus 9 Takten, ist also un re-
gelmäßig gebaut. Das Klavier nimmt das Thema jedoch nicht etwa auf, sondern zieht in freier Kantabilität seine Kreise, gerät dabei aber immer wieder ins Stocken. Erneut ist die Kadenz nicht sein letztes Wort, denn diese mündet nach dem obligatorischen Dominanttriller nicht in das übliche Orchestertutti, weshalb das Klavier, alleingelassen, den rezitativischen Gesang notgedrungen unbegleitet fortführen muss, wobei es nur noch von zwei Forteeinwürfen des Orchesters unterbrochen wird, für die sich die Violinen ihrer Dämpfer entledigen. Der Satz endet in ohnmächtiger Verzweiflung.
Das abschließende, fortreißend-fulminante Rondeau beginnt das Klavier in stürmischem Presto solistisch, erst nach 34 Takten setzt das Orchester ein. Mit insgesamt 467 Takten ist es der umfangreichste Finalsatz eines Konzertes, den Mozart bis zu diesem Zeitpunkt komponiert hat. Geistreiche Erfindung, unbändige Spielfreude, brillanter Witz und glänzende Virtuosität kennen hier buchstäblich keine Grenzen, aber auch die Experimentierfreude ist ungebremst: Völlig überraschend und gegen jede Regel wird die Rondoform exakt in der Satzmitte durch den Einschub eines stilisierten, variativ ausgearbeiteten Menuetts in As-Dur unterbrochen, das als Verbeugung vor dem prominenten Ballettmeister Noverre, dem Vater der Auftraggeberin, zu verstehen sein dürfte. Erneut setzt das Klavier zunächst alleine ein, bevor die Kombination von gezupften Noten der 1. Violinen und der tiefen Streichinstrumente mit gestrichenen Tönen der sordinierten
2. Violinen und Violen eine zaubrische Begleitung ergibt, über der die Klänge des Klaviers, aller Erdenschwere enthoben, zu schweben scheinen. Grazie, Delikatesse und Serenität dieses wahrhaft apollinischen Moments sind mit Worten nicht zu beschreiben. Im Hintergrund, in dem, was man die kompositorische Tiefenschicht nennen könnte, hat an diesem Punkt längst ein kleines, scheinbar völlig unbedeutendes Achtelmotiv, das aus dem Hauptthema des Rondos stammt, die heimliche Herrschaft über den Satz gewonnen. Es bestimmt, dort dann in beinahe manischer Ausschließlichkeit, noch die im Diminuendo bis zum Pianissimo verhauchenden Schlusstakte, bevor ihm zwei Forteschläge das Wort abschneiden und das Konzert so abrupt wie energisch zu Ende bringen.
REVOLUTION III: DIE SINFONIE
Mehr als 40 vollständige Sinfonien – die genaue Zahl schwankt je nach Forschungsstand durch Zu- und Abschreibungen, aber auch Neuentdeckungen sowie Definitionsfragen erheblich – komponierte Mozart zwischen dem Winter 1764/65 und dem Sommer 1788, wobei ihn Revisionsarbeiten noch bis in sein Todesjahr 1791 hinein beschäftigten. Mit keiner anderen bedeutenden Gattung seiner Epoche hat er sich über einen so langen Zeitraum auseinandergesetzt. Es waren just jene Jahre, in denen sich der Transformationsprozess vom ouvertürenartigen, nach italienischem Vorbild stets dreisätzigen Konzertstück der Sinfonia zur gewichtigen, durch den Einbezug eines an dritter Stelle stehenden Menuetts nun regelmäßig viersätzigen Sinfonie vollzog. An dieser Entwicklung hatte Mozart durch sein sinfonisches Schaffen entscheidenden Anteil. „Mozarts Sinfonien lassen sich“, so fasst der Musikwissenschaftler Volker Scherliess zusammen, „insgesamt betrachtet, als Repertorium des klassischen Stils verstehen; sie enthalten das ganze Vokabular seiner Tonsprache. Neben Nachwirkungen älterer italienischer Meister und neben unmittelbaren Vorbildern aus Süddeutschland und Österreich gibt es Einflüsse durch die Mannheimer Schule ebenso wie die französische und norddeutsche Tradition mit ihren jeweiligen Errungenschaften. Sie betreffen sowohl die Behandlung des Orchesters, die Dynamik und Harmonik wie typische Figurationen, Ornamente und bestimmte melodische Bildungen.“ Aus der Amalgamierung dieser nicht selten heterogenen Komponenten zu einer eigenen, unverwechselbaren Klangsprache entstanden, gipfelnd in den ‚späten‘ Sinfonien der 1780er-Jahre, etliche Meisterwerke, die „angesichts ihres ästhetischen Ranges, ihrer Einzigartigkeit in jeder Hinsicht“, aber auch „in ihrem kompositorischen Niveau und im Anspruch an das Hören durchaus von allen früheren Sinfonien unterschieden [sind]“ (Scherliess).
Die ausweislich des Autographs am 25. Juli 1788 vollendete Sinfonie Nr. 40 g-moll KV 550 bildet das Mittelglied einer Trias. Ihr war die Komposition der Sinfonie Nr. 39 Es-Dur KV 543 vorausgegangen, die Mozart am 26. Juni des Jahres abgeschlossen hatte, und ihr folgte unmittelbar die Niederschrift der Sinfonie Nr. 41 („Jupiter“) C-Dur
KV 551, die schon am 10. August beendet war. „Drei Meisterwerke solchen Gewichtes und ganz unterschiedlichen Charakters in so kurzer Zeit – das übersteigt jede normale Vorstellung vom schöpferischen Prozess; und dieses Faktum wird umso unerklärlicher, als kein Auftrag bekannt ist, der den Komponisten zu so schneller Produktion gedrängt hätte“ (Scherliess). Während die Gründe und Umstände ihrer Entstehung rätselhaft bleiben, ist immerhin eine äußere Anregung durch die Sinfonien Nr. 82–84 Hob. I:82–84 von Joseph Haydn nicht auszuschließen, bei denen es sich um die ersten drei der sechs sogenannten „Pariser Sinfonien“ handelt, die im Dezember 1787 bei Artaria in Wien als Opus 51 im Druck erschienen waren und in den(selben) Tonarten C-Dur, g-Moll und Es-Dur stehen.
Als einzige der drei letzten Sinfonien Mozarts scheint das g-MollWerk noch zu seinen Lebzeiten erklungen zu sein. In einem Brief aus dem Jahre 1802 berichtet der Prager Musiker Johann Wenzel, leider ohne den genauen Ort und ein Datum zu nennen, von einer Aufführung der Sinfonie in Anwesenheit Mozarts, die bei Gottfried van Swieten stattfand, einem Diplomaten und treuen Förderer des Komponisten, der diesen nicht zuletzt erstmals mit Werken von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel in Berührung gebracht hatte. Dort heißt es, dass Mozart, „als Er sie [die Sinfonie] bei Baron Wanswiten [sic!] hat produciren lassen, […] wärend der production aus dem Zimmer sich hat entfernen müssen, wie man Sie unrichtig aufgeführt hat“. Als Quelle beruft sich Wenzel, der bei dem Konzert nicht zugegen war, auf Mozart: „im Wien habe ich selbst es von verstorbenem Mozart gehört“. Zu öffentlichen Aufführungen kam es höchstwahrscheinlich im Rahmen der traditionellen Akademien der TonkünstlerSocietät am 16. und 17. April 1791, für die der Anschlagzettel als ersten Programmpunkt „eine große Sinfonie von der Erfindung des Hrn. Mozart“ ankündigte, die übrigens ausgerechnet dessen angeblicher Widersacher Antonio Salieri dirigierte. Da an diesen Konzerten der mit Mozart befreundete Anton Stadler sowie dessen jüngerer Bruder Johann Nepomuk als Klarinettisten mitwirkten und sich zur Sinfonie g-moll eine separate Bläserpartitur mit ergänzten Klarinetten- und im Zuge dessen überarbeiteten Oboenstimmen von Mozarts Hand
erhalten hat, die der Komponist dem Autograph beilegte, besteht Grund zu der Annahme, dass es sich bei der „große[n] Sinfonie“ um dieses dem Anlass entsprechend adaptierte Werk gehandelt hat.
Ohne jede Übertreibung kann man den Beginn des aufgewühlten Kopfsatzes als einen der außergewöhnlichsten Sinfonieanfänge der Musikgeschichte bezeichnen. Denn das Molto allegro hebt mit einer Achtelbewegung der geteilten Violen an, einer simplen Begleitfigur, die gar nicht zur eigentlichen Musik gehört, weshalb sie in der Reprise auch wegfällt. Es ist nur ein Takt – wobei es genauso gut mehrere sein könnten –, der aber dafür sorgt, dass von vornherein schon etwas da ist, Musik vor der Musik gewissermaßen, mit dem paradoxen Resultat, dass diese Sinfonie keinen klar definierten Anfang hat: Sie beginnt aus dem Nichts. Auftaktig und im Piano setzt das Hauptthema in den oktaviert parallel geführten Violinen ein, dessen Linie aus einer kleinteiligen motivischen Reihung entsteht. Als Keimzelle dient eine klassische Seufzerfigur, ein Halbtonschritt abwärts mit Wiederholung des Zieltons im Rhythmus zwei Achtel plus eine Viertel:
Wie schon im Finale des „Jenamy“-Konzerts kommt damit auch hier wieder einem unscheinbaren Motiv zentrale Bedeutung zu, denn auf das Intervall der kleinen Sekunde ist der gesamte Satz konstruktiv bezogen. Rastlose Bewegung und erregte Unruhe prägen die Exposition, in der selbst noch das lichtere B-Dur des Seitenthemas von abwärtsziehender Chromatik überlagert wird. „Die ungemein konzentrierte, mit einem Ruck nach fisMoll modulierende Durchführung verarbeitet ausschließlich den Hauptgedanken, setzt aber dessen expressivem, schwingendem Charakter bald erregte, hämmernde Gegenrhythmen entgegen. Schneidende BläserVorhalte, die Hetze durch rasch wechselnde Ton

arten und die immer stärkere Reduzierung des Hauptgedankens auf ein Kleinstmotiv verleihen dem Abschnitt etwas Auswegloses, Verzweifeltes“ (Uwe Kraemer). In der Reprise spitzen sich die Konflikte im Vergleich zur Exposition noch einmal zu und auch das Seitenthema erscheint nun in g-Moll, sodass Fatalismus und Tragik, Schmerz und Klage, Resignation und Melancholie allgegenwärtig sind.
Das in EsDur stehende Andante ist, oberflächlich betrachtet, ein kantabler, sonatenförmig angelegter Siciliano-Satz, der bei aller Bewegung, die jeden seiner Takte erfüllt, eine große Ruhe atmet, wiewohl ihn dunkle Schatten durchziehen. Erneut beginnen die Violen allein. Sie etablieren mit ihrem auftaktigen Einsatz eine für den Siciliano typische 6/8-Bewegung, die den Grundpuls des Satzes darstellt. Das sich darüber entfaltende Hauptthema ist jedoch keine einzelne, begleitete melodische Linie, wie man sie erwarten würde. An ihre Stelle tritt ein mehrschichtiges Geflecht, ein ungemein kunstvolles Gebilde, das den seinerzeit geltenden Regeln des Periodenbaus und der Melodiebildung hohnspricht. Gänzlich unvereinbar mit der Kompositionslehre der Klassik ist dann die Durchführung, denn diese ist genaugenommen vollkommen amelodisch. Überhaupt gewinnt der Satz seine Ausdrucksintensität nicht mehr, wie das bis dahin stets üblich war, aus einprägsamen, strömenden Melodien, sondern aus einer Vielfalt unterschiedlicher Klangfarben, die Mozart der gegenüber den Ecksätzen ungewöhnlicherweise nicht reduzierten Besetzung des Orchesters entlockt, und aus dem Element des Rhythmus, das hier in Gestalt dreier einander mal abwechselnder, mal überlagernder Bewegungsverläufe wirksam wird: den 6/8-Repetitionen, den ausgesungenen Fortschreitungen in 3/8-Werten und den tänzerisch bewegten Zweiunddreißigstel-Figuren. Das Ergebnis ist der vielleicht komplexeste langsame Sinfoniesatz des 18. Jahrhunderts.
Das Menuett steht quer zur Gattungstradition und bewegt sich weit außerhalb der zeitgenössischen Konventionen, die es nur noch hinsichtlich des 3/4-Taktes und der Form respektiert. Mozart läutet selbstbewusst das Ende gesellschaftlicher Unterhaltungsmusik ein und deutet den höfischgraziösen Tanz zu einem mürrischherben Charakter

stück um, dem er eine kontrapunktische Zahnradkonstruktion implementiert und das er mit zahlreichen metrischen Konflikten sowie im zweiten Teil mit kontinuierlich die Spannung verschärfenden Dissonanzen anreichert. Schon das ausgesprochen störrische, synkopisch den Dreiertakt überlagernde Thema, zu dem ein Menuett zu tanzen, so gut wie unmöglich sein dürfte, signalisiert, dass hier die Emanzipation des galanten Tanzsatzes zu einem vollwertigen Sinfoniesatz intendiert ist, der den drei anderen an Bedeutung nicht nachsteht. Das G-Dur-Trio, der einzige Abschnitt des Werkes, in dem in der überarbeiteten Fassung die Klarinetten schweigen, ist mit seinen zarten Oboenklängen gleichzeitig der einzige ungetrübte Moment der ganzen Sinfonie, eine tönende Phantasmagorie arkadischen Friedens.
Das aufgepeitschte Thema, mit dem das Allegro assai des Finalsatzes losbricht, hat nicht mehr das Geringste mit der sogenannten Rakete der Mannheimer Schule zu tun, vielmehr wird das Fatalistische und Resignative des Kopfsatzes damit ins wütend Aufbegehrende gewendet. Der in lauerndem Piano hochschießenden Fanfare der 1. Violinen antwortet das Orchestertutti im Forte mit einem tumultuösen, stark chromatisierten Nachsatz, der sich in der Folge verselbständigt und für einen ruhelosen Vorwärtsdrang des musikalischen Geschehens sorgt. Der Beginn der Durchführung markiert dann die größte Revolution in Mozarts gesamtem Orchesterschaffen:
Im Unisono löst sich das Hauptthema auf, verliert, aller harmonischen Bindungen beraubt, den Halt und zerfällt, durch Pausen regelrecht zerstückelt, in seine Einzeltöne. Diese bilden, mehr als 125 Jahre vor Arnold Schönberg, zugleich eine Zwölftonreihe, der bezeichnenderweise das g, also der Grundton des g-Moll fehlt. Es scheint tatsächlich, um es mit Glenn Gould zu sagen, als ob „Mozart ausholt, um den Geist Anton Weberns zu grüßen“. Was hier geschieht, ist nichts anderes als der durch form- und harmoniesprengende Kräfte herbeigeführte Zusammenbruch der tonalen Ordnung. Der zunehmend ver-
zweifelte, sich bis in entlegenste Kreuztonarten verrennende Versuch, diese Ordnung im Rahmen der Durchführung wiederherzustellen, scheitert, sodass der Eintritt der Reprise förmlich erzwungen werden muss. In ihr sind die Themen der Exposition stark verkürzt und nur noch ein Schatten ihrer selbst, vor allem aber verharrt auch das zweite Thema nun ausschließlich in Moll. Jede Aufhellung und erst recht ein konventioneller Dur-Schluss sind nach den vorangegangenen Erschütterungen der klassischen Ästhetik nicht mehr vorstellbar. Unerbittlich und desillusioniert endet das Werk in g-Moll.
Mozarts einstiger Rivale, der Komponist Muzio Clementi, der das Finale der Sinfonie zu Beginn des 19. Jahrhunderts in einer kammermusikalischen Septettfassung kennlernte, urteilte hellsichtig: „Mozart hat die Grenzen der Musik erreicht und sich darüber hinausgeschwungen, die alten Meister, die Modernen und die Nachwelt selbst hinter sich lassend.“
„JA, WUNDERVOLLE DINGE!“
Mit dem Wissen um die historischen Umstände und das soziokulturelle Umfeld der Entstehung von Mozarts Werken sowie um deren revolutionäre kompositorische Züge sehen wir sie nicht mehr allein in den überlieferten Noten, sondern hören sie als klingende Realität auch in Mozarts Musik: wundervolle Dinge!
Mag. Jan David Schmitz