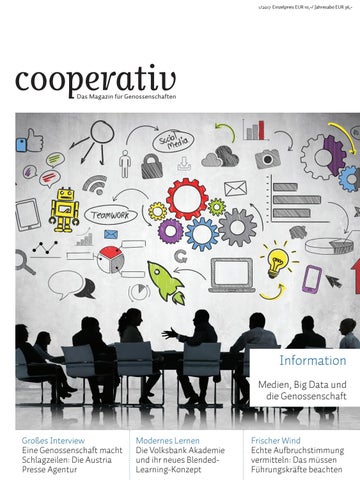1/2017 Einzelpreis EUR 10,-/ Jahresabo EUR 36,-
Das Magazin für Genossenschaften
Information Medien, Big Data und die Genossenschaft
Großes Interview Eine Genossenschaft macht Schlagzeilen: Die Austria Presse Agentur
Modernes Lernen Die Volksbank Akademie und ihr neues BlendedLearning-Konzept
Frischer Wind Echte Aufbruchstimmung vermitteln: Das müssen Führungskräfte beachten