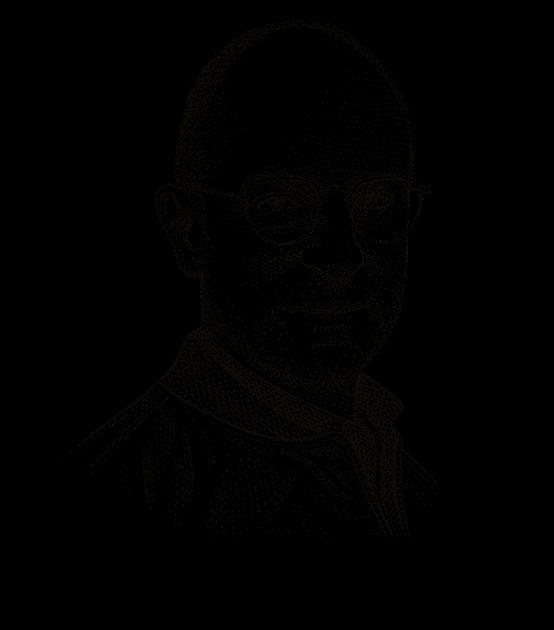
3 minute read
von Benjamin Herzog
C WIE CHORAL
VON BENJAMIN HERZOG Für gewöhnlich vermag der Mensch zu unterscheiden zwischen Wichtigem und Unwichtigem. Es wäre ja auch unpraktisch, wenn uns alles, was uns in unserer Umwelt begegnet, völlig gleich bedeutend vorkäme. Wir sähen bloss, dass die Dinge einander glichen wie ein Ei dem anderen. In der Zeitung müssten wir jeden Artikel lesen. Auch die Anzeigen, die Lösung vom Kreuzworträtsel der Vorwoche und den Sport.
Auch aus musikalischer Perspektive ist das mit dem Wichtigen und Unwichtigen von Bedeutung. Melodie und Begleitstimme, Solo und Tutti, Thematisches und Überleitungen. Das sind (wichtige) Kategorien. Eine Lehrerin am Konservatorium behauptete einmal, Mozarts Musik sei wie ein perfektes Mobile. Alle Teile schwebten darin in völliger Ausgeglichenheit. Würde man hier nur eine Note wegnehmen, so diese Mozart-Verehrerin, käme das Ganze in musikalische Schräglage. Vielleicht hatte sie recht. Aber gilt das für jede Musik? Wieviel Graue Energie steckt zum Beispiel in einem spätromantischen Sinfoniebrocken? Ist da jedes Teilchen tatsächlich gleich wichtig? Hören Sie nur mal die Fünfte von Bruckner. Das hundertköpfige Orchester spielt. Wir biegen in die Schlusskurve des letzten Satzes ein. Hinten bringen sich die Blechbläser in Stellung, Hörner, Posaunen, Trompeten, und setzen zum alles überstrahlenden Choral an. Da ist dann klar, wo Gott hockt. Mögen die Streicher, Flöten, Klarinetten noch so sehr figurale Fülle dazugeben, sie und viele andere sind kaum mehr als auratischer Glanz. Ein Hintergrundflimmern in Sechzehntelnoten.
Und genau darauf liess es Bruckner, auch in anderen Sinfonien, ankommen. Auf diesen Fokus, dieses Scheinwerferlicht auf ein paar wenige Noten, die mit vollem Gewicht einer Sinfonie den Stempel aufdrücken. Der Musikwissenschaftler Dietmar Holland hörte in Bruckners Fünften eine «Steigerung der Gesamtentwicklung bis zum absoluten Höhepunkt am Schluss des Finales, wo sich gleichsam der Himmel öffnet». Wo man ja bekanntlich die letzten Dinge sieht.
Allerdings: Einen Choral im ursprünglichen Sinne zeigt uns Bruckner hier gar nicht. Choral leitet sich ab von Lateinisch ‹choralis›, also chorisch, zum Chordienst gehörend. So weiss es das Lexikon und verweist auf die seit dem Mittelalter geläufige Praxis, in der Kirche ein- oder mehrstimmig im Chor zu singen. War diese ehrenvolle Aufgabe anfänglich nur ausgebildeten Sängern vorbehalten, so durften nach der Reformation auch Krethi und Plethi aus der Kirchbank mitsingen. Die Melodien des reformierten Gottesdienstes waren eingängig und allbekannt durch Sammlungen wie Martin Luthers Wittenberger Gemeindegesangbuch. «Die Musik vertreibt den Teufel und macht die Leute fröhlich», sagte Luther.
© Janine Wiget
Er meinte damit jedoch nicht die Instrumentalmusik, sondern den Gesang.
In Bachs Passionen hat sich für uns, das Konzertpublikum, diese Choralpraxis erhalten. Meine Tante zerknüllte regelmässig Taschentücher, wenn sie in der Matthäus-Passion «Wenn ich einmal soll scheiden» sangen. Über Bachs Passionen ist dieser ‹Choral-Effekt› in die Sinfonik gewandert. Felix Mendelssohn Bartholdy machte – in seiner 2. Sinfonie etwa – Gebrauch davon. Sie ist eine ‹Choral-Sinfonie› gleich im doppelten Sinne. Erst intonieren die Posaunen zu Beginn mottoartig die Psalmmelodie «Alles, was Odem hat, lobet den Herrn». Am Schluss singt dann ein Chor denselben Psalm. Der Bogen zum Sinfoniebeginn ist geschlagen, die Aussage festgenagelt. Den Typus Sinfonie mit Chor hat Mendelssohn natürlich bei Beethoven abgekupfert. Und er ist damit nicht alleine. Erhalten hat er sich über Mahler hinaus bis zu Komponisten wie Ralph Vaughan Williams (A Sea Symphony) oder Dmitri Schostakowitsch (13. Sinfonie, Babi Jar).
Das Deutsche verwendet für solche Sinfonien mit Chor den Begriff Chorsinfonie. Die Engländer sprechen von einer ‹choral symphony›, was aber nicht bedeutet, dass ein Choral, ob erfunden oder zitiert, darin vorkommen muss. Oft finden wir Mischformen. In Gustav Mahlers Auferstehungssinfonie steht auch der Chor zum Schluss wieder auf, das Blech legt choralartig nach, und die Glocken bimmeln überdies dazu. Das ist eine Predigt, sapperlot, und dem lauschenden Volk schallert die Melodie noch lange nach. Auch Brahms und natürlich Beethoven griffen auf das Modell ‹Gemeindegesang› zurück, um ihren Sinfonien den erwünschten Nachdruck zu verleihen.
Böse Zungen behaupten, solche Choralschlüsse dienten einzig dazu, dem Publikum nach einer Stunde sinfonischer Kraftanstrengung die Gewissheit zu geben, dass nun endlich alles gut sei. Und das im Wortsinne: alles. So schreibt ein Bernhard Scheyrer in seiner Nutzlichen Underweisung 1663: «Dahero wird das Choralgesang genennet ein stetes Gesang, weil in dem Choral ain Noten soviel giltet als die ander». Alles ist also gleich wichtig, so einfach ist das.
→ Das nächste Mal: D wie Dienst









