JAHRGANG 33 HEFT 3 Juli 2024
FÜR PHARMAKOLOGIE UND THERAPIE
JOURNAL
OF PHARMACOLOGY AND THERAPY

Prospektive, nicht interventionelle Studie zur Wirksamkeit und Verträglichkeit einer Fixkombination aus Bendroflumethiazid und Amilorid bei erwachsenen Patienten mit arterieller Hypertonie
Wirkstoffkombination von Cariban® ist Mittel der Wahl bei Emesis gravidarum
Urothelkarzinom: Erstlinien-Erhaltungstherapie mit Avelumab eröffnet neue Behandlungsperspektiven
Mythen und Fakten zur chronischen Hauterkrankung Hidradenitis suppurativa
Mpox: Impfstoff Imvanex™ schützt vor Infektion und schwerem Krankheitsverlauf
Rozanolixizumab für die Therapie der generalisierten Myasthenia gravis zugelassen
Dabrafenib plus Trametinib – die erste Kombinationstherapie für pädiatrische Gliome mit BRAF-V600E-Mutation

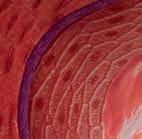














...WÜRDEN SIE IHNEN SAGEN, DASS DIE PULMONAL ARTERIELLE HYPERTONIE (PAH) EINE KOMPLEXE UND FORTSCHREITENDE ERKRANKUNG IST.1,2



Vertiefen Sie Ihr Verständnis für die Pathophysiologie der PAH sowie den Verlauf der Erkrankung.
Lernen Sie mehr über die physiologischen Veränderungen bei PAH und deren Auswirkungen auf Herz und Lunge1,3 –auf www.msdconnect.de/pah/


Ab September stehen zuverlässig die ersten Weihnachtslebkuchen in den Regalen der Supermärkte. Ebenso zuverlässig schafft es 2 Monate vorher die Stiftung Warentest mit ihrem alljährlichen Test von Mineralwässern [1] in so gut wie alle Medien. Dann ist es für mich wieder Zeit, mich zu ärgern über „Ergebnisse“, die unfair und unsachlich Äpfel mit Birnen vergleichen, an vielen Stellen logisch inkonsequent daherkommen, Wesentliches unter den Tisch fallen lassen und aus Mücken Elefanten machen. So gehen nicht weniger als 40 % der Gesamtbewertung auf das Konto eines „sensorischen Urteils“ von „fünf geschulten Prüfpersonen“, die Aussehen (wie sieht Mineralwasser wohl aus?), Geruch, Geschmack und Mundgefühl bewerteten. Wer die Prüfpersonen geschult hat, bleibt im Dunkeln. Geruch und Geschmack wiederum hängen von den Inhaltsstoffen ab: Je weniger Inhaltsstoffe, umso weniger können Geruch und Geschmack auffallen – umso besser das „sensorische Urteil“. Dabei sind es ja gerade die Mineralstoffe, die die (ernährungsphysiologische) Qualität eines Mineralwassers, eines einzigartigen Lebensmittels, ausmachen. Lapidar wird darauf verwiesen, dass wer Wert auf viel Kalzium, Magnesium, Hydrogenkarbonat oder Sulfat legt, halt tiefer in die Tasche greifen und ein solches Wasser kaufen muss.
In der Übersicht der getesteten Mineralwässer ist zwar die Gesamtmineralisation angegeben, ein Kriterium für die Bewertung ist sie indes nicht. Auch findet sich kein Wort dazu, dass mineralstoffarme Wässer dem Körper systematisch Elektrolyte entziehen. Die Niere kann eben nun mal kein quasi destilliertes Wasser ausscheiden. Kein Hinweis auch auf die Elektrolytverluste durch Schwitzen – gerade im Sommer. Mit 1 Liter Schweiß verliert der Körper bis zu 2 Gramm Natrium und bis zu einem halben Gramm Kalium. Bei trockener Hitze ist die beträchtliche Schweißproduktion besonders wenig wahrnehmbar. Würde der Konsum mineralstoffreicher Mineralwässer stärker propagiert, wäre ein klinisch allgegenwärtiges Problem, die chronische Hyponatriämie [2], möglicherweise keines mehr.
Ein gutes Mineralwasser
ist viel besser als sein Ruf –und als Leitungswasser
Übrigens sollten Kinder und Erwachsene deshalb auch Wässer, die mit dem Argument „für Babynahrung geeignet“ werben, mit Vorsicht genießen. Wegen der noch beschränkten Leistungsfähigkeit der Nieren und dem enorm hohen Flüssigkeitsumsatz muss man bei Säuglingen vorsichtig sein mit der Zufuhr zusätzlicher Elektrolyte, ganz im Gegensatz zu gesunden Menschen jedes anderen Alters.
Mineralwässer müssen sehr strenge Bedingungen erfüllen, damit sie überhaupt eine Chance auf amtliche Anerkennung haben, ohne die ein Mineralwasser erst gar nicht in den Handel gebracht werden darf. Dazu zählt u.a. auch die Maßgabe der Mineral- und Tafelwasserverordnung (MTVO), wonach ein Mineralwasser seinen „Ursprung in unterirdischen, vor Verunreinigungen geschützten Wasservorkommen“ haben und in diesem Zustand auch abgefüllt werden muss. „Es ist von ursprünglicher Reinheit und gekennzeichnet durch seinen Gehalt an Mineralien, Spurenelementen oder sonstigen Bestandteilen und gegebenenfalls durch bestimmte, insbesondere ernährungsphysiologische Wirkungen“ heißt es dort weiter. Außer „Eisen-, Mangan- und Schwefelverbindungen sowie Arsen“ darf dem Wasser nichts entzogen, außer Kohlensäure nichts zugesetzt werden.
Die Autoren des Testberichts der Stiftung Warentest stimmen vor diesem Hintergrund auch dieses wie jedes Jahr das Hohe Lied auf den Konsum von Leitungswasser an mit dem Totschlagargument „seine Qualität ist laut Umweltbundesamt gut“. Kein Wort dazu, dass jeder der ca. 2400 Wasserversorger in Deutschland an seinem Standort pro Kopf und Tag über 100 Liter Wasser gewinnen und so aufbereiten muss, dass es den Vorgaben der Trinkwasserverordnung genügt. Dort heißt es „im

Prof. Dr. med. Karl-Ludwig Resch
Trinkwasser dürfen chemische (sowie mikrobiologische und radioaktive) Stoffe nicht in Konzentrationen enthalten sein, die eine Schädigung der menschlichen Gesundheit besorgen lassen“, und dazu dürfen die in einer langen Liste genannten Grenzwerte für alle möglichen Schadstoffe nicht überschritten werden. Gegebenenfalls kann durch Mischen verschiedener Quellen versucht werden, unterhalb der Grenzwerte zu bleiben, oder es kommen chemische Substanzen zum Einsatz, die in einer nicht weniger als 26 Seiten langen Liste aufgeführt sind [3], um das Wasser „aufzubereiten“. Im Test führen „Spuren“ vereinzelt gefundener mutmaßlich eingetragener Stoffe automatisch zur Abwertung, teilweise um Dimensionen höhere Grenzwerte im Leitungswasser werden erst gar nicht thematisiert. Und die finden sich in vielen Leitungswässern reichlich. Jeder lokale Versorger muss eben nehmen, was er kriegt: Leitungswasser stammt „zu 70 % aus Grund- und Quellwasser, zu 13 % wird See-, Talsperren- oder Flusswasser direkt genutzt.
Die übrigen 17 % sind ein Mittelding: ursprünglich Oberflächenwasser, aber durch eine Bodenpassage oder Uferfiltration fast wie Grundwasser“ [4]. Nur wer das den Test begleitende Infomaterial auf den Seiten der Stiftung Warentest durcharbeitet, erfährt Folgendes: „Wenn Sie Leitungswasser zum Trinken oder zum Kochen zapfen, sollten Sie immer Stagnationswasser ablaufen lassen“ [5] – so nennt man Wasser, das aus dem Hahn kommt, der einige Stunden/über Nacht nicht genutzt wurde. Wie lange steht wieder woanders, nämlich so lange, bis das Wasser „merklich kühler aus dem Hahn kommt“. Tut das jemand? Mein Fazit lautet deshalb: Es gibt kaum eine so einfache und nachhaltig gesundheitsförderliche Maßnahme wie das richtige Mineralwasser im Keller. Man muss nur ein einziges Mal die Bedarfe im eigenen Haushalt abwägen und aus ernährungsphysiologischer Sicht bewerten, sich dann für ein oder mehrere Mineralwässer entscheiden und diese kontinuierlich zu Hause vorhalten. Übrigens: In Glasflaschen hält sich Mineralwasser ewig, in PET-Flaschen wird es schnell schal. Und ökologisch kann man auch noch Pluspunkte sammeln, wenn man sich für Mineralwässer mit möglichst kurzem Transportweg entscheidet. Kommen Sie gut hydriert und gesund durch den Sommer – und sparen Sie woanders!
Karl-Ludwig Resch, Nürnberg
ORIGINALARBEIT
Prospektive, nicht interventionelle Studie zur Wirksamkeit und Verträglichkeit einer Fixkombination aus Bendroflumethiazid und Amilorid bei erwachsenen Patienten mit arterieller Hypertonie 68 Elke Parsi, Gernot Schmidt-Petters, Marcus Lutz, Regina Hampel, Patrizia Eirich, Irene Bognar-Steinberg
Quellen
1 Es sprudelt gute Noten. Zeitschrift „Test“, August 2024, 11-17
2 Perschinka F et al. Hyponatriämie: Ätiologie, Diagnostik und Akuttherapie. Med Klin Intensivmed Notfallmed 2023; 118:505-517
3 https://www.umweltbundesamt.de/ themen/wasser/trinkwasser/rechtlichegrundlagen-empfehlungen-regelwerk/ aufbereitungsstoffe-desinfektionsverfahren-ss-20
4 https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/trinkwasser
5 https://www.test.de/FAQ-Wasser-istLeitungswasser-besser-als-Mineralwasser-4745742-0
AKTUELLE THERAPIEKONZEPTE FÜR DIE PRAXIS
Wirkstoffkombination von Cariban® ist Mittel der Wahl bei Emesis gravidarum 82
Urothelkarzinom: Erstlinien-Erhaltungstherapie mit Avelumab eröffnet neue Behandlungsperspektiven 84
Mythen und Fakten zur chronischen Hauterkrankung Hidradenitis suppurativa 86
NEUE UND BEWÄHRTE ARZNEIMITTEL
Mpox: Impfstoff Imvanex™ schützt vor Infektion und schwerem Krankheitsverlauf 89
Rozanolixizumab für die Therapie der generalisierten Myasthenia gravis zugelassen 91
Dabrafenib plus Trametinib – die erste Kombinationstherapie für pädiatrische Gliome mit BRAF-V600E-Mutation 93
RUBRIKEN
Wissenswertes 87, 95 Kongresse 96
IRAK : Unsere jordanische Kinderärztin Tanya Haj-Hassan untersucht ein Neugeborenes in Mossul. © Peter Bräunig
IRAK : Unsere jordanische Kinderärztin Tanya Haj-Hassan untersucht ein Neugeborenes in Mossul. © Peter Bräunig


SPENDEN SIE GEBORGENHEIT FÜR SCHUTZLOSE MENSCHEN
Mit Ihrer Spende rettet ÄRZTE OHNE GRENZEN Leben:
SPENDEN SIE GEBORGENHEIT FÜR SCHUTZLOSE MENSCHEN
Mit Ihrer Spende rettet ÄRZTE OHNE GRENZEN Leben:
Mit 50 Euro ermöglichen Sie z. B. das sterile Material für fünf Geburten. Ohne dieses erleiden Frauen häufig lebensbedrohliche Infektionen.
Private Spender*innen ermöglichen unsere unabhängige Hilfe – jede Spende macht uns stark!
Mit 50 Euro ermöglichen Sie z. B. das sterile Material für fünf Geburten. Ohne dieses erleiden Frauen häufig lebensbedrohliche Infektionen.
Private Spender*innen ermöglichen unsere unabhängige Hilfe – jede Spende macht uns stark!
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft
www.aerzte-ohne-grenzen.de/spenden
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX
www.aerzte-ohne-grenzen.de/spenden
ZUSAMMENFASSUNG
Hintergrund: Die arterielle Hypertonie ist die häufigste kardiovaskuläre Erkrankung weltweit. Obwohl sie der am besten behandelbare kardiovaskuläre Risikofaktor ist, sind gegenwärtig weltweit 4 von 5 betroffenen Patienten nicht adäquat behandelt. In dieser prospektiven, nicht interventionellen Studie wurden die Veränderungen des Blutdrucks unter Medikation und die Verträglichkeit der Fixkombination aus dem Thiazid-Diuretikum Bendroflumethiazid (2,5 mg) und dem kaliumsparenden Diuretikum Amilorid (5,0 mg) bei der Behandlung der arteriellen Hypertonie im klinischen Alltag untersucht. Methode: In die Studie wurden 207 Patienten (66,0 ± 13,6 Jahre; 53,1 % weiblich; 78,2 % übergewichtig/adipös) mit gesicherter arterieller Hypertonie eingeschlossen, für die sich der behandelnde Arzt im Voraus für eine Therapie mit der Fixkombination entschieden hatte. Die Hauptzielparameter systolischer, diastolischer Blutdruck und Herzfrequenz wurden im Zeitraum von 6 Monaten bei 4 Visiten (U1 – U4) erfasst. Als deskriptive Sekundärvariablen waren Laborparameter nach Ermessen der Ärzte zusätzlich möglich. Behandlungserfolg und Verträglichkeit wurden bei der Enduntersuchung vom Arzt und Patient bewertet.
Ergebnisse: Zu Studienbeginn betrug die mittlere Erkrankungsdauer 9,5 Jahre; 84,1 % der Patienten erhielten mindestens eine antihypertensive Medikation, die bei 24,2 % teilweise abgesetzt wurde. Im Verlauf der 6-monatigen Therapie verringerten sich der systolische und diastolische Blutdruck von 155,9/90,0 mmHg auf 132,9/79,3 mmHg (mittlere
Prospektive, nicht
interventionelle Studie zur Wirksamkeit und Verträglichkeit einer Fixkombination aus
Bendroflumethiazid und Amilorid bei erwachsenen
Patienten mit arterieller Hypertonie
Elke Parsi1,Gernot Schmidt-Petters2, Marcus Lutz3, Regina Hampel4, Patrizia Eirich3, Irene Bognar-Steinberg3
1 Facharzt für Innere Medizin/Kardiologie, Berlin
2 Facharzt für Allgemeinmedizin, Flörsheim am Main
3 Medizinische Wissenschaft, Hennig Arzneimittel, Flörsheim am Main
4 Gesellschaft für Therapieforschung mbH (GKM), München
Die arterielle Hypertonie ist nach wie vor die häufigste kardiovaskuläre Erkrankung weltweit. In Europa sind jeder 4. Mann und jede 5. Frau daran erkrankt. Obwohl sie der am besten behandelbare kardiovaskuläre Risikofaktor ist, werden auch heute noch 4 von 5 betroffenen Patienten nicht adäquat behandelt [1]. Die Folge ist, dass die arterielle Hypertonie, die die WHO als „stillen Killer” bezeichnet, jedes Jahr für mehr als 10 Millionen Todesfälle weltweit verantwortlich ist [2]. Die arterielle Hypertonie ist auch Teil des metabolischen Syndroms. Daraus ergeben sich Besonderheiten in der Hochdrucktherapie bei kardiometabolischen Patienten, die deshalb für jeden individuell
einzuschätzen und anzupassen ist. Von den 5 Hauptklassen der Antihypertensiva werden die Diuretika am häufigsten verordnet und hier besonders hervorgehoben das Hydrochlorothiazid (HCT) in Kombination oder in Monotherapie [1]. Da alle Diuretika vom Thiazid- und Thiazid-Analoga-Typ metabolische Veränderungen und Elektrolytverschiebungen in Form einer Hypokaliämie nach sich ziehen, wird als Ausgleich dafür ihre Kombination mit einem kaliumsparenden Diuretikum empfohlen [3].
Mit der vorliegenden nicht interventionellen Studie (NIS) werden die Erfahrungen zur Wirksamkeit und Verträglichkeit der Fixkombination aus dem ThiazidDiureti
kum Bendroflumethiazid (2,5 mg) und dem kaliumsparenden Diuretikum Amilorid (5,0 mg)* unter Alltagsbedingungen dargestellt.
Material und Methoden
Studienaufbau
Die vorliegende Untersuchung war als prospektive, nicht interventionelle Studie (NIS [4], Synonym Beobachtungsstudie) angelegt und wurde im gesamten Bundesgebiet mit niedergelassenen Ärzten aus den Fachbereichen Allgemeinmedizin, Innere Medizin und Kardiologie durchgeführt. Untersucht werden sollte die Fragestellung, ob unter der Therapie mit der Fixkombination aus Bendroflumethiazid und Amilorid deutliche und konsistente Veränderungen des Blutdrucks bei den eingeschlossenen Patienten mit gesicherter arteriellen Hypertonie zu beobachten sind, die als Evidenz dafür zu werten sind, dass es sich bei dem beobachteten Zusammenhang zwischen Medikamenteneinnahme und Veränderung der Blutdruckwerte um einen kausalen Zusammenhang nach Bradford Hill handelt (vgl. Tabelle 12.3 in [5]). Die Datenerhebung startete im September 2020 und endete im Januar 2022. Die Ärzte, die das handelsübliche Kombinationspräparat aus Bendroflumethiazid (2,5 mg) und Amilorid (5,0 mg) zur Behandlung der arteriellen Hypertonie einsetzten, wurden gebeten, das Behandlungsergebnis in standardisierten Prüfungsbögen (Case Report Forms, CRFs) zu dokumentieren. Die Entscheidung für die Verordnung der Fixkombination wurde unabhän
* Tensoflux®, Hennig Arzneimittel, Flörsheim am Main
gig vom und vor dem Einschluss des Patienten in die Studie getroffen. Einschlusskriterium war die ambulante Behandlung der arteriellen Hypertonie bei erwachsenen Patienten (≥18 Jahre) gemäß den Bestimmungen der Fachinformation [6]. Patienten, die in den letzten 30 Tagen vor Einschluss in die Studie oder derzeit an anderen interventionellen oder nicht interventionellen Studien teilnahmen, wurden von der Teilnahme ausgeschlossen. Alle Patienten gaben eine schriftliche Einwilligungserklärung zur Teilnahme und Weitergabe der persönlichen Daten. Die Studie wurde der Ethikkommission bei der Landesärztekammer Hessen für eine berufsethische und berufsrechtliche Beratung vorgelegt. Das positive Votum vom 25.08.2020 wurde von den Ethikkommissionen im Hoheitsgebiet der teilnehmenden Ärzte ratifiziert. Die Ärzte bestimmten die Anfangsdosis (empfohlene Dosierung 1 Tablette mit 2,5 mg Bendroflumethiazid und 5,0 mg Amilorid täglich, bei Bedarf konnte auf 2 Tabletten täglich erhöht werden) und die Erhaltungsdosis sowie die Dauer der Behandlung gemäß der Fachinformation [6] und unabhängig von der Studiendokumentation. Die gleichzeitige Anwendung von weiteren Antihypertensiva erfolgte nach Ermessen des Arztes. Vorgesehen waren 4 Erhebungszeitpunkte, deren zeitliche Festlegung in der Entscheidung des behandelnden Arztes lag und sich nach der ärztlichen Routine richtete. Die demographischen Daten und die Anamnese wurden bei der ersten Visite (U1 am Tag 0) erhoben. Vorhandene Laborparameter, die im Rahmen der üblichen Praxis bestimmt wurden, sowie die Begleitmedikation, der Blutdruck, die Herzfrequenz und die verord
Abnahme: 22,8/11,0 mmHg; p < 0,001) und die Herzfrequenz von 75,3 auf 72,2 Schläge/min (mittlere Abnahme: –2,5 Schläge/min; p < 0,001). Die limitiert vorhandenen Laborwerte zeigten keine wesentliche Veränderung im Behandlungszeitraum. Das Serum-Kalium war bei U4 nur geringfügig vermindert (–0,19 mmol/l; n = 22). Bei Patienten mit Typ-2-Diabetes mellitus deutete sich eine Tendenz zur Verbesserung des Glukosestoffwechsels mit einer mittleren Reduktion der Nüchtern-Glukose um –1,29 mmol/l (n = 11) und des HbA1c um –1,95 % (n = 15) an. Die Verträglichkeit wurde von den Ärzten mit 96,5 % und den Patienten mit 96,1 % überwiegend als gut oder sehr gut beurteilt. Lediglich 6 Patienten (2,9 %) berichteten 10 unerwünschte nicht schwerwiegende Ereignisse. Schlussfolgerungen: Die Fixkombination aus Bendroflumethiazid und Amilorid ist eine zuverlässig wirksame, gut verträgliche Option zur Erreichung des Blutdruckzielwertes bei der Behandlung der arteriellen Hypertonie unter Minimierung von Diuretika-assoziierten Elektrolytstörungen und ihren Folgen, weshalb sie auch für die Therapie der arteriellen Hypertonie bei kardiometabolischen Patienten geeignet ist. Die Fixkombination ist sowohl als Add-on zur verordneten als auch in Monotherapie wirksam. Im Praxisalltag erreichte die Behandlung eine sehr hohe Akzeptanz hinsichtlich der beobachteten Wirksamkeit und Verträglichkeit bei einem sehr niedrigen Anteil unerwünschter Ereignisse.
Schlüsselwörter: arterielle Hypertonie, Bendroflumethiazid, Amilorid, Fixkombination, nicht
interventionelle Studie (NIS), Wirksamkeit, Verträglichkeit
SUMMARY
Introduction: Arterial hypertension is the most common cardiovascular disease worldwide. Although hypertension is the most effectively treatable cardiovascular risk factor, 4 out of 5 patients worldwide are still not adequately treated.
This prospective, non-interventional study investigated the perceived effectiveness in reducing blood pressure and the tolerability of the thiazide diuretic bendroflumethiazide (2.5 mg) and the potassium-sparing diuretic amiloride (5.0 mg) in fixed combination in the treatment of arterial hypertension in everyday clinical practice.
Methods: The study enrolled 207 patients (66.0 ± 13.6 years; 53.1 % female; 78.2 % overweight/obese) with confirmed arterial hypertension, for whom the physician had decided in advance on a therapy with the fixed combination. Main outcome parameters, blood pressure and heart rate, were recorded at 4 visits (U1 – U4) over a period of 6 months. Laboratory parameters were determined as descriptive secondary variables at the physicians’ discretion. Treatment success and tolerability were assessed at the final examination by physicians and patients. Results: At baseline, the mean duration of illness was 9.5 years; 84.1 % of patients received antihypertensive medication, which was partially discontinued in 24.2 %. Over the course of 6-months therapy, the mean blood
nete Therapie einschließlich der Fixkombination wurden ebenfalls bei Visite U1 (Baseline) erfasst. Bei den nachfolgenden optionalen Kontrolluntersuchungen U2 und U3 (nach ca. 1 Monat und nach 3 Monaten) sowie bei der Abschlussuntersuchung U4 (nach ca. 6 Monaten oder bei Beendigung der Therapie) wurden neben Blutdruck und Herzfrequenz ggf. auch die vorliegenden Laborparameter sowie jegliche Änderungen der Dosierung, Begleitmedikation und Begleiterkrankungen dokumentiert. Zur Dokumentation von Blutdruck und Herzfrequenz im Verlauf der Therapie trugen die Patienten die von ihnen zuhause gemessenen Werte in einen den Studienteilnehmern ausgehändigten Kontrollpass ein.
Prüfvariablen und Auswertung
Zur Analyse der Evidenz für die blutdrucksenkende Wirkung der Prüfmedikation wurden bei jeder Visite der systolische und diastolische Blutdruck sowie die Herzfrequenz im Sitzen und Liegen gemessen. Primäres Zielkriterium waren die Veränderungen zwischen den Messzeitpunkten U1 und U4. Die geplante Analyse des von den Patienten ausgefüllten Blutdruckkontrollpasses konnte jedoch wegen unzureichender Datenlage nicht durchgeführt werden.
Im Rahmen der sekundären Wirksamkeitsanalyse wurden folgende Laborparameter erfasst: SerumKalium, SerumNatrium, Lipide (Gesamtcholesterin, HDL und LDL-Cholesterin, Triglyzeride), NüchternGlukose, HbA1c, SerumHarnsäure, AlaninAminotransferase (ALT), AspartatAminotransferase (AST), Gam
maGlutamyltransferase (GGT) sowie Albumin im Urin. Bei der Abschlussuntersuchung wurde die wahrgenommene Wirksamkeit (sog. perceived effectiveness) des Kombinationspräparates mittels einer verbalen 5PunkteSkala (sehr gut, gut, gering, unwirksam, verschlechtert) vom Arzt beurteilt. Außerdem bewerteten Arzt und Patient die Verträglichkeit der Medikation anhand einer verbalen 4-Punkte-Skala (sehr gut, gut, mäßig, schlecht). Die Sicherheitsbewertung umfasste die Dokumentation der unerwünschten Ereignisse (UEs), einschließlich ihrer Klassifizierung in Bezug auf Schweregrad, Ausmaß und möglichem Zusammenhang mit der Studienmedikation (unerwünschte Arzneimittelwirkungen, UAW).
Zur Kodierung der unerwünschten Ereignisse wurde das Medizinische Wörterbuch für Aktivitäten im Rahmen der Arzneimittelzulassung (Medical Dictionary for Regulatory Activities, MedDRA) in der aktuellen Version verwendet. Da es sich hier um eine nicht interventionelle Beobachtungstudie handelt, waren die Analysen deskriptiver Natur. Nach doppelter Dateneingabe wurde die statistische Auswertung mit dem Programm SAS (Statistisches AnalyseSystem, SAS Institute Inc.) durchgeführt. Für numerische Variablen wurden Mittelwert, Standardabweichung, Minimum, Median, 25% und 75%Quantil sowie Maximum und zusätzlich 95%-Konfidenzintervalle (95%KI) berechnet. Kategoriale Daten wurden mittels absoluter und relativer Häufigkeit dargestellt. Für Variablen, die im Verlauf der Studie bei verschiedenen Visiten dokumentiert wurden (primäre und sekundäre Wirksamkeitsvariablen), erfolgte zusätzlich zu der visiten
Anzahl der Patienten (%)
Aufnahme
Teilgenommen
Nicht teilgenommen 0 (0,0) 13 (6,3) 22 (10,6) 31 (15,0)
Tabelle 1: Anzahl der Patienten pro Visite.
weisen Auswertung eine Analyse gemäß der LOCF (Last Observation Carried Forward)Methode. Dabei wurde bei nicht verfügbaren Werten der letzte gültige Wert fortgeschrieben. Zusätzlich zu den o.g. Berechnungen wurden die p-Werte für die Veränderung zwischen U1 und U4 der primären Wirksamkeitsvariablen berechnet.
Ergebnisse
Patienten-Charakteristika
Insgesamt nahmen 207 Patienten mit gesicherter arterieller Hypertonie (Blutdruckgrenzwert >140/90 mmHg) an der Studie teil. Alle Patienten wurden in die Analyse eingeschlossen. Bei allen Untersuchungspunkten nahmen rund 90 % der Patienten täglich 1 Tablette der Fixkombination ein. Die Einnahme erfolgte meistens am Morgen.
An den Kontrolluntersuchungen nahmen nach 1 Monat 93,7 % und nach 3 Monaten 89,4 % der Patienten teil, 85 % (176 Patienten) durchliefen die Studie komplett bis zur Abschlussuntersuchung nach 6 Monaten (Tab. 1).
Das Durchschnittsalter der Patienten betrug 66 Jahre. 53,1 % waren weiblich, 89,0 % kaukasisch und 78,2 % Nichtraucher. Basierend auf der BMI-Kategorisierung der WHO waren 38,3 % der Patienten übergewichtig und 39,9 % adipös (Adipositas Grad I bis III). Etwa
60,6 % der Patienten zeigten eine familiäre Disposition bezüglich Hypertonie (Tab. 2).
Bei Studienbeginn (U1) lag die angegebene Dauer der Erkrankung seit Erstdiagnose im Mittel 9,5 ± 7,9 Jahre (n = 192) zurück; 84,1 % der Patienten wurden bereits behandelt. Die 3 häufigsten Antihypertensiva in den Vormedikationen waren Candesartan, Ramipril und Amlodipin. Bei 50 Patienten (24,2%) wurde mindestens eine antihypertensive Vormedikation vor/bei Studienbeginn abgesetzt. Zur U1 hatten 174 Patienten (84,1 %) eine oder mehrere Begleiterkrankungen; die häufigsten waren Typ-2-Diabetes mellitus (22,2 %), Hyperlipidämie (16,4 %), Adipositas (10,1 %) und Hypothyreose (7,7 %). Entsprechend den Begleiterkrankungen waren die häufigsten nicht antihypertensiven Begleitmedikationen Levothyroxin-Natrium (13,0 %) und Metformin (12,1 %) (Tab. 2).
Veränderungen des Blutdrucks und der Herzfrequenz unter der Medikation
Bei Aufnahme in die Studie betrug der mittlere systolische Blutdruck in der Gesamtpopulation (n = 207) im Sitzen 155,9 ± 15,2 mmHg und der mittlere diastolische Blutdruck 90,0 ± 10,3 mmHg. Der Blutdruck im Sitzen verringerte sich bis zur Abschlussuntersuchung nach 6 Monaten (U4,
pressure (systolic/diastolic) decreased from 155.9/90.0 mmHg to 132.9/79.3 mmHg (mean decrease –22.8/–11.0 mmHg; p < 0.001) and heart rate from 75.3 to 72.2 beats/min (mean decrease –2.5 beats/min; p < 0.001). The limited laboratory values showed no significant change during the treatment period, serum potassium was only slightly reduced at U4 (–0.19 mmol/L; n = 22). Patients with type 2 diabetes mellitus showed a tendency towards improvement in glucose metabolism with a mean reduction in fasting glucose by –1.29 mmol/L (n = 11) and HbA1c by –1.95 % (n = 15). The tolerability was rated as mostly good or very good by the physicians (96.5 %) and the patients (96.1 %). Only 6 patients (2.9 %) reported a total of 10 adverse events, all non-serious. Conclusion: The fixed combination of bendroflumethiazide and amiloride is a perceived effective, well-tolerated option for achieving the blood pressure target value in the treatment of arterial hypertension while minimizing diuretics-induced electrolyte disturbances. The fixed combination is effective both as an add-on and as monotherapy, also in the therapy of arterial hypertension of cardiometabolic patients. In everyday practice, the treatment achieved a very high acceptance in terms of efficacy and tolerability, with a very low incidence of adverse events.
Keywords: arterial hypertension, fixed combination, bendroflumethiazide, amiloride, noninterventional study, efficacy, tolerability
Merkmal
Alter (Jahre), Mittelwert ± SD
Altersgruppe, n (%)
≤65 Jahre
>65 Jahre
Geschlecht, n (%)
(51,7)
(0,5)
Körpergröße (cm), Mittelwert ± SD
Gewicht (kg), Mittelwert ± SD
Body Mass Index (kg/m2), Mittelwert ± SD
BMI in Kategorien gemäß WHO, n (%)
Übergewicht
Adipositas Grad I
Adipositas Grad II
Adipositas Grad III
Mit familiärer Disposition bzgl. Hypertonie, n (%)
Dauer der Hypertonie seit Diagnose (Jahre), Mittelwert ±
Vorbehandlung der Hypertonie, n (%)*
Bisoprolol
(38,3)
(22,9)
(10,0)
(7,0)
(60,6)
(84,1) /
(21,3) / 1 (0,5)
(18,8) / 5 (2,4)
(16,9) / 2 (1,0) Metoprolol
(5,8) / 7 (3,4)
(13,0) / 3 (1,4) Valsartan
Torasemid 11 (5,3) / 9 (4,3)
Lercanidipin 10 (4,8) / 0
Candesartan + Hydrochlorothiazid 6 (2,9) / 2 (1,0)
Hydrochlorothiazid 5 (2,4) / 4 (1,9)
Enalapril 5 (2,4) / 3 (1,4)
Lisinopril 5 (2,4) / 4 (1,9)
Olmesartan + Amlodipin 5 (2,4) / 1 (0,5)
Begleiterkrankung, n (%)** 207 174 (84,1)
Diabetes mellitus Typ 2 46 (22,2)
Hyperlipidämie 34 (16,4)
Adipositas 21 (10,1)
Hypothyreose 16 (7,7)
Koronarerkrankung 15 (7,2)
Störung des Purin-, Pyrimidin- oder Nukleotidstoffwechsels 13 (6,3)
* Nur antihypertensive Medikamente, die von >2 % der Patienten genommen wurden.
** Nur Begleiterkrankungen, die bei >5 % der Patienten vorlagen; Mehrfachnennungen möglich.
Tabelle 2: Demographische und ausgewählte weitere Merkmale der Patienten bei Aufnahme in die Studie (Baseline).

und Herzfrequenz im
bei Aufnahme in die Studie (U1, n = 207), nach 1 Monat (U2, n = 194), nach 3 Monaten (U3, n = 185) und nach 6 Monaten Therapie (U4, n = 176). *** p < 0,001 für den Vergleich der Werte bei U4 und U1.
n = 176) auf 132,9 ± 11,1 mmHg bzw. 79,3 ± 7,2 mmHg. Dies entspricht einer signifikanten mittleren Abnahme um systolisch –22,8 ± 17,4 mmHg und diastolisch um 11,0 ± 10,4 mmHg (Abb. 1; p < 0,001). Die Analyse aller Teilnehmer unter Fortschreibung des letzten gültigen Messwerts auf den Messzeitpunkt U4 (LOCFMethode) bestätigte die vorher beschriebenen Ergebnisse (Abb. 2).
Auch die Herzfrequenz im Sitzen nahm im Verlauf der Therapie signifikant von 75,3 ±9,6 Schlägen/ min auf 72,2 ± 7,9 Schläge/min ab (Abb. 1; p < 0,001), was einer Reduktion von –2,1 ± 9,2 Schlägen/ min entsprach (LOCF-U1, Abb. 3).
Blutdruck und Herzfrequenz im Liegen wurden von den Ärzten nur bei etwa 60 % der Patienten (n = 129) gemessen. Die Messungen im Liegen ergaben ähnliche Werte wie im Sitzen. Alle 3 Hauptparameter nahmen im Verlauf der Behandlung (LOCF-
U1) signifikant (p < 0,001) ab. Der Blutdruck ging systolisch um –21,1 ± 17,2 mmHg, diastolisch um –11,5 ± 15,9 mmHg und die Herzfrequenz um 1,9 ± 13,0 Schläge/min zurück.
In den Subgruppenanalysen zeigten die Hauptparameter Blutdruck und Herzfrequenz keinen geschlechtsspezifischen Unterschied, jedoch fand sich eine etwas stärkere Reduktion bei den unter 65-Jährigen im Vergleich zu den über 65-Jährigen. Auch die Patienten ohne antihypertensive Vorbehandlung zeigten eine Tendenz zur stärkeren Reduktion des Blutdrucks und in geringem Ausmaß auch der Herzfrequenz, aber mit einer größeren Streuungsbreite als die bereits vorbehandelten Hypertoniker. Vergleichbare Ergebnisse wurden bei Patienten mit und ohne Hyperlipidämie sowie mit oder ohne Typ2Diabetes mellitus gefunden (Abb. 2, Abb. 3).
Veränderungen von Kontrollparametern im Beobachtungszeitraum
Die Auswertung der Laborparameter in der Gesamtpopulation ist aufgrund der geringen Anzahl der vorliegenden Daten limitiert, zeigte aber für keinen der Parameter eine wesentliche Veränderung im Verlauf der Behandlung mit der Fixkombination (Abb. 4). Der mittlere SerumKaliumwert war geringfügig mit einem sehr engen 95%-Konfidenzintervall sowohl im Gesamtkollektiv als auch bei den Patienten mit Diabetes mellitus oder Hyperlipidämie vermindert. Das SerumNatrium war ebenfalls im Verlauf der Behandlung im Mittel ohne wesentliche Veränderung, obwohl hier eine größere Streuung der Werte um die Null-Veränderung zu verzeichnen ist. Die Subgruppe der Patienten mit Diabetes mellitus lässt eine Tendenz zur Verbesserung des Glukosestoffwechsels

Abbildung 2: Systolischer und diastolischer Blutdruck im Sitzen.
* Wert bei U4 ermittelt nach der LOCF (Last Observation Carried Forward)-Methode.
*** p < 0,001 für den Vergleich U4 vs. U1.
mit einer mittleren Senkung um 1,29 mmol/l für NüchternGlukose und –1,95 % für HbA1c im Verlauf der Behandlung erkennen. Die Li
pidwerte blieben bei allen Patienten, einschließlich derjenigen mit Hyperlipidämie (Abb. 4) und Diabetes mellitus (nicht dargestellt),
während der Behandlung mit der Fixkombination nahezu unverändert und verteilten sich in einem engen Konfidenzintervall um den

Abbildung 3: Herzfrequenz im Sitzen.
* Wert bei U4 ermittelt nach der LOCF (Last Observation Carried Forward)-Methode. ** p < 0,01 für die Veränderung (LOCF-U1).
Nullpunkt. Ein ähnliches Bild ergab sich auch für die HarnsäureWerte und die Leberenzyme im Gesamtkollektiv.
Beurteilung der beobachteten Blutdruckveränderungen und der Verträglichkeit
Bei der Abschlussuntersuchung wurde die wahrgenommene blutdrucksenkende Wirksamkeit der Fixkombination durch den behandelnden Arzt beurteilt. Sie wurde dabei für 97,1 % der Patienten (n = 200) mit „sehr gut“ oder „gut“ bewertet. Nur bei 2 Patienten (1,0 %) wurde die Fixkombination als „unwirksam“ bewertet; die Kategorie „verschlechtert“ fand sich bei keinem Patienten (Tab. 3).
Tabelle 3: Beurteilung der Wirksamkeit durch den Prüfarzt.
Die Verträglichkeit der Medikation wurde zum Studienabschluss sowohl durch den Arzt als auch durch den Patienten beurteilt (Abb. 5). In ca. 96 % der Fälle lautete die Bewertung „sehr gut“ oder „gut“ (Arzt: n = 193; Patient: n = 198). Eine mäßige Verträglichkeit wurde nur in 6 bzw. 4 Fällen durch den Patienten bzw. Arzt, eine schlechte
Verträglichkeit in 2 bzw. 3 Fällen angegeben.
Arzneimittelsicherheit
Im Rahmen der nicht interventionellen Studie kam es bei 6 Patienten (2,9 %) zu insgesamt 10 nicht schwerwiegenden, unerwünschten

Abbildung 4: Laborparameter bei Aufnahme (U1) und ihre Veränderung zur letzten Untersuchung (U4), ermittelt nach der LOCF (Last Observation Carried Forward)Methode. Dargestellt sind die Werte im Gesamtkollektiv (schwarz) und in den Subgruppen mit den Diagnosen Typ-2-Diabetes mellitus (rot) und Hyperlipidämie (grün) bei U1.
ALT = AlaninAminotransferase, AST = AspartatAminotransferase, GGT = GammaGlutamyltransferase.

Abbildung 5: Beurteilung der Verträglichkeit der Medikation durch den Arzt und durch den Patienten am Studienende, bewertet anhand einer 4-Punkte-Skala (sehr gut, gut, mäßig, schlecht).
Ereignissen (UEs) (Tab. 4). Zwei davon (Diarrhö und Dehydratation) wurden als unerwünschte Arzneimittelwirkung (UAW) mit einem möglichen kausalen Zusam
Unerwünschtes Ereignis (UE)
menhang mit der Prüfmedikation bewertet. Diese UAWs sind für die Fixkombination entsprechend in der Fachinformation gelistet und wurden daher als „erwartet“ bewertet. Aus den gemeldeten UEs ergibt sich folglich kein neues sicherheitsrelevantes Signal.
Diskussion
Die arterielle Hypertonie ist nach wie vor der bedeutendste kardiovaskuläre Risikofaktor für Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzinsuffizienz und kardiovaskulären Tod. Die effektive Kontrolle des Blutdrucks ist daher weltweit von entscheidender Bedeutung, um einerseits das Risiko dieser schwerwiegenden Gesundheitsprobleme für die Betroffenen und andererseits die dadurch entstehenden hohen Gesundheitskosten zu reduzieren. Die häufigste Medikamentengruppe in der Therapie der arteriellen
unerwünschte Ereignisse (UEs)
Als unerwünschte Arzneimittelwirkung (UAW) klassifiziert*
Einzelne UEs nach MedDRA-Terminologie
Bevorzugter Begriff (PT) Systemorganklasse (SOC)
Vertigo Erkrankungen des Ohrs und des Labyrinths
Dehydratation* Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
Infektion Infektionen und parasitäre Erkrankungen
Periphere Ödeme Allgemeinerkrankungen
Schmerzen in den Extremitäten Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankun
gen
Blutdruck
des Gastrointestinaltrakts
* Unerwünschte Arzneimittelwirkungen: Diarrhö, Dehydratation
** Anzahl der Patienten mit mindestens einem UE
MedDRA = Medical Dictionary for Regulatory Activities
Tabelle 4: Unerwünschte Ereignisse in der Sicherheitsanalyse (n = 207).
Hypertonie sind die Diuretika und hier besonders die Thiazide und Thiazid-Analoga. Zwei große Studien – SHEP [7] und ALLHAT [8] – untersuchten die Wirkung von Chlortalidon, die ASCOTBPLA-Studie [9] untersuchte die Wirkung von Bendroflumethiazid in Kombination mit Atenolol auf den Blutdruck. Es liegen insgesamt nur wenige Untersuchungen zur Wirksamkeit von Bendroflumethiazid als Monosubstanz sowohl zur Blutdrucksenkung als auch zu den metabolischen Wirkungen vor [10, 11, 12]. Harper et al. [12] verglichen den Einfluss von Bendroflumethiazid 1,25 mg und 5,0 mg in einer Studie über 12 Wochen auf den Blutdruck und die Auswirkungen der Therapie auf Kalium, Natrium, Harnsäure, Kreatinin, NüchternGlukose, HbA1c und Blutfette. Die Autoren konnten zeigen, dass Bendroflumethiazid 1,25 mg genauso wirksam hinsichtlich der Blutdrucksenkung ist wie 5,0 mg, aber im
Gegensatz zur höheren Dosis keinen Einfluss auf die hepatische Insulinwirkung hat. Von den Laborparametern hingegen war der Kaliumverlust unter 5,0 mg Bendroflumethiazid signifikant höher als unter 1,25 mg. Die blutdrucksenkende und metabolische Wirkung der Fixkombination aus Bendroflumethiazid und Amilorid wurde in klinischen Studien bisher nicht eingehend untersucht. Trotz individualisierter Therapie ist der Blutdruck nicht immer optimal im Zielbereich einstellbar. Gründe dafür sind vielfältig, u.a. eine nicht adhärente Medikamenteneinnahme, eine unzureichende, nicht angepasste Medikation, vorher nicht bekannte Medikamentenunverträglichkeiten oder -nebenwirkungen und eine obstruktive Schlafapnoe. Darüber hinaus können Lebensstilfaktoren wie eine nicht ausgewogene oder kochsalzbetonte Ernährung, mangelnde körperliche Aktivität, erhöhter Alkoholkonsum und Rauchen dazu führen, dass der Blutdruck nicht ausreichend gesenkt wird. Auch in der vorliegenden Untersuchung zeigt sich, dass die Patienten mit bereits eingeleiteter antihypertensiver Therapie mit einem durchschnittlichen Wert von 156/90 mmHg zu Studienbeginn unzureichend eingestellt waren.
Beobachtete antihypertensive Wirkung der Fixkombination
Die Fixkombination aus Bendroflumethiazid und Amilorid wird meist zusätzlich zur bestehenden antihypertensiven Therapie angewendet, kann aber auch als Monotherapie in Betracht gezogen werden, insbesondere bei Patienten, bei denen eine arterielle Hyperto
nie ohne weitere kardiovaskuläre Risikofaktoren vorliegt, die Therapie mit einem anderen Diuretikum nicht zufriedenstellend ist bzw. Nebenwirkungen wie eine Hypokaliämie oder Muskelkrämpfe, Palpitationen etc. hervorruft. In unserer Untersuchung konnte durch die Zugabe der Fixkombination bei vorbehandelten Patienten eine durchschnittliche Blutdrucksenkung auf 132,9/79,3 mmHg zu Studienende erreicht werden. In einer 1981 durchgeführten multizentrischen Studie [13] mit Amilorid, Hydrochlorothiazid (HCT) sowie der Kombination aus beiden (Amilorid 5 – 10 mg plus HCT 50 – 100 mg) bei 179 Patienten mit leichter bis mittelschwerer arterieller Hypertonie im Alter von 21 – 69 Jahren über einen Zeitraum von 12 Wochen kam es unter der Kombination zu einer signifikanten Senkung des Blutdrucks um 23/11 mmHg. Vergleichbare Ergebnisse zeigte auch die PATHWAY3Studie [14], die darüber hinaus den Einfluss des HCT auf den Glukosestoffwechsel untersuchte. In einer Langzeitstudie [15] mit HCT in Monotherapie wurden neben der Blutdrucksenkung auch metabolische Folgen wie die Hypokaliämie und Hyperurikämie gefunden. Diese metabolischen Veränderungen konnten durch die Zugabe von Amilorid ausglichen werden.
In der vorliegenden NIS unter Anwendung der seit 1984 auf dem deutschen Markt erhältlichen Fixkombination eines Thiazids (Bendroflumethiazid 2,5 mg) und eines kaliumsparenden Aldosteron-unabhängigen Diuretikums (Amilorid 5 mg) wurde eine fast identische Blutdrucksenkung um 23/11 mmHg über die blutdrucksenkende Wirkung der bestehen
den antihypertensiven Medikation hinaus beobachtet. Der Unterschied zu den vorherigen Studien liegt jedoch in der geringeren Dosierung von Bendroflumethiazid in der Fixkombination und damit in der deutlich geringeren Wirkstoffbelastung besonders durch das Thiazid (2,5 mg Bendroflumethiazid vs. HCT 50 – 100 mg) bei vergleichbarer Amilorid-Dosis (5,0 mg). Peterzan et al. [16] fanden darüber hinaus, dass Bendroflumethiazid etwa 20-mal potenter in der Blutdrucksenkung ist als HCT, was dafür spricht, dass bei einer geringeren Wirkstoffbelastung eine vergleichbare Wirkung erzielbar sein dürfte.
Der Wirkmechanismus des Bendroflumethiazids [10] basiert auf einer Inhibition des NatriumchloridKanals im distalen Tubulussystem der Niere, sodass weder Natrium noch Chlorid rückresorbiert werden können. Somit verbleiben diese osmotisch wirksamen Ionen im Tubulus und führen dazu, dass auch Wasser, welches normalerweise den Ionen folgt, nicht rückresorbiert wird. Folglich wird es samt Natrium und Chlorid ausgeschieden, was mit einer vermehrten Ausscheidung des Körperwassers einhergeht. Die erhöhte Natriumkonzentration im Urin führt zu einer verstärkten Rückresorption von Natrium im spätdistalen Tubulus und im Sammelrohr durch den Aldosteron-abhängigen epithelialen Natriumtransporter (ENaC). Dies geschieht im Austausch mit Kalium, was mittelbar zu Kaliumverlusten durch die ThiazidDiurese führt. Der Kombinationspartner Amilorid hemmt den ENaC, sodass weniger Natrium rückresorbiert und folglich auch weniger Kalium im Austausch gegen Natrium ausgeschieden wird [3].
Fixkombination aus Bendroflumethiazid und Amilorid bei kardiometabolischen Patienten
Die Fixkombination aus Bendroflumethiazid und Amilorid bietet auch eindeutige Vorteile in der Therapie der Patienten mit kardiometabolischen Risikofaktoren, die durch das metabolische Syndrom mit Übergewicht/Adipositas, einem erhöhten Taillenumfang, arterieller Hypertonie, Typ2Diabetes mellitus und Hyperlipidämie/ Dyslipoproteinämie charakterisiert sind. Bei der Verwendung der Fixkombination sind eine erhöhte Körperwasserausscheidung und die damit einhergehende wirksame Senkung des Blutdrucks mit einer neutralen Kalium- und Magnesiumbilanz verbunden. Diese dual wirkende Kombination reduziert somit das bei der ThiazidMonotherapie auftretende Risiko der Hyperurikämie sowie von Elektrolytstörungen wie der Hypokaliämie oder Hyponatriämie (vgl. Abb. 4).
Die aktuelle HypertonieLeitlinie der ESH [3] geht speziell auf dieses Therapieproblem bei Adipositas ein und weist darauf hin, dass bei dieser Patientengruppe Thiazide und Thiazid-Analoga ein Nebenwirkungsprofil haben, das weniger vorteilhaft ist als das der RAAS-Blocker. In Abhängigkeit von der ThiazidDosis kann sich die Insulinresistenz erhöhen und damit auch zur Auslösung bzw. einer Verschlechterung des Typ2-Diabetes mellitus beitragen. Dieser Aspekt ist besonders bei Übergewichtigen/Adipösen zu beachten. Neben den Thiaziden und Thiazid-Analoga werden darüber hinaus für diese Patienten auch die Beta-Rezeptorenblocker mit ihren vergleichbaren ungünstigen me
tabolischen Wirkungen besonders auf den Glukosestoffwechsel in der Therapie der arteriellen Hypertonie erwähnt. Es wird aber angemerkt, dass eine Kombination mit diesen Substanzen jedoch häufig zur optimalen Blutdruckkontrolle notwendig ist und deshalb empfohlen wird [3].
Die durch die Anwendung der Thiazide ausgelösten metabolischen Vorgänge sind noch nicht völlig aufgeklärt und bedürfen deshalb weiterer Untersuchungen [17]. Diskutiert wird in diesem Zusammenhang auch ursächlich das vergesellschaftete metabolische Syndrom [18, 19] sowie die resultierende Hypokaliämie [20] und der damit verbundene niedrige Insulinspiegel [21]. Es kann davon ausgegangen werden, dass dem Kalium bei diesen metabolischen Effekten eine wichtige Rolle zukommt. Diese metabolisch ungünstigen Wirkungen können durch eine Kombination mit einem kaliumsparenden Diuretikum oder einem RAAS-Blocker reduziert werden. In unserer Untersuchung traten unter Anwendung der Fixkombination aus Bendroflumethiazid und Amilorid keine Veränderungen des Serum-Kaliums, der Blutfette, der Leberenzyme sowie der Harnsäure auf. Bei Patienten mit Diabetes mellitus reduzierte sich die NüchternGlukose und der HbA1c innerhalb des 6-monatigen Beobachtungszeitraums (vgl. Abb. 4). Diese Beobachtung sollte jedoch in einer randomisierten, kontrollierten Studie mit einem größeren Patientenkollektiv eingehend untersucht werden.
Sturzneigung
Ein weiteres Problem besonders bei älteren Patienten ist die Sturz
neigung, die sowohl durch eine diuretische Therapie als auch andere Erkrankungen und damit verbundene Medikationen verursacht sein kann. Die hier untersuchte Fixkombination hat in der Regel ein geringes Risiko für eine orthostatische Hypotonie im Vergleich zu einigen anderen Blutdrucksenkern, da sie unter der empfohlenen Dosierung (Bendroflumethiazid 2,5 mg/Amilorid 5,0 mg) nicht zur Hypovolämie und Hypotonie führt. Dies kann auf mehrere Faktoren zurückzuführen sein. Unabhängig davon ist aber besonders bei älteren Patienten auf eine ausreichende tägliche Trinkmenge zu achten. In der vorliegenden Untersuchung wurden keine Stürze als unerwünschtes Ereignis berichtet.
Limitationen der Studie
Die NIS war fokussiert auf eine regelhaft beobachtbare Senkung des Blutdrucks und deren typisches Ausmaß unter der Fixkombination in der täglichen Praxis. Einschränkungen der Studie entsprechen solchen, die mit Beobachtungsstudien einhergehen, einschließlich des Fehlens einer Kontrollgruppe, fehlender Daten für einige Beurteilungen und des Potenzials einer ungenügenden Untersuchung von möglicherweise beeinflussenden Faktoren. Die Kernaussage bezüglich der Reduktion des Blutdrucks wird durch diesen Sachverhalt jedoch nicht geschmälert und zeugt von der Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse und der Anwendbarkeit der Therapie im komplexen Setting der üblichen klinischen Praxis [5]. Eine differenzierte Untersuchung zu den metabolischen Auswirkungen war nicht Ziel dieser Untersuchung. Dennoch zeigten die Ergebnisse an einer kleinen Pati
entenzahl mit kardiometabolischen Risikofaktoren, dass keine negativen Stoffwechselfolgen besonders bei Übergewichtigen/Adipösen, Diabetikern und Patienten mit Hyperlipidämie/Dyslipoproteinämie auftraten. Eine tiefergehende Analyse dieser metabolischen Beeinflussungen bleibt weiteren Untersuchungen unter kontrollierten Bedingungen in einem größeren Patientenkollektiv vorbehalten.
Schlussfolgerungen
Die Fixkombination aus Bendroflumethiazid und Amilorid allein oder als Zusatztherapie ist eine regelhaft als wirksam wahrnehmbare Option zum Erreichen des Blutdruckzielwertes bei Behandlung der arteriellen Hypertonie, auch für kardiometabolische Patienten. Sie bietet Vorteile in Bezug auf die Blutdrucksenkung bei Minimierung der Elektrolytstörungen, die üblicherweise bei der Behandlung mit verschiedenen Diuretika auftreten. Das untersuchte Medikament erreichte eine sehr hohe Akzeptanz bei den behandelnden Ärzten hinsichtlich Verträglichkeit und Wirksamkeit und wurde auch von den Patienten als sehr gut/gut verträglich bewertet. Es ist für die Therapieakzeptanz darüber hinaus entscheidend, die individuellen Bedürfnisse und Risiken des Patienten zu berücksichtigen, um so eine optimale Blutdruckkontrolle besonders bei kardiometabolischen Patienten zu erreichen. Unerwünschte Ereignisse waren selten, keines schwerwiegend. Es wurde kein neues sicherheitsrelevantes Signal detektiert.
Interessenkonflikt
E.P. und G.SP. haben keinen Interessenkonflikt in Bezug auf die Erstellung dieses Artikels. P.E, M.L., I.B-S. sind Mitarbeiter von Hennig Arzneimittel. Die teilnehmenden Ärzte wurden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und des ärztlichen Standesrechtes für die Dokumentation der Patientendaten auf den Fallberichtsformularen entschädigt.
Danksagung
Das Autorenteam möchte sich an dieser Stelle für die sorgfältige und zuverlässige Mitarbeit der beteiligten Praxen und Patienten bedanken.
Literatur
1 Williams B, Mancia G, Spiering W et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). Eur Heart J 2018;39:3021-3104. DOI: 10. 1093/eurheartj/ehy339
2 World Health Organisation (WHO). Global report on hypertension: the race against a silent killer. www.who.int/publications/i/item/9789240081062; Stand: 19.09.2023. ISBN 978-92-4-008106-2 (electronic version); ISBN 978-92-4008105-5 (print version)
3 Mancia G, Kreutz R, Brunström M et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension. Endorsed by the International Society of Hypertension (ISH) and
the European Renal Association (ERA). J Hypertens 2023;41:1874-2071. DOI: 10.1097/HJH.0000000000003480
4 Röhrig B, du Prel JB, Wachtlin D et al. Types of study in medical research: part 3 of a series on evaluation of scientific publications. Dtsch Arztebl Int 2009;106: 262-268. DOI: 10.3238/arztebl.2009. 0262
5 Fletcher GS. Clinical epidemiology: the essentials. Sixth edition. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2021
6 Fachinformation Tensoflux®, aktueller Stand
7 Hulley SB, Furberg CD, Gurland B et al. Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP): antihypertensive efficacy of chlorthalidone. Am J Cardiol 1985; 56:913920. DOI: 10.1016/00029149 (85)90404-7
8 ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group. Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic. The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). JAMA 2002;288:2981-2997. DOI: 10.1001/jama.288.23.2981
9 Dahlöf B, Sever PS, Poulter NR et al for the ASCOT Investigators. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regime of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial – Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomized controlled trial. Lancet 2005;366:895-906. DOI: 10.1016/S01406736(05)67185-1
10 Ferguson LD, McKay G, Fisher M. Bendroflumethiazide. Practical Diabetes 2013;30:340341a
11 Wiggam MI, Bell PM, Sheridan B et al. Low dose bendrofluazide (1.25 mg) effectively lowers blood pressure over 24 h: results of a randomized, doubleblind, placebocontrolled crossover study. Am J Hypertens 1999;12:528-531. DOI: 0.1016/s0895-7061(98)00268-4
12 Harper R, Ennis CN, Sheridan B et al. Effects of low dose versus conventional dose thiazide diuretic on insulin action in essential hypertension. Br Med J 1994;309:226230. DOI: 10.1136/bmj. 309.6949.226
13 Multicenter Diuretic Cooperative Study Group. Multiclinic comparison of amiloride, hydrochlorothiazide, and hydrochlorothiazide plus amiloride in essential hypertension. Arch Intern Med 1981;

141:482-486. DOI: 10.1001/archinte. 1981.00340040078021
14 Brown MJ, Williams B, Morant SV et al. Effect of amiloride, or amiloride plus hydrochlorothiazide, versus hydrochlorothiazide on glucose tolerance and blood pressure (PATHWAY-3): a parallel-group, doubleblind randomized phase 4 trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2016;4:136147. DOI: 10.1016/S2213-8587(15) 003770
15 Thomas JP, Thomson WH. Comparison of thiazides and amiloride in treatment of moderate hypertension. Br Med J (Clin Res Ed) 1983;286:2015-2018. DOI: 10.1136/bmj.286.6383.2015
16 Peterzan MA, Hardy R, Chaturvedi N et al. Metaanalysis of doseresponse relationships for hydrochlorothiazide, chlorthalidone, and bendroflumethiazide on blood pressure, serum potassium, and urate. Hypertension 2012;59:11041109. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA. 111.190637
17 Carter BL, Einhorn PT, Brands M et al. Thiazide-induced dysglycemia: call for research from a working group from the national heart, lung, and blood institute. Hypertension 2008;52:30-36. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.108. 114389
18 Bakris G, Molitch M, Hewkin A et al. Differences in glucose tolerance between fixed-dose antihypertensive drug combinations in people with metabolic syndrome. Diabetes Care 2006;29:25922597. DOI: 0.2337/dc061373
19 Wright JT Jr, Harris-Haywood S, Pressel S et al. Clinical outcomes by race in hypertensive patients with and without metabolic syndrome: Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). Arch Intern Med 2008;168:207-217. DOI: 10.1001/archinternmed.2007.66
20 McKenney JM, Goodman RP, Wright JT Jr et al. The effect of lowdose hydrochlorothiazide on blood pressure, serum

potassium, and lipoproteins. Pharmacotherapy 1986;6:179-184. DOI: 10.1002/ j.1875-9114.1986.tb03473.x
21 Rowe JW, Robin JD, Rosa RM et al. Effect of experimental potassium deficiency on glucose and insulin metabolism. Metabolism 1980;29:498-502. DOI: 10. 1016/0026-0495(80)90074-8
Für die Verfasser: Marcus Lutz
Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG Liebigstraße 1–2
65439 Flörsheim am Main
E-Mail: marcus.lutz@hennig-am.de
Rund 85 % aller schwangeren Frauen leiden an Übelkeit und Erbrechen [1] und bis zu 95 % haben weit über den Morgen hinaus Beschwerden [2]. Die Symptome können bereits 4 – 6 Wochen nach der letzten Periode beginnen [3, 4, 5]. Der Höhepunkt der Beschwerden ist in der Regel nach etwa 10 Wochen erreicht. Ab der 14.–16. Woche lassen die Symptome in der Regel merklich nach [5]. Bei 10 % der Schwangeren bleiben Übelkeit und Erbrechen allerdings während der gesamten Gravidität bestehen [4, 5]. Trotz der Häufigkeit der Erkrankung und der starken Beeinträchtigung des Alltags und der Leistungsfähigkeit der Betroffenen wird die Emesis gravidarum oft nicht ernst genommen, sondern eher als Belästigung gesehen. Dem entgegen steht, dass eine anhaltende Übelkeit und häufiges Erbrechen in der Schwangerschaft sowohl die Schwangere als auch das Ungeborene gefährden können und daher eine Hyperemesis gravidarum mit ihren Folgen möglichst frühzeitig verhindert werden sollte. In Deutschland ist eine Kombination von Doxylamin und Pyridoxin die medikamentöse Therapie der Wahl. Cariban® enthält beide Wirkstoffe in einer Retardformulierung, die eine effektive, flexible und bedarfsangepasste Dosierung ermöglicht. Mit mehr als 23 Millionen in Deutschland verordneten Kapseln ist Cariban® weiterhin Marktführer.
Ursachenforschung: GDF15 bestimmt die Ausprägung der Symptomatik
Neben physiologischen und psychologischen Faktoren scheint der Growth Differentiation Factor 15 (GDF15) eine Rolle bei Emesis
Wirkstoffkombination von Cariban® ist Mittel der Wahl bei Emesis gravidarum
gravidarum zu spielen. Das hormonähnliche Protein ist einer aktuellen Studie [6] zufolge höchstwahrscheinlich neben anderen Faktoren der Grund, warum viele Schwangere unter Übelkeit und Erbrechen leiden. Darüber hinaus hängen die Schwere der Übelkeit und das Risiko einer Hyperemesis gravidarum davon ab, wie hoch die vom Embryo produzierte GDF15Konzentration im mütterlichen Blut ist und wie empfindlich die Schwangere darauf reagiert, was durch ihre vorherige Hormonexposition bestimmt wird. Auch im nicht schwangeren Zustand wird GDF15 vom Körper in geringen Mengen produziert. Heute weiß man, dass je höher der GDF15Spiegel vor der Schwangerschaft ist, desto geringer ist die Emesis gravidarum ausgeprägt [6]. Frauen mit chronisch erhöhten GDF15Konzentrationen vor der Schwangerschaft, z.B. bei Beta-Thalassämie, leiden selten an Übelkeit und Erbrechen in der Schwangerschaft. Jedoch lassen sich aus diesen Erkenntnissen noch keine innovativen Therapien wie die medikamentöse Blockade der GDF15Rezeptoren ableiten.
Cariban®: Erste In-Label-Therapie für die Indikation Emesis gravidarum
Auch ohne GDF15-Blockade und bislang fehlender deutscher Leitli
nie ist eine effektive Therapie der Emesis gravidarum möglich. So empfiehlt das Pharmakovigilanzund Beratungszentrum für Embryonaltoxikologie der Charité Berlin Doxylamin in Kombination mit Pyridoxin als Mittel der Wahl [7]. Doxylamin reduziert die Stimulation des Brechzentrums im Hirnstamm [8], Pyridoxin (Vitamin B6) ist vermutlich an der Regulation des übelkeitsauslösenden Hormonungleichgewichts beteiligt [9].
Cariban® ist in Deutschland als Kombinationspräparat auf dem Markt und enthält beide Wirkstoffe: 10 mg Doxylaminsuccinat und 10 mg Pyridoxinhydrochlorid pro Hartkapsel (Größe 3). Das Präparat ist seit 2019 das erste Arzneimittel in Deutschland, das explizit für die Indikation Emesis gravidarum zugelassen wurde und erstattungsfähig ist [10].
Cariban®Hartkapseln enthalten 2 Arten von Pellets mit veränderter Freisetzung für jeden Wirkstoff. Die spezielle Galenik der Retardformulierung ermöglicht eine verzögerte und verlängerte Freisetzung der Wirkstoffe, indem diese schnell absorbiert und bis zu einem nachhaltigen Wirkstoffplateau verlängert freigesetzt werden, wobei der Wirkstoffspiegel initial und lang anhaltend ansteigt. Dies erfolgt aufgrund der Formulierung als Pellets und ist mit der freien Verteilung im Magen-Darm-Trakt, einer verkürzten Magenpassage und einer kontrollierten Wirkstoff
freisetzung erklärbar. Vorteile sind geringere Spitzenplasmaschwankungen sowie ein geringeres Dosis-Dumping [11]. Hierdurch resultiert eine optimierte Arzneimittelabsorption und potenzielle Nebenwirkungen können minimiert werden [11].
Retardformulierung und 1-1-2-Dosierung ermöglichen flexible und bedarfsorientierte
Behandlung
Durch die Retardformulierung lässt sich bei abendlicher, morgendlicher oder nachmittäglicher Dosierung der Wirkzeitraum steuern und auf die Symptomatik der Patientin einstellen. Die schnelle Absorption und Freisetzung der Wirkstoffe ist innerhalb der ersten 30 Minuten nachweisbar [11]. Der Cmax wird nach 6 – 7 Stunden erreicht [10]. So zeigt beispielsweise die Einnahme von 2 Kapseln vor dem Schlafengehen auch am Morgen noch volle Wirkung. Zudem ermöglicht eine 1-1-2-Dosierung mit 2 bis maximal 4 Kapseln täglich je nach Häufigkeit und Schwere der Symptome sowohl einen bedarfsorientierten Beginn als auch eine bedarfsgerechte Dosisreduktion bei Besserung der Symptome.
Eine sichere, bewährte und erstattungsfähige Therapieoption
Die Wirksamkeit und Sicherheit der Wirkstoffkombination in Cariban® wurden in klinischen Studi
Die ambulante Cariban®-Therapie –ein Beispiel aus der Praxis
Die Patientin (Alter: 35 Jahre; zweite Schwangerschaft; erste Schwangerschaft ohne Besonderheiten, normale Entbindung, BMI = 24,1; keine Begleiterkrankungen oder relevante Risikofaktoren) wurde in der 6. Schwangerschaftswoche (6+4 SSW) erstmals vorstellig. Zu diesem Zeitpunkt war die morgendliche Übelkeit erträglich und es erfolgte keine Medikation. In der 10+3 SSW berichtete die Patientin von kaum auszuhaltender Übelkeit, ständigem Würgereiz und gelegentlichem morgendlichem Erbrechen. Hausmittel wie Tee, Zwieback und Ingwer zeigten keine Wirkung. Die Therapie mit Cariban® in einer Dosierung von 2 Kapseln am Abend, einer Kapsel am Morgen und Bedarfsmedikation am Nachmittag führte innerhalb kurzer Zeit zu einer deutlichen Besserung der Beschwerden. Der PUQE-Score (PregnancyUnique Quantification of Emesis and Nausea) sank von 9 (SSW 10+3) auf 2 (SSW 12+5). Mit Beginn der SSW 13 nahm die Patientin Cariban® in ausschleichender Dosierung ein. Ab der SSW 15+4 war sie beschwerdefrei [12].
en mit mehr als 200.000 Teilnehmerinnen bestätigt [10, 13]. Bereits nach 3 Tagen zeigte Doxylamin/ Pyridoxin eine statistisch signifikante Verbesserung der Symptome bei den schwangeren Frauen im Vergleich zu Placebo [12]. Für die Abrechnung und auch für die Plausibilität der Arzneimittelverordnung ist die richtige ärztliche Codierung für die Indikation wichtig. Cariban® ist gemäß §24c SGB V erstattungsfähig und kann auf einem rosa Kassenrezept mit dem ICD-10-Code O21.8 oder O21.9 verordnet werden. Aus wirtschaftlicher Sicht empfiehlt sich die Verordnung der 48er Packung. Im Vergleich zu 2 24er Packungen wird das ärztliche Budget um rund 13 % entlastet.
Elisabeth Wilhelmi, München
Literatur
1 Madjunkova S et al. Pediatr Drugs 2014; 16:199121
2 Gadsby R et al. Br J Gen Pract 1993; 43:325
3 Klebanoff MA et al. Obstet Gynecol 1985;66:612-616
4 Vellacott ID et al. Int J Gynaecol Obstet 1988;27:57-62
5 Lacroix R et al. Am J Obstet Gynecol 2000;182:931-937
6 Fejzo M et al. Nature 2024;625:760767
7 Pharmakovigilanzzentrum Embryonaltoxikologie der Charité Berlin. https:// www.embryotox.de/erkrankungen/details/ansicht/erkrankung/emesis-gravidarum-hyperemesis-gravidarum
8 Nuangchamnong N et al. Int J Women’s Health 2014;6:401409
9 Hassan A et al. J Clin Diag Res 2019; 13:0106
10 Fachinformation Cariban®; Stand: 12/22
11 Saz-Leal P et al. Drugs in R&D 2023; 23:185-195
12 CASE CARD Cariban®, 11. Jahrgang, November 2021, Sonderpublikation in Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Thieme 2021
13 Koren G et al. BMC Pregnancy and Childbirth 2016;16:371375
Das Urothelkarzinom (UC) macht etwa 90 % aller Blasenkrebsfälle aus [1]. Seine Behandlung wird umso schwieriger, je weiter die Erkrankung fortschreitet, da sich der Tumor durch die Schichten der Blasenwand hindurch ausbreitet. In diesen Fällen beträgt die 5-Jahres-Überlebensrate lediglich 8,3 % [2]. Nur etwa ein Drittel der Patienten erhält nach der ErstlinienChemotherapie eine Zweitlinientherapie [3]. Dabei werden neben einer erneuten Chemotherapie mit platinhaltigen Zytostatika oder Vinflunin auch ImmuncheckpointInhibitoren wie Avelumab (Bavenico®) als Erstlinien-Erhaltungstherapie eingesetzt [4]. Auf dem diesjährigen Genitourinary Cancers Symposium der American Society of Clinical Oncology (ASCO GU) präsentierte RealWorldDaten [5] und PosthocAnalysen zur ErstlinienErhaltungstherapie mit Avelumab [6, 7] untermauern dessen Stellenwert bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem bzw. metastasiertem Urothelkarzinom (UC), die nach einer Platinbasierten Chemotherapie (CT) progressionsfrei sind.
Verlängertes medianes Gesamtüberleben von über 40 Monaten
Langzeitdaten der zulassungsrelevanten JAVELIN Bladder 100-Studie hatten ein verlängertes medianes Gesamtüberleben (mOS) ab Start der ErstlinienChemotherapie von 29,7 Monaten unter Avelumab plus bestmögliche Begleitbehandlung (BSC) gegenüber 20,5 Monaten unter alleiniger BSC gezeigt (HR: 0,77; 95%KI: 0,635 – 0,921) [8].
Eine aktualisierte Auswertung der laufenden, ambispektiven (retro
Urothelkarzinom: Erstlinien-Erhaltungstherapie mit Avelumab eröffnet neue
und prospektiven) AVENANCEStudie bestätigt nun nicht nur die Wirksamkeit der Avelumab Erstlinien-Erhaltungstherapie in einer RealWorldPopulation mit fortgeschrittenem UC, sondern gibt auch einen Ausblick auf weitere Behandlungsperspektiven [5]. Eingeschlossen waren 595 Patienten, von denen 55,5 % nach Beendigung der Erstlinien-Erhaltungstherapie (zumeist aufgrund einer Krankheitsprogression) auf eine Zweitlinienbehandlung eingestellt worden waren. Als Folgetherapien kamen vor allem eine Platinbasierte CT (n = 81), andere CT (n = 163) oder Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC, n = 62) zum Einsatz. Dabei zeigte sich ein verlängertes mOS bei den Patienten mit Avelumab und anschließender ADC-Behandlung von bis zu 41 Monaten ab Start der Platinbasierten Chemotherapie in der Erstlinie versus 24,5 Monate unter anschließender platinbasierter CT bzw. 17,9 Monate unter anderer CT [5]. Die Ergebnisse spiegeln sich auch in den 1 und 2JahresOS-Raten wider. Diese lagen unter Avelumab und anschließender ADC-Behandlung bei 96,7 % und 81,1 %, verglichen mit 88,6 % bzw. 51,0 % unter Platinbasierter CT und 78,1 % bzw. 33,5 % unter einer anderen CT, jeweils ab Beginn der Erstlinientherapie [5].
Anhaltende Wirksamkeit auch bei hohem BMI
Schätzungen zufolge wird im Jahr 2035 ein Viertel der Weltbevölkerung einen BMI von ≥30 haben; gleichzeitig gilt Übergewicht als Risikofaktor für die Entstehung von Blasenkrebs [6]. Dass Avelumab auch für die Subgruppe der Patienten mit einem BMI von ≥30 eine wirksame und sichere Behandlungsoption darstellen kann, verdeutlichen die Ergebnisse einer PosthocAnalyse der PhaseIIIStudie JAVELIN Bladder 100 [6]. Diese untersuchte die langfristige Wirksamkeit und Sicherheit der Erstlinien-Erhaltungstherapie mit Avelumab bei Patienten mit fortgeschrittenem UC und einem Baseline-BMI von ≥30, die nach einer Platin-basierten CT progressionsfrei waren. Das mediane OS unter Avelumab plus BSC lag dabei bei 20,8 Monaten, verglichen mit 12,7 Monaten unter alleiniger BSC. Es traten keine neuen Sicherheitssignale auf [6].
PROs auch bei längerer Behandlungsdauer stabil
Patientenberichtete Ergebnisse (PROs) und der Erhalt der Lebensqualität standen im Fokus einer weiteren PosthocAnalyse der
Avelumab
Avelumab (Bavenico®) ist ein humaner Antikörper, der gegen den programmierten Zelltod-Liganden 1 (PD-L1) gerichtet ist. Durch die Blockierung der Interaktion von PD-L1 mit PD-1-Rezeptoren hat
Avelumab in präklinischen Modellen nachweislich die hemmende Wirkung von PD-L1 auf zytotoxische CD8+ T-Zellen aufgehoben, was zur Verstärkung bzw. Wiederherstellung der gegen den Tumor gerichteten T-Zell-Antwort führt [4].
JAVELIN Bladder 100-Studie [7].
Darin wurden PROs zu Symptomen und Lebensqualität mithilfe der Instrumente FBISI-18 (Functional Assessment of Cancer Therapy Bladder Symptom Index-18) und EQ5D5L (EuroQoL 5 Dimensions 5 Levels) erfasst. Die Auswertung umfasste sowohl die Gesamtpopulation als auch diejenigen, die bereits seit ≥12 Monaten die Erstlinien-Erhaltungstherapie erhielten. Rund 3 Viertel der Patienten, die ≥12 Monate behandelt wurden, berichteten von keiner oder einer nur geringen Beeinträchtigung durch Nebenwirkungen. Die PROs blieben auch bei längerer Behandlungsdauer stabil, was auf einen langfristigen Erhalt der Lebensqualität schließen lässt [7].
Mehrheit der Patienten mit metastasiertem UC gilt als Platin-geeignet
Voraussetzungen für den Einsatz der Erstlinien-Erhaltungstherapie mit Avelumab bei lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem
UC sind die Durchführung einer Platinbasierten CT in der Erstlinie und eine anschließende Progressionsfreiheit [4].
Gemäß der Leitlinie soll Patienten mit einem metastasierten UC der Harnblase eine Cisplatin-haltige Chemotherapie angeboten werden, sofern Allgemeinzustand und Komorbiditäten dies zulassen [9]. Für mehr Transparenz bezüglich der Kriterien zur Platin-Eignung könnten die auf dem ASCO GU 2024 vorgestellten Ergebnisse einer Umfrage unter Behandlern aus 5 europäischen Ländern (n = 503) sorgen [10]. Als Altersgrenze, ab der die Befragten ihre Patienten nicht mehr mit einer Platinbasierten CT behandeln würden, wurde am häufigsten (66,8 %) >80 Jahre genannt. In Hinblick auf den ECOGPS (Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status) lag der Konsens bei ≥3 als Grenzwert für die Platin-Eignung. Bei der NYHA-Klassifikation galt dies für Klasse III, bei der KreatininClearance für <25 ml/ min und bei peripheren Neuropathien für Grad ≥3. Die Ergebnisse stehen teilweise in Einklang mit
vorherigen Erhebungen unter USBehandlern. Abweichungen zu den europäischen Befragten gab es darin bei der Altersgrenze (keine empfohlen) sowie bei den Schwellenwerten für die KreatininClearance (<30 ml/min) und für die periphere Neuropathie (Grad ≥2) [10].
Die Autoren der Auswertung kommen zu dem Schluss, dass eine standardisierte und breitere Anwendung der Kriterien Behandlungsunterschiede ausgleichen und die klinischen Outcomes der Patienten verbessern könnte [10].
Brigitte Söllner, Erlangen
Literatur
1 Cancer.net. Bladder cancer: introduction. https://www.cancer.net/cancertypes/bladdercancer/introduction
2 SEER. Cancer stat facts: bladder cancer. https://seer.cancer.gov/statfacts/html/ urinb.html
3 Niegisch G et al. J Cancer 2018; 9:13371348
4 Fachinformation Bavencio®, aktueller Stand
5 Barthélémy P et al. ASCO GU 2024, Poster/Abstract #561
6 Aragon-Ching J et al. ASCO GU 2024, Poster/Abstract #600
7 Grivas P et al. ASCO GU 2024, Poster/ Abstract #581
8 Sridhar SS et al. ASCO GU 2023, Poster/ Abstract 508
9 Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): S3Leitlinie Früherkennung, Diagnose, Therapie und Nachsorge des Harnblasenkarzinoms, Langversion 2.0, 2020, AWMF-Registernummer 032/038OL. https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/leitlinien/harnblasenkarzinom/
10 Gupta S et al. ASCO GU 2024, Poster/ Abstract #696
Die Hidradenitis suppurativa (HS, Synonym: Akne inversa) ist eine seltene, wenig bekannte Hauterkrankung, die durch rezidivierende tiefe Abszesse, Knoten und Fisteln charakterisiert ist [1, 2]. Allerdings beschränkt sich die HS nicht nur auf die Haut, sondern ist eine chronische Systemerkrankung, sodass zusätzlich zu den HStypischen Symptomen verschiedene Begleiterkrankungen auftreten können, wie z.B. Zuckerund Fettstoffwechselstörungen sowie weitere chronischentzündliche Erkrankungen [3, 4].
Hohe Dunkelziffer und meist sehr späte Diagnose
Krankenkassendaten zufolge liegt die Prävalenz der HS in Deutschland zwischen 0,03 % und 0,07 %, damit sind in etwa 25.000 bis 50.000 Patienten von der HS betroffen [3, 5]. Es ist jedoch von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, sodass die Prävalenz schätzungsweise bis zu 1 % betragen kann [6]. Diese hohe Dunkelziffer resultiert vermutlich aus dem allgemein fehlenden Bewusstsein für die Erkrankung sowie aus der Scham der Betroffenen. Das könnte zu seltenen Arztbesuchen führen und damit auch ein Grund für die lange Zeit bis zur Diagnose sein – von den ersten Symptomen der HS bis zur korrekten Diagnose verstreichen in Deutschland durchschnittlich 10 Jahre [7]! Für die Patienten bedeutet eine späte Diagnose aber, dass sie häufiger chirurgische Eingriffe über sich ergehen lassen müssen und unter mehr Begleiterkrankungen leiden [3]. Dazu zählen beispielsweise das metabolische Syndrom oder kardiovaskuläre Erkrankungen [8, 9].
Mythen und Fakten zur chronischen Hauterkrankung Hidradenitis suppurativa
Da die HS oftmals im Genitalbereich auftritt, wird fälschlicherweise häufig angenommen, dass hauptsächlich Gynäkologen oder Urologen die HS diagnostizieren [10]. Dabei handelt es sich jedoch um einen Mythos: HS wird am häufigsten von niedergelassenen Ärzten, vor allem von Dermatologen und auch häufig in Krankenhäusern diagnostiziert [11].
Ganzheitliche Therapie, auch mit systemischen Biologika
Im Anschluss an die Diagnosestellung sollte zügig die ganzheitliche Therapie beginnen. Zurzeit gilt die HS weitläufig als nicht heilbar, aber therapierbar. Zu den medikamentösen Behandlungsoptionen zählen topische und systemische
Secukinumab
Antibiotika, Antiseptika sowie intraläsionale Kortikosteroide und systemisch wirksame Biologika [12, 13].
Die Therapieoptionen für die Betroffenen haben sich im letzten Jahr erweitert: Seit Juni 2023 ist der IL17A Inhibitor Secukinumab (Cosentyx®) zur Behandlung von Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer aktiver HS zugelassen, die auf eine konventionelle systemische HSTherapie unzureichend angesprochen haben [14].
Die Mehrheit der Patienten mit moderater bis schwerer HS benötigt im Verlauf der Erkrankung sowohl systemische Therapien als auch chirurgische Eingriffe [13]. Dass ab einem gewissen Punkt ausschließlich operative Eingriffe helfen, ist nicht richtig. Vielmehr sollten sich je nach Krankheitsbild
Secukinumab (Cosentyx®) ist ein vollhumaner, monoklonaler Antikörper, der direkt gegen IL-17A gerichtet ist. Das Zytokin IL-17A ist an Entzündungsprozessen und der Entstehung von Plaque-Psoriasis (Pso), Psoriasis-Arthritis (PsA) und der axialen Spondyloarthritis (axSpA) beteiligt.
Secukinumab ist ein Wirkstoff, der seit mehr als 14 Jahren klinisch untersucht wird. Der IL-17A-Inhibitor verfügt über eine umfangreiche klinische Evidenz für die 3 Indikationen Pso, PsA und axSpA. Secukinumab ist seit 8 Jahren für mittlerweile 8 Indikationen zugelassen. Dazu zählen die Pso, pädiatrische Pso, Hidradenitis suppurativa (HS), PsA, nicht-röntgenologische axSpA (nr-axSpA), ankylosierende Spondylitis (AS) sowie Enthesitis-assoziierte Arthritis (EAA) und juvenile Psoriasis-Arthritis (JPsA), zwei Unterformen der juvenilen idiopathischen Arthritis (JIA) [14].
die medikamentöse und operative Behandlung ergänzen. Biologika können Entzündungen entgegenwirken und bei starker Vernarbung können sie zur Entzündungskontrolle mit operativen Eingriffen kombiniert werden. Dieses Vorgehen hat sich als vorteilhaft für die Therapie von HS erwiesen [13]. Nicht zu vergessen ist, dass die Patienten aufgrund der Symptome oft auch unter Depressionen oder Ängsten leiden. Für eine erfolgreiche Therapie ist daher ggf. zusätzlich eine psychologische Beratung in Betracht zu ziehen [15, 16].
Brigitte Söllner, Erlangen
Inaqovi® – eine neue Option zur Behandlung Erwachsener mit neu diagnostizierter AML
Literatur
1 Sabat R et al. Nat Rev Dis Primer 2020; 6:18
2 Kirsten N et al. Arch Dermatol Res 2021; 313:9599
3 Pinter A et al. Dermatol Ther (Heidelb). 2020;10:721734
4 Sabat R et al. PLoS ONE 2012;7:e31810
5 Kirsten N et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2020;34:174179
6 Zouboulis C et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2015;29619644
7 Kokolakis G et al. Dermatology 2020; 236:421430
8 Sabat R et al. PLoS ONE 2012;7:e31810
9 Egeberg A et al. JAMA Dermatol 2016; 152:429434
10 Zouboulis C et al. Akt Dermatol 2015;41: 185-199
11 Kirsten N et al. Poster presented at EADV 2023; P0018
12 Nikolakis G et al. Hautarzt 2021;72:676685
13 Bechara FG et al. JAMA Surg 2021; 156:10011009
14 Fachinformation Cosentyx®, aktueller Stand
15 Pinter A et al. Dermatol Ther 2020; 10(4):721734
16 Gill L et al. F1000Prime Rep 2014;6:112
Für die Monotherapie von erwachsenen Patienten, bei denen eine akute myeloische Leukämie (AML) diagnostiziert wurde und die nicht für eine StandardInduktionschemotherapie geeignet sind, steht mit Inaqovi® eine neue Behandlungsoption zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine oral verabreichbare Fixdosiskombination des bereits zugelassenen hypomethylierenden Wirkstoffs Decitabin (35 mg) in Kombination mit Cedazuridin (100 mg), einem Inhibitor der CytidinDesaminase (CDA). Dieses Enzym ist verantwortlich für den Abbau von CytidinNukleosiden, darunter das Cytidin-Analogon Decitabin, das eine zytotoxische Wirkung auf sich schnell teilende Zellen ausübt. Hohe CDA-Spiegel im Gastrointestinaltrakt und der Leber führen zu einem raschen Abbau von Decitabin und schränken dessen orale Bioverfügbarkeit ein. Daher wird Decitabin zusammen mit dem CDAHemmer Cedazuridin verabreicht. Die Fixdosiskombination ist so gestaltet, dass eine tägliche orale Gabe von Decitabin über 5 Tage im jeweiligen Zyklus eine vergleichbare systemische Exposition erzielt wie die i.v. Verabreichung von Decitabin im selben Dosierungsschema.
Orale Gabe statt i.v. oder s.c. Applikation
Inaqovi® ist der erste oral verabreichbare hypomethylierende Wirkstoff, der in der EU für für Er
wachsene mit AML zugelassen ist. Die bisherigen Therapieoptionen umfassten entweder im Krankenhaus verabreichte i.v. ChemotherapieInfusionen oder, wenn die Patienten nicht für eine Chemotherapie geeignet waren, Therapieschemata auf Basis von parenteral applizierten hypomethylierenden Wirkstoffen. Die Behandlungszyklen erstreckten sich dabei in der Regel über 5 – 7 Tage – eine deutliche Belastung vor allem für ältere Patienten.
Die empfohlene Dosis von Inaqovi beträgt 1 Tablette einmal täglich an den Tagen 1 – 5 eines 28-tägigen Behandlungszyklus. Die Behandlung muss mindestens 4 Zyklen lang fortgesetzt werden, bis zur Krankheitsprogression oder dem Auftreten nicht akzeptabler Toxizität.
ASCERTAIN-Studie bestätigt die Expositionsäquivalenz
Die Zulassung von Inaqovi® basiert auf den Ergebnissen der klinischen PhaseIIIStudie ASCERTAIN, die die pharmakokinetische Expositionsäquivalenz der oralen Fixdosiskombination bei AML-Patienten mit der von i.v. Decitabin verglich. Für die Studie wurden insgesamt 89 AML-Patienten 1 : 1 auf 2 Studienarme randomisiert. Im Cross-over-Design erhielten sie entweder Inaqovi® (35 mg Decitabin und 100 mg Cedazuridin) in Zyklus 1 und i.v. Decitabin (20 mg/ m2) in Zyklus 2 (n = 44) oder die Medikation in umgekehrter Abfolge (n = 45). Sowohl Inaqovi® als auch i.v. Decitabin wurden an den Tagen 1 – 5 des 28-tägigen Zyklus jeweils einmal täglich verabreicht. Beginnend mit Zyklus 3 erhielten alle Patienten bis zur Krankheitsprogression, dem Tod oder einer inakzeptablen Toxizität an den
Tagen 1 – 5 jedes 28-tägigen Zyklus orales Inaqovi® einmal täglich. Die Studie erreichte ihren primären Endpunkt: Für die oral verabreichte Decitabin und Cedazuridin-Fixdosiskombination konnte eine pharmakokinetische Expositionsäquivalenz mit dem 5-tägigen Standardschema mit i.v. Decitabin nachgewiesen werden. Verglichen mit i.v. Decitabin (20 mg/m2) erreichten die Patienten unter Inaqovi® eine pharmakokinetische Expositionsäquivalenz von 99,64 %. Bei 21,8 % der mit Inaqovi® behandelten Patienten kam es zur vollständigen Remission. Das mediane Gesamtüberleben betrug 7,9 Monate. Die Sicherheitsergebnisse für die orale die Fixdosiskombination aus Decitabin und Cedazuridin waren mit denen für i.v.Decitabin konsistent.
B. S.
Talazoparib in Kombination mit Enzalutamid für die Therapie des mCRPC zugelassen
Das metastasierte kastrationsresistente Prostatakarzinom (mCRPC) ist die aggressivste und am weitesten fortgeschrittene Form des Prostatakarzinoms. Es hat eine ungünstige Prognose und ist nicht heilbar. Deshalb besteht für die davon betroffenen Patienten ein dringender medizinischer Bedarf für neue Behandlungsoptionen, die das Fortschreiten der Erkrankung verzögern können.
Am 15. Januar 2024 hat die Europäische Kommission den oralen Poly ADP Ribose Polymerase (PARP)Inhibitor Talazoparib (Talzenna®) in Kombination mit Enzalutamid zur Behandlung von erwachsenen mCRPCPatienten
Talazoparib
Talazoparib (Talzenna®) ist ein oral zu verabreichender Hemmstoff der Poly-ADP-Ribose-Polymerase (PARP), die eine Rolle bei der Reparatur von DNA-Schäden spielt. Präklinische Studien zeigten, dass Talazoparib die Aktivität des PARP-Enzyms blockiert und PARP am Ort der DNA-Schädigung abfängt, was zu einem verringerten Wachstum der Krebszellen und deren Absterben führt.
In Deutschland ist Talazoparib seit Juni 2019 zur Monotherapie von Patienten mit BRCA1/2-Mutationen in der Keimbahn zugelassen, die ein HER2-negatives, lokal fortgeschrittenes oder metastasiertes Mammakarzinom aufweisen. Mit der Zulassungserweiterung ist Talazoparib auch in Kombination mit Enzalutamid zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit mCRPC zugelassen, bei denen eine Chemotherapie klinisch nicht indiziert ist.
zugelassen, bei denen eine Chemotherapie klinisch nicht indiziert ist. Damit ist Talazoparib der erste und einzige PARP-Inhibitor, der in Kombination mit Enzalutamid – einer der Standardtherapien des mCRPC – in der EU zugelassen ist. Die Indikation gilt für alle Patienten, unabhängig vom Status des homologous recombination repair (HRR)DNAReparatursystems –mit oder ohne Genmutationen.
TALAPRO-2 zeigt eine überzeugende Wirksamkeit
Die Zulassung beruht auf den Ergebnissen der randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten PhaseIIIStudie TALAPRO2, die 2 Patientenkohorten umfasste: Kohorte 1, in die alle Patienten unabhängig von ihrem HRR-Mutationsstatus eingeschlossen waren (n = 805), und Kohorte 2, in der Patienten mit HRRMutationen (HRRm) aufgenommen wurden (n = 399). Patienten, die eine Androgendeprivationstherapie bekamen oder sich im Verlauf der Studie einer bilateralen Orchiektomie unterzogen, wurden randomisiert und erhielten entweder Talazoparib 0,5 mg/Tag plus Enzalutamid 160 mg/Tag oder Placebo plus
Enzalutamid 160 mg/Tag. Primärer Studienendpunkt war die Verbesserung des radiologischen progressionsfreien Überlebens (rPFS).
Die Ergebnisse der Kohorte 1wurden bereits in The Lancet veröffentlicht. Demnach verringerte die Kombinationstherapie mit Talazoparib plus Enzalutamid das Risiko für eine Krankheitsprogression oder den Tod um 37 % gegenüber Placebo plus Enzalutamid (HR: 0,63, 95%-KI: 0,51 – 0,78; p < 0,0001). Damit war der primäre Studienendpunkt erreicht. Das mediane rPFS des Behandlungsarms (definiert als der Zeitpunkt, zu dem 50 % der Patienten in jedem Therapiearm eine Progression entwickeln) wurde zum Zeitpunkt der Analyse nicht erreicht, gegenüber 21,9 Monaten für Placebo plus Enzalutamid. Ein Trend wurde auch hinsichtlich des Gesamtüberlebens, einem wichtigen sekundären Endpunkt, zugunsten von Talazoparib plus Enzalutamid beobachtet; allerdings sind diese Daten noch nicht abschließend zu bewerten.
Das Sicherheitsprofil von Talazoparib plus Enzalutamid entsprach dem bekannten Sicherheitsprofil der beiden Wirkstoffe.
E. W.
Die Mpox (monkey pox, Affenpocken) sind 2022 erstmals weltweit aufgetreten [1]. Am 23. Juli 2022 erklärte die WHO den Ausbruch zum Gesundheitsnotstand von internationaler Tragweite, hob diese Anordnung am 11. Mai 2023 aber wieder auf. Ein erneuter weltweiter Ausbruch – verursacht durch weitere Virusvarianten – wird jedoch nicht ausgeschlossen [2]. Über den aktuellen Stand informierte PD Dr. Christoph Boesecke vom Universitätsklinikum Bonn im Rahmen des Redaktionsgesprächs „MPOX: Gekommen, um zu bleiben“.
Gefahren durch neue Virusvarianten
Das Mpox-Virus weist 2 genetische Kladen (I und II) auf. Die Virusvariante Klade IIb ist verantwortlich für das weltweite MpoxGeschehen seit Mai 2022. Infektionen der Klade I gab es bislang ausschließlich in Zentralafrika, darunter auch in der Demokratischen Republik Kongo [1]. Im Herbst 2023 wurde im Kongo erstmals die Übertragung der vermutlich besonders krankmachenden Virusvariante Klade I im Rahmen sexueller Aktivitäten beschrieben [3]. Bisher ist dieser Transmissionsweg nur bei der Virusvariante Klade II aufgetreten. Eine Verbreitung durch Reisende in alle Welt ist nun auch bei Klade I wahrscheinlicher geworden.
Hauptübertragungsweg:
Enger Körperkontakt einschließlich Sex
Infektionen mit dem Mpox-Virus erfolgen hauptsächlich durch direkten Kontakt mit infektiösen
Mpox: Impfstoff Imvanex™ schützt vor Infektion und schwerem Krankheitsverlauf

Abbildung 1: Bei Mpox sind z.B. Hände, Brust, Genital- und Analbereich betroffen (Bildnachweis: Halfpoint).
Wunden, Schorf und Körperflüssigkeiten oder mit kontaminiertem Material wie Kleidung, Bettwäsche, Handtüchern oder Sexspielzeug. Bei sexuellen Kontakten ist die Übertragungswahrscheinlichkeit deutlich erhöht. Mit 66 % aller Fälle waren Sexualkontakte im Ausbruch 2022 der Hauptübertragungsweg [4]. Männer, die Sex mit Männern haben und dabei häufig die Partner wechseln, haben das höchste Expositionsrisiko [5].
Schwere Krankheitsverläufe bei schlechtem Immunstatus
In der Regel haben Erkrankungen mit der Klade IIb einen milden Verlauf und heilen innerhalb weniger Wochen von selbst wieder ab. Symptome treten meist 4 – 21 Tage nach Kontakt mit einer infizierten Person auf. Zu den häufigsten allgemeinen Beschwerden gehören Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen, geschwollene
Lymphknoten, Frösteln und starke körperliche Schwäche. Darüber hinaus kann es zu schmerzhaften Hautveränderungen kommen, die als Pickel, Blasen, Ausschlag oder Wunden sichtbar werden. Diese Läsionen treten am häufigsten im Bereich der Infektionspforte, beispielsweise im Anogenitalbereich, an Extremitäten (inkl. Handinnenflächen und Fußsohlen, Abb. 1), im Brust- und Gesichtsbereich auf. Auch eine Ausbreitung über die gesamte Hautoberfläche ist möglich. Todesfälle oder schwere Krankheitsverläufe sind eher selten und betreffen vor allem immungeschwächten Personen (z.B. durch HIV, Chemotherapie). Sie können mit Komplikationen wie bakteriellen Sekundärinfektionen, Entzündung der Lunge und des angrenzenden Bindegewebes, Blutvergiftung, Gehirn- und Hornhautentzündung einhergehen. Ein anorektaler Befall führt nicht selten zu einer Enddarmentzündung und Durchfall, der Befall der Bin
Imvanex™
Imvanex™ ist seit Juli 2022 für die aktive Immunisierung von Erwachsenen gegen Pocken, Mpox und durch das Vaccinia-Virus verursachte Erkrankungen zugelassen [8]. Die Grundimmunisierung besteht aus 2 Impfdosen, wobei die zweite Dosis frühestens 28 Tage nach der ersten Impfung verabreicht werden sollte [7]. Der subkutan zu verabreichende Lebendimpfstoff enthält keine im Menschen replikationsfähigen Viren, sodass der Einsatz auch bei immunsupprimierten Personen möglich ist [5]. Grundsätzlich ist Imvanex™ für alle Arztpraxen verfügbar. Gesetzliche Krankenkassen erstatten die Kosten.
dehaut zu relevanten Komplikationen inklusive Sehverlust [6].
STIKO empfiehlt Impfung mit Imvanex™
Zum Schutz vor Mpox empfiehlt die Ständige Impfkommission die Impfung mit dem einzigen in der EU zugelassenen Impfstoff Imvanex™ für Personen mit erhöhtem Expositions- und Infektionsrisiko [7]. Dazu zählen Männer ab 18 Jahre, die Sex mit Männern haben und dabei häufig die Partner wechseln. Auch eine Impfung, die zeitnah nach einer potenziellen Infektion erfolgt, kann noch wirksam sein. Hierzu gibt es seitens des Herstellers keine Angaben, aber eine entsprechende Empfehlung der STIKO: Diese sog. postexpositionelle Impfung wird symptomfreien, erwachsenen Menschen empfohlen, die enge körperliche Kontakte mit Infizierten über nicht intakte Haut oder Schleimhäute hatten, z.B. sexuelle Kontakte und enge zwischenmenschliche Kontakte im Haushalt oder Familienkreis [7]. Für die Grundimmunisierung ist eine zweite Impfdosis im Abstand von mindestens 28 Tagen erforderlich. Wer in der Vergangenheit bereits gegen Pocken geimpft wurde, benötigt nur eine Impfdosis [8].
Studien bestätigen hohe Wirksamkeit und positives Sicherheitsprofil
Etwa 2 Wochen nach der ersten Impfdosis ist das Risiko für eine Erkrankung deutlich reduziert. Eine retrospektive Kohortenstudie zeigte nach einer ersten Dosis Imvanex™ eine geschätzte Impfstoffwirksamkeit von 86 % (95%KI: 59–95) [9]. Die US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) berichteten, dass die Mpox-Inzidenz bei ungeimpften Personen 9,6 und 7,4 Mal höher war als bei denjenigen, die mindestens 14 Tage zuvor 2 Dosen bzw. eine Dosis Imvanex™ erhalten hatten [10].
In der randomisierten offenen Nichtunterlegenheitsstudie POXMVA006 bei Pockenimpfstoffnaiven, gesunden Probanden im Alter von 18 – 42 Jahren wurde Imvanex™ mit ACAM2000, einem aus Zellkultur gewonnenen und in den USA zugelassenen attenuierten LebendPockenimpfstoff der zweiten Generation, verglichen. Die Studie ergab, dass der neutralisierende Antikörperspiegel nach der Impfung mit Imvanex™ mindestens so hoch war wie nach einer konventionellen Pockenimpfung [11].
Neben der signifikanten Wirksamkeit weist Imvanex™ auch ein po
sitives Sicherheitsprofil auf. Dieses wurde in 22 klinischen Studien untersucht und in allen Populationen, einschließlich HIV-infizierter Personen und Patienten mit atopischer Dermatitis, positiv beurteilt [12]. Zu den häufigsten Impfreaktionen (bei >10 % der Geimpften) zählen Kopfschmerzen, Übelkeit, Myalgie und Müdigkeit sowie an der Injektionsstelle auftretende Schmerzen, Erythem, Schwellungen, Induration und Pruritus [7]. Fabian Sandner, Nürnberg
Literatur
1 Gessain A et al. Monkeypox. N Engl J Med 2022;387:1783-1793
2 WHO. Disease Outbreak News. Mpox (monkeypox) - Democratic Republic of the Congo. 23 November 2023. https:// www.who.int/emergencies/disease-outbreaknews/item/2023DON493
3 RKI. Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Mpox (früher: Affenpocken). https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Affenpocken/affenpocken_gesamt.html
4 Brosius I et al. Pre- and asymptomatic viral shedding in high-risk contacts of monkeypox cases: a prospective cohort study. medRxiv 2022:2022.11.23.22282505
5 Mitjà O et al. Monkeypox. Lancet 2023; 401:6074
6 RKI. Mpox/Affenpocken. https://www. rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Mpox_Affenpocken. html#doc16750264bodyText7
7 RKI. Schutzimpfung gegen Mpox/Affenpocken: Häufig gestellte Fragen und Antworten. https://www.rki.de/SharedDocs/ FAQ/Impfen/Affenpocken/FAQ Liste_ Affenpocken_Impfung.html?nn=2375548
8 EMA. Imvanex – smallpox and monkeypox vaccine, https://www.ema.europa.eu/ en/medicines/human/EPAR/imvanex
9 Wolff Sagy Y et al. Real-world effectiveness of a single dose of mpox vaccine in males. Nat Med 2023;29:748-752
10 Payne AB et al. Reduced risk for Mpox after receipt of 1 or 2 doses of JYNNEOS Vaccine compared with risk among unvaccinated persons. 43 U.S. Jurisdictions, July 31 – October 1, 2022. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022;71:15601564
11 Pittman PR. et al. Phase 3 efficacy trial of modified vaccinia ankara as a vaccine against Smallpox. N Engl J Med 2019; 381:1897-1908
12 FDA (2019). Summary basis for regulatory action template. https://www.fda.gov/ media/131802/download
Rozanolixizumab für die Therapie der generalisierten Myasthenia gravis zugelassen
Die generalisierte Myasthenia gravis (gMG) ist eine seltene Autoimmunerkrankung mit einer weltweiten Prävalenz von 100 – 350 Fällen pro 1 Million Menschen [1]. Patienten mit gMG können unter einer Vielzahl von Symptomen leiden, insbesondere an einer schweren Muskelschwäche, die zu Doppeltsehen, hängenden Augenlidern, Schwierigkeiten beim Schlucken, Kauen und Sprechen sowie zu einer lebensbedrohlichen Schwäche der Atemmuskeln führen kann [2].
Ursache der Erkrankung sind pathogene Autoantikörper, welche die neuromuskuläre Übertragung beeinträchtigen, indem sie sich gegen bestimmte Proteine auf der postsynaptischen Membran richten und diese zerstören. Am häufigsten betroffen sind die nikotinergen Acetylcholinrezeptoren und die muskelspezifische Tyrosinkinase [3]. Folge ist eine Muskelschwäche, die typischerweise bei körperlicher Belastung weiter zunimmt und sich in Ruhe wieder bessert [4].
Klinisch relevante Verbesserungen dieser Muskelschwäche kann ein neuer monoklonaler IgG4P-Antikörper bringen: Am 5. Januar 2024 hat die Europäische Kommission Rozanolixizumab (Rystiggor®) als Zusatzbehandlung zur Standardtherapie der generalisierten Myasthenia gravis bei erwachsenen Patienten zugelassen, die AntiAcetylcholinrezeptor (AChR)
oder Anti-Muskelspezifische Tyrosinkinase (MuSK)-Antikörper positiv sind [5].
Verringerung der Konzentration pathogener IgG-Autoantikörper
Rozanolixizumab 140 mg/ml Injektionslösung ist ein subkutan zu verabreichender, humanisierter monoklonaler Antikörper, der spezifisch an den menschlichen neonatalen FcRezeptor (FcRn) bindet. Er wurde entwickelt, um die Interaktion von FcRn und Immunglobulin G (IgG) zu blockieren und damit das zirkulierende IgG zu verringern, den Abbau von Antikörpern zu beschleunigen und die Konzentration der AChR und MuSK-Autoantikörper im Blut zu reduzieren [6].
Klinisch bedeutsame Verbesserungen
Die Zulassung von Rozanolixizumab stützt sich auf die Verträglichkeits und Wirksamkeitsdaten aus der randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten PhaseIIIStudie MycarinG bei erwachsenen Patienten mit gMG [6]. Die Studienteilnehmer erhielten 6 Wochen lang einmal pro Woche eine subkutane Infusion von entweder Rozanolixizumab 7 mg/kg (n = 66), Rozanolixizumab 10 mg/ kg (n = 67) oder Placebo (n = 67).
Primärer Wirksamkeitsendpunkt war die Veränderung des Myasthenia GravisActivities of Daily Living (MG-ADL)-Scores an Tag 43 in den beiden Verumgruppen mit 7 mg/kg bzw. ca. 10 mg/kg Rozanolixizumab gegenüber der Placebobehandlung. Weitere Endpunkte waren die Veränderungen im Myasthenia Gravis Composite (MGC) und im Quantitative Myasthenia Gravis (QMC) Score, in den von den Patienten berichteten Ergebnissen am Tag 43 sowie unerwünschte Ereignisse.
Ergebnisse für den Myasthenia Gravis-Activities of Daily Living Score
Beim MG-ADL-Score handelt es sich um eine 8 Punkte umfassenden Skala, die zur Bewertung der MGSymptome und ihrer Auswirkungen auf die alltäglichen Funktionen in 8 Bereichen verwendet wird, die bei gMG typischerweise beeinträchtigt sind. Dazu gehören Aktivitäten wie Atmen, Sprechen, Schlucken und die Fähigkeit, von einem Stuhl aufzustehen. Jedes Element wird auf einer 4PunkteSkala bewertet, wobei ein Wert von 0 für eine normale Funktion und ein Wert von 3 für den Verlust der Fähigkeit zur Ausführung dieser Funktion steht. Die Gesamtpunktzahl reicht von 0 bis 24, wobei höhere Punktzahlen eine stärkere Beeinträchtigung anzeigen.
Die Verringerung des MG-ADLScores vom Ausgangswert bis zum Tag 43 war in der Gruppe mit ca. 7 mg/kg Rozanolixizumab (kleinste quadratische mittlere Veränderung –3,37 [SE 0,49]) und in der Gruppe mit ca. 10 mg/kg (–3,40 [SE 0,49]) deutlicher als unter Placebo (–0,78 [SE 0,49]); für 7 mg/ kg ergab sich eine kleinste quadratische mittlere Differenz von –2,59 (95%CI: –4,09 bis –1,25; p < 0,001) und für 10 mg/kg betrug sie –2,62 (95%-CI: –3,99 bis –1,16; p < 0,001) [5].
Ergebnisse für den Myasthenia Gravis Composite Score
Der MGC ist ein Instrument mit 10 Items, das die Symptome und Anzeichen der MG auf Grundlage der ärztlichen Untersuchung und der Anamnese erfasst. Die Items beziehen sich auf Ptosis, Doppeltsehen, Augenschließen, Sprechen, Kauen, Schlucken, Atmen, Nackenflexion, Schulterabduktion und Hüftflexion. Jedes Item wird auf einer Ordinalskala mit 4 möglichen Kategorien bewertet und gewichtet. Die Gesamtpunktzahl reicht von 0 bis 50, wobei höhere Punktzahlen schwerere Beeinträchtigungen anzeigen.
Bei der Veränderung des MGC-Scores vom Ausgangswert bis zum Tag 43 ergab sich ein statistisch signifikanter Unterschied zugunsten von Rozanolixizumab im Vergleich zu Placebo. Für Rozanolixizumab ca. 7 mg/kg
betrug die kleinste quadratische mittlere Differenz –3,90 (95%CI: –6,63 bis –1,25; p < 0,001) und für Rozanolixizumab ca. 10 mg/kg betrug sie –5,53 (95%-CI: –8,30 bis –2,97; p < 0,001) [5].
Ergebnisse für den Quantitative Myasthenia Gravis Score
Der QMG ist ein kategoriales Einstufungssystem mit 13 Punkten zur Bewertung der Muskelschwäche. Jedes Item wird auf einer 4PunkteSkala bewertet, wobei ein Wert von 0 für keine Schwäche und ein Wert von 3 für schwere Schwäche steht. Die mögliche Gesamtpunktzahl reicht von 0 bis 39, wobei höhere Punktzahlen eine stärkere Beeinträchtigung anzeigen. Auch bei der Veränderung des QMGGesamtscores vom Ausgangswert bis zum Tag 43 wurde ein statistisch signifikanter Unterschied zugunsten von Rozanolixizumab im Vergleich zu Placebo beobachtet. Für Rozanolixizumab ca. 7 mg/kg ergab sich eine kleinste quadratische mittlere Differenz von –3,48 (95%-CI: –5,61 bis –1,58; p < 0,001) und für Rozanolixizumab ca. 10 mg/kg betrug sie –4,76 (95%-CI: –6,82 bis –2,86; p < 0,001) [5].
Ergebnisse zur Sicherheit
Wie in der EU-Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels von Rozanolixizumab angegeben,
waren die am häufigsten gemeldeten Nebenwirkungen Kopfschmerzen (48,4 %), Durchfall (25,0 %) und Fieber (12,5 %) [5].
Die Mehrheit der Patienten, die an der MycarinGStudie teilnahmen, entschied sich für die Teilnahme an der offenen Verlängerung dieser klinischen Studie. Infolgedessen prüft der Hersteller UCB das Potenzial für weitere Verlängerungsstudien zu dieser Behandlung.
Fabian Sandner, Nürnberg
Literatur
1 Punga AR et al. Epidemiology, diagnostics, and biomarkers of autoimmune neuromuscular junction disorders. Lancet Neurol 2022;21:176-188
2 Myasthenia Gravis Foundation of America. https://myasthenia.org/MG-Education/ MGQuickFacts
3 Juel VC et al. Myasthenia gravis. Orphanet J Rare Dis 2007;2:44
4 National Institute of Neurological Disorders and Stroke. 2022. Myasthenia Gravis Fact Sheet. https://www.ninds.nih.gov/ healthinformation/disorders/myastheniagravis?search-term=myasthenia%20gravis%20fact%20sheet
5 Rozanolixizumab EU SmPC https:// www.ema.europa.eu/en
6 Bril V et al. Safety and efficacy of rozanolixizumab in patients with generalised myasthenia gravis: a randomised, doubleblind, placebocontrolled, adaptive Phase 3 study. Lancet Neurol 2023; 22:383-394
Die beiden BRAF/MEK-Inhibitoren Dabrafenib (Finlee®) und Trametinib (Spexotras®) stehen ab sofort als erste und derzeit einzige zugelassene, zielgerichtete Kombinationstherapie für die Behandlung pädiatrischer Gliome mit BRAF-V600E-Mutation zur Verfügung. Indiziert ist die Kombinationstherapie bei Kindern ab 1 Jahr mit einem BRAF-V600Epositiven niedriggradig malignen Gliom (pediatric low-grade glioma, pLGG), die eine systemische Erstlinientherapie benötigen, oder mit einem BRAF-V600E-positiven hochgradig malignen Gliom (pediatric high-grade glioma, pHGG), die vorher mindestens mit einer Strahlen oder Chemotherapie behandelt wurden [1, 2]. Novartis hat für Dabrafenib und Trametinib neue orale Flüssigformulierungen entwickelt, die auch für Kinder ab einem Jahr geeignet sind. Dabrafenib ist in Tablettenform zur Herstellung einer Suspension und Trametinib als Pulver zur Herstellung einer Lösung erhältlich [1, 2].
Zulassungsstudie zeigt bei pLGG bessere Wirksamkeit als Standard-Chemotherapie
In den offenen, randomisierten Arm der zulassungsrelevanten
Dabrafenib plus Trametinib – die erste Kombinationstherapie für pädiatrische Gliome mit BRAF-V600E-Mutation
PhaseIIStudie TADPOLEG [10] wurden insgesamt 110 Patienten im Alter von 1 – 17 Jahren mit einem BRAF-V600E-positiven LGG eingeschlossen und entweder mit Dabrafenib plus Trametinib (n = 73) oder einer StandardChemotherapie mit Carboplatin plus Vincristin (n = 37) als Erstlinientherapie behandelt. Primärer End
Pädiatrische Gliome
Gliome sind Tumoren des zentralen Nervensystems. In Deutschland sind ZNS-Tumoren nach den Leukämien die zweithäufigste Krebserkrankung bei Kindern und Jugendlichen – im Unterschied zu Erwachsenen [3, 4]. Gliome werden entweder als niedriggradig maligne (Grad 1 und 2) oder hochgradig maligne (Grad 3 und 4) eingestuft [5].
Das niedriggradig maligne Gliom (low-grade glioma, LGG) ist die häufigste pädiatrische ZNS-Tumorart und macht mit rund 250 Neuerkrankungen pro Jahr etwa die Hälfte der pädiatrischen ZNS-Tumoren aus [6]. Seine Symptome hängen von verschiedenen Faktoren wie dem Lebensalter und der Tumorlokalisation ab. Neben unspezifischen Beschwerden wie Kopf- und Rückenschmerzen sowie Schwindelgefühlen, Übelkeit und Nüchternerbrechen können LGG spezifische Symptome wie epileptische Anfälle sowie Seh-, Gleichgewichts- und Gangstörungen verursachen [6].
Bei etwa 15 – 20 % der pädiatrischen ZNS-Tumoren handelt es sich um aggressive, hochgradig maligne Gliome (high-grade glioma, HGG; 60 bis 80 Neuerkrankungen pro Jahr) mit einer hohen Rezidivrate und einer meist schlechten Prognose [7].
BRAF-V600-Mutation – ein wichtiger Prognosefaktor Entscheidend für die Überlebensperspektive der Patienten ist generell die Operabilität der Gliome [6, 7]. Darüber hinaus können auch molekulare Signaturen maßgeblich für Therapieentscheidungen und damit für den weiteren Erkrankungsverlauf sein. So weisen 15 – 20 % der pädiatrischen LGG eine BRAF-V600-Mutation auf, die mit einer ungünstigeren Prognose assoziiert ist [8]. Bei den HGG lässt sich bei 3 – 7 % der Tumoren eine BRAF-V600-Mutation nachweisen (über alle Altersgruppen) [9].
Kombination aus Dabrafenib und Trametinib
Die zielgerichtete Kombinationstherapie mit den BRAF/MEK-Inhibitoren Dabrafenib und Trametinib ist die bisher einzige zugelassene Therapieoption zur Behandlung pädiatrischer Gliome mit einer BRAF-V600-Mutation.
Dabrafenib (Finlee®) ist ein Inhibitor der RAF-Kinasen. Onkogene Mutationen im BRAF-Gen führen zur konstitutiven Aktivierung des RAS/RAF/MEK/ERK-Signalübertragungswegs. V600E ist die am häufigsten beobachtete BRAF-Mutation, die bei 19 % der pädiatrischen LGG bzw. ungefähr 5 % der pädiatrischen HGG identifiziert wurde [1].
Trametinib (Spexotras®) ist ein reversibler, hochselektiver allosterischer Inhibitor der Aktivierung der mitogen aktivierten, über extrazelluläre Signale regulierten Kinasen 1 (MEK1) und 2 (MEK2) sowie deren Kinaseaktivität. MEK-Proteine sind Bestandteile des mit extrazellulären Signalen verbundenen Kinase-Signalübertragungswegs (ERK). Bei Krebserkrankungen beim Menschen ist dieser Signalweg häufig durch mutierte Formen von BRAF aktiviert, wodurch MEK ebenfalls aktiviert wird. Trametinib inhibiert die Aktivierung von MEK durch BRAF und hemmt die Kinaseaktivität von MEK [2].
Vor der Verabreichung des Kombinationspräparates muss bei den Patienten die BRAF-V600E-Mutation mittels eines In-vitro-Diagnostikums (IVD) mit CE-Kennzeichnung mit der entsprechenden Zweckbestimmung bestätigt worden sein. Sollte ein IVD mit CE-Kennzeichnung nicht verfügbar sein, muss der BRAF-V600E-Nachweis durch einen alternativen validierten Test erbracht werden [1, 2].
punkt war die Gesamtansprechrate, sekundäre Endpunkte waren u.a. die Dauer des Ansprechens, das progressionsfreie Überleben und das Gesamtüberleben [10]. Nach einer medianen Beobachtungszeit von 18,9 Monaten zeigte die Kombinationstherapie mit Dabrafenib plus Trametinib eine signifikant (p < 0,001) bessere Wirksamkeit als die StandardChemotherapie: Die Gesamtansprechrate (overall response rate, ORR) unter Dabrafenib plus Trametinib betrug 47 % (95%-KI: 35 – 59) gegenüber 11 % (95%-KI: 3 – 25) im ChemotherapieArm [10].
In der Dabrafenib/TrametinibGruppe setzte das therapeutische Ansprechen meist 4 Monate nach der Randomisierung ein. Die me
diane Dauer des Ansprechens (duration of response, DOR) bei Patienten unter Dabrafenib plus Trametinib betrug 20,3 Monate (95%KI: 12,0 bis nicht erreicht), während in der ChemotherapieGruppe bis zum Datenschnitt kein valider medianer Wert ermittelt werden konnte [10].
Das mediane progressionsfreie Überleben (progression-free survival, PFS) unter Dabrafenib plus Trametinib war mit 20,1 Monaten (95%-KI: 12,8 bis nicht erreicht) signifikant länger als in der ChemotherapieGruppe mit 7,4 Monaten (95%-KI: 3,6 – 11,8; p < 0,001).
Gegenüber der Vergleichsgruppe verminderte sich unter Dabrafenib plus Trametinib das Risiko für Progression oder Tod um 69 %
(HR: 0,31, 95%KI: 0,17 – 0,55; p < 0,001). Das mediane Gesamtüberleben wurde in beiden Studienarmen zum Analysezeitpunkt noch nicht erreicht [10].
In der TADPOLEGStudie war das akzeptable Sicherheitsprofil von Dabrafenib plus Trametinib in der pLGGKohorte konsistent mit jenem in Studien bei Erwachsenen und anderen Indikationen. Die häufigsten Nebenwirkungen (alle Grade) waren Pyrexie, Kopfschmerzen und Erbrechen [10].
Hohe Ansprechrate und lange Ansprechdauer bei pHGG
Im Rahmen der TADPOLEGStudie wurden auch 41 pädiatrische Patienten mit einem rezidivierten oder refraktären HGG eingeschlossen und mit Dabrafenib plus Trametinib behandelt (einarmiges Studien-Design) [11]. Diese Kohorte erreichte eine ORR von 56 % (95%KI: 40 – 72) bei einer medianen DOR von 22,2 Monaten (95%KI: 7,6 bis nicht erreicht), einem medianen PFS von 9,0 Monaten (95%KI: 5,3 – 24,0) und einem zugleich akzeptablen Sicherheitsprofil [11]. Damit profitierten die Patienten mit einem pHGG unter Dabrafenib plus Trametinib von einer besseren Wirksamkeit, verglichen mit relevanten publizierten Ergebnissen zu anderen Behandlungsregimen [11].
Fazit
Die Studienergebnisse machen deutlich, dass Kinder mit einem BRAF V600-positiven pLGG oder einem rezidivierten bzw. refraktären pHGG von einer zielgerichteten Therapie mit der Kombination aus Dabrafenib und
Trametinib (Finlee®/Spexotras®) profitieren können. Entscheidend für die Überlebensperspektive sind eine möglichst frühe Diagnosestellung und molekulargenetische Testungen sowie die Überweisung an ein kinderonkologisches Zentrum.
Brigitte Söllner, Erlangen Literatur
1 Fachinformation Finlee®, aktueller Stand
2 Fachinformation Spexotras®, aktueller Stand
3 Jahresbericht / Annual Report 2019. Deutsches Kinderkrebsregister. https:// www.kinderkrebsregister.de/dkkr/ergebnisse/jahresberichte/jahresbericht2019. html
4 Krebs in Deutschland für 2019/2020. 14. Ausgabe. Hrsg. Robert Koch-Institut und die Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V. Berlin, 2023
5 Louis DN et al. The 2016 World Health Organization classification of tumors of the central nervous system: a summary. Acta Neuropathol 2016;131:803-820
6 Niedriggradig maligne Gliome (Kurzinformation). Stand: 19.05.2020. www.kinderkrebsinfo.de. Charité Universitätsmedizin Berlin Campus Virchow-Klinikum. Klinik für Pädiatrie m. S. Onkologie und Hämatologie. https://www.gpoh.de/kinderkrebsinfo/content/erkrankungen/zns_ tumoren/pohpatinfong120070725/pohpatinfongkurz120070627/index_ger.html
7 Hochmaligne Gliome (Kurzinformation). Stand: 21.03.2024. www.kinderkrebsinfo. de. Charité Universitätsmedizin Berlin Campus VirchowKlinikum. Klinik für Pädiatrie m. S. Onkologie und Hämatologie. https://www.gpoh.de/sites/gpoh/kinderkrebsinfo/content/e9031/e10566/ e25383/e19510/e41776/hochmaligneGliome_Kurzinfo24012022_ger.pdf
8 Lassaletta A et al. Therapeutic and prognostic implications of BRAF V600E in pediatric low-grade gliomas. J Clin Oncol 2017;35:29342941
9 Mistry M et al. BRAF mutation and CDKN2A deletion define a clinically distinct subgroup of childhood secondary highgrade glioma. J Clin Oncol 2015;33: 10151022
10 Bouffe E et al. Dabrafenib plus trametinib in pediatric glioma with BRAF V600 mutations. N Engl J Med 2023;389:11081120
11 Hargrave DR et al. Phase II trial of dabrafenib plus trametinib in relapsed/refractory BRAF V600-mutant pediatric highgrade glioma. J Clin Oncol 2023;41: 5174-5183
Amyotrophe
Lateralsklerose: Tofersen zur Behandlung der genetisch bedingten SOD1-ALS zugelassen
Die SOD1ALS ist eine schwere, tödlich verlaufende und äußerst seltene genetische Form der amyotrophen Lateralsklerose. In Europa sind weniger als 1.000 Menschen davon betroffen [1]. Die durchschnittliche Lebenserwartung von Menschen mit ALS beträgt 3 – 5 Jahre ab dem Einsetzen der Symptome [2]. Mit Tofersen (Qalsody™) hat die Europäische Kommission die erste zielgerichtete Therapie für eine genetisch bedingte Form der Motoneuronerkrankung ALS in der EU zugelassen. Indiziert ist das von der EMA als als Orphan-Drug eingestufte Medikament für die Behandlung von Erwachsenen mit ALS, wenn diese mit einer Mutation im Superoxid-Dismutase 1 (SOD1) Gen assoziiert ist. Dies ist bei etwa 2 % der weltweit schätzungsweise 168.000 Menschen mit ALS der Fall. Bei ihnen wird infolge der Mutation eine fehlerhaft gefaltete, toxische Version des SOD1-Proteins gebildet. Dieses toxische Protein bewirkt eine Degeneration der Motoneuronen, was zu fortschreitender Muskelschwäche, einem Verlust an Muskelfunktion und letztendlich zum Tod führt.
Tofersen (Qalsody™) ist ein Antisense-Oligonukleotid (ASO), das an die SOD1mRNA bindet, was zu deren Abbau führt und dazu, dass eine geringere Menge an SOD1Protein produziert wird.
Wichtiger Meilenstein für ALS-Patienten
Die Zulassung von Tofersen erfolgte auf Grundlage der Gesamtheit der Evidenz, die den gezielten Wirkmechanismus, Biomarker und klinische Daten umfasst. In der doppelblinden PhaseIIIStudie VALOR [3] mit 108 Teilnehmern erhielten die Patienten im Verhältnis 2 : 1 randomisiert 24 Wochen lang entweder Tofersen 100 mg (n = 72) oder Placebo (n = 36). Primärer Endpunkt war die Veränderung des ALS Functional Ratings Scale-Revised (ALSFRS-R) vom Ausgangswert bis Woche 28. Die Ergebnisse zeigen einen Effekt durch Tofersen, jedoch ohne statistische Signifikanz (ITTPopulation: TofersenPlaceboadjustierte mittlere Differenz [95%KI]: 1,4 [1,3, 4,1]). In Woche 28 war die mittlere PlasmaNeurofilament-Leichtkette (NfL), ein Marker für axonale Verletzungen und Neurodegeneration, bei den mit Tofersen behandelten Teilnehmern (ITT) um 55 % reduziert (geometrischer Mittelwert zum Ausgangswert), verglichen mit einem Anstieg von 12 % unter Placebo (Unterschied im geometrischen Mittelwert für Tofersen zu Placebo: 60 % (95%KI: 51 – 67 %) [3]. Sehr häufige, d.h. mehr als 1 von 10 Personen betreffende Nebenwirkungen bei den mit Tofersen behandelten Patienten waren Rückenschmerzen, Schmerzen in Armen oder Beinen, Ermüdung, Muskel und Gelenkschmerzen, Fieber sowie erhöhte Protein- und/oder Leukozytenzahl im Liquor [3].
B. S. Quellen
1 Brown CA et al. Neuroepidemiology 2021; 55:34253
2 National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)
3 Meyer T et al. Muscle Nerve 2023; 67: 515521
Non Melanoma Skin Cancer: Vorteile der photodynamischen Therapie mit künstlichem Tageslicht
Seit Jahren ist die Behandlung bestimmter Formen des Non Melanoma Skin Cancer mittels Photodynamischer Therapie (PDT) mit MethylaminolevulinatCreme (Metvix®) in der Anwendung mit kaltem Rotlicht (cPDT) und mit natürlichem Tageslicht (DaylightPDT; DLPDT) etabliert. Die zu
Methylaminolevulinat-Creme
letzt zugelassene Therapie mit künstlichem Tageslicht (artifical Daylight PDT, ADL-PDT) verbindet die Vorteile beider PDTFormen: Sie ermöglicht eine ganzjährige, wetterunabhängige Behandlung und ist ebenso effektiv und gut verträglich wie die schon vorher etablierten PDTFormen. Aktuelle Daten einer nicht interventionellen Studie an 224 Patienten bestätigen nun die Effektivität der Metvix®PDT mit künstlichem Tageslicht im Praxisalltag. Im Rahmen des Galderma Mittagssymposiums anlässlich der diesjährigen DERM-Tagung in
Methylaminolevulinat-Creme (MAL-Creme, Metvix®) ist zugelassen zur Behandlung von dünnen oder nicht hyperkeratotischen und nicht pigmentierten aktinischen Keratosen auf der Gesichts- oder Kopfhaut sowie zur Behandlung anderer Formen des hellen Hautkrebses (Non Melanoma Skin Cancer, NMSC) wie dem oberflächlichen und nodulären Basalzellkarzinom (sBCC, nBCC) und zur Behandlung des Morbus Bowen, wenn eine chirurgische Entfernung als weniger geeignet angesehen wird.
MAL-Creme wird angewendet als Photosensibilisator zur photodynamischen Therapie (PDT) sowohl mit kaltem Rotlicht (conventional PDT, cPDT) als auch mit natürlichem Tageslicht (Daylight PDT, DL-PDT) oder künstlichem Tageslicht (artificial Daylight, ADLDaylight-PDT). Für alle Therapieformen werden zur Vorbereitung oberflächige Krusten und Schuppen entfernt, danach wird die MAL-Creme ca. 1 mm dick aufgetragen und die Läsion mit einem licht- und luftundurchlässigen Verband abgedeckt, der 3 Stunden auf dieser Stelle verbleibt. Nach dem Abnehmen des Verbands erfolgt die Belichtung entsprechend der gewählten Therapieform. Der Wirkung von MAL liegt folgender Mechanismus zugrunde: 5-Aminolävulinsäure (5-ALA) bzw. ihr Methylester (MAL) penetriert nach lokaler Applikation in das erkrankte Gewebe und wird dort zu Protoporphyrin IX (PpIX) umgewandelt. PpIX stellt den eigentlichen Photosensibilisator dar, der für das Grundprinzip der PDT notwendig ist. Dieses beruht darauf, dass nach einer Anreicherung des PpIX im Gewebe eine Aktivierung durch die Anwendung von Licht einer bestimmten Wellenlänge (635 nm, 37 J/cm2) erfolgt. PpIX absorbiert das Licht und die so gespeicherte Energie wird auf benachbarte Sauerstoffmoleküle übertragen. Dies führt zur Bildung hochreaktiver Sauerstoffspezies, die zur Nekrose und Apoptose der Zellen führen.
Frankenthal stellte PD Dr. Wolfgang G. Philipp-Dormston, Köln, die finalen Daten vor. „Die Ergebnisse dieser sehr umfangreichen Studie aus der Praxis bestätigen, was wir in den Zulassungsstudien bereits gesehen haben: Die sehr gute Effektivität der Metvix®PDT mit künstlichem Tageslicht bei gleichzeitig hoher Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten“, berichtete PhilippDormston.
Überzeugende Ergebnisse der Studie ArtLight
Die nicht interventionelle prospektive Studie ArtLight untersuchte die Anwendbarkeit, Wirksamkeit, Zufriedenheit und Verträglichkeit der ADL-PDT mit Metvix® 160 mg/g Creme bei erwachsenen Patienten mit leichten bis mittelschweren aktinischen Keratosen (AK) im Gesicht und/oder auf der Kopfhaut unter realen Praxisbedingungen. Sie schloss in insgesamt 38 Studienzentren (95 % Praxen) 224 Patienten mit 4.147 AK-Läsionen ein. Der Beobachtungszeitraum pro Patient lag bei bis zu 6 Monaten, inklusive bis zu 4 Visiten. Primärer Beobachtungsparameter war u.a. die Reduktion der AKLäsionen in einem jeweils definierten Fokusbereich von 100 cm2
Die finalen Daten der Studie zeigen nach einer Behandlung in den definierten Fokusbereichen 3 Monate post PDT eine signifikante Reduktion der AKLäsionen um 71 % (p < 0,001). Der Actinic Keratosis Area and Severity Index (AKASI)Score on nahm um 45 % ab (3,4 post ADL-PDT gegenüber 6,2 zur Baseline, p < 0,001). Außerdem verbesserte sich die allgemeine Hautqualität, gemessen an den Einzelparametern raue
Haut, Teleangiektasien, fleckige Pigmentierung und Fältchen (fine lines; Parameter nach Karrer et al. 20214) signifikant (p = 0,002).
Die Metvix® ADLPDT erwies sich auch in dieser groß angelegten praxisorientierten Studie als nahezu schmerzfrei. Ein Großteil der 224 Patienten gab an, während (93,3 %) und direkt nach (96 %) der PDT keine Schmerzen empfunden zu haben (Angaben nach
einmaliger Behandlung). 90,2 % der Patienten würden diese Therapie für eine weitere Behandlung wieder in Betracht ziehen – eine ebenfalls relevante Aussage vor dem Hintergrund der chronischen Erkrankung AK mit mindestens jährlich wiederkehrendem Behandlungsbedarf.
„Diese groß angelegte, umfassende Datenerhebung bestätigt den therapeutischen Stellenwert der

Herausgeber:
Prof. Dr. med. Karl-Ludwig Resch, Deutsches Institut für Gesundheitsforschung gGmbH, Ossecker Str. 172, 95030 Hof
Univ.-Prof. Dr. med. Hermann Eichstädt, Leiter Bereich Kardiologie RZP Potsdam und Geschäftsführer BBGK e.V. Berlin Konstanzer Straße 61 10707 Berlin
Wissenschaftlicher Beirat:
Prof. Dr. M. Alexander, Infektiologie, Berlin
Prof. Dr. L. Beck, Gynäkologie, Düsseldorf
Prof. Dr. Berndt, Innere Medizin, Berlin
Prof. Dr. H.-K. Breddin, Innere Medizin, Frankfurt/Main
Prof. Dr. K. M. Einhäupl, Neurologie, Berlin
Prof. Dr. E. Erdmann, Kardiologie, Köln
Prof. Dr. Dr. med. E. Ernst, University of Exeter, UK
Prof. Dr. K. Falke, Anästhesiologie, Berlin
Prof. Dr. K. Federlin, Innere Medizin, Gießen
Prof. Dr. E. Gerlach, Physiologie, München
Prof. Dr. H. Helge, Kinderheilkunde, Berlin
Prof. Dr. R. Herrmann, Onkologie, Basel
Prof. Dr. W. Jonat, Gynäkologie, Hamburg
Prof. Dr. H. Kewitz, Klin. Pharmakol. Berlin
Prof. Dr. B. Lemmer, Pharmakologie, Mannheim/Heidelberg
Prof. Dr. med. R. Lorenz, Neurochirurgie, Frankfurt
Prof Dr. J. Mann, Nephrologie, München
Dr. med. Veselin Mitrovic, Kardiologie, Klinische Pharmakologie, Bad Nauheim
Prof. Dr. R. Nagel, Urologie, Berlin
Prof. Dr. E.A. Noack, Pharmakologie, Düsseldorf
Prof. Dr. P. Ostendorf, Hämatologie, Hamburg
Prof. Dr. Th. Philipp, Innere Medizin, Essen
Priv.-Doz. Dr. med. B. Richter, Ernährung – Stoffwechsel, Düsseldorf
Prof. Dr. H. Rieger, Angiologie, Aachen
Prof. Dr. H. Roskamm, Kardiologie, Bad Krozingen
Prof. Dr. E. Rüther, Psychiatrie, Göttingen
Prof. Dr. med. A. Schrey, Pharmakologie, Düsseldorf
Dr. Dr. med. C. Sieger, Gesundheitspolitik u. Gesundheitsökonomie, München
Prof. Dr. E. Standl, Innere Medizin, München
Prof. Dr. W. T. Ulmer, Pulmologie, Bochum
Schriftleitung:
Prof. Dr. med. Karl-Ludwig Resch, Deutsches Institut für Gesundheitsforschung gGmbH, Ossecker Str. 172, 95030 Hof
E-Mail: info@d-i-g.org
E-Mail persönlich: k.l.resch@d-i-g.org
Metvix® ADL-PDT. Die Behandlung mit künstlichem Tageslicht verbindet die Vorteile beider PDTFormen: Sie kann unabhängig vom Wetter eingesetzt werden, ist sehr effektiv und genauso schmerzarm wie die DLPDT mit natürlichem Tageslicht“, resümierte PhilippDormston.
Elisabeth Wilhelmi, München
Titelbild: Quelle iStock
Die Zeitschrift erscheint 6 mal im Jahr; Jahresabonnement € 66,00 inkl. MwSt. zzgl. Versandspesen. Einzelheft € 11,00 inkl. MwSt. zzgl. Versandspesen. StudentenAbo zum halben Preis. Der Abonnementpreis ist im Voraus zahlbar. Stornierungen sind bis 6 Wochen vor Ablauf eines Kalenderjahres möglich. Abonnementbestellungen direkt beim Verlag.
Geschäftsführerin: Sibylle Michna Anschrift wie Verlag
Chefredaktion: Brigitte Söllner (verantwortlich) Anschrift wie Verlag
Herstellung/Layout: HGS5 GmbH Schwabacherstr. 117 90763 Fürth
Werbung, Beratung, Verkauf: Sibylle Michna Anschrift wie Verlag
Die Annahme von Werbeanzeigen impliziert nicht die Empfehlung durch die Zeitschrift; die in den Beiträgen zum Ausdruck gebrachten Meinungen und Auffassungen drücken nicht unbedingt die der Herausgeber, des wissenschaftlichen Beirates oder des Verlages aus. Der Verlag behält sich alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung jeglicher Art, sowie die Übersetzung vor. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages.
Erfüllungsort: Puschendorf Gerichtsstand: Fürth
Fälle höherer Gewalt, Streik, Aussperrung und dergleichen entbinden den Verlag von der Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen und Leistungen von Schadensersatz.
Anmerkung der Redaktion: Zur besseren Lesbarkeit werden im Journal für Pharmakologie und Therapie personenbezogene Bezeichnungen, die sich auf das männliche oder weibliche Geschlecht beziehen, grundsätzlich nur in der männlichen Form verwendet. Damit wird keine Diskriminierung des Geschlechts ausgedrückt.
Satz:
HGS5 GmbH, Schwabacherstr. 117 90763 Fürth
Druck und Verarbeitung: DRUCK_INFORM_W.R.
Roland Welker Austraße 7, 96114 Hirschaid
VERL AG PERFUSION
Verlag PERFUSION GmbH
Storchenweg 20 90617 Puschendorf
Telefon: 09101/990 11 10
Fax: 09101/990 11 19
www.Verlag-Perfusion.de
EMail: perfusion@tonline.de
Denken Sie an Ihre KHK-Patient:innen: Tiefgang statt Höhenflug. LDL-C weiter senken.

Statin + Nustendi® als Add-on: 95 % der Patient:innen erreichen eine LDL-C-Senkung von ≥ 50 %*,1
Endpunktstudie bestätigt: Bempedoinsäure reduziert signifikant das Risiko schwerer kardiovaskulärer Ereignisse2 durch effektive LDL-C-Senkung.
KHK: Koronare Herzkrankheit; LDL-C: Low-Density-Lipoprotein-Cholesterin. Tiefgang in Anlehnung an das Konzept „the lower the better“ siehe: Mach F et al. Eur Heart J.2020;41:111–188. * Im Vergleich zu den LDL-C-Ausgangswerten.
Referenzen: 1. Rubino J et al. Atherosclerosis. 2021;320:122–128. 2. Nissen SE et al. N Engl J Med. 2023;388(15):1353–1364.

Für die haus- und fachärztliche Praxis!
Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Bitte melden Sie jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Website: www.bfarm.de. Nustendi® 180 mg/10 mg Filmtabletten. Zusammensetzung: Wirkstoffe: 180 mg Bempedoinsäure, 10 mg Ezetimib. Sonst. Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Mikrokristalline Cellulose (E 460), Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A), Hydroxypropylcellulose (E 463), Magnesiumstearat (E 470b), hochdisperses Siliciumdioxid (E 551), Natriumdodecylsulfat (E 487), Povidon (K30) (E 1201), Polyvinylalkohol (E 1203), Talkum (E 553b), Titandioxid (E 171), Indigocarmin-Aluminiumsalz (E 132), Glycerolmonocaprylocaprat, Natriumdodecylsulfat (E 487), Brillantblau-FCF-Aluminiumsalz (E 133). Anwendungsgebiete: bei Erwachsenen mit primärer Hypercholesterinämie (heterozygot familiär und nicht-familiär) oder gemischter Dyslipidämie, adjuvant zu einer Diät: entweder in Kombination mit einem Statin bei Pat., die LDL-C-Ziele mit der maximal verträglichen Statin-Dosis zusätzlich zu Ezetimib nicht erreichen oder als Monotherapie bei Pat., die entweder eine Statin-Intoleranz aufweisen oder bei denen ein Statin kontraindiziert ist und bei denen die LDL-C-Ziele mit Ezetimib allein nicht erreicht werden können, oder bei Pat., die bereits mit der Kombination aus Bempedoinsäure und Ezetimib als separate Tabletten mit oder ohne ein Statin behandelt werden. Gegenanzeigen: Überempf. gegen Bempedoinsäure oder einen der sonst. Bestandteile. Schwangerschaft u. Stillzeit. Gleichz. Anwendung mit Simvastatin > 40 mg täglich. Gleichz. Anw. mit einem Statin bei Pat. mit aktiver Lebererkrankung oder ungeklärten anhaltenden Erhöhungen der Serumtransaminasen. Nebenwirkungen: Kombi: Häufig: Anämie, reduz. Hämoglobin, Hyperurikämie, vermind. Appetit, Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Hypertonie, Husten, Obstipation, Diarrhö, Abdominalschmerz, Übelkeit, Mundtrockenheit, Flatulenz, Gastritis, erh. Werte Leberfunktionstest, Rückenschmerzen, Muskelspasmen, Myalgie, Schmerzen in den Extremitäten, Arthralgie, erh. Kreatinin im Blut, Ermüdung, Asthenie. Bempedoinsäure Mono zus.: Häufig: Gicht, erh. Aspartataminotransferase. Gelegentlich: erh. Werte für Alaninaminotransferase, Blutharnstoff, red. glomerul. Filtrationsrate. Ezetimib Mono zus.: Häufig: erh. CPK im Blut. Gelegentlich: Hitzewallung, Dyspepsie, gastroösoph. Refluxerkr., erh. Werte für Aspartataminotransferase, Alaninaminotransferase, Gammaglutamyltransferase; Pruritus, Nackenschmerzen, Muskelschwäche, Brustkorbschmerzen, Schmerzen, periphere Ödeme. Nicht bekannt: Thrombozytopenie, Überempfindlichkeit einschl. Ausschlag, Urtikaria, Anaphylaxie, Angioödem, Depression, Parästhesie, Dyspnoe, Pankreatitis, Hepatitis, Cholelithiasis, Cholecystitis, Erythema multiforme, Myopathie, Rhabdomyolyse. Weitere Hinweise: Enthält Lactose. In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen. Weitere Informationen siehe Fachinformation. Verschreibungspflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer: Daiichi Sankyo Europe GmbH, Zielstattstraße 48, 81379 München, Deutschland. Mitvertrieb in Deutschland: Daiichi Sankyo Deutschland GmbH; Tel.: +49 (0)89 78080. Stand der Information: Oktober 2021.
