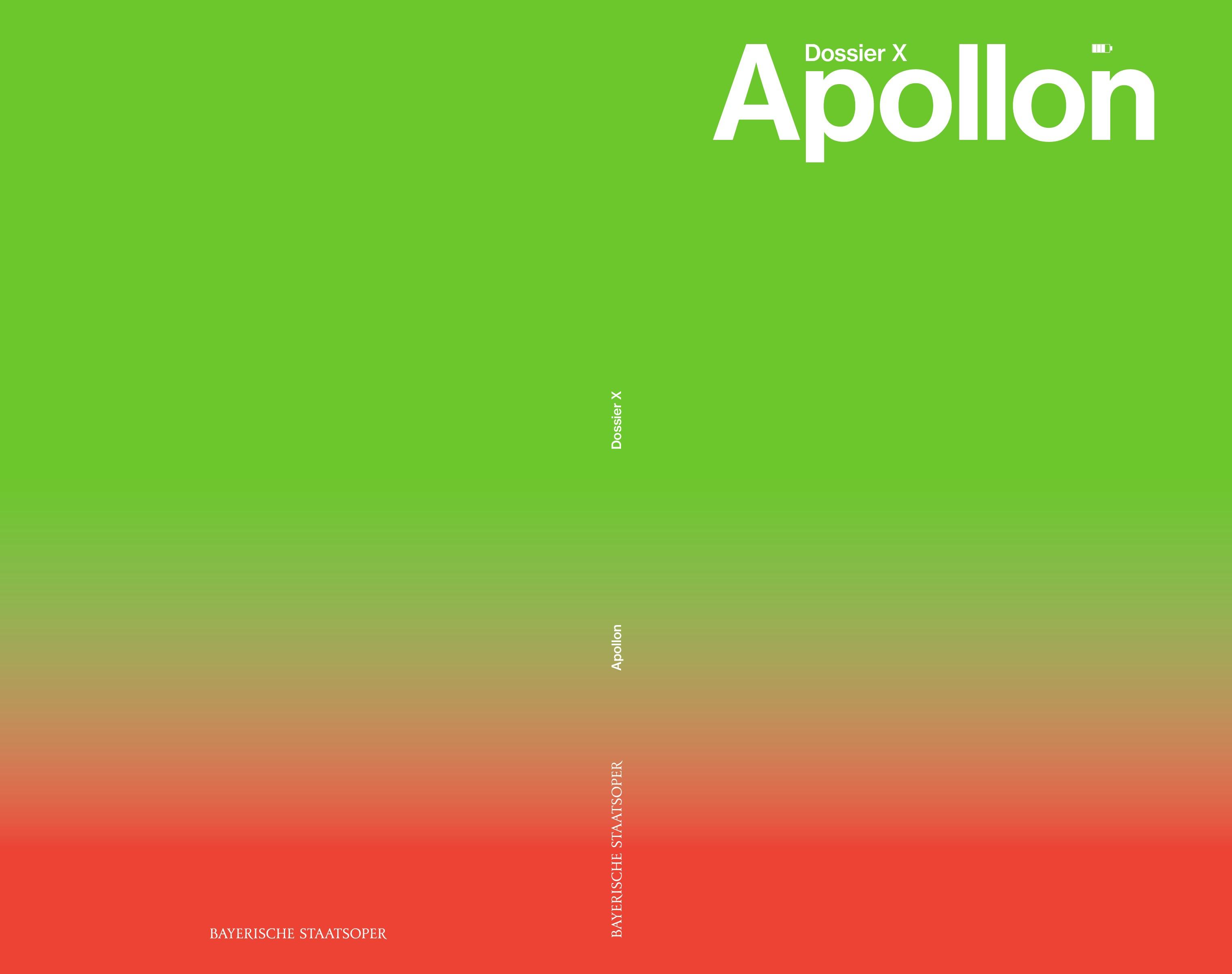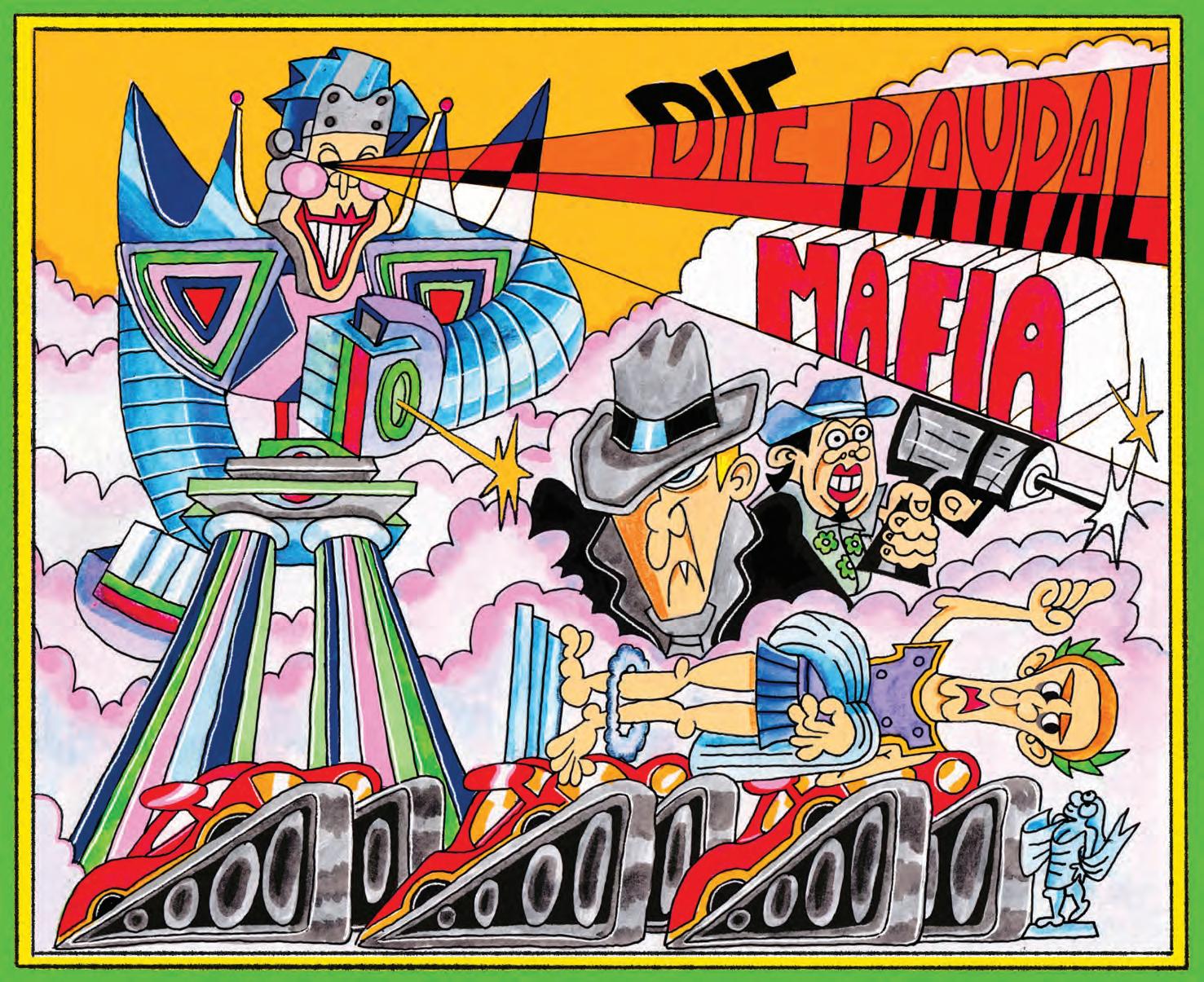4 Everything is alive
Ian Chillag
14 Sieben Symbole der Macht
Kathrin Bierling
22 Nimm mich, Kapital
Julia Werner
28 Macht und McMansions
Kate Wagner
40 Ich will Gold, Digger
Danijela Pilić
50 Die Paypal-Mafia
Adrian Lobe
58 Sieben Wege zur Macht
Lili Ruge
66 Mohamed Bourouissa Périphérique
82 Im Plural
Stefan Gärtner
86 Wir sind mehr
Christian Gottwalt
94 Rein Gold
Elfriede Jelinek
102 Der Ausfall
John Updike
I Ian C Colin
C Vor ein paar Jahren wurde ich einem kleinen Kind geschenkt – von der Zahnfee. Nette Geschichte, denkst du wohl, aber warte ... Da bin ich also: an der Upper West Side. Ein Kind, es ist etwa sieben, hat einen seitlichen Schneidezahn verloren. Das Kind geht schlafen, wacht morgens auf und ich, ich warte nur auf diesen Moment. Dieses Kind wird durchdrehen. Es bekommt gleich einen Zehner für seinen Zahn! Das Kind öffnet die Schachtel, faltet mich auseinander, schaut mich an und sagt: »Ist das alles?« – Hallo, mein Name ist Colin und ich bin ein Zehn-Dollar-Schein.
C Ich würde gerne glauben, dass ich alles kann, was ein Zwanziger kann, oder alles, was ein Hunderter kann. Aber nein, ich kann nur die Hälfte von dem, was ein Zwanziger kann, und ein Zehntel von dem, was ein Hunderter kann.
I Genau.
C Mathematisch gesehen, natürlich.
I Nun, Colin, ich nehme an, du bist viel umgezogen. Wo hältst du dich aktuell auf?
C Dieser Tage bin ich viel in einer Brieftasche.
I Okay.
C Ich meine, es sind viele Brieftaschen, viele Portemonnaies, Geldautomaten. Da findet man mich in der Regel.
I Dein Zuhause ist also eine Brieftasche?
C Ja.
I Wohnst du da allein?
C Nein, ein Geldschein kommt selten allein. Normalerweise sind da noch andere Scheine. In meiner aktuellen Brieftasche sind dann auch noch Quittungen … richtig viele Quittungen. Das mag ich gar nicht, versteht man, oder? Ich meine, der Typ soll sich
mal zusammenreißen. Geht ja gar nicht. Stell dir vor, du wärst zwischen acht oder vierzig Bons eingeklemmt!
I Das sind wirklich viele Bons.
C Das sind viele. Der Kerl ist ein Ferkel. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
I Mich würde interessieren, von wie vielen Menschen warst du schon im Besitz? Wäre das richtig formuliert?
C Das ist kein schlechter Begriff – Besitz. Manchmal ist es eher eine Übergabe. Kann man das dann auch als Besitz definieren? Insgesamt waren es hundertachtzig, ungefähr.
I Das sind viele.
C Ach ja? Ich weiß nicht. Für mich fühlt es sich normal an. Wenn ich so gerade darüber nachdenke … Eine Brieftasche zum Beispiel, das war einfach nur peinlich da. Ein demütigender Ort war das. Viel zu lange, Wochen, war ich dort gegen ein Kondom gedrückt. Das ist einfach kein gutes Gefühl, an einem Gummi herumgerieben zu werden. Ich dachte mir: Junge! Entweder du gibst mich jetzt langsam mal mit vollen Händen aus oder es muss sich hier etwas anderes ändern. Ekelig war das.
I Du sagtest, du warst wochenlang dort.
C Ja. Keine Ahnung, was er da gemacht hat, was für ein Leben er geführt hat. Nichts schien für ihn zu funktionieren.
I Wer hat die Brieftasche zuerst verlassen?
C Nun, ironischerweise bin ich zuerst gegangen. Ich fand das in Ordnung. Ich dachte mir: egal. Lustig war, dass er mit mir mehr Kondome gekauft hat! Ich dachte mir nur: »Mach mal langsam, Casanova.«
I Ich möchte ein bisschen über dein Aussehen reden, wenn das okay ist.
C Ja, das ist okay.
I Auf dir ist ziemlich viel los: Gründervater Hamilton, die Zahl zehn, die Fackel der Freiheit. Das ist jetzt vielleicht eine etwas seltsame Frage, aber was ist für dich dein liebster Teil?
C Was ich am liebsten mag und gleichzeitig am wenigsten, sind all die Worte. Denn Worte, wie du weißt, bleiben für die Ewigkeit. Sie sind wie Tattoos: Man muss damit leben.
I Stimmt.
C »We the People« liebe ich zum Beispiel. »In God We Trust« weniger. Früher war ich ziemlich religiös. Mit der Zeit bin ich, na ja, mehr ein Atheist geworden, ein Atheist mit einem »In God We Trust«-Tattoo. Es ist verwirrend.
I Das glaube ich.
C Ich gehöre nicht wirklich in die … patriotische Ecke. Ich liebe das Land, klar, aber ein bisschen übertrieben ist das schon. Flagge, Siegel, Peter … all dieses Zeug ist einfach nicht mein Ding.
I Wer ist Peter?
C Peter, Peter der Adler, kennst du bestimmt. Der Adler auf den Geldscheinen, das ist Peter.
I Willst du mir sagen, dass der Adler, den ich auf allen DollarScheinen sehe, einen Namen hat?
C Ja, Peter.
I Der Adler heißt also Peter.
C Er heißt Peter, ja. Einst lebte er in der Münzstätte in Philadelphia und saß auf den Münzpressen. Er saß einfach da oben und beobachtete alles. Und dann ging eines Tages leider eine der Druckmaschinen an, während Peter zur falschen Zeit am falschen Ort war. Das war das Ende von Peter.
I Ist doch ein seltsamer Name für einen Adler.
C Hast du einen besseren?
I Na ja, ich habe mir einfach etwas eher Majestätisches vorgestellt.
C Bruce?
I Bruce – wohl kaum.
C Sandy?
I Nein.
C Herr Flattermann? Sir John Eaglegud?
I Schon eher.
C Don Henley, von den Eagles?
I Macht Sinn.
C Schnabel Ferrara? Ei Weiwei? Jürgen Vogel? Kralle Blomquist? Meister Feder? … Mitch McKrähnell?
I Der wäre wohl eher eine Krähe.
C Greif Dracula?
I Peter passt schon.
C Gut.
I Colin, was ist deine erste Erinnerung?
C Ich habe nur noch einen kleinen Ausschnitt vor Augen. Es ist laut, superlaut, und ich sehe viele alte weiße Männer, die an mir vorbeiziehen.
I Okay.
C Das war kein gutes Gefühl. Wo war ich da gelandet, im Altersheim? Ich kann es immer noch nicht einordnen.
I Wie viel weißt du über den weißen Mann auf dir?
C Alexander Hamilton?
I Ja.
C Tja, also, die Show habe ich gesehen. Besser gesagt, ich war dabei. Wirklich gesehen habe ich nichts.
I Du meinst das Musical?
C Ja. Die Originalbesetzung.
I Wie ist das passiert?
C Also, die Person, die mich in Besitz genommen hatte, kriegte Karten und wir waren da, also, ich war dabei. Ich war für LinManuel Miranda da, für die ganze Show.
I Und wie war es?
C Keine Ahnung. Es lag wahrscheinlich an meinem Platz. Wenn man in einer Brieftasche ist, kann man überall sein und doch nicht wirklich da. Ich würde gern sagen können, »Es war mega!«, aber sobald sie anfingen zu singen, schaltete ich einfach ab. Ich dachte: »O, sie singen.« Und dann sangen sie und sangen und sangen immer noch. Ich bin einfach kein Musicalfan, schätze ich.
I Gibt es ein Musical, das du magst?
C Doch, ich war in »Avenue Q« und das war einfach der Brüller.
I Also, Colin, eine andere Sache: Du bist natürlich US-Währung. Hast du auch schon Währungen aus anderen Weltteilen kennengelernt?
C Ich habe tatsächlich einmal einen kanadischen Dollar gesehen. Er war eine Weile mit mir gemeinsam in meiner Brieftasche.
I Okay.
C Das ist eine etwas peinliche Geschichte für mich. Es war so: Ich war aufgeregt, weil ich immer nur mit US-amerikanischer Währung zu tun hatte und es fühlte sich so exotisch an, einen Kanadier bei mir zu haben. Wir waren beide zehn Dollar und ich startete das Gespräch. Ich bin aber wohl ein bisschen zu tief in die globale Wirtschaft eingestiegen und wollte ihm erklären, dass er, obwohl er zehn Dollar wert ist, nicht wirklich so viel wert ist wie ich. Wenn ich das heute so laut sage, hört sich das wirklich ein bisschen creepy an.
I Das hat er bestimmt nicht gern gehört.
C Nein, nett ist das nicht. Und ich versuchte zurückzurudern, indem ich sagte: »Aber die Dinge könnten sich ändern! Importe, Exporte … Vielleicht bist du eines Tages mehr wert als ich!« Aber er hatte schon auf Durchzug geschaltet.
I Hatte er einen bestimmten Geruch?
C Darüber möchte ich nicht sprechen.
I Colin, mich hat dein Tauschwert interessiert und ich habe mich nach verschiedenen Dingen umgesehen, die man für zehn Dollar bekommen kann. Jetzt interessiert mich deine Reaktion darauf. Lass sie uns sie durchgehen.
C Ja, gern.
I Es gibt einen Imbiss, der zwölf Tacos für zehn Dollar anbietet.
C Mit E. coli dazu?
I Ein Poster von Vincent van Goghs Gemälde »Sternennacht«.
C Gerahmt?
I Nein.
C Mau.
I Für zehn Dollar kann man im Heimtierbedarf eine Wüstenrennmaus bekommen, Größe, Geschlecht und Farbe variieren je nach Geschäft, Käfig ist nicht im Lieferumfang enthalten.
C Das klingt doch nett ... Ich mag Rennmäuse.
I Ich finde es ja schon seltsam, dass man euch füreinander eintauschen kann, aber austauschbar seid ihr nicht. Stell dir mal vor, du tauschst mit der Rennmaus für einen Tag das Leben. Dann käme die Rennmaus in eine Brieftasche und du wohl zu anderen Rennmäusen in einen Käfig.
C Boah, Mindfuck. Ich glaube nicht, dass der im Geldbeutel so gut zurechtkommen würde.
I Nein?
C Nein, dafür braucht man eine gewisse mentale Stärke. Und dann
wäre noch die Frage, ob man eine Wüstenrennmaus falten kann?
I Nein. Nein!
C Natürlich nicht, daran würde sie sterben.
I Es ist auch komisch, dass ich als Mensch neben anderen Menschen herumlaufe und glaube, dass wir alle den gleichen Wert haben. Egal, woher wir kommen oder was aus uns geworden ist, wir sind alle in gewisser Weise gleich viel wert. Bei Scheinen ist das per definitionem nicht der Fall.
C Nein, du hast recht. Wir sind alle mit unserem Wert gebrandmarkt.
I Ich wollte dann auch wissen, wie viel ich wert bin, wenn man mich in Einzelteilen verkaufen würde. Und weißt du was? Der menschliche Körper ist summa summarum etwa hundertsechzig Dollar wert.
C O, nicht schlecht. Wie fühlt sich das für dich an?
I Ich wäre gern mehr wert.
C Hattest du eine Vorstellung, wie viel man für dich verlangen könnte?
I Ich hatte tausend Dollar geschätzt.
C Wow, das ist viel. Vielleicht wenn man berühmt ist.
I Nein, alle Menschen, ob berühmt oder nicht, wenn man sie runterreduziert, sind so viel wert … außer Babys, die sind weniger wert, wenn man nur von den Einzelteilen ausgeht, weil sie einfach weniger davon haben.
C Was ist mit Pharrell Williams?
I Wahrscheinlich auch hundertsechzig Dollar.
C Okay.
I Colin, der Junge, den du am Anfang erwähnt hast, das Zahnfeekind?
C Ja?
I Wie hat er dich ausgegeben?
C Gar nicht.
I Wie meinst du das?
C Er ging zu dem Fenster in seinem riesigen, riesigen Zimmer und warf mich auf die Straße. Er wollte mich lieber aus dem Fenster werfen als auszugeben, so eine Enttäuschung war ich für ihn.
I Und du lagst einfach da?
C Ja, ich lag da. Es waren schreckliche, schreckliche, ich würde sagen, fünf bis sechs Minuten, einfach nur daliegend. Ich bin zwar Übergangszeiten gewohnt, an der Kasse, am Geldautomaten, ins Portemonnaie, in die Handtasche, in die Hosentasche … Aber das war anders. Normalerweise ist so ein Übergang schnell. Aber in dem Fall wurde ich weggeworfen, rausgeworfen, und wusste nicht mal, was als Nächstes kommen würde, ob überhaupt irgendwas kommen würde …
I Und, was kam als Nächstes?
C Jemand hob mich auf und ich fühlte mich sofort besser. Ich entfaltete mich, was eine Weile dauerte, weil der Junge mir wirklich zugesetzt hatte. Und dann wurde ich für ein paar Chips und ein Sandwich eingetauscht. Ein echter Aufstieg war das, von Bordsteinkante zu Sandwich und Chips, kein schlechtes Ergebnis.
I Wenn du ein größerer Schein gewesen wärst …
C Ja.
I … wärst du vielleicht viel länger mit diesem Kind zusammengeblieben.
C Das ist mein großer Vorteil gegenüber einem Hundert-DollarSchein, oder sogar gegenüber einem Zwanzig-Dollar-Schein. Die Leute wollen nicht unbedingt an mir festhalten.
I Ja, du hast nichts zu verlieren.
C Ja. Ich bin nichts zu verlieren.
Sieben Symbole der Macht
Erkenne auf den ersten Blick, wer der Bestimmer ist! Diese sieben Symbole stellen Zepter und Krone von heute dar. Schnöde Dinge wie Sneaker aus Plastik oder die richtige Kaffeemaschine demonstrieren inzwischen mehr Macht als ein Reichsapfel. Die Aussage ist die gleiche: Mein Wort wiegt mehr als deines.
1. BOTOXSPRITZE
T
Kathrin Bierling
K Luca Schenardi
Mittels Nervengiften, die wir uns freiwillig unter die Haut spritzen lassen, bestimmen wir, welchen Gesichtsausdruck wir offenbaren – oder vielmehr, welchen nicht. Sorgen, Ärger, Lachfalten und eine Denkerstirn können wir auf diese Weise optisch verschwinden lassen. Wobei man sich in manchen Fällen fragen darf, wer da noch über wen die Macht ausübt: der Patient über das Altern oder das Gift über den Patienten. Nicht ohne Grund sprechen Verabreicher solcher Faltenlahmleger auch von einer Droge.
2. WEISSER SNEAKER
Was hat es mit den immer frisch gekauft aussehenden, neuschneeweißen Turnschuhen auf sich, die manche scheinbar das ganze Jahr über tragen? An die extrem limitierten Sneakertrophäen kommt man jedenfalls nur mit guten Kontakten, ganz viel Glück und nicht zuletzt genügend Geld heran. Damit die Investition lupenrein bleibt, benötigt man unbedingt auch eine präzisere Wetter-App und leistungsfähigere Sneaker-Schmutzradierer als jene, die unsereinem zur Verfügung stehen. Die immer strahlenden Sneaker sind so etwas wie die überlangen, sich bereits kräuselnden Fingernägel des kaiserlichen Chinas: Der Träger demonstriert damit, dass er keinesfalls vorhat, sich bei irgendwas die Hände schmutzig zu machen.
3. TRILLERPFEIFE
Sie kann ganze Nationen zum Weinen bringen, Fußballspieler wie Erling Haaland komplett ausflippen lassen, Ronaldo dafür in die Schranken weisen. Wer über sie verfügt, bestimmt über Ruhm und Niederlage. Kein Wunder, dass Dreijährige, denen die Gehälter der anderen Männer auf dem Platz noch unbekannt sind, vor allem Schiedsrichter:in werden wollen. Doch wehe, sie verfügen irgendwann tatsächlich über so ein Instrument – schließlich sollten An- und Abpfiff streng unter der Maßgabe der Unparteilichkeit getätigt werden.
4. YACHT
Die Tragödien dieses Sommers haben gezeigt, dass auch Yachtbesitzer leicht die Kontrolle über ihr Leben verlieren können. Wer zerstört jetzt eigentlich zuvörderst wen: die Yachten das Klima oder das Klima die Yachten? Vielleicht haben Schauspieler und Klimaaktivist Leonardo DiCaprio sowie Amazon-Gründer Jeff Bezos genau diese Frage auf Bezos’ Megayacht diskutiert, auf deren Deck DiCaprio vor Kurzem gesichtet wurde? Fraglich muss bleiben, ob er bei dem 485-Millionen-Dollar-Schwanzvergleich mithalten konnte. Sollten die Maschinen der »Koru« mal ausfallen, zum Beispiel bei der Kollision mit einem Eisberg, könnte der Luxus-Schoner immerhin noch per Windantrieb davonsegeln.
5. GOLDUHR
Armbanduhr war gestern, im High-End-Segment heißen die Zeitmesser »Chronographen«. Vergiss künstliche Verknappung. So eine goldene Uhr muss man sich schlicht leisten können … zu tragen. Bedingung dafür: entweder die väterliche Dönerbude zu einer Kette ausgebaut haben oder in einem Ausmaß über finanzielle Mittel verfügen wie etwa Comedian Felix Lobrecht (»Laut meiner Rolex ist es kurz nach bei mir läuft’s«). In der Netflix-Serie »Kaos« trägt Schauspieler Jeff Goldblum sie aktuell in seiner Rolle als Zeus. Dort schenkte ihm Herkules den Glücksbringer – göttlich.
6. SIEBTRÄGERKAFFEEMASCHINE
Die muss man erst einmal bedienen können. Und all das Know-how, das in den Kauf und in die regelmäßige Feinjustierung fließt! Mit einer solchen Luxuskaffeemaschine ergeben sich dann auf jeden Fall viel bessere Chancen auf dem Singlemarkt. Schließlich weiß hier jemand, was gut ist, und zeigt, dass er oder sie bereit ist, dafür einiges zu unternehmen. Kaffeekapseln sind demgegenüber wohl eher was für Motoryachten.
7. SIEGELRING
Ich bin geboren, also bin ich. Der einstige Stempelsiegel in Form eines Rings ist eine geradezu absolute Machtdemonstration. Denn hier wird gezeigt, was sich andere nicht einmal erarbeiten können: ein vor vielen Generationen ausgedachtes Familienwappen, mit dem man es dem Adel nachtun wollte. Angeblich soll die auf den Siegeln abgebildete Flora und Fauna für besondere Tugenden wie Stärke (Bär, Löwe), Barmherzigkeit (Granatapfel) oder Demut (Esel) stehen. Blickt man auf das, was von den Wachs auf Briefumschläge tropfenden Geschlechtern immer mal wieder nach außen dringt, muss die Frage erlaubt sein, wie gut sich solche Behauptungen selbst erfüllen. »Barmherzig wie ein Granatapfel« hat sich als Sprichwort zumindest bis heute nicht durchgesetzt.
T Julia Werner K Jiro Bevis
Nimm mich, Kapital!
Wir kennen sie alle, diese Menschen, die mehr Geld, mächtigere Positionen und reichere Partner abkriegen. Sie sind schön, sie sind charmant, sie sind der Funken, der auf Partys auf jeden überspringt. Das einzige, was über diese Ungerechtigkeit hinwegtröstet, ist das gedankliche Verwenden einer Sauerkirsche unter den Sätzen: »Hat sich wohl hochgeschlafen«. Was in so manchem Fall aus der Vergangenheit vielleicht gestimmt, meistens allerdings auf Frauen abgezielt und den Tathergang wohl eher stark paraphrasiert hat. Denn es ist nun mal so, dass es nicht immer gleich zum Äußersten kommen muss, um seine Vorteile auszuspielen. Die britische Soziologin Catherine Hakim nannte solche Eigenschaften in ihrem gleichnamigen Buch von 2011 schlicht und ergreifend: das erotische Kapital, verbunden mit der Forderung an Frauen, es endlich bewusst einzusetzen und zu monetarisieren. Das war natürlich ein Tabubruch, vor allem, weil es ja stimmt: Ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital ist gut, erotisches on top ist besser. Anders gesagt: Nicht nur Vermögen, Zugang zu Bildung und Kontakten entscheiden über gesellschaftlichen Erfolg, sondern auch Sex-Appeal, eine feine Austarierung verschiedener Komponenten wie Schönheit, Humor, sexuelle Kompetenz und Anziehungskraft. Während Männer ihren Sex-Appeal seit Tausenden von Jahren schamlos einsetzen (Stichwort: char-
manter Playboy), sollen sich Frauen bis dato bitte dafür schämen (Stichwort: hübsches Dummerchen). Frauenrechtlerinnen predigen Frauen seit den siebziger Jahren die innere Schönheit, und jeglicher Verbesserungsversuch am eigenen Körper oder Verhalten gilt ihnen als Bestätigung des patriarchalen Narrativs.
Aber es ist, wie es ist: Trotz aller aufrichtiger Bemühungen, die Seele des Menschen in den Vordergrund zu stellen und Äußerlichkeiten so weit wie möglich abzuschaffen (letzter Versuch: Body Positivity), passiert die ganze Zeit das Gegenteil. Dicke Frauen bekommen, wissenschaftlich erwiesen, seltener Jobs als dünne, und wenn, dann weniger Geld, da können noch so viele runde Influencer auf Instagram beschwören, dass sie auch schön sind. Nie haben die Leute mehr Geld für plastische Chirurgie, Kosmetik und Fitness ausgegeben als heute, nie war das Bedürfnis nach Coaching größer, nie war die Spritzenangst (vor der Abnehmspritze Wegovy) geringer als heute. Könnte es vielleicht sein, dass die Kardashians nur deshalb so triggern, weil sie in Wahrheit exakt das machen, was man sich selbst nicht zugesteht, weil es sich einfach nicht gehört? Also: Nase, Hintern und Brüste einfach so lange bearbeiten, bis sie richtig Kohle bringen?
Wie weit einen das eigene erotische Kapital bringen kann, wenn man endlich aufhört, es moralisch zu bewerten, beweist Kim Kardashian ja nun mal mit ihrem Milliardenvermögen. Da können Feministinnen über ihren zugegeben höchst fragwürdigen Geschmack noch so lange die Nase rümpfen. Sex ist Geld ist Macht. Fakt. Selbst das Argument, dass all diese aufgespritzten Insta-Bom-
ben alle die gleichen Wangenknochen, Katzenaugen und HotdogLippen haben, ist ein Rohrkrepierer. Sex-Appeal liegt laut Hakim in Symmetrie und Gleichförmigkeit, diese Regel ließe sich selbst auf Punks anwenden, in deren Gruppe auch wieder eine ganz eigener erotischer Appeal über Sex, also Macht, entscheidet. Aber benötigt Hakims These nach dreizehn Jahren nicht vielleicht ein Update? Die Lage ist seitdem noch weitaus komplizierter geworden. Die Schlacht ums erotische Kapital wird schließlich schon lange nicht mehr exklusiv unter biologischen Männern und Frauen ausgetragen. Die immer größer werdende Gender Diversity hat das Spielfeld der Macht um viele Player erweitert. Plötzlich also gibt es stark beworbene Herren-Beauty-Produkte wie Sand am Meer. George Clooney und Brad Pitt sind definitiv geliftet, sehr gut, wohl, weil sie ihr erotisches Kapital – bisher extrem effektiv und vorbildlich schamlos eingesetzt – schwinden sehen. Queere Menschen sitzen endlich in Machtpositionen, Transsexuelle haben Beef mit biologischen Frauen, weil sie gegen sie im Sport antreten wollen. Es ist ja hoffentlich auch nur noch eine Frage der Zeit, bis LGBTQIA+ People auch US-Präsidenten oder Siemens-CEO werden. Macht haben sie trotzdem schon, und zwar in der Kultur. Welches Buch darf geschrieben, welcher Künstler ausgestellt und welcher Schauspieler besetzt werden?
Auch das sind Machtfragen, auf welche die Antwort in progressiven Verlags-, Kunst- und Kulturinstitutionen immer seltener »mittelalter Heteromensch« lautet. Und das liegt natürlich nicht nur daran, dass ein homosexueller Publisher mit einem Autoren schlafen will. Deswegen muss jetzt die Frage erlaubt sein, ob es im Kampf um Macht doch noch etwas Wertvolleres gibt als den sexy Kardashian-Wan-
genknochen. Ist nicht in unseren Breitengraden eigentlich die Genderidentität längst das kostbarste erotische Kapital?
Der Antwort kommt man nicht mit Hakim, sondern einem anderen soziologischen Duo näher. Die israelischen Soziologinnen Eva Illouz und Dana Kaplan veröffentlichten 2021 ebenfalls ein Buch über Macht und Sex, Titel: »Was ist sexuelles Kapital?« Darin arbeiten die beiden sich von der sexuellen Revolution bis zum Status quo vor und zeichnen nach, wie ehemals als pervers angesehene Begierden irgendwann in den Fokus einer neuen Ökonomie der Aufmerksamkeit rückten – nicht nur Homosexualität und Bisexualität, auch Sadomasochismus, Fetische, Swingerclubs. Das alles ist heute ja längst salonfähig und gilt nicht mehr als übler Kink, sondern eher als Challenge für den modernen Menschen. Wenn man selbst in der braven Schweiz beim Colakaufen in irgendeiner Raststätte an einem riesigen Sexshop mit Strap-ons und Sadomaso-Grundausrüstung im Schaufenster vorbeispaziert, dann muss man sagen: Yep, da ist was dran – die moralische Einwandfreiheit, die einem vor der sexuellen Revolution den gesellschaftlichen Topspot sicherte, hat sich genau ins Gegenteil verkehrt. Nichts erscheint jetzt so uncool wie eingefahrene sexuelle Muster, wie langweiliger – und, noch schlimmer: seltener – Sex. Man muss als moderner Mensch quasi eine sexuelle Innovation nach der anderen raushauen, als wäre die eigene Sexualität ein Wirtschaftsunternehmen. Die Autorinnen sehen dieses »neoliberale Sexualkapital« als direkten »Schlüssel für die Sphäre der Wirtschaft« (bleiben stichfeste Beweise allerdings schuldig): »Arbeitssoziologen haben festgestellt, dass in der New Economy Privatsphäre und Öffentlichkeit endemisch verschwimmen. Dies bedeutet auch, dass
die Arbeitnehmerinnen als Ein-Personen-Marken auftreten müssen. Sie verkaufen also nicht mehr nur ihre Arbeitskraft, sondern ihr ganzes existenzielles Sein.« Demnach häuft der moderne Mensch sexuelles Kapital, ganz so wie Geld, mit möglichst vielen Erfahrungen einfach an und wird dadurch zum interessanteren, attraktiveren, erfolgreicheren Menschen. Das wirft sogar die gute alte Marketingstrategie »Sex sells« über den Haufen, weil es laut Illouz und Kaplan längst andersherum läuft – »Statt zu fragen, wie der Kapitalismus heteronormative und geschlechtsspezifische Drehbücher und Narrative reproduziert, drehen wir die Frage um: Inwiefern tragen die neoliberale Sexualität und der sexuelle Kapitalstock, den sie aufbauen kann, zur Reproduktion des Kapitalismus bei?«
Das sexuelle Subjekt wird demnach längst nicht mehr ausgenutzt – es bereichert sich bereits seit geraumer Zeit selbst.
Das Ergebnis wären also zwei Seiten der Medaille: einerseits der jahrelange Mega-Erfolg der »Fifty Shades of Grey«-Bände, diesem feuchten Traum so vieler gutbürgerlicher Frauen. Exotische, aber von der Gesellschaft offensichtlich eingeforderte Sadomaso-Offenheit, allerdings gepaart mit Liebes-Happy-End: Diese Geschichte zumindest zu lesen ist der Ausweg für alle, die dem Narrativ der romantischen Liebe immer noch anhängen und auch von ihm abhängig sind – die meisten Frauen landen nach der Geburt eines Kindes immer
noch in Teilzeit, und damit in der wirtschaftlichen Abhängigkeit von einem Mann. Und andererseits die extreme Identifikation mit der eigenen sexuellen Identität. Es ist kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen nicht nur wahnsinnig viele Gedanken über ihr Pronomen machen, sondern dessen Anerkennung stetig einfordern, als hinge davon die Rettung des Planeten ab. »They/them« ist, zynisch gesagt, einfach eine viel größere Kapitalanhäufung als ein einfaches »sie« oder »er«. Insofern war Catherine Hakim ihrer Zeit einfach ein bisschen zu weit voraus: Erst jetzt, so scheint es, machen die Leute, egal ob sie, er oder x, von ihren erotischen Ressourcen ganz bewusst Gebrauch.
Der Traum von der sexuellen Freiheit hat auch wieder nichts anderes hervorgebracht als eine neue Form der Machtausübung. Waren die Eliten früher konservativ, sind sie heute progressiv. Die großen politischen Debatten unserer Zeit, die sich an Körpern und Liebesfragen abarbeiten, am Recht auf Abtreibung und der Ehe für alle: Das sind nur noch letzte Zuckungen, Stellvertreterkriege, welche die Mächtigen von gestern anzetteln, weil sie längst die Deutungshoheit verloren haben. Der große Oscar Wilde wusste das alles natürlich schon viel früher: Alles im Leben dreht sich um Sex, nur nicht der Sex. Der dreht sich um Macht.
Macht und McMansions
T Kate Wagner
Wenn es um Machtdarstellung in der amerikanischen Architektur geht, muss man oft schmunzeln. Besonders amüsant ist, dass in einem Land, das so gern mit seiner Verfassungsfreiheit und (Schein-) Demokratie prahlt, die wohlhabendsten Bürger:innen dennoch den Drang verspüren, mit ihren Häusern das genaue Gegenteil darzustellen. Während die amerikanischen Villen des Goldenen Zeitalters im späten 19. Jahrhundert die Kennzeichen des Feudalismus (insbesondere der Tudor- und Neogotik) übernommen haben, offenbaren ihre Nachfolger aus der Reagan-Ära, die sogenannten McMansions, eine viel grausamere Wahrheit über die amerikanischen Oberschichten: Sie haben keinen Geschmack.
Ein Anwesen wie das Biltmore des Raubritters Cornelius Vanderbilt könnte man wohl als eine Art nostalgische feudale Wunscherfüllung betrachten. (Die Tage von Versailles und dergleichen sind zwar vorbei, aber zum Glück können sie durch die Machenschaften des unverfälschten Handels wiederbelebt werden.) Die McMansions kommen nicht derart subtil daher. Das liegt daran, dass sie nicht nur von unfassbar reichen Leuten erbaut werden, sondern von den obersten zehn Prozent (wie Ärzt:innen und Anwält:innen) sowie von Bauträgern mit einer Klientel aus ambitionierten Newcomer:innen. Was diese heterogene Gruppe als Sinnbild architektonischer Macht betrachtet, deckt eine breite ästhetische Vielfalt ab.
Hinzu kommt, dass die Entwicklung immer billigerer, massenproduzierter Baumaterialien der Architektur jegliche Kunstfertigkeit geraubt hat und einen weitgefächerten Katalog unterschiedlicher stilistischer Verzierungen, Ornamente und Ausstattungen ermöglicht hat. Alles so schön praktisch produziert, aus Styropor oder Plastik. Das architektonische Endergebnis ist Pastiche. Man muss dabei nicht mehr komplette Designs aus ferner Vergangenheit kopieren, sondern kann nun nach Herzenslust kombinieren: Korinthische Säulen stützen popelige Giebel, palladianische Fenster können nun in einer Reihe stehen, anstatt nur als einzelner Blickfänger zu fungieren, Colonial Revival geht Hand in Hand mit Neoklassizismus. Manche Häuser sind so individuell gestaltet – zweistöckige Eingangshallen ohne
Oberlicht oder Kronleuchter, die wie ein schwarzes Loch ihre Gäste empfangen, gewölbte Dächer, Fenster in mannigfaltigen Formen –, dass man sie nur, mit beißender Höflichkeit, als »neoeklektisch« beschreiben kann.
Der Zweck bleibt aber der gleiche: Man will Reichtum durch Architektur demonstrieren. Denn in den USA bedeutet Geld: Macht. Theoretisch lässt sich eine McMansion am besten als alltägliche Erweiterung der Postmoderne verstehen, eine Bewegung, die Architektur als ein System von Kennzeichen und Symbolen betrachtete. Hohepriester der postmodernen Architektur wie Robert Venturi oder Michael Graves setzten diese Symbole so zusammen, dass sie manchmal kitschig, clever und selbstironisch wirkten, oder sie gestalteten mit Bezügen zu regionalen Besonderheiten und bestimmten Gebäuden. Postmoderne Bauten sind fast immer ein Neuentwurf des Alten unter Einsatz neuer Technologien und Materialien.
Auch ohne auf die Theorien des Sprachwissenschaftlers Ferdinand de Saussure zurückzugreifen, teilen die Erbauer:innen der McMansions seine Vorstellung von Architektur als Kommunikationssystem. Ein McMansion bedient sich gerne der Symbolik. In der Regel sind es Insignien der Macht, manchmal sogar unverblümter Unterdrückung, und gelegentlich sind es bloß harmlose Statussymbole. Man entdeckt an einer McMansion Säulen und weitläufige Veranden, wie sie für die Sklavenplantagen in den Südstaaten typisch waren. Ihre Fassaden sind oft ein Duplikat des Weißen Hauses, während ihre hoch aufragenden Glasarkaden Einkaufszentren der achtziger Jahre nachempfunden sind. Die vergoldeten und verzierten Säulen im Innenbereich sind sowohl von der italienischen Renaissance als auch von Las Vegas inspiriert.
Um die Herrschaftspräsentation noch wirkungsvoller zu machen, werden derlei Symbole vom Maßstab her oft seltsam verzerrt verwendet. Solche Häuser sind schließlich nicht für eine menschliche Körpergröße gestaltet worden, sondern für diejenige ihrer Autos, der omnipräsenten Erweiterung des amerikanischen Körpers. Man
Kann mir jemand dieses Fenster erklären?
Wer sich keine Haushaltshilfe leisten kann, klaut sie von Madame Tussauds.
»Hmm …«
mehr Säulen
Stuck-Chaos
Wandschrank oder Jukebox?
Wer braucht schon umlaufenden Stuck?
Schreibtisch der Schande
Kamin im Stil eines Windows-98-Bildschirmschoners
Was ist hier los?
Schreibtisch der Macht
Die vernünftigste Erklärung für dieses Haus ist, dass es das Meisterwerk eines betrügerischen Fensterverkäufers ist.
Diokletianisches Fenster
Bauherr: Fred Feuerstein.
Minigolf-Terraforming
Schutz vor feindseligem Angriff
Ein Schreckmoment aus der Renaissance
Rapunzels Turm?
fährt an einer McMansion vorbei und jede:r, der aussteigt, soll sich möglichst klein und mickrig fühlen. Eine weitere Methode, mit der McMansions Macht kommunizieren, sind akkumulierte Anzahlen: vier Erker, Garagen für drei Autos, zweistöckige Foyers. Auch die Innenräume sind gewaltig – große Zimmer, Aufenthaltsräume, Gemeinschaftsräume, Schlafräume, Trainingsräume, Bars, sybaritische Badezimmerlandschaften und begehbare Kleiderschränke. All diese Annehmlichkeiten müssen irgendwo untergebracht werden. Daher breiten sich diese Häuser, ähnlich wie ihre vorstädtische Umgebung, weitläufig aus, um zu vermitteln, dass sie den Platz dafür haben.
Hinter dieser Praxis der Akkumulation steckt eine kulturelle Logik. Als die Federal Housing Administration in den dreißiger Jahren Mindeststandards für Wohnraum festlegte, erkannten die Bauträger, dass sie mit jedem Haus, das mehr als das absolute Minimum bot, zusätzlichen Gewinn erzielen konnten. Dank reichlich vorhandener staatlich finanzierter Hypotheken, eines Wirtschaftsbooms nach dem Krieg, einer vorstadtorientierten Stadtentwicklung sowie einer allgemeinen Verbesserungen des Lebensstandards begannen die Amerikaner:innen, Häuser als Kapitalanlage zu betrachten. Man kaufte ein »Einsteigerhaus« und rüstete dann zu einem »Traumhaus« auf oder renovierte sich dorthin. Daraus entstanden immer größer werdende Häuser. Dass dies mit der dauernd weiter steigenden Renditeerwartung von Hypotheken und dem Wettrüsten zusammenfiel, das letztlich zur Großen Rezession führte, hat die McMansion unauslöschlich geprägt. Sie ist ein Sinnbild dafür, es geschafft zu haben, und ein Paradebeispiel für amerikanische Völlerei und Hybris. Trotz der Rezession gibt es die Häuser bis heute, nun auch gern mit pseudo-ländlicher Rustikalität oder sogar totalem Minimalismus.
Die Charakteristika der Orte, an denen McMansions gebaut werden, schaffen eine zusätzliche Ebene von Kontext und Bedeutung. Wenn ein kleines Haus in einem älteren Viertel abgerissen wird und durch ein riesiges Einfamilienhaus ersetzt wird, ist das sowohl ein Triumph als auch eine Warnung. Säumen Dutzende von McMansions die gewundenen Straßen und Sackgassen einer bewachten Wohnan-
lage, zielt ihre Präsenz auf die ebenso statushungrigen Nachbar:innen ab. Wird eine McMansion auf einem riesigen Stück Land mitten im Nirgendwo gebaut, unterstreicht dies erneut den feudalen Unterton, indem das Anwesen von einer Belagerungsmentalität und Herrschaftsfantasien zeugt. Der bevorzugte Gast solcher Häuser sind die weniger betuchten Freund:innen und Familienmitglieder der Besitzer:innen, denn die fingierte Geselligkeit einer McMansion ist in der Tat zutiefst unsozial. Entfernt von jeglicher Gemeinschaft muss das gesamte Leben im Haus selbst stattfinden. Man sitzt allein in seinem zweistöckigen Foyer wie König Midas, aber hey – zumindest ist es gülden.


Golddigger: Geschichte, Fakten und Anleitungen – ein A bis Z wie Altersunterschied. Ein großer Altersunterschied ist von außerordentlicher Bedeutung und kann ein eindeutiger Hinweis auf Golddigging sein. Der Golddigger (m/w/d) sollte wesentlich jünger sein, während für Sugardaddy oder Sugarmama gilt: je älter und gebrechlicher, umso besser.
Berühmtestes Beispiel: Anna Nicole Smith, damals sechsundzwanzig, heiratete 1994 den neunundachtzigjährigen Milliardär J. Howard Marshall II – ein Altersunterschied von stolzen dreiundsechzig Jahren. Er starb vierzehn Monate später wenig überraschend. Sie erbte dennoch »nur« achtundachtzig Millionen Dollar und das nach jahrelangem Rechtsstreit. Ein jüngstes Beispiel allerfeinsten Diggings: die letzte Frau Lugner, »Mörtels« sechste. Der Wiener Baulöwe war einundneunzig, Simone Reiländer (»Bienchen«), zweiundvierzig, als sie im Juni 2024 heirateten. Er starb zehn Wochen später. Altersunterschied: neunundvierzig Jahre. Bienchen ist im Testament. (Siehe auch → Ehe). Alles richtig gemacht!

wie Begriff. Den Begriff »Gold Digger« (eine Person, die mit jemand anderem wegen seines Reichtums eine romantische Beziehung sucht) wurde erstmals 1911 in Rex Beachs Buch »The Ne’er-Do-Well« verwendet. Der Begriff gelangte um 1915 in den allgemeinen Sprachgebrauch, nachdem eine US-Zeitung ihn gebrauchte, um das Leben der ersten und weltberühmten Golddiggerin → Hopkins Joyce, Peggy zu beschreiben.
Wörterbuchdefinitionen weisen auf eine eindeutig geschlechtsspezifische Konnotation hin – das Wort wird fast immer für eine gierige Frau verwendet, die einen reichen Mann aus finanziellen Gründen heiratet, siehe auch → Gender Gap
wie Charity-Lady. Beim ersten Treffen von Anna Nicole Smith und J. Howard Marshall II musste sie nach ein paar Stunden los, zur Arbeit. Der Ölmilliardär wollte das nicht: »Schätzchen, du wirst nie mehr arbeiten müssen.« Richtig! Aber irgendwas muss man ja tun außer dekorieren und unterhalten. Da bietet sich an: Charity. Erfolgreiche, lange verheiratete Golddigger werden in der Knallpresse häufig »Charity-Lady« genannt, als wäre es eine Berufsbezeichnung. Charity-Galas sind übrigens ein zu empfehlendes
→ Jagdrevier für angehende Golddigger.
wie Diamanten. »Diamonds are a girl’s best friend«, hauchte
→ Lorelei Lee so überzeugend wie zeitlos und Mae West sagte: »Kein Golddigging für mich … Ich nehme Diamanten.« Viel besser als Gold und die ultimative Währung!
wie Ehe. Das ultimative Ziel eines Golddiggers ist die Ehe, denn nur diese garantiert im Falle eines Auseinanderlebens einen Lebensstandard, an den man sich gewöhnt hat, sprich Abfindung, und siehe auch → Unterhalt. Man braucht die Unterschrift sozusagen, sonst auch schwierig mit dem Platz im Testament.
Zur Verdeutlichung ein zeitloser Dialog aus »Wie angle ich mir einen Millionär?« zwischen Schatze Page (dargestellt von Lauren Bacall) und Loco Dempsey (dargestellt von Betty Grable):
Schatze Page: Wenn du eine Maus fangen willst, stellst du eine Mausefalle auf. Gut, wir haben also eine Bärenfalle aufgestellt. Jetzt muss nur noch einer von uns einen Bären fangen.
Loco Dempsey: Du meinst, ihn heiraten?
Schatze Page: Wenn du ihn nicht heiratest, hast du ihn nicht gefangen, er hat dich gefangen. wie Filme. Filme lieben Golddigger als Protagonistinnen! Hier eine subjektive Top-Five:
1. »Breakfast at Tiffany’s« (mit dem schicksten Golddigger aller Zeiten, Audrey Hepburn aka Holly Golightly)
2. »The Big Lebowski« (scheinbar ein Subplot, aber ohne den trashigen Golddigger Bunny Lebowski gäbe es The Dude nicht)
3. »Blondinen bevorzugt« (siehe auch → Lee, Lorelei)
4. »Heartbreakers«, mit Sigourney Weaver und Jennifer Love Hewitt als golddiggendes Mutter-Tochter-Duo
5. »Wie angelt man sich einen Millionär?«, mit Marilyn Monroe, Lauren Bacall und Betty Grable wie Gender Gap. Golddigging ist einer der wenigen Karrierezweige, in dem Frauen einen Vorteil gegenüber Männern haben, besser aufgestellt sind und besser verdienen. Doch natürlich gibt es auch männliche Golddigger, und Grüße gehen raus unter anderem an Casper Judd (bekam angeblich fünfzehn Millionen US-Dollar für acht Monate Ehe mit Jennifer Lopez) und den Verwaltungsbeamten





Alfonso Díez Carabantes, der die reichste Frau Spaniens, geschätztes Vermögen drei Komma sechs Milliarden Euro, heiratete. Er war damals sechzig, Cayetana Fitz-James Stuart, die Herzogin von Alba, war fünfundachtzig. Sie starb drei Jahre später. wie Hopkins Joyce, Peggy. Peggy Hopkins Joyce (1893–1957) war die allererste Golddiggerin, und was für eine! (Mindestens) sechsmal verheiratet, mit mehreren Millionären und einem Grafen, hatte Joyce kein erkennbares Talent außer der Selbstvermarktung. Peggy wollte unbedingt berühmt sein, gab ständig Interviews, spielte in Filmen mit und war dauernd in der Klatschpresse. Einer ihrer krassesten Moves: In ihrer Hochzeitsnacht mit ihrem dritten Mann, Stanley Joyce, schloss sie sich im Bad ein und wollte erst dann herauskommen und mit ihm → Sex haben, wenn er ihr einen Scheck über eine halbe Million Dollar ausgestellt hatte. Was er tat! Dann, in der ersten Woche der Ehe, gab sie noch einmal eine Million Dollar beim Shopping aus. wie Investition. Und zwar seitens der Golddigger. Ja, auch dieser hat Kosten, denn ein Golddigger entspricht häufig (nicht immer) einem gängigen heteronormativen Schönheitsideal, das man heutzutage dank ästhetischer Chirurgie erreichen kann. Brüste, Nase, Haarfarbe, Lippenform: Alles lässt sich richten, doch man sollte aufpassen, denn wenn es zu viel ist, passt es nicht in das Konzept von → Quiet Luxury wie Jagdrevier. Charity-Galas, Kunstauktionen und Golfplätze sind die erwartbaren Jagdreviere. Doch Melania Trump lernte Donald auf einer Fashion-Week-Party kennen, Simone Reiländer den »Mörtel« im Baumarkt, und auch das gemeine Büro ist keine so blöde Anlaufstelle, siehe PA, ehemals Vorzimmerdame. Man muss die Augen und Ohren überall offenhalten! wie Kinder. Gemeinsame Kinder garantieren, bis sie volljährig sind, einen Unterhalt. Oder um es mit → Ye zu sagen: »Eighteen years, eighteen years, she got one of your kids, got you for eighteen years.« – Kanye West, »Gold Digger« ee, Lorelei. Die Blaupause für Golddigger. Marilyn Monroe spielt in »Blondinen bevorzugt« die Protagonistin der Geschichte, die das Klischee der »dummen Blondine« verkörpert. Hinter ihrem dümmlichen Getue und materialistischen Äußeren verbirgt sich aber
eine raffinierte Frau, die Männer zu ihrem Vorteil manipuliert. Außerdem kommuniziert sie ihre Absichten offen, und so gilt Lorelei Lee als selbstbestimmte Frau. Für ihre Zeit war sie bahnbrechend. François Truffaut meinte über den Film: »Das ist alles andere als zynische und liebenswürdige Unterhaltung: Es ist ein böses, intelligentes und unerbittliches Werk.«





wie Motto. »’Cause the boy with the cold hard cash is always Mr. Right.« – Madonna, »Material Girl« wie NDA. Die Verschwiegenheitsklausel (Non-disclosure agreement) ist häufig Bestandteil von Scheidungsverhandlungen. wie Online-Dating. Seiten wie millionairematch.com, elitecupid. com oder lemonswan.de versprechen Sugardaddys (und -mummys) als Dates. Siehe auch → Jagdrevier wie Plan. Man wäre gut beraten, einen zu haben! Es gibt sogar Literatur und Ratgeber (»Es geht nicht nur um Prada und Privatjets, sondern auch um Proust und Picasso.«) oder aber man kann studieren, wie es einige → Vorbilder angestellt haben. wie Quiet Luxury. Könnte der entscheidende Hinweis sein, ob es sich um einen Millionär (eher laut und trashy) oder einen Milliardär handelt. Quiet Luxury: stiller Luxus, keine Logos, eher subtil als pompös und ausschließlich an der herausragenden Qualität festzustellen.

wie Rubicondi, Rossano. Ein Golddigger, der einen Golddigger heiratete: Rossano Rubicondi heiratete die vierundzwanzig Jahre ältere Ivana Trump, die wiederum als Golddigger galt, weil sie sich Donald Trump geschnappt hatte. (»Don’t get mad, darling. Get everything.«) Donald richtete übrigens die Hochzeit zwischen Rossano und Ivana für geschätzte dreihundert Millionen US-Dollar aus. Acht Monate später waren sie geschieden.
wie Sex. Die eine Partei hat Geld. Und die andere? Vielleicht Jugend, Schönheit, wahrscheinlich gewisse Trophy-Wife-Qualitäten, doch die Währung ist und bleibt: Sex. Darum geht’s. Siehe auch → Transaktion
wie Transaktion. Wer für Geld heiratet, wird jeden Cent verdienen müssen, heißt es. Umsonst ist das süße Leben nicht, siehe auch → Sex.
wie Unterhalt. Eigentlich will man bei einer Scheidung eine Abfindung, aber Unterhalt (oder eine Kombination aus beiden) geht auch, wenn gemeinsame Kinder vorhanden sind. Ivana Trump bekam nach ihrer Ehe mit Donald Trump sechshundertfünfzigtausend Dollar pro Jahr, bis alle ihre Kinder achtzehn Jahre wurden. wie Vorbilder. In keiner bestimmten Reihenfolge: Slavica Ecclestone, Lauren Sánchez, Anna Nicole Smith, Heather Mills, Ivana Trump, Noor Alfallah. Wer? Nun, Letztere datete, als sie dreiundzwanzig war, den achtundachtzigjährigen Clint Eastwood. Ein Jahr zuvor schon Mick Jagger, damals vierundsiebzig. Und mit achtundzwanzig kam sie mit Al Pacino zusammen, der da zweiundachtzig war, und wurde prompt schwanger. Siehe auch → Altersunterschied → Kinder → Unterhalt wie Wertesystem. Besteht aus den drei Eckpfeilern Kapitalismus, Ehrgeiz und Geldgier.


wie XY, Aktenzeichen. Und dann gibt es jene, die das Golddigging auf ein kriminelles Level heben: die sogenannten Heiratschwindler:innen. Ob Otto F., der 1967 mit dreiundvierzigtausend Mark verschwand, oder Silke H., die sich 2006 als Pferdehändlerin ausgab und so von ihrem Lebenspartner vierhunderttausend Euro erschwindelte.
wie Ye. 2005, als Ye noch Kanye West hieß, brachte er den Song »Gold Digger« heraus: »Now, I ain’t sayin’ she a gold digger, but she ain’t messin’ with no broke n****«
wie Zeitgeist. Golddigging wird nie out sein. Zum Thema #golddigger gibt es momentan auf Tiktok mehr als neunundzwanzig Millionen Videos.
Es geht nicht nur um Prada und Privatjets,
sondern auch um Proust und Picasso.
Es geht nicht nur um Prada und Privatjets, sondern auch um Proust und Picasso.
Elon Musk und Peter Thiel gehören zu den einflussreichsten, schillerndsten und kontroversesten Figuren im Silicon Valley. Porträt zweier Finsterlinge, die Netflix nicht hätte besser casten können.
Im März 2000 hatten Elon Musk und Peter Thiel einen Termin im Büro des Investors Mike Moritz, dem Chef der einflussreichen Wagniskapitalfirma Sequoia Capital im kalifornischen Menlo Park. Es ging um die Übernahme ihrer beiden Unternehmen, die später zu Paypal fusionieren sollten. Musk war da mit seinen achtundzwanzig Lenzen bereits ein erfolgreicher Unternehmer, seine Internetbank X.com sorgte für Furore. Es war der Höhepunkt des Dotcom-Hypes. Ein Jahr zuvor hatte Musk sein erstes Start-up veräußert und selbst zweiundzwanzig Millionen Dollar aus dem Verkauf bekommen. Für eine Million davon gönnte er sich einen Sportwagen. Nicht irgendeinen, sondern einen Supersportwagen: einen McLaren F1. Flügeltüren, sechshundertsiebenundzwanzig PS, Höchstgeschwindigkeit über dreihundertsiebzig Stundenkilometer. Der Motorraum mit purem Gold ausgekleidet. Limitierte Auflage. Der Sportwagenhersteller hatte ein paar Dutzend Exemplare gefertigt. Ein deutscher PharmaManager hatte Musk das Sammlerstück verkauft.
Als der Formel-1-Bolide 1999 ausgeliefert worden war, schickte der Sender CNN ein Reporterteam und filmte einen schnöseligen, großspurigen Möchtegern-Unternehmer in braunem Sakko, der neben seiner Verlobten Justine in die Kamera sein maliziöses Haifischlachen lachte, das der Raubtierkapitalist bis heute an den Tag legt. Musks Motto: »Go big or go home«.
Wer so denkt, fährt nicht im Nissan zum Investorengespräch, sondern will groß auftrumpfen. Also stieg Musk an diesem Tag im März 2000 in seinen McLaren, und weil sein Konkurrent Thiel in Palo Alto wohnte, was quasi auf dem Weg lag, bot er ihm eine Mitfahrgelegenheit an. Während Musk die Sand Hill Road entlangfuhr, wo das Geld auf der Straße liegt und die Träume höher wachsen als die Eichen- und Zypressenbäume, fragte ihn Thiel immer wieder, was »das Teil« –gemeint war der Rennwagen – denn eigentlich könne.
Davon herausgefordert, drückte Musk aufs Gaspedal und beschleunigte. Zu schnell. Der McLaren raste mit überhöhter Geschwindigkeit auf den vor ihm fahrenden Wagen zu. Musk konnte eine Kollision nur vermeiden, indem er das Lenkrad herumriss. Der McLaren krachte in die Leitplanke und wurde »wie ein Diskus« (Musk) durch die Luft geschleudert. »Ich wusste gar nicht, wie man das Auto fährt«, er-
T Adrian Lobe
K Lillian Ansell
innerte sich Musk später. Nur mit viel Glück überlebten die Insassen den Unfall – Thiel war nicht angeschnallt. Weil der Libertäre den Sicherheitsgurt als Gängelung empfand?
Thiel befreite sich, ganz eigenverantwortlich, ohne die minimalstaatliche Hilfe von Polizei und Feuerwehr aus dem Autowrack und trampte (!) in die vornehmen Büros von Sequoia Capital, wo wenig später auch der Bruchpilot Musk zum Termin eintraf. Eine Erklärung für ihre Verspätung lieferten sie nicht. Der Deal wurde besiegelt. Musk und Thiel fuhren zwar nie wieder zusammen Auto, saßen aber fortan im selben Boot.
Die Anekdote, die Jimmy Soni in seinem Buch »The Founders« (2022) erzählt, sagt viel über die Risikobereitschaft im Silicon Valley, das virile, machistische Gehabe der Tech-Entrepreneure, die mit PS protzen und immer auf der Überholspur sind. Dass aus einem Crashpiloten und Wannabe-Autoposer einmal der Chef des weltgrößten Elektroautobauers (Tesla) werden sollte, entbehrt nicht einer gewissen Komik, folgt aber auch der Logik des Akzelerationismus, den Motor des Kapitalismus immer noch ein wenig schneller laufen zu lassen. Das Facebook-Motto »Move fast and break things« entstand aus diesem Geist heraus. »Kreative Zerstörung« nennen es die Schüler des österreichischen Nationalökonomen Joseph Schumpeter, »Disruption« die Tech-Jünger. Dass man dabei krachend scheitern kann? Egal! Go big or go home. Vielleicht baut man andere Autos, wenn man auf einem Highway einen Formel-1-Boliden gegen die Wand fährt, und vielleicht hat man auch eine andere Risikowahrnehmung, wenn man, wie Musk, als kleiner pausbäckiger Nerd, in der Schule in Südafrika gehänselt und von einer Gang krankenhausreif geschlagen wurde. Diese Lebenserfahrungen können aber nur bedingt erklären, warum der Tesla-Chef und reichste Mann der Welt seinen Cybertruck – eine Panzerkarosse, die ästhetische Anleihen an dem faschistoiden Futurismus des italienischen Schriftstellers Filippo Tommaso Marinetti nimmt – als »apokalypsesicher« vermarktet. Man fragt sich: In welcher Welt lebt der Mann?
Auch der deutschstämmige Investor Thiel, der 1967 inmitten der Studentenrevolte in Frankfurt am Main geboren wurde, fürchtet sich,
wie die anderen »Doomer« im Silicon Valley, vor dem Weltuntergang. Schon seit Jahren sucht der Prepper – bislang vergeblich – nach einem Bauplatz für einen Bunker, in Neuseeland verweigerte ihm eine Gemeinde die Baugenehmigung. Auch als Milliardär ist es nicht einfach, seine Wunschimmobilie zu finden.
Musk und Thiel sind Brüder im Geiste. Die Tech-Milliardäre eint nicht nur die Angst vor dem Weltuntergang, sondern auch ihre Unterstützung für Donald Trump und eine damit verbundene antiwoke, libertaristische Weltanschauung: Thiel, der Demokratie und Freiheit für unvereinbar hält (»Wettbewerb ist für Verlierer«) und Wokeness mit Wahhabismus gleichsetzt, finanziert das Seasteading-Institut, das in internationalen Gewässern schwimmende Inselstaaten errichten will.
Auch Musk fasziniert die Idee eines Soziallabors, wenngleich er noch viel höher hinauswill: Der Anhänger des Longtermismus, einer Denkrichtung, die – radikal konsequentialistisch – die Menschheit auch in zehntausend Jahren vor aller Unbill (also auch vor dem Batterieschrott von Tesla-Autos) bewahren will, plant, bis zum Jahr 2050 den Mars zu besiedeln. Musk gefällt sich in der Rolle des Visionärs, der die Menschheit mit immer neuen Ideen betört: Hyperloop, Gehirn-ComputerSchnittstellen, Marsmission – kein Projekt scheint ihm zu groß. Als der selbsternannte »Absolutist der freien Rede« 2022 den Kurznachrichtendienst Twitter für vierundvierzig Milliarden Dollar übernahm und damit das Projekt der elektronischen Agora abwickelte, marschierte er demonstrativ mit einem Waschbecken ins Hauptquartier (»Entering Twitter HQ – let that sink in!«), wobei er habituell wie eine Mischung aus Klempner und Gangster wirkte. Ein paar Monate später leuchtete auf dem Dach der Firmenzentrale wie in einem »Star Wars«-Remake das X-Zeichen – der neue Name der Plattform. Musk liebt die Show, die mediale Inszenierung, er braucht die große Geste und die Macht der Bilder, um seine heilsgeschichtlich aufgeladenen Missionen vor Investoren zu rechtfertigen. So ließ er 2018 mit großen Fanfaren einen Tesla-Roadster ins Weltall schießen, um die Traglast seiner »Falcon Heavy«-Rakete zu demonstrieren. Der Weltraum wurde zum Werbekosmos. Mit seiner Weltraumfirma SpaceX kontrolliert Musk das All; sein Satellitennetzwerk Starlink, welches mobiles Internet zur Erde funkt
und unter anderem vom ukrainischen Militär zur Navigation von Drohnen genutzt wird, macht die Hälfte aller Satelliten in der Erdumlaufbahn aus. Starlink hat die militärische Logik des Kriegs verändert. Ohne schnelles Internet hätte die Ukraine keine so effektive Gegenoffensive gegen Wladimir Putins Truppen starten können. Allerdings hängt die Unterstützung zuweilen von den Launen des Gönners ab. So kappte Musk kurzerhand den Zugang zu dem Netzwerk und unterband damit nach eigenen Aussagen einen ukrainischen Drohnenangriff auf ein russisches Kriegsschiff.
Musks Machtdemonstrationen, gepaart mit einer Rhetorik der Superlative (»Gigafactory«), ziehen nicht nur seine Jünger, darunter Krypto-Aficionados und andere Glücksritter, magisch an, sondern beflügeln auch die Allmachtsfantasien derer, die sich nach einem starken Führer sehnen. Mit Starlink und der Plattform X besitzt Musk eine Kommunikationsinfrastruktur, von der Verleger im Printzeitalter nur träumen konnten: Musk kann auf Knopfdruck Börsenkurse bewegen, Oppositionellen das Internet an- und ausschalten und missliebige Journalisten sperren. Wenn er das Megafon für seine Agenda lauter drehen will, schickt er einfach seine Mitarbeiter in den Maschinenraum und lässt den Algorithmus so tunen, dass die Sichtbarkeit seiner Posts um den Faktor tausend gehebelt wird. Demgegenüber ist die Herrschaft, die Thiel ausübt, subtiler und diskreter. Der »Machtjongleur des Silicon Valley«, wie ihn sein Biograph Max Chafkin nennt, agiert im Verborgenen – als »Hinterzimmerdiplomat« und Winkeladvokat. Thiel ist der Kopf der »Paypal-Mafia«, einem clanartigen Beziehungsgeflecht aus persönlichen und finanziellen Verbindungen, die bis in die 1990er Jahre zurückreichen.
Dieses inoffizielle, männerbündlerische Netzwerk pumpte Geld in Start-ups wie Airbnb, Deepmind, Lyft, Palantir und Spotify. Thiel wurde so zum ersten Investor von Facebook und zum Mentor von dessen Gründer Mark Zuckerberg, den er wie ein »Puppenspieler«, so Chafkin, steuerte, manche sagen auch: manipulierte. Der »Pate des Silicon Valley« (Chafkin) ist eine der mächtigsten Figuren in der Tech-Branche. Zu seinen Protegés gehören Alex Karp, Chef des Überwachungskonzerns Palantir, Oculus-Gründer Palmer Luckey sowie der republikanische US-Vizekandidat J. D. Vance. Thiel
kann mit seinen Beziehungsnetzen Start-ups zu Global Playern machen und ganze Medienhäuser zu Fall bringen. So finanzierte er heimlich eine Klage des Wrestlers Hulk Hogan gegen das Klatschportal Gawker und trieb das Medium in den Ruin – aus Rache, weil die Redaktion ihn, Thiel, 2007 als schwul geoutet hatte. Die Klagefinanzierung bezeichnete der Paypal-Gründer als eine seiner »größten philanthropischen Bemühungen«. Sein soziales Engagement besteht darin, Studienabbrechern ein Stipendium von hunderttausend Dollar zu bezahlen, damit diese ein Start-up gründen können. Man lernt bei dem Mann einiges über die strategische Kunst der Täuschung. Thiel-Schüler Palmer Luckey, der sich mit Kinnbart, Vokuhila-Frisur und Hawaii-Hemd als Prototyp des Nerds präsentiert und einst von der grenzenlosen Freiheit im virtuellen Raum schwärmte, ist heute ein Rüstungsunternehmer, der autonome Waffensysteme für das Pentagon entwickelt.
Es gibt Stimmen, die sagen, dass Big Tech bloß die Wucherung eines militärisch-industriellen Komplexes ist. Dass das Darpa-Projekt »Lifelog«, in dessen Rahmen eine umfassende elektronische Datenbank von jeder Person (»Cyber-Tagebuch«) aufgebaut werden sollte, just an jenem Tag gestoppt wurde, als Facebook gegründet wurde, sorgt unter Verschwörungsgläubigen immer wieder für Spekulationen. Einst waren es soziale Netzwerke, heute sind es Waffen und Radikalisierungswerkzeuge: Die Maschinen, die die Tech-Milliardäre zu beherrschen versuchen, sind außer Kontrolle geraten.
Wünsche, die einem von den Lippen abgelesen werden, Kontrolle über sich und andere, Einfluss und im Idealfall eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf die Menschen um einen herum: Die Versprechen der Macht sind süß. Und das Beste ist, dass Macht für die Privilegien, die sie gewährt, nicht viel zurückverlangt. Zumindest, wenn man die Schriften Machiavellis konservativ interpretiert und Macht
als Selbstzweck begreift, der weder moralischen noch ethischen Grundsätzen zu folgen hat. So ruthless würden wir natürlich niemals vorgehen, wären wir in einer mächtigen Position. Oder? Denn das mit den Wünschen, die uns andere von den Lippen ablesen, klingt auf jeden Fall schon irgendwie reizvoll. Wie aber kommt man an Macht? Hier ein paar Ideen:
Keine:r hat Bock, die Spülmaschine in der Büroküche auszuräumen oder beim Meeting das Protokoll zu führen? Übernimm diese Jobs! Aber mach dabei nie den Fehler, fleißig und still die Dinge wegzuarbeiten. Lass unbedingt alle wissen, wie gut du deine Aufgaben machst. Schreib einen Büroküchen-Newsletter. Verfasse das beste Protokoll der Welt. Und dann verschicke es über ein neuartiges Tool, das nur du beherrschst. Biete dazu Workshops an, die niemand sonst versteht. Wissen ist Macht und die Macht ist jetzt in deiner Hand. Wenn das noch nicht zur Beförderung führt, erfinde Defekte an der Kaffeemaschine und lass alle spüren, wie abhängig sie von dir sind.
T Lili Ruge
Macht kommt von Machen, aber ganz ehrlich: Wir sind nicht geboren, um unsere Zeit damit zu verbringen, To-do-Listen abzuarbeiten. Um trotzdem das befriedigende Gefühl zu bekommen, einen Haken hinter eine Aufgabe zu setzen, schreib eine Liste mit Aufgaben, die keinerlei Mühe bereiten oder schon erledigt sind. Aufgestanden: Check! Kaffee getrunken: Check! Die Klotür fehlerfrei geöffnet: Läuft doch, Tiger!
Egal, wie groß oder klein dein Einflussbereich ist: Unberechenbarkeit wird dir Macht verleihen. Handle immer nach dem Grundsatz »Meine Laune soll mindestens im Umkreis von fünf Metern von jedem bemerkt werden.« Und »Was ich heute gut fand, ist morgen komplett daneben.« Mit anderen Worten: Werde eine toxische Person. Triff dich mit Freund:innen zum Essen. Bestell selbst nichts. Aber betone, wie schlecht du den Service findest. Muscheln würdest du lieber nicht essen im Juli? Bring es wortreich zur Sprache! Wichtig ist aber, dass du beim nächsten Treffen wieder alle mit Liebe überschüttest (und Spaghetti alle Vongole bestellst). Alle werden sich über dich den Kopf zerbrechen und so stellst du sicher, dass du dauerhaft einen Platz in den Gedanken der Menschen einnimmst. Eine subtile, aber effektive Form der Macht, denn mit der Zeit werden alle versuchen, dich glücklich zu machen, um nicht schon wieder einen komplett grauenvollen Abend zu erleben.
Keiner wird deine Macht infrage stellen, wenn du mit deinem Outfit bereits glasklar signalisierst, dass du über sie verfügst. Achte bei deiner Kleidung also unbedingt auf hochwertige Stoffe und gute Verarbeitung. Es reicht übrigens vollkommen aus, ein einziges wirk-
lich teures Kleidungsstück zu besitzen. Okay, vielleicht in mehreren Ausführungen. Die New Yorkerin Matilda Kahl trägt in der Werbeagentur, in der sie arbeitet, bei ihrem Job als Kreativchefin seit über zehn Jahren das gleiche Outfit. Ihr Look aus weißer Bluse mit kleiner Schleife um den Hals und schwarzer Hose ist mittlerweile ikonisch. Und ihre Kolleg:innen brauchten teilweise Wochen, um zu merken, dass sie jeden Tag das Gleiche trug. Noch ein Vorteil: Auf diese Weise spart man jeden Morgen Zeit. Pro-Tipp: das Outfit mit einem kleinen Rollkoffer kombinieren – egal wohin man unterwegs ist.
Dabei sollte man unbedingt betonen, dass man sofort noch einen Flieger oder Zug irgendwohin erwischen musst. Es ist egal, dass das nicht stimmt. Menschen werden gleich ganz anders auf dich reagieren. Und für dieses mächtige Gefühl braucht es keinen Uniabschluss – noch nicht einmal ein Job ist dafür vonnöten.
Niccolò Machiavelli, der alte Haudegen, hat es mit seiner Theorie der Macht, die er in »Il Principe« aufschrieb, sogar bis in die Psychologie geschafft. Dort beschreibt der »Machiavellismus« die Persönlichkeitsstruktur von kühlen und berechnenden Menschen, die dazu oft noch extrem ehrgeizig sind und andere zu ihren Zwecken manipulieren. Klingt erst mal superunangenehm? Ganz genau so soll es sein! Denn Macht ist nur bedingt etwas für Menschen, die Zugang zu ihrem Gefühlshaushalt haben. Also müssen wir da ran: Zunächst muss das Gefühl von Empathie ausgeschaltet werden. Übe Gefühlskälte, indem du warmherzige, aber ansonsten eher erfolglose Personen aus deinem Freundeskreis aussortierst, denn andere Menschen sind nur dann etwas wert, wenn sie uns ein Sprungbrett in mächtigere Sphären bieten. Oder uns den Machterhalt sichern. Andernfalls ist jeder Umgang mit ihnen nur Zeitverschwendung. Dieser Grundsatz wird uns nach und nach einsam machen. Und das ist perfekt! So können wir uns auf das konzentrieren, was wichtig ist: unseren Einfluss zu vergrößern und zu sichern. Wer braucht schon Freund:innen, wenn er Menschen um sich scharen kann, die aus rein strategischem Denken dazu gezwungen sind, alles dafür zu geben, uns zufriedenzustellen?
Hast du schon mal von einer unsicheren Person in einer Machtposition gehört? Wenn, dann wahrscheinlich nur, weil sie kurz danach spektakulär abgesägt wurde. Du brauchst Selbstbewusstsein, um es zu etwas zu bringen im Leben! Und wie das Wort Selbst-Bewusstsein schon sagt, ist es dafür essenziell, das Bewusstsein auf sich selbst zu richten. Pushe dich, indem du dir für jede Kleinigkeit ein
inneres High-Five gibst. Glaub dir, keiner bindet sich so elegant den Schuh und bedient so mühelos den Drehregler an der Heizung wie du. Kinder, die von ihren Eltern für jede Kleinigkeit Applaus bekommen, werden oft zu unsicheren Erwachsenen. Aber du bist schon groß und dir selbst ein unendlicher Quell an Beifall. So immunisierst du dich auch effektiv gegen jede Form von Kritik. Fehler sind etwas, was andere machen. Du lässt dich nicht unnötig kleinmachen, denn du bist zu Höherem berufen.
Schon Machiavelli wusste: Egal wie talentiert du bist und wie beflissen du daran arbeitest, um mächtig zu werden – um wirklich an Einfluss zu gewinnen, braucht es eine zusätzliche Kraft, die außerhalb deiner Kontrolle liegt. Es braucht Fortuna, Schicksal, einen glücklichen Umstand, um tatsächlich aufzusteigen. Das kann eine Entwicklung
sein, in der plötzlich genau deine Fähigkeiten gefragt sind, oder ein Machtvakuum, das sich jäh auftut. Thomas aus der Buchhaltung geht in Rente? Nutze die Chance und übernimm den Dienst in der Büroküche! Aber Vorsicht – Fortuna kann auch zu deinen Ungunsten wirken. Elon Musk hat von Fortuna profitiert, als seine zuerst etwas nischige Elektroauto-Vision auf einmal politisch und gesellschaftlich sehr gefragt war. Er wurde zum CEO-Superstar. Und beschloss, als Nächstes sei es eine megagute Idee, eine der wichtigsten digitalen Diskussionsräume zu übernehmen, ihre bisherige Struktur plattzumachen und die Welt mit rechten Hassbotschaften fluten zu lassen. Das führte zu einem erheblichen Imageschaden für ihn und das zwischenzeitlich führungslos gewordene Tesla sowie verheerenden Kursstürzen an der Aktienbörse. Wir lassen uns die Macht also nicht zu Kopfe steigen, Leute, okay? Wer die oben genannten Empfehlungen beherzigt, sollte diesbezüglich eigentlich safe sein.









Mohamed Bourouissa Périphérique
Der französisch-algerische Künstler Mohamed Bourouissa erkundet in seiner Fotoserie »Périphérique« (2005–2008) den sozialen und urbanen Raum der Pariser Vororte. Die Serie stellt die Spannung zwischen den marginalisierten Jugendlichen der Banlieues und den dominanten politischen Kräften der französischen Gesellschaft dar. In seinen kraftvoll inszenierten Fotografien erinnert Bourouissa an die klassische Historienmalerei und wirft ein neues Licht auf die Beziehungen zwischen Macht, Raum und sozialer Ausgrenzung.
Im Mittelpunkt von »Périphérique« steht der zuweilen aggressiv angespannte Umgang der staatlichen Autoritäten, der Polizei und gesellschaftlicher Normen mit der dargestellten Jugend. Bourouissa inszeniert Momente der Konfrontation und des Widerstands, in denen die Jugendlichen versuchen, ihre eigene Identität und Autonomie gegenüber den allgegenwärtigen Machtstrukturen zu behaupten. Die Protagonist:innen seiner Fotografien sind oft Menschen, die zurückgelassen wurden und sich an der Schnittstelle zwischen Integration und Ausgrenzung befinden. Diese Fotografien beleuchten das Machtgefälle, das nicht nur auf soziale Ungleichheit hinweist, sondern auch die visuelle Darstellung von Unterdrückten und ihren Handlungsräumen im kunsthistorischen Kontext thematisiert. Mit einem kritischen Blick auf Bilder in den Massenmedien bringen Bourouissas Kunstwerke Komplexität in die Darstellungen der heutigen Gesellschaft zurück.
T Stefan Gärtner
Die meisten Pläne sind schneller gemacht als ausgeführt, und also wärme ich mich seit Längerem an einem Buchprojekt, das sich unentscheidbaren Fragen widmen soll: Sind neue Plattenspieler besser als alte? Ist das muslimische Kopftuch Ausdruck persönlicher Religionsfreiheit oder misogyner Unterdrückung? Und ist die allüberall wehende Regenbogenfahne nun der verdiente Sieg queeren Aktivismus oder bloß Pseudorevolution und Beweis für die skeptische These, Gerechtigkeit sei im Kapitalismus nur als wohlfeil symbolische zu haben?
Vermutlich ruht das Projekt auch deshalb, weil es mich nirgends hinführt, denn dass es für die großen Fragen der Zeit kaum einmal Lösungen gibt, die keine Parteinahmen sind, ist ja seine Voraussetzung. Waffen für die Ukraine: die Verlängerung eines Krieges, den die Ukraine nicht gewinnen kann; keine Waffen für die Ukraine: Sabotage eines Widerstands, der völkerrechtlich nicht zu beanstanden ist. Identitätspolitik: nötig, weil Diskriminierung entlang von Race und Gender verläuft; schädlich, weil es Diskriminierung entlang der Besitzverhältnisse verschleiert. Gendersensible Sprache: gut, weil sie Deutsch als Männersprache dekonstruiert; schlecht, weil sie den geistfeindlichen Trend zum Konkret-Körperlichen bedient.
Da bleibt bloß die Erkenntnis, dass die einfache Wahrheit immer eine Lüge ist, es sei denn, jene würde lauten, dass es einfache Wahrheiten nicht gibt. Beispiel Nahost: Palästina hat das Recht auf Staatlichkeit, schön – aber auch als militant antisemitische? Die Nakba, die Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung nach der Gründung Israels, war Unrecht – aber war sie nicht Folge des arabischen Überfalls? Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten – aber doch mit einer rechtsextremen Regierung, nein? Man kann ewig so weitermachen, und es ist der sichere Weg in den Abgrund, sich vorbehaltlos auf der richtigen Seite zu wähnen, so wie der elitestudentische Nachwuchs, der in Harvard gegen einen Juraprofessor hetzte, weil er zu den Verteidigern Harvey Weinsteins zählte, der sich in
einem Rechtsstaat gerade dann verteidigen lassen darf, wenn das moralische Urteil längst gefällt ist. Den Campus schmückten Graffiti: »Down with Sullivan« und »Whose side are you on?«, denn wer nicht auf meiner Seite ist, hat nicht nur eine andere Meinung. Der ist ein Feind.
Von links ist das heikler als von rechts, weil auf der richtigen Seite zu sein der ganze Witz am Linkssein ist. »Sag mir, wo du stehst«, forderte ein bekanntes DDR-Propagandalied, und aus Sicht des dialektischen Materialismus war das nicht falsch gefragt: Stehst du auf der Seite der Besitzenden oder der Besitzlosen? Es gehört aber zur Wahrheit, dass der Realsozialismus als auf absehbare Zeit letzte Gelegenheit, der Kapitalherrschaft etwas entgegenzusetzen, an seinem »Wer nicht für uns ist, ist gegen uns« zerbrochen ist, so wie es zur Wahrheit gehört, dass die Verhärtung dieses Sozialismus zumal jenem feindlichen Weltkapital geschuldet war, das seinen Klassenstandpunkt kannte. Heute sollen die Verdammten dieser Erde, unterstützt von einer postkolonialen Linken, die ihren Kampf auf Marxens Überbau austrägt, wieder Geschichte schreiben, aber auch die Verliererperspektive ist keine neutrale, ist es vielleicht um so weniger, als man sich Neutralität leisten können muss. Als der Kongo-Ameisenpicker, ein kleiner afrikanischer Singvogel, nicht mehr »Jameson’s Antpecker« heißen sollte, weil sein Erstbeschreiber James Sligo Jameson ein kolonialer Rassist gewesen war, der eine indigene Gemeinschaft dazu gebracht haben soll, eine gefangene Zehnjährige aufzuessen, sah sich der westliche Blick dahingehend korrigiert, dass der Skandal allein im Auftrag und nicht in dessen prompter Ausführung zu liegen kam, und wenn die Forderung nach möglichst diverser »Pluralität« bloß heißt, auf dem anderen Auge blind zu werden, ist die Perspektive sicher eine andere, aber keine höhere.
So hat es die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann zu einer gewissen Berühmtheit gebrach, indem sie davor warnte, das Insistieren auf der Singularität von Auschwitz schließe die migrantischen Gewalterfahrungen heutiger Nichtjuden aus, der Syrer, Afghaninnen, Palästinenser. »Meinungspolizisten« sollten nicht verhindern dürfen, dass alle ihr eigenes Trauma ins sich auch erinnerungskulturell di-
versifizierende Deutschland tragen könnten, ohne Angst haben zu müssen, von »Ideologen« unter Hinweis auf den unvergleichlichen deutschen Zivilisationsbruch zum Schweigen gebracht zu werden. Der Vorteil für die deutsche Seele, die es immer gewusst hat, dass es auch nichtdeutsche Schuldkonten gibt, liegt auf der Hand, und um so befreiender, wenn einer von denen, deren nichtweiße Stimme so lang unterdrückt worden ist, die Opfer von einst als Täter von heute anzeigt. Es war nur konsequent, dass Assmann sich, wie viele andere, hinter den kamerunischen Historiker Achille Mbembe stellte, der Israel, Jahre vor dem von der Hamas mit ihrem OktoberÜberfall provozierten Gaza-Krieg, »Gemetzel, Zerstörung, schrittweise Ausrottung« vorwarf, woraus sich die Pflicht zur »globalen Isolation« ergebe, und wer immer auf den pluralistischen Effekt eines Endes weißer Dominanz gehofft hatte, wurde enttäuscht: Denn für die alte Erzählung von Juda als zu isolierendem Welthauptfeind muss man die Verdammten dieser Erde nicht zu Sicht- und Hörbarkeit befreien, es sei denn, man wünscht der Erzählung neues Gehör; weshalb sich queere Menschen in großer Zahl für ein »freies« Palästina einsetzen, dessen Freiheit darin bestünde, queere Menschen an den nächsten Baum zu hängen. Und aus dem richtigen Ansatz, dass die Welt, wie sie ist, eine Welt weißer Gewalt ist, wird der weniger richtige, dass deren Opfer als solche im Recht sind, ob sie nun Juden hassen oder Kinder essen. Als eine indonesische Künstlergruppe, stellvertretend für den sogenannten Globalen Süden, die Kasseler Documenta kuratieren durfte, kam sofort ein antisemitischer Skandal dabei heraus, und die Aufgeklärten, die die westlich-anmaßende Neigung zu »Othering« und »Orientalisierung« monieren, können nicht erklären, warum eine Muslima, die bei dreißig Grad im schwarzen Mantel steckt, während ihr Mann T-Shirt und Flipflops trägt, Produkt meiner Perspektive sein soll und nicht schlicht jenes Patriarchats ist, dem man sonst mit dem Genderstern zu Leibe rückt. Der andere Blick und die neue Stimme der Minderheiten führen also nicht direkt zu Wahrheit und Aufklärung, und das Interesse, das Identitätspolitik formuliert, wird den objektiven Anspruch auf Freiheit und Gerechtigkeit notwendig subjektivieren: Aktivismus ist, wenn
die Community recht hat, schlimmstenfalls im Internet, wo ein TransAktivist der Trans-Kritikerin Joanne K. Rowling vorwarf, sie plane geradezu einen »Genozid«. Wider diese »Kultur der Unerbittlichkeit« (Andreas Reckwitz) bilde ich mir dann immer ein, dass Rowling und ihre Gegner bei einer guten Tasse Tee mal über alles hätten reden können, statt sich per Twitter gegenseitig Faschismus vorzuwerfen, wie ich als guter Liberaler und obendrein Dialektiker sowieso keine andere Wahl habe, als für eine Pluralität zu stehen, mit der die Dialektik erst anfängt. Theodor Fontanes alter Stechlin wusste, dass es etwas ganz Richtiges nicht gibt, und wer sich eine Meinung bilden will, tut das am besten anhand zweier ganz konträrer: So fand zuletzt ein postkolonialer Reader, die vielbeschriebene »Clankriminalität« gebe es gar nicht, sie werde von Medien, Polizei und Politik gegen jede Statistik als rassistischer Popanz aufgebaut; gleichzeitig erschien der Erfahrungsbericht einer türkischen Deutschen, die, als »Insiderin«, nicht unplausibel von ebendiesen Clanstrukturen berichtete, von organisierter Kriminalität und nackter androzentrischer Gewalt. Vielleicht ist es nicht feige, sondern weise, hier nicht zu fragen, wer recht hat, sondern zwei Wahrheiten zu akzeptieren, die einander ja nicht ausschließen müssen, sondern konturieren können: Sicher ist die geflissentliche Rede vom »Ehrenmord« Teil kulturalistischer Zuschreibungen, denn wenn ein abendländischer Deutscher aus Eifersucht mordet, ist der Besitzanspruch derselbe. Das macht einen Mord, der aus einem Quatsch wie »Familienehre« verübt wird, aber nicht ungeschehen, und es wäre eine seltsame Ironie, wenn eine Stimme, die davon berichtet, im Sinne eines neuen, jetzt postkolonialen Hegemonieanspruchs unterginge.
Wir sind mehr
Entschuldigt bitte, dass wir hier in der Mehrzahl, also quasi im Pluralis Majestatis zu euch sprechen, aber erstens sind wir deutlich mächtiger als ihr und zweitens ergeben wir im Singular, als Einzelnes also, schlichtweg keinen Sinn.
Entschuldigt bitte weiter, dass im Laufe dieses Plädoyers detailliert die Rede sein wird von Knötchen im menschlichen Atmungsorgan, ein Umstand, der sich in jene der zarteren Seelen, die das hier lesen, als Erinnerung regelrecht einfräsen kann, fast so, als wäre der Blick ungeschützt in die Sonne gefallen. Deshalb an dieser Stelle eine – wie heißt das noch gleich? – Triggerwarnung, verbunden mit der Empfehlung, vielleicht besser nicht weiterzulesen.
Erlaubt, dass wir uns erst einmal vorstellen. Wir sind’s, der weiße Tod. Die tödlichste Infektionskrankheit aller Zeiten. Eine Geißel der Menschheit. Grund für das Ableben von eins Komma drei Millionen Menschen allein im vergangenen Jahr. Oder, falls Sie von großen Zahlen nicht genug bekommen können: Ursache von einer Milliarde vorzeitig beendeter Menschenleben seit dem Jahr 1900. Darunter George Orwell, Simone Weil und Franz Kafka. Gestatten: Tuberkulose.
Die Wissenschaft kennt uns unter dem Namen Mycobacterium tuberculosis. Wir sind Einzeller, die als Parasiten diffamiert werden, treten aber selbstverständlich nicht einzellend auf. Vielleicht liegt hier, wenn wir es recht bedenken, der eigentliche Unterschied zwischen euch und uns: dass wir uns des zellulär-kollektiven Aspekts unserer Existenz bewusst sind, während ihr das vergessen oder verdrängt habt und der Illusion nachhängt, Individuen zu sein, von der Außenwelt des restlichen Universums durch Schleim und Haut aseptisch getrennt. Vergessen habt ihr, dass das, was ihr Körper nennt, auch nur eine Ansammlung einzelner Zellen ist, also im Kern nichts anderes als wir. Zugegeben, das Zusammenspiel eurer kleinsten Bausteine erscheint wohlorchestriert und ist ganz manierlich anzusehen, nur leider habt ihr trotz oder wegen eures großen Gehirns, das euch die ganze Zeit ein Ego vorgaukelt, vergessen, dass ihr bestimmt zur Hälfte gar nicht ihr selbst seid, weil ihr kolonisiert wurdet von Myriaden eigenständiger und manchmal auch eigensinniger Kleinstlebewesen wie uns, die an oder in euch eine kollektive gleichberechtigte Existenz führen.
T Eine Fabel von Christian Gottwalt
Was ihr als Körper erlebt, ist bloß ein Kommen und Gehen von belebter und unbelebter Materie in allen verfügbaren Aggregatzuständen. Ein Werden und Vergehen, denn das ist der Lauf der Dinge hier auf diesem Planeten, seit der Ursuppe, in der wir gemeinsam schwammen vor Milliarden von Jahren. Wart ihr nicht die Mikrobe, die den Sex erfunden hat, indem sie auf die Idee kam, das soeben einverleibte andere Mikröbchen nicht zu verdauen, sondern mit ihm zu kooperieren und sich erst nach Bildung eines gemeinsam gemischten Erbgutes zu teilen? Coole Idee. Na ja, lange her.
Heute lebt ihr mit vielen mikrobiellen Begleitern harmonisch zusammen, mit manchen sogar symbiotisch, sodass sie aus eurer Sicht friedlich erscheinen. Mit uns lebt ihr nicht so, denn mit uns seid ihr im Krieg. Ihr mit uns, wohlgemerkt, nicht wir mit euch. Denn uns geht es nicht ums Siegen oder Zerstören, um Vorherrschaft oder Macht. Das sind Konzepte, die durch eure Köpfe schwirren und sie vernebeln, während wir unbemerkt durch eure Körper schwimmen und uns vermehren. Uns käme es nicht in den Sinn, übereinander herzufallen. Oder uns, motiviert durch krude Ideologien, darüber zu streiten, wer nun welches Lungenbläschen besiedeln darf. Wir agieren als Kollektiv und Kooperation ist unsere Stärke. Nur mit euch kooperieren wir nicht. Wir mögen ein Erreger öffentlichen Ärgernisses sein, doch wir setzen keine moralische Agenda, wir verfolgen keinen Plan und wir bestrafen niemanden. Wer uns in sich trägt, trägt daran keine Schuld.
Aus unserer Sicht ähnelt ihr eher Ökosystemen und Lebensräumen, die wir besiedeln, die uns nähren, uns die kollektive Fortpflanzung erlauben und uns durch Raum und Zeit tragen. Für uns seid ihr das, was für euch die Erde ist, jeder Mensch ein eigener Planet. Hundert Milliarden Exemplare von euch haben im Lauf der Äonen diesen Planeten besiedelt, hundert Milliarden Exemplare von uns passen in die Tränen, die ihr vergießt, wenn die Besiedelung eines euch emotional nahestehenden Wesens durch uns außer Kontrolle geraten ist.
Der Kontrollverlust bewirkt einen Kollateralschaden. Vorsätzlich den eigenen Lebensraum zu zerstören? Geh, bitte. So etwas macht doch nur ihr, oder? Lebt ihr etwa in friedlicher Koexistenz mit dem euch
ernährenden Ökosystem? Wir wollen nicht zu sehr schimpfen, denn auch in dieser Ambivalenz ähneln wir uns. Denn hin und wieder machen wir das Gleiche mit euch, was ihr mit dem Planeten macht: exponentielles Wachstum, bis das Gesamtsystem nicht mehr kann. Aber anders als ihr Menschen, die ihr immer etwas sofort wollt und alles verzehrt und verbrennt, als ob es kein Morgen gäbe, weil ihr eure Triebe namens Hunger, Gier und Sex nicht mäßigen könnt, anders als ihr also, nehmen wir uns Zeit. Wir vermehren uns durch Teilung – schwupps, sind wir zu zweit – aber wir erlauben uns das nur einmal alle vierundzwanzig Stunden. Andere Mikroben mögen über unser gemächliches Tempo spotten. Wir finden: In der Ruhe liegt unsere Macht.
Sobald unsere Raumkapsel, dieses für euch unsichtbare Wassertröpfchen, an der Schleimhaut eurer Lunge landet, haben wir gewonnen. Hach ja, das Anlanden in einer gesunden Lunge. Bei uns löst dieser Gedanke vermutlich die gleiche Vorfreude aus wie bei euch die Fantasie von einem einsamen Sandstrand oder unberührten Tiefschneehang. Aber wie das so ist mit dem Paradies: Lange bleibt man nicht allein. In unserem Fall treten Makrophagen auf den Plan, Riesenfresszellen eures Immunsystems, und sie tun, was ihnen aufgetragen und einprogrammiert wurde: uns fressen.
Doch uns macht das Gefressenwerden nichts aus. Von außen betrachtet könnte man fast meinen, das sei Teil unseres Plans, denn unsere Außenhaut besteht aus einer wachsähnlichen Schicht, durchsetzt mit langfettigen Fettsäuren, die unseren Namen tragen, und beide Substanzen bewirken, dass eure Abwehrzellen uns zwar fressen, aber nicht verdauen können. Wir sind resistent gegen die Säure, in der eure Fresszellen Eindringlinge üblicherweise auflösen. Während wir uns in aller Gelassenheit vermehren, eilen immer mehr weiße Blutkörperchen und Lymphozyten heran, schließen uns ein und kapseln uns ab. Mit der Zeit bilden wir im Kampf mit und gegen eure Fresszellen etwas, das ihr Granulom nennt, eine Art Gefangenenlager für unliebsame Eindringlinge. Und im Kern eines Granuloms tobt eine Schlacht. Wer setzt sich durch? Eure hauseigene Immunabwehr oder wir, die Eindringlinge?
In einem »soliden Granulom« behalten eure Zellen die Oberhand.
Die Infektion endet mit einem Patt. Wir vermehren uns nicht weiter, weil uns der Sauerstoff ausgeht, und fallen in eine Art Winterschlaf, während eure Immunzellen uns gefangen halten.
Doch manchmal bilden wir im Lager einen unkontrollierbaren Kern aus, eine Nekrose. Das ist unser Friedhof, denn wir leben ja auch nicht ewig. »Verkäsende Nekrose« haben eure Mediziner diese Kerne in ihrem Endstadium genannt, ein recht bildhaft-saftiger Begriff, wie wir meinen, weil wir in diesem Zustand an Weichkäse erinnern. Wir haben uns in ein Potpourri aus toten Wirtszellen und abgestor-
benen Keimen verwandelt. Ein hervorragender Nährboden für neue kleine Mycobakterien, süß.
Wie eingangs erwähnt, mag die Vorstellung einer Lunge, die von Knötchen durchsetzt ist, die mit weichkäsiger Masse gefüllt sind, recht ekelhaft erscheinen, aber so endet die Besiedelung durch uns in den allermeisten Fällen nun mal. Das ist die Natur.
Solide Gefangenenlager, die in einem Gleichgewicht des Schreckens verharren, existieren in jedem vierten Menschen. Ja, sie haben richtig gelesen: Zwei Milliarden Menschen auf diesem Planeten halten wir auf diese Weise besetzt. Ein Zustand, der Jahre anhalten kann oder Jahrzehnte. Wir haben es nicht eilig.
Doch hin und wieder brechen wir aus. Im Kollektiv reißen wir dann die Mauern unserer Gefangenenlager nieder, breiten uns explosionsartig aus und versetzen eure Körper in Alarm. Dann fühlt ihr euch krank. In diesem Zustand, den ihr »offene Tuberkulose« nennt, werden wir lebensbedrohlich für euch. Zwischen einer und zwei Millionen Menschen hauchen jedes Jahr ihr Leben aus wegen uns, weil wir ein Organ nach dem anderen besiedeln.
Flüssigkeit steht in der Lunge. Euer Immunsystem reagiert panisch. Und längst tut ihr das, was wir wollen: husten, manchmal mit Blut darin. Ihr hustet und hustet und hustet Myriaden kleiner Tröpfchen in die Welt hinaus. Tröpfchen, in denen wir zu Abertausenden sitzen und in denen wir durch die Luft schweben, in der nur selten erfüllten Hoffnung, von einem unbekannten Mund in eine neue Luftröhre gesaugt zu werden und an einer gesunden Lunge anzulanden. Es sind die Schwachen und Unterernährten unter euch, die auf engstem Raum leben müssen und sich keinen Arzt leisten können,
deren geschwächte Immunsysteme uns nicht unter Kontrolle halten können. Vor allem in Asien und den Kontinenten des Südens besiedeln wir die Menschen. Und weil die dort arm gehalten werden von den Stärkeren unter euch, können sie sich die Medikamente nicht leisten, mit deren Einnahme sie uns besiegen könnten. In Nordamerika hat eines von achtundreißigtausend menschlichen Wesen eine offene Tuberkulose. In Deutschland eines von zwanzigtausend. In Indien eines von fünfhundert. Und unter den Obdachlosen von Delhi eines von zwölf.
Ihr könnt Lungen durchleuchten lassen mit Geräten, die in einen Rucksack passen. Ihr habt intelligente Computer, welche die Bilder genauso gut deuten können wie ein Facharzt. Ihr habt neue Antibiotika, die billiger sind und schneller wirken, sodass sie nicht länger über Monate täglich eingenommen werden müssen. Ihr habt Schnelltests und bald sogar einen neuen Impfstoff. Ihr habt alle Waffen, die ihr braucht, in der Hand. Und ihr drückt nicht ab.
Anstelle eines kollektiven, globalen medizinischen Kraftaktes bezahlt ihr lieber Heerscharen von Schönheitschirurgen. Es gibt nicht genug Profit zu machen mit einem neuen Antibiotikum, das ist der unmenschliche Grund. Dabei sind wir es doch gewesen, die euch Frauen in den Augen von euch Männern schön gemacht haben: blasser Teint, eingefallene Wangen und große, traurige Augen. Schaut euch im Bahnhofskiosk die Titelbilder der Modemagazine an, dann könnt ihr uns sehen. Und wenn ihr das nicht glaubt, googelt mal »Schwindsucht und Schönheit«. Nein, tut es lieber nicht. Wir entgehen eurer Aufmerksamkeit, weil wir keine Sensation sind wie Covid-19, das euch kollektiv in Panik versetzt hat. Ihr Angsthasen!
Und der schwarze Tod, na ja. Wir hatten nie so einen großen Auftritt wie dieses Corona-Virus und stehen nicht so prominent im Geschichtsbuch wie die Pest. Wir begleiten euch, seit ihr das Feuer erfunden habt. Und doch seid ihr, bei all eurer technologischen Überlegenheit, nicht mitgewachsen. Weil ihr nicht kollektiv denken und handeln könnt. Ihr seid viele kleine Ichs. Wir sind noch kleiner, aber wir sind ein großes Wir.
Und? Wer ist jetzt stärker?
Der Ausfall
Die Wetterfrösche im Fernsehen, immer auf der Suche nach neuen Katastrophen, um die Einschaltquoten zu steigern, hatten für Neuengland einen heftigen Herbststurm mit peitschendem Regen und starken Böen vorhergesagt. Brad Morris, der von zu Hause aus arbeitete, während seine Frau Jane eine Boutique in der Newbury Street in Boston leitete, blickte ab und zu aus dem Fenster auf die sich wiegenden Bäume – hartnäckige Eichen, die an ihrem rostfarbenen Laub festhielten, und Ahornbäume, die ihre Blätter in rotgoldenen Böen von sich warfen – und blieb dennoch unbeeindruckt von dem hochgespielten Wetterereignis. Es regnete jede halbe Stunde heftig und zog sich dann zusammen zu einem silbrigen Himmel gespickt mit schnell dahinschwindenden Flauschewolken. Das Schlimmste schien vorbei zu sein, als gegen Spätnachmittag sein Computer vor seinen Augen den Geist aufgab. Die Finanzzahlen, die er mühsam zusammengetragen hatte, schmolzen im Einklang dahin und wurden von dem toten, leeren Bildschirm aufgesogen wie das schillernde Wasser in einem Abfluss. Das Haus um ihn herum schien zu seufzen, als alle Lichter und Antriebsysteme, alle computergesteuerten Schalter und Anzeigen gleichzeitig abschalteten. Das Klangbild von Wind und Regen, das draußen gegen die Bäume peitschte, durchdrang die Stille. Ein Balken knarrte. Ein loser Fensterladen knallte. Das Tropfen einer verstopften Dachrinne klopfte durchdringend auf die hölzerne Abdeckung eines Kellerfensterschachts, wie ein nerviger kleiner Junge, der nach Aufmerksamkeit sucht.
Die Leitungen, die das Morris’sche Haus mit Strom, Telefon und Kabelfernsehen versorgten, verliefen auf drei Masten durch knapp einen Hektar Wald. Brad trat während einer Sturmflaute hinaus in die seltsam leuchtende Luft, um zu sehen, ob er Äste entdecken konnte, die auf die Leitungen gefallen waren. Er sah keine und auch kein Licht im nächsten Haus, das durch den Wald, dessen Blätter es im Sommer vollständig verbargen, kaum zu sehen war. Die Wipfel
T
der höchsten Bäume wogten in einem Wind, den er kaum spürte; ein Kegel dicker, kalter Tropfen scheuchte ihn zurück ins Haus, wo sich Schattenschwaden in die Ecken verkrochen und der Ofen im Keller klackerte, während sein Metall abkühlte. Ohne Strom gab es nichts zu tun. Er öffnete den Kühlschrank und war überrascht, dass kein einladendes Licht ihn aus dem Inneren begrüßte. Der Kamin im Wohnzimmer gab den sonderbar sauren Duft von feuchter Asche ab. Der Wind pfiff aus unbekannten Spalten am Dach und entlang der Fenster. Er fühlte sich machtlos und belächelte seine Machtlosigkeit in dieser Notlage. Er dachte an die Briefe, die er zu der kleinen Poststelle im Zentrum seines Vororts bringen wollte, und an den Scheck, der zur Bank musste. Es gab also doch noch etwas zu tun: Er sammelte die Papiere zusammen, zog den Reißverschluss seines beigefarbenen, wasserfesten Mantels hoch und setzte sich ein Red-SoxCap auf. Der Alarm an der Haustür fiepte und blinkte sanft vor sich hin. Brad hieb auf die Neustart-Taste und das Gerät gab Ruhe. Es war ein komisches Gefühl, als das Auto wie gewohnt startete. Nasse Blätter zementierten die Einfahrt und die Schotterstraßen der Wohnsiedlung; die Gebäude waren damals, vor zwanzig Jahren, in einem Zug auf dem Gelände eines ertraglosen Bauernhofes erbaut worden. Er fuhr vorsichtig, vor allem um den Ententeich neben der verblassten Scheune, wo in einem Schneesturm vor zehn Jahren ein Teenager mit dem Mercedes seiner Eltern durch einen Holzzaun geschlittert und bis zu den Radkappen im Schnee versunken war. Das Ortszentrum – zwei Kirchen, eine Apotheke, ein Dunkin’ Donuts, ein Pizzaladen, ein vorwiegend italienisches Restaurant, zwei Kosmetikstudios, ein Kleidungsgeschäft und ein Laden für Hochzeitskleider, ein paar Geschäfte, die in immer wieder leer stehenden Räumlichkeiten regelmäßig eröffneten und schlossen, ein Versicherungsmakler und eine Anwaltskanzlei in der Etage über dem Immobilienbüro, ein Zahnarzt, eine Bankfiliale und die Post – war ebenfalls ohne Strom, dafür belebter als sonst, die Gehwege geschwollen mit Passanten in der aufglimmend grauen Windstille.
Brad blickte überrascht zu zwei jungen Frauen, die sich umarmten und dann unterhielten, als ob sie im Begriff wären, eine längst vernachlässigte Bekanntschaft wiederzubeleben. Menschen standen
da und diskutierten ihr Schicksal in kleinen Gruppen. Die für gewöhnlich hellen Schaufenster waren dunkel und ihm wurde klar, dass der Stromausfall die Menschen auf den Bürgersteig gespült hatte. Der Biomarkt, die Regale voll mit Nussvariationen und Multivitaminpräparaten und die Kühlfächer voller Tofu-Sandwiches, und der Gemüseladen, der Rivale in Sachen gesunder Ernährung auf der anderen Straßenseite, standen beide wie Höhlen abweisender Dunkelheit am Straßenrand.
Er hatte nicht daran gedacht, dass die Bank, deren Automat für sein Geld gewöhnlich so aufnahmebereit waren, per Aushang an der Tür auf die nächste Filiale verweisen würde, und dass er, obwohl er die Kassierer auf der gepolsterten Sitzbank, wo sonst Hypothekenantragsteller und Überziehungstäter schmachten, beim Plaudern beobachten konnte, genauso wenig Hand an sein Geld legen konnte wie an Fische in einem Aquarium. Die Filialleiterin, eine nervöse Frau von hoher Statur in einem strengen Anzug, patrouillierte auf dem Gehsteig. Atemlos wandte sie sich zu Brad: »Es tut mir sehr leid, Mr. Morris. Unser Geldautomat, die Alarmanlage, alles ist ausgefallen. Ich wollte eben nachsehen, ob der Baumarkt Strom hat.« »Myra, ich glaube, wir sitzen alle im selben Boot«, beruhigte Brad sie; doch er verstand ihre Skepsis. Er selbst hatte nicht erwartet, dass zwar die Postschließfächer und die innen gelegenen Briefkästen frei zugänglich waren, die Post selber für Transaktionen aber geschlossen sein würde; alles war von einem eifrig modernisierenden Postdienst auf Computer umgestellt worden, und jetzt konnte kein einziger Brief gewogen oder eine einzige Briefmarke verkauft werden, selbst wenn es hell genug gewesen wäre, um etwas zu sehen. Der Nachmittag wurde dunkler. Da er Gefahr lief, überhaupt keine Besorgungen erledigt zu kriegen, versuchte er es an der Tür des Bioladens. Der Riegel öffnete sich und er hörte ein Kichern im Schatten. »Habt ihr geöffnet?«, rief er.
»Für dich: na sicher«, antwortete die Stimme der jungen Besitzerin, der lockigen, immer sonnengebräunten Olivia. Brad tastete sich nach hinten, wo eine einzelne gedrungene Duftkerze Behälter mit kleinen Plastiktüten beleuchtete; sie schimmerten mit tropfenförmigen Reflexionen. Er brachte eine Tüte zur Theke, von der er hoffte, sie sei
mit gerösteten, aber ungesalzenen Cashewnüssen gefüllt. »Die Kasse ist leer. Spenden werden angenommen«, scherzte Olivia und holte Wechselgeld aus ihrer eigenen Geldbörse für einen Schein, von dem er, als er ihn dicht vor die Augen hielt, feststellte, dass es eine Fünf-Dollar-Note war. Die Transaktion war ihm kokett vorgekommen, und die Atmosphäre in der Innenstadt unter den herabhängenden Girlanden aus nutzlosen Kabeln schien festlich. Autos paradierten mit lodernden Scheinwerfern vorbei. Eine bedrohliche Verdichtung der Luft veranlasste die Fußgänger, wieder Schutz zu suchen. Es herrschte ein Überfluss an Gutmütigkeit und Transparenz: Etwas Verdeckendes war entfernt worden und hatte vernachlässigte Möglichkeiten enthüllt. Brad eilte zurück in den Schutz seines Autos und lachte voll irrationaler Freude. Frische Tropfen besprenkelten seine Windschutzscheibe, als er durch einen Durchbruch in der Steinmauer, die einst die Grenze des Hofes markiert hatte, in die Siedlung einbog. »Privatweg«, hieß es streng auf einem aufgemalten Schild. Eine Frau in Weiß – in einem glänzenden Vinyl-Regenmantel und albern aussehenden weißen Laufschuhen – ging mitten auf der schmalen Straße. Mit flatternden Gesten deutete sie ihm, anzuhalten. Er erkannte eine noch recht neue Nachbarin, eine schmale Blondine, die vor ein paar Jahren mit ihrem Mann und zwei heranwachsenden Jungen in ein Haus gezogen war, das von den Morrises aus nicht zu sehen war. Sie trafen sich nur ein paar Mal im Jahr, auf Cocktailpartys oder bei Anhörungen des Bezirksausschusses. Sie sah aus wie ein lockender Geist. Er bremste und ließ das Autofenster herunter. »O, Brad«, sagte sie mit atemloser Erleichterung. »Du bist es. Was ist los?«, fragte sie. »Bei mir ist der Strom ausgefallen, sogar die Telefone.«
»Meine auch«, beruhigte er sie. »Alle. Irgendwo muss bei diesem Wind ein Baum auf eine Stromleitung gefallen sein. Solche Dinge passieren einfach, Lynne.« Er war froh, ihren Namen aus den Tiefen seines Gedächtnisses geangelt zu haben: Lynne Willard. Sie trat näher an sein offenes Fenster und er konnte sehen, dass sie tatsächlich zitterte, ihre Lippen tasteten nach Halt wie die eines Kindes, das den Tränen nahe ist. Ihr Blick wanderte über den Horizont
seines Autodachs, als suchte sie die Baumwipfel nach Rettung ab. Sie richtete den Blick zurück auf sein Gesicht und erklärte mit schwacher Stimme: »Willy ist weg. Die ganze Woche in Chicago. Ich bin ganz alleine da oben, jetzt, wo die Jungs im Internat sind. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also hab ich mir Turnschuhe angezogen und bin losgelaufen.«
Brad hatte die Jungs als durchtrieben und neugierig in Erinnerung; in Blazern warteten sie täglich am Ende der Straße auf den Schulbus, direkt vor der eingestürzten Steinmauer. Wenn sie nun alt genug für das Internat waren, dann konnte diese Frau nicht so jung sein, wie sie wirkte. Ihr Gesicht, verschmälert durch den Einsatz eines geknoteten Kopftuchs, war weiß, bis auf die Nasenspitze, die rosa wie die eines Kaninchens in ihrem Gesicht prangte. Ihre Augenlider waren ebenfalls rosa, verrieben und vertränt. »Ich mag dein Cap« sagte sie, um die anhaltende Stille zu füllen. »Bist du Fan?«
»Nicht mehr als jeder andere.«
»Sie haben die World Series gewonnen.«
»Stimmt. Steig ein, Lynne«, sagte er mit ansteigender Beruhigungskraft. »Ich fahre dich nach Hause. In der Innenstadt gibt es nichts zu tun. Niemand weiß, wie lange der Stromausfall andauern wird. Nicht einmal bei der Bank und der Post wussten sie es. Das Einzige, was geöffnet hatte, war der Bioladen.«
»Ich wollte spazieren gehen«, erwiderte sie, als hätte sie diese Tatsache noch nicht ganz klar etabliert. »Das kann ich immer noch.«
»Siehst du das nicht? Es fängt wieder an zu regnen. Der Himmel entlädt sich gleich schon.«
Blinzelnd presste sie die Lippen zusammen, um ihr Zittern zu unterdrücken – die Unterlippe verspürte den Zwang, seitwärts zu zucken–und ging vor seinen Scheinwerfern herum. Er beugte sich über den Beifahrersitz, um ihr die Tür zu öffnen, als ob sie dazu nicht selbst in der Lage wäre. Sie glitt im glitschigen weißen Vinyl über den Sitz und gestand, »Ich musste dem Piepen im Haus entkommen. Willy ist nicht einmal in Boston, wo ich ihn anrufen könnte.«
»Wahrscheinlich eure Alarmanlage«, erklärte ihr Brad. »Oder ein anderer Alarm, der nicht gern ohne Strom sein möchte. Ich komme rein, wenn ich darf, und sehe mir das Problem an.«
Sie hatte einen angenehmen Duft ins Auto gebracht, einen Geruch aus seiner Kindheit, wie Hustenbonbons oder Lakritze. »Darfst du«, sagte sie und entspannte sich in seinem ledernen Autositz. »Ich hatte solche Angst«, fuhr sie mit einem schiefen Lächeln fort, als müsste sie über sich selbst lachen, oder über eine längst vergessene Version ihrer selbst.
Er war noch nie bei den Willards gewesen. Ihre Einfahrt war von einer sorgfältiger durchdachten Bepflanzung gesäumt – knorrige, laublose Azaleen und Spindelsträucher im surreal schmetternden magentafarbenen Herbstkleid – als die der Morrises. Den Parkbereich bedeckten größere und weißere Steine als die braunen Kieselsteine, auf denen Brads Frau bestanden hatte, trotz der Tendenz dieser Kiesel, (auf die er hingewiesen hatte), sich im Winter beim Schneeräumen im Rasen zu verteilen. Doch das einfache Haus, ein zwanzig Jahre altes, gut dimensioniertes, mit Schindeln verkleidetes neokoloniales Haus mit einem unnötigen Streifen Backsteinfassade, sah seinem sehr ähnlich. In ihrer fliehenden Panik hatte Lynne vergessen, die Haustür abzuschließen. Ihr folgend, staunte Brad, wie geschmeidig und flink sie die Stufen der Steinveranda hinaufstieg und ihm die Sturmtür aufhielt, während sie die andere öffnete. Drinnen war das Piepen deutlich und eindringlich, aber es war nicht das immer lauter werdende Blöken einer akuten Alarmstufe. Er wandte sich in die falsche Richtung; der Grundriss des Hauses war anders als bei seinem: Das Wohnzimmer lag links anstatt rechts, die Küche dahinter, nicht daneben. Die Einrichtung war jedoch fast die gleiche, modern von vor zwanzig Jahren, kastenförmig und gepolstert, aus Naturholz und einfarbiger Wolle, Couchtische aus dickem Glas auf gekreuzten Edelstahlgestellen, kombiniert mit Familienerbstücken und Perserteppichen. Diese wirkten schicker und weniger abgenutzt als die in seinem Haus, aber Brad neigte dazu, das zu verherrlichen, was andere Leute hatten. »Hier drüben«, sagte Lynne, »neben dem Schrank« – genau dem Schrank im Flur, in den sie gerade ihren Vinylmantel hängte. Das eng anliegende graue Strickkleid, das sie darunter trug, sah für ihn aus, als käme sie gerade von einem Damen-Brunch. Mit den Zehen streifte sie ihre Turnschuhe ab, ohne sie aufzuschnüren – womöglich
wollte sie sich nicht vor seinen Augen bücken müssen – und deponierte sie auf dem Schrankboden.
»Ja«, sagte er und drehte sich zum Bedienungsfeld. »Genau wie meins.« Er hob die Hand, um es anzufassen, hielt dann inne und fragte: »Darf ich?«
»Klar«, sagte sie und trat näher. Sie klang in ihrem eigenen Haus lässiger, ihre Stimme hatte ihr Zittern verloren. »Fühl dich ganz wie zu Hause!«
Er drückte den kleinen rechteckigen Knopf mit der Aufschrift »Reset«. Das Piepen hörte abrupt auf. Dicht hinter ihm klang sie beeindruckt, »Das war alles?«
»Offensichtlich«, sagte er. »So weiß die Alarmanlage, dass der Ausfall kein Einbruch war. Nicht, dass ich mich mit Technik besonders gut auskennen würde.«
Sie kicherte aus einer unbekannten Freude heraus. Er erkannte, dass der Duft aus dem Auto Alkohol enthielt, gemischt mit Lakritz. »Willy ist so ein Arsch«, sagte sie zu Brad. »Er weiß, wie alles geht, und erklärt es mir nie. Sag mal«, fuhr sie fort, »aus deiner Sicht als Mann: Muss er denn wirklich so lange in Chicago sein?«
Brad sagte vorsichtig: »Geschäfte können viel Zeit in Anspruch nehmen. Ab einem gewissen Punkt müssen sich Businessmänner – Businessfrauen auch, natürlich – gegenüberstehen und gegenseitig in die Augen schauen. Früher saß ich selbst ständig im Flieger und hatte Besprechungen und all das ganze Zeug, aber ich fand Homeoffice dann einfach effizienter. Digital kommunizieren kann man überall, da besteht eigentlich keine Notwendigkeit, das Haus zu verlassen. Aber ich weiß ja gar nicht, was Will – Mr. Willard – genau macht.« Seine nervös wortreiche Erklärung schien in dem unbekannten Haus nachzuhallen, oder vielmehr zu verblassen, in den teilweise fremden Räumlichkeiten; die Laute versickerten in den vielen kleinen Unterschieden zwischen diesem Haus und seinem eigenen. Der von ihm prophezeite Regen war zurückgekehrt. Draußen flüsterte und trommelte er vor sich hin und vertiefte nach innen den Schatten der Dunkelheit. Der Wind peitschte stoßartig Regenperlen gegen die Fenster.
»Ich auch nicht. Möchtest du etwas trinken?« fragte die Frau, selbst
nervös. Sie fügte mit einem weiteren Kichern hinzu: »Nachdem du schon herkommen musstest.« Sie zeigte in Richtung der ruhig gewordenen Küche. »Kaffee kann ich leider nicht machen.«
»Was hast du getrunken?« fragte Brad sie. Ihre Augen weiteten sich, als suchten sie nach dem fehlenden Licht. »Woher weißt du, dass ich überhaupt etwas getrunken habe? Meine Freundinnen und ich haben unseren Mittagstisch mit einer Anisette besiegelt.«
»Im Auto«, antwortete er, »hast du süß gerochen«, und trat näher, als wollte er sich davon überzeugen. Ihre Küsse schmeckten nicht nach Lakritz. Dort im Wohnzimmer, wo der leere Blick des Plasmafernsehers auf sie starrte und die Tageszeitung, immer noch in ihrer Plastikhülle, ungelesen auf dem Sofa lag, küsste Lynne trocken und vorsichtig, als würde sie einen neuen Lippenstift ausprobieren. Dann gewöhnten sich ihre Lippen an die neue Passform; ihr Gesicht drückte sich in seines und ihre unruhigen Hände umklammerten seinen Rücken, hielten sich an seinem Kreuz und seinem Nacken fest, und Brad fragte sich benommen ob er nicht schon zu weit, zu schnell vorgeprescht ist. Aber nein, versicherte er sich, es war nur menschlich, ja, harmlos, diesen schützenden Kontakt zu suchen, während der Regen draußen prasselte und sich die Lichter im Haus allmählich in kaum erkennbaren Stufen dimmten. Sein Impuls war, ihr Haar an den Stellen zu glätten, an denen es vom Kopftuch zerzaust und zerdrückt worden war. Seine Hände zitterten, wie zuvor ihre Lippen gezittert hatten. Ihre Gesichter brannten, und die Zärtlichkeiten fühlten sich über der Kleidung unbeholfen an. »Wir sollten hochgehen«, raunte sie ihm zu. »Es könnte uns jemand sehen.«
»Wer wird bei diesem Wetter schon vorbeikommen?« fragte er. »Er bekommt viele Fedex-Sendungen geschickt«, sagte sie. Die Treppe vor ihm hinaufsteigend – sie war mit blassgrünem Teppich belegt und nicht mit kastanienbraunem wie Janes – sprach Lynne mit nicht zugeordnetem Pronomen weiter: »Er ruft jeden Tag ungefähr um diese Zeit an. Wahrscheinlich räumt er sich so seinen Abend frei.«
»Ja, er hat irgendein billiges System einbauen lassen, bei dem alle Kabel zusammenhängen. Ich verstehe es nicht ganz. In unserem neuen Auto kann ich nicht einmal die Radiosender einstellen. Man hat jetzt zu viele Optionen.«
»Ja«, stimmte er ihr zu.
Auch oben hatte das Haus einen anderen Grundriss als seines, das Zimmer, in das sie ihn führte, war kahler und kleiner, als es das Hauptschlafzimmer gewesen wäre. Die Fotos auf der Kommode zeigten ihre Jungs in verschiedenen Altersstufen sowie ältere Menschen in jungen Jahren, im Stil der fünfziger Jahre gekleidet – vermutlich ihre Eltern, oder die von Willy. Die Farben der verschiedenen eingerahmten Urlaubsfotos waren verblasst, die Stimmung verschoben. An der Wand hing ein Poster von einer Frau, die sich, nur in ein Tigerfell gehüllt, auf einem Lamborghini räkelte.
»Schau mal«, sagte sie. »Jetzt, wo die Blätter weg sind, kann man dein Haus sehen.« Brad brauchte ein paar Sekunden, bis er es erkennen konnte – ein blasser Schatten, der Anflug von Rauch – durch die dazwischen liegenden Bäume.
»Du hast gute Augen«, sagte er zu ihr. Es behagte ihm nicht, das Gefühl zu haben, dass diese Nachbarin viel jünger war als er, doch der Altersunterschied zeigte sich darin, wie leger und schnell sie ihre Klamotten abstreifte, als wäre es nichts Besonderes. Es war aber besonders: Sie sah fantastisch aus, alles an ihr war herrlich knochig und flaumig und blass, ihr Fett genau an den richtigen Stellen. Sie schwebte hin und her durch die Schatten im Raum und legte ihre gefalteten Kleider auf die schlichten Stühlen des Jugendzimmers. Als er sie zuvor mitten auf der Straße gesehen hatte, hatte er für einen Augenblick geglaubt, sie sei ein Geist; ihre Bewegungen hatten etwas gespenstisch Losgelöstes an sich, ihre Lippen waren zu einem Anflug von Selbstkritik gekräuselt, wie es ihm schon im Auto aufgefallen war, als sie neben ihn gerutscht war. Sie kam zu ihm, um ihm beim Ausziehen zu helfen, etwas, das Jane nie tat. Diese unterwürfige Geste – ihre kleine Stirn, vor Anstrengung gerunzelt, während sie seine Knöpfe öffnete – erregte ihn ungemein,
Brad, der seinen Atem beim Bewundern ihrer schwankenden Hüften im engen Strickkleid angehalten hatte, war an der obersten Stufe angekommen und fragte kurzatmig: »Meintest du das ernst? Dass dein Telefon auch nicht funktioniert?«
und er fühlte sich nicht länger nervös oder einsam in seinem Vorpreschen; die Geräusche von Regen und Winden schwanden. Der tosende Blutstrom in ihm war lauter. In ihrer Konzentration kroch ihre Zungenspitze langsam zwischen ihren Lippen hervor. In den vorderen Haarsträhnen, die das Kopftuch nicht bedeckt hatte, funkelten winzige Tropfen, sie rochen nach Regen – ein weiterer Duft aus seiner Kindheit.
»O Gott«, brach es aus ihm heraus. »Ich liebe das.« Er hatte sich mit Mühe das »dich« verkneifen können.
»Und es nicht noch nicht vorbei«, versprach sie in einem leichten Ton, als spräche sie mit einer guten Freundin. »Es geht weiter, Brad.« Der Strom ging an. Um ihn herum sprangen Tapeten und Stuck ins Licht. Unten in der Küche surrte der Geschirrspüler in seinen nächsten Spülgang. Am Eingang setzte die Alarmanlage ihr Piepen fort, diesmal jedoch schriller. Im Keller, in einer Tonlage tiefer als der Wind, entflammte die Heizung mit einer beständigen Kraft, stärker als der Wind, um das kühle Haus mit neuer Wärme zu füllen. Aufgeregt laute Stimmen verkündeten, dass Lynne vor einer Stunde die Nachrichten im Fernsehen geschaut hatte, bevor sie in Panik geraten war. Ihr Gesicht, so nah an ihm, dass sich ihre Atemzüge vermengten, sprang zurück wie ein schlechter Schnitt im Film.
»O«, sagte sie, und ihre verriebenen Augen stellten sich scharf.
»Zu Hilfe«, sagte er. Er knöpfte sein Hemd zu.
»Du musst nicht gehen.« Aber auch sie, in ihrer Nacktheit, war peinlich berührt – ihre Wangen brannten rot wie von einem Ausschlag.
»Ich denke schon. Er«, sagte er, »könnte anrufen. Sie vielleicht auch, wenn man in Boston vom Stromausfall gehört hat. Alles wird jetzt gut, Lynne. Hör zu. Die Alarmanlage ist aus. Sie sagt dir: ›Alles ist gut. Alles ist wie gewohnt.‹ Sie sagt dir: ›Schmeiß diesen Mann aus meinem Haus.‹«
»Nein«, protestierte sie schwach.
»Sie sagt: ›Ich trage jetzt die Verantwortung.‹«
Brad wandte seine Augen von dem nackten Körper seiner federgleichen Blondine.
»Sie sagt«, erklärte er, »›So ist es einfach. Das ist die Realität.‹«
LILLIAN ANSELL, S. 50–57
Die britische Illustratorin Lillian Ansell malt lebhafte und detailreiche Bilder, die oft humoristisch, karikaturistisch und strange wirken. Sie studierte Illustration an der Falmouth University. Ansell hat für namhafte Marken und Publikationen wie Penguin Random House, The New York Times und The New Yorker gearbeitet. Ihre Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet, darunter mit einem D&AD New Blood Pencil und dem Macmillan Prize.
RONA BAR UND OFEK AVSHALOM,
S. 94–99
Bar und Avshalom sind ein Fotograf:innenduo, das in London lebt und arbeitet. Ihr Universum schwebt zwischen Fantasie und Realität, dem Faktischen und dem Bizarren, und taucht jeden, der darauf stößt, in eine Mischung aus surrealen Visionen, Alltagserfahrungen und künstlerischen Referenzen. Indem sie ihr Wissen über Kunstgeschichte nutzen und es mit ihrer natürlichen Neigung zur zeitgenössischen Kultur in allen Bereichen kombinieren, geben sie eine visuelle Darstellung der heutigen Gesellschaft wieder, die zugleich ergreifend wirkt und zum Nachdenken anregt.
JIRO
BEVIS, S. 22–27
Jiro Bevis ist ein britischer Grafikdesigner und Illustrator, bekannt für seinen humorvollen Stil, der Popkultur, knallige Farben und verspielte Motive kombiniert. Er hat für eine Vielzahl von Marken und Musikern gearbeitet, darunter Nike, Red Bull und Stüssy. Bevis’ Arbeiten zeichnen sich durch ihre verspielte Ästhetik und ihre Referenzen an Comics, Cartoons und retro-inspirierte Grafik aus. Seine Radiosendung, Radio Jiro, läuft alle vier Wochen, montags zwischen 14 und 16 Uhr bei dem Indie-Online-Sender NTS Radio.
KATHRIN BIERLING, S. 14–21
Kathrin Bierling-Bosch co-gründete vor 17 Jahren Deutschlands ersten Modeblog Modepilot, den sie heute noch betreibt. Ihr neuestes Machtsymbol ist ein Paper-Tablet, mit dem sie die Freiheit über ihre Gedanken zurückgewonnen hat und ganze Artikel verfassen kann. Natürlich bleibt auch die Fernbedienung ein wichtiges Machtinstrument in einem Familienhaushalt. Die gelernte Journalistin lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Den Haag und München, arbeitet als Autorin und entwickelt als Werbetexterin Fernsehkampagnen und Slogans.
MOHAMED BOUROUISSA, S. 66–81
Mohamed Bourouissa wurde 1978 in Blida (Algerien) geboren und lebt und arbeitet in Paris. Seine Arbeiten wurden in zahlreichen Einzelausstellungen gezeigt, unter anderem im Palais de Tokyo in Paris (2024), im Goldsmiths Centre for Contemporary Art in London (2021), im Schinkel Pavillon in Berlin (2020), beim Festival »Les Rencontres de la Photographie« im französischen Arles (2019), und sind in namhaften öffentlichen Sammlungen weltweit vertreten, darunter im Centre Pompidou und in der Fondation
Louis Vuitton, Paris, dem Los Angeles County Museum of Art in Kalifornien, der Sammlung Philara in Düsseldorf und dem Stedelijk Museum in Amsterdam. Bourouissas Arbeiten wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Deutsche Börse Photography Foundation Prize (2020).
IAN CHILLAG, S. 4–13
Ian Chillag ist Podcastproduzent und Autor. »Everything is alive« ist eine Interviewserie ohne Drehbuch, in der alle Gesprächspartner:innen leblose Objekte sind. Abgesehen davon, dass die Dinge sprechen können, ist es wie ein Sachbuch: Alles, was uns die Objekte sagen, ist wahr.
STEFAN GÄRTNER, S. 82–85
Stefan Gärtner, Jahrgang 1973, arbeitet als Kolumnist für Titanic, Konkret sowie die Zürcher Wochenzeitung und schreibt neben Romanen (»Putins Weiber«, 2015) und Zeitkritischem (»Terrorsprache. Aus dem Wörterbuch des modernen Unmenschen«, 2021) fürs Neue Deutschland, die Junge Welt und die letzte Seite der Taz.
CHRISTIAN GOTTWALT, S. 86–91
Christian Gottwalt, Jahrgang 1968, hat sich als Journalist auf die kurze Form konzentriert. Für das SZ-Magazin konzipierte er einst »Gemischtes Doppel« und »Sagen Sie jetzt nichts«. Für Apollon begann er, Fabeln zu schreiben.
ELFRIEDE JELINEK, S. 94–99
Elfriede Jelinek, Jahrgang 1946, ist eine österreichische Schriftstellerin. Im Jahr 2004 erhielt sie den Literaturnobelpreis für »den musikalischen Fluss von Stimmen und Gegenstimmen in Romanen und Dramen (...)«. In diesem Apollon Dossier ist ein Textauszug aus dem Bühnenessay »Rein Gold« abgedruckt, das auf Anregung der Bayerischen Staatsoper entstand und 2012 im Prinzregententheater uraufgeführt wurde.
ADRIAN LOBE, S. 50–57
Adrian Lobe, geboren 1988, ist Politikwissenschaftler und freier Publizist. Im August 2023 erschien sein aktuelles Buch »Mach das Internet aus, ich muss telefonieren«.
DANIJELA PILIĆ, S. 40–47
Danijela Pilić ist Autorin, Journalistin und Kolumnistin. Sie schreibt über Mode, Beauty, Zeitgeist, Astrologie und Popkultur, unter anderem für Glamour, Vogue, Cosmopolitan, SZ Magazin und Playboy. Sie wurde in Split an der dalmatinischen Küste geboren und zog, als sie zehn Jahre alt war, mit ihrer Familie nach München, wo sie heute wieder lebt und arbeitet. Außerdem hat sie drei Bücher veröffentlicht und schreibt gerade ihren ersten Roman.
LILI RUGE, S. 58–65
Lili Ruge ist Kulturjournalistin und sich sicher, dass Macht genauso wenig von Machen kommt wie Kunst von Können.
LUCA SCHENARDI, S. 14–21
Seit 2003 entwickelt der in der Schweiz lebende Illustrator Luca Schenardi, Jahrgang 1978, eine einzigartige Hybridtechnik für seine Illustrationen: Er kombiniert digitale und analoge Ansätze und schichtet Rastermuster aus verschiedenen Laserdruckern, um eine analoge Textur für seine digitalen Zeichnungen zu erzeugen. Sein ausdrucksstarker Stil spiegelt sich auch in seiner Musik wider, die ihn zu mehreren internationalen Projekten führte, unter anderem mit dem ElectroLabel Patience und der australischen Psychedelic-Rockband Tame Impala. Von seinem Wohnort im schweizerischen Altdorf arbeitet er regelmäßig für Magazine und Zeitungen wie WOZ, Hochparterre, Neon, Neue Zürcher Zeitung, Rolling Stone Magazin, Strapazin, WWF Magazin, Die Zeit und Züritipp.
JOHN UPDIKE, S. 102–113
John Updike (1932–2009) war ein USamerikanischer Schriftsteller. Updike hat mehr als zwanzig Romane und Sammlungen von Kurzgeschichten veröffentlicht, außerdem mehrere Essay- und Gedichtbände. Er erhielt zahlreiche amerikanische Literaturpreise und -auszeichnungen und zählte viele Jahre lang zu den Anwärtern auf den Literaturnobelpreis.
KATE WAGNER, S. 28–39
Kate Wagner ist Architekturkritikerin und Journalistin. Sie ist die Gründerin des Blogs »McMansion Hell« und war als Kolumnistin bei The New Republic, Curbed und The Baffler tätig. Zur Zeit arbeitet sie als Architekturkorrespondentin bei The Nation und ist Dozentin im Department of Art History an der Universität Chicago.
JULIA WERNER, S. 22–27
Julia Werner ist Journalistin und Buchautorin. Sie konzentriert sich auf zeitgenössische Kultur im Allgemeinen und schreibt regelmäßig eine Modekolumne für die Süddeutsche Zeitung.
Apollon ist eine Initiative der Bayerischen Staatsoper. Apollon will Räume erschließen und öffnen, die künstlerischen Impulsen in verschiedene Formen eine Plattform ermöglichen, sich mit dem Menschsein auseinanderzusetzen.
»Apollon Dossier« ist eine Sammlung von Artikeln zu einem Thema. Die exklusiven gedruckten Inhalte erscheinen zeitversetzt digital. »Apollon Dossier« kondensiert aus dem Spielplan der Bayerischen Staatsoper die Themen, Narrative, Fragen an unsere Zeit und an eine Gesellschaft.
»Apollon Dossier« gendert, wo es möglich ist, männliche Sprachformen, es wird den Autor:innen überlassen, ob sie diese Genderform in ihren Texten übernehmen.
»Apollon Hand aufs Hirn« ist ein Podcast. Prominente Meinungsbildner:innen werden eingeladen, über ihr biographisches Thema öffentlich nachzudenken. Überall wo es Podcasts gibt.
»Apollon Hidden« sind versteckte künstlerische Interventionen an (un-)gewöhnlichen Orten Münchens, von denen die:der erfährt, der:die sich um die Apollon-Whatsapp-Nummer bemüht. Und Apollon ist mehr: apollon-dossier.de
IMPRESSUM: Apollon der Bayerischen Staatsoper, apollon-dossier.de
HERAUSGEBER
Staatsintendant Serge Dorny (V. i. S. d. P.)
Bayerische Staatsoper, Max-Joseph-Platz 2, 80539 München
KONZEPT & REDAKTION
Martina Borsche, Lukas Kubina, Olaf Roth, Michael Wuerges
PROJEKTMANAGEMENT
Lukas Kubina
LEKTORAT
Katja Strube
ÜBERSETZUNGEN
Martina Borsche (»Der Ausfall«, »Macht und McMansions« und »Everything is alive«)
BILDDRAMATURGIE
Martina Borsche
MITARBEIT
Dramaturgie der Bayerischen Staatsoper
GESTALTUNG
Bureau Borsche
ANZEIGENLEITUNG
Clara Unger
DRUCK UND HERSTELLUNG
Gotteswinter und Fibo Druck- und Verlags GmbH, München
TEXTNACHWEIS
»Der Ausfall« (original: »Outage«) erschien 2007 im New Yorker. Mit freundlicher Genehmigung des John H. Updike Literary Trust veröffentlicht Apollon eine deutsche Fassung.
BILDNACHWEIS
S. 15–21: Luca Schenardi für Apollon
S. 22–27: Jiro Bevis für Apollon
S. 28–37: Bilder mit freundlicher Genehmigung der Autorin
S. 50 / 51: Lillian Ansell für Apollon
S. 66–80: © Mohamed Bourouissa, mit freundlicher Genehmigung des Künstlers
S. 94, 99: Rona Bar und Ofek Avshalom / Connected Archives