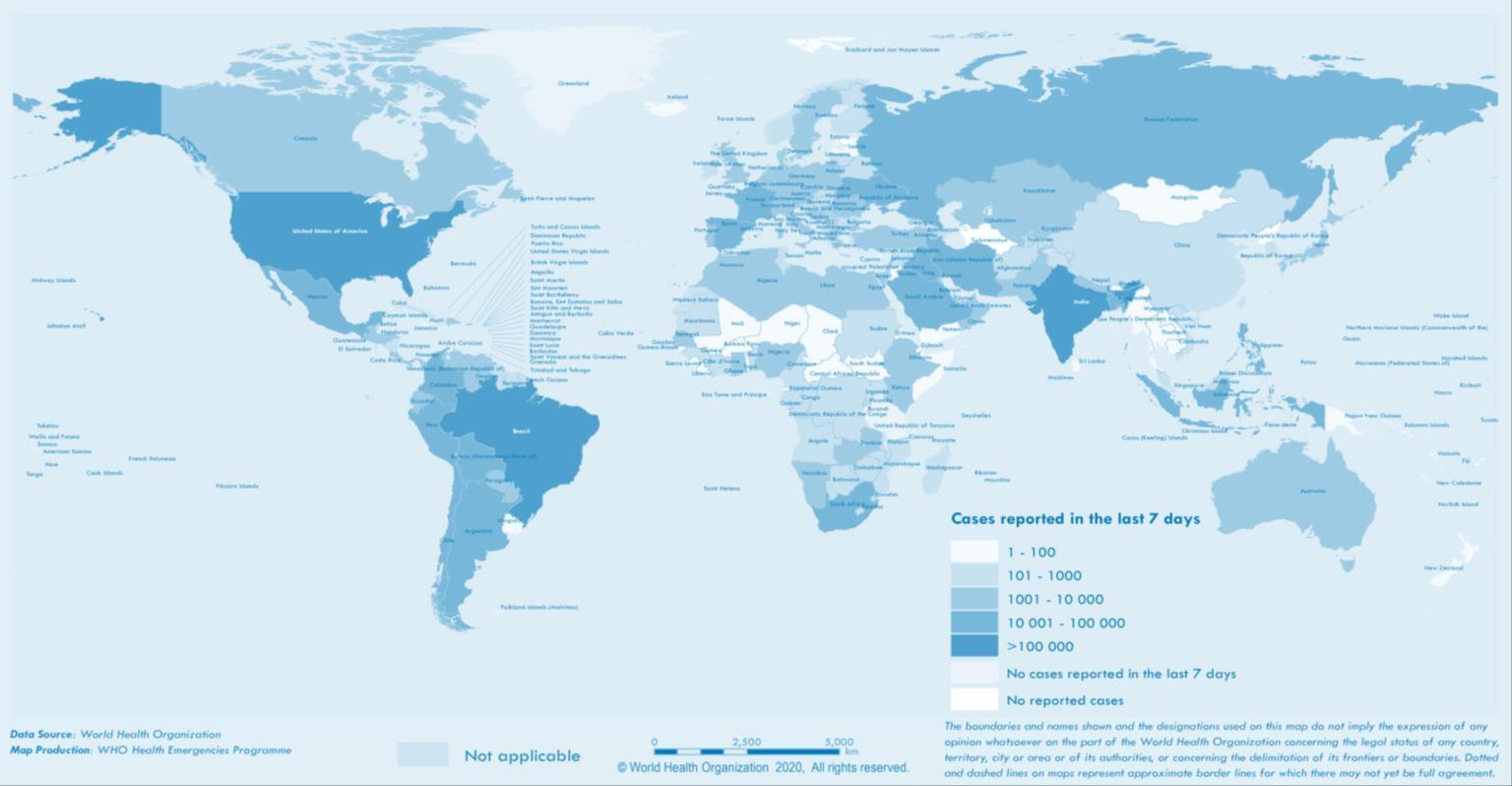10 minute read
China: Einbruch überwunden, nachhaltiges Wachstum gesucht
Ein Arbeitslosengeld in Höhe von 400 US-Dollar wöchentlich soll zu 75 Prozent aus föderalen und zu 25 Prozent aus Mitteln der Bundesstaaten ausgezahlt werden. Hierfür werden Mittel aus einem föderalen Katastrophenfonds umgeschichtet. Die Finanzierung durch die Bundesstaaten ist jedoch nicht geklärt.
Die Federal Housing Finance Agency wird angewiesen, Ressourcen zu prüfen, um Zwangsräumungen und Zwangsversteigerungen von Mietern und Hausbesitzern zu verhindern.
Das US-Finanzministerium soll die Eintreibung der so genannten Payroll Tax vom 1. September auf den 31. Dezember verschieben.
Inhaber von staatlichen Studienkrediten sollen bis Ende der Corona-Krise keine Zahlungen (inklusive Zinsen) leisten müssen.
Sollte sich der US-Kongress im September doch auf ein neues Finanzmittelpaket einigen, könnten diese präsidentiellen Dekrete und Memoranden zurückgenommen werden. In Anbetracht der kommenden US-Präsidentschaftswahlen wäre eine längerfristige Lösung wichtig, um die Konjunktur und die Unternehmen zu stützen.
China: Einbruch überwunden, nachhaltiges Wachstum gesucht
China wurde als erstes Land vom Covid-19-Strudel erfasst und schaffte als erste Volkswirtschaft die Rückkehr zum Wachstum. Nach dem Angebotsschock und dem massiven Einbruch um 6,8 Prozent im Zeitraum von Januar bis März –dem ersten Quartalsminus seit 1992 –schnellte das BIP im zweiten Quartal wieder um 3,2 nach oben. Die Erholung im zweiten Quartal spiegelt in erster Linie eine Stabilisierung und Stärkung der Angebotsseite durch staatliche Impulse wider. Die Nachfrage vor allem von privater Seite hinkt hinterher. Für das erste Halbjahr 2020 ergab sich ein –im internationalen Vergleich kleines –Minus von 1,6 Prozent. Der Primärsektor verzeichnete in diesem Zeitraum sogar ein leichtes Wachstum von 0,9 Prozent, Sekundär- und Tertiärsektor schrumpften um 1,9 bzw. 1,6 Prozent.
Verschuldung engt Spielraum ein
Die Weltbank hat in ihrem Update zu China Ende Juli die BIP-Prognose im Basisszenario von zuletzt einem Prozent auf 1,6 Prozent für 2020 angehoben. Wir gehen derzeit von einem BIP-Wachstum von zwei Prozent für das Gesamtjahr aus. Dieses auf den ersten Blick positive Szenario wird allerdings dadurch relativiert, dass China als Schwellenland für die Armutsbekämpfung und Schaffung von Arbeitsplätzen ein weitaus höheres Wachstum benötigt. Ein langfristiges Ziel der Parteiführung um XI Jinping war es, bis Ende 2020 die extreme Armut im Land zu besiegen. Dazu wäre aber wie in den vergangenen Jahren ein Wachstum in der Nähe von sechs Prozent notwendig. Doch die Spielräume sind für den Staat längst eng geworden. Ein vergleichbar massives staatliches Konjunkturprogramm wie nach der Finanzkrise ist angesichts der hohen Verschuldung nicht in Sicht. Nach offiziellen Angaben ist die Gesamtverschuldung von Staat, Unternehmen und Haushalten von 245 Prozent zu Jahresanfang auf 266 Prozent Ende Juni gestiegen. Angesichts der notorischen Intransparenz der Schuldensituation von Lokalregierungen erscheint eine tatsächliche Steigerung von 300 auf 330 Prozent realistischer. Die Weltbank schätzt, dass der bisher angekündigte und eingeleitete fiskalische Stimulus rund fünf Prozent des BIP ausmacht und damit weit unter dem Anteil in der EU, den USA oder Japan liegt.
Zu den staatlichen Stützungsmaßnahmen zählen Steuererleichterungen für die Unternehmen und eine zusätzliche Ausgabe von Staatsanleihen durch die Zentralregierung im Wert von einer Billion CNY (122 Milliarden Euro) sowie im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Anleiheplatzierung durch lokale Regierungen von 2,15 auf 3,75 Billionen CNY (458 Milliarden Euro). Letztere sollen vor allem der Finanzierung der „neuen Infrastruktur (u.a. 5G, industrielles Internet, KI, Verkehrssysteme, Batterieladestationen, Höchstspannungsnetze) dienen. In den Fokus zusätzlicher Kreditvergabe stellt die People’s Bank of China (PBoC) vor allem kleine und mittlere Unternehmen, die rund 80 Prozent der städtischen Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Von außerordentlichen Instrumenten der Geldpolitik sieht die PBoC nach wie vor ab.
Überangebot versus Nachfrageschwäche
Schon ab März drängte die Zentralregierung die Industrieunternehmen, möglichst rasch die Produktion wiederaufzunehmen. Die vor allem durch den Lockdown in Wuhan und der umliegenden Provinz Hubei bedingte Disruption der Lieferketten im Land wurde relativ schnell überwunden. Verstärkte Infrastrukturausgaben sorgten für zusätzliche Impulse und einen steigenden Bedarf an Grundstoffen für die Industrie. Am stärksten zog der Baubereich wieder an, als kurzfristig gestoppte Immobilienprojekte wieder aufgenommen wurden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete die Branche nach einem Einbruch von 17,5 in den ersten drei Monaten ein deutliches Plus von 7,8 Prozent im zweiten Quartal. Dem Wiedererstarken der industriellen Angebotsseite steht aber nach wie vor eine schwache Nachfrage der Verbraucher gegenüber. Denn statt eines verstärkten Konsums nach dem Lockdown üben sich vor allem einkommensschwächere Schichten nach wie vor in Zurückhaltung. Im Durchschnitt schrumpften die Haushaltseinkommen im Zeitraum von Januar bis Juni real um 1,3 Prozent, die der ländlichen Haushalte sogar um zwei Prozent. Im Gegenzug stieg die Sparneigung der Haushalte deutlich an. Darin spiegeln sich in erster Linie die verschlechterten Arbeitsbedingungen und fallende Löhne der rund 280 Millionen Wanderarbeiter wider. Mittlere und ober Einkommensschichten sind dagegen weniger von Einkommenseinbußen betroffen.
Die lückenhafte soziale Absicherung in China, insbesondere der nicht in den Städten registrierten Bevölkerung, stellt hier einen systemischen Nachteil dar und belastet eine breite und nachhaltige Erholung des Konsums. Ein weiterer struktureller Schwachpunkt ist der von privaten kleinen und mittleren Unternehmen geprägte Servicesektor. Dieser wurde von der Pandemie besonders stark gebeutelt. Gerade die Arbeitsplätze im einfachen Dienstleistungsbereich sind häufig prekär. Dagegen werden die vergleichsweise privilegierten Stellen in den großen staatlichen Industrieunternehmen notfalls auch durch administrative Interventionen gesichert.
Die makroökonomische Schieflage in Form eines vorauseilenden industriellen Outputs in Kombination mit einer hinterherhinkenden Nachfrage übt dabei deflationären Druck aus. Angesichts des langsameren Wachstums und eines vergleichsweise hohen Zinsniveaus steigt damit das Risiko von Kredit- und Anleiheausfällen.
Konjunkturdaten: Tempo der Erholung uneinheitlich
Die statistisch erfasste Industrieproduktion (d.h. von Unternehmen mit mindestens 20 Millionen CNY Umsatz) fiel in den ersten sechs Monaten um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, nachdem in den ersten drei Monaten ein Einbruch von 8,4 Prozent verzeichnet worden war. Der Trend zeigt aber mit einem Plus von 4,4 Prozent im zweiten Quartal und zuletzt 4,8 Prozent im Juli wieder nach oben. Die Privatunternehmen zeigten sich in der Coronakrise robuster als die Staatsunternehmen. Ihr
Output schrumpfte im ersten Halbjahr lediglich um 0,1 Prozent, die Staatsbetriebe mussten dagegen ein Minus von 1,5 Prozent hinnehmen. Der High-Tech-Sektor, konnte für den Zeitraum bis Juni entgegen dem Trend ein Plus von 4,5 Prozent vermelden. Im Segment der Industrieroboter belief sich das Wachstum auf 10,3 und im Halbleiterbereich sogar auf 16,4 Prozent.
Die Investitionen in Sachanlagen gingen von Januar bis Juni um insgesamt 3,1 Prozent zurück. Noch stärker wäre das Minus ohne die staatlichen Stützungsmaßnahmen ausgefallen, denn die privaten Investitionen gingen sogar um 7,3 Prozent zurück. Die Investitionen im produzierenden Gewerbe fielen um 11,7 Prozent, im Infrastrukturbereich war der Rückgang in Höhe von 2,7 Prozent vergleichsweise klein, die Immobilienbranche konnte sogar ein Plus von 1,9 Prozent melden. Die besondere Bedeutung der High-Tech-Industrie spiegelt sich auch hier mit einem Investitionsplus von 5,8 Prozent wider. Dem Gesundheitssektor flossen angesichts der Pandemie 15,2 Prozent mehr an Mitteln zu. Profitieren konnte als Folge des Lockdowns besonders der Online-Handel. Hier schnellten die Investitionen um 32 Prozent nach oben.
Nach dem Minus von 5,7 Prozent zu Jahresbeginn zeigt sich der Dienstleistungssektor mit einem leichten Plus von 1,9 Prozent im zweiten Quartal etwas erholt. Doch dahinter verbirgt sich über die verschiedenen Branchen hinweg ein sehr uneinheitliches Bild: So konnten IT-Dienstleistungen in den ersten sechs Monaten einen Zuwachs von 14,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum melden. Finanzdienstleistungen waren 6,6 Prozent im Plus. Indes musste das arbeitsplatzintensive Hotel- und Gaststättengewerbe im ersten Halbjahr einen dramatischen Einbruch von 28,6 Prozent hinnehmen.
Ebenso musste der Einzelhandel im ersten Halbjahr deutlich Federn lassen. Der Absatz von Konsumgütern fiel um 11,4 Prozent. Auch in den letzten Monaten lagen die Umsätze noch im negativen –wenngleich niedrig einstelligen –Bereich. So betrug das Minus im Juni noch 1,8 und im Juli 1,1 Prozent. Der Konsum kann damit nach wie vor nicht die Rolle des Wachstumsmotors spielen. Ein Teilbereich, der von der Corona-Krise profitieren konnte, war der Online-Handel. Dieser legte von Januar bis Juni um insgesamt 7,3 Prozent zu. Da die chinesischen Verbraucher sich zunächst mit Restaurantbesuchen zurückhielten, konnte auch der Lebensmitteleinzelhandel ein Plus von 12,9 Prozent verzeichnen. Der Absatz von Pharmazeutika und Medizinprodukten lag um 5,9 Prozent höher. Eine Berg- und Talfahrt gab es in der Automobilbranche. Nach einem Absatzkollaps von 79,1 Prozent im Februar erholte sich der Fahrzeugmarkt von Monat zu Monat. In der Summe lag im ersten Halbjahr der KfzUmsatz noch um 16,9 Prozent im Rückstand –darunter das Pkw-Segment mit einem Minus von 22,4 Prozent. Bereits im April hatten jedoch die monatlichen Absatzzahlen wieder ins Plus gedreht. Zuletzt lag der Zuwachs im Juli bei 16,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat (Pkw-Segment: plus 8,5 Prozent). Für das Gesamtjahr erwartet der chinesische Autoherstellerverband CAAM allerdings nach wie vor ein Absatzminus von rund zehn Prozent.
Angesichts des weltweiten Nachfrageeinbruchs kam der Außenhandel des Exportweltmeisters China vergleichsweiche glimpflich davon. In US-Dollar gerechnet fielen die Ausfuhren in den ersten sechs Monaten 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,1 Prozent. Die Einfuhren kontrahierten um 7,1 Prozent. Zuletzt zogen die Exporte wieder an. Der chinesische Zoll meldete im Juni erstmals wieder einen leichten Anstieg der Exporte um 0,5 Prozent. Im Juli ging es dann um überraschende 7,2 Prozent aufwärts. Die Importe fielen im selben Monat allerdings wieder um 1,4 Prozent, nachdem sie im Juni um 2,7 Prozent zugelegt hatten. Als Hauptstütze des Exports erwiesen sich neben Elektronikprodukten vor allem medizinische Güter, deren weltweite Nachfrage in Corona-Zeiten geradezu explodierte.
Während die Produzentenpreise (PPI) im ersten Halbjahr um 1,9 Prozent zurückgingen, stieg der Verbraucherpreisindex (CPI) gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,8 Prozent. Auch im Juli bestand weiterhin auf Herstellerseite deflationärer Druck. Der PPI fiel um 2,4 Prozent. Der Anstieg des CPI betrug 2,7 Prozent. U.a. aufgrund der Hochwassersituation in Zentral- und Südchina verteuerten sich Nahrungsmittel und auch steigende Aufwendungen für Energie heizten die Verbraucherpreise an.
Nach einem Rekordanstieg auf 6,2 Prozent auf dem Höhepunkt der Corona-Krise im Februar lag die städtische Arbeitslosenquote im Juni und im Juli jeweils bei 5,7 Prozent. Jedoch gelten die offiziellen Zahlen notorisch als zu niedrig. Eine Studie der Economist Intelligence Unit vom April schätzte den Arbeitsplatzverlust bei der städtischen Bevölkerung in der Spitze bei bis zu 10 Prozent. Darüber hinaus wird in den Statistiken nicht systematisch erfasst, wie die Lage bei dem Heer der ländlichen Wanderarbeiter aussieht. Neben der Baubranche ist ein großer Teil von ihnen traditionell im von Covid-19 besonders hart getroffenen Servicesektor beschäftigt.
Der vom National Bureau of Statistics ermittelte offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) des produzierenden Gewerbes stieg im Juli zum fünften Mal in Folge, erreichte 51,1 Punkte und blieb damit nach 50,9 Zählern im Vormonat weiterhin im expansiven Bereich. Der private Caixin Einkaufsmanagerindex sprang im Juli sogar auf 52,8 Punkte. Diese kräftige Erholung der beiden Gradmesser industrieller Aktivität erfolgte allerdings auch nach einem historischen Einbruch (35,7 Punkte beim PMI im Februar). Indes zeigte der offizielle PMI-Subindex für KMUs im Juli eine verstärkte Kontraktion an. Auch die Indizes für Exporte und Beschäftigung blieben im Bereich unter 50 Zählern, verzeichneten aber gegenüber dem Vormonat einen deutlichen Aufwärtstrend.
Pläne zur Stärkung der Staatswirtschaft
Auf dem Ende Mai verspätet abgehaltenen Nationalen Volkskongress verzichtete die chinesische Regierung erstmals seit 1994 auf die Vorgabe eines konkreten Wachstumsziels für das laufende Jahr. Betont wurden hingegen die „sechs zu schützenden Bereiche“ zur Sicherung von gesellschaftlicher und ökonomischer Stabilität: städtische Arbeitsplätze und Grundversorgung, Funktion der Märkte, Energie- und Lebensmittelsicherheit, Lieferketten sowie die Funktion der Verwaltung auf den unteren Ebenen. Die Rolle der Staatswirtschaft soll künftig weiter gestärkt werden. Dazu verabschiedete die von XI Jinping persönlich geleitete „Zentralkommission zur umfassenden Vertiefung der Reformen“ im Juli einen dreijährigen Aktionsplan für die Reform der Staatsunternehmen. Darin stehen eine verbesserte Marktorientierung sowie eine Ausweitung des gemischten Eigentumssystems auf dem Programm. Die Staatsbetriebe sollen die Entwicklung der Regionen durch Großprojekte vorantreiben. Zudem plant die Regierung „Technologiedurchbrüche“ im High-Tech-Bereich. Ziel ist, die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren und Lieferketten im Land zu stabilisieren und auszubauen.
Geostrategischer Konflikt engt Optionen ein
Die Sicherung von Lieferketten ist nicht nur eine Reaktion auf die Disruptionen durch Covid-19, sondern vor allem auch eine strategische Antwort auf den Handelskonflikt mit den USA. Dieser entwickelt sich zunehmend zu einer geopolitischen Konfrontation. Im beiderseitigen Verhältnis spielt das mühsam erarbeitete Phase-eins-Abkommen keine ausschlaggebende Rolle mehr. Kurz nach Unterschrift Mitte Januar warf die Pandemie die ambitionierten chinesischen Verpflichtungen zur Einfuhr von US-Gütern bereits über den Haufen. Die Disruption des Außenhandels ist aber noch das geringere Problem für China. Nach der anfänglichen Vertuschung und der verspäteten Reaktion Pekings auf die Pandemie