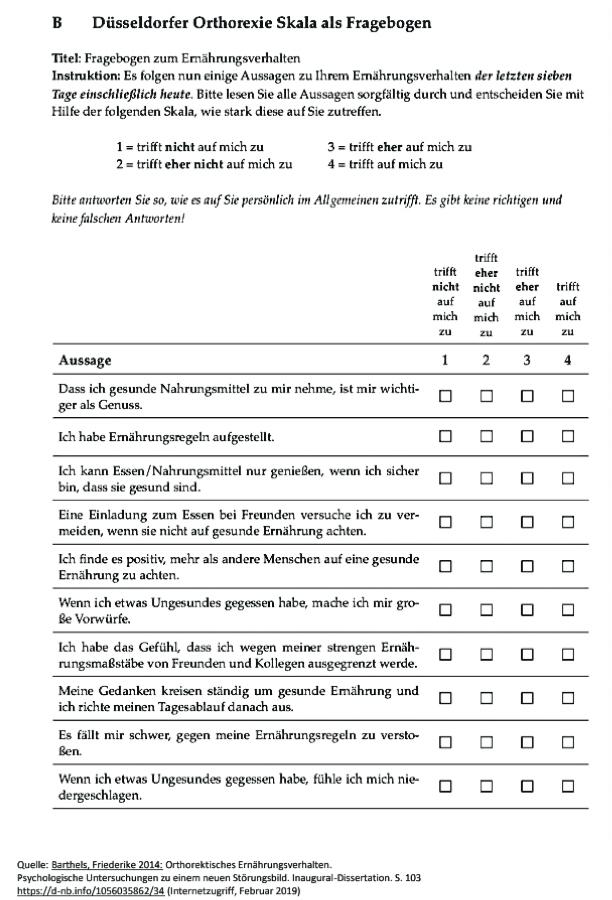8 minute read
Augentraining
Die Augen sind für unser Gehirn der primäre Informant in Bezug auf die Umwelt. Bessere Informationen bedeuten optimalere Entscheidungsmöglichkeiten. Einige
Faktoren sind insbesondere durch Augentraining optimierbar.
Unsere Augen (visuelles System) sind, je nach Literatur, für ca. 70–90 Prozent der sensorischen Informationen verantwortlich. Diesem Umstand kommt umso mehr Bedeutung zu, wenn man sich die zwei
Hauptaufgaben des Gehirns anschaut – die haben sich nämlich seit Beginn der Menschheit bis zum heutigen Zeitpunkt nicht verändert. Schon immer immer ging es für das Gehirn nur um eines: das Überleben. Alle Informationen aus der Peripherie – Auge,
Innenohr, Körperwahrnehmung – dienen der Aufgabe, die bestmögliche Entscheidung für das Überleben zu treffen.
Bewegung ist oft das Mittel der Wahl, das Überleben zu sichern – sei es zur Energiebeschaffung oder zum Schutz vor Gefahr. Wer die besseren Informationen hat, kann bessere Entscheidungen treffen; das gilt gestern wie heute.
VISUELLE WAHRNEHMUNG
Das Thema „visuelle Wahrnehmung“ wird je nach Betrachtung unterschiedlich dargestellt. Wenn wir uns in eine augenärztliche Untersuchung zur Abklärung von Sehfehlern begeben, wird sich in der Regel nur einem Aspekt der visuellen Wahrnehmung, dem fovealen Sehen (zentralen Sehen), gewidmet. Aus neurologischer Sicht ist dies aber bei Weitem nicht das einzige Kriterium. Das foveale Sehen wird beim Arzt in der Regel durch Testen des Nahsehens und Fernsehens geprüft. Das fixierte Objekt und der Proband bewegen sich nicht.
Aus neurologischer Sicht kommen aber noch weitere Faktoren zum fovealen Sehen hinzu: die Tiefenwahrnehmung, die Tiefeneinschätzung und das peripheres Sehen, um nur einige zu nennen. Zusätzlich betrachten wir das Umwelt-Setting, bei dem diese visuellen Eigenschaften unter verschiedenen Bedingungen abgerufen werden können:
4 VERSCHIEDENE BEDINGUNGEN
1. Das Objekt und der Beobachter bewegen sich nicht. 2. Das Objekt steht still und der Beobachter bewegt sich. 3. Das Objekt bewegt sich und der Beobachter steht still. 4. Das Objekt und der Beobachter bewegen sich.
Später im Artikel werde ich erklären, warum die medizinische Sichtweise in Ordnung, aber bei Weitem nicht ausreichend ist. Damit die Schlussfolgerungen auch wirklich logisch erscheinen, möchte ich nachfolgend auf ein paar neurologische Aspekte des Sehens eingehen.
NEUROLOGIE DES SEHENS
Die These, dass das Sehen ca. 70–90 Prozent der sensorischen Informationen ausmacht, wird gestützt, wenn wir uns anschauen, wie viele unserer Hirnnerven mit dem Sehen zu tun haben. Insgesamt besitzt jeder Mensch 12 Hirnnerven; vier davon haben direkt etwas mit dem Sehen zu tun. Also ein Drittel aller Hirnnerven beschäftigt sich damit, korrektes Sehen zu ermöglichen. Dies verdeutlicht die Wichtigkeit der visuellen Information für das Gehirn.

AUGENLIEGESTÜTZ
Der Stab wird mit dem gestreckten Arm auf Augenhöhe angehoben. Der Buchstabe sollte hier klar zu erkennen sein. Anschließend wird der Stab langsam in Richtung Nasenspitze geführt. Wenn der Buchstabe zu verschwimmen beginnt, ist der Umkehrpunkt erreicht. Der Arm wird, wenn möglich, wieder komplett gestreckt. Durch das Blicken auf den Stab ergibt sich ein Innenschielwinkel (Konvergenz), der alle oben beschriebenen neurologischen Prozesse einleitet. Folgende Schwierigkeiten ergeben sich: Der Kurzsichtige wird ein Verschwimmen eher in der Distanz wahrnehmen und nah scharf sehen. Für ihn gilt: Sobald der Stab in der Ferne verschwimmt, wird die Bewegung umgekehrt. Der Weitsichtige hingegen sieht nahe Bereiche verschwommen und kehrt die Bewegung um, wenn der Stab in Richtung Nasenspitze verschwimmt.
1. Hirnnerv II: N. opticus (der Sehnerv): Er überträgt die visuellen Reize von der Netzhaut (Retina) zum visuellen Cortex. Ursprung: im visuellen Cortex. 2. Hirnnerv III: N. oculomotorius: Er ist für Bewegungen des Auges nach innen/unten und oben links/ rechts verantwortlich. Dies geschieht über die Ansteuerung der Muskeln M. rectus inferior, M. rectus medialis, M. rectus superior, M. obliquus inferior und des Lidhebemuskels M. levator palpebrae; Ursprung: im Mittelhirn. Als einziger Hirnnerv hat er zusätzlich eine Wirkung auf den inneren Augenmuskel M. ciliaris und wirkt über dessen Kontraktion und die Entspannung der Zonulafasern bei einer stärkeren Krümmung der Linse mit.
INDIANERBLICK
Diese Übung stärkt die Divergenz. Als Kontrolle dient uns ein spezielles Blatt, das man sich vor die Augen hält. Dieses Blatt kannst du dir über den Link hier im Artikel herunterladen. Die Übung dient der Schulung des Weitblickens.
Dafür wird der Blick auf ein weit entferntes Objekt gerichtet. Dafür muss der M. rectus lateralis aktiviert werden. Dieser zieht die Augen nach außen. Bei korrekter Anwendung beginnen die Objekte auf dem Kontrollblatt zu verschwimmen und bilden in der Mitte ein neues Objekt. Damit wird über die antagonistische Hemmung der Hirnnerv III gehemmt und der Linsenmuskel M. ciliaris entspannt, die Linse abgeflacht und das Auge stellt auf Weitsicht. 3. Hirnnerv IV: N. trochlearis. Er initiiert die Bewegung nach außen-unten über den M. obliquus superior; Ursprung: im Mittelhirn. 4. Hirnnerv VI: N. abducens. Er bewegt das Auge nach außen über die Aktivierung des M. rectus lateralis; Ursprung: im Pons (Hirnstamm).


SYSTEME ARBEITEN ZUSAMMEN
Die Nervenkerne des visuellen somatomotorischen Systems liegen allesamt im Hirnstamm. Auffällig ist, dass auch die Nervenkerne des Hirnnervs VIII (N. vestibulocochlearis) im Hirnstamm liegen. Aus neurozentrierter Trainingsweise ist dies sinnvoll, denn diese Systeme müssen Informationen austauschen und zusammenarbeiten. Wir Neurotrainer haben dafür ein Sprichwort: „Neurons that fire together, wire together“ – übersetzt bedeutet es so viel wie: Neuronen, die zusammenarbeiten, verbinden sich zusammen.
Für ein klares Bild aus dem visuellen System braucht es einen ruhigen Kopf. Damit das Gehirn weiß, wo sich der Kopf befindet und wie er beschleunigt wird, benötigt es die Informationen aus dem Vestibularapparat. Informationen aus den visuellen und den vestibulären Kernen werden dann zur Nackenmuskulatur weitergeleitet und sorgen dort für eine reflexive Stabilität. Natürlich müssen diese Informationen schnellstmöglich übertragen werden, deshalb liegen all die dafür verantwortlichen Kerngebiete nah beieinander. Wenn diese Systeme nicht ineinandergreifen, bekommt das Gehirn möglicherweise keinen korrekten Bildeindruck und wird Schwierigkeiten beim Scharfstellen bekommen.
SEHEN IM DETAIL
Wenn man sich jetzt noch einmal das Umwelt-Setting anschaut, dann wird deutlich, dass wir aus augenärztlicher Sicht hauptsächlich den Hirnnerv III mit seiner Funktion, den M. ciliaris betreffend, betrachten. Die Bewegungsmuskeln werden größtenteils außen vor gelassen; für das Setting 1 wäre das ausreichend. Das Leben besteht jedoch auch aus den Settings 2–4 und die können wir über Augenbewegungen trainieren und verbessern.
Wenn ich etwas nah fixieren möchte, müssen meine Augen ein wenig einen inneren Schielwinkel einnehmen, das heißt, sie bewegen sich nach innen-unten, sofern ich den fixierten Gegenstand, z. B. ein Buch, auf Brusthöhe und den Kopf geradeaus halte. Das heißt, hierfür muss der Hirnnerv III arbeiten. Beide Funktionen liegen auf diesem Hirnnerv. Die Augen müssen sich nach innen-unten bewegen (s. o. Punkt 2), der M. ciliaris muss sich anspannen, um die Linse zu krümmen und das Licht korrekt zu bündeln. Eine passende Übung für diese Funktion ist der sogenannte Augenliegestütz. Hierfür wird ein Fi-
SEMINARTIPP
Mehr Informationen und Übungen finden Interessierte im Online-Kurs „Augentraining online – besser sehen ohne Brille“. Das 8-Wochen-Trainingsprogramm kostet 329 Euro. Mit dem Code „TRAINER22" gibt es eine Ermäßigung von 130 Euro. www.augentraining.online
xierstab benötigt. Der Stab dient als Kontrollgerät, ein scharfes Bild zu produzieren. Trainiert werden soll, wenn möglich, ohne Brille. Es ist darauf zu achten, ausreichend große Buchstaben auf den Stab zu kleben. Handelsübliche Stäbe sind oft zu klein für Menschen mit einem Sehfehler. Aus diesem Grund empfehle ich, über ein Schreibprogramm eine ausreichend große Buchstabenreihe zu drucken und diese aufzukleben. Sollte auch bei großer Schrift (36 Punkt und mehr) kein klares Bild erkennbar sein, sollte zunächst mit Brille trainiert werden.
FAZIT
Die Augen als primäre sensorische Informationsgeber senden nicht nur jede Menge Signale an das Gehirn, sondern sind auch enorm wichtig für jegliche Bewegungen. Circa 40 Prozent der Informationen für die Bewegungsplanung werden durch die Augen aufgenommen. Nur Dinge, die ich korrekt sehe, kann ich korrekt einordnen und meine Bewegung entsprechend darauf abstimmen. Gerade im Sport kommt dem visuellen System oft eine Schlüsselrolle zu. Wer Situation schneller erfasst, weiß eher, wo der Gegner hinläuft oder sich der Ball befindet. Dies verschafft dem Sportler in der Regel den entscheidenden Vorteil. Über den visuell-muskulären Reflex kann man Bewegung zusätzlich unterstützen. Ein nach oben gerichteter Blick stärkt die Strecker und Blick nach unten gerichtet die Beuger. Ein Schauen nach links fördert die Rotation nach links und Schauen nach rechts begünstigt das Drehen nach rechts. Das Trai-
PATRICK EURICH ning der Augen Der Diplom-Sportwissen- kann somit helfen, schaftler hat die Z-Health-Ausbildung absolviert und Kraftimpulse zu ist Gründer der Deutschen verstärken und Be-
Akademie für Neuro-Perforwegungen zu vermance. www.neuro-performance.com bessern. Trotzdem fristet das Training
PALMING
Unsere Augen und damit die Netzhaut sind permanenten Reizen ausgesetzt. Vor allem blaues Licht bei dunkler Arbeitsumgebung strengt die Augen an, denn dann sind die Pupillen weit geöffnet und viel grelles blaues Licht kann auf die Netzhaut fallen. Hier kann das „Palming“, das Bedecken beider Augen mit den Handflächen, Abhilfe schaffen. Das Palming soll die Augen vor äußeren Reizen schützen und zur Regeneration beitragen. Man reibt dafür die Hände kurz warm, legt anschließend die Finger aufeinander und dann die Handflächen auf die geschlossenen Augen. Nun sollte ein vollkommen schwarzer Bildeindruck entstehen. Sieht man flackernde Blitze oder andere Lichtfragmente, ist die Netzhaut gestresst. Das Palming sollte so lange durchgeführt werden, bis ein vollkommen schwarzes Bild zu sehen ist.


der Augen und der vielen Reflexe eher noch ein stiefmütterliches Dasein. Ich hoffe, dass in Zukunft das Training der Augen genauso zum Standard gehören wird wie das Kraft- oder Ausdauertraining. Denn wenn wir als Trainer erkennen, dass sich unsere Sportler eben nur so gut bewegen können, wie sie ihre Umwelt wahrnehmen, kommen wir an einer Verbesserung der visuellen Wahrnehmung zur Leistungssteigerung nicht mehr vorbei. W