
4 minute read
Immunsuppressiva
Immunsuppressiva kommen zum Einsatz, um das Immunsystem zu unterdrücken, wenn es körpereigenes Gewebe angreift. Dr. Jens Freese erklärt die Wirkungen und Nebenwirkungen dieser Medikamentengruppe.


Ständig versuchen Pathogene wie Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten und Umweltgifte, in unseren Körper einzudringen. Haben diese Fremdkörper unsere Barrieren im Darm oder im Nasen-Rachen-Raum überwunden, aktiviert unser Immunsystem eine ganze Armada von Abwehrmechanismen. Das Ziel: die Eindringlinge unschädlich zu machen, bevor sie sich weiter ausbreiten und den Körper in Lebensgefahr bringen. Unser Immunsystem, das sich über viele Millionen Jahre immer differenzierter an die Umwelt angepasst hat, stimuliert im Falle einer Infektion spezielle Immunzellen, die unter anderem Antikörper produzieren, um Pathogene frühzeitig auszuschalten. Ähnliches passiert, wenn körpereigene Zellen entarten, wie es bei Krebszellen der Fall ist. Mutationen passieren ständig irgendwo in unserem Körper in den etwa 100 Billionen Körperzellen. Solange unser Immunsystem seine Kontrollfunktion ausübt, entwickelt sich weder eine schwere Infektion, wie z. B. eine Lungenentzündung, noch bleiben entartete Zellen unerkannt. Sie werden in der Regel eliminiert, bevor sich ein Tumor bilden kann. Ohne unser angeborenes und adaptives Immunsystem würden wir nicht lange überleben. Aber auch ein durch Stressoren geschwächtes, durch schlechte Ernährung oder Medikamente gehemmtes Immunsystem kann über kurz oder lang zum Problem werden.
Suppression Statt
URSACHENFAHNDUNG
Seit einigen Jahrzehnten ist eine epidemische Ausbreitung von Problemen des Immunsystems zu beobachten: Bei Allergien kann eine Reaktion auf eigentlich harmlose Allergene, wie zum Beispiel Birkenpollen aus der Luft oder Lektine aus Nahrungsmitteln, übertrieben ausfallen. Unser Immunsystem schießt praktisch mit Kanonen auf Spatzen. So kann zum Beispiel die durch allergisches Asthma ausgelöste Entzündung das Lungengewebe schädigen, wenn sie nicht rechtzeitig gebremst wird. Bei den inzwischen 600 bekannten Autoimmunerkrankungen aktiviert unser Immunsystem Abwehrmechanismen, die sich irrigerweise auch gegen körpereigenes Gewebe richten. Typische Autoimmunerkrankungen sind Diabetes Typ 1, Multiple Sklerose, Morbus Crohn, rheumatoide Arthritis und viele andere. Die Schulmedizin fahndet im Allgemeinen nicht nach den Ursachen, sondern verordnet immunsupprimierende Medikamente, die man auch bei Organtransplantationen benötigt. Ansonsten würde unser Immunsystem das neue Organ als fremd erkennen und attackieren. Organtransplantierte Menschen sind daher lebenslang auf immunsupprimierende Medikamente angewiesen, damit es nicht zu einer Abstoßungsreaktion kommt. Gilt das für Autoimmunerkrankungen auch?




UMWELTGIFTE
AUF DER ÜBERHOLSPUR
Die Ursachen von Autoimmunerkrankungen sind multifaktoriell. Sie dürften irgendwo zwischen unserem stark veränderten Lebensstil und den Hunderttausenden von Umweltgiften zu suchen sein, die vor allem die chemische Industrie und die Agrarindustrie in den letzten 70 Jahren massenhaft in unsere moderne Welt eingeführt haben. Insbesondere Pflanzenschutzgifte, Zahngifte, Chemikalien im Haushalt und industrielle Emissionen in die Atmosphäre setzen unserem Immunsystem immer mehr zu. Wen wundert es da noch, dass bei der Fülle an Fremdstoffen unser Immunsystem nicht mehr zwi- schen Freund und Feind unterscheiden kann? Vonseiten medizinischer Fachverbände, die ihre Behandlungskonzepte in sogenannten Leitlinien definieren, heißt es lapidar: Ursache unbekannt. Deshalb können aus Sicht der Schulmedizin diese Erkrankungen nicht auf natürliche Weise ausheilen und bedürfen daher einer kontinuierlichen Hemmung durch immunsuppressiv wirkende Medikamente. Das bekannteste immunsuppressive Medikament ist das Kortison. Darüber hinaus existieren zahlreiche andere immunsuppressiv wirksame Wirkstoffgruppen. Die wichtigsten sind in der Tabelle aufgeführt. Nicht nur die Wirkungen, sondern vor allem auch die Nebenwirkungen sollten neben den verordnenden Medizinern auch die Therapeuten, Gesundheitsberater und Trainer kennen, die mit diesen Patienten auf anderer Ebene, wie zum Beispiel in der Ernährungsberatung, im Rehatraining oder in der Prävention, arbeiten.
WIRKUNGEN UND
NEBENWIRKUNGEN
Wenn die Prognose stimmt, wird die Pharmaindustrie mit Immunsuppressiva in diesem Jahr zirka 51 Mrd. Euro umsetzen. Für die nächsten Jahre ist zudem ein Wachstum von 12 Prozent jährlich prognostiziert, was einem Volumen von etwa 80 Mrd. Euro im Jahr 2027 entspricht. Folglich werden Autoimmunerkrankungen in den kommenden Jahren ein epidemisches Ausmaß einnehmen. Grund genug, sich im Folgenden einen kleinen

Im Berblick
Immunsuppressive Wirkstoffgruppen:
• Glucokortikoide (Hydrokortison, Prednisolon etc.)
• CalcineurinInhibitoren (z. B. Ciclosporin A, Pimecrolimus, Tacrolimus)
• Zytostatika (z. B. Methotrexat, Azathioprin)
• mTOR-Inhibitoren (wie z. B. Rapamycin)
• Biologicals (z. B. Basiliximab Infliximab Infliximab, Belatacept)
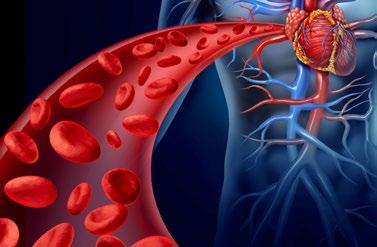
Überblick zu verschaffen, welche Medikamentenklassen zur Unterdrückung des Immunsystems eingesetzt werden.
Bei Allergien kommen unter anderem Kortisonpräparate zum Einsatz. Sie sind synthetisch vom körpereigenen Kortisol abgeleitet, das antientzündliche und immunsuppressive Eigenschaften besitzt. Bei lebensbedrohlichen allergischen Reaktionen wie dem allergischen Schock oder schweren Asthmaanfällen zählt Kortison zu den wichtigsten Medikamenten der Notfallmedizin. Bei harmloseren Reaktionen, wie zum Beispiel Hautentzündungen, werden kortisonhaltige Cremes eingesetzt, bei Asthma kennen viele die Aufnahme von Kortison in Form eines Sprays. Das zu den Glucocorticoiden zählende und in der Nebenniere gebildete Kortisol bindet in der Zelle an einen Glucocorticoid-Rezeptor. Dadurch unterdrückt Kortisol die Bildung klassischer Entzündungsbotenstoffe wie Interleukin-1 und -6, Prostaglandine, Leukotriene, TNF-α oder Interferon.
CALCINEURIN-INHIBITOREN UND ZYTOSTATIKA
Tacrolimus, Pimecrolimus und Cyclosporin A gehören zu den sogenannten Calcineurin-Inhibitoren, die aus bestimmten Pilzen gewonnen werden und vor allem bei Transplantationspatienten Anwendung finden. In Salbenform werden sie in der Dermatologie auch bei Hauterkrankungen, wie z. B. Neurodermitis, eingesetzt. Der antientzündliche Wirkmechanismus dieser Medikamentenklasse beruht auf der Hemmung eines speziellen Enzyms mit dem Namen Calcineurin. Dieses Enzym aktiviert in den T-Lymphozyten den sogenannten Transkriptionsfaktor (NF-AT), wodurch eine Immunreaktion eingeleitet wird. Die Hemmung der Calcineurinwirkung führt auf diese Weise zu einer verminderten Reaktion des Immunsystems. Zytostatika sind natürliche oder synthetische Substanzen, die das Zellwachstum hemmen. Deshalb werden sie vor allem bei Krebs als Chemotherapeutikum eingesetzt, kommen jedoch auch bei der Behandlung von Autoimmunerkrankungen in wesentlich geringerer Dosierung zum Einsatz. Bekannte Medikamente aus dieser Klasse sind Methotrexat und Azathriopin. Sie blockieren die Synthese von DNA und hemmen dadurch unter anderem die Vermehrung von T- und B-Lymphozyten. Auf diese Weise wird die Aktivität des Immunsystems supprimiert. Die Nebenwirkungen sind breit gefächert: von erhöhter Infektanfälligkeit über Probleme im Magen-DarmTrakt wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall bis hin zu einem Mangel an roten und weißen Blutkörperchen, Haarausfall, Schleimhautentzündungen, Schädigungen innerer Organe und Störungen im Zentralnervensystem bei längerer Gabe.


MTOR-INHIBITOREN
Das Protein mTOR ist ein Enzym, das in den Zellen aller Säugetiere vorkommt und den Zellstoffwechsel sowie die Zellproliferation steuert. mTOR-Inhibitoren wie z. B. Rapamycin (Sirolimus), die aus Bakterien gewonnen werden, blockieren die Aktivität dieser Proteine, was unter anderem zur Hemmung aktivierter Lymphozyten führt. Damit wird eine Immunreaktion unspezifisch herunterreguliert. Aufsehen erregte Rapamycin durch Forschungsarbeiten im Tiermodell, die auf eine Lebensverlängerung hindeuteten; ein neues Anti-Aging-Medikament schien geboren. Wie Forscher des Helmholtz Instituts anschließend entschlüsselten, ist diese lebensverlängernde Wirkung vor allem auf die Wachstumshemmung von Tumoren zurückzuführen.
Eine noch junge Klasse im Rahmen der Immunsuppressiva sind die sogenannten Biologicals. Hierbei handelt es sich um biotechnologisch hergestellte Proteine, die gezielt in immunologische Prozesse eingreifen, indem sie je nach Präparat den intrazellulären Entzündungsschalter TNFalpha oder proentzündliche Botenstoffe oder deren Rezeptoren hemmen. Medikamente dieser Art mit Handelsnamen wie Adalimumab, Etanercept und Infliximab regulieren auf diese Weise eine Gewebeentzündung herunter. Was biologisch klingt, ist allerdings mit erheblichen Nebenwirkungen erkauft, denn Anwender sind unter anderem wesentlich anfälliger für schwere Infektionen.
Kollateralsch Den
Eine gezielte Unterdrückung spezifischer Abwehrreaktionen in bestimmten Geweben ist bislang kaum möglich. Immunsuppressiva wirken immer auf das gesamte Immunsystem ein. Dadurch vermindert sich natürlich auch der Schutz vor Infektionserregern und die Eliminationsfähigkeit von entarten Zellen (Krebs!). Je höher Immunsuppressiva dosiert werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für Folgeerkrankungen. Viele der immunsuppressiv wirkenden Medikamente können darüber hinaus den Blutdruck steigern sowie die Blutzucker- und Cholesterinwerte erhöhen. Außerdem kommt es oft zu Übelkeit, Durchfall und Erbrechen. Ein langfristiger Einsatz kann zudem Nieren, Nerven, Leber und weitere Organe nachhaltig schädigen!









