6. Oktober 2024, 18:00 Uhr
Großer Saal

6. Oktober 2024, 18:00 Uhr
Großer Saal



Das Programm auf einen Blick
Als Anton Bruckner die Nachricht erhielt, dass Richard Wagner am 13. Februar 1883 in Venedig gestorben war, befand er sich mitten in der Kompositionsarbeit an seiner 7. Sinfonie und hatte gerade den Höhepunkt des Adagios fertiggestellt. Nicht nur im anschließenden, Wagner gewidmeten »Trauergesang« finden sich Anklänge an dessen Klangsprache, sondern auch in vielen anderen Passagen der Sinfonie wird der Einfluss von Werken wie dem Ring des Nibelungen, Tristan und Isolde oder der Walküre offenkundig.
Eine ambivalentere Haltung zum Vorbild Wagner prägte den französischen Komponisten Ernest Chausson. Einerseits engagierte er sich nach dem deutsch-französischen Krieg 1871 für die Aufführung von Wagners Werken in Frankreich, andererseits versuchte er sich in seinen eigenen Kompositionen – wie der zwischen 1889 und 1890 entstandenen Sinfonie (Nr. 1) – zunehmend von direkten klanglichen Einflüssen loszusagen.
Le Cercle de l’Harmonie
Jérémie Rhorer | Dirigent
Ernest Chausson 1855–1899
Sinfonie (Nr. 1) BDur op. 20 // 1889–90
I Lent – Allegro vivo
II Très lent
III Animé
// Pause //
Anton Bruckner 1824–1896
Sinfonie Nr. 7 EDur WAB 107 // 1881–83
I Allegro moderato
II Adagio. Sehr feierlich und sehr langsam
III Scherzo. Sehr schnell – Trio. Etwas langsamer
IV Finale. Bewegt, doch nicht schnell
Konzertende ca. 20:15 Uhr
Ernest Chausson war zeitlebens alles andere als ein hungernder Künstler. Geboren 1855 in eine wohlhabende Unternehmerfamilie, musste er sich nie Sorgen um sein Auskommen machen – und eigentlich auch nicht arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu sichern. Gerade deshalb hatte er allerdings die Qual der Wahl: Wollte er sich der Literatur, der Malerei oder doch lieber der Komposition widmen? Chausson wuchs abgeschirmt und behütet auf und kam durch einen Privatlehrer in den Genuss einer hervorragenden kulturellen Bildung. Seiner Familie zuliebe absolvier te er zunächst einen Abschluss in Jura, bevor er sich schließlich ganz der Komposition widmete. Mit 24 Jahren wurde er Schüler von Jules Massenet am Pariser Konservatorium und bewarb sich um den renommierten Kompositionspreis Prix de Rome. Als er dort erfolglos blieb, gab er seine institutionelle Ausbildung bald wieder auf und widmete sich von nun an dem Komponieren als hochtalentierter Autodidakt. Ohne materielle Zwänge hatte Chausson so das Privileg, sich für das Komponieren, Überarbeiten und ReKomponieren seiner musikalischen Einfälle so viel Zeit zu lassen, wie er nur wollte. Er pflegte dazu die Sommermonate auf dem Land, den Winter in Paris zu verbringen. Trotz seiner komfortablen Lebenssituation quälten Chausson sein Leben lang Zweifel an seinem eigenen kompositorischen Talent. Ob es für sein künstlerisches Schaffen wohl produktiver gewesen wäre, wenn er vom Komponieren hätte leben und daher Werke schneller fertigstellen müssen? Den deutlich weniger finanziell privilegierten Anton Bruckner hielten chronische Geldnöte – oder zumindest seine Vorstellung davon – jedenfalls auch nicht davon ab, seine Werke wieder und wieder umzuarbeiten – wenn auch bei ihm Revisionen häufig erst nach der Uraufführung eines Werkes erfolgten. Die einzigen Kompositionen, die so über Jahre ihren Weg aus Chaussons Arbeitszimmer in die Welt fanden, waren Lieder und andere Miniaturen, denen man anmerkt, dass ihr Autor zuvor minutiös an ihnen gefeilt hatte. Vor diesem Hintergrund wundert es kaum, dass Chausson für die Komposition
Ernest Chausson Sinfonie (Nr. 1) B-Dur
einer Oper über den KönigArtusStoff fast zehn Jahre brauchte – auch das Libretto hatte er selbst verfasst. In der Zwischenzeit gelang es ihm, sich von seinem lähmenden Perfektionismus zu befreien. Im Jahr 1889 begann er – angeregt durch seinen Schwager – mit der Komposition seiner ersten Sinfonie, in der sein zweifelloses kompositorisches Potenzial voll zur Geltung kommt. Bereits die Uraufführung 1891 in Paris sorgte für Enthusiasmus beim Publikum – allerdings warfen ihm kritische Stimmen auch vor, dass einige Passagen »unklar« und »zu dissonant« seien. Seinen finalen Durchbruch verdankte das Werk schließlich einer Aufführung der Berliner Philharmoniker unter Arthur Nikisch 1897 in Paris.

Ernest Chausson Sinfonie (Nr. 1) B-Dur
Der Aufbau der Sinfonie folgt dabei dem Vorbild César Francks, zu dessen wichtigsten Förder:innen Chausson gehörte. Francks 1888 fertiggestellte 1. Sinfonie bestand unkonventioneller Weise aus nur drei statt vier Sätzen und Chausson nahm sich daran auch in seiner eigenen Sinfonie ein Beispiel. Der erste Satz folgt der Sonatenhauptsatzform. In einer langsamen Einleitung wird das feierliche Hauptthema der Sinfonie eingeführt, das sich zu einem ersten erschütternden Höhepunkt steigert. Die hochdramatische Ernsthaftigkeit des Anfangs ist im anschließenden Allegro vivo schnell verflogen. Das zweite Thema des Satzes zeichnet sich durch seine fast schon impressionistische chromatische Harmonisierung aus. Den Beginn des zweiten Satzes könnte man fast als ›TristanParaphrase‹ bezeichnen, so überdeutlich sind die Anklänge an das Vorspiel zum dritten Aufzug. Zugleich mischen sich aber auch Zitate aus anderen Passagen des Musikdramas in das musikalische Gewebe – mal mehr, mal weniger offensichtlich. Der dritte Satz ist ein manisches Rondo, ergänzt um einen Epilog –eine weitere Parallele zu Francks Sinfonie. Nach stürmischen Sechzehnteln in Streichern und Holzbläsern, die die Musik von Klingsors Zaubergarten aus Wagners Parsifal heraufbeschwören, folgt als zweites Thema ein hymnischer Blechbläserchoral. Zum Schluss blitzt das Thema des ersten Satzes nochmals auf und bildet so eine zyklische Verbindung zwischen erstem und letztem Satz der Sinfonie. Auch bei der Dramaturgie der Tonarten orientiert sich Chausson am Vorbild Franck: Francks Sinfonie beginnt in dMoll und endet in DDur, der Mittelsatz steht währenddessen in bMoll. Chausson dreht dieses Prinzip um: Seine Sinfonie beginnt in BDur, der letzte Satz steht in bMoll (mit einem Ende in BDur), während der Mittelsatz in der Tonart dMoll steht. Obwohl er dieselben Grundtonarten verwendet, stellt er so zugleich die »Per aspera ad astra«Dramaturgie von Francks Sinfonie auf den Kopf.
Die Musik Richard Wagners war für Chausson als Komponist – wie auch für Anton Bruckner – ein wichtiger Bezugspunkt. Eine besondere Anziehungskraft übte das Musikdrama Tristan und Isolde auf ihn aus. Zum ersten Mal
Sonatenhauptsatzform bezeichnet den dreiteiligen Aufbau (Exposition –Durchführung –Reprise) eines ersten oder letzten Satzes einer Sonate, Sinfonie oder eines Solokonzerts »Per aspera ad astra« übersetzt: »Durch Mühsal kommt man zu den Sternen« (Seneca); bezeichnet in der Musik einen dramaturgischen Bogen vom ›Dunklen‹ ins ›Helle‹
(Nr. 1) 1889–90
hatte er die Oper im Sommer 1880 in München gehört – der damals 25jährige Chausson war zu dieser Zeit noch Schüler Massenets in Paris gewesen. Die Bayreuther Festspiele besuchte er erstmals im Sommer 1882, um dort Parsifal zu sehen. Es folgten weitere Besuche in den Jahren 1883 und 1889. Kompositorisch versuchte Chausson allerdings in derselben Zeit, sich mehr und mehr von seinem Vorbild zu emanzipieren. Bereits 1884 beklagte er sich bei seinem Freund Paul Poujaud: »Das rote Gespenst Wagner lässt mich nicht los – ich beginne, es zu hassen.« Chaussons ambivalentes Verhältnis zu Wagner, das er mit vielen seiner Zeitgenoss:innen teilte, hatte dabei eine kulturpolitische Dimension, die über den Hass auf das »rote Gespenst« hinausging. Im Jahr 1886 änderte die Société nationale de musique auf Initiative von Chausson, Vincent d’Indy und anderen Komponisten ihre Statuten, um die Aufführung von ausländischen Werken in Frankreich zu ermöglichen. Die Debatten um Wagners Platz im französischen Musikleben und das Verhältnis seines ästhetischen Programms zur Identität der französischen Musik erreichten daraufhin einen neuen Höhepunkt, befeuert auch durch die Pariser Erstaufführung des Lohengrin im Frühjahr 1887. Das Verhältnis zu Deutschland war in den 1880erJahren angespannt, der Ausbruch eines weiteren Krieges schien sich abzuzeichnen. Während sich Chausson also kulturpolitisch durchaus für die Aufführung von Wagners Werken in Frankreich einsetzte, versuchte er sich in derselben Zeit kompositorisch zu ›dewagnerisieren‹. Für ihn bedeutete das vor allem: eine Loslösung von der Programmmusik, die er zuvor mit Vorliebe komponiert hatte. In diesem Sinne stellte seine Sinfonie für Chausson gewissermaßen einen Versuch der künstlerischen Selbstbefreiung vom großen Vorbild Wagner dar – auch wenn er offenbar zugleich nicht gänzlich auf Einflüsse der Wagner’schen Klangwelten verzichten konnte.
Paula Schlüter
Anton Bruckner // Sinfonie Nr. 7 E-Dur
Als Anton Bruckner am 23. September 1881, nur zwanzig Tage nach Vollendung seiner 6. Sinfonie, mit den Entwürfen zur Sinfonie Nr. 7 EDur begann, konnte er kaum ahnen, dass ihm dieses Werk drei Jahre später, im Alter von 60 Jahren, zum internationalen Durchbruch als Kom ponist und zur lang ersehnten Anerkennung als Sinfoniker verhelfen sollte. Während die Sechste durch eine mehrjährige Pause von ihrem Vorgängerwerk getrennt ist, in der Bruckner seine ersten vier nummerierten Sinfonien einer kritischen Durchsicht und formalen Überarbeitung unter zog, spiegelt die mit der Siebten »wiedergewonnene Kontinuität des sinfonischen Schaffens« (HansJoachim Hinrichsen) wohl auch das durch jene Revisionsarbeiten gestärkte Selbstbewusstsein des Komponisten wider. Dennoch oder vielleicht gerade aufgrund des daraus erwachsenen gesteigerten Anspruchs benötigte Bruckner für die Komposition des am 29. Dezember 1882 fertiggestellten Kopfsatzes mehr als ein Jahr, wobei er einige Monate lang zeitgleich am Scherzo arbeitete. Nach der Niederschrift des Adagios zwischen dem 22. Jänner und dem 21. April 1883 konnte er das Finale und damit das gesamte Werk – einzig unterbrochen durch eine Reise zu einer ParsifalAufführung und an das Grab des am 13. Februar unerwartet verstorbenen Richard Wagner in Bayreuth – am 5. September in St. Florian abschließen. Inmitten der Arbeit am Adagio erweiterte Bruckner das Instrumentarium noch um zwei Tenor und Basstuben – die sogenannten Wagnertuben –, deren eigentümlichen, sonoren Klang er während seines Besuchs der Uraufführung des Ring des Nibelungen im August 1876 kennengelernt hatte und die er später auch in seiner 8. und 9. Sinfonie verwendete.
Am 28. März 1884 traf sich der Pianist und ehemalige BrucknerSchüler Josef Schalk mit Arthur Nikisch, dem 1. Kapellmeister des Leipziger Stadttheaters, um für eine gemeinsame Aufführung von Bruckners 7. Sinfonie
Anton Bruckner Sinfonie Nr.
7
E-Dur
»Die Sachen sind so ernst und großartig, daß ich mir von einem Klaviervortrag vor den Leipzigern nicht viel verspreche, lassen Sie also in Gottes Namen den Abend fallen. Dafür wird noch heuer im April oder anfangs Mai im Theater unter meiner Leitung ein großes Konzert zu Gunsten des Wagnerdenkmals stattfinden und ich gebe Ihnen hiermit mein heiliges Ehrenwort, daß ich diese Symphonie in sorgfältigster Weise zur Aufführung bringen werde. Ich halte es für mich von nun an für eine Pflicht für Bruckner einzutreten.«
Arthur Nikisch dem Bericht Josef Schalks zufolge in einem Brief vom 30. März 1884 an seinen Bruder Franz Schalk
in einer Version für zwei Klaviere zu proben, bei der Nikisch als Ersatz für den Dirigenten Ferdinand Löwe einsprang. »Kaum hatten wir den ersten Satz der 7. gespielt«, berichtete Schalk seinem Bruder Franz zwei Tage später, »fing der sonst so ruhige und gesetzte Nikisch Feuer und Flamme; […] ›Seit Beethoven [ist] nichts auch nur ähnliches geschrieben worden. Was ist da Schumann! etc. etc.‹[,] ging es in einem fort. Du kannst Dir denken, wie ich mich auf die Wirkung des 2. Satzes freute und kaum waren wir fertig[,] […] sagte Nikisch: ›Ich werde Ihnen einen ehrlichen Rat geben und zugleich einen Vorschlag machen. Die Sachen sind so ernst und großartig, daß ich mir von einem Klaviervortrag vor den Leipzigern nicht viel verspreche, lassen Sie also in Gottes Namen den Abend fallen. Dafür wird noch heuer im April oder anfangs Mai im Theater unter meiner Leitung ein großes Konzert zu Gunsten des Wagnerdenkmals stattfinden und ich gebe Ihnen hiermit mein heiliges Ehrenwort, daß ich diese Symphonie in sorgfältigster Weise zur Aufführung bringen werde. Ich halte es für mich von nun an für eine Pflicht für Bruckner einzutreten.‹« Für Bruckner ergab sich somit die Möglichkeit, sein neues Werk einem unvoreingenommenen Publikum vorgestellt zu sehen; eine Aussicht, die ihn angesichts der missgünstigen Kritik, der seine Werke in Wien immer wieder ausgesetzt waren, geradezu euphorisch stimmte.
»Hochwohlgeborner, hochverehrter Herr Kapellmeister!« – »Hochwohlgeborner Herr Kapellmeister! Edelster, hochberühmter Künstler!« – »Hochwolgeborner [sic!], hochberühmter größter Dirigent!« – »Hochwolgeborner
Anton Bruckner Sinfonie Nr. 7 E-Dur
Herr Kapellmeister! Edelster Gönner!« Die manierierten Titel, welche Bruckner dem mehr als 30 Jahre jüngeren Nikisch in seinen Briefen von nun an angedeihen ließ, verdeutlichen, wie sehr dem Komponisten am Gelingen des Projekts gelegen war. Die Uraufführung, die letztlich auf den 30. Dezember 1884 verschoben werden musste und bei der Nikisch die Wagnertuben in Ermangelung geeigneter Instrumente durch Hörner ersetzte, geriet in Bruckners Anwesenheit zu einem »wahrhaft durchschlagenden Erfolg« (Neues Wiener Tagblatt), von dem die Leipziger Nachrichten schwärmten: »Das Werk selbst fordert die höchste Bewunderung heraus.« Spätestens mit der ebenso enthusiastisch gefeierten Münchner Erstaufführung am 10. März des darauffolgenden Jahres unter Hermann Levi – die auch Anlass für die spätere Widmung der Sinfonie an König Ludwig II. war – trat das Werk seinen Siegeszug an, den auch Eduard Hanslicks Verunglimpfung als »symphonische Riesenschlange« nicht aufhalten konnte. Der überwältigende Erfolg führte schließlich dazu, dass die Siebte und die zu Bruckners Lebzeiten nie vollständig aufgeführte Sechste die einzigen beiden Sinfonien sind, an denen der Komponist keine gravierenden nachträglichen Änderungen vornahm und die deshalb in nur einer Fassung vorliegen.
»Einfahrt in einen vorhandenen Hafen«
Über einem flächigen Tremolo schwingt sich ein für Bruckners Sinfonik ungewohnt weitschweifendes, von Violoncelli und SoloHorn vorgetragenes Thema empor, dessen raumgreifende Akkordbrechung von einer expressiven chromatischen Wendung beantwortet wird. Der elegische Gestus dieses Beginns nimmt dabei gleichsam den Charakter des gesamten Werkes vorweg: Weich, hymnisch, in sich ruhend und organisch fließen die Motive ineinander und zeichnen damit ein völlig anderes Klangbild als die schroff kontrastierenden Formblöcke der 6. Sinfonie. Beiden Werken gemeinsam ist die zweiteilige Sonatenform, innerhalb der Bruckner den Übergang zwischen Durchführung und Reprise gekonnt verschleiert und das Geschehen stattdessen auf den Beginn der mit »sehr feierlich« überschriebenen Coda fokussiert. Die majestätische Schlusssteigerung spiegelt im Gegensatz zu den dramatischen Pendants etwa der 5. und 6. Sinfonie schließlich keinen kompositorischen Kraftakt wider:
Anton Bruckner
Sinfonie Nr. 7 E-Dur

Anton Bruckner, Fotografie von Franz Hanfstaengl, 1885 während Bruckners Aufenthalt in München zur Aufführung der Sinfonie Nr. 7 durch Hermann Levi entstanden
Ganze 30 Takte lang erstrahlt das Hauptthema, begleitet von auf und abwogenden Dreiklangsbrechungen, und erweckt damit den Eindruck einer »feierlich langsame[n] Einfahrt in einen vorhandenen Hafen« (Peter Gülke). Zahlreiche Korrekturen, Radierungen und Überklebungen in der handschriftlichen Partitur zeigen, dass Bruckner den Beginn des Adagios mehrmals umgearbeitet hat. War das choralhafte Hauptthema anfangs für einen vollen Bläserchor aus Klarinetten, Fagotten, Hörnern, Trompeten und Posaunen notiert, so vertraute er es zu einem späteren Zeitpunkt
Anton Bruckner Sinfonie Nr. 7 E-Dur
schließlich allein den Wagnertuben und der Basstuba an. Während die ersten vier Takte motivisch mit dem Hauptthema des Kopfsatzes verbunden sind, gleicht der anschließende Streichersatz der Stelle »non confundar in aeternum« (»Laß mich nicht zu Schanden werden ewiglich«) aus dem Te Deum, an dem der Komponist vor und nach Fertigstellung seiner Sinfonie arbeitete. Für den Moment, in dem das Hauptthema im späteren Satzverlauf nach einer großartigen Steigerung in strahlendem CDur erklingt, hat Bruckner im Nachhinein, wohl auf Anraten Nikischs, einen zusätzlichen Becken und Triangelschlag notiert, den er auf einem gesonderten Papierstreifen in die Partitur einklebte. Ob das später über diesem Zusatz notierte »gilt nicht« von seiner Hand stammt, bleibt bis heute Gegenstand lebhafter musikwissenschaftlicher Diskussionen. Bruckners Berichten zufolge war der Satz bereits bis zu diesem Punkt gediehen, als ihn die Nachricht vom Tod Wagners erreichte. »Zum Andenken an den Hochseligen, heißgeliebten unsterblichen Meister« fügte er daraufhin einen achttaktigen Trauerchoral in cisMoll ein, an dessen Ende sich ein schmerzhafter Klageruf der Hörner im dreifachen Forte erhebt. Der mit der für Bruckners Scherzi ungewöhnlichen Tempoangabe »Sehr schnell« versehene dritte Satz exponiert einen treibenden Rhythmus, über dem ein knappes Fanfarenmotiv mit zügellos chromatisch modulierenden Streicherfiguren einen atemlosen Wechselgesang anstimmt, dem im Trio eine schlichte, idyllische Pastorale entgegentritt. Mit seiner Tremolobegleitung und der »leicht durchschaubare[n] Verkleidung« (Hinrichsen) des Kopfsatzhauptthemas greift der Beginn des Finales schließlich den Tonfall des Werkanfangs wieder auf, ehe der anschließende, von den Wagnertuben verstärkte Streicherchoral gewissermaßen auf das Adagio zurückblickt. In der Reprise lässt Bruckner die Themen des Satzes ungewohnterweise in umgekehrter Reihenfolge auftreten, sodass die letztliche Wiederkehr des Hauptthemas mühelos in die grandiose Steigerungswelle der Coda münden kann, deren Faktur nahezu identisch mit jener des Kopfsatzes ist. Die abermalige »feierlich langsame Einfahrt in einen vorhandenen Hafen« umschifft somit den gewaltigen Kraftakt jener für Bruckners Werkdramaturgie grundlegenden Finalkulmination, der seine vorhergehenden Werke bestimmte und in noch größerem Ausmaß seine folgende 8. Sinfonie bestimmen sollte.
Andreas Meier
Le Cercle de l’Harmonie ist ein innovatives Ensemble, das für den Charakter und die Besonderheit seiner Interpretationen sowie für seinen transparenten und dynamischen Klang bekannt ist. Es ist eines der führenden Orchester, die das klassische und romantische Repertoire auf historischen Instrumenten erkunden. Fast 20 Jahre nach seiner Gründung setzt es seine Entdeckungsreise unter seinem Gründer und musikalischen Leiter Jérémie Rhorer fort. Dessen Vision besteht darin, sich von der Schwere, die die Tradition mit sich bringen kann, zu entfernen, um den Glanz und den Atem des vom Komponisten beabsichtigten Geistes wiederzuentdecken. Auf diese Weise hat sich das Orchester mit einer innovativen Aufführung von Mozarts Idomeneo beim Festival de Beaune 2006 einen Namen gemacht. Bald darauf folgten Werke wie Don Giovanni, Così fan tutte, Die Hochzeit des Figaro, Die Zauberflöte und Die Entführung aus dem Serail. Mit demselben Geist geht Le Cercle de l’Harmonie an das Instru

mentalrepertoire heran und bietet energiegeladene und leidenschaftliche Interpretationen von Mozart, Gluck, Haydn und Beethoven. Seit einigen Jahren bringt das Ensemble sein Wissen und seine Erfahrung auch in die späteren Repertoires ein: Rossini, Verdi, Wagner, die französische Schule (Berlioz, Méhul, Gossec, Auber) und die Anfänge der Romantik mit Cherubini und Spontini. Im sinfonischen Repertoire sind es nun Mendelssohn Bartholdy, Schumann, Brahms und Bruckner, denen sie ihren ganzen Glanz zurückgeben.
Le Cercle de l’Harmonie ist ein unabhängiges und vielseitiges Ensemble, bestehend aus etwa 50 Musiker:innen, das seine Besetzung an das jeweilige Repertoire anpassen kann und weltweit eingeladen wird, vom Grand Théâtre de Provence, wo es Orchester in Residence ist, über Paris, Amsterdam, Venedig, Brüssel, dem Festival d’AixenProvence bis nach London, Edinburgh und Salzburg.

Dirigent
Vor fast zwanzig Jahren hat Jérémie Rhorer die internationale Musikszene mit seiner unwiderstehlichen Interpretation von Mozarts Opern erobert. Seitdem verfolgt er seinen Weg zwischen Opern und SinfonieRepertoire und dirigiert sowohl sein Ensemble Le Cercle de l’Harmonie als auch Orchester auf der ganzen Welt. Er setzt sich für seine Vision von Musik ein, in der sich Texttreue, ein intimer Sinn für Dramatik und der Geist der Freiheit treffen.
Jérémie Rhorer kam bereits als Mitglied des Kinderchors von Radio France in Kontakt mit Künstler:innen wie Jessye Norman, Colin Davies und Lorin Maazel. Da er sich zum Dirigieren hingezogen fühlte, bildete er sich bei Emil Tchakarov, dem berühmten Assistenten von Herbert von Karajan, weiter. Doch erst über die Komposition, die er bei Thierry Escaich studierte, näherte er sich dem Beruf des Dirigenten. Weitere wichtige Begegnungen waren die mit Nikolaus Harnoncourt, dessen Ideen ihn begeisterten, und mit William Christie, der ihm seine ersten Erfahrungen am Pult vermittelte. Der Kontakt mit historischen Instrumenten war für Jérémie Rhorer eine Offenbarung: Seither erkundet er mit den Musiker:innen von Le Cercle de l’Harmoie den langen Weg von Haydn und Mozart zu Beethoven, Schumann, Brahms und nun Bruckner; auf der Opernseite von Gluck, Berlioz, Auber, Spontini und Cherubini bis hin zu Rossini, Donizetti, Verdi und Wagner. Seine starke und ehrliche musikalische Vision hat ihm Einladungen an die Wiener Staatsoper, an das MusikTheater an der Wien, an die Opernhäuser von Amsterdam, Zürich, Turin, Rom und Brüssel, zu den Salzburger Festspielen, an die Staatsoper Berlin, das Teatro Real in Madrid und das Teatro La Fenice in Venedig eingebracht. Zudem trat er mit dem Orchestre Symphonique de Montréal, dem Gewandhausorchester Leipzig, der Staatskapelle Berlin, dem Orchestra Dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen auf.

Impressum
Herausgeberin
Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH, Brucknerhaus Linz, Untere Donaulände 7, 4010 Linz
René Esterbauer, BA MBA, Kaufmännischer Geschäftsführer
Redaktion
Paula Schlüter, MA
Biografien
Romana Gillesberger
Lektorat
Mag.a Claudia Werner, Romana Gillesberger
Gestaltung
Anett Lysann Kraml
Leiter Programmplanung, Dramaturgie und szenische Projekte
Mag. Jan David Schmitz
Abbildungen gemeinfrei (S. 6), Anton Bruckner Institut Linz (S. 12), C. Doutre (S. 14–15 & 17)
Programm-, Termin- und Besetzungsänderungen vorbehalten LIVA – Ein Mitglied der Unternehmensgruppe Stadt Linz

Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen einen schönen Konzertabend!
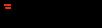

Mit unserer eigenen Hammerkopfproduktion entfesseln wir das volle tonliche Spektrum unserer Flügel und Klaviere –eine Kunst, die Leidenschaft, Erfahrung und Disziplin erfordert. www.bechstein-linz.de
