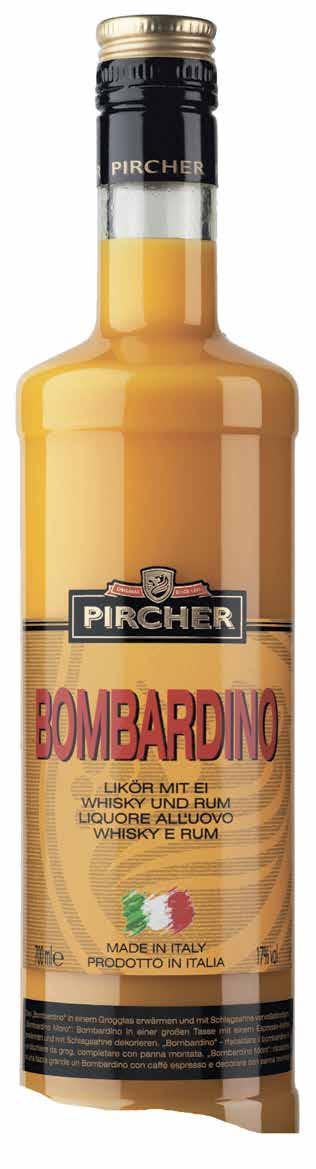Industrie und Lebensmittelwirtschaft
Modern, digital, nachhaltig
Resilienz durch Digitalisierung
Die Verwendung digitaler Tools hat viele Vorteile.
Dennoch gibt es noch Luft nach oben, sagt Wolfgang Weber, Global Head of Engineering and Industry 4.0 bei Henkel.
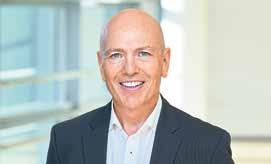
Um Produkte effizienter, nachhaltiger und sicherer zu transportieren, bietet CHEP das „Pooling“ an. Durch das Teilen und Wiederverwenden der Ladungsträger unterstützt der Logistik-Experte die Kreislaufwirtschaft.

Künstliche Intelligenz – Industrie 4.0

Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz gilt als Innovationstreiber, ihre Fähigkeiten eröffnen weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten industrieller Abläufe.
Die Biobranche im Jahr 2022
Peter Röhrig, geschäftsführender Vorstand des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft, bewertet die aktuelle Situation.
Kann Convenience nachhaltig sein?
Christian Rach im Gespräch über Convenience und Nachhaltigkeit, gesunde Ernährung mit viel Geschmack und mögliche Zukunftstrends in der Foodbranche.
„Nachhaltigkeit funktioniert nur gemeinsam“
Großes Interview | Wolfgang Weber| Henkel
14 27 16 34 28
Partner Content | CHEP
Eine unabhängige Kampagne von Contentway Welt | Dezember
Lesen Sie weitere interessante Artikel auf contentway.de
2022
Nachhaltige Schokolade: Von der Kakaobohne zur Tafel
Einfach mal vom hektischen Alltag abschalten – viele tun das mit einem Stück zartschmelzender Schokolade. Sie kann süß, fruchtig, salzig oder bitter schmecken – wird pur, aber auch mit allerlei Extras wie Keksstückchen angeboten – und ist mittlerweile die Lieblingssüßigkeit der Deutschen: 33 Prozent verzehren Tafelschokolade mindestens wöchentlich.1 Mit einem Pro-Kopf-Schokoladen-Konsum von 9,1 Kilogramm liegt Deutschland in Europa auf Platz zwei, gleich hinter der Schweiz (11,3 Kilogramm). 2 Schokolade als Genussmittel ist kaum wegzudenken – und damit auch der Kakao, der Grundlage für diese vielseitige Süßigkeit ist. Bis wir ihn in Form von Pralinen und Co. genießen können, hat die Kakaobohne eine lange Reise hinter sich gebracht. Wohl die wenigsten wissen, wo und auf welche Weise die Kakaobohne geerntet wird und vor welchen Herausforderungen der Anbau aktuell steht. Dabei findet dort ein Umbruch statt, der auch Schokoladeliebende hierzulande betrifft.
Schauen wir auf die Westküste Afrikas: Mehr als die Hälfte der weltweiten Kakaoernte stammt von dort. 3 Inmitten des feucht-warmen Klimas gedeihen die Kakaobäume besonders gut. Sie tragen Früchte mit den begehrten Kakaosamen in sich, die ihrer bohnenähnlichen Form ihren Namen verdanken. Allerdings sind die Kakaobäume häufig überaltert und daher nicht mehr so ertragreich. Hinzu kommt, dass die Bewirtschaftung der Plantagen besonders arbeitsintensiv ist und größtenteils noch von Hand erledigt wird. Den Landwirtinnen und Landwirten fehlt oft das Wissen, den Kakaoanbau produktiver und nachhaltiger zu gestalten. So schätzt die nächste Generation der Kakaounternehmerinnen und -unternehmer das Geschäft als nicht lukrativ genug ein und sucht sich anderweitige Beschäftigungen in den Großstädten. Damit sich das ändert, muss der Kakaoanbau attraktiver und vor allem nachhaltiger gestaltet werden. Genau hier setzen sektorweite Initiativen in der Branche an, um die Kakaobäuerinnen und -bauern zu unterstützen.
Cocoa Life:
Nachhaltigere Schokolade für alle Mondelēz International, einer der führenden Snacking-Anbieter mit Marken wie Milka, Oreo, TUC und Philadelphia, arbeitet seit über zehn Jahren daran, die Bedingungen für den Kakaoanbau zu verbessern und ihn nachhaltig zu gestalten. Mit dem Programm Cocoa Life engagiert sich das Unternehmen dafür, dass sich die Arbeits- und Lebensbedingungen der Kakaobäuerinnen und -bauern verbessern und Kakao nachhaltiger angebaut wird.
Zudem zielt das Programm darauf ab, dass Gemeinden ihre Entwicklung selbst in die Hand nehmen können – damit der Kakaoanbau zu einem zukunftsträchtigen Geschäft wird. Bis zum Jahr 2025 hat sich Mondelēz International zum Ziel gesetzt, den Kakao, den das Unternehmen für ihre Schokolade benötigt, zu 100 Prozent über Cocoa Life zu beziehen. Milka ist da bereits einen großen Schritt weiter: Seit 2019 wird für die Alpenmilch-Schokolade ausschließlich Kakao aus diesem Nachhaltigkeits-Programm verwendet.
Kürzlich hat das Unternehmen bekannt gegeben, Cocoa Life bis 2030 mit zusätzlich 600 Millionen US-Dollar zu unterstützen. Damit belaufen sich die Investitionen seit Beginn des Programms auf insgesamt 1 Milliarde US-Dollar.
Die Schwerpunkte von Cocoa Life Bis 2030 strebt Cocoa Life an, die Zahl der Bauernhaushalte zu erhöhen, die ein existenzsicherndes Einkommen erzielen. Das Unternehmen hat den weiteren Ausbau von Überwachungs- und Abhilfesysteme von Kinderarbeit zum Ziel und beteiligt sich aktiv an öffentlich-privaten Partnerschaften zur Verbesserung der Bildungsqualität – dem Schlüssel für ein besseres Einkommen. Auch der Schutz des Regenwalds ist eine Priorität von Cocoa Life: Das Programm unterstützt die Stärkung von Überwachungssystemen hinsichtlich Entwaldung, fördert die Agrarforstwirtschaft und steigert der Attraktivität des Waldschutzes.

Frauenförderung als ein Schlüssel zur Veränderung in den Anbaugemeinden
ist eines der Grundprinzipien des Programms. Die Stärkung der Frauen über die örtlichen Frauengruppen, das Angebot zur finanziellen Bildung und das Aufzeigen zusätzlicher Geschäftschancen für Frauen treibt den Wandel voran. Letztlich kommt die Gleichstellung der Geschlechter allen zugute, deshalb ist die Förderung der Selbstbestimmung von Frauen einer der Grundsätze von Cocoa Life. Eine wichtige Rolle spielt dabei Yaa Peprah Amekudzi. Als führende Mitarbeiterin bei Cocoa Life ist die Ghanaerin mit allen Beteiligten des Kakaosektors vernetzt, von Politikerinnen und Politikern bis NGOs. So kann sie den Bedürfnissen der Frauen Gehör verschaffen und einen gerechteren Kakaoanbau fördern. Was sie besonders fasziniert, ist der positive Wandel in den vergangenen zehn Jahren. „Ich bin sehr stolz auf die Frauen des Landes. Ihr Mut, ihre Stimme zu erheben und das Wissen, eine starke Stimme zu haben, sowie die wirtschaftlichen Chancen, die sie für sich finden, sind beeindruckend“, sagt Yaa Peprah Amekudzi.
Bisherige Fortschritte von Cocoa Life
• Die Nettoeinkommen der Bäuerinnen und Bauern sind in Ghana um 15 Prozent und in der Elfenbeinküste um 33 Prozent gestiegen.
• Höhere Kakaoerträge und zweistellige Steigerungsraten bei den Bäuerinnen und Bauern, die ein existenzsicherndes Einkommen erzielen.
• 61 Prozent der Cocoa-Life-Gemeinden in Westafrika sind mit Überwachungsund Abhilfesystemen für Kinderarbeit ausgestattet, mit dem Ziel, bis 2025 100 Prozent zu erreichen.
„Auch wenn bereits Fortschritte und Auswirkungen erzielt wurden, stehen die Kakaobäuerinnen und -bauern und ihre Gemeinden noch immer vor großen Herausforderungen. Wir setzen uns leidenschaftlich für einen dauerhaften Wandel im gesamten Kakaosektor ein und investieren in den integrierten Ansatz von Cocoa Life. Denn wir wissen, dass nur eine langfristige Strategie für den gesamten Sektor, unterstützt durch Maßnahmen aller Akteure der Branche, der Regierungen der Erzeuger- und Verbraucherländer und der Zivilgesellschaft, zu einer dauerhaften Wirkung führen wird“, so Christine Montenegro McGrath, Senior Vice President und Chief Impact and Sustainability Officer von Mondelēz International.
Verbesserung durch Kooperationen Die Herausforderungen lassen sich nicht allein von Unternehmen bewältigen. Deshalb ruft Mondelēz International dazu auf, zusammenzuarbeiten und Partnerschaften im Kakaosektor einzugehen. Dirk Van de Put, Chairman & CEO von Mondelēz International, kommentiert: „Wir freuen uns über die vielversprechenden Ergebnisse unserer Investitionen, aber wir fordern auch mehr sektorweite Bemühungen und Maßnahmen, um eine größere Wirkung zu erzielen, einschließlich neuer öffentlich-privater Partnerschaften. Wir wollen eine umfassende Zusammenarbeit anregen, um Kakao gemeinsam voranzubringen.“ Durch ein gemeinsames Umdenken kann die Zukunft des Kakaos und der Schokolade gesichert werden.
Mondelēz International bestärkt Menschen in über 150 Ländern darin, auf die richtige Art und Weise zu snacken. 2021 verzeichnete das Unternehmen einen Netto-Umsatz von rund 29 Milliarden US-Dollar und ist ein führender SnackingAnbieter mit beliebten Marken wie Milka, Oreo, TUC, Toblerone und Philadelphia. Mit der Strategie „Snacking Made Right“ bietet das Unternehmen Konsument:innen für jeden Anlass den richtigen Snack, zum richtigen Zeitpunkt, auf die richtige Art und Weise hergestellt, an. www.mondelezinternational.com
2 LEBENSMITTELWIRTSCHAFT
NACHHALTiGE KAKAOANBAUBETRiEBE ERHALTUNG & WiEDERHERSTELLUNG VON WÄLDERN
Eine unabhängige Kampagne von Contentway MONDELEZ INTERNATIONAL – PARTNER CONTENT
GESTÄRKTE KAKAOGEMEiNSCHAFTEN
1 Statista 2 Statista 3 Cocoa Life
kakaoanbau
kakaoanbau isT keine leichTe aufgabe. deswegen arbeiTen wir miT kakaobäuerinnen und kakaobauern zusammen, um sie dabei zu unTersTÜTzen, ihre landwirTschafTlichen beTriebe besser zu fÜhren.

DOMiNiKANiSCHE REPUBLiK COTE D'IVOiRE INDONESiEN GHANA INDiEN BRASiLiEN w ei T ere InformaT ionen finden sie unTer www.cocoalife.org bis ende 2021 haben wir 209,954 bäuerinnen und bauern erreichT bis ende 2021 wurden welTweiT 75% des kakaovolumens fÜr unsere schokoladenmarken Über cocoa life bezogen bis ende 2021 haben wir 3 mio. gemeindemiTglieder erreichT cocoa life umfassT 6 kakaoproduzierende länder ghana, coTe d’Ivoire, indonesien, indien, die dominikanische republik, brasilien RZ_Aufsteller_A2_Cocoa Life_V07.indd 2 17.11.22 15:36
WEITERE INHALTE
Industrie 4.0 11. Energiepreise 16. Automatisierung 20. Solidarität 24. Künstliche Intelligenz
CONTENTWAY.DE
Nachhaltigkeit entlang der Lieferkette
Das Siegel von We Care geht über herkömmliche Bio-Siegel hinaus.
CONTENTWAY.DE Qualitätsmerkmal Regionalität Trends und Entwicklungen bei Nahrungsmitteln und Getränken.
CONTENTWAY.DE Zukunft ist schon da In der Logistik-Branche ist die Zukunft Gegenwart.
AUCH IN DIESER AUSGABE:
INDUSTRIE UND LEBENSMITTELWIRTSCHAFT

Die deutsche Industrie ist die Grundlage des gesellschaftlichen Wohlstands und das Fundament für den wirtschaftlichen Erfolg. Auf Grund der aktuellen Krisen muss die innovative und dekarbonisierte Transformation der Industrie in allen Branchen beschleunigt werden. Allerdings stellen sich die Energieabhängigkeit Deutschlands und die gehemmte Digitalisierung als die größten Herausforderungen der deutschen Industrie dar. Hier müssen Alternativen und Lösungen gefunden werden, um energieunabhängig zu werden, aber auch effizienter und nachhaltiger zu produzieren. Mehr denn je ist es nun an der Zeit eine moderne Industrie zu definieren und zu gestalten.

Auch die Lebensmittelwirtschaft durchlebt derzeit einen Wandel, um die
Innovationskraft und das Nachhaltigkeitsengagement dieser Branche hervorzuheben und durch die Manifestation fixer Ziele voranzutreiben. Dabei stellt sich die Frage unter welchen Voraussetzungen eine Ernährungswende herbeigeführt werden kann, die nicht nur den verschiedensten Essgewohnheiten gerecht wird, sondern ebenso nachhaltig, gesund und genussvoll ist.
Auf den folgenden Seiten informieren wir Sie in interessanten Artikeln und spannenden Interviews über die Zukunft der deutschen Wirtschaft und wie sich die Industrie sowie auch die Lebensmittelwirtschaft neu aufstellt.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Informieren!
Prof. Dr.-Ing. Thomas Bauernhansl, Leiter des Fraunhofer- Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung IPA, Stuttgart und des Instituts für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb der Universität Stuttgart, IFF

FOLGE UNS! Bleiben Sie mit unseren neuesten Kampagnen auf dem Laufenden auf unseren sozialen Kanälen.
EXKLUSIVE ONLINE INHALTE
Sehen Sie sich exklusive Filme und Videos auf unserer Website an.
Auf unserer Website finden Sie viele weitere interessante Artikel und Interviews.

Im Jahr 2020 gaben 43 Prozent der befragten Industrieunternehmen
Predictive Maintenance als wichtigsten Vorteil der Künstlichen Intelligenz im Kontext von Industrie 4.0 an.
65 Prozent der Unternehmen in Deutschland nutzen bereits spezielle Anwendungen für Industrie 4.0. Im Jahr 2020 waren es noch 59 Prozent.
84 Prozent der Unternehmen in Deutschland nutzen Cloud Computing
mit unseren Kunden erstellt und sind Anzeigen.
Für die Lesbarkeit verwenden wir das generische Maskulinum. Die Formulierungen sprechen alle Geschlechter gleichberechtigt an.
Im Jahr 2021 erzielte die deutsche Robotik- und Automationsbranche im In- und Ausland einen Gesamtumsatz von rund 13,6 Milliarden Euro.
Das Bundesland mit der höchsten Anzahl der Betriebe in der Lebensmittelindustrie ist Bayern.
INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway 4
Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer Lebensmittelverband Deutschland
Seite 10 Seite 20
AUSGABE #113 Industrie 4.0 und Lebensmittelwirtschaft
Seite 26
Campaign Manager: Christopher Binder, Aljoscha Sandvoss, Alia Fahda, Nicolas Praeger Geschäftsführung: Nicole Bitkin Head of Content & Production: Aileen Reese Text: Armin Fuhrer, Jakob Bratsch, Thomas Soltau, Dejan Kosmatin, Julia Butz, Chan Sidki-Lundius Coverfoto: shutterstock Distribution&Druck: Die Welt, 2022, Axel Springer SE
mit wertvollen und interessanten Inhalten, die an relevante Zielgruppen verteilt werden. Unser Partner Content und Native Advertising stellt Ihre Geschichte in den Vordergrund. Herausgegeben von: Contentway GmbH Rödingsmarkt 20 DE-20459 Hamburg Tel.: +49 40 87 407 400 E-Mail: info@contentway.com Web: www.contentway.de
Contentway Wir erstellen Online- und Printkampagnen
Die Inhalte des „Partner Content“ in dieser Kampagne wurden in Zusammenarbeit
UND LEBENSMITTELWIRTSCHAFT
28.
32.
34.
Lebensmittelwirtschaft
Biolebensmittel
Veranstaltungen
Convenience-Produkte
Quellen: Statista
Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil
nachhaltig wirtschaften Unternehmen, die klima- und umweltfreundlich sind und soziale Belange beachten, können auf Dauer wirtschaftlich profitieren.
Text: Armin Fuhrer Foto: Alena Koval/Pexels
Die Zahl der deutschen Unternehmensvorstände, die auf Nachhaltigkeit setzen, wächst. Was zunächst wie eine gute Nachricht wirkt, hat auf den zweiten Blick eine Schattenseite, denn in vielen Fällen geht es weniger um das eigene Unternehmen oder gar um das Klima und die Menschen, sondern schlichtweg ums Marketing. Wie aus einer aktuellen Umfrage der Personalberatung Russell Reynolds hervorgeht, sagen 46 Prozent aller befragten deutschen Vorstände, dass Nachhaltigkeitsmaßnahmen lediglich aus Marketingerwägungen getroffen werden. Die Intention dahinter ist also klar: Man hofft, sich bei den Kunden und Verbrauchern ein positives Image aufzubauen.
Doch das ist ziemlich kurz gedacht. Tatsächlich lohnen sich Klima- und Umweltbewusstsein nämlich nicht nur für den Planeten, sondern auch für diejenigen Unternehmen, die sich für ein echtes nachhaltiges Wirtschaften entscheiden. Das zeigt eine weitere, von Genpact durchgeführte Untersuchung, die in
diesem Herbst veröffentlicht wurde. Von 510 weltweit befragten Unternehmen –darunter auch viele aus Deutschland –konnten 58 Prozent aller tatsächlich nachhaltig-arbeitenden Unternehmen in den beiden vergangenen Jahren auf eine gute Geschäftsentwicklung zurückblicken – unter allen anderen Unternehmen lag die Zahl nur bei rund 40 Prozent. Circa 70 Prozent entwickelten darüber hinaus neue, ökologische Technologien, wodurch sie sich zusätzlich fit für die Zukunft machten. Das zeigt: Nachhaltiges Agieren kann sehr wohl positive Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung haben.
Auch das Lieferkettengesetz, das Anfang kommenden Jahres in Kraft gesetzt wird – für viele Unternehmen allerdings einen bürokratischen Mehr-
Tatsächlich lohnen sich Klima- und Umweltbewusstsein nämlich nicht nur für den Planeten, sondern auch für diejenigen Unternehmen, die sich für ein echtes nachhaltiges Wirtschaften entscheiden.
aufwand bedeutet – sollte nicht nur als Belastung gesehen werden, sondern auch als Chance. Zwar betrifft das Gesetz eigentlich nur Unternehmen ab 3.000 Mitarbeitern, doch auch zahlreiche kleine Mittelständler werden die Auswirkungen zu spüren bekommen, weil sie als Zulieferer für Großunternehmen arbeiten und von diesen in die Pflicht genommen werden können. Aber abgesehen von dem unliebsamen zusätzlichen Aufwand, weisen Experten darauf hin, dass gerade in Zeiten unsicherer Lieferketten, unter denen ganze Branche leiden, nachhaltige und somit stabile Lieferketten einen großen Wettbewerbsvorteil darstellen können, da sie Firmen resilienter gegen neue Krisen machen.
Auch die grüne Transformation bedeutet zwar zunächst Investitionen, aber Unternehmen, die zum einen auf Erneuerbare Energien setzen und zum anderen konsequent überprüfen, an welchen Stellen sie zum Teil viel Energie und damit Kosten sparen können, haben langfristig die Nase vorn. Das gilt angesichts der hohen Energiepreise noch mehr als bisher. Und den Vorteil, den sich manche Unternehmen vom Greenwashing erhoffen, nämlich bei den Kunden und Verbrauchern ein positives Image zu haben, erreichen sie auch – aber mit einem guten Gewissen und ohne die ständige Furcht, möglicherweise aufzufliegen.
Auch die grüne Transformation bedeutet zwar zunächst Investitionen, aber Unternehmen, die zum einen auf Erneuerbare Energien setzen und zum anderen konsequent überprüfen, an welchen Stellen sie zum Teil viel Energie und damit Kosten sparen können, haben langfristig die Nase vorn.
fakten Unternehmen können sich Nachhaltigkeit auf drei Wegen bestätigen lassen. Erstens durch eine Zertifizierung nach ISO 14001 oder ISO 45001. Zweitens können sie einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen und sich drittens von unabhängigen Anbietern ein Compliance-Profil erstellen lassen.

5 INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway
Finden Verbraucher heraus, dass sie von einem Unternehmen getäuscht wurden (Greenwashing), führt dies schnell zu einem Vertrauensverlust.
Transparente und nachhaltige Produktion
einleitung
CO2-Fußabdruck, Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft: Um den Klimawandel zu stoppen, müssen wir nachhaltig und umfassend umdenken. Gerade Deutschland als maßgebender Produktionsstandort muss hier vorangehen und die Maßstäbe setzen.
Einer der zentralen zukünftigen Aspekte ist der Einstieg in eine reale Kreislaufwirtschaft. Produkthersteller müssen Reparaturen und den Austausch verschlissener Komponenten ermöglichen und langlebige Komponenten bei der Herstellung neuer Produkte wiederverwendet werden. Denn gerade in komplexen Produkten werden viele Teile während ihres Lebenszyklus nur wenig benutzt. Wenn sie noch tauglich sind, spricht nichts dagegen, sie erneut zu integrieren. Doch dazu muss die Geschichte eines Produkts und seiner Komponenten von Anfang an dokumentiert sein. Ein Weg dazu kann die digitale Lebenszyklusakte sein, an der wir aktuell arbeiten. Darin wird digital festgehalten, um welches Produkt es sich handelt, welche Teile enthalten sind, welche Materialien verbaut wurden und welche Verarbeitungsschritte genau durchgeführt worden sind. Nur so ist echtes Recycling im Sinne einer Wiederverwertung möglich. Denn derzeit scheitert die Wiederverwertung daran, dass niemand weiß, welche Kunststoffe oder Metallverbindungen ursprünglich verbaut wurden.
Ein weiterer Baustein auf dem Weg der Eindämmung des Klimawandels ist die kontinuierliche Optimierung der Energieeffizienz. Unsere Vision Production Level 4 zeigt auf, wie eine verteilte Produktion, eine Shared Production, aussehen kann. Darin werden Produktionsnetzwerke intelligent, produktindividuell und firmenübergreifend konfiguriert. Konkret stellen wir uns digitale Plattformen vor, über die Maschinen angeboten werden, die zur Fertigung ausgewählt werden können. Bei deren Auswahl können so zukünftig Eigenschaften wie die Energieeffizienz oder ein geringer CO2-Fußabdruck berücksichtigt werden. Durch die Verknüpfung der
Produktionsdaten mit der Lebenszyklusakte kann zudem der Nachweis einer nachhaltigen Fertigung für das einzelne Produkt festgehalten werden.
Auf der Hannover Messe 2023 werden wir erstmals live vorführen, wie der CO2-Fußabdruck eines Produktes exakt ermittelt, dokumentiert und dargestellt werden kann. Technisch ist dieser Schritt machbar, es liegt am politischen Willen, dass er auch umgesetzt wird. Gerade wenn es um die Forschungsförderung geht, sollten diejenigen Projekte besonders berücksichtigt werden, die durch konsequentes Umdenken den Stopp des Klimawandels zum Ziel haben.
Oft wird argumentiert, dass Nachhaltigkeit aufgrund vermeintlich höherer Kosten die Wettbewerbsfähigkeit einschränken würde. Dem möchte ich massiv widersprechen. Vielmehr haben wir in der Vergangenheit durch die Vernachlässigung der ökologischen Folgekosten Kredite auf die Zukunft aufgenommen. Diese Kredite holen uns aktuell ein. Die Folgen der Vernichtung der deutschen Solarindustrie durch eine fehlgeleitete Energiepolitik sind täglich sichtbar. Die Herstellung von wirklich grünem Strom ist unbestritten ein Standortvorteil für Deutschland. Jedoch sind wir immer noch viel zu sehr von fossilen Brennstoffen abhängig und auch die Technologieführerschaft und damit viele Arbeitsplätze sind verloren gegangen. Wir könnten heute schon viel weiter sein.
Als Vorstandsvorsitzender der SmartFactory Kaiserslautern weiß ich, dass bei den meisten unserer Mitgliedsunternehmen die Bereitschaft besteht, die Zukunft unseres Planeten ernsthaft positiv mitzugestalten und ressourcenschonende Technologien zu implementieren. Es wäre wünschenswert, wenn sich viele Unternehmen dem wichtigen Ziel verpflichten würden, den Klimawandel zu stoppen. Gemeinsam können wir an einem Strang ziehen. Neben der notwendigen Änderung eingeschliffener Verhaltensweisen können uns neue Technologien, Künstliche Intelligenz und neu gedachte Systeme helfen.
Seien wir mutig und gehen es an. Für uns, unseren Planeten und unsere Kinder!
Im Jahr 2020 verursachten Industrieprozesse in Deutschland Kohlenstoffdioxid-Emissionen in Höhe von rund 42 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent.
Den mit Abstand größten Anteil an den Umsätzen mit Umweltschutzmaßnahmen haben seit jeher dem Klimaschutz zuzurechnende Waren, Bau- und Dienstleistungen.
Im Jahr 2021 wurden in Deutschland rund 44.000 MehrzweckIndustrieroboter produziert.
Prof. Dr.-Ing. Martin Ruskowski, Vorstandsvorsitzender der SmartFactory Kaiserslautern

Oft wird argumentiert, dass Nachhaltigkeit aufgrund vermeintlich höherer Kosten die Wettbewerbsfähigkeit einschränken würde. Dem möchte ich massiv widersprechen. Vielmehr haben wir in der Vergangenheit durch die Vernachlässigung der ökologischen Folgekosten Kredite auf die Zukunft aufgenommen.
Im Jahr 2021 setzte die deutsche Automatisierungsbranche rund 53 Milliarden Euro um. Zu den Teilbranchen der Automationsindustrie gehören elektrische Antriebe; Schaltgeräte, Schaltanlagen und Industriesteuerungen sowie Messtechnik und Prozessautomatisierung.
Rund 51,3 Prozent der Unternehmen in Deutschland nutzen oder implementieren Machine Learning
INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway 6
Foto: Presse
Quellen: Statista
Dr.-Ing. Timo Böhm von Syntax über die zentrale Rolle der Cloud und warum Digitalisierung auch in den Köpfen der Belegschaft stattfinden muss.

Der deutsche Mittelstand gilt als besonders innovativ, wie ist der Stand in Sachen Digitalisierung?
Grundsätzlich ist die digitale Transformation als Thema bei den Verantwortlichen angekommen. Wer sein Unternehmen auch künftig wettbewerbsfähig aufstellen möchte, weiß, dass er sich damit auseinandersetzen und eine Strategie entwickeln muss. Gerade für den industriellen Mittelstand, den Motor für Innovation und Produktivität für die gesamte Wirtschaft, ist die Umsetzung von Industrie 4.0, also einer digitalisierten Produktionsumgebung, erfolgsentscheidend. Als Partner, der Unternehmen auf dieser Reise begleitet und unterstützt, stellen wir von Syntax immer wieder fest, dass es noch größere Unterschiede gibt: Während einige Kunden schon richtig innovative digitalisierte Werke in Betrieb haben – und damit weltweit ganz vorne mitspielen – stehen manche noch in den Startlöchern. Der Mittelstand ist also auf einem guten Weg, es ist aber bei vielen immer noch Luft nach oben.
Was ist eine digitale Fabrik, und wie schaffen mittelständische Fertigungsunternehmen den Schritt dorthin?
In einer digitalen Fabrik sind Maschinen, IT-Systeme und Prozesse intelligent miteinander vernetzt. Ziel ist es, alle Abläufe der gesamten unternehmensinternen Wertschöpfungskette abbilden und steuern zu können. Wer hier auf entsprechende Lösungen von etablierten Anbietern wie SAP – Stichwort: Digital Manufacturing Cloud – setzt, profitiert neben einer hohen Funktionalität auch von der Kompatibilität der einzelnen Lösungen. Das wiederum ist Voraussetzung für ein
Fortschritt aus der Wolke
durchgängiges IT-Konzept, bei dem alle relevanten Systeme verzahnt sind – von der Ressourcenplanung über die Maschinensteuerung bis hin zu Lieferanten und Kunden. Grundsätzlich ist aber wichtig zu verstehen, dass Digitalisierung ein permanenter Prozess ist. Es geht nicht darum, einmal eine digitale Fabrik aufzubauen und sich dann zurückzulehnen. Unternehmen müssen ständig auf dem aktuellen Stand der Technik bleiben.
Gibt es denn bereits eine funktionierende digitale Fabrik? Syntax hat Smart Press Shop, ein Joint Venture von Porsche und Schuler, bei der Planung und Umsetzung einer digitalen Fabrik in Halle/Saale unterstützt – das modernste Presswerk der Welt. Die SAP-Systeme und Maschinenanbindung laufen hier komplett in der Cloud, selbst die IT-Infrastruktur ist Cloud-basiert –und deshalb wird weder ein Rechenzentrum noch ein IT-Team vor Ort benötigt. Nahezu alle Prozesse sind miteinander vernetzt, wo es geht, automatisiert und lassen sich von einer zentralen Plattform aus steuern. Darauf zugreifen können die Werker per Mobile Device, auf dem exakt zugeschnittene Anwendungen installiert sind. Diese Apps wurden gemeinsam mit den Nutzern konzipiert und richten sich folglich genau nach ihren Vorstellungen. Und die Zahlen sprechen für sich: Die Fabrik benötigt im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen 60 Prozent weniger Zeit in der Produktionsvorbereitung, produziert

bis zu 25 Prozent schneller und kann 60 Prozent kleinere Losgrößen wirtschaftlich herstellen. Das spart Lagerkosten und steigert die Time-to-Market um 15 Prozent.
Wieso sollten nicht nur Konzerne, sondern auch der industrielle Mittelstand auf die Cloud setzen? Die Cloud ist die ideale Betriebsumgebung für SAP und damit auch für eine digitale Fabrik – alle Daten sind überall, zu jeder Zeit und auf jedem Device verfügbar. Alle wichtigen Prozesse lassen sich mit geringem Aufwand zentral zusammenführen und managen – das schafft Transparenz. Darüber hinaus ist es mit Hyperscalern möglich, neue Technologien wie künstliche Intelligenz zu nutzen, etwa für Analysen, die aus Daten entscheidungsrelevante Informationen machen. Ohnehin macht es der Fachkräftemangel Hidden Champions & Co. immer schwerer, ein eigenes Rechenzentrum und Softwareentwicklung zu betreiben. Das gilt auch und gerade im Hinblick auf das Thema IT-Security, bei der die Cloud – entgegen landläufigen Meinungen – in der Regel deutlich besser dasteht. Wer sich einen kompetenten IT-Serviceprovider an die Seite holt, kann alle diese Vorteile nutzen, sich mit den freien Kapazitäten auf seine Kernkompetenzen konzentrieren und die Firma weiterentwickeln. Erfolgsentscheidend ist immer, dass sich der Partner nicht nur mit der Technologie auskennt, sondern auch die branchenspezifischen Anforderungen und Prozesse des produzierenden Mittelstands voll und ganz versteht.
Wie schätzen Sie die Rolle der IT für die Zukunft des industriellen Mittelstands ein?
„In einer digitalen Fabrik sind Maschinen, IT-Systeme und Prozesse intelligent miteinander vernetzt.“
Die IT spielt eine sehr große Rolle, gleichzeitig gehört sie rein fachlich natürlich nicht zu den Kernkompetenzen der meisten KMU. Für eine gelungene Digitalisierung ist das allerdings kein Hindernis. Wichtig dabei: Die digitale Transformati-
Syntax ist ein global agierender IT-Service- und Cloud-Provider, der insbesondere Unternehmen aus dem industriellen Mittelstand bei ihren vielfältigen IT-Herausforderungen unterstützt. Neben Cloud Computing, Application Management Services, Digital Manufacturing und Modern Workplace liegt ein Schwerpunkt auf vielfältigen Services rund um SAP: Von der Beratung und Planung, über die Implementierung bis hin zum Betrieb regionaler und global verteilter hybrider SAPLandschaften bietet Syntax ein umfassendes Dienstleistungsspektrum. Syntax weist seinen Kunden den Weg hin zu S/4HANA, hilft ihnen bei der digitalen Transformation durch SAP im Industrial IoT und liefert Beratung zum Betrieb von SAP in der Cloud – egal ob Private, Public oder Hybrid. www.syntax.com/de-de/

Foto:Presse
„Die digitale Transformation muss nicht nur auf technischer Ebene, sondern auch in den Köpfen der Belegschaft stattfinden.“
on muss nicht nur auf technischer Ebene, sondern auch in den Köpfen der Belegschaft stattfinden. Ein solches „Digital Mindset“ bedeutet, alte Abläufe durch neue, IT-basierte Prozesse zu ersetzen, in die die langjährige und wertvolle Erfahrung der Werker direkt einfließt. Der Einstieg in diese neue Welt war noch nie so einfach wie heute, denn jedes Projekt, das Dienstleister wie Syntax umsetzen, schafft Best Practices. Die technologischen Vorteile der Cloud mit den individuellen Anforderungen der Kunden zu kombinieren ist eine spannende Aufgabe. Bei uns gestalten motivierte und kreative Köpfe die Digitalisierung und Innovation im Mittelstand – und damit die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland – jeden Tag aktiv mit.
7 INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway
SYNTAX – PARTNER CONTENT
«
«
Dr.-Ing. Timo Böhm, Director Manufacturing Advisory & Innovation Leadership bei Syntax Systems GmbH & Co. KG
Turbulente Zeiten für KMU
einblick
Bereits die Folgen der Coronapandemie haben viele Betriebe getroffen. Der lastende Kostendruck hat die Situation enorm verstärkt.
Text: Julia Butz Foto: Jeriden Villegas/unsplash
Der andauernde Krisenmodus stellt eine permanente Belastung für die deutsche Wirtschaft dar, nun quer durch alle Branchen und unabhängig von der Unternehmensgröße. Noch ist völlig unklar, welche Ausmaße die anhaltenden Krisen annehmen werden. Die exorbitant gestiegenen Energiepreise und Risiken in der Energiebeschaffung führen zu existenziellen Sorgen bei Geschäftsführenden und Mitarbeitern. Zudem stehen immer mehr Unternehmen vor der Herausforderung, trotz Versorgungsunsicherheit, Lieferengpässen und Ressourcenknappheit eine kontinuierliche Produktion aufrechterhalten zu müssen.
Konnte man noch im Frühjahr von einigen besonders stark betroffenen Branchen sprechen, wie Chemie, Maschinenbau, Speditionen und Baugewerbe, sind nach der DIHK Konjunkturumfrage von Mai
Die deutsche Wirtschaft kann mit Krisen umgehen, derzeit aber fehle es nach Auskunft des Deutschen Mittelstands-Bund (DMB) an einer wirklichen Perspektive.

2022 bereits rund 80 % aller Unternehmen von höheren Energiepreisen (Gas, Strom, Kraftstoff und anderes) sowie den gestiegenen Preisen für Rohstoffe, Waren und Vorprodukte betroffen. Viele Betriebe sehen keine andere Möglichkeit, als die gestiegenen Kosten an die Kunden weiterzugeben. Eine schwierige Abwägung angesichts der Markt- und Wettbewerbssituation oder ohne mögliche langjährige Kundenbeziehungen zu belasten. Aufgrund langfristiger Verträge sind zudem schnelle Kostenanpassungen nicht immer möglich. Eine Schwierigkeit auch für den Export, wenn im internationalen Wettbewerb höhere Preise nur schwer durchzusetzen sind.
Die Kostensteigerungen, gekoppelt mit vielen weiteren Herausforderungen, kann für viele Unternehmen das Aus bedeuten. Wirtschaftsbeobachter befürchten eine drohende Welle der Insolvenzen, gerade im klein- und mittelständischen Segment. Nach Umfrage des Bundesverbandes ‚Der Mittelstand BVMW e. V.‘ leiden über 70 % der kleinen und mittleren Unternehmen unter den explodierenden Energiepreisen, fast die Hälfte sieht sich in ihrer Existenz bedroht *. Auch die Landwirt- und Lebensmittelwirtschaft hat mit den höheren Kosten für Energie, Düngemittel und Futtermitteln zu kämpfen. Arbeitskräftemangel und Mindestlohn lassen zudem die Personalkosten in die Höhe schießen.
Laut Statistischem Bundesamt stiegen die Erzeugerpreise in der Landwirtschaft im Spätsommer 2022 um fast 40 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Aufgrund gestiegener Getreidepreise erhöhte sich auch der Preis für pflanzliche
Produkte um mehr als ein Viertel binnen eines Jahres. Die gestiegenen Kosten für Energie und Futter trieben auch die Preise für tierische Erzeugnisse in die Höhe. Im Oktober errechnete das Statistische Bundesamt Preissteigerungen um fast 50 % innerhalb eines Jahres, Milch verteuerte sich um knapp 60 %, der Preis für Schlachtschweine um über 60 %. Damit legten die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um insgesamt 10,4 % zu – der stärkste Anstieg seit etwa 70 Jahren. Im Oktober sind die Erzeugerpreise nach Informationen des Statistischen Bundesamtes** allerdings wieder um 4,2 % gegenüber dem Vormonat gesunken und somit erstmals seit Mai 2020. Verantwortlich seien dafür vor allem die um über 10 % gesunkenen Energiepreise. Experten sehen darin erste Anzeichen, dass der Höhepunkt der Inflation damit überschritten sein könnte, geben aber noch keine Entwarnung.
Internationale Verwerfungen, geopolitische Veränderungen, Herausforderungen, die es immer schon gab, die aber nun aber alle parallel da sind. Die deutsche Wirtschaft kann mit Krisen umgehen, derzeit aber fehle es nach Auskunft des Deutschen Mittelstands-Bund (DMB) an einer wirklichen Perspektive. Die sogenannte „neue Normalität“ sieht so aus, dass sich wirtschaftliche Rahmenbedingungen extrem schnell verändern. Um wirtschaftlich überleben zu können, muss schnell reagiert werden können. Wie sich für zukünftige Veränderungen gut rüsten und Resilienz entwickeln? Wie können erste Schritte zur Energie- & Ressourcenkostensenkung konkret aussehen bzw. innerhalb bestehender Prozesse reguliert
werden? Digitalisierung kann dabei für Faktoren wie Effizienz, Geschwindigkeit und Margenverbesserung der Schlüssel sein. Viele der kleinen und mittleren Unternehmen sollten daher gerade jetzt dringend in Digitalisierung, neue Technik und nachhaltige Energiekonzepte investieren. Wo die dazu nötige Liquidität fehlt, riskiert man, im Wettbewerb zurückzufallen. Kaum ein Betrieb kann es sich daher leisten, in den „Krisenmodus zu schalten“. Im Gegenteil: Gerade jetzt muss investiert werden, strategisch gut geplant, nach vorn gedacht und der unternehmerische Geist aufrechterhalten werden.
*von 850 in Deutschland befragten Unternehmen/Umfrage: Der Mittelstand. BVMW ** Umfrage aus November 2022
fakten
So viel mehr kostet aktuell die Herstellung - am Beispiel einer Flasche Bier : Aufwand für Hopfen: + 100 %, für Glas: + 90 %, für Kornkorken: + 70 %, für Kohlensäure: + 60 %, für Etiketten: + 45 %. Die Kosten für Lagerung sind um 50 %, für Versand um 40 %, für Verpackungen um 25 % und Energie um 65 % gestiegen.
INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway 8
Gerade jetzt muss investiert werden, strategisch gut geplant, nach vorn gedacht und der unternehmerische Geist aufrechterhalten werden.
Jedes zweite KMU muss sich anpassen und vorausplanen, um sicher durch Krisenzeiten zu kommen.
„Die Krise wird das neue Normal“
Warum Unternehmen immer schnelleren Veränderungen ausgesetzt sind und wie sie darauf reagieren können, erklärt Ute Juschkus vom RKW Kompetenzzentrum
Frau Juschkus, wann spricht man eigentlich von einer Krise?
Während der Pandemie hat das RKW eine Reihe von Unternehmen begleitet und interviewt. Wir begegneten dabei vielen Unternehmen, deren Angebote und Geschäftsmodelle nicht mehr funktionierten, zum Beispiel weil sie überhaupt nicht digital aufgestellt waren. Für andere Unternehmen war die Pandemie zwar auch „ungemütlich“, aber sie haben dennoch profitiert. Einige Firmen bezeichneten sich sogar selbst als „Krisengewinner“, weil sie mit ihren Geschäftsmodellen, zum Beispiel mit Angeboten zur Digitalisierung von mittelständischen Unternehmen genau zur richtigen Zeit am Markt waren.
Natürlich gibt es ganz unterschiedliche Krisen. Es gibt solche wie die Pandemie oder den Ukraine-Krieg mit der damit verbundenen Energiekrise, bei denen die Destabilisierung von außen kommt. Und es gibt Krisen, die durch Veränderungen im Inneren eines Unternehmens ausgelöst werden. In beiden Fällen sollte man die Dynamik im Innen und im Außen anschauen. Passen sie zueinander oder nicht? In beiden Fällen muss man aber auch schnell gegensteuern und sich bei Bedarf auch Unterstützung suchen.
Worin sehen Sie derzeit das größte Problem bei den vielen sich überlappenden Krisen?
Vielen Unternehmen, vor allem den kleineren, gehen ganz klar die Reserven aus. Etliche Unternehmen kämpfen sogar um ihr Überleben und brauchen Hilfe. War es während der Pandemie in manchen Fällen noch eine Option abzuwarten, von Reserven zu zehren oder auf bewährte Maßnahmen wie Kurzarbeit zurückzugreifen, ist das jetzt meist nicht mehr möglich. Derzeit sind ja vor allem die Energiepreise ein unkalkulierbarer Kostenfaktor geworden, Fachkräftemangel und Lieferkettenengpässe kommen verstärkend hinzu. Besonders energieintensive Unternehmen stehen vor zum Teil existenziellen Problemen, insbesondere, wenn sie die Preissteigerungen nicht einfach an Ihre Kundschaft weitergeben können.
Wie muss ein erfolgreiches akutes Krisenmanagement aussehen?
Mein Rat: Bilden Sie einen Krisenstab und legen Sie alle Karten offen auf den Tisch. Der erste Fokus ist in der Krise dann meist Liquidität sichern, über zusätzliche Bankkredite, Preisverhandlungen mit Lieferanten oder
Über das RKW Kompetenzzentrum
Foto : Pre s s e
Ute Juschkus, Referentin für Digitalisierung und Innovation beim RKW Kompetenzzentrum

«
„Digitalisierung ist ein wichtiges Werkzeug und kann helfen, Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken oder auch neue Märkte zu erschließen und Netzwerke aufzubauen.“
Kunden oder Ausgleichszahlungen der öffentlichen Hand. Der zweite Blick gilt den Geschäftsmodellen und Prozessen, einer Bestandaufnahme von Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken und der agilen Entwicklung und Umsetzung von schnellen Lösungsansätzen, um Kosten zu sparen und Umsätze zu generieren.
Allerdings ist nach der Krise vor der Krise. Wie müssen längerfristige Maßnahmen aussehen? Stärken Sie Ihre Krisenbewältigungskompetenz, bauen Sie Resilienz auf. Dazu gehören zum Beispiel gute Beziehungen zur Hausbank, zur regionalen Wirtschaftsförderung, den Lieferanten und der Kundschaft, Reserven u.v.a.m. Dazu gehören aber auch resiliente Mitarbeitende, die in der Krise schnell aber auch überlegt handeln können. Wer auf diese Art von Resilienz zurückgreifen kann, ist in akuten Krisensituationen besser gerüstet.
Sehen Sie Unterschiede zwischen großen und kleineren Unternehmen? Große Unternehmen verfügen über mehr Ressourcen
und sind daher meist resilienter. Durch eine stärkere Differenzierung in der Organisation verfügen Sie über mehr spezifische Kompetenzen auch in der Krise. In den kleineren Unternehmen macht der Chef die Strategie und die Problembewältigung häufig allein. Andererseits sind kleine Unternehmen sehr agil und anpassungsfähig – das ist ein großer Vorteil gerade in Krisenzeiten, wie ja ganz viele Unternehmen in den letzten Jahren eindrucksvoll bewiesen haben.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung bei der Schaffung von mehr Resilienz?
Digitalisierung ist ein wichtiges Werkzeug und kann helfen, Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken oder auch neue Märkte zu erschließen und Netzwerke aufzubauen. Digitalisierung wird allerdings niemals wieder so langsam sein, wie heute. Damit wird das Außen für die Unternehmen immer dynamischer und das führt praktisch zu einer ständigen akuten Krisensituation, wenn die Unternehmen nicht selbst dynamischer werden. Deshalb bezeichnen wir beim RKW auch die Krise als das „neue Normal“.
Was ist mit dem wachsenden Druck, nachhaltig zu wirtschaften?
Nachhaltigkeit geht nicht mehr weg, ebenso wenig wie die Digitalisierung und der Fachkräftemangel. Deshalb macht es auch hier Sinn, weniger auf die Probleme, und mehr auf die Chancen schauen. Zwei Beispiele: Unternehmen, die bereits auf erneuerbare Energien und energieeffiziente Technologien umgestellt haben, betrifft das Problem der explodierenden Preise heute weniger stark. Unternehmen, die wissen und auch kommunizieren, wie nachhaltig die eigenen Produkte heute schon sind, kommen bei immer mehr Kundinnen und Kunden sehr gut an.
Das RKW existiert seit 101 Jahren. Wie unterstützen Sie Unternehmen?
Das RKW Kompetenzzentrum ist ein gemeinnütziger und neutraler Impuls- und Ratgeber für den deutschen Mittelstand. Unsere Themen sind Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Unternehmensentwicklung, aber auch Gründungsökosysteme und Personalarbeit.
Umfassende Informationen und viele Tools finden mittelständische Unternehmen auf www.rkw-kompetenzzentrum.de, mehr zur Krise als New Normal auf www.rkw.link/disrupt

Das Angebot des RKW richtet sich an Menschen, die ihr etabliertes Unternehmen weiterentwickeln ebenso wie an jene, die mit eigenen Ideen und Tatkraft ein neues Unternehmen aufbauen wollen. Ziel ihrer Arbeit ist es, kleine und mittelständische Unternehmen für Zukunftsthemen wie Digitalisierung zu sensibilisieren. Das RKW Kompetenzzentrum unterstützt sie dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft zu entwickeln, zu erhalten und zu steigern, Strukturen und Geschäftsfelder anzupassen und Beschäftigung zu sichern. www.rkw-kompetenzzentrum.de

9 INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway
RKW – PARTNER CONTENT
Warum die Matrix punktet
flexible fertigung
Im Interview spricht Prof. Dr. Thomas Bauernhansl vom Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) über die Vorteile der Matrix in der Fertigung
 Text: Jakob Bratsch Foto: Presse
Text: Jakob Bratsch Foto: Presse
durchlaufen nur die jeweils benötigten Prozessmodule und auch die Reihenfolge der Prozesse kann, sofern es das Produkt zulässt, flexibel verändert werden.
Wie ist es zum Begriff Matrix gekommen?
Produktionstechniker verstehen unter einer Matrix eine schachbrettförmige Anordnung von Prozessmodulen: Warenlager, Fertigungsmaschinen, Montagearbeitsplätze arbeiten nicht gebunden an einen gemeinsamen Arbeitstakt und sind über Transportsysteme flexibel miteinander verbunden. Gleichzeitig sind sie cyberphysisch vernetzt: Im virtuellen Raum gibt es einen Digitalen Zwilling, der die Produktionsprozesse und Fertigungs- bzw. Produktionsmodule abbildet. Durch ihn lassen sich die Arbeitsproduktivität, Stoffströme und Maschinenauslastungen optimieren. Mithilfe der Ergebnisse werden dann die realen – physischen – Module gesteuert.
Können Sie uns ein Beispiel aus der Praxis nennen?
Was ist das besondere an Matrixproduktionssystemen?
Matrixproduktionssysteme bieten eine hohe Flexibilität bei gleichzeitig hoher Produktivität, denn sie arbeiten mit frei anfahrbaren Prozessmodulen. Dabei ist ein Prozessmodul die aus logistischer Sicht kleinste unabhängig beplanbare Produktionsressource, die häufig mittels fahrerlosen Transportsystemen mit Material versorgt werden.
Wie sieht das im Einzelnen aus?
In einem getakteten Fließband ist jede Anpassung an neue Varianten mit enormem Aufwand verbunden. Bei der Matrixproduktion ist das ganz anders. Die Systeme sind adaptiv, Maschinen und Stationen sowie der Auftragsdurchlauf passen sich an neue Stückzahlen und Varianten an. Somit sind die Prozessketten flexibel: Produkte
Ja, der Deutschen Lieblingskind, das Auto, ist ein gutes Beispiel: In einer klassischen Produktionslinie gehen alle Autos über alle verbundenen Stationen eines Fließbands. Die Stationen haben alle die gleiche Zeit zur Verfügung zur Ausführung ihrer Arbeitsinhalte. Je höher die Variantenvielfalt, desto häufiger passt die benötigte Zeit für die Ausführung nicht mehr zu der festen Vorgabe. Das nennt man Taktzeitspreizung. Oft werden auch zusätzliche Arbeitsinhalte zur Herstellung einer spezifischen Variante gebraucht, die dann sehr mühsam auf die vorhandenen Stationen verteilt oder mit einer neuen Station integriert werden müssen. Das alles führt zu hohen Produktivitätseinbußen. In einer Matrixproduktion kann jede Variante einen anderen Weg durch die Stationen nehmen und jede Station kann eine andere
Ausführungszeit zur Verfügung haben. Braucht es mehr Kapazität an einer Station, wird diese mit mehr Personal oder Automatisierung versehen oder die Station wird vervielfältigt. Die Auslastung bzw. Produktivität aller Stationen ist somit sehr hoch, während die Varianten und Kapazitätsflexibilität ebenfalls sehr hoch ist.
Wie wird das Ganze gesteuert?
Eine intelligente Steuerung lastet die Prozessmodule gleichmäßig aus. Weil viele Arbeiten auf mehreren Stationen durchgeführt werden können, werden die Aufträge der Station zugewiesen, die freie Kapazität aufweist. Die Stationen arbeiten also ohne einheitlichen Takt und die Matrixproduktion lastet damit die verfügbaren Ressourcen optimal aus.
Das klingt nach einem fragilen Gleichgewicht, wie robust ist das System denn?
Nein, das ist gar nicht fragil. Denn, weil für einen Prozessschritt oft mehr als ein Prozessmodul zur Verfügung steht, fällt nicht das gesamte System aus, wenn ein Modul, also eine Station, nicht mehr funktionsfähig ist. Eine Linie wäre in einem solchen Fall vollständig blockiert. Ganz anders die Matrixproduktion: Sie ist deutlich weniger störungsanfällig.
Wie sieht es mit der Personalisierung aus?
Gut! Auf unterschiedliche Kundenwünsche und Varianten wird im Rahmen der Matrixproduktion sehr flexibel reagiert, indem Stationen hinzugefügt oder entfernt werden. Bei einer Rekonfiguration bzw. Umplanung verteilen sich Prozesse neu auf die Stationen, die Prozessketten werden fast ohne Aufwand angepasst. Ohne das laufende System zu stören, können neue Produkte oder Technologien im Sinne der Wandlungsfähigkeit integriert und getestet werden.
Das klingt, als ob Matrix das ideale System wäre.
Ist es auch in vielerlei Hinsicht. Immer mehr Unternehmen setzen heute auf Matrixproduktion ohne Takt und Band, weil sie eine hohe Flexibilität bei einer gleichzeitig hohen Produktivität bietet. Die eingesetzten Prozessmodule können produkt-, kapazitäts- und/oder prozessorientiert gestaltet werden.
Insbesondere bei komplexen Montagesystemen mit vielen Prozessschritten hat sich in der Praxis gezeigt, dass der manuelle Entscheidungsaufwand zur Gestaltung dieser Prozessmodule und des Gesamtsystems aufgrund der vielen Freiheitsgrade noch sehr hoch ist. Bei engen Restriktionen bezüglich der verfügbaren Fläche, insbesondere bei Brownfield-Planungen oder großen Produkten, sind der Flexibilität Grenzen gesetzt.
Was sind denn die neusten MatrixEntwicklungen an Ihrem Institut, dem Fraunhofer IPA?
Eine ganz neue Entscheidungsunterstützungsmethode des Fraunhofer IPA reduziert den manuellen Aufwand bei der Gestaltung von Matrixproduktionssystemen. Die Methode stellt sicher, dass insbesondere die Prozesse in eine flexible Struktur gebracht werden, die auch wirklich einen hohen Flexibilitätsbedarf haben. Prozesse mit geringerem oder keinem Flexibilitätsbedarf werden im Kompromiss zur begrenzten Fläche und für eine hohe Produktivität in ein Prozessmodul in klassischer Linienstruktur geplant.

Interroll
Besuchen

INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway 10
ANZEIGE
Prof. Dr.-Ing. Thomas Bauernhansl, Leiter des Fraunhofer IPA & des Instituts für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb an der Universität Stuttgart
„Eine intelligente Steuerung lastet die Prozessmodule gleichmäßig aus.“
Sie interroll.com für weitere Informationen
präsentiert seine Sorter Solution Platform. Diese Plattform besteht aus dem Split Tray Sorter, dem Horizontal und dem Vertical Crossbelt Sorter. Außerdem sind Interroll Infeeds, Destinations, Controls und der Global Lifetime Service Bestandteile der Sorter Solution Platform. Was auch immer Ihre Sortieranforderungen sind - Interroll hat die Lösung dafür. Modulare Plattform Höchste Flexibilität: geeignet für verschiedene Güter, Durchsatzleistungen und Branchen Erhältlich mit Interroll Controls Bis zu 50% Energieeinsparung im Vergleich zu elektrischen Sortiersystemen Globaler Lifetime Service für Installations- und Wartungsunterstützung Weltweite Verfügbarkeit
Sorter Solution Platform One platform to sort it all
Interroll
Das Ende der Discountpreise für Energie
energiepreise
Der Strompreis in Deutschland explodiert und scheint kein Limit zu kennen. Das liegt am sogenannten MeritOrder-Prinzip, das kontrovers diskutiert wird.
Text: Thomas Soltau Foto: Michal Pech/unsplash
Wer aktuell auf seine Stromrechnung schaut, bekommt vor Entsetzten schnell graue Haare. Fast täglich steigen die Energiepreise ins Astronomische und viele Verbraucher können die verlangten Summen nicht mehr bezahlen. Dadurch erleidet die Volkswirtschaft einen ökonomischen Schock, der nicht nur durch die weltweiten Krisen zu erklären ist. Klar ist, dass durch den Angriff Russlands auf das Nachbarland Ukraine russisches Erdgas zur strategischen Waffe wurde, um die Energiemärkte in Europa zu destabilisieren. Das alleine erklärt aber noch nicht die absurden Strompreise.
Gut 41 Prozent des Stroms in Deutschland im Jahr 2021 kommt laut Bundesumweltamt aus erneuerbaren Quellen, weitere 19 Prozent aus Braunkohle und knapp zwölf Prozent aus Atomkraft. Diese Produzenten könnten eigentlich weiterhin auf unveränderte Preise setzten. Das Problem

liegt beim Erdgas, das durch die Abhängigkeit von russischen Lieferungen extrem teurer wurde. Denn der Preis für den an der Strombörse, dem Spotmarkt, gehandelten Strom ist direkt an den Gaspreis gekoppelt. Deshalb zahlen Privatkunden sowie Unternehmen teils das Zehnfache dessen, was sie 2021 zahlen mussten.
Grund für den hohen Strompreis ist das Merit-Order-Prinzip an der Strombörse. Alle Anbieter rechnen dabei nach dem Preis des teuersten Erzeugers ab – und das sind derzeit die Gaskraftwerke, die ebenfalls zur Stromerzeugung beitragen. Als Merit-Order (Reihenfolge der Vorteilhaftigkeit) bezeichnet man die Einsatzreihenfolgen von Kraftwerken. Schuld an dieser Regelung ist die Öffnung des Energiemarktes auf Druck der EU. Bis 1998 war der Strommarkt in Deutschland strikt reguliert, die Preise unterlagen in der Regel keinen großen Schwankungen. Seit der Öffnung des Marktes ist Strom zur handelbaren Ware geworden. Die Hälfte des Stroms beziehen Großkunden meist über spezialisierte Broker, wobei die Konditionen privat bleiben. Der Rest wird an der Strombörse zu öffentlich einsehbaren Konditionen gehandelt.
Zudem wird großer Teil der Stromkontingente mehrere Jahre im Voraus gekauft. So können etwa Stadtwerke ihre Kosten auf Jahre hinaus planen. Zusätzlich benötigter Strom besorgt man sich von Anbietern kurzfristig am sogenannten Day-Ahead-Markt. Das Problem: Dort erhalten zwar die günstigsten Anbieter den Zuschlag zuerst. Müssen die Energieversorger jedoch kurzfristig ihren Bedarf einkaufen und erhalten nur noch Strom von den teuren Gaskraftwerken, bestimmen sie den Börsenpreis, zu dem alle
Geschäfte abgewickelt werden: das Merit-Order-Prinzip. Unabhängig davon, ob der Strom aus preiswerten Photovoltaikanlagen kommt.
Fast alle Energieversorger gelten als Gewinner in diesem Spiel. Sie verkaufen den billigen Strom teuer an die Verbraucher, die keine anderen Angebote wahrnehmen können. Solange alle Stromerzeuger ähnliche Preise anboten, funktionierte das Prinzip auch für die Kunden. Als der Gaspreis plötzlich kräftig anzog und damit die Produktion von Strom durch Gaskraftwerke extrem teuer wurde, kippte der lange anhaltende Gleichtakt der Preise. Diese neue Schieflage im Preisgefüge betrifft vor allem Energiediscounter, die Strom über kurzfristige Verträge möglichst günstig einkaufen und Kunden mit langfristiger Preisbindung ködern. Zuerst mussten sie massiv die Preise erhöhen und später das Geschäft häufig komplett einstellen. Durch den Wechsel zu Stadtwerken mussten Neukunden teilweise weit über 80 Cent pro Kilowattstunde zahlen.
Besonders regenerative Energie profitiert vom Preisboom. Da weder bei Solar- noch bei Windkraftanlagen vorher klar ist, wie viel Strom sie produzieren, handeln Betreiber ihre Energie am kurzfristigen Spotmarkt. Das bringt momentan viel Profit. So ist der Marktwert des Stroms aus Land-Windkraftanlagen von 2020 um fast das Zehnfache gestiegen. Ein schöner Zufall für die Betreiber, ein Ärgernis für alle Kunden. Die Preisbildung an der Strombörse wird seitdem kontrovers diskutiert. Der ursprüngliche Sinn vom Merit-Order-Prinzip ist nachzuvollziehen, weil es preiswertere Anbieter begünstigt. Der Gedanke: Wer
seine Produktionskosten gering hält, verdient am meisten Geld und spornt weitere Unternehmen an, Billigstrom zu produzieren.
Mittlerweile gerät der gesamte Markt aus den Fugen – mit fatalen Folgen für die Wirtschaft und Privatkunden. Eine zufriedenstellende Lösung lässt jedoch auf sich warten. Das liegt vor allem daran, dass bislang kein Konzept deutliche Einsparungen bieten kann. Robert Habeck plant nun, den Strompreis vom Gaspreis abzukoppeln. Die Richtung ist eindeutig: Zukünftig wollen Bundesregierung und EU-Kommission die Rahmenbedingungen für den Stromhandel reformieren. Alleine die neuen Technologien und der dadurch veränderte Energieerzeugungsmix gelten als Treiber für eine Reform. Dazu gesellt sich die Erkenntnis aus der aktuellen Krise, möglichst unabhängig zu agieren. Doch die Umsetzung von Reformen benötigen viel Zeit. Firmen und Verbraucher können bis dahin nur auf Hilfspakete der Bundesregierung hoffen. Die EU hat etwa beschlossen, die Übergewinne der Stromkonzerne abzuschöpfen. Ihre Einnahmen sollen künftig bei 180 Euro pro Megawattstunde gedeckelt werden. Der daraus entstandene Überschuss soll Bürger entlasten. Die konkrete Umsetzung ist aber längst nicht geklärt. Klar ist aber, dass Energie auch zukünftig ein kostbares Gut bleibt.
11 INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway
Seit der Öffnung des Marktes ist Strom zur handelbaren Ware geworden.
Zukünftig wollen Bundesregierung und EU-Kommission die Rahmenbedingungen für den Stromhandel reformieren.
Im ersten Halbjahr 2022 stammten rund 51,4 % des Stroms aus Erneuerbaren Energien, 42,2 % kamen aus fossilen Energieträgern und 6,3 % aus Kernenergie.
Viele Lösungen stehen schon parat
additive fertigung
Das additive Fertigungsverfahren im 3D-Druck steigert die Effektivität und senkt die Kosten. Fachkräfte können an anderen Stellen eingesetzt werden.
Text: Armin Fuhrer Foto: eMotion Tech/unsplash
3D-Drucker sind in der Industrie bereits seit einigen Jahren auf dem Vormarsch und diese Entwicklung scheint unumkehrbar. Inzwischen werden sie auch immer häufiger in der Serienproduktion eingesetzt. Eine Umfrage unter europäischen und US-amerikanischen Nutzern ergab jüngst, dass 40 Prozent der User 3D-Drucker für Klein- und 18 Prozent für Großserien einsetzen. Dabei nutzen 47 Prozent sie für die Herstellung mechanischer Geräte und 28 Prozent für die Herstellung von Konsumgütern. Es existieren eine Reihe verschiedener 3D-Druckverfahren. Welches das Beste ist, muss im jeweiligen Fall individuell entschieden werden.
Durch die zunehmende Verbreitung des 3D-Drucks in der Serienproduktion rückt das Problem in den Vordergrund, dass manche Prozesse, die vor und
nach dem Druckvorgang liegen, länger dauern, als der eigentliche Druckprozess. Um einen Stau oder einen Leerlauf zu vermeiden, muss daher ein Bediener vor Ort für den permanenten Fortgang des Produktionsprozesses sorgen. Daher kann es Sinn ergeben, eine vollständig oder teilautomatisierte additive Prozesskette zu errichten – das sogenannte additive Fertigungsverfahren. Denn wenn Prozesse, die nicht zum eigentlichen Produktionsvorgang zählen, ausgelagert und automatisiert werden, wird automatisch bereits der nächste Druckvorgang gestartet, während diese Prozesse noch laufen. Eine solche automatisierte Prozesskette kann rund um die Uhr, also auch nachts und am Wochenende laufen, ohne dass ein Bediener nötig ist. Das steigert die Produktivität erheblich, senkt die Kosten und ist in Zeiten des Fachkräftemangels auch eine willkommene Möglichkeit, das Personal an anderen Stellen, in denen eine Vollautomatisierung nicht möglich ist, einzusetzen.
Das Angebot an Lösungen ist bereits breit und wächst parallel kontinuierlich. So können Prozesse wie das Sortieren und das Be- und Entladen innerhalb der additiven Fertigung voll- oder auch teilautomatisiert werden, um nur zwei von vielen
Beispielen zu nennen. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Vermeidung gesundheitlicher Risiken für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie Verbrennungen oder das permanente Einatmen von schädlichem Pulver, die beim 3D-Druck auftreten. Neben dem gesundheitlichen Aspekt werden durch den Wegfall von Auszeiten überdies Kosten gesenkt.
Ob der Einsatz additiver Verfahren beim 3D-Druck in der Fertigung ökonomisch
sinnvoll sein kann, sollte genau überprüft werden, bevor ein Unternehmen sich dafür entscheidet. Hilfreich ist es, zunächst eine konkrete Anwendung auszuwählen und sie zu testen. Auf Basis bisheriger Erkenntnisse kann eine fundierte Entscheidung über den Sinn einer Einführung getroffen werden. In vielen Fällen können entstehende Fixkosten beim Einsatz additiver Fertigungsverfahren anders als bei den meisten klassischen Prozessen auf unterschiedliche Produkte verteilt werden.
GRENZEBACH GROUP – PARTNER CONTENT

Kosten sparen mit dem 3D-Druckverfahren
Eine automatisierte Prozesskette macht die additive Serienproduktion viel effizienter, erklärt Mario Schafnitzel vom Automatisierungsspezialist Grenzebach.
Herr Schafnitzel, es gibt zahlreiche verschiedene Druckverfahren in 3D. Welches bevorzugen Sie?
Jedes Verfahren hat seine Vorteile, aber unser Favorit als Experten für Automatisierungstechnik ist das pulverbettbasierte Laserschmelzverfahren, bei dem das Pulver Schicht für Schicht aufgetragen und an den notwendigen Stellen mit dem Laser verfestigt wird. Wenn man den Prozess beherrscht, bekommt man damit Bauteile von überragender Qualität. Dieses Verfahren wird derzeit mit Abstand am häufigsten im Metall-3D-Druck eingesetzt. Die Entwicklung geht zurzeit aber noch in sehr schnellem Tempo weiter.
Bei der Serienproduktion tritt oft das Problem auf, dass die Druckzeit eines Bauteils viel länger dauert als die vorund nachgelagerten Prozesse. Wie kann man das ändern?
Die Pre- und Postprocessing-Schritte wie
Über Grenzebach Group
das Entpulvern sind kürzer als der eigentliche Druckvorgang. Um unnötige Verzögerungen zu vermeiden, ist es sinnvoll, eine vollautomatisierte additive Prozesskette aufzubauen, in der die verschiedenen Prozessschritte vernetzt sind, ohne dass ein Bediener benötigt wird. So können beispielsweise nichtproduktive Vorgänge wie das Abkühlen aus dem Drucker ausgelagert werden, sodass er bereits einen neuen Produktionsvorgang starten kann, während das gerade gedruckte Produkt auskühlt. Dadurch wird die Produktivität des Druckers deutlich gesteigert.
Lassen sich so die Kosten reduzieren?
Die Reduzierung der Kosten steht im Mittelpunkt und sie kann durch die größere Effizienz des Druckers durch Auslagern von nichtproduktiven Schritten gesteigert werden. Daher macht der Aufbau einer (teil)automatisierten additiven Prozesskette auf jeden Fall Sinn. Die notwendigen Investitionskosten sind schnell wieder hereingeholt, zumal es sich für gewöhnlich um serienmäßige Lösungen handelt.
Welches Equipment gibt es?
Es gibt inzwischen ein vielfältiges An-
gebot. Grenzebach beispielsweise bietet Lösungen für den vollautomatischen und sicheren Transport, das automatisierte Be- und Entladen, das Auslagern nichtproduktiver Prozesse, das Entpulvern nach dem Bauprozess und das Sortieren von Bauteilen am Ende der Prozesskette mit Hilfe eines Roboters.
Können auch gesundheitliche Risiken für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser eingedämmt werden? Es ist richtig, dass gesundheitliche Gefährdungen beim 3D-Druck auftreten können. Einerseits durch das Arbeiten mit dem gesundheitsschädlichen Pulver, das nicht eingeatmet werden sollte, andererseits durch den Kontakt mit heißen Produktionsteilen. Aber in einem automatisierten Verfahren treten diese Gefahren nicht mehr auf, weil kein Bediener benötigt wird. Das schützt die Menschen und spart nebenbei weitere Kosten für Schutzmaßnahmen ein.
Wie sollte ein Unternehmen, das sich für den 3D-Druck mit additiver Produktionsweise interessiert, vorgehen? Als erstes sollte ein sinnvoller Anwen-
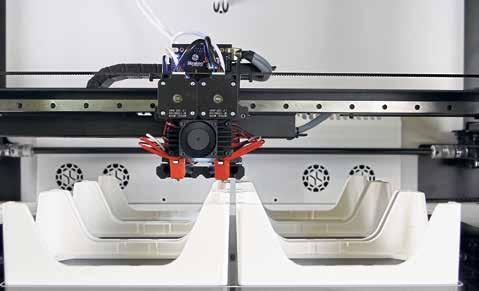
Die Grenzebach Group ist ein international tätiges Familienunternehmen im Bereich Anlagenbau und Automatisierungstechnik. Die ganzheitlichen Automatisierungslösungen beinhalten Beratung, Hardware, Software und Service. Als starker Partner begleitet Grenzebach weltweit Unternehmen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. www.grenzebach.com
dungsfall identifiziert werden. Welche Bauteile kommen in Frage und welche Verfahren könnten dazu passen? Wenn ein Unternehmen sich für die Anschaffung entscheidet, sollte es von Anfang an die möglichen und kostenreduzierenden Automatisierungslösungen einplanen. Grenzebach bietet die notwendige Unterstützung für Potenzialbewertung, Planung, Entwicklung und Umsetzung an.
INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway 12
Vom ursprünglichen Prototypenbau zum etablierten Fertigungsverfahren: Die Einsatzgebiete des 3D-Druckers sind mittlerweile vielfältig.
Foto:Presse / G r e n z beGhcapuor
Mario Schafnitzel, Product Manager Additive Manufacturing bei der Grenzebach Group
Schleppende Digitalisierung rächt sich
innovation
Das Bewusstsein über die Auswirkungen von Konsum und Wirtschaft auf Umwelt und Gesellschaft mit globalen Folgen für die Zukunft ist rapide gestiegen.
Text: Dejan Kosmatin Foto: Christin Hume/unsplash
Unternehmen in Deutschland treffen nicht nur auf ein sich veränderndes Konsumverhalten, sondern auch auf strengere Regulierungen und Investorenanforderungen in puncto Nachhaltigkeit. Durch die steigenden Anforderungen von Kunden, Politik und Investoren, kommt der IT bei der Erreichung von mehr Nachhaltigkeit eindeutig eine Schlüsselrolle zu. Sie kann mittels Datenverarbeitung und -analysen
Die IT unterstützt also nicht nur die Umsetzung, sondern ermöglicht diese erst durch den Einsatz und Bereitstellung von neuen Technologien wie Cloud, IoT oder KI.
sowohl Nachhaltigkeitsinitiativen effektiv begleiten als auch die Grundlage für neue innovative Prozesse und Produkte mit positiven Auswirkungen darauf sein. Die IT unterstützt also nicht nur die Umsetzung, sondern ermöglicht diese erst durch den Einsatz und Bereitstellung von neuen Technologien wie Cloud, IoT oder KI.
Die IDC-Studie „IT & Sustainability Deutschland 2022“ zeigt, dass Nachhaltigkeit hauptsächlich durch eine fehlende Transparenz über Prozesse und Daten ausgebremst werden. Zurückzuführen ist das auf einen niedrigen digitalen Reifegrad und der aktuellen Datenerfassung mit Kennzahlen (KPIs), die sich auf interne Prozesse fokussieren. Für ambitionierte Initiativen planen aber viele den Ausbau des gesamten Wertschöpfungssystems. So verschiebt sich der Schwerpunkt bei der Umsetzung von IT-Initiativen für nachhaltige Unternehmensprozesse, in Richtung Lieferketten und Zukunftstechnologien, wie IoT, Big Data & Analytics, RPA und Green Coding. Bis 2030 wollen fast alle befragten Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsziele erreicht haben. 38 Prozent geben an, über einen unternehmensweiten Ansatz zu verfügen und weitere 40 Prozent über einzelne Programme.

Die größten Treiber sind die Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten und Angeboten sowie die Verbesserung der Betriebs- bzw. Produktionseffizienz, neben der konsequenten Ausrichtung auf die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und die Zusammenarbeit mit Lieferanten und Partnern, die ihre Nachhaltigkeitsziele teilen. Das höchste Potenzial liegt in der eigenen Organisation, zum einen bei der Bereitstellung von ressourceneffizienter IT mit längeren Lebenszyklen. Also entweder ein System mit nachhaltiger Hardware und eine regelmäßige Modernisierung der IT-Infrastruktur und Anwendungsumgebung oder eine nachhaltige Softwareentwicklung und -architektur. Und zum anderen bei der Einbindung und Befähigung der eigenen Beschäftigten, um auf operativer Ebene mit den neuen Systemen und Prozessen umgehen zu können.
In den heutigen stark vernetzten Wertschöpfungssystemen können viele Nachhaltigkeitsinitiativen jedoch erst dann wirklich erfolgreich werden, wenn Betriebe über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus aktiv werden. Ein umfassender und effizienter Datenaustausch mit Partnern in den Lieferketten und Business-Ökosystems ist dafür eine essenzielle Voraussetzung, und umso
Erfolg bringender, je mehr Teilnehmer sich gegenseitig motivieren und fördern. IDC sieht hier vor allem die Anbieter in der Pflicht, sowohl ihr eigenes Business nachhaltig zu transformieren als auch ihr Angebotsportfolio unter diesem Blickwinkel zu überarbeiten und zu ergänzen und vor allem die Kunden bei ihren Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu beraten und zu unterstützen.
fakten IDC hat im Dezember 2021 in Deutschland branchenübergreifend 200 Unternehmen befragt, um detaillierte Einblicke in die Planungen, Herausforderungen und Treiber in Bezug auf Nachhaltigkeitsinitiativen durch und mit IT zu erhalten. Die Pandemie hat der Bedeutung von Nachhaltigkeit bei 80 Prozent der befragten Unternehmen deutlich Schub verliehen.
13 INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway
Bis 2030 wollen fast alle befragten Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsziele erreicht haben.
Die IT-Infrastruktur kann die Nachhaltigkeitsentwicklungen eines Unternehmens entscheidend nach vorne bringen.
fakten Wolfgang Weber lebt mit seiner Frau und zwei seiner drei Kinder in den Niederlanden. Er liebt Diversität , sowohl im professionellen, als auch im privaten Umfeld. Seine Freizeit verbringt er in der Natur zu Fuß, im Wasser oder auf dem Rad, die hierzu hervorragende Infrastruktur seiner Wahlheimat genießend. Inspiriert durch seine geschäftliche Verantwortung automatisiert er seinen Haushalt mit digitalen Tools und Applikationen.
Wolfgang Weber:

Resilienz durch Digitalisierung
INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway 14
großes interview
Die Verwendung digitaler Tools hat viele Vorteile. Dennoch gibt es noch Luft nach oben, sagt Wolfgang Weber, Global Head of Engineering and Industry 4.0 bei Henkel.
Text: Armin Fuhrer Foto: Presse
Herr Weber, wo steht Deutschland mit Blick auf die Digitalisierung?
Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir erst einmal klären, worüber wir eigentlich genau reden. Nach meiner Definition gehört zur Digitalisierung nicht nur der Bereich der Arbeit mit Daten, sondern auch der Bereich der Robotik. Daher fällt mein Bild für beide Bereiche differenziert aus.
Inwiefern?
In Deutschland gibt es immer, wenn es um Daten geht, eine gewisse Grundskepsis in der Bevölkerung, was die Sicherheit betrifft. Das erhöht die Eingangshürde für die Digitalisierung im Vergleich zu anderen Ländern. Davon ist besonders der Mittelstand betroffen. Hinzu kommen die Defizite in der öffentlichen Infrastruktur, die wir in Deutschland haben, angefangen mit der Abdeckung mit 5G und WLAN. Bei der Robotik stellt sich die Lage günstiger da. Deutsche Großunternehmen treiben die Entwicklung an dieser Stelle entscheidend mit voran.
Stellen die sich derzeit überlappenden Krisen eine Hemmschwelle bei der weiteren Digitalisierung dar?
Im Gegenteil. Aus unserer Sicht ist es ganz eindeutig so, dass die Digitalisierung ein Instrument zur Bewältigung von Krisen ist. Das hat sich sehr klar in den ersten Wochen der Pandemie gezeigt, denn damals gelang es uns aufgrund der schon vorhandenen digitalen Infrastruktur ziemlich gut, den Überblick zu behalten. Wir konnten vor dem Hintergrund
der unterbrochenen Lieferketten unser Netzwerk sehr schnell so anpassen, dass wir ununterbrochen die Märkte versorgen konnten, weil wir mit unseren digitalen Tools in Echtzeit arbeiten konnten.
Grundsätzlich haben wir eine ganze Reihe von „digitalen Zwillingen“ einzelner Geschäfts- und Prozessbereiche, die wir für die Analyse einer bestimmten Situation nutzen. Auf der Basis dieser Analyse können wir dann eine fundierte Entscheidung treffen. Beispielsweise nutzen wir einen „Digital Twin“ zur Analyse des Marktbedarfs eines bestimmten Artikels und er hilft uns, die Produktionsplanung zu verbessern.
Gibt es beim Entwicklungsstand Unterschiede zwischen der Großindustrie und dem Mittelstand?
Beim Testen digitaler Tools ist der Mittelstand in manchen Punkten dynamischer als Großunternehmen, denn vorhandene Strukturen können in der Regel einfacher aufgebrochen werden. Bei einem großen Unternehmen wie Henkel müssen mehr Abteilungen eingebunden werden, bis ein solches Tool genutzt werden kann. Die Government-Struktur ist bei den Großen aufwendiger. Großunternehmen haben dagegen viel mehr Erfahrungen, verfügen über größere Teams und höhere Finanzierungsmöglichkeiten und haben daher Vorteile bei der Skalierung von neuen digitalen Anwendungen.
Sehen Sie in der Robotik ein Mittel gegen den wachsenden Fachkräftemangel?
Ja, denn die Digitalisierung führt zu einer Steigerung der Effizienz von Anlagen und daneben zu einer Umqualifizierung der Menschen, die an diesen Anlagen arbeiten. Sie sind weiterhin im Unternehmen, arbeiten aber an einer anderen Stelle auf einem höheren Effizienzniveau. Und sie können mit Aufgaben betreut werden, die interessanter und weniger monoton sind.
Wie wichtig ist es, die Angestellten mitzunehmen?
Digitale Applikationen bringen sehr viele Vorteile, aber man muss immer auch vorsichtig damit umgehen, um bei den Angestellten keinen Frust zu erzeugen. Denn wenn sie nicht funktionieren oder die Angestellten damit nicht umgehen können, kann das zu großer Ernüchterung führen. Bei Henkel versuchen wir diesem Problem entgegenzuwirken, indem wir in jeder Produktionsstätte einen sogenannten „Digital Engineer“ einsetzen. Eine Schnittstellenposition, die dem Produktionsleiter den Rücken frei hält, das Funktionieren der Anlagen sicherstellt und zugleich als Botschafter und Ansprechpartner im lokalen Team fungiert. Der Digitalingenieur schult die Mitarbeitenden und gibt der Leitung Feedback darüber, wie das neue digitale Tool angenommen wird.
Neben der Digitalisierung ist auch die Dekarbonisierung ein großes Thema. Sehen sie in beiden gleichzeitigen Entwicklungen eine doppelte Herausforderung?
Im Gegenteil. Bei uns ist es definitiv so, dass die Digitalisierung die Dekarbonisierung unterstützt. Eine permanente Messung der Energiebilanz und klare Ziele zur Umsetzung der Dekarbonisierung sind ein absolutes Muss, um im Markt zu bestehen. Das steht nicht im Widerspruch zum Ziel der Digitalisierung, sondern es gibt im Gegenteil sogar viele Synergien. Die Kombination von nachhaltigen Maßnahmen mit smarten Tools hat sehr viele Vorteile – für die Unternehmen und für das Klima.
Nachhaltigkeit bedeutet in der Logistik nicht nur günstig ökologischen Treibstoff zu finden, sondern auch Wege, um einen der größten Kostenfaktoren zu reduzieren: Leerfahrten.
Grüner Transport

Unternehmen, die früh auf regenerative Energie gesetzt haben, sind in Zeiten, in denen Gas knapp wird, im Vorteil. Für die anderen bietet die Krise, die Russlands Krieg ausgelöst hat, nun Chancen, sich neu aufzustellen.
Text: Christian Litz, Foto: Elevate/unsplash
Lösungen sind dabei nicht einfach: Wir nehmen eine andere Energiequelle. Dazu gehört auch: Wir müssen energiesparender Waren transportieren. Die gute Nachricht: Lösungswege sind bereits angelegt, werden seit Jahren genutzt und immer besser. Die Logistikbranche spürt schon länger öffentlichen Druck, ökologischer zu arbeiten.
Nachhaltigkeit bedeutet in der Logistik nicht nur günstig ökologischen Treibstoff zu finden, sondern auch Wege, um einen der größten Kostenfaktoren zu reduzieren: Leerfahrten. Mit viel Computertechnik und Rechnerleistung wird seit Jahren daran gearbeitet, Leerfahrten zu reduzieren oder wenn möglich, ganz zu vermeiden. Nichts ist unökologischer als leer zurückgelegte Kilometer von Transportkapazitäten...
Lesen Sie den ganzen Artikel online auf: contentway.de

ANZEIGE – ADVERTORIAL
Energiewende für zu Hause – mit der Wärmepumpe!
Die Nachteile fossiler Energieträger werden immer deutlicher. Zum Glück gibt es mit der Wärmepumpe schon heute eine zukunftssichere Heizungsalternative, die 100 % unabhängig von Öl und Gas macht.
Umweltenergie nutzen
Eine Wärmepumpe macht Umweltenergie für Heizung und Warmwasser nutzbar. Dabei braucht sie nur ca. 25 % Antriebsstrom, um bis zu 75 % Energie aus der Umgebung zu generieren. Als Energiequelle hat sich Umgebungsluft durchgesetzt. Wichtig ist ein hocheffizienter, invertergeregelter Verdichter, wie z. B. in den Wärmepumpen von Mitsubishi Electric. Denn er passt die Wärmepumpenleistung dem benötigten Wärmebedarf an und verbessert die Effizienz.
Auch für die Modernisierung Prinzipiell lassen sich die meisten Gebäude mit Öloder Gasheizung auf eine Wärmepumpe umstellen. Das gilt insbesondere, wenn bei gut 20 Jahre alten
Häusern eine neue Heizung ansteht. Denn hier ist die Gebäudehülle entsprechend gedämmt, Fenster sind doppelt verglast, und oft ist eine Fußbodenheizung vorhanden.
Den alten Wärmeerzeuger weiternutzen? Es lohnt sich fast immer, ganz zur Wärmepumpe zu wechseln. Soll die alte Heizung jedoch weitergenutzt werden, bietet ein Luft/Luft-System interessante Möglichkeiten. Es kann mit geringem Aufwand installiert werden und arbeitet unabhängig von der bestehenden Wärmeverteilung. Damit kann man in der Übergangszeit bares Geld sparen, denn die Wärmepumpe erzeugt aus einer Kilowattstunde Strom bis zu 5,2 kWh Wärme.
Förderung beachten und Fachpartner einbinden Noch attraktiver wird der Wechsel durch die aktuellen Fördermöglichkeiten: Der Staat bezuschusst Wärmepumpen mit bis zu 40 %. Förderfähig sind z. B. Kosten für Installation, Optimierung der Wärmeverteilung und Entsorgung von Altanlagen.
Modernisierungswillige sollten sich frühzeitig einen auf Wärmepumpen spezialisierten Fachpartner suchen.
Weiterführende Informationen bietet Mitsubishi Electric unter: mitsubishi-les.com/heiztrend-interaktiv
15 INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway
„Digitale Applikationen bringen sehr viele Vorteile, aber man muss immer auch vorsichtig damit umgehen, um bei den Angestellten keinen Frust zu erzeugen.“
Künstliche Intelligenz – Industrie 4.0
fortschritt
Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz gilt als Innovationstreiber, ihre Fähigkeiten eröffnen weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten industrieller Abläufe.
Text: Julia Butz
Fotos: DFKI/Jürgen Mai Simon Kadula/unsplash
Zusätzlich wird vordefiniertes Expertenwissen eingebaut. Aus der Kombination von Information und erlernter Regel kann die KI Schlussfolgerungen ziehen und Entscheidungen treffen – in der Automatisierung oder bei der Unterstützung an Handarbeitsplätzen.
Ein Hilfesystem und keine Konkurrenz zum Arbeitsplatz?
Kollege Roboter kann viele Lücken füllen
Wie wird KI bereits eingesetzt?
Künstliche Intelligenz begegnet uns auch im Alltag schon länger, ohne dass es uns aktiv bewusst ist. Ähnlich ist es in der Industrie: Dinge, die man früher von Hand tätigen musste, passieren nun automatisch. Maschinen sind in der Lage Meldungen abzugeben, wenn sie bestimmte Zustände erkennen, wenn es Probleme gibt oder ein Prozess gut funktioniert. Die Maschine lernt aus dem Prozess heraus.
Es besteht das häufige Missverständnis, dass KI die Menschen ersetzen würde. Es geht aber darum, dass der Computer manuelle Arbeitsschritte unterstützt, um die Qualität zu steigern oder Fehler zu erkennen. Viele Unternehmen stehen zudem vor der Herausforderung, dass sie immer weniger Personal zur Verfügung haben. Da stellt sich die Frage: Wie kann ich die Leute, die da sind, möglichst effizient einsetzen?
Was bringt KI in der Zukunft?
Unsere Vision ist eine Shared-Production, bei der die Industrie ihre Ressourcen bündelt und firmenübergreifend über ihre eigenen Anlagen hinaus zusammenarbeitet. Ähnlich wie wir es heute in den Büros in der Cloud bereits tun. Man muss nun schauen, inwieweit man auf dieses Idealbild zuarbeiten wird, auch in Hinblick auf die noch existierenden Datenbarrieren.


automatisierung
Die Robotik ersetzt in mittelständischen Unternehmen kostengünstig fehlende Fachkräfte, erklärt Helmut Schmid vom Deutschen Robotik-Verband.
Text: Armin Fuhrer
Fotos: Presse Possessed Photography/unsplash
dend sind. Das bedeutet, sie ermöglichen es, die Menschen dort einzusetzen, wo ihre Stärken liegen. Die Befürchtung, dass der Roboter den Menschen Arbeitsplätze wegnimmt, ist überflüssig. Im Gegenteil: Er schafft welche.
Für welche Branchen und Wirtschaftsbereiche gilt diese Feststellung?
Nehmen wir nur mal das Beispiel Pflege. Roboter können den Pflegekräften viele Aufgaben abnehmen, sodass wichtige Lücken aufgefüllt werden und die Pflegekräfte sich ihrer eigentlichen Aufgabe, also der Betreuung der Patienten, zuwenden können. Diese Feststellung gilt grundsätzlich für fast alle Segmente, sei es für den Servicebereich, Logistik, Agrarwirtschaft, Gastronomie und natürlich die Industrie.
Haben Sie eine Zielsetzung, wie viele Roboter jährlich neu in den Einsatz kommen könnten?
Herr Schmid, viele Unternehmen und ganze Branchen leiden unter einem Mangel an Fach- und Arbeitskräften. Sehen Sie in der Robotik ein Mittel, dem Problem entgegenzuwirken?
Der demografische Wandel bringt tatsächlich einen Mangel an Fach- und Arbeitskräften mit sich. Das Problem wird zusätzlich verstärkt durch den Wunsch, die Produktion zum Teil wieder nach Deutschland zurückzuverlagern, denn das erfordert zusätzliche Arbeitskräfte. Mit Zuwanderung allein ist dieses Problem nicht zu lösen, denn damit schaffen wir es nur, zwischen 200.000 und 400.000 Personen jährlich ins Land zu holen – das reicht aber bei Weitem nicht aus. 2030 werden uns zwischen vier und sechs Millionen Arbeitskräfte fehlen. Diese hohe Zahl können wir nur mit Hilfe der Robotik ausgleichen.
Wo liegen denn die Vorteile von Robotern?
Mit Robotern können Unternehmen heute viel Geld für hochbezahlte Fachkräfte sparen oder Lücken auffüllen, die sie anders gar nicht mehr besetzen können. Roboter können vor allem diejenigen Aufgaben übernehmen, die für den Menschen monoton und gesundheitsgefähr-
Der Deutsche Robotik-Verband hat als Maßgabe bis 2030 die Zahl von einer Million Robotern zusätzlich pro Jahr ausgegeben. 2021 hat Deutschland rund 25.000 Roboter in den Markt gebracht. Das war ein Wachstum von sechs Prozent. Zum Vergleich: In China beträgt das Wachstum derzeit jährlich mehr als 50 Prozent bei 250.000 Robotern in 2021.

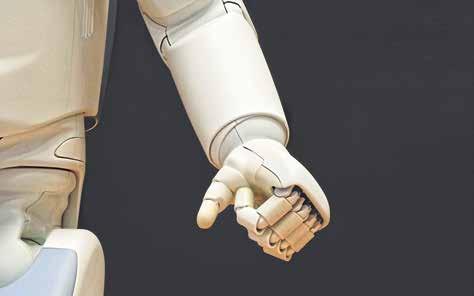
Droht Deutschland also, zurückzufallen?
Ja, die Gefahr besteht, dass wir eine wichtige Entwicklung verschlafen. Der Haupttreiber in Deutschland ist die Großindustrie wie zum Beispiel die Automobilhersteller. Aber das Herz der deutschen Industrie ist der Mittelstand, doch dieser ist erst zu etwa sechs bis sieben Prozent automatisiert. Das zeigt: Wir müssen noch viel über die neuen Technologien aufklären, denn es hat sich von der Lowcost-Robotik bis hin zu einfachen Handhabungen technologisch sehr viel getan, aber das hat sich noch nicht ausreichend herumgesprochen. Das bedeutet auch, dass sich die Ausbildungswege in Deutschland ändern müssen, denn wir benötigen keine studierten Fachkräfte, um mit Robotern zu arbeiten.
INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway 16
Es besteht das häufige Missverständnis, dass KI die Menschen ersetzen würde.
Aus der Kombination von Information und erlernter Regel kann die KI Schlussfolgerungen ziehen und Entscheidungen treffen.
Künstliche Intelligenzen unterstützen u. a. Abläufe und Prozesse in der Automobilindustrie.
Bis 2030 werden hierzulande ca. fünf Millionen Arbeitskräfte fehlen, z. B. in der Pflege oder der Industrie.
Prof. Dr. Martin Ruskowski, Forschungsbereichsleiter Innovative Fabriksysteme am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI).
Helmut Schmid, Vorstandsvorsitzender Deutscher Robotik Verband e. V.
Mit Respekt vor der Verantwortung, palettierte Waren sicher zu verladen, entstand zu Beginn der Pandemie das Konzept des TRAPO Ladungs Systems (TLS 3600). Denn noch nie war es wichtiger, Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
Optimierter Materialfluss für Lager und Ladebereich


















Mit dem TLS erfolgt das Beladen von Ko erLkw mit Europaletten automatisiert. Wichtigste Ziele sind die Zeitersparnis und die Erhöhung der Sicherheit zwischen Lager und Verladerampe.
Sicherheit für Mensch und Ware Betrachten wir den Ablauf an der Verladung: Nach Ankunft meldet sich der Lkw-Fahrer aus der Wartezone heraus über einen Monitor an und löst damit das autonome Verladen aus –über die Ladebrücke bis in den Lkw hinein. Auf die Anwesenheit von Menschen wird in diesem unfallträchtigen Bereich verzichtet.
Stationär oder zwischen Hubs verfahrbar
Das TLS 3600 verlädt in einem Arbeitsgang jeweils 3 Paletten à 1200 kg, also 3600 kg. Es bedient eine Ladeluke; alternativ verfährt es auf Schienen oder radgetrieben zwischen mehreren Ladeluken, um diese zu bedienen. Der Antrieb kann kabelgebunden oder per Akku erfolgen. Für den Einsatz in Care-Bereichen wird das TLS in Edelstahl-Ausführung gefertigt.
Kreative Ideen verändern Produktionsabläufe
Mit unseren integrierten Fertigungslösungen optimieren Sie Unternehmenswachstum, Flexibilität und Nachhaltigkeit.
Autonome Positionierung vor Lkw-Einfahrt Das TLS korrigiert vor Einfahrt in den Lkw autonom seine Position – analog zur leichten Schiefstellungen des angedockten Lkw. So werden beim selbsttätigen Verladen Beschädigung am Auflieger vermieden.

24/7 e izienter, kontinuierlicher


Verladeprozess

Auf dem stationären Teil des Systems werden drei Paletten aufgesetzt, in Reihe positioniert und ausgerichtet (Schritt 1). Es folgen die Aufnahme (Schritt 2) und das Verladen der Reihe (Schritt 3). Während des Verladevorgangs wird die nachfolgende Palettenreihe auf dem stationären Teil gebildet und bereitgestellt. Ein kontinuierlicher Ablauf, der Zeit und Wegstrecke spart.
Anlieferung über autonome Shuttle
Der Kunde hat die Wahl, denn neben konventioneller Fördertechnik bewähren sich Fahrerlose Transportsysteme. In direkter logistischer Anbindung an das Lagermanagement kann ein TRAPO-Shuttle je Fahrt drei Paletten zum TLS anliefern und als Reihe bereitstellen. Eingebunden in TIM, das TRAPO Intelligent Managementsystem, werden alle Abläufe überwacht und verwaltet – bei Bedarf inklusive Steuerung eines Shuttle-Schwarms.


it flexible. Make it sustainable. Make it
#MakeitOMRON
Make
OMRON.
ANZEIGE ADVERTORIAL
steigert
Lkw Beladung
Sicherheit
Verladeprozess in drei Schritten: 1 2 3
So
autonome
die
für Mensch und Ware
Daten vernetzen, um voranzukommen
umbruch
Hartmut Rauen, stellv. Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA), spricht über die klimaneutrale Produktion in der Industrie.
 Text: Silja Ahlemeyer Fotos: VDMA thisisengineering/unsplash
Text: Silja Ahlemeyer Fotos: VDMA thisisengineering/unsplash
Beim Umbau der Industrie in Deutschland hin zur Klimaneutralität hat Bundeskanzler Olaf Scholz Tempo versprochen. Ist dieses Ziel bis 2045 tatsächlich zu erreichen?
Es ist noch ein langer Weg bis dahin, aber ja, man kann dieses Zeil erreichen!
Es ist eine Frage der Ambitionen. Wir sehen derzeit, dass sich alle Seiten bemühen, Kompromisse einzugehen, beispielsweise bei der Balance zwischen Umweltschutz und den Flächen für Windkraftanlagen. Da herrscht schon Einsicht zur Notwendigkeit, und das ist viel wert.
Welche Schritte müssen jetzt konkret unternommen werden, insbesondere im Anlagenbau?
Aus Sicht der Anlagenbauer sind Innovation und ein erfolgreicher Vertrieb der Schlüssel zum Erreichen der Klimaneutralität. Denn dass wir klimaneutral produzieren und realisieren können, was die Industrie sich wünscht, haben wir bereits bewiesen. Wir bieten konkrete Lösungen – und müssen diese nun auch in die Umsetzung bringen. Wir sehen dabei den Maschinenbau als zentralen Lösungsgeber für eine klimaneutrale Welt.
Wir wollen mit Deutschland die Techniknation Nummer Eins bleiben und begrüßen daher auch die Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften aus dem Ausland.
Kann die industrielle Transformation trotz oder wegen der aktuellen Krisen gelingen?
Eine Krise ist auch immer eine Chance und ein Einstieg in eine Wende. Diese passiert jetzt. Die aktuellen Debatten sehen wir als Basis der Neuausrichtung für viele zukünftige Investitionen.
Welches sind aktuell weitere wichtige Themen?
Der Fachkräftemangel beschäftigt uns
sehr. Dem müssen wir begegnen und auch hier aktiv nach Lösungen suchen. Wir wollen mit Deutschland die Techniknation Nummer Eins bleiben und begrüßen daher auch die Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften aus dem Ausland.
Welche Schlüsseltechnologien sind im Sinne der Industrie 4.0 Voraussetzung für das Umsetzen der industriellen Transformation?
Wichtig ist die Vernetzung von Prozessen. Die Maschinenbauer sehen sich hier als maßgebliche Treiber, denn sie sind sowohl in der Lage, Sensoren in ihre Maschinen zu integrieren als auch Daten in die Cloud zu schicken. Und wir sind bereits dabei, IT und OT, also Office und Shop Floor, miteinander zu verbinden zur intelligent vernetzten Produktion hin zu neuen Geschäftsmodellen.
Eine weitere Grundvoraussetzung für die industrielle Transformation ist, dass über alle Stufen des Wertschöpfungsnetzwerks Klarheit über Prozesse und eingesetzte Materialien besteht – und zwar über Lebenszyklusphasen hinweg. Und es braucht mehr Zusammenarbeit hin zu einem souveränen und resilienten Produktionsstandort Europa. Mithilfe digitaler, datenbasierter Lösungen werden die benötigten Informationen verfügbar. Dafür treiben wir in Kooperation mit anderen Partnern die Initiative „Manufacturing-X“ an.
Was ist das genau?
Durch das System „Manufacturing-X“ soll die Einbindung der mittelständischen Unternehmen in die digitale Transformation gelingen. Wir setzen
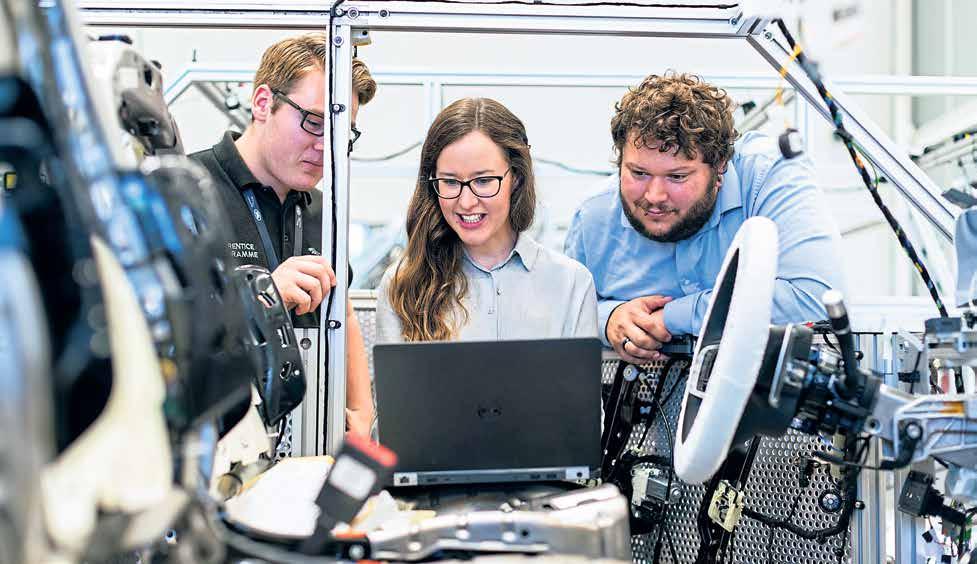
hier den Datenraum Industrie 4.0 um, also auf offenen Standards basierendes föderatives Daten-Ökosystem, welches den Unternehmen und der Wirtschaft digitale Souveränität bietet. Dies ist ein Gegenentwurf zu zentralen Plattformlösungen. Mit einem solchen System wird es möglich, Wertschöpfungsnetzwerke neu zu organisieren und schnell auf Störungen zu reagieren; neue Geschäftsmodelle, geschlossene Kreislaufwirtschaft und Effizienzsteigerungen im Sinne der Nachhaltigkeit genauso zu ermöglichen wie digitale Innovationen, um die globale Führungsposition der deutschen Industrie zu sichern und auszubauen.
Aus Sicht der Anlagenbauer sind Innovation und ein erfolgreicher Vertrieb der Schlüssel zum Erreichen der Klimaneutralität.
fakten
Mit rund 3.500 Mitgliedern ist der VDMA die größte Netzwerkorganisation und wichtiges Sprachrohr des Maschinenbaus in Deutschland und Europa. Der Verband vertritt die gemeinsamen wirtschaftlichen, technischen und politischen Interessen des Maschinen- und Anlagenbaus. Sein Hauptsitz befindet sich in Frankfurt/Main.
INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway 18
„Der Maschinenbau ist zentraler Lösungsgeber für eine klimaneutrale Welt“, sagt Hartmut Rauen.
Hartmut Rauen, stellv. VDMA-Hauptgeschäftsführer
DASSAULT SYSTÈMES – PARTNER CONTENT

Vorsprung durch starken Wissenstransfer
Dominic Kurtaz, Managing Director Eurocentral bei Dassault Systèmes, erläutert im Interview, wie Nachhaltigkeit in der Industrieproduktion gelingen kann.

Eine Erkenntnis der aktuellen Accenture CEO-Studie zur Nachhaltigkeit ist, dass CEOs aus mehreren Ländern den Klimawandel bereits deutlich spüren und bereit sind, jetzt einschneidende Maßnahmen zu ergreifen. Wie ordnen Sie das ein?
Die Reaktion ist absolut richtig. Heute und in der Zukunft werden Unternehmen an ihrer Fähigkeit gemessen, eine nachhaltige, positive Wirkung zu erzielen, um die Klimaziele zu unterstützen. Das Thema Nachhaltigkeit hat den Sprung geschafft – von den Marketing- und PR-Abteilungen hinein in die Produktion. 96 Prozent der großen Unternehmen weltweit legen heute einen Fokus auf Nachhaltigkeit.
Was genau muss getan werden? Wie kann die Industrie schnell und anhaltend umweltfreundlicher werden? Jetzt geht es nicht mehr nur um Optimierung und den Versuch, die letzten fünf Prozent an Effizienz oder Materialeinsparung zu erreichen. Vielmehr geht es darum, ganz neu zu denken. Nehmen wir als Beispiel die Gebäude um uns herum. Wir haben in den letzten 100 Jahren überall in rasantem Tempo gebaut, größtenteils aus Beton. Den meisten Menschen ist jedoch nicht bewusst, dass der CO2-Fußabdruck von Beton mit rund 900 kg CO2 pro Tonne riesig ist. Das ist keineswegs nachhaltig. Wir müssen hier also unter anderem Materialwissenschaften anwenden und andere Lösungen finden. Und wir sehen, dass das geschieht, beispielsweise per
3D-Druck. Wir können jetzt modulare Wohnkonzepte aus völlig neuen Materialien drucken, die wir uns vor fünf Jahren noch nicht vorstellen konnten. Wichtig ist ebenfalls die geschlossene Kreislaufwirtschaft, also die abfallfreie Produktion.
Wann sollte das Thema Nachhaltigkeit in die Fertigung von Produkten einfließen?
Gleich zu Beginn der Entwicklung! 80 Prozent der Auswirkungen eines Produkts, das in den nächsten 20 oder 30 Jahren existiert, werden direkt am Anfang festgelegt, unter anderem durch die Materialauswahl. Wichtig ist, dass der gesamte Lebenszyklus berücksichtigt wird. So ist es beispielsweise denkbar, ein Auto, das als Personenkraftwagen entwickelt wurde, Jahre später als Nutzfahrzeug einzusetzen. Durch eine modulare Bauart kann der Lebenszyklus des Fahrzeugs maßgeblich verlängert werden.
Hierzu finden sich viele Daten und Informationen, aber nicht jeder Ingenieur hat genau das benötigte Wissen, um Produkte und Dienstleistungen für eine nachhaltige Wirtschaft zu entwickeln. Die Frage ist also: Was kann man dagegen tun?
Es gibt zum Beispiel Unternehmen, die die bekannten UN-Nachhaltigkeitsziele aufgegriffen und tatsächlich spezifische, messbare Kennzahlen definiert haben, nach denen man arbeiten kann. Es wurde zum Beispiel bereits mathematisch beschrieben, wie hoch der CO2-Ausstoß eines bestimmten Materials, eines bestimmten Herstellungsprozesses, eines Logistikprozesses oder sogar einer menschlichen Aktivität ist. Dieses Wissen muss für alle zugänglich sein und ein konkretes Handeln nach sich ziehen. Wir bieten
Dassault Systèmes, die 3DEXPERIENCE Company, ist ein Katalysator für den menschlichen Fortschritt. Sie stellt Unternehmen und Anwendern virtuelle 3D-Umgebungen zur Gestaltung nachhaltiger Innovationen bereit und schafft Mehrwert für über 300.000 Kunden aller Größenordnungen in sämtlichen Branchen. www.3ds.com/de
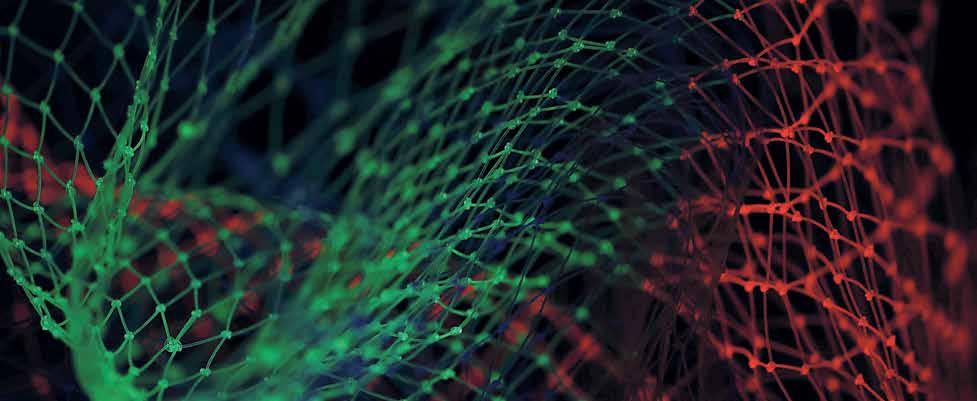
mit unserer 3DEXPERIENCE Plattform die Möglichkeit, Wissen zu bündeln. Die Plattform ermöglicht als Single-Source-ofTruth eine Datenbasis für alle Beteiligten, und bietet je nach Rolle und Funktion eine passende Ansicht. Dadurch können Unternehmen die Zusammenarbeit sowie die Prozesse über alle Abteilungen hinweg
«
„Das Thema Nachhaltigkeit hat den Sprung geschafft – von den Marketing- und PR-Abteilungen hinein in die Produktion. 96 Prozent der großen Unternehmen weltweit legen heute einen Fokus auf Nachhaltigkeit.“
«
„Wichtig ist, dass der gesamte Lebenszyklus berücksichtigt wird. So ist es beispielsweise denkbar, ein Auto, das als Personenkraftwagen entwickelt wurde, Jahre später als Nutzfahrzeug einzusetzen. Durch eine modulare Bauart kann der Lebenszyklus des Fahrzeugs maßgeblich verlängert werden.“
verbessern – vom Design und Engineering über die Simulation bis hin zu Fertigung und Logistik.
Dabei spielt auch die virtuelle Welt eine große Rolle?
Richtig. Wir schließen die Informationslücke zwischen der physischen und der virtuellen Welt, indem Produkte als virtuelle Zwillinge abgebildet werden. Benutzer können Daten in direkt anwendbares Wissen umwandeln, komplexe, reale Situationen modellieren und Geschäftsprozesse und -erfahrungen verbessern. So entsteht ein vernetztes System, das die Zusammenarbeit über alle Abteilungen hinweg fördert. Mit datenbasierten virtuellen Zwillingsmodellen können Benutzer Ergebnisse unter verschiedenen Bedingungen genauer vorhersagen und unbegrenzte Was-wäre-wenn-Szenarien durchführen, um eine wirklich nachhaltige Lösung für ihre Produkte zu entwickeln.
19 INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway
Foto:Presse
Dominic Kurtaz, Managing Director Eurocentral bei Dassault Systèmes
„Wir sind als Land ärmer geworden“
solidargemeinschaft
Deutschland braucht die Solidarität der Reichen, um den Ärmeren durch die Krise zu helfen, sagt die Chefin der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer.
 Text: Armin Fuhrer Fotos: Presse Towfiqu barbhuiya/unsplash
Text: Armin Fuhrer Fotos: Presse Towfiqu barbhuiya/unsplash
stemmen zu können. Daher kommen sie alleine zurecht.
Und wie sollte die Unterstützung Ihrer Ansicht nach aussehen?
Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Viele Menschen ächzen unter den gestiegenen Energiekosten und manche können sie gar nicht mehr stemmen. Was muss eine Solidargemeinschaft tun, um gezielt zu helfen?
Grundsätzlich muss man feststellen, dass Deutschland als Land ärmer geworden ist. Das müssen wir jetzt alle verkraften, aber es gibt einen bestimmten Teil der Bevölkerung, der das nicht alleine verkraften kann, weil das Einkommen nicht reicht, um die Extrakosten wie die hohen Gas- und Strompreise zu tragen. Und weil bei diesen Menschen auch nichts oder nicht genug auf der hohen Kante liegt. Diese ärmeren Menschen, die sich das alles nicht leisten können, brauchen die Unterstützung des Staates, also der Solidargemeinschaft. Bei den reicheren Menschen ist das anders – sie hätten genug Einkommen und auch genug Ersparnisse, um diese Zusatzkosten
Das Problem ist, dass wir kein zielgenaues Instrument haben. Zielgenau im Sinne von: Wir unterstützen genau diejenigen, die mit Gas heizen und sich das nicht mehr leisten können. Das aktuelle Instrument der Ampelregierung sieht vor, dass alle unterstützt werden – also auch diejenigen, die diese Hilfe gar nicht benötigen. Die Gaspreiskommission hat viel darüber nachgedacht, ob man das besser hinbekommen kann, aber das klappt nicht. Wir Wirtschaftsweisen haben vorgeschlagen, mehr Zielgenauigkeit zu schaffen, indem man ein Gesamtpaket schnürt mit Entlastungen auf der einen Seite und Belastungen auf der anderen.
Wie stellen Sie sich das vor?
Das ist eigentlich ganz einfach: Diejenigen, die keine Unterstützung benötigen, werden belastet. Diese Belastungen sollte es so lange geben, wie es auf der anderen Seite Entlastungen für alle gibt. Das wäre ein Gesamtpaket, das erheblich zielgenauer ist, als die jetzt beschlossenen und diskutierten Regelungen.
Wo ziehen Sie die Grenze zwischen reich und arm und wie könnte die Belastung aussehen?
Diese Grenze ist nicht so einfach festzumachen. Aber es gibt dennoch Möglichkeiten, sie zu ziehen. Die Einfachste ist unserer Meinung nach, den geplanten Abbau der Kalten Progression zu verschieben, denn davon sind die mittleren und vor allem die hohen Einkommen stärker betroffen als die Niedrigeren. Ich mache mir aber keine Illusionen, dass dieser Vorschlag Gehör
findet. Eine andere Möglichkeit wäre ein Energiesoli, denn bei dieser Variante sind diejenigen betroffen, die auch jetzt schon den Solidaritätszuschlag zahlen – und das sind die oberen zehn Prozent. Man könnte beispielsweise den aktuellen Soli verdoppeln, das würde einen zweistelligen Milliardenbetrag bringen. Ebenso könnte man den Spitzensteuersatz erhöhen.
Warum sind Sie dagegen, dass die Bundesregierung einfach weitere Schulden macht?
Schulden belasten die Generationen, die nach uns kommen, denn wir zahlen sie nicht in den kommenden drei oder vier Jahren zurück, sondern in den nächsten 30 oder 40. Diese Krise muss die jetzige Generation stemmen. Allerdings ist in der aktuellen Situation eine gewisse Schuldenaufnahme wohl nicht zu vermeiden. Ein anderer Grund, der gegen weitere Schulden spricht, ist der, dass dadurch zu viel Geld ins System kommt und die derzeit ohnehin schon sehr hohe Inflation weiter angetrieben wird. Aber eigentlich wollen wir die Inflation ja begrenzen, indem wir die Nachfrage zurückdrehen. Durch die Entlastungspakete heizen wir sie aber wieder an und damit auch die Inflation.
Also keine weiteren Schulden – wie wäre es mit Sparen?
An der Stelle frage ich jeden, der dies vorschlägt, wo er denn sparen möchte. Klar ist doch: Es wäre fatal, an den Investitionen zu sparen. Wir müssen zum Beispiel die Erneuerbaren Energien dringend weiter ausbauen, hier kann nicht gespart werden, im Gegenteil. Das Gleiche gilt für die Digitalisierung und natürlich für Bereiche wie Bildung, Infrastruktur oder Nah- und Fernverkehr. All das sind Zukunftsinvestitionen und es wäre völlig verkehrt, hier den Rotstift anzusetzen. Und bei dem großen Posten der
„Schulden belasten die Generationen, die nach uns kommen, denn wir zahlen sie nicht in den kommenden drei oder vier Jahren zurück, sondern in den nächsten 30 oder 40.“
Sozialausgaben und den Renten zu sparen, während gleichzeitig die Reichen Geld vom Staat bekommen, ist schwer zu vermitteln. Es kann hier bestenfalls darum gehen, zu verhindern, dass die Kosten, z. B. für die Renten, in Zukunft noch deutlich steigen.

Glauben Sie, dass die Besserverdienenden zu einer solchen Solidarleistung bereit sind?
Ohne mich auf Umfragen beziehen zu können, glaube ich das tatsächlich. Ich glaube auch nicht, dass die Belastungen für mittelständische Unternehmen zu groß wären. Außerdem reden wir ja über eine temporäre Belastung.
Wäre es nicht auch ein Ausdruck von Solidarität, die Kohlekraft- und Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, wenn dadurch die Energiepreise sinken?
Auf jeden Fall. Denn die beste Art, jemanden vor steigenden Preisen zu schützen, ist, dass die Preise gar nicht erst steigen. Dafür muss aber das Angebot an Energie erweitert werden und dazu ist die Laufzeitverlängerung ein probates Mittel, wenn sie technisch machbar ist. Dazu gehört es auch, Flüssigerdgas zu besorgen. Auf diesem Gebiet ist in den vergangenen Monaten Erstaunliches geleistet worden. Und genauso muss jetzt der Ausbau der Erneuerbaren Energien beschleunigt werden, denn je mehr wir davon haben, desto stärker werden die Energiepreise für die Verbraucher sinken. Auch der Ausbau der erneuerbaren Energie hat also eine soziale Komponente und ist Teil des solidarischen Handels.
„Diejenigen, die keine Unterstützung benötigen, werden belastet. Diese Belastungen sollte es so lange geben, wie es auf der anderen Seite Entlastungen für alle gibt.“
fakten
Bei gutem Wetter macht Monika Schnitzer gerne längere Radtouren. In ihrer Freizeit kocht sie sich aktuell durch die neuesten Ottolenghi-Kochbücher. Und zur Entspannung liest sie gerne Krimis wie die von Wolf Haas („Müll“) oder den neuesten von Volker Kutscher („Transatlantik“).
INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway 20
In einer Solidargemeinschaft stehen die einzelnen Mitglieder bei den großen Lebenskrisen füreinander ein.
Jetzt die grüne Transformation anpacken
Mit dem richtigen Maßnahmenmix können Energie gespart und Kosten gesenkt werden, erklärt Herbert Warnecke, L eiter Key Account Green Solutions bei EWE.
Herr Warnecke, die steigenden Energiepreise setzen Unternehmen unter Druck – wie sollten sie jetzt am besten reagieren?
Energieeffizienz und Energiesparen sind wichtige Hebel, um den Energieverbrauch und so die finanzielle Belastung zu senken. Außerdem sollten sich Unternehmen konkret damit beschäftigen, Energie selbst zu erzeugen.
Welche Möglichkeiten gibt es für das Energiesparen?
Zunächst sollte man prüfen, ob überhaupt alle erforderlichen Daten im Unternehmen vorliegen. Es geht also um die Frage, ob das Unternehmen einen Überblick über die Energieströme hat, um auf dieser Basis eine Analyse der Einsparmöglichkeiten vorschalten zu können. Ein guter Ansatz, um kurzfristig viel Energie zu sparen und sofort Kosten im Unternehmen zu senken, ist beispielsweise die Modernisierung der Beleuchtungsanlage.
Warum?
Der Anteil an den Energiekosten, den ein Unternehmen für die Beleuchtung ausgibt, ist sehr unterschiedlich und kann je nach Branche bei bis zu 50 Prozent liegen. Allein im deutschen Industriesektor beträgt der jährliche Stromverbrauch für Beleuchtung etwa neun Milliarden kWh mit Kosten in Höhe von etwa zwei Milliarden Euro. Aber: Derzeit entspricht
Foto : EW E
Herbert Warnecke, Gruppenleiter Key Account im Fachvertrieb für Green Solutions bei EWE

nur ein geringer Anteil der Beleuchtungsanlagen dem aktuellen Stand der Technik. Erhebungen gehen davon aus, dass rund drei Viertel der Anlagen in deutschen Immobilien älter als 20 Jahre sind. Hier sollte dringend auf LED umgerüstet werden.
Was bringt denn die LED-Umrüstung konkret?
Hierdurch lassen sich bis zu 80 Prozent der Energiekosten für die Beleuchtung einsparen – und das sogar ohne eigene Investitionskosten und ohne nennenswerte Beeinträchtigung der Betriebsabläufe. Wer schon jetzt auf moderne, effiziente LED-Technik umsteigt, spart auf längere Sicht natürlich mehr Energie und schont dadurch den Geldbeutel. Außerdem sorgt die europäische RoHS-Richtlinie für die Ausphasung nicht-nachhaltiger Lichtquellen wie T5- und T8-Leuchtstofflampen ab Ende August 2023. Unternehmen sollten also frühzeitig planen und sich schnellst-
«
„Wer schon jetzt auf moderne, effiziente LED-Technik umsteigt, spart auf längere Sicht natürlich mehr Energie und schont dadurch den Geldbeutel.“
möglich auf den Umstieg vorbereiten. Wir können ihnen das denkbar einfach machen, denn wir übernehmen für sie die komplette Umrüstung.
Sollten sich Unternehmen in Hinblick auf die Eigenerzeugung mit Photovoltaik auseinandersetzen?
Vor dem Hintergrund der aktuellen Strompreise und der Erwartung, dass diese auch absehbar nicht signifikant fallen werden, lohnt sich dieser Schritt unbedingt, und zwar für jedes Unternehmen. Mit der eigenen PV-Anlage sind heute Strombezugspreise von unter 10 Cent je Kilowattstunde möglich. Bei größeren Anlagen sind oft noch niedrigere Kosten darstellbar. Solche Preise liegen also deutlich unter den heutigen Strompreisen von Gewerbe- und Industrieunternehmen.
Schrecken manche Unternehmen die notwendigen Investitionskosten ab? Diese Bedenken sind vollkommen unbegründet, denn wir können flexible
Vertragsmodelle anbieten, durch die Liquidität und Eigenkapital geschont und finanzielle Freiräume erhalten bleiben.
Sollte man eine PV-Anlage mit Energiespeicher und Elektromobilitätslösungen kombinieren?
Generell ist es eine sinnvolle Überlegung Photovoltaik, Energiespeicher und Elektromobilität miteinander zu verknüpfen. Denn dadurch erhöht sich in der Regel der Eigenverbrauch und damit die Wirtschaftlichkeit der gesamten Investition. Und: Die Kombination kann durchaus ein zentraler Baustein für ein umfassendes Konzept zur Dekarbonisierung im Unternehmen sein.
Wie gelingt Unternehmen die Umsetzung eines solchen Konzeptes?
Eine fundierte Beratung im Vorfeld ist entscheidend für den Erfolg. Gemeinsam mit unseren Kunden analysieren wir die individuelle Ist-Situation und Rahmenbedingungen, definieren Ziele und erarbeiten schließlich ein sogenanntes Transformationskonzept. Das lässt sich bei Beachtung bestimmter Standards sogar bis zu 50 bzw. 60 Prozent staatlich fördern. Für die grüne Transformation ist jetzt also genau der richtige Zeitpunkt.
«
„Unternehmen sollten sich konkret damit beschäftigen, Energie selbst zu erzeugen.“
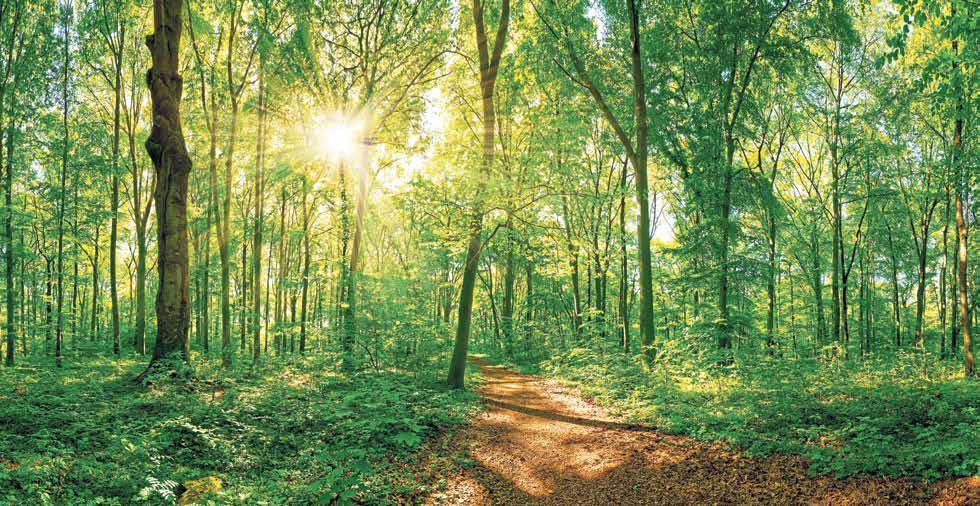
21 INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway
GmbH Cloppenburger Straße 310 26133
business.ewe.de EWE – PARTNER CONTENT
EWE VERTRIEB
Oldenburg
Fördern und Fordern
energiewende Prof. Dr. Quaschning ist Professor für das Fachgebiet Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin. Als einer der renommiertesten Experten fordert er, das Erneuerbare Energie deutlich stärker und schneller gefördert werden muss.
 Text: Thomas Soltau Foto: Presse, Chelsea/unsplash
Text: Thomas Soltau Foto: Presse, Chelsea/unsplash
Der Ausbau der Erneuerbaren Energie ist dringender als je zuvor. Wie könnte sich dieser Prozess beschleunigen lassen?

Wir müssen den Ausbau Erneuerbarer Energien mit dem gleichen Willen vorantreiben wie den Umbau der Erdgasinfrastruktur. Wenn ein LNG-Terminal in Deutschland in weniger als einem Jahr gebaut werden kann, muss das doch auch mit einem Windpark möglich sein. Der uneingeschränkte Wille dazu fehlt aber immer noch und dieser Wille muss von allen demokratischen Parteien gemeinsam ausgehen.
Sie sagen, dass Deutschland bei den Krisen der letzten drei Jahre immer nur als Getriebener gehandelt hat. Was muss sich ändern?
Deutschland fährt seit Jahren nur auf Sicht. Angesichts der immer größeren Krisen, die sich vor uns auftürmen, ist das die absolut falsche Politik. Wir brauchen jetzt strategische Entscheidungen, die uns langfristig auf den richtigen Weg bringen, auch dann, wenn diese kurzfristig unbequem erscheinen. Dann entsteht auch die Planungssicherheit, die Investoren und
„Wenn ein LNG-Terminal in Deutschland in weniger als einem Jahr gebaut werden kann, muss das doch auch mit einem Windpark möglich sein.“
Industrie für die schnelle Transformation dringend brauchen.
Sowohl von der Politik als auch der Wirtschaft müssen Erneuerbare Energien deutlich stärker gefördert werden. Welche Maßnahmen wünschen Sie sich?
Wir müssen gleichzeitig fördern und fordern. Technologien, die uns in die Sackgasse führen, wie die Gasheizung oder der Verbrennermotor, dürfen nicht mehr neu auf die Straße kommen. Für den Ausbau von Photovoltaik, Windkraft und Speicher muss es hingegen möglichst einfache Regeln und ausreichende Anreize geben.
Für eine Windkraftanlage gibt es einen Planungshorizont von sieben bis zehn Jahren. Bremst Bürokratie die Energiewende aus?
Ja. Es ist inzwischen einfacher, in Deutschland eine Munitionsfabrik zu bauen als einen Windpark. Die Bürokratiemonster wurden von den letzten Regierungen geschaffen, um bei der Energiewende Tempo rauszunehmen. Das gilt es nun schnellstmöglich zu korrigieren. Wir müssen die Regeln umdrehen. Liegt die Genehmigung nicht nach einigen Monaten vor, gilt der Windpark einfach automatisch als genehmigt. Fertig.
Bis 2035 plant die Bundesregierung 100 Prozent Ökostrom. Können wir so die Pariser Klimaziele erreichen?
Strom umfasst momentan nur einen kleinen Teil unseres Energiebedarfs. Wollen wir das Pariser Klimaschutzab -
kommen einhalten, muss unser gesamter Energiebedarf bis 2035 ausschließlich mit Erneuerbaren Energien gedeckt werden, also auch beim Verkehr, der Wärme und der Industrie.
Politikerinnen und Politiker sollten eigentlich auf die Expertise der Wissenschaft vertrauen. Warum hören so wenige auf die Mahnungen der Experten?
Weil wir so lange wirksamen Klimaschutz verschleppt haben, brauchen wir inzwischen sehr ambitionierte Maßnahmen, die nicht alle Menschen begrüßen werden. Viele Politikerinnen und Politiker wählen darum den einfachen Weg: Augen zu und Weiter so. Weil wir quasi wie die Titanic mit Volldampf auf einen Eisberg zusteuern, ist das sicher nicht die beste Strategie. Je früher wir das erkennen und das Ruder rumreißen, umso mehr Menschen werden überleben.
„Wollen wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten, muss unser gesamter Energiebedarf bis 2035 ausschließlich mit Erneuerbaren Energien gedeckt werden, also auch beim Verkehr, der Wärme und der Industrie.“
INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway 22
„Eine vollständig Erneuerbare Energieversorgung in Deutschland ist technisch und ökonomisch machbar“, so der Experte.
Prof. Dr. Volker Quaschning, Professor für das Fachgebiet Regenerative Energien an der HTW Berlin
„Wir stehen vor einem massiven Wandel, in den Anleger jetzt investieren können“
Erneuerbaren Energien fällt in Zukunft eine Schlüsselrolle unserer Versorgung zu. Eine einmalige Chance für Anleger? Ein Gespräch mit Uwe Mahrt, CEO von Pangaea Life, deren Fonds „Blue Energy“ direkt in den Sektor investiert.
Herr Mahrt, Europa leidet seit der Abkehr von russischem Gas an einer eklatanten Energieknappheit – mit äußerst unangenehmen Folgen für Verbraucher und Wirtschaft. Welche Rolle kommt den erneuerbaren Energien jetzt zu?
Die von Bundeskanzler Olaf Scholz kurz nach Kriegsbeginn beschworene Zeitenwende gilt definitiv auch für den Energiesektor. Wenn Europa seiner Vorreiterrolle für den Klimaschutz in der Welt gerecht werden möchte, müssen wir den Ausbau erneuerbarer Energien mit Hochdruck vorantreiben – so viel war bereits vor dem Beginn des schrecklichen Angriffs Russlands auf die Ukraine klar. Seit Februar und insbesondere in diesem Winter erhält das Thema Energiewende jedoch eine gänzlich neue Dimension. Nur wenn wir es schaffen unsere bisherige Abhängigkeit von russischem Gas so schnell wie möglich durch unabhängige Energiequellen zu ersetzen, sichern wir unseren Wohlstand und Industriestandort. Zurecht als „Freiheitsenergien“ betitelt, spielen die Erneuerbaren bei dieser Herausforderung die Hauptrolle.
«
„Investoren stehen bereit, den Ausbau von Windkraftanlagen oder Solarparks voranzutreiben“

Welche Weichen muss die Politik stellen, um diese Herausforderung zu meistern?
Gerade in Deutschland brauchen wir schnell einen Abbau bürokratischer Hürden. Investoren stehen bereit, den Ausbau von Windkraftanlagen oder Solarparks voranzutreiben. Zähe, langwierige Genehmigungsverfahren wirken jedoch als hartnäckiger Bremsklotz – mitunter auch ein Grund, warum wir mit unserem Fonds bislang nur in anderen europäischen Ländern investieren. Angesichts der aktuellen Energiekrise bin ich aber zuversichtlich, dass sich die Politik für eine Vereinfachung der Rahmenbedingungen einsetzt.
Sie sprechen Ihren Fonds für Erneuerbare Energien an. Wo investiert dieser?
Der Pangaea Life Fonds „Blue Energy“ umfasst aktuell Windparks an den windreichen skandinavischen Küsten in Dänemark und Norwegen, Solarparks in einigen der sonnenreichsten Regionen Südeuropas sowie Wasserkraftanlagen in den Bergen Portugals. Aktuell sind wir dabei einen weiteren Windpark in Polen in unser Portfolio aufzunehmen. Enormes Interesse haben wir außerdem in Kürze auch in modernste nachhaltige Energiespeicher zu investieren – diese sind für das Gelingen der europäischen Energiewende elementar.


Das heißt Ihr Fonds investiert anstatt in Unternehmensbeteiligungen direkt in die Anlagen zur Produktion des sauberen Stroms?
Exakt. Das ist es auch, was „Blue Energy“ auf dem Markt so einzigartig macht. Denn üblicherweise handelt es sich bei Fonds zum Thema grüne Energien um Aktienfonds mit Beteiligungen an unzähligen Energie-Unternehmen. Unser Fonds dagegen investiert direkt in die Wind-, Wasserund Solar-Anlagen selbst. Für Anleger bedeutet das eine maximale Transparenz.
Sie wissen, dass der Fonds ihre Rendite ausschließlich damit erwirtschaftet, saubere Energie für ein nachhaltiges und von russischem Gas unabhängiges Europa zu produzieren.
Stichwort Rendite: Mit was können Anleger rechnen und wie steht es um die Risiken?
Der Fonds steht aktuell bei einer Jahres-Performance von 21,3 Prozent Rendite, seit Auflage sind es jährlich im Schnitt 10,5 Prozent nach Kosten (Stand 30.09.2022). Das zeigt, dass Investments in nachhaltige Sachwerte eben nicht nur gut für das Gewissen sind, sondern zugleich attraktive Renditechancen bieten. Im Vergleich zu Aktien finden Anleger bei Pangaea Life außerdem eine sehr hohe Stabilität. Gerade jetzt, wo die
«
„Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind sich weitgehend einig, dass erneuerbare Energien in Zukunft einen maßgeblichen Sockel unserer Energieversorgung einnehmen werden.“
Aktienkurse stark schwanken, überzeugt „Blue Energy“ mit einer kontinuierlichen Wertentwicklung. Denn ein Großteil der Einnahmen aus den Energie-Anlagen ist über langfristige Stromabnahmeverträge abgesichert. Insofern eignet sich der Fonds bestens für sicherheitsorientierte Anleger.

Was erwarten Sie für den Sektor der Erneuerbaren in Zukunft?
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind sich weitgehend einig, dass erneuerbare Energien in Zukunft einen maßgeblichen Sockel unserer Energieversorgung einnehmen werden. Die Weichen sind gestellt. Die aktuelle Energiekrise führt uns die Dinglichkeit dieser Entwicklung drastisch vor Augen. Wir stehen vor einem massiven Wandel – in den Anleger gemeinsam mit uns investieren können.
Über Pangaea Life
Pangaea Life wurde als nachhaltige Marke der Versicherungsgruppe die Bayerische im Jahr 2017 gegründet. Hinter der Marke stehen zwei Fonds, die in konkrete Sachwerte aus den Bereichen erneuerbare Energien (Blue Energy) und nachhaltige Wohnimmobilien (Blue Living) investieren. Beide Fonds eint die Vision konsequente Nachhaltigkeit, Stabilität und Rendite zu vereinen.
Weitere Informationen zum Fonds „Blue Energy“: pangaea-life.de/fonds/blue-energy

23 INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway
PANGAEA LIFE – PARTNER CONTENT
Foto:Presse Uwe Mahrt, Geschäftsführer/CEO von Pangaea Life
Windpark TESLA in Norwegen, in den Pangaea Life investiert
Investment Solarpark Aljustrel in Portugal
Die Logistik wird immer digitaler

künstliche intelligenz Künstliche Intelligenz breitet sich in den Lagerhallen mehr und mehr aus. So können Unternehmen neue Herausforderungen meistern und Kosten senken.
Text: Armin Fuhrer Foto: Adrian Sulyok/unsplash
Scanner, Roboter, RFID oder der Container, der mitdenkt – es ist längst nicht mehr zu übersehen, dass die Logistik smart wird und das Lager digital. Angesichts immer komplizierter werdender Lieferketten und wachsender Kundenansprüche führt auch gar kein Weg daran vorbei. Die Vorteile der Digitalisierung liegen dabei auf der Hand, wie ein paar Beispiele zeigen.
So ersetzt die beleglose Kommissionierung mithilfe von praktischen Handheld-Computern, die mit integrierten Barcode-Scannern ausgestattet sind, beispielsweise die klassische Kommissionsarbeit mit Papier. Die Computer führen die Mitarbeiter bei der auch „Pickby-Scan“ genannten Methode Schritt für Schritt durch die Aufträge. Auch bei der Pick-by-Light-Methode wird auf den althergebrachten Papierweg verzichtet. Dem Mitarbeiter werden die jeweiligen zu entnehmenden Artikel über eine am
Entnahmefach angebrachte Anzeige übermittelt. Bei der Pick-by-VoiceMethode hat der Mitarbeiter ein Höchstmaß an Bewegungsfreiheit, da er die Hände während der ganzen Zeit der Auftragserledigung frei hat. Die Aufträge werden ihm über einen Voice Client übermittelt.
Auch die Pick-by-Vision-Methode mit Hilfe einer Datenbrille, die der Mitarbeiter trägt, ist noch ziemlich neu. Dabei werden dem Mitarbeiter
Informationen über die Brille direkt im Blickfeld angezeigt. Schließlich erobern immer mehr Roboter die Lagerhallen und die Logistik und das gilt auch für die Kommissionierung. Die neueste Generation von Kommissionierungsrobotern ist in der Lage, unterschiedliche Waren fast genauso zu unterscheiden, wie der Mensch. Auch das kontaktlose Lesen von Daten über Funk breitet sich in den Lagern immer weiter aus. Genannt wird diese Arbeitsweise „Radio Frequency
Identification (RFID)“. Dabei sendet ein Lesegerät die benötigten Informationen über einen Transponder an das Gerät des Empfängers.
Das digitale Lager kann aber noch viel mehr. Zum Beispiel arbeiten Unternehmen mit intelligenten Containern, die verhindern, dass Ware verdirbt. Dabei handelt es sich um ein sehr großes Problem, denn der Anteil der verdorbenen Lebensmittel liegt weltweit bei rund einem Drittel. Der Grund ist meistens in der Lieferkette zu finden. Ein intelligenter Container kann mit Sensorik feststellen, welche Waren möglichst bald geliefert werden müssen und dann nach dem Prinzip „First Expired, First Out“ die Auslieferung steuern.
Ordnung ist das halbe Leben, heißt es –in der Logistik aber ist sie der wichtigste Grundsatz. Digitalisierung hilft dabei, die unterschiedlichen Teilbereiche der Logistik wie Wareneingang, Einlagerung, Kommissionierung, Verpackung und Versand sauber zu trennen und damit die Arbeitsabläufe zu vereinfachen und zu beschleunigen. Insgesamt zeigen die Beispiele: Digitalisierung bringt viele Vorteile für die Logistikbranche – und für die Unternehmen die Möglichkeit, Kosten einzusparen.
Materialflüsse intelligent steuern
digitale prozesse Optimale Raumausnutzung, direkter Warenzugriff und ineinandergreifende Abläufe zeichnen gute Systeme aus.
Text: Chan Sidki-Lundius Foto: CDC/unsplash
In der Logistik, Deutschlands drittgrößtem Wirtschaftsbereich, war digitale Technik schon früh Usus. Von Computern, die in vielen Speditionen in den 1970er-Jahren die Touren berechnet haben, über Barcode-Scanner zur schnelleren Erfassung von Sendungsdaten in den 80ern bis hin zu vollvernetzten und transparenten Lieferketten mit Einsatz von Algorithmen, künstlicher Intelligenz, Drohnen, Exoskeletten oder Datenbrillen, wie sie heute zunehmend im Einsatz sind: Die Logistik gehört zu den Treibern digitaler Innovation, und das muss sie auch. Denn die Kundenanforderungen ändern sich laufend und

Entscheidend für die Realisierung eines effizienten, unterbrechungsfreien Materialflusses ist ein übergreifendes Verständnis aller intralogistischen Prozesse.
mit ihnen steigen auch die Erwartungen: Nicht nur in der Zustellung von Paketen, sondern zum Beispiel auch in der Produktionslogistik und den damit verbundenen Prozessen und Schnittstellen.
Im Fokus der Entwicklungen steht unter anderem auch das Thema Materialfluss. Einigkeit besteht darin, dass es intelligenter Lösungen und optimal strukturierter Prozessabläufe bedarf, um den Anforderungen, die der Onlinehandel, die zunehmend individualisierte Massenfertigung und permanent steigende Stückzahlen mit sich bringen, bestmöglich gerecht zu werden. Entscheidend für die Realisierung eines effizienten, unterbrechungsfreien Materialflusses ist ein übergreifendes Verständnis aller intralogistischen Prozesse, vom Wareneingang über die Lagerung und Produktionsversorgung bis hin zum Warenausgang.
Den Kern vieler Materialflusslösungen bilden heute intelligente Logistiksysteme und -lösungen, die sich in Leistung, Kapazität und Grad der Vernetzung und möglichst unkompliziert skalieren und individuell an die jeweiligen Bedarfe anpassen lassen. Diese unterstützen auch bei der Modernisierung und sind in der Lage, bestehende Systeme zu aktualisieren. Beispiel: Kommen bereits Anlagen unterschiedlicher Hersteller zum Einsatz, lassen sich diese intelligent verbinden – komplizierte Insellösungen gehören damit der Vergangenheit an. Das zahlt
auch auf die Kundenorientierung ein. Unternehmen, die einen besseren Service in Form von einer optimierten Sendungsverfolgung oder einer gesteigerten Liefergeschwindigkeit bieten wollen, müssen allerdings auch für reibungslose Abläufe im Lager sorgen. Mit Hilfe eines grafischen Rechners für den Materialfluss beispielsweise können Unternehmen die internen Abläufe im Lager steuern und mögliches Optimierungspotenzial ausschöpfen. Fehlerquellen machen die Systeme ebenfalls ausfindig. Damit kommen sie dem Wunsch einen Schritt näher, dem Kunden ein Plus an Service zu bieten.
In einem funktionierenden Materialflussprozess steuert der Nutzer sämtliche Prozesse zentral, intuitiv und übersichtlich. Denn die beste Automation kommt ins Stocken, wenn die notwendigen Informationen für einen effektiven und agilen Materialfluss nicht vorliegen oder Anwender sie nicht richtig nutzen (können). Komplexe Abläufe in Lagern und in der Produktion erfordern also ganzheitliche Lösungsansätze, die sich über manuelle, teilautomatisierte oder vollautomatisierte Prozesse abbilden lassen.
INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway 24
Digitalisierung bringt viele Vorteile für die Logistikbranche – und für die Unternehmen die Möglichkeit, Kosten einzusparen.
Komplexe Abläufe in Lagern und in der Produktion erfordern also ganzheitliche Lösungsansätze, die sich über manuelle, teilautomatisierte oder vollautomatisierte Prozesse abbilden lassen.
OCM – PARTNER CONTENT
Die aktuelle Krise setzt vor allem mittelständische Unternehmen unter Druck. Seit mittlerweile drei Jahren werden die Lieferketten durch die Pandemie und seit diesem Jahr nun auch durch die explodierenden Energiekosten und inflationären Preise immer wieder stark belastet. Nun besteht Zugzwang, die altbewährten Beschaffungsmethoden und Abläufe entlang der Lieferkette zu transformieren und zu optimieren. Denn bis sich die Preislage und die Lieferketten wieder stabilisiert haben, benötigt die Industrie eine Strategie, die sie durch die unsichere Zeit führt.
Flexibilität, Resilienz und eine enge Zusammenarbeit mit Partnern sind die hierfür essenziellen Eigenschaften in Einkauf und SCM. Deren Erreichung muss in die Supply Chain und Einkaufsstrategie integriert und entsprechend entlang der Wertschöpfungskette umgesetzt werden.
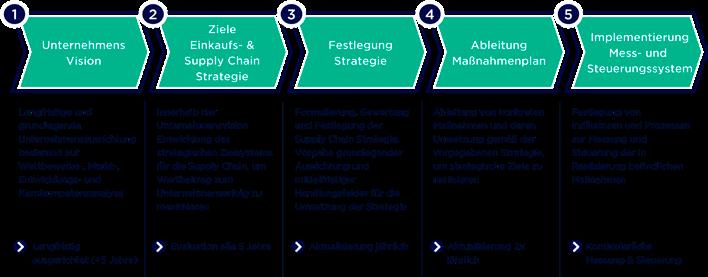

Hierbei gilt es Wettbewerbsvorteile kontinuierlich neu zu beurteilen und durch gezielte Maßnahmen dahingehend zu optimieren. Viele Unternehmen unterschätzen weiterhin und insbesondere in der aktuellen Situation, die Potenziale, die in Einkauf und Supply Chain Management stecken. Dies gilt sowohl für die strategische Ausrichtung, als auch für die effektive Umsetzung. Aus der Verbindung von individuell passender Einkaufs- und SCM-Strategie, den richtigen Methoden und Fähigkeiten können Wettbewerbsvorteile geschaffen und ein großer Beitrag zum Unternehmenserfolg geleistet werden. Um die Strategie in Einkauf und Supply Chain sinnvoll anzupassen, müssen die aktuellen Gegebenheiten mit der Unternehmenssituation und -vision in Einklang gebracht werden. Die stark gestiegenen Versorgungsrisiken entlang der Lieferketten stoßen auf Preis- und Energiekostensteigerungen und dies alles vor dem Hintergrund eines drohenden wirtschaftlichen Abschwungs und damit einhergehenden Nachfrageeinbußen.
Fokus und Ausrichtung der Strategie Gerade in der aktuell sich ständig wandelnden Situation, muss man flexibel reagieren können. Damit eine solche Flexibilität zu Stande kommt, benötigt es neben kurzen Wegen und schnellen Entscheidungen im Unternehmen auch einer partnerschaftlichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Lieferanten. Um die Resilienz zu stärken, können zudem eine agilere, breitere Lieferantenbasis, ein angepasstes Bestandsmanagement und alternative Lieferwege adäquate Lösungen sein. Zusätzlich zu dem Blick auf Externe, lohnt es sich die enge Zusammenarbeit mit den unternehmensinternen Funktionen zu intensivieren. Gemeinsame Lösungen mit der Verkaufsseite, der Produktion und der Produktentwicklung bieten oftmals weitere Möglichkeiten um Margen zu sichern, Nachfrageverpflichtungen gerecht zu werden, oder Anforderungen an die Lieferkette zu vereinfachen.
Bedeutung der Einkaufs- und SCM-Strategie
Der Anteil der externen Ausgaben an den Gesamtausgaben liegt je nach Unternehmen zwischen 40 Prozent und 80 Prozent – weshalb die Strategie in Einkauf und SCM oftmals auf die Rolle zur Erreichung von Kostensenkungen reduziert wird. Eine durchdachte und passende Strategie in Einkauf und SCM vermag jedoch noch viel mehr: Sie dient der übergeordneten Orientierung in der täglichen Arbeit der Einkaufsorganisation und definiert Verantwortungen, Prozesse, Richtlinien, Tools und Leitfäden für die gesamte Organisation in Bezug auf externe Ausgaben und die Versorgungssicherheit. Es ist also empfehlenswert die Strategien in Einkauf und Supply Chain auf die Gegebenheiten unserer Zeit anzupassen und ebenfalls die Ausrichtung hinsichtlich Digitalisierung und methodischen Nutzen des strategischen Warengruppeneinkaufs als treibendes Element in der Umsetzung sicherzustellen.
Umsetzung der Strategie Auf ihre Einkaufsstrategie angesprochen,
Beschaffungsstrategie
oft nicht im betroffenen Team in klaren Zielen ankommen und somit nicht zielführend angewendet werden. Daher ist es essenziell das Team mit einzubinden, eine ganzheitliche Strategie zu kommunizieren und in die Verantwortlichkeit der Organisation zu bringen.
«
Foto: Pres s e
Florian Dederichs, Gründer von OCM Management Consultants. Er ist Experte für Kostenoptimierung und Effizienzsteigerungen durch strategischen Einkauf, Supply Chain Management sowie im Bereich Logistik Optimierung.
Gemeinsame Lösungen mit der Verkaufsseite, der Produktion und der Produktentwicklung bieten oftmals weitere Möglichkeiten um Margen zu sichern, Nachfrageverpflichtungen gerecht zu werden, oder Anforderungen an die Lieferkette zu vereinfachen.
Florian Dederichs, Managing Partner und Gründer von OCM Management Consultants, empfiehlt produzierenden Unternehmen vor allem eines: „Passen Sie Ihre Strategie in Einkauf und Supply Chain Management an die veränderten Gegebenheiten an! Setzen Sie in der aktuellen Zeit auf Flexibilität, Resilienz und Partnerschaft und bringen Sie diese in die Verantwortung und das tägliche Handeln Ihrer Organisation, um sich Wettbewerbsvorteile zu schaffen und gestärkt aus der Krise herauszugehen“

geben 8 von 10 Einkaufsleitern an, eine Einkaufs-bzw. 25 INDUSTRIE 4.0 Eine unabhängige Kampagne von Contentway
zu haben. Stellt man die gleiche Frage jedoch budgetverantwortlichen Mitarbeitern und Einkäufern, so sinken die Werte auf 2 von 10. Daraus lässt sich ableiten, dass die geplanten Maßnahmen und Ausrichtungen
OCM Management Consultants ist eine Boutique Unternehmensberatung mit Spezialisierung auf moderne Einkaufberatung, Supply Chain Management sowie Logistik-Optimierung. www.ocmconsulting.de
„Eine Entspannung entlang der Lieferketten erfordert eine angepasste Strategie in Einkauf und SCM“
Zukunft der Lebensmittelbranche – Vielfalt und Innovationen

einleitung
Wie sieht die Zukunft unserer Ernährung und der Lebensmittebranche aus? Wir als Lebensmittelverband stellen diese Frage seit 2018 jährlich auf der Internationalen Grünen Woche (IGW), der weltgrößten Verbrauchermesse: „Wie schmeckt die Zukunft?“
Foto: Sandra Ritschel/Lebensmittelverband
Und die Antworten zeigen vor allem zwei Aspekte: Die Zukunft wird geprägt sein von Vielfalt und Innovationen. Seit vier Jahren präsentieren wir an unserem Stand neben etablierten Unternehmen der Branche auch junge Start-ups. Wir konnten bereits viele Highlights zeigen: Kreative Getränkeideen wie Proteinbier, Brotbier, Kaffeekirschenlimonade, Orangenschalenlimonade, Wasser, das mittels Geruch nach Zitrone etc. schmeckt, Algen, Jackfruit, Insekten in verschiedenen Varianten als Burger, als Mehl, als Müsliriegel und viele mehr. Meist stehen nachhaltige oder gesundheitsorientierte Ansätze dahinter, um z. B. mittels Food-Upcycling aktiv gegen Lebensmittelverluste vorzugehen oder neue Proteinquellen zu erschließen. Wie viele der jungen Unternehmer sich letztlich fest etablieren werden, hängt vom Markt und der Nachfrage der Verbraucher ab. Gleiches gilt auch für die Produktund Verpackungsinnovationen, die unsere Mitglieder als Zukunftsideen mitgebracht haben und auch 2023 wieder mitbringen werden. Es wird viele pflanzliche Alternativprodukte geben, vegane Chicken-Nuggets, veganes Ei, pflanzliche Milchalternativen. Die Lebensmittelbranche demonstriert damit ihr unglaubliches Innovationspotential. Es geht darum, Lebensstile zu ermöglichen und nicht, welche zu verbieten.
Fleischalternativen sollen vegetarisch und vegan lebenden Menschen eine ebenso große Produktauswahl ermöglichen, wie sie Menschen haben, die tierische Produkte essen. Dabei gibt es nicht die eine „Ersatz-Ressource“, sondern es kommt darauf an, die Vielfalt zu nutzen, die wir an möglichen Rohstoffen zur Verfügung haben, wie Hülsenfrüchte, Pilze, Reis, Hafer, Soja und viele mehr. Nur so erhalten wir Biodiversität und können vielfältige Geschmackserlebnisse anbieten. Fleischalternativen sollen aber eben nur Alternativen sein und nicht Ersatzprodukte in dem Sinne, dass sie Fleisch- und Wurstwaren komplett ersetzen sollen. Fleisch wird es auch in Zukunft geben – aus artgerechter Tierhaltung. Die Fleischbranche arbeitet seit Jahren u. a. mit der Initiative Tierwohl daran, ihrer Verantwortung gegenüber Menschen und Tieren gerecht zu werden und die Haltungsbedingungen stetig zu verbessern. Das ist uns wichtig – mit Blick auf die wachsende Weltbevölkerung müssen wir nicht nur so ressourcenschonend wie möglich arbeiten, sondern auch Lösungsansätze aufzeigen, wie wir die Proteinversorgung zukünftig sicherstellen können. Und dafür müssen wir weiterhin offen sein für alle Möglichkeiten, d. h. Ernährungsstile mit und ohne Fleisch, Rohstoffe, die in Bioreaktoren wachsen, Rohstoffe, die mit neuen Züchtungstechnologien angebaut und mit Robotern geerntet werden. Und dafür brauchen wir eine Politik, die faire Rahmenbedingungen setzt und ein freies marktwirtschaftliches Geschehen zulässt und nicht durch Verbote den Markt regulieren will. Außerdem – was mir persönlich wichtig ist und woran ich fest glaube: Auch Tradition wird ihren festen Platz in der Zukunft haben. Der klassische Schweinebraten, rheinischer Labskaus und Berliner Buletten werden auch in 50 Jahren noch zum kulturellen Erbe dieses Landes gehören!
Wir müssen weiterhin offen sein für alle Möglichkeiten, d. h. Ernährungsstile mit und ohne Fleisch, Rohstoffe, die in Bioreaktoren wachsen, Rohstoffe, die mit neuen Züchtungstechnologien angebaut und mit Robotern geerntet werden.
WE ARE HIRING!
(Junior) Editor
(m/w/d)
Dann
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann informiere dich und scanne den QR-Code.
Sende uns gerne deine Bewerbung an bewerbung@contentway.de oder melde dich bei Madeleine Buyna unter der Telefonnummer: +49 40 87 407 417
LEBENSMITTELWIRTSCHAFT Eine unabhängige Kampagne von Contentway 26
Du schaffst es, mit deiner Superpower – der deutschen Sprache – bunte Geschichten zu erzählen und fühlst dich in der Welt der Medien heimisch?
bist du bei uns genau richtig!
ANZEIGE
Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer Lebensmittelverband Deutschland
„Nachhaltigkeit funktioniert nur gemeinsam“
Um Produkte effizienter, nachhaltiger und sicherer zu transportieren, bietet CHEP das „Pooling“ an. Durch das Teilen und Wiederverwenden der Ladungsträger unterstützt der Logistik-Experte die Kreislaufwirtschaft aktiv.
Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sind Buzzwörter dieser Zeit, besonders in der Logistik. Doch damit eine echte Kreislaufstrategie gelingt, müssen alle Ökosystempartner, wie Lieferanten und Hersteller, als gemeinsame Einheit handeln. Die Logistik ist jetzt schon Dreh- und Angelpunkt vieler Geschäftsmodelle und wird zukünftig noch wichtiger. Dieser Verantwortung müssen sich Unternehmen stellen und entsprechende Angebote schaffen. Letztlich wird die Circular Economy lineares Wirtschaften ablösen, um zirkulären Warenströmen Platz zu machen. Das weiß auch Kai Derda, Deutschlandchef von CHEP, einem führenden Anbieter für das Pooling von Paletten und Behältern. Rund 360 Millionen Paletten, Kisten und Behälter sind im Besitz von CHEP, die auf ein Netzwerk von über 750 Service Centern verteilt sind. Diese unterstützen mehr als 500.000 Kundenkontaktpunkte für globale Marken.

Herr Derda, wie funktioniert das Paletten Pooling System von CHEP? Unser Geschäftsmodell dient dazu, die Nachhaltigkeit in der Supply Chain anzugehen, um unsere Paletten und Ladungsträger so nachhaltig wie möglich zu betreiben. Konkret bedeutet das: Unsere Kunden mieten von uns Paletten, die wir wieder abholen, reparieren und dann erneut zur Verfügung stellen. So tragen wir zu einer echten Kreislaufwirtschaft bei und haben gemeinsam mit unseren Kunden einen positiven Einfluss auf Mensch und Natur. Im Gegensatz zur Einmalpa-

Über CHEP
lette bleiben CHEP-Paletten dauerhaft in einer regenerativen Lieferkette.
Warum ist das Modell nicht nur nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich vorteilhaft?
Ein großer Vorteil ist, dass wir das ganze Palettenmanagement für unsere Kunden übernehmen. Das gebundene Kapital in Holz ist signifikant, wenn Unternehmen die eigenen Paletten kaufen und zusätzlich verwalten müssen. Dabei wissen sie nie, wie viele Paletten nötig sind. Bei CHEP bezahlen Firmen das, was sie benötigen. Zusätzlich können wir auf saisonale Spitzen reagieren – und bei Bedarf mehr liefern. Deswegen ist unser Modell wirtschaftlich aber auch nachhaltig sicherlich für viele Kunden interessant. Wir merken jetzt gerade alle, dass Ressourcen nicht mehr unendlich zur Verfügung stehen.
Wie hoch sind die Umwelteinsparungen durch das wiederwendbare System von CHEP?
Es gibt keine pauschale Antwort für jeden Kunden, weil es immer darauf ankommt, was sie für eine Lösung wählen.
«
„Kunden mieten von uns Paletten, die wir wieder abholen, reparieren und dann erneut zur Verfügung stellen. So tragen wir zu einer echten Kreislaufwirtschaft bei und haben gemeinsam mit unseren Kunden einen positiven Einfluss auf Mensch und Natur.“
Foto:CHEP
Wenn wir einmal global schauen, dann reden wir etwa von zweieinhalb Millionen Tonnen CO2 , die wir einsparen. Wir sprechen von 4.500 Megaliter Wasser, von über drei Millionen Kubikmeter Holz und über drei Millionen Bäumen, allein im letzten Geschäftsjahr (Juli 2021 - Juni 2022). Das ist viel und bringt natürlich Einsparungen im ganzen Nachhaltigkeitsbereich.
Welche wichtige Funktion haben Teilnehmer, um die Supply Chain nachhaltiger zu gestalten – und welche Störfaktoren beeinflussen globale Lieferketten?
Natürlich spielt jeder einzelne Akteur der Lieferkette eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung nachhaltigerer Lieferketten. Zusammenarbeit ist für uns der Schlüssel und sie erfordert ein tiefgreifendes Veränderungsmanagement. Und da sehe ich die größte Herausforderung, da wir aus einer Welt der Silos kommen, in der Unternehmen nicht daran gewöhnt sind, mit anderen Branchen oder Unternehmen zusammenzuarbeiten, die möglicherweise ihre Konkurrenten sind. Technologien für die gemeinsame Nutzung von
Seit mehr als 60 Jahren befähigen wir Lieferketten, qualitativ hochwertigere Plattformen zu nutzen, sich mit mehr Handelspartnern zu verbinden, Transporte zu reduzieren, weniger Abfall zu erzeugen, weniger natürliche Ressourcen zu verbrauchen, Plattformbestände zu senken und die Effizienz der Standardisierung zu erreichen. www.chep.com
«
„Natürlich spielt jeder einzelne Akteur der Lieferkette eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung nachhaltigerer Lieferketten.“
Daten werden immer wichtiger, um diese Zusammenarbeit erfolgreich zu gestalten, was auch ein großes Umdenken in der gesamten Branche erfordert. Aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg.
Das Unternehmen widmet sich auch dem Thema der Digitalisierung von Lieferströmen. Welche Funktion erfüllt dabei das Palettentracking? Mittels Tracking-Systemen können unsere Produkte entlang der gesamten Supply Chain verfolgt werden. Vom Distributionszentrum der Hersteller über das Handelszentrallager bis hin zur Platzierung im Verkaufsraum kann man den Standort unserer Paletten automatisiert nachverfolgen. So lassen sich Abholungen von Paletten besser planen und dadurch auch deren Verlust reduzieren. Außerdem bietet es unseren Kunden eine bessere Sichtbarkeit, Kontrolle und Sicherheit über ihre Produkte. Die Track-&-TraceTechnologie gibt uns die Möglichkeit, die globale Lieferkette genau abzubilden, Synergien zu identifizieren und Ineffizienzen zu beseitigen. Diese Technologie wollen wir weiterentwickeln, um unseren Kunden volle Transparenz zu bieten.
27 LEBENSMITTELWIRTSCHAFT Eine unabhängige Kampagne von Contentway
CHEP – PARTNER CONTENT
Kai Derda, Country General Manager von CHEP Deutschland
Die Biobranche im Jahr 2022
biolebensmittel
Peter Röhrig, geschäftsführender Vorstand des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft, bewertet die aktuelle Situation
Text: Julia Butz
 Fotos: BÖLW, Markus Spiske/unsplash
Fotos: BÖLW, Markus Spiske/unsplash
ternehmen zunehmend zur existenziellen Bedrohung wird.
Nach Peter Röhrig, dem geschäftsführenden Vorstand des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), bleiben die Kunden aber Bio-Lebensmitteln treu, auch wenn vermehrt zu günstigeren Bio-Produkten gegriffen wird: „Es ist ein sehr positives Signal, dass die Verbrauchertreue trotz Inflation, wirtschaftlicher Einbußen und der noch immer anhaltenden Pandemie ungebrochen ist.“ Bio als Antwort auf globale Krisen? Die zunehmend spürbaren Konsequenzen der Energie- und Klimakrise wirke sich auf das Verbraucherverhalten aus, bilanziert der BÖLW.
Aktuell überlagern sich vier krisenbedingte Situationen: Die Umweltkrise, der Rückgang des Lebensmittelumsatzes im Handel, da nach der Lockdown-Zeit wieder mehr auswärts gegessen wird, die allgemeine Kaufzurückhaltung in Folge des Krieges in Europa und der immense Anstieg der Energiepreise, der auch für viele Bio-Un-
Billigware, die nachhaltige Produkte diskriminiere, müsse ab sofort stärker besteuert werden. Damit auch die Verbraucher, die sich für umweltund tierfreundliche Lebensmittel an der Ladenkasse entscheiden, profitieren.
Die Situation sei aber für Bio-Bäuerinnen und -Bauern aktuell sehr fordernd. „Die Bundesregierung muss dringend dafür sorgen, dass Energie bezahlbar bleibt. Viele Bio-Unternehmen haben bereits seit Jahrzehnten in Erneuerbare Energien investiert und so deren Ausbau gefördert. Gerade diese Betriebe dürfen nun nicht für Fehlentscheidungen bei der Energiepolitik bluten“, sagt Peter Röhrig und mahnt: „Das Marktversagen bei der Nutzung von Umweltgütern muss endlich beendet werden, und zwar mit ‚wahren Preisen‘, die die Herstellungs- und Produktionskosten miteinberechnen.“ Billigware, die nachhaltige Produkte diskriminiere, müsse ab sofort stärker besteuert werden. Damit auch die Verbraucher, die sich für umwelt- und tierfreundliche Lebensmittel an der Ladenkasse entscheiden, profitieren.
Auf die Frage, ob es jemals genügend Öko-Lebensmittel geben wird, um alle Menschen zu versorgen, antwortet Peter Röhrig mit einem klaren JA. „Bio ist die einzig unmittelbar funktionierende Alternative, um die globale Ernährungskrise zu

lösen“. Bio stärke mit seiner ressourcenschützenden Kreislaufwirtschaft und den starken regionalen Wertschöpfungsketten die Sicherheit und Unabhängigkeit der weltweiten Ernährung. Landwirtschaft müsse so umgebaut werden, dass auch künftigen Generationen ausreichend intakte Ökosysteme und somit Produktionsgrundlagen für die Ernährung hinterlassen werde. Denn „dort, wo Bio draufsteht, ist auch Bio drin“, so Peter Röhrig. Die klaren Regeln für eine Bio-Zertifizierung gelten von der Öko-Pflanzenzüchtung über die artgerechte Tierhaltung, die schonende Lebensmittelherstellung bis hin zu Import- und engmaschigen Öko-Kontrollen – vom Hofladen- bis zum Discounterangebot. Mit der neuen EU-Öko-Verordnung, die Anfang 2022 in Kraft getreten ist, wurde das seit 1991 geltende Bio-Recht zudem positiv weiterentwickelt, in seinem Geltungsbereich erweitert und an den aktuellen Stand von Praxis und Forschung angepasst.
fakten 2022 wurde bis Mai rund 35 % mehr für Bio-Frischeprodukte ausgegeben als im gleichen Zeitraum 2019 (somit vor der Pandemie)*. Das Preisniveau für Bio-Frischeprodukte lag im 1. Halbjahr 5,2 % höher als 2021, damit aber deutlich unter der Entwicklung konventioneller Lebensmittel, für die 8 % ermittelt wurden.**
nach *AMI-Analyse nach GfK-Haushaltspanel 1-5/22 / **AMI-Verbraucherpreisspiegel
Ernährungswende: Klimatarier im Trend
Aus Sorge um den Klimawandel ändern immer mehr Menschen ihre Ernährungsgewohnheiten. Mehr als die Hälfte aller Deutschen, die ihre Ernährung in den vergangenen zwei Jahren umgestellt haben, taten dies aus Umwelt- und Klimaschutzgründen, so das Ergebnis einer aktuellen Studie!
Text: Jakob Bratsch
Fotos: Presse, Jean Wimmerlin/unsplash

Tatsächlich hat die Art, wie wir uns ernähren, Einfluss aufs Klima. Wir können z. B. den Treibhausgasausstoß reduzieren, indem wir deutlich weniger rotes Fleisch essen. Die sogenannten „Klimatarier“ passen ihre Ernährung der Klimakrise an: Gemüse, Getreide und Obst stehen im Vordergrund, ebenso unverarbeitete Lebensmittel, Regionalität und Saisonalität. Und als Proteinquelle spielen Muscheln und Fisch eine wichtige Rolle, deren CO2-Fußabdruck bis zu 50-mal niedriger ist, als der von Fleisch. Dass Fisch zu den klimafreundlicheren Proteinquellen zählt, ist allerdings nur die eine Seite der Medaille – ob er ohne Überfischung und ohne Schaden am Ökosystem gefangen wurde, ist die andere... Damit Klimatarier und Pescetarier auch in dieser Hinsicht eine umweltfreundliche Wahl treffen können, helfen Zertifizierungsprogramme von NGOs wie dem MSC. Dessen blaues Siegel steht für Fisch aus nachhaltigem Fang.
„Dass Fisch zu den klimafreundlicheren Proteinquellen zählt, ist allerdings nur die eine Seite der Medaille – ob er ohne Überfischung und ohne Schaden am Ökosystem gefangen wurde, ist die andere...“
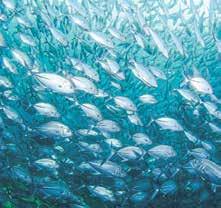
LEBENSMITTELWIRTSCHAFT Eine unabhängige Kampagne von Contentway 28
„Bio ist die unmittelbar einzige Alternative, um die globale Ernährungskrise zu lösen.“
Biolebensmittel sind deutlich weniger mit Insektiziden belastet, als vergleichbare konventionelle Ware.
Peter Röhrig, geschäftsführender Vorstand des BÖLW
Andrea Harmsen, Pressesprecherin DACH vom MSC
Was wir essen, verändert die
Einzelmaßnahmen reichen nicht mehr aus. Fischerei, Land- und Lebensmittelwirtschaft müssen für planetare Gesundheit an einem Strang ziehen.
Die Artenvielfalt und Gesundheit der rund 30.000 Fischarten in unseren Meeren tragen maßgeblich zur Balance maritimer Ökosysteme und damit unseres Klimas bei. Weltweit aber gelten über 30 % der kommerziell genutzten Fischbestände als überfischt und 60 % als maximal befischt mit steigender Tendenz. Zwar greifen immer mehr Verbraucher:innen zu Fischen aus nachhaltiger Fischerei, der Anteil steigt aber nicht so schnell wie nötig. Um die Meere zu retten und die Lebensgrundlage künftiger Jahre nicht weiter zu gefährden, müsse Überfischung gestoppt werden, sagt Julius Palm, stellvertretender Geschäftsführer der followfood GmbH: „Nicht mehr rausfischen, als natürlich nachwächst, steht als Maxime über allem, wenn wir darüber entscheiden, welche Fische wir anbieten und auf welche Fangmethoden wir setzen.“
followfood ist mit rund 80 Mitarbeitenden und 80 Mio. Euro Umsatz eine der wachstumsstärksten und innovativsten Foodmarken in Deutschland und setzt im Hinblick auf eine nachhaltige, zukunftsfähige Lebensmittelwelt neue Standards.
Begonnen hat alles mit followfish, der ersten nachhaltigen Fischmarke mit Tiefkühl- und Konserven-Fischprodukten aus ökologischem Fischfang. Den von der WWF gegründeten Marine Stewardship Council (MSC) sehen die followfood Fischerei-Richtlinien dabei nur als Mindestmaßstab an. Nach followfood sei der MSC unabdingbar, da er die globalen Fischereisysteme so schnell wie möglich auf Nachhaltigkeit umstellen will. followfood hat jedoch ein Ziel, das darüber hinaus geht: Als Leuchtturmmarke mit den strengsten Richtlinien die nachhaltigsten Lebensmittelprodukte der Welt auf den Markt zu bringen.

So sind 100 % des Sortiments aus Aquakulturen, Bio oder Naturland zertifiziert. Anhand der eigenen followfood Fischerei-Richtlinien, die über MSC oder Naturland hinaus gehen, werden mit sechs Zusatz-Kriterien die nachhaltigsten Fischereien ausgewählt. Dazu zählt auch die Ersteinführung von Sozialstandards im Wildfisch-Bereich. Als Vorzeigeprodukt gilt der von Hand geangelte und weltweit erste Fair Trade Thunfisch von den Malediven oder die Black Tiger Garnele aus einem Naturland-Projekt, bei der der Erhalt von Mangrovenwäldern mit Bio-Garnelen-Farming ohne Fütterung einhergeht.
 Julius Palm, stellvertretender Geschäftsführer der followfood GmbH
Julius Palm, stellvertretender Geschäftsführer der followfood GmbH
Foto:Presse
Welt.
weltweit im Lebensmittelbereich nicht mal eine Handvoll Unternehmen, die das erreicht haben. Zum besseren Verständnis: Wer alle gesetzlichen Standards einhält, erhält 0 Punkte. 1000 Punkte sind der Höchstwert für alles, was darüber hinausgeht“, so Julius Palm.
followfood geht mit seiner Initiative noch weiter und hat erste Produkte aus regenerativer Öko-Landwirtschaft auf den Markt gebracht, von Mehl über Kaffee bis Pommes frites und Kroketten. „Wir können noch so nachhaltig fischen: Wenn wir nicht die Eintragungen aus der Landwirtschaft wie Dünger oder Pestizide kontrollieren, werden die Fischbestän-
«
„Mit der Erfindung des Tracking-Codes auf allen Verpackungen wird es Verbraucher:innen ermöglicht, Ökobilanz, Fanggebiet, Produktion und Transportroute jedes Produkts zurückzuverfolgen.“
de und maritimen Ökosysteme degradieren. Alles hängt zusammen und bildet einen Kreislauf. Deshalb hört unsere Vision einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Lebensmittelwelt nicht beim Fisch auf, sondern wir kümmern uns nun auch um die Fragen einer zukunftsfähigen Landwirtschaft. Und hier ist Bio nur der Anfang.“, sagt Julius Palm und ergänzt: „Wir wollen den Beweis erbringen, dass man mit einem Geschäftsmodell die Welt verändern kann und damit unserer unternehmerischen Verantwortung gerecht werden. Denn wirtschaftliches Handeln innerhalb der planetaren Grenzen ist der zentrale Hebel zur Lösung unserer ökologischen Krisen.“
«„Wir können noch so nachhaltig fischen: Wenn wir nicht die Eintragungen aus der Landwirtschaft wie Dünger oder Pestizide kontrollieren, werden die Fischbestände und maritimen Ökosysteme degradieren.“
Über followfood
Mit der Erfindung des Tracking-Codes auf allen Verpackungen wird es Verbraucher:innen ermöglicht, Fanggebiet, Produktion und Transportroute jedes Produkts zurückzuverfolgen. Darüber hinaus wird für alle Produkte die jeweilige Ökobilanz aufgeführt. Von Treibhausgasemissionen über Wasserverbrauch bis hin zu Landnutzungsänderung werden insgesamt sechs Indikatoren ausgewiesen.
„Besonders stolz sind wir auf unsere erste Gemeinwohlökonomie-Bilanz, bei der wir ein absolutes Spitzenergebnis mit 719 Punkten erreichen konnten. Es gibt
Es fing mit followfish, dem Tracking-Code und der Vision, die Meere zu retten, an. Das traf den Nerv vieler Menschen und machte followfish in kurzer Zeit zur erfolgreichsten TK-Fischmarke. Es bestätigte die Gründer, weiter an ihren Vorstellungen von einer besseren Welt zu arbeiten. Mit followfood und der Vision, Böden zu retten, ging es deshalb weiter. www.followfood.de

29 LEBENSMITTELWIRTSCHAFT Eine unabhängige Kampagne von Contentway
FOLLOWFOOD – PARTNER CONTENT
fakten Sina Gritzuhn ist Gründerin und Geschäftsführerin der unabhängigen Start-up-Plattform Hamburg Startups und des Food Innovation Camps, das am 22. Mai 2023 wieder in Hamburg stattfindet. Die Start-up-Enthusiastin und Mutter zwei Teenager fördert und vernetzt die Start-upSzene bereits seit über 10 Jahren.
Sina
Gritzuhn:
„Start-ups werden den Food-Markt verändern“

LEBENSMITTELWIRTSCHAFT Eine unabhängige Kampagne von Contentway 30
großes interview
Die Innovationskraft von Start-ups kann die gesamte Lebensmittelbranche verändern – und gleichzeitig eine Ernährungswende einleiten. Sina Gritzuhn, Gründerin und Geschäftsführerin von Hamburg Startups, über kleine Revolutionen auf den Tellern.
 Text: Thomas Soltau Foto: Presse
Text: Thomas Soltau Foto: Presse
Sie sind Initiatorin des Food Innovation Camp. Worum geht es dabei genau? Das Food Innovation Camp ist eine Veranstaltung, die vier Säulen hat und im Prinzip als Plattform für das Food- und vor allem für das Start-up-Ökosystem dient. Es ist eine große Expo in der Handelskammer in Hamburg mit über 85 Ausstellern und vielen innovativen Produkten. Auf einer Bühne pitchen Start-ups mit ihren Produkten vor einer Jury. Wir haben eine Konferenz, in der es um Food Innovation geht – also wie sich die Menschheit auch in den nächsten 50 Jahren ernähren kann. Ein wichtiger Teil davon ist das Thema Matchmaking: Wie bekomme ich passgenaue Investoren geangelt, wenn ich ein innovatives Food Produkt habe? Also eine gezielte geschäftliche Partnerbörse.
Auf der Veranstaltung wurde mit Branchenexperten auch über die Zukunft der Gastronomie diskutiert. Wie ist Ihr Fazit in diesen unsicheren Zeiten?
Die Branche ist schwer im Umbruch. Corona, Energiekrise, Mangel an Arbeitskräften. Zusätzlich verlangen Kunden zunehmend vegetarische und nachhaltige Produkte. Die Politik hat auch Forderungen. Von der EU kommen Auflagen,
wenn es um Einwegverpackungen geht. Von 2023 an sind Restaurants, Cafés und Bistros verpflichtet, Mehrwegbehältnisse als Alternative zur Einwegverpackung anzubieten. Das sind viele Faktoren, die dazu zwingen, sich umzuorientieren.
Was sind denn die zukünftigen FoodTrends?
Mit der Art und Weise, wie wir essen, können wir die Klimaziele nicht erreichen. Die Generation Z gibt an, dass sich seit dem Beginn der Pandemie 75 Prozent von ihnen gesünder, vegetarischer und nachhaltiger ernähren. Fleischersatzprodukte aus Soja oder Erbsen schmecken mittlerweile so gut, dass sie kaum von Wurst oder Schnitzel zu unterscheiden sind. Greenforce etwa ist ein innovatives Unternehmen, das auf Erbsenbasis Cevapcici macht: Und zwar mit TrockenMischungen. Ein Pulver, das man nur mit Wasser mischt und dann daraus Cevapcici formt. Das schmeckt grandios gut. Beim Oktoberfest gibt es sogar eine vegane Weißwurst, die sich großer Beliebtheit erfreut. Wir haben beim Food Camp sogar ein veganes Ei gesehen. Start-ups bringen wirklich Bewegung in den Markt und werden ihn verändern.
Die Digitalisierung spielt eine tragende Rolle in jedem Lebensbereich. Ist FoodTech die technologische Zukunft von Essen?
Es ist sehr interessant, was in Israel gerade passiert. Das ist ein Hotspot, wenn es um Labor-Performance geht. Dort wird unter anderem aus Zellen tierischen Ursprungs Kuhmilch entwickelt. Ein anderes Beispiel: Fischstäbchen sind schnell gemacht und beliebt, doch viele Gewässer überfischt. Ein Start-up aus Lübeck sucht deshalb nach einer Alternative. Fischstäbchen, die im Labor aus Zellen von Fischen gezüchtet wurden, sollen nach den Plänen von Bluu Seafood schon bald auf den Tellern der Verbraucher landen. Und bei den Pilzen tut sich auch einiges: Wir essen ja
wird schlichtweg zu viel reguliert und damit werden zu hohe Hürden für Start-ups aufgebaut – denn sie liefern Ideen für eine flächendeckende und nachhaltige

Nur Fleisch aus artgerechter Tierzucht gehört auf den Teller
gewöhnlich nur das, was man oben sieht, den Fruchtkörper vom Pilz. Dabei sind auch die Myzelien interessant, also auch die Wurzeln vom Pilz. Sie enthalten ganz viele Nährstoffe, sind relativ groß und können gut verarbeitet werden. Letztlich wird alles fermentiert und daraus werden dann Fleisch-Alternativen erzeugt. Damit beschäftigen sich momentan auch diverse Start-ups. Das alles ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was gerade so passiert. Sie sehen: Start-ups geben der Branche mit ihren innovativen Ideen einen Kick, um zukünftig facettenreiche Angebote im Regal zu haben.
Unser Planet hat nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung. Wie gelangen wir zu mehr Nachhaltigkeit bei den Lebensmitteln?
Neben der bereits erwähnten Wende in der Ernährung spielt die Politik hier eine übergeordnete Rolle: Es wird schlichtweg zu viel reguliert und damit werden zu hohe Hürden für Start-ups aufgebaut – denn sie liefern Ideen für eine flächendeckende und nachhaltige Versorgung. Natürlich macht die Regulierung Sinn, weil Menschen vor neuen Erzeugnissen ausreichend geschützt werden müssen. Aber bestimmte Hürden müssen einfach niedriger angesetzt werden. Ganz wichtig ist auch die Möglichkeit, Finanzierungsmittel für neue Unternehmen zu generieren, damit die teure Entwicklung der Produkte finanziert werden kann.
Frau
Die Kritik ist absolut gerechtfertigt und ich teile sie. Das erhöht den Druck bei den Herstellern und Produktionsbetrieben.
Jeder Verbraucher und jeder Gast sollte sich dafür interessieren, wie Produkte entstehen und dazu Fragen stellen. Wir achten schon seit jeher sehr auf das Tierwohl und auf eine artgerechte Aufzucht.
Muss eigentlich jeden Tag Fleisch auf den Tisch?
Für die Gesundheit sind eine abwechslungsreiche Vitalkost sowie frische und natürliche Produkte das Beste. Ein Steak von einem grasgefütterten Rind ergänzt sich da prima, aber natürlich nicht jeden Tag. Und wenn Fleisch auf den Teller kommen soll, dann nur das Beste.
Sehen Sie in veganen Produkten einen teilweisen Ersatz?
Wir produzieren auch einen veganen Burger, den mag ich persönlich sehr gerne. Vegane Produkte können manchmal also durchaus als Ersatz dienen.
Wichtig ist nur, dass die Zusatzstoffe natürlich und frisch sind. Das ist bisher leider nur selten der Fall.
31 LEBENSMITTELWIRTSCHAFT Eine unabhängige Kampagne von Contentway
ANZEIGE
„Mit der Art und Weise, wie wir essen, können wir die Klimaziele nicht erreichen.“
„Es
Versorgung.“
Block, unter Verbraucherinnen und Verbrauchern wird Kritik an billigen Produkten aus der Massentierhaltung lauter. Was können Sie tun?
Christina Block, Mitglied des Aufsichtsrats und Gesellschafterin der Block Gruppe
Wir verbinden Ihre Marke mit der richtigen Zielgruppe. Unsere Mission ist es, Ihr Unternehmen als Marktführer über die relevantesten Vertriebskanäle zu vermarkten. Wir garantieren Ihnen, dass Ihre Botschaft die richtige Zielgruppe erreicht. Möchten Sie mehr wissen?
Text: Armin Fuhrer, Foto: Presse
www.contentway.de
Bio als TransformationsTreiber
veranstaltung
Auf der BIOFACH, Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, treffen sich vom 14. – 17. Februar 2023 wieder internationale Vertreter der Bio-Branche entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Im Fokus: Bio. Ernährungssouveränität und „wahre Preise“.

 Text: Jakob Bratsch Foto: Presse/BIOFACH
Text: Jakob Bratsch Foto: Presse/BIOFACH
Bio ebnet den Weg zu einer zukunftsfähigeren und resilienteren Ernährungswirtschaft.
Der Kongress ist integraler Bestandteil der Messe und findet parallel zur BIOFACH statt. 2023 rückt dieser in Zeiten multipler Krisen in den Fokus, welchen Beitrag Bio für Ernährungssicherheit und -Souveränität leistet und wie wahre Preise den Weg für eine ökologische Transformation der Ernährungs- und Lebensmittelwirtschaft ebnen. Ein Wirtschaften innerhalb der planetaren Belastungsgrenzen und somit eine wahr-
haft enkeltaugliche Lebensmittel- und Landwirtschaft gelingt nur mit einem Blick auf die Leistungen von Bio für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz und mit „wahren Preisen“, also die Einbeziehung der ökologischen Folgekosten in die Preise von Lebensmitteln.
Vier Tage BIOFACH, das heißt vier Tage die gesamte internationale Vielfalt an Bio-Lebensmitteln erleben, Netzwerken sowie Wissen teilen und mehren, aber auch: Mit allen Sinnen entdecken und genießen, was der Markt an Neuheiten und Trends zu bieten hat. Die BIOFACH ist dabei viel mehr als ein Handelsplatz. Auch 2023 findet die BIOFACH hybrid statt; neben der Präsenzmesse profitieren Aussteller und Besucher von den Mehrwerten der digitalen Plattform, die das Vor-Ort-Erlebnis ergänzt.
Parallel zur BIOFACH findet die internationale Fachmesse für Naturkosmetik statt. Hier präsentieren Hersteller, darunter zahlreiche Start-ups und Newcomer, welche Neuheiten der Sektor zu bieten hat.
Mehr Infos unter www.biofach.de und www.vivaness.de
Die Internationale Grüne Woche wieder live in Berlin
veranstaltung Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet die Internationale Grüne Woche vom 20. – 29. Januar 2023 wieder live auf dem Berliner Messegelände statt. Besucherinnen und Besucher erwarten zehn Tage voller Köstlichkeiten aus Deutschland und der Welt, spannende Informationen rund um die IGW-Themen Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau sowie tierische Begegnungen, die es sonst in einer Großstadt wie Berlin nicht ohne Weiteres gibt.
Text: Jakob Bratsch Foto: Messe Berlin
Die Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie (BVE) stellt unter dem Leitthema „So schmeckt die Zukunft“ vor, wie die Lebensmittelproduktion von morgen aussieht. Unter dem Motto „Ernährung sichern. Natur schützen“ gibt das Forum Moderne Landwirtschaft auf dem ErlebnisBauernhof einen Einblick, wie unsere Lebensmittel heute und morgen produziert werden. Hier präsentiert
sich auch der Deutsche Bauernverband (DBV). Weitere Highlights der Grünen Woche sind der Streetfood-Markt mit Köstlichkeiten aus aller Welt, die Hallen der Bundesländer mit regionalen Spezialitäten von der Küste bis zu den Bergen sowie die Blumen- und Tierhalle.
Aber auch den Themen unserer Zeit – Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung und nachhaltige Landnutzung – gibt die Internationale Grüne Woche 2023 ein Podium. In der neuen Themenwelt grünerleben können Besucherinnen und Besucher erleben, wie vielseitig Nachhaltigkeit sein kann. Im Re-Use-Superstore zeigt die Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz die Facetten recycelter Waren – von Upcycling-Möbeln über Second-Hand-Kleidung, bis hin zu einem Repair-Café und vielen spannenden Workshops.
Tickets für die Internationale Grüne Woche gibt es in diesem Jahr ausschließlich hier im Online-Ticketshop. Weitere Informationen zur Messe finden Sie hier: www.gruenewoche.de
Im Re-Use-Superstore zeigt die Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz die Facetten recycelter Waren – von Upcycling-Möbeln über Second-Hand-Kleidung, bis hin zu einem RepairCafé und vielen spannenden Workshops.
LEBENSMITTELWIRTSCHAFT Eine unabhängige Kampagne von Contentway 32
Interessierte Besucher haben die Möglichkeiten an hybriden Veranstaltungsformaten der Messe teilzunehmen.
Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet die Internationale Grüne Woche wieder live auf dem Berliner Messegelände statt
Nachhaltigkeit und Klimawandel im Blick
Die Block Gruppe forciert seit langem den Wandel zur klimagerechten und tierfreundlichen Rinderaufzucht. Das hat viele Vorteile auch für die Artenvielfalt.

Immer mehr Verbraucher in Deutschland wünschen sich mehr Nachhaltigkeit und Qualität bei der Haltung von Rindern. Und sie sind auch bereit, diese Entwicklung durch den Verzehr von Produkten aus einer klimagerechten und tierfreundlichen Tierhaltung zu unterstützen. Dass die Produkte von Rindern, die auf der Weide unter freiem Himmel leben gesünder sind als industriell produzierte aus der Massentierhaltung, hat sich längst herumgesprochen. Denn die negativen Auswirkungen der konventionellen Fleischproduktion bedrohen sowohl unsere ökologische als auch persönliche Gesundheit in zunehmender Weise.

Aber es geht auch anders. Das zeigt ein Blick nach Uruguay: Weideland, soweit das Auge reicht und darauf friedlich grasende Rinder. 365 Tage im Jahr können die Tiere hier ihre Freiheit in ihrem natürlichen Ökosystem dem Grasland genießen. Diese Haltung stärkt die natürlichen Kreisläufe: Die Rinder fressen Gräser und regen mit ihrem Biss deren Wachstum an, die Gräser wiederum nehmen Kohlendioxid auf und binden
es durch ihre Feinwurzeln besonders effizient im Boden. Die Tiere düngen mit ihren Exkrementen schließlich den Boden und bieten Nahrung für Insekten.
Rinder sind als Wiederkäuer ein Teil der wertvollen Graslandökosysteme, die in der Co-Evolution mit Weidetieren entstanden sind. Sie bilden heute das größte Biom der Welt. Diese Ökosysteme spielen eine ungemein wichtige Rolle, denn sie speichern weltweit mehr CO2 als die Waldökosysteme und fördern zugleich die Artenvielfalt. Grasökosysteme nehmen zudem bei Starkregen besonders viel Wasser auf, füllen Grundwasserspeicher und stärken Wasserkreisläufe.
Unterstützt werden die Landwirte in Uruguay vom Hamburger Traditionsunternehmen Block, das unter seiner Marke Block House das Umdenken in der Ernährungswirtschaft vorantreibt. So erhöht es seit Jahren konsequent den Anteil der Grasfütterung bei den von ihm weiterverarbeiteten Rindern. Der Handlungsbedarf ist klar definiert: Es sollen Emissionen in der Landwirtschaft und der Produktion vermieden, die Versorgungssicherheit angesichts der sich immer stärker herausbildenden Wetterextreme abgesichert und Böden durch Humusaufbau in lebendige Kohlenstoffsenken verwandelt werden. Und ganz wichtig: Es soll eine

Nutztierhaltung gefördert werden, die nicht mehr in einer Nahrungskonkurrenz zum Menschen steht und die natürlichen Kreisläufe stärkt.
tier- und umweltgerechtere Rinderzucht ermöglicht und gleichzeitig eine Regeneration der Böden unterstützt. Dadurch bleibt auch die Wertschöpfung in der Region und schafft und erhält Arbeitsplätze.
Neben ihren Aktivitäten in Uruguay und Norddeutschland pioniert die Block Gruppe zudem die Herstellung prämierter veganer und vegetarischer Alternativen. Die veganen Burger kommen nicht nur ganz ohne Fleisch aus, sondern auch ohne künstliche Zusatzstoffe. Für eine nachhaltige und ausgewogene Ernährung gilt es nicht nur zu fragen ‚Was‘, sondern es kommt, wie die Block Gruppe zeigt, vor allem auch auf das ‚Wie‘ an.
Doch warum in die Ferne schweifen? Was in Uruguay funktioniert, klappt auch hierzulande. Schon seit 2014 kooperiert die Block Gruppe mit Landwirten in Mecklenburg-Vorpommern und Nord-Brandenburg und fördert auch dort eine tier- und umweltgerechte, regionale Rinderaufzucht mit dazugehörigen eigenen Forschungsprogrammen. Auch mit Beratungsangeboten und Wissensvermittlung steht die Block Gruppe den Landwirten zur Seite und honoriert entsprechende Erfolge mit Humusaufbauzertifikaten. Weil die Landwirte hochwertige heimische Eiweißlieferanten wie Lupinen, Ackerbohnen und Luzernen selbst anbauen, wird eine immer
«
„Weil die Landwirte hochwertige heimische Eiweißlieferanten wie Lupinen, Ackerbohnen und Luzernen selbst anbauen, wird eine immer tier- und umweltgerechtere Rinderzucht ermöglicht und gleichzeitig eine Regeneration der Böden unterstützt.“


www.block-house.de BLOCK HOUSE – PARTNER CONTENT
BLOCK HOUSE Im Block House ist es selbstverständlich, dass Gäste ihre Gerichte und Produkte mit gutem Gefühl genießen können. Damit aus dem guten Gefühl ein immer besseres wird, setzt BLOCK HOUSE auf Qualität, Tierwohl und Umweltschutz. Von der Aufzucht der Rinder über Forschungsprojekte bis hin zu einer visionären und validierten Klimastrategie im Block House werden Genuss und eine „enkeltaugliche“ Zukunft zusammen gedacht und serviert.
33 LEBENSMITTELWIRTSCHAFT Eine unabhängige Kampagne von Contentway
Kann Convenience nachhaltig sein?
fertiggerichte
Christian Rach im Gespräch über Convenience und Nachhaltigkeit, gesunde Ernährung mit viel Geschmack und mögliche Zukunftstrends in der Foodbranche
 Text: Julia Butz
Fotos: Thomas Pritschet Eduardo Soares/unsplash
Text: Julia Butz
Fotos: Thomas Pritschet Eduardo Soares/unsplash
Convenience Food hat in vielen Fällen einen hohen CO2-Fußabdruck und gilt durch den hohen Energiebedarf bei Herstellung und Kühlung, lange Transportwege und die Nutzung von Einwegverpackungen alles andere als klimafreundlich. Auch auf die Gesundheit können sich Fertiggerichte negativ auswirken. Sollte man der Gesundheit und Umwelt zuliebe Convenience also besser meiden?


Christian Rach, Spitzenkoch, Gastronom, Kochbuchautor und Branchenbegleiter diverser Fernsehformate, beantwortet die Frage nach der Vereinbarkeit von Nachhaltigkeit und industriell hergestellten Fertiggerichten mit einem klaren „Ja“. „Convenience bedeutet frei übersetzt ‚der Bequemlichkeit dienend‘. Wenn ich mir eine Portion Nudeln koche und eine Soße dazugebe, ist das auch ‚Convenience‘. Mich stört manch-

mal die negative Pauschalverurteilung bei bestimmten Begrifflichkeiten, man sollte schon differenzieren.“ Auch die Bewertung des CO2-Fußabdrucks müsse differenziert betrachtet werden: „Wie klimafreundlich eine Tomate ist, hängt z. B. stark davon ab, wann, wo und in welcher Weise sie erzeugt wird. Im Sommer oder im Süden produziert werden etwa 0,85 kg CO2 je Kilo Tomate emittiert, wohingegen der Wert in einem beheizten, beleuchteten Treibhaus im Winter auf bis zu 10 kg CO2 ansteigen kann und sie so zum echten Klimakiller wird. Und unsere gute alte Butter führt die Liste als umweltschädlichstes Molkereiprodukt an.“, so Christian Rach. Trotzdem schneidet Gemüse im Vergleich zu Rindfleisch, Käse, Sahne und Tiefkühlprodukten noch immer sehr viel besser ab. Esst mehr Gemüse als Fleisch, mehr regional und saisonal – bleibt somit auch in Bezug auf die Ökobilanz das Credo.
Dass viele Verbraucher aus Bequemlichkeit zu Fertigprodukten greifen, kann Christian Rach durchaus verstehen. Obwohl er das Argument des zeitlichen Aufwandes eher nicht nachvollziehen kann: „20 – 25 Minuten müssen eine gesunde Ernährung wert sein.“ Wie eine schnelle, gesunde und günstige Küche für den Hausgebrauch funktioniert, daran mangele es noch in der öffentlichen Aufklärung. Sein Tipp: „Wer
eher zu Ende der Marktzeit auf den Wochenmarkt geht, hat große Chancen auf günstigere Preise. Jeder Händler ist dann froh, seine Frischware noch an den Mann zu bringen.“
Als richtungsweisend sieht Christian Rach die Themen Foodprinting – die Fleischerzeugung ohne Tiersterben, bei der nach jetzigem Stand über 50 % weniger Energie und 96 % weniger CO2 emittiert werden – sowie eine flexiblere landwirtschaftliche Flächennutzung durch z. B. Urban und Vertical Gardening in den Ballungszentren und die Nutzung von Agri-Photovoltaikanlagen, die neben der Erzeugung von Sonnenenergie gleichzeitig als Wetterschutz und Bewässerung für den darunterliegenden Gemüseanbau dienen. „Die Erhöhung der Kapazitäten auf vorhandenen Flächen ist ein wichtiger Weg für die Sicherstellung unserer Ernährung“, so Christian Rach.
Die Erhöhung der Kapazitäten auf vorhandenen Flächen ist ein wichtiger Weg für die Sicherstellung unserer Ernährung
fakten
Der Hamburger Christian Rach wurde als RTL-Restauranttester überregional bekannt. In Kooperation mit dem WWF setzt er sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln ein und betreibt gemeinsam mit Wolfgang Bosbach den Politik-Personality-Podcast „Die Wochentester“, der bereits 0,5 Mio. Abonnenten zählt.
Leuchtturm für eine zukunftsfähige Lebensmittelwelt
Wie sieht eine zukunftsfähige Lebensmittelversorgung aus?
Die Wissenschaft ist hier eindeutig. Wir brauchen 1. mehr nachhaltige Lebensmittel. Wir müssen 2. den Konsum von Fleisch- und Milchprodukten und 3. die Lebensmittelverschwendung je um ca. 50 % reduzieren.
Wie kann der Handel unterstützen?
Indem mehr Produkte mit diesem Anspruch angeboten werden. Der klare Fokus liegt auf Fisch und plant-based Produkten, da hier die beste Ökobilanz zu erreichen ist. Wir haben kein Fleisch, nur wenig Milchprodukte und ausschließlich 100 % Bio und nachhaltigen Fisch im Sortiment. Das spiegelt das Angebot einer zukunftsfähigen Lebensmittelwelt wider. Wir wollen ein Leuchtturm sein und die Branche bewusst animieren, uns zu kopieren. Allein schaffen wir das nicht, es braucht alle – global.
Und der 3. Punkt?
Wir schmeißen mehr als 30 % an Lebensmitteln weg. Es gibt kaum etwas Unnötigeres. Mit der Marke „Rettergut“ wollen wir Lebensmittel retten und zu leckeren Produkten verarbeiten.
Mit diesen drei Punkten sind wir meines Wissens das erste Unternehmen, das einen echten ganzheitlichen Lösungsansatz verfolgt.
LEBENSMITTELWIRTSCHAFT Eine unabhängige Kampagne von Contentway 34
Wie eine schnelle, gesunde und günstige Küche für den Hausgebrauch funktioniert, daran mangelt es noch in der öffentlichen Aufklärung.
Christian Rach, deutscher Koch, Fernsehkoch und Kochbuchautor
Julius Palm, stellvertretender Geschäftsführer followfood GmbH
Text: Julia Butz, Foto: Presse/followfood, Markus Spiske/unsplash
Tiefkühlgerichte sind beliebt – Der Pro-Kopf-Verbrauch liegt laut einer Studie des Deutschen Tiefkühlinstituts bei 46,9 Kilogramm im Jahr.
Der klare Fokus liegt auf Fisch und plantbased Produkten, da hier die beste Ökobilanz zu erreichen ist.
Wir schmeißen mehr als 30 % an Lebensmitteln weg. Es gibt kaum etwas Unnötigeres.
Das Gastgewerbe wieder attraktiv machen
fachkräftemangel
Der Gastronomie und Hotellerie fehlen die Beschäftigten. Was kann getan werden, um Mitarbeiter für einen Arbeitsplatz in der Branche zu begeistern?
Text: Julia Butz Foto: Kate Townsend/unsplash
Sprach man vor Corona noch von Fachkräftemangel, ist man inzwischen froh, überhaupt Mitarbeiter zu bekommen. Über den Personalmangel in Gastronomie und Hotellerie ist aktuell viel berichtet worden. Lange Schließzeiten und die monatelang andauernden Unsicherheiten haben dazu geführt, dass sich die Beschäftigten aus Restaurant, Küche und Guest Services andere Jobs gesucht haben – und dort bleiben. Weil die Löhne möglicherweise höher sind, Arbeitszeiten kürzer und die Work-Life-Balance gesün-

der. So sind Gastronomen ausgerechnet im Sommergeschäft gezwungen, Ruhetage einzuführen, Speisekarten zu kürzen und ihr Angebot einzuschränken. Schwierige Voraussetzungen, um an Vor-Corona-Umsatzniveaus anzuknüpfen.
Was aber kann seitens der Arbeitgeber getan werden, um Mitarbeiter wieder für Gastronomie und Hotellerie zu begeistern?
Vor der Problematik stehen Anbieter von Sylt bis zum Bodensee, vom Fünf-Sterne-Resort bis zum Café nebenan.
Die gesamte Branche müsse sich von Grund auf reformieren, so die Forderungen aus der Fachwelt. Der sich bereits lange vor Corona schleichend andeutenden Krise müsse mit einem Angebot an zeitgemäßen Berufsbildern, flexibleren Arbeitszeiten, modernen Ausbildungsund Weiterbildungsprogrammen ent-
gegengetreten und an die Bedürfnisse der Arbeitnehmer von heute angepasst werden.
Einige Hoteliers und Gastronomen versuchen sich über innovative Mitarbeiterbenefits oder hochwertig ausgestattete Unterkünfte als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Aber es bedarf insgesamt der Modernisierung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Alltag und einer sehr viel wertschätzenderen Betriebskultur. Und dies nicht nur in Bezug auf eine entsprechende Entlohnung. Wertschätzend bedeutet auch, dass Dienstpläne frühzeitig aufgesetzt werden, um Arbeitnehmern Planungssicherheit zu geben, auch für eine sozial verträgliche Freizeitgestaltung; Jahresarbeitszeitkonten einzuführen; die Übersicht geleisteter (Über-)Stunden transparent und für den Mitarbeiter jederzeit einsehbar zu gestalten; Urlaub zur Wunschzeit nehmen zu dürfen und nicht nur zur Schließzeit im November. Regelmäßige Team-Events, Feedback-Gespräche, eine transparente Kommunikation, auch zwischen Abteilungen, Mitarbeiter bei Entscheidungsfindungen einzubeziehen, bei Interesse Verantwortungen zu übertragen – all diese Tools stehen für einen wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander und fördern ein positives Arbeitsklima.
Denn die Arbeit im Hotel- und Gastgewerbe ist sehr attraktiv, sehr vielfältig und abwechslungsreich. International und horizonterweiternd. Sehr bereichernd.
Weil man sich einbringen und auspowern kann, viel lernen und kreativ sein kann, weil man etwas bewirken kann und nicht zuletzt Menschen mit seiner Arbeit glücklich macht. Regelmäßige, auch internationale Betriebswechsel sind in der Branche durchaus üblich, auch gewünscht und gut geeignet, um ganz nebenbei die Karriere- und Einkommensleiter hinaufzuklettern. Die Spa-Gäste im Ostseehotel beraten? Fine Dining im Schwarzwald oder Kaiserschmarrn auf der Almhütte zubereiten? Glühwein mit Blick aufs Matterhorn ausschenken? Geht alles in der Hospitality-Branche. Am besten mit einer nachhaltigen Personalführung.
fakten Vor der Corona-Krise erwirtschaftete das Gastgewerbe rund 100 Milliarden Euro, dabei arbeiteten zwei Drittel der Beschäftigten zu einem Stundensatz unterhalb der Niedriglohngrenze. 2020 sank die Anzahl der Beschäftigten um knapp ein Viertel im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019. (Statistisches Bundesamt)
Mexikanische Tradition in Deutschland
Beliebt in der Gastro-Szene besonders in den deutschen Metropolen ist San Cosme, der meistverkaufte Mezcal in Deutschland. Mezcal San Cosme ist ein handwerklich hergestellter Mezcal aus 100% Espadin-Agaven. Produziert wird er in Santiago Matatlán im Bundesstaat Oaxaca in Mexiko. Mittlerweile ist San Cosme in 22 Ländern der Welt verfügbar, geschaffen mit der Mission, Mexiko auf der ganzen Welt erlebbar zu machen. Mit seinen 40 %-vol. ist der Mezcal mild, hat jedoch alle klassischen Noten, für die das Agavendestillat bekannt ist. Für Mexikanerinnen und Mexikaner symbolisiert Mezcal die
Schönheit und die Magie ihrer geliebten Heimat. In den Bars in Deutschland geht der Entry Level Mezcal besonders häufig als San Cosme Mule über die Tresen. Die Abwandlung des Moscow Mule genießt wachsende Beliebtheit, schmeckt frisch und gibt als DrinkVorschlag eine gute Balance zu dem rauchigen Eigengeschmack, den Mezcal klassischerweise mitbringt. Beim Bestellen von Mezcal San Cosme gilt: Mezcal wird nicht getrunken – Mezcal wird geküsst. Und mit jedem Schluck erleben die Feiernden ein Stück Tradition seiner geliebten Heimat in Mexiko – auch in Berlin, in Köln und in deiner Stadt.

Mule
35 LEBENSMITTELWIRTSCHAFT Eine unabhängige Kampagne von Contentway ADVERTORIAL
Zutaten: • 50 ml Mezcal San Cosme • 10 ml Limettensaft • Gingerbeer zum Aufgießen San
Cosme
San Cosme und Limettensaft
Zubereitung: Mezcal
in einen Tumbler geben. Eis hinzufügen und mit Gingerbeer auffüllen. Mit frischer Minze und einer Limettenscheibe garnieren. Salud!

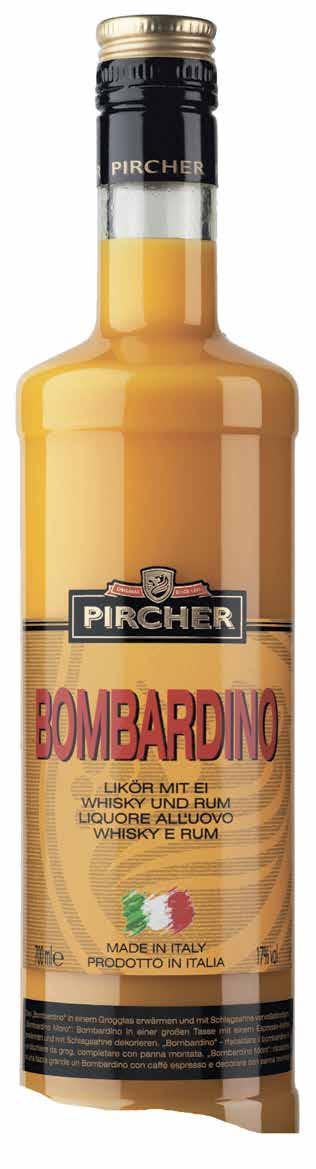

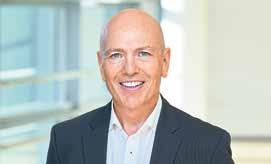


















 Text: Jakob Bratsch Foto: Presse
Text: Jakob Bratsch Foto: Presse




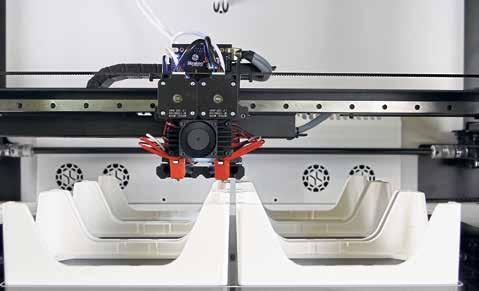







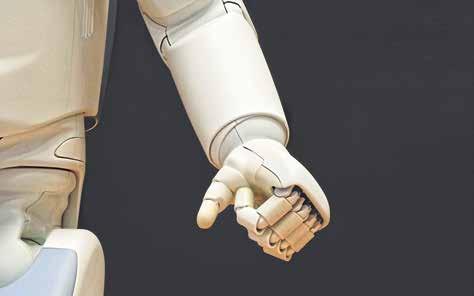




















 Text: Silja Ahlemeyer Fotos: VDMA thisisengineering/unsplash
Text: Silja Ahlemeyer Fotos: VDMA thisisengineering/unsplash
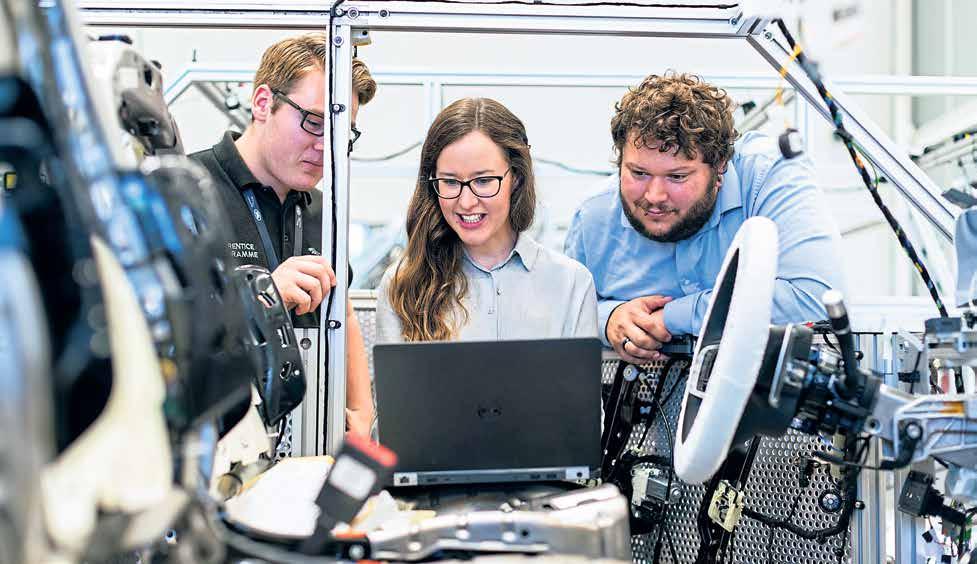


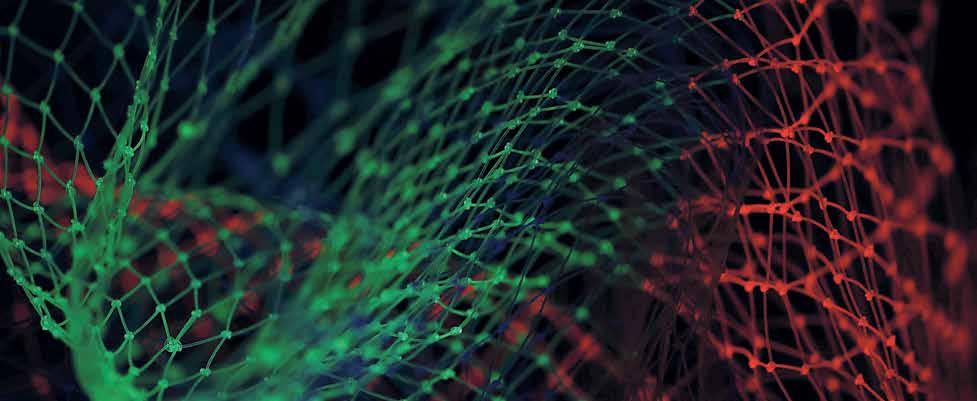
 Text: Armin Fuhrer Fotos: Presse Towfiqu barbhuiya/unsplash
Text: Armin Fuhrer Fotos: Presse Towfiqu barbhuiya/unsplash


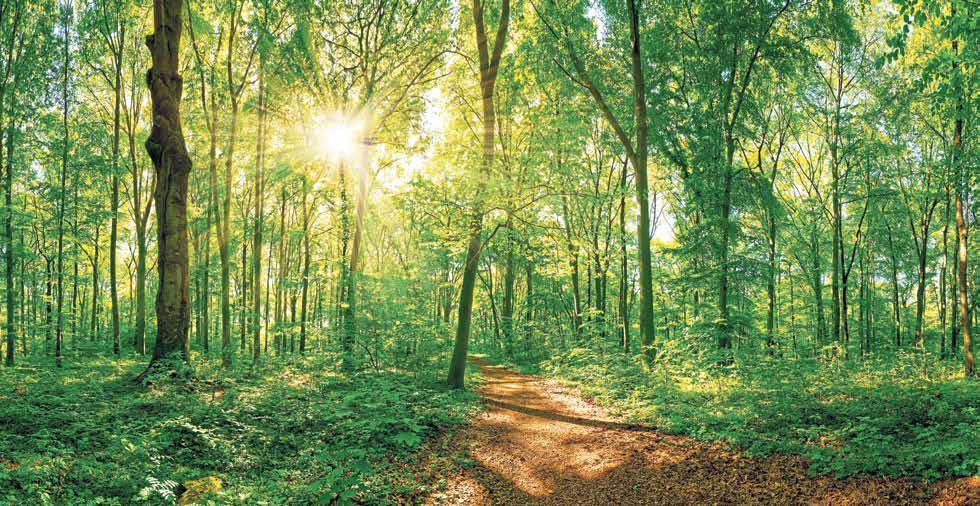
 Text: Thomas Soltau Foto: Presse, Chelsea/unsplash
Text: Thomas Soltau Foto: Presse, Chelsea/unsplash







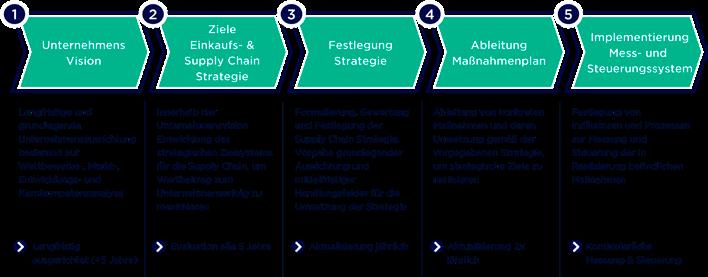





 Fotos: BÖLW, Markus Spiske/unsplash
Fotos: BÖLW, Markus Spiske/unsplash


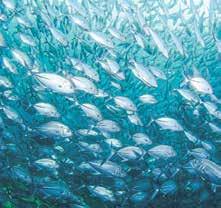

 Julius Palm, stellvertretender Geschäftsführer der followfood GmbH
Julius Palm, stellvertretender Geschäftsführer der followfood GmbH


 Text: Thomas Soltau Foto: Presse
Text: Thomas Soltau Foto: Presse


 Text: Jakob Bratsch Foto: Presse/BIOFACH
Text: Jakob Bratsch Foto: Presse/BIOFACH





 Text: Julia Butz
Fotos: Thomas Pritschet Eduardo Soares/unsplash
Text: Julia Butz
Fotos: Thomas Pritschet Eduardo Soares/unsplash