MARC RIBOT
Der Gitarrist als Klangbildhauer
VIVA NAPOLI
Brodelnde Musik aus der Stadt am Vesuv

ARNOLD SCHÖNBERG
So viel mehr als »Zwölfton«
ANTOINE TAMESTIT
Ein Gespräch über den Reiz der Bratsche
PRINCIPAL SPONSOR DER

juliusbaer.com


MARC RIBOT
Der Gitarrist als Klangbildhauer
Brodelnde Musik aus der Stadt am Vesuv

ARNOLD SCHÖNBERG
So viel mehr als »Zwölfton«
ANTOINE TAMESTIT
Ein Gespräch über den Reiz der Bratsche
PRINCIPAL SPONSOR DER

juliusbaer.com

Liebe Leserin, lieber Leser, angeblich beginnt Südeuropa für manche Hamburger bereits am Südufer der Elbe – also gegenüber der Elbphilharmonie, dort, wo sich die Weiten des Hamburger Hafens er strecken. Bis nach Neapel aber, der Quintessenz einer südeuropäischen Metropole, sind es noch beinahe 1.500 Kilometer. Dank seiner bewegten zweieinhalbtausendjährigen Geschichte und der strategischen Lage am Mittelmeer ist Neapel ein kultureller Schmelztiegel par excellence, was sich auch in seiner reichen musikalischen Tradition widerspiegelt. Grund genug, im Spätherbst mit dem Festival »Viva Napoli« ein langes Wochenende lang einige der vielen markanten Klänge aus dieser aufregend vielstimmigen Stadt zu zelebrieren, mit Musik aus der Renaissance bis hin zur aktuellen Canzone Neapoletana (Seite 46). Kaum vier Wochen zuvor sind in der Elbphilharmonie einige der wunderbarsten Interpreten der populären Musik Brasiliens zu erleben, die mich seit Jahrzehnten fasziniert und begleitet (Seite 4). Neapel, Brasilien – die grobe Himmelsrichtung für diese beiden verlockenden Ohrenreiseziele lockte uns, den Süden zum Titelwort für diese Ausgabe des »Elbphilharmonie Magazins« zu erheben.
Zwei essayistisch gehaltene Porträts in diesem Heft widmen sich zwei bedeutenden Komponisten aus dem deutschsprachigen Raum, denen die Musikgeschichte ganz unterschiedliche, gleichwohl entscheidende Impulse verdankt: dem Opernerneuerer Christoph Willibald Gluck (Seite 66) und dem streitbaren Musikrevolutionär
Arnold Schönberg (Seite 10), dessen Name allein schon Generationen von Musikfreunden die Schweißperlen auf die Stirn trieb. Schließlich gilt seine Musik als komplex und allzu abstrakt. Dabei finden sich in seinem vielfältigen Œuvre viele Meisterwerke des 20. Jahrhunderts, die zu kennen sich unbedingt lohnt. Damit das auch hörbar wird, braucht es allerdings meisterliche Interpretinnen und Interpreten, wie etwa Patricia Kopatchinskaja, PierreLaurent Aimard, Alan Gilbert oder Ingo Metzmacher, die in der Elbphilharmonie anlässlich des 150. Geburtstags des Komponisten einige seiner wichtigsten Werke zur Aufführung bringen.
Wie gewohnt finden Sie auf den folgenden Seiten auch Geschichten, Texte, Interviews, in denen es um exponierte Künstlerinnen und Künstler geht, auf die wir uns in den kommenden Wochen besonders freuen. Zu ihnen zählen der Bratschist Antoine Tamestit, Artist in Residence des NDR Elbphilharmonie Orchesters (Seite 34), der sensible Klangberserker Marc Ribot, der einen »Elbphilharmonie Reflektor« gestaltet (Seite 58), und die französische OscarPreisträgerin Marion Cotillard, die als Sprecherin in Arthur Honeggers bewegendem Werk »Jeanne d’Arc au bûcher« zu erleben ist (Seite 28).
Ich wünsche Ihnen wie stets eine anregende und lehrreiche Lektüre!
Mit herzlichen Grüßen hoch aus dem Norden
Ihr Christoph LiebenSeutter Generalintendant Elbphilharmonie und Laeiszhalle
4
FESTIVAL
BRAZILIAN LEGENDS
Zehn Schlüsselmomente aus der wechselvollen Musikgeschichte Brasiliens
VON STEFAN FRANZEN
18
ESSAY
DIE ENTGRENZER
In der Kammermusik haben Komponisten aller Zeiten besonders viel gewagt.
VON VOLKER HAGEDORN
26
MUSIKLEXIKON
STICHWORT »SÜDEN«
Es gibt nichts, wozu die Musik nichts zu sagen hätte.
VON CLEMENS MATUSCHEK
28

ORATORIUM
VISION, NATION, EMOTION
Marion Cotillard in Arthur Honeggers »Jeanne d’Arc au bûcher«
VON SIMON CHLOSTA
34

INTERVIEW
»DER RAUM ZWISCHEN KÜNSTLER
UND PUBLIKUM IST SPIRITUELL«
Der Bratschist Antoine Tamestit im Gespräch
VON BJØRN WOLL
38
FOTOSTRECKE
MEHR LICHT!
VON ARAS GÖKTEN
52

POP
SIE IST KÜNSTLERIN, SIE SCHAUT NICHT ZURÜCK
Cat Power spielt ein denkwürdiges BobDylanKonzert eins zu eins nach.
VON JAN PAERSCH
56
ENGAGEMENT
ICH BIN EIN FAN
VON CLAUDIA SCHILLER
64
UMGEHÖRT
SOUTHERN SOUNDTRACK
Eine Frage, sieben Antworten
VON IVANA RAJIC ˇ
66
ALTE MUSIK
RITTER GLÜCK
Das rasante Leben des Opernreformers Christoph Willibald Gluck
VON REGINE MÜLLER
70
GLOSSE
BITTE UMDREHEN!
Warum muss der Süden eigentlich immer unten sein?
VON TILL RAETHER
72
MITARBEITER
DIE TEXTFABRIK
Die Redaktion produziert Information in jedem nur denkbaren Format.
VON HANNO GRAHL
76
REPORTAGE
NEUE HEIMAT NORD
Wie fühlt sich Hamburg als neues Zuhause an?
VON STEPHAN BARTELS
FÖRDERER UND SPONSOREN 82

10
JUBILÄUM
KENNEN SIE SCHÖNBERG?
Vergessen Sie das Schlagwort »Zwölfton«!
Die Vielfalt von Arnold Schönbergs Persönlichkeit und Werk ist schillernd und irritierend.
VON ALBRECHT SELGE

46
NEAPEL ’O SOLE MIO Neapel! Traumstadt für Viele, geheimnisvolles Urlaubsziel, legendenumwittert. Romantik, Morde, Müllskandale. Und großartige Musik.
VON PETER REICHELT

58
JAZZ
DER KLANGBILDHAUER
Marc Ribot vereint in sich die Rohheit des Punk, die Cleverness des Jazz und die Sensibilität eines Künstlers, den das Leben nicht glattzuschleifen vermochte.
VON TOM R. SCHULZ
Zehn Schlüsselmomente aus der wechselvollen
Musikgeschichte Brasiliens.
VON STEFAN FRANZEN

Als ein Spiegel der Vielfalt, so zeigt sich das Musikleben Brasiliens seit mindestens 150 Jahren. Der riesige Staat in Südamerika ist ein ethnisches und topografisches Patchwork mit einer Geschichte, an der eine Menge Völker und Kulturen mitgewirkt haben. Die Musik war und ist dabei eine integrative, solidarisierende Kraft, ein klingender Kitt, der große Teile der Gesellschaft zusammenhält. Sie hat Diktaturen und Militärregimes überstanden, ist gegen Politik aufgetreten, hat sie aber auch selbst mitgestaltet. »Über brasilianische Musik zu sprechen, heißt über Diversität zu sprechen, über Mischungen«, sagt die Sängerin Marisa Monte. »Diese Vielfalt, diesen Mix kann man in der Küche, in der Religion, in den Menschen und der Sprache sehen – und eben auch in der Musik. Dazu kommt: Brasilien ist ein junges Land, das immer noch originale Stile hervorbringt.« Anlässlich des BrasilienFestivals in der Elbphilharmonie: zehn markante Ereignisse aus der Musikhistorie des Landes, die weit über den jeweiligen Tag wirkten und wirken.

RIOS ERSTE SELFMADEFRAU
Mitte des 19. Jahrhunderts bekommen in Rio de Janeiro die Salontänze, die die Kolonialherren mitgebracht haben, einen swingenden Touch. Die mit Flöte und Gitarre gespielten Polkas, Walzer und Mazurken färben sich mit den Rhythmen der verschleppten Afrikaner. Auch Blechbläser und Klarinetten aus den Fabrik und Feuerwehrkapellen finden Eingang in diese Instrumentalmusik, die man bald Choro nennt, ihres oft melancholischen Charakters wegen wohl vom Verb chorar, weinen. Es ist die erste genuin brasilianische Musik. In der neu entstehenden Mittelschicht kommt das Klavierspiel immer mehr in Mode und bereichert diese junge Musik ebenfalls. Eine solche Pianistin aus gutem Hause ist Chiquinha Gonzaga (1847–1935). Sie wird zur ersten Selfmadefrau Rios: Zunächst Mitglied im Ensemble des ChoroPioniers Joaquim Callado, greift sie 1877 selbst zur Feder und schreibt die Komposition »Atraente«. Dann folgt Hit auf Hit, etwa »Corta Jaca«, entworfen für eine burleske Operette. Mit ihrem eigenen Orchester und Revuetheater geht Gonzaga in Brasiliens Geschichte ein und wird von vielen bis heute als Leitbild verehrt – nicht nur als Musikerin, sondern auch als Vorkämpferin für Frauenrechte und die Abschaffung der Sklaverei. Ihre Musik, der Choro, ist bis heute im ganzen Land beliebt, auch bei den Jungen, als spontane Straßenmusik ebenso wie in jazzigen Studioproduktionen.
Mit den Zuwanderern aus der Region Bahia, die Ende des 19. Jahrhunderts im Hafen und in den Straßen von Rio Arbeit suchen, gelangt eine frühe Form des Samba in die damalige Hauptstadt, der Samba de Roda, noch mit Zügen eines afrikanisch geprägten Kreistanzes. In den Tanzhäusern trifft er – wie der Choro – auf europäische Melodien und Harmonien. In frechen und saftigen Texten erzählt er von Saufgelagen, von Herzschmerz, auch vom Katz und Mausspiel mit der Polizei. Ab den 1930ern wird er bei den Paraden des Karnevals mit aufwendigen Choreografien gekoppelt, Sambaschulen sprießen überall aus dem Boden. Auf den Hügeln bleibt er als Samba de Morro eine Musik der Armen; unten in der Stadt hält er Einzug in die Bourgeoisie und ins Radio, wird ein richtiger Wirtschaftszweig. Oft nimmt dieser MittelschichtSamba pathetische Gestalt an, orchestral gewandet und mit schmelzendem Gesang.
Diesen massentauglichen Samba Exaltação weiß auch der Diktator Gétulio Vargas für seine Zwecke zu nutzen. Zum größten Hit des Genres wird »Aquarela do Brasil« aus der Feder von Ary Barroso (1903–1964), veröffentlicht am 18. August 1939. Diese Hymne verherrlicht brasilianische Landschaft, Kultur und Leute in überschwänglichen Versen zu einer nachgerade operntauglichen Melodie. 1942 entdeckt Walt Disney sie für seinen Zeichentrickfilm »Saludos Amigos« und macht das Stück damit
zum ersten brasilianischen Hit in den USA. Unter dem neuen Namen »Brazil« ist sein Siegeszug um die ganze Welt dann Legende, mit Versionen etwa von Django Reinhardt, Frank Sinatra, Santana, Harry Belafonte und Dionne Warwick.

SANFTE REVOLUTION MIT KÜSSCHEN UND FISCHLEIN
Können zwei Minuten Musik (präzise: eine Minute und 58 Sekunden) die Welt verändern? Am 10. Juli 1958 betritt ein Mann mit seiner Gitarre die OdeonStudios in Rio de Janeiro. Seine Stimme ist eine Mischung aus näselndem Fagott und flüsterndem Flügelhorn, sein Zupfen ökonomische Eleganz. Brasilien hat lange Jahre

der Schwülstigkeit erlebt, der pathetische Samba Exaltação beherrschte die Radios. Doch die Jugend sucht jetzt nach leichtfüßigeren, spielerischeren Klängen, und ein junger Bohemien aus Bahia namens João Gilberto (1931–2019) hat das Rezept. Er überträgt die vielen Perkussionsmuster des Samba in raffinierter, sanfter Rhythmik auf seine sechs Saiten. Präzisiert hat er diesen Sound in monatelanger Kleinarbeit auf der Toilette – wegen der schönen HallAkustik dort.
Die Texte für seine Miniaturen liefert ihm der Poet Vinicius de Moraes (1913–1980), die Arrangements der Pianist und Komponist Antônio Carlos »Tom« Jobim (1927–1994). Alle drei zusammen entwickeln das, was sich allmählich unter dem Namen Bossa Nova (»neue Flause«) herauskristallisiert. Das kurze, knackige »Chega de Saudade« (»Schluss mit der Traurigkeit«) ist die Blaupause dafür. Einzigartig sind die Wortspielchen im Text: Da reimen sich »peixinhos« auf »beijinhos«, denn sie soll so viele »Küsschen« bekommen, wie »Fischlein« im Meer schwimmen. Als das Lied im Dezember 1958 erscheint, will plötzlich jeder so Gitarre spielen wie João Gilberto. Für sechs intensive Jahre blüht die Bossa Nova in Brasilien – bis die Militärdiktatur dem unbekümmerten Lebensgefühl 1964 ein Ende setzt. Doch da ist sie längst schon Weltsprache geworden.

Militärputsch 1964
Im März 1964 endet die unbeschwerte
Es folgen 21 finstere Jahre der Militärdiktatur.
Als am Morgen des 1. April 1964 der Gitarrist Roberto Menescal mit einer jungen Sängerin in Rio de Janeiro zum Aufnahmestudio fährt, ist das Gebäude leer. Langsam sickert zu den Musikern durch, was am Vorabend passiert ist: Rio durch einen Putsch der Generäle lahmgelegt, Panzer auf den Straßen – der Auftakt zu einer 21jährigen finsteren Militärdiktatur. Der 31. März markiert somit auch das Ende der unbeschwerten BossaNovaÄra. Schlechtes Timing für die 19jährige Wanda Sá, die gerade am Beginn ihrer Karriere steht und mit ihrem Debütalbum »Vagamente« nun unfreiwillig einen letzten Abschiedsgruß an die BossaÄra sendet.
Menescal und Sá machen aus der Not eine Tugend: Sie nehmen das vorgesehene Stück einfach mit den wenigen Musikern auf, die zum Studio durchgekommen sind, ohne großes Streichorchester, in denkbar intimer Atmosphäre. Und so entsteht eines der schönsten Stücke der späten Bossa, eine grandiose, intensive Zwiesprache zwischen der versonnenen EGitarre und dieser schmachtenden Stimme: »Inútil Paisagem«. Die Melodie ist schmerzlichchromatisch, macht viele unerwartete Wendungen. Tom Jobim greift hier bewundernd auf Impressionisten wie Debussy zurück. Und der Text von Aloysio de Oliveira ist eine Sternstunde der tropischen Romantik.

PROMINENZ HINTER GITTERN
Im Oktober 2023 stand er wieder einmal auf der Bühne der Elbphilharmonie, und mit seinen 81 Jahren zeigte Caetano Veloso noch die Spannkraft und den Charme eines 60Jährigen, wurde frenetisch gefeiert für seine immer noch geschmeidige, androgyne Stimme. 55 Jahre zuvor: der Beginn seiner Karriere in einer explosiven Zeit. Auf die Militärdiktatur reagieren er und seine Mitstreiter, allen voran GilbertoGil, mit dem Tropicalismo.
Das ist ein Amalgam aus Urwaldund Karnevalsklängen, Anleihen bei den Beatles und der Bossa Nova, lautmalerischer und bilderreicher, kritischer Poesie. Das Regime wittert zu viel Zündstoff in diesen seltsamen Soundcollagen, die auf den ersten Alben der beiden jungen Wilden zu finden sind, und in ihrem HippieLook ohnehin.
In der Morgendämmerung des 27. Dezember 1968 werden Veloso und Gil zu Hause verhaftet. Es folgen Monate grausamer Einzelhaft, schließlich schiebt man sie für drei Jahre ins Londoner Exil ab. Ungebrochen schwingen sie sich nach der Rückkehr zu höchster Schaffenskraft auf, haben seitdem brasilianische Popmusik federführend mitgeformt. Sie spielten stets meisterhaft auf der Klaviatur der Stile mit afrikanischen, indigenen, psychedelischen Elementen. Provozierten durch Auflösung des Rollenverständnisses. Und waren immer am Puls der Zeit – Veloso mit elaborierten, philosophischen Texten und seinem großartigen Teamwork mit dem Cellisten Jaques Morelenbaum; Gil seit den Achtzigern auch in der Politik als Grüner und Umweltbewegter, später gar als Kulturminister im Kabinett Lula (2003–2008).
Neben der Tropicália formiert sich in den 1960ern eine zweite künstlerische Bewegung als Antwort auf die zensierende, folternde und mordende Militärdiktatur. Auch sie arbeitet mit einem Patchwork an Stilen, ist aber eher mild als wild, lyrischer und versonnener. Ihre Heimat ist der Bundesstaat Minas Gerais mit seiner Hauptstadt Belo Horizonte. Der Sound dieses »Clube da Esquina« (Club an der Ecke) um den jungen Musiker Milton Nascimento und das Brüderpaar Lô und Márcio Borges ist einzigartig: BossaRhythmen und Progressive Rock à la Genesis werden gepaart mit Farben der klassischen, insbesondere barocken und sakralen Musik, Elementen der afrobrasilianischen Musik, Folklore der Viehhirten und einer starken Vorliebe für das spanische Erbe Lateinamerikas. Der Grundton ist empfindsam, spielerisch, fast kontemplativ. Visionär sind die Verse, die sich mit Metaphern der Traurigkeit und Freiheitssehnsucht gegen die Diktatur wehren.
Auf ihrem ersten Meilenstein, der am im März 1972 erscheint, spürt man förmlich in jedem Stück, wie die sensiblen Künstler dem Korsett eines

menschen und kunstverachtenden Regimes, der täglichen Absurdität spirituelle Leuchtkraft und Trost für die Seele entgegensetzen, und das liegt auch an der unvergleichlichen FalsettStimme von Milton Nascimento. Der Einfluss des Clube kann kaum überschätzt werden: Der psychedelische, meditative Ton von Minas Gerais spiegelt sich seitdem im Werk vieler Künstler wider, etwa in dem des Sängers und Komponisten Vinicius Cantuária, der vom Progressive Rock kommend eine feine introspektive Tonsprache zwischen cooler Bossa Nova und sanfter Elektronik modelliert hat.

Die ganz dunklen Jahre der Militärdiktatur sind überstanden, auch wenn sie sich noch bis Anfang 1985 halten wird. Freier lässt es sich nun über die Verbrechen und über die Verbannten texten. Ein SongwriterPaar, das man getrost als die Lennon/McCartney Brasiliens bezeichnen kann, schafft in diesem Klima eine Hymne für die Zeit der politischen Amnestie. Die Musik stammt von João Bosco, einem der großen Komponisten der 1970er. In vielen seiner Lieder hat er den Samba zu einer neuen lyrischen Popkunst erhoben. »Als Komponist arbeite ich sehr intuitiv und liebe es,
mit den Formen zu spielen«, sagt er. Inspiriert von Charlie Chaplins Tod und dem Thema der Hoffnung in dessen Filmen, schreibt Bosco einen solchen Samba. Das musikalische Thema ist hörbar an Chaplins »Smile« angelehnt, voller ebenso eleganter und raffinierter Harmonien. Sein dichtender Partner Aldir Blanc (1946–2020) setzt dazu bildgewaltige Verse, in denen berühmte Ermordete gewürdigt werden, Oppositionelle und Exilierte auftreten und ihre Rückkehr gefordert wird. »O Bêbado e a Equilibrista« (Der Säufer und der Seiltänzer) wird schnell zu einer Hymne auf den Kundgebungen, rührt sogar die Polizisten. In der berühmten Interpretation der grandiosen Sängerin Elis Regina (1945–1982) auf der am 15. Juni 1979 lancierten Platte »Essa Mulher« findet der politische Hintergrund des Stücks eine perfekte Balance mit der puren Schönheit brasilianischen Melodieflusses.
Star Gilberto Gil ist neben der Samba und Chorogruppe Época de Ouro zu finden, Laurie Anderson hat einen Auftritt, am Produktionspult sitzt der New Yorker Avantgardekünstler Arto Lindsay. Monte covert sogar Velvet Underground. Außerdem arbeitet sie in etlichen Songs mit dem Bahianer Carlinhos Brown, der den Klang des Nordostens, die dortigen Trommeln und musikalischen Bögen beisteuert, und der im Jahr darauf wiederum seinen eigenen Meilenstein »Alfagamabetizado« veröffentlicht. Denn die Neunziger sind auch das Jahrzehnt der afrobrasilianischen Musik: Durch Kooperationen von Paul Simon und Michael Jackson mit der Trommelgruppe Olodum aus Salvador wächst die weltweite Aufmerksamkeit für die afrobrasilianischen Roots. Der Titel von Montes Album bezieht sich übrigens auf das Spektrum an Hautfarben der brasilianischen Einwohner, die alle zu dieser einzigartigen Mischkultur beitragen.
Ist Rio de Janeiro wirklich Brasiliens Musikhauptstadt? Sicher, hier entstanden Choro, der Samba in moderner Form und die Bossa Nova. Dochgenauso gut könnte man eben Salvador da Bahia mit seinem afrobrasilianischen Kosmos zur KlangkulturKapitale küren – oder die Megapolis São Paulo. Hier, in Brasiliens mit Abstand größter Stadt, existieren unzählige Facetten nebeneinander, von SambaSoul bis zum Forró, der Tanzmusik der aus dem Nordosten Eingewanderten. Zu Beginn des Jahrtausends entwickelt sich hier außerdem eine psychedelisch gefärbte IndierockSzene, die mit Namen wie Céu weltweit Furore macht.
Die Neunziger sind die Dekade, in der die Música Popular Brasileira (MPB) in der internationalen Weltmusik und PopSzene kräftig mitmischt. Ein Album setzt dabei Maßstäbe: »CordeRosa e Carvão« ist das dritte Werk der Sängerin Marisa Monte, die aus der Umgebung der Sambaschule Portela kommt und ihre Wurzeln mit Soul und ExperimentalPop auflädt. »Bob Marley, Michael Jackson und Stevie Wonder sind in meinem Inneren in Frieden mit dem Samba«, sagt sie. Ihr Album beherbergt ein grandioses Spektrum an Stilen und Gästen: Der brasilianische


Die alma lírica aber, die lyrische Seele São Paulos, findet man in der Musik einer Frau mit unverwechselbarer Altstimme, die ebenfalls seit ihrem fulminanten Werk »Voadeira«, aufgenommen im August 1999, eine Ausnahmestellung hat: Mônica Salmaso. Sie filtert die Essenzen nahezu sämtlicher Stile des Tropenlandes heraus, macht sich Samba und Choro, die Lieder Bahias und die Rhythmen des Hinterlandes zu eigen, fängt selbst Amazonisches ein. Sie interpretiert die großen Klassiker der MPB wie Milton Nascimento oder Chico Buarque, brilliert im intimen Duo mit Gitarre oder mit großem sinfonischen Orchester. Stets ausgeklügelt und reich instrumentiert sind die Arrangements ihrer Lieder mit den Saxofonen und Flöten ihres Ehemannes Teco Cardoso, mit Klarinetten, Klavier, Akkordeon. Mônica Salmaso hat die brasilianische Musik hin zum Jazz und zur Klassik entgrenzt.
Eine Tugend, die sie mit dem eine Generation älteren Gitarristen, Pianisten und Komponisten Egberto Gismonti teilt, der über Jahrzehnte in beiden Amerikas und in Europa eine spannende, hochvirtuose Tonsprache zwischen FolkFärbungen der verschiedenen Regionen, Improvisation und Kammermusik schuf, auch auf dem deutschen Label ECM.

ten in den 2010ern wieder weg, gipfelnd in der Wahl des Rechtspopulisten Jair Bolsonaro 2018. Doch schon fünf Jahre zuvor, beginnend mit den Straßenprotesten vom 17. Juni 2013, äußert sich der Unmut über Korruption, nicht eingelöste Reformversprechen, die überteuerte FußballWM und die Zwangsumsiedlung für die Olympischen Spiele. Der Aufruhr im Volk spiegelt sich in der Musik wider, und der HipHop ist auch in Brasilien dafür das Sprachrohr.
BRAZILIAN LEGENDS
MARISA MONTE
Di, 22.10.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
Marisa Monte (Gesang), Davie Moraes (Gitarre), Dadi Carvalho (Bass), Pretinho da Serrinha (Perkussion), Pupillo (Schlagzeug) »Os maiores secessos«
BOSCO & MORELENBAUM
Mi, 23.10.2024 | 20:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
DER SOUNDTRACK DER PROTESTE
Im 21. Jahrhundert hat Brasilien politische Extreme erlebt: Präsident Lula bringt bei der Armutsbekämpfung und im Umweltschutz ab 2003 Einiges auf einen guten Weg, doch bröckeln die Errungenschaf
Es ist aber keine blanke Wut, die der führende RapPoet Emicida auf seinem zweiten und dritten Album an den Tag legt, die zeitgleich mit den Protesten erscheinen. Emicida, aus ärmsten FavelaVerhältnissen in São Paulo stammend, ist geradezu ein Philosoph der Missstände. Mos Def und der WuTang Clan sind seine frühen Vorbilder, und wie seinerzeit die Tropikalisten verknüpft er Samba, afrikanische Töne, Funk und HipHop zu einer fiebrigen Collage, kämpft für die kleinen Leute und gegen Rassismus. Er zitiert die afrobrasilianischen Gottheiten im gleichen Atemzug mit Martin Luther King, baut eine halb mythische, halb politische Gegenwelt zur Sphäre der Weißen auf. Von einem friedlichen Miteinander ist die brasilianische Gesellschaft derzeit weit entfernt, Künstler wie Emicida sind der Stachel im Fleisch der Gleichgültigkeit. »Ein Alligator, der schläft, wird eine Geldbörse«, kommentiert er. Brasilien, das Land der Diversität und Unvereinbarkeit, bleibt weiter in Bewegung –und die Musik wird immer ihren Beitrag dazu leisten.
João Bosco (Gesang, Gitarre), Jaques Morelenbaum (Cello)
VINÍCIUS CANTUÁRIA
Fr, 25.10.2024 | 20:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
Vinícius Cantuária (Gesang, Gitarre), Paolo andriolo (Bass), Roberto Rossi (Schlagzeug) »Psychedelic Rio«
MÔNICA SALMASO
Sa, 26.10.2024 | 20:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
Mônica Salmaso (Gesang), teco Cardoso (Flöte, Klarinette, Saxofon), Nelson ayres (Klavier) »alma lírica Brasileira«
EGBERTO GISMONTI
So, 27.10.2024 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
Egberto Gismonti (Gitarre, Klavier)
BEGLEITPROGRAMM
Sa, 19.10.2024 | 12:30 Uhr
So, 20.10.2024 | 11 Uhr
Zeise Kinos
Mika Kaurismäki: »Moro no Brasil« (BRa, FiN, D 2002)
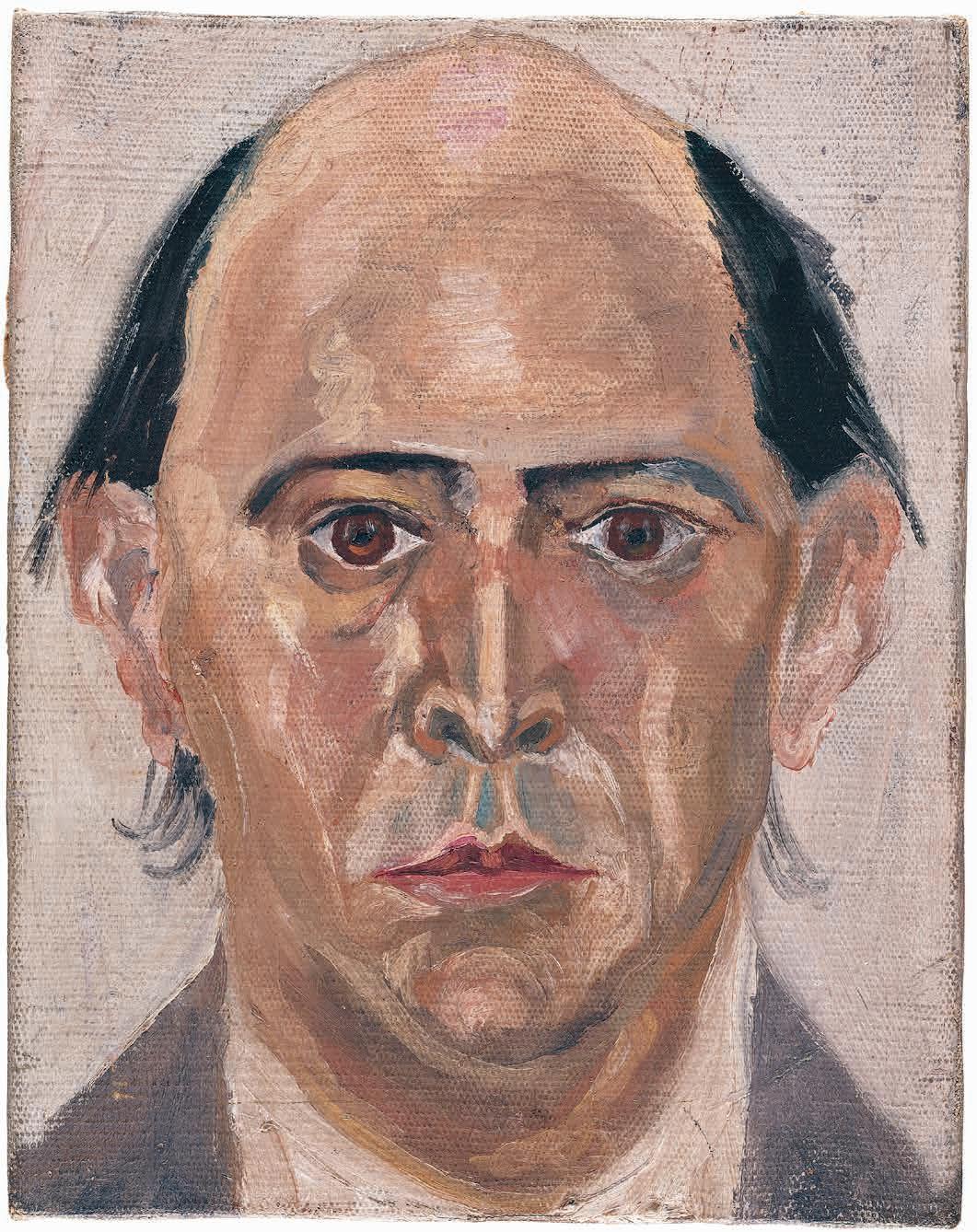
Vergessen Sie das Schlagwort »Zwölfton«! Arnold Schönberg war nicht nur ein musikgeschichtlicher Epochenmacher. Die Vielfalt seiner Persönlichkeit und seines Werkes ist schillernd und irritierend.
VON ALBRECHT SELGE
Daß der Raubmörder einen Lustmörder unbegreiflich findet, ist ebenso einzusehn, wie daß der Geschäftsreisende den Vergnügungsreisenden nicht verstehen kann.« Diese reißerische These ist einer von vierzehn Aphorismen Arnold Schönbergs, die 1911 in »Gutmanns KonzertTaschenbuch« erschienen. Schönbergs kreative Energie war ungemein vielseitig: Er schrieb viel, nicht nur Theoretisches wie die berühmte »Harmonielehre«, sondern gelegentlich auch derart Literarisches. Und als Maler schaffte er es sogar zwischen die erlesenen Almanachdeckel des »Blauen Reiter«; wobei das eine eigene Geschichte wäre, diese Sache mit Schönbergs Karriere in der bildenden Kunst und seiner Freundschaft mit Wassily Kandinsky, die später wegen dessen kolportiertem Antisemitismus zerbrach. Zu welcher Kategorie würde man nun, wenn man selbst mal fragen darf, den weltberühmten Musiker Arnold Schönberg zählen: zu den Raub oder den Lustmördern unter den Komponisten, zu den Geschäftsoder den Vergnügungsreisenden der Musikgeschichte?
Als Argument sowohl fürs eine als auch fürs andere könnte man die Antwort gelten lassen, die der ins k.u.k. Heer eingezogene Komponist 1917 auf die Frage eines Stellungskommissärs gab, ob er der Schönberg sei (welcher kürzlich, so darf man frei ergänzen, durch Einführung der Atonalität die schöne deutsche Musikgeschichte abge
murkst hatte): »Einer hat es sein müssen, keiner hat es sein wollen. Da habe ich mich halt hergegeben.« Schönbergs nicht ganz gerechtfertigter Ruf als großer Verkopfter der klassischen Musik würde eher auf den rational kalkulierenden Raubmörder setzen lassen. Andererseits spräche für den innerlich getriebenen Lustmörder, dass Schönberg immer wieder emphatisch das unbedingte Müssen seines Tuns betonte. Nicht nur in jener Antwort an den habsburgischen Offizier, sondern auch in seiner Umdeutung des geflügelten Wortes »Kunst kommt von Können«, 1910 in seinem Aufsatz »Probleme des Kunstunterrichts«: »Ich glaube: Kunst kommt nicht vom Können, sondern vom Müssen.« Darin wiederum steckt neben Müssen ein zweiter SchönbergSchlüsselbegriff: das Glauben Oder eben: der Glaube. Denn auch die religiöse, gottsucherische Dimension spielt immer eine Rolle bei ihm.
Im Übrigen mag die Frage nach der richtigen Kapitalverbrechenskategorie gar nicht so willkürlich schöngeistig sein, wie es zunächst scheinen könnte. Denn Schönbergs Leben war von mörderischen Ereignissen umgeben, von tatsächlichen, von literarisch fantasierten und von gegen die eigene Person gerichteten. Ein erschütterndes biografisches Erlebnis war 1907 der Suizid des jungen Malers Richard Gerstl, des Liebhabers von Schönbergs erster ›
Frau Mathilde, die soeben von Schönbergs Schüler Anton Webern überredet worden war, zu ihrem angetrauten Gatten zurückzukehren. Gerstl, mit dem Schönberg zu Beginn ihrer Bekanntschaft geistig eng verbunden gewesen war, erhängte sich in seinem Atelier. Dass dann Schönbergs eigene zwischenzeitliche MalerKarriere ausgerechnet in den Jahren nach der GerstlTragödie richtig Fahrt aufnahm, hat vielleicht nicht nur einen überraschend praktischen Grund, den Wilhelm Sinkovicz in seiner gut lesbaren Biografie »Mehr als zwölf Töne« (Zsolnay, 1998) aufzeigt: nämlich dass Schönberg sich durch die erstaunlich hohen Verkaufspreise seiner Porträts eine Lösung akuter Finanzprobleme erhoffte. Vielmehr schreit doch eigentlich der mehrjährige MalerSchwenk nach der Selbstauslöschung des sexuellen Rivalen, die Schönberg heftig mitnahm, nach tiefgründigen Seelenspekulationen im Geiste des Wiener SchönbergZeitgenossen Sigmund Freud … »Schönberg est mort«, sollte dann im Jahr 1951 ein junger Komponist von bemerkenswerter krimineller Energie schreiben, der später auch noch die Opernhäuser in die Luft sprengen wollte. Die Behauptung von Pierre Boulez, dass Schönberg tot sei, war rein faktisch fraglos richtig, denn der Komponist war im Sommer 1951 mit 76 Jahren gestorben. Und zwar an einem Freitag, dem Dreizehnten, was für einen Menschen, der durchaus abergläubisch, gegen Ende seines Lebens angeblich auch paranoid war und jedenfalls sich vor der Zahl 13 fürchtete, selbst dann tragikomischbizarr wäre, wenn dieser Mensch nicht auch noch als »Erfinder der 12TonMusik« weltweit berühmtberüchtigt gewesen wäre.
Aber dass bei Schönberg eben alles komplizierter ist und jede Pointe nochmal um die Ecke geht, zeigt sich auch darin, dass er im Jahr 1874 ebenfalls an einem Dreizehnten geboren worden war, in dem Fall einem Sonntag. Und ein bemerkenswerter Knick ums Eck ist ebenso die ver rufene ZwölftonMethode selbst, also die systematische Reglementierung des zuvor ein paar aufregende Jahre lang anarchistisch freien »atonalen« Komponierens. Denn diese Methode war eher eine kreativwillkürliche Setzung, ja Schöpfung von Schönberg als eine irgendwie historisch zwingende »Entdeckung«.
Boulez ging es beim Verfassen seiner Sterbeurkunde natürlich nicht um physiologische Fakten, sondern darum, den als Übervater der »modernen Musik« geltenden Schönberg abzuservieren. Und zwar aufgrund dessen diverser Rückständigkeiten, etwa dem konservativ scheinenden Beharren auf Inspiration oder Ausdruckswillen, einer bis in Schönbergs Spätwerk spürbaren romantischen Expressivität. Eine Eigenschaft, die heute den meisten Konzertbesuchern nicht unbedingt als Mangel, sondern eher als Vorzug erscheinen wird.
Bei Schönberg ist eben alles komplizierter, jede Pointe geht nochmal um die Ecke.


BÜRGERSCHRECK UND LANGWEILER
Immerhin zeigt das notorische BoulezZitat, dass Arnold Schönberg bei seinem Tod bereits ein Klassiker war, vielleicht sogar (wir denken ans NietzscheZitat!) ein Gott. Nur dann lohnen ja Sockelstürze und Blasphemien. Darüber hinaus verweist die ganze Angelegenheit darauf, dass Schönberg schon früher ein doppeldeutiges Bild abgab. Daran hat sich nichts geändert.
Einerseits ist sein Name gerade für Menschen, die nur sporadisch mit klassischer Musik in Kontakt stehen, der Inbegriff des musikalischen Bürgerschrecks. Lang ist die vom Hörensagen bekannte Liste der seinerzeitigen Skandale. Bereits 1902 kam es bei der Uraufführung des Streichsextetts »Verklärte Nacht« (das uns heute als »noch traditionell schön klingender früher Schönberg« erscheint) zu Unmutsbekundungen von Teilen des Publikums. Und als 1907 das 1. Streichquartett dMoll uraufgeführt wurde (also ebenfalls ein Werk, das bei aller harmonischen Raffinesse noch einen Grundton hatte), notierte der SchönbergSchüler Paul Stefan: »Das Werk schien vielen unmöglich, und sie verließen während des Spiels den Saal; ein besonders witziger sogar durch den Notausgang. Als auch nachher noch vernehmlich gezischt wurde, ging Gustav Mahler, der unter dieser Zuhörerschaft saß, auf einen der Unzufriedenen los und sagte in seiner wunderbar tätigen Ergriffenheit und gleichsam für die entrechtete Kunst aufflammend: ›Sie haben nicht zu zischen!‹ – Der unbekannte, stolz vor Königen des Geistes (vor seinem Hausmeister wäre er zusammengebrochen): ›Ich zische auch bei Ihren Sinfonien!‹«
Zu diesen fast Folklore gewordenen Skandalerzählungen wäre Differenzierendes anzumerken: etwa dass laut einem Rezensenten bei einem weiteren Skandalkonzert 1908 der Großteil des Publikums sich neutral verhalten habe und sich lediglich kleine Gruppen von SchönbergAnhängern und SchönbergGegnern gegenseitig hochgeschaukelt hätten. Die nicht genug zu lobende Konzertgängertugend des EssicheinfachmalAnhörens könnte also schon im Zeitalter der Krawalle verbreiteter gewesen sein, als es heute den Anschein hat.
Wenn heutzutage mehr SchönbergMusik denn je auf den Konzertprogrammen steht, dann liegt dieser alte Witz nahe: »Gott ist tot.« (Nietzsche) – »Nietzsche ist tot.« (Gott) Schönberg hätte es natürlich eleganter oder zumindest umständlicher formuliert als lediglich ein läppisches »Boulez ist tot«. Denn er schrieb ja über sein eigenes Dasein als »Vorläufer« bereits 1923, also zwei Jahre, bevor Boulez überhaupt geboren wurde: »Aber ich bin ohnedies nicht sehr besorgt: meine Nachläufer werden mich bald nicht mehr einholen, da ihnen mein Atem ausgehen wird.« ›
Was den größten Wiener Konzertskandal angeht, das sogenannte Watschenkonzert am 31. März 1913 im Goldenen Saal des Musikvereins, so war es nicht Arnold Schönbergs Kammersinfonie Opus 9, die den Krakeel auslöste (sie hatte ihren eigenen Aufruhr bereits bei ihrer Uraufführung sechs Jahre zuvor gehabt). Vielmehr standen hier, neben Musik von Zemlinsky und Mahler, auch Werke der treuen SchönbergSchüler Anton Webern und Alban Berg auf dem Programm. Während Weberns eröffnende »Sechs Stücke für Orchester« anscheinend noch durchgingen, ließen zwei der »Fünf Orchesterlieder nach Ansichtskartentexten von Peter Altenberg« von
Alban Berg einigen Hörern die Sicherungen durchbrennen. Auslöser war offensichtlich die irritierende Kontrastwirkung, dass der riesige Orchesterapparat nicht etwa die erwarteten Riesenklänge hervorbrachte; Musik also in der Überwältigungsart von Schönbergs »GurreLiedern«, die der Komponist zwar schon kurz nach 1900 entworfen hatte, die aber aufgrund ihrer gewaltigen logistischen Ansprüche erst einige Wochen vor dem »Watschenkonzert« uraufgeführt worden waren. Und zwar mit ganz schönberguntypischem Riesenerfolg!
Die Komposition von Berg hingegen entlockte, im Geist seines Lehrers Schönberg und von diesem dirigiert, dem Riesenorchester zu den verknappten AltenbergSätzen radikal feinstziselierte Klänge in freier (A)Tonalität. Das muss für Teile des überrumpelten Publikums wie ein dreist provozierendes »Hurz!«Erlebnis gewesen sein. Kaum mehr vorstellbar angesichts der betörenden, farbenreichen Schönheit von Bergs Orchesterliedern, die das heutige Ohr (hoffentlich!) wahrnimmt und genießt.
Kaum begreiflich auch, dass ein anderer Avantgardist der 1950erJahre, Olivier Messiaen, aus seiner synästhetischen Klangwahrnehmung die Musik Arnold Schönbergs als »grau« klassifizierte. Und ebenso wenig vorstellbar, dass die Persönlichkeit jenes Mannes im Zentrum so heftiger ästhetischer Stürme dem Zeitgenossen Arthur Schnitzler schlicht langweilig vorkam. Er notierte im November 1913, also dem Herbst des Gurre und Watschenjahres: »Nicht übermäßig gescheidt, aber ein Blender; irgendwie nixenhaft, (wie Olga richtig findet) – seelenlos –«
Aber vielleicht ist selbst das private Langweilertum eine der erstaunlichen Facetten an diesem Umstürzler, der als Mensch von bemerkenswerter Vielseitigkeit war: versierter Tennisspieler, HobbyBastler und Tüftler (der etwa ein Schachspiel für vier Spieler entwickelte), auch humorvoller Geschichtenerzähler für seine Kinder (nach deren Lieblingsgeschichte, »Die Prinzessin«, entstand übrigens 2006 ein hübsches Bilderbuch von Peter Schössow; die zugrunde liegende originale Tonaufnahme des Erzählers Schönberg ist auf der Webseite des Wiener Schönberg Centers, www.schoenberg.at, und auch auf YouTube leicht zu finden).
ANKERPUNKTE UND SCHAFFENSPHASEN
Einige biografische Ankerpunkte: Geboren 1874 in der Wiener Leopoldstadt in eine jüdische Familie, die musikliebend war, aber keineswegs Musikerdynastie (der Vater Schuhmacher, die Mutter immerhin von jüdischen Kantoren abstammend). Dass Arnold Schönbergs musikalische Ausbildung eher erratisch verlief und er auf keinem Instrument ein Meister war wie der etwa gleichaltrige Max Reger als Organist oder der wenige Jahre jüngere George Enescu als Violinvirtuose, mag mitverantwortlich dafür sein, dass sein Zugang zur Musik in erster Linie kompositorisch war, nicht »musikantisch«.
Als Mensch war dieser Umstürzler von bemerkenswerter Vielseitigkeit: versierter Tennisspieler,
Tüftler, humorvoller Erzähler.
Als unbestrittener Lehrer, der sich gar wagnerhaft als »Meister« ansprechen ließ, führte er die sogenannte »Wiener Schule« (manchmal auch als »Zweite« nummeriert, als hätten bereits Haydn, Mozart und Beethoven eine »Schule« gebildet). Obwohl deren Zusammenhalt durchaus sektenhafte Züge trug, inklusive des strikten FreundFeindDenkens, brachte sie charismatische Künstlerpersönlichkeiten wie eben Webern und Berg hervor; in späteren Jahren durchlief auch die Karriere von Hanns Eisler den SchönbergZirkel, und ebenso die von Viktor Ullmann, der später in Auschwitz ermordet wurde. Und dieses Schicksal von Ullmann lässt einem dann auch alle KapitalverbrechensWitzeleien vom Beginn des Essays im Halse steckenbleiben, genau wie das Leid so vieler anderer NaziOpfer in Schönbergs Umfeld, etwa seines jüngeren Bruders Heinrich, eines Operettensängers, den die Gestapo 1941 zu Tode quälte.
Schönbergs Verhältnis zum Judentum ist ein Stoff, der Bücher füllen kann. Nachdem er sich als junger Mann, noch vor der Jahrhundertwende hatte taufen lassen, brachten ihn antisemitische Erfahrungen bereits 1921 dazu, sich ausdrücklich zu seiner jüdischen Herkunft zu bekennen. Auf Kandinskys Wiederannäherungsversuch reagierte er wegen dessen Judenfeindlichkeit kompromisslos abweisend, prophezeite auch eine »neue Bartholomäusnacht«, die aus der Glut des Judenhasses entstehen würde. Und als er 1933 Deutschland verließ, rekonvertierte er in einem bewussten Akt zurück zum Judentum: »Ich bin seit langem entschlossen, Jude zu sein«, schrieb er an Anton Webern. Und half von Amerika aus, wohin er 1934 hatte emigrieren können, mit großem Einsatz zahlreichen Juden bei der Flucht aus NaziDeutschland und Europa. Der grassierende Judenhass war ein besonders scheußliches Ingrediens, das eben auch zum seligen Wienum1900Klischee gehört. Diese FindesiècleWelt ist natürlich die Sphäre, in der sich der musikalische Umwerfer Schönberg »ereignete«. Immer wieder sind naheliegende Parallelen des großen MusikReinigers Schönberg zu umliegenden Phänomenen gezogen worden, etwa zum »Ornament ist Verbrechen«Architekten Adolf Loos oder dem Sprachdenker Karl Kraus, für den die daher geplapperte Phrase eine Straf und Gräueltat war. Oder eben zu Wassily Kandinsky, der auf absoluter Weißheit Farben und Formen quasi vollkommen neu entstehen ließ.

Der Musikwissenschaftler Hermann Danuser hat zu derlei Parallelen allerdings gestreng darauf hingewiesen, dass schon Schönberg selbst »einen KunstMythos der Wiener Moderne nährte, der als Motor seines Schöpferwillens zu respektieren ist, von einer um Distanz bemühten Historiografie aber nicht einfach übernommen werden darf«. In unserem nichtwissenschaftlichen Zusammenhang hier reicht es wohl aus, darauf hinzuweisen, dass es sich bei den genannten Verwandtschaften um ganz freie Assoziationen zu doch sehr unterschiedlichen Dingen handelt. Dem freien Hörer jedoch, der zu keiner Wissenschaftlichkeit verpflichtet ist, kann es durchaus auf die Sprünge helfen. Das Lebenswerk Schönbergs sei hier schließlich, nochmals nach Professor Danuser, in vier orientierende Etappen unterteilt: die »erweiterttonalmoderne Phase bis etwa 1908«, zu der man das Sextett »Verklärte Nacht«, das 1. Streichquartett und den Koloss der »GurreLieder« zählen kann; die »freiatonalexpressionistische Phase bis Anfang der 1920erJahre«, in der ein betörend farbenreiches Werk wie die »Fünf Orchesterstücke« entstand, aber auch das ambitionierte Oratorium »Die Jakobsleiter«, um dessen Gestaltung Schönberg tatsächlich ein Leben lang
Arnold Schönberg: »Blick« (Öl auf Pappe, um 1910)
rang wie Jakob mit dem Engel (und das vielleicht, da wir außerhalb der biblischen Welt eben keinen Gottesboten niederringen können, Fragment bleiben musste); die »zwölftönigklassizistische Phase bis Anfang der 1930erJahre«, in der Schönberg einigermaßen strikt nach der von ihm »erfundenen« Methode komponierte und die sich, entgegen der ZwölftonDominanz im Schönbergklischee, im Konzertleben eher wenig widerspiegelt; die »zwölftönig wie neotonalengagierte Phase« zuletzt, die vielleicht die ergiebigste SchönbergFundgrube für heutige Hörer ist. Denn obwohl der Komponist hier seiner erfundenen Methode treu blieb, begriff er sie frei und ausdrucksfreudig und auch gelassen gegenüber tonalen Zufällen. Wie viel von dieser Relaxtheit auf das USamerikanische Umfeld zurückgeht, in dem Schönberg sich seit 1934 befand (und wo er sich, nebenbei, mit einem Künstler wie George Gershwin anfreundete), und wie viel auf sein eigenes künstlerisches Temperament, das eben weit mehr als bloß »fortschrittlich« war: egal. Auf jeden Fall gilt für das Violinkonzert von 1936 ebenso wie für das Klavierkonzert von 1942 das, was Schönberg nachdrücklich für all seine Kunst seit den 1920ern in Anspruch nahm – dass sie nämlich keine ZwölftonKompositionen seien, sondern ›
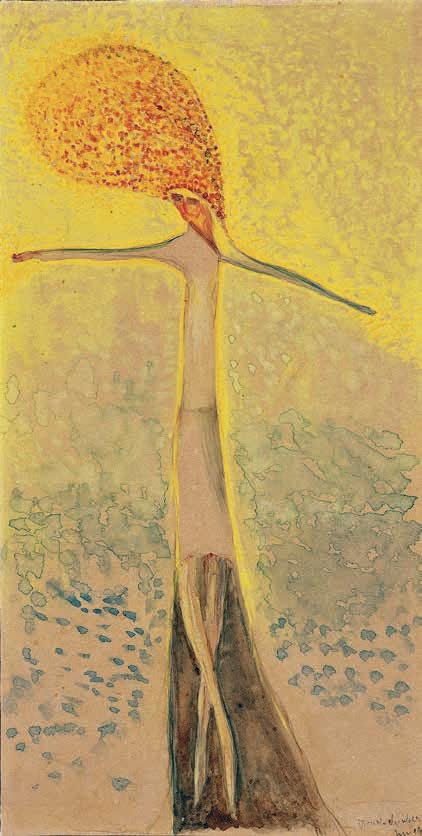
FÜNF ORCHESTERSTÜCKE
Mi, 28.8.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
Gustav Mahler Jugendorchester ingo Metzmacher (leitung)
arnold Schönberg: Fünf Orchesterstücke op. 16 sowie Werke von Beethoven und Schostakowitsch
GURRE-LIEDER
Mi, 11. und Fr, 13.9.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
NDR Elbphilharmonie Orchester und Vokalensemble
Stuart Skelton, Christina Nilsson, Jamie Barton, Michael Nagy, Michael Schade, thomas Quasthoff
alan Gilbert (leitung)
arnold Schönberg: Gurre-lieder für Soli, Chor und Orchester
KLAVIERKONZERT
Do, 26. und Fr, 27.9.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
NDR Elbphilharmonie Orchester
Pierre-laurent aimard (Klavier)
David Robertson (leitung)
arnold Schönberg: Klavierkonzert op. 42
sowie Werke von Debussy, Mahler und Gershwin
VIOLINKONZERT
Sa, 28.9.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen
Patricia Kopatchinskaja (Violine), Bettina Wild (Flöte)
Pekka Kuusisto (leitung)
arnold Schönberg: Violinkonzert op. 36 sowie Werke von Barber, Varèse und Prokofjew
ZwölftonKompositionen. Die Methode, das Hilfsmittel steht niemals über dem Zweck, der inspirierten Schöpfung eines Kunstwerks.
Die Umständlichkeit der PhasenBenennungen weist allein schon auf die Vielfalt, Komplexität, Widersprüchlichkeit der subsumierten lebendigen Werke hin. Bemerkenswert bleibt bei all dem eines: So omnipräsent der Name Arnold Schönberg als Inbegriff der musikalischen Moderne für Otto und Frieda Normalhörer ist, so wenig konkret haben viele doch seine Musik im Ohr. Das ist ein bezeichnender Unterschied nicht nur zum »Sacre du printemps« von Igor Strawinsky, der oft und durchaus zweifelhaft zu Schönbergs Antipoden stilisiert wurde, sondern auch zur Präsenz seiner wichtigsten Schüler in unserer Klangvorstellung. Bei Berg denken wir an den Knaller »Wozzeck« und das ergreifende Violinkonzert, bei Webern haben wir immerhin oberhalb aller konkreten Werkebene eine fixe Vorstellung seiner Miniaturen: dreimal pling, einmal fieps, vorbei, so ungefähr.
Aber wie ist es bei Schönberg, dem Legendären? Da kann nun eines dieser bisweilen leidigen Jubiläen Gutes bewirken: indem wir endlich die Musik des Mannes kennenlernen, den jeder kennt. Also, vergessen Sie Zwölfton, wenigstens die Betonung darauf, und hören Sie einfach zu.
M MEHR ZU ARNOLD SCHÖNBERG FINDEN SIE UNTER: WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK
Arnold Schönberg: »Christus-Vision« (Aquarell auf Papier, 1919)
VOLKSLIEDER UND SATIREN
So, 20.10.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
NDR Vokalensemble
Julius Drake (Klavier)
Klaas Stok (leitung)
»Schubertiade – Reise durch die Erste und Zweite Wiener Schule«. ausgewählte Werke von Schönberg und Schubert
DIE JAKOBSLEITER
Sa, 9.11.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
NDR Elbphilharmonie Orchester und Vokalensemble
Claire de Sévigné, avery amereau, toby Spence, Michael Nagy u. a. ingo Metzmacher (leitung)
arnold Schönberg: Die Jakobsleiter für Soli, Chor und Orchester sowie Bruckners Messer Nr. 1
STREICHQUARTETT
Mi, 27.11.2024 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal tetzlaff Quartett arnold Schönberg: Streichquartett Nr. 1 d-Moll op. 7 sowie Werke von Brahms und Widmann
VERKLÄRTE NACHT
So, 8.12.2024 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal ilya Gringolts (Violine) Franziska Hölscher (Violine) Gregor Sigl (Viola) lily Francis (Viola) Clemens Hagen (Cello) Julia Hagen (Cello) arnold Schönberg: Verklärte Nacht d-Moll op. 4 sowie Werke von Grädener und Brahms

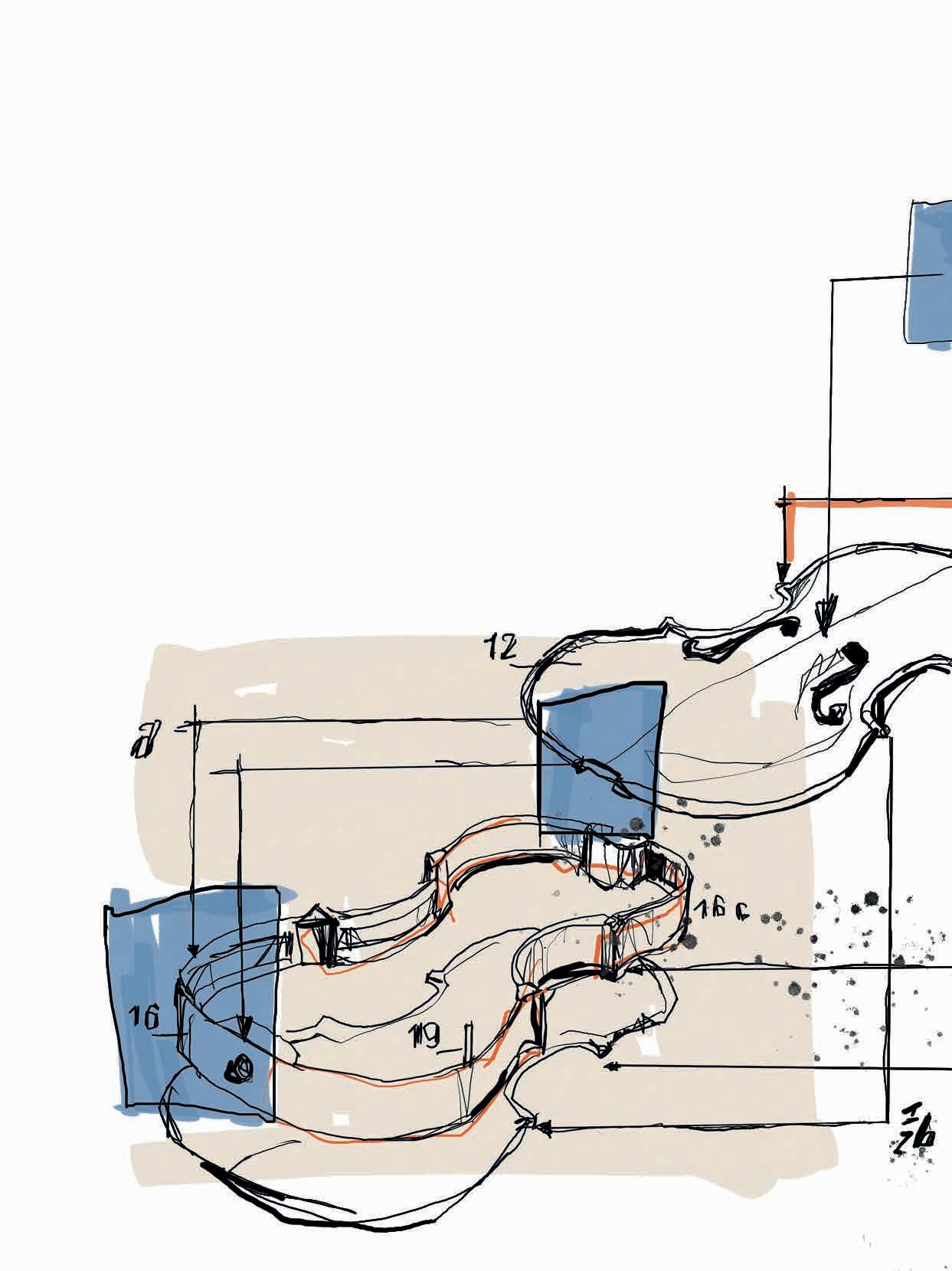
In den kleinen Besetzungen der Kammermusik haben Komponisten aller Zeiten besonders viel gewagt und gesagt.
VON VOLKER HAGEDORN ILLUSTRATIONEN ANSELM M. HIRSCHHÄUSER
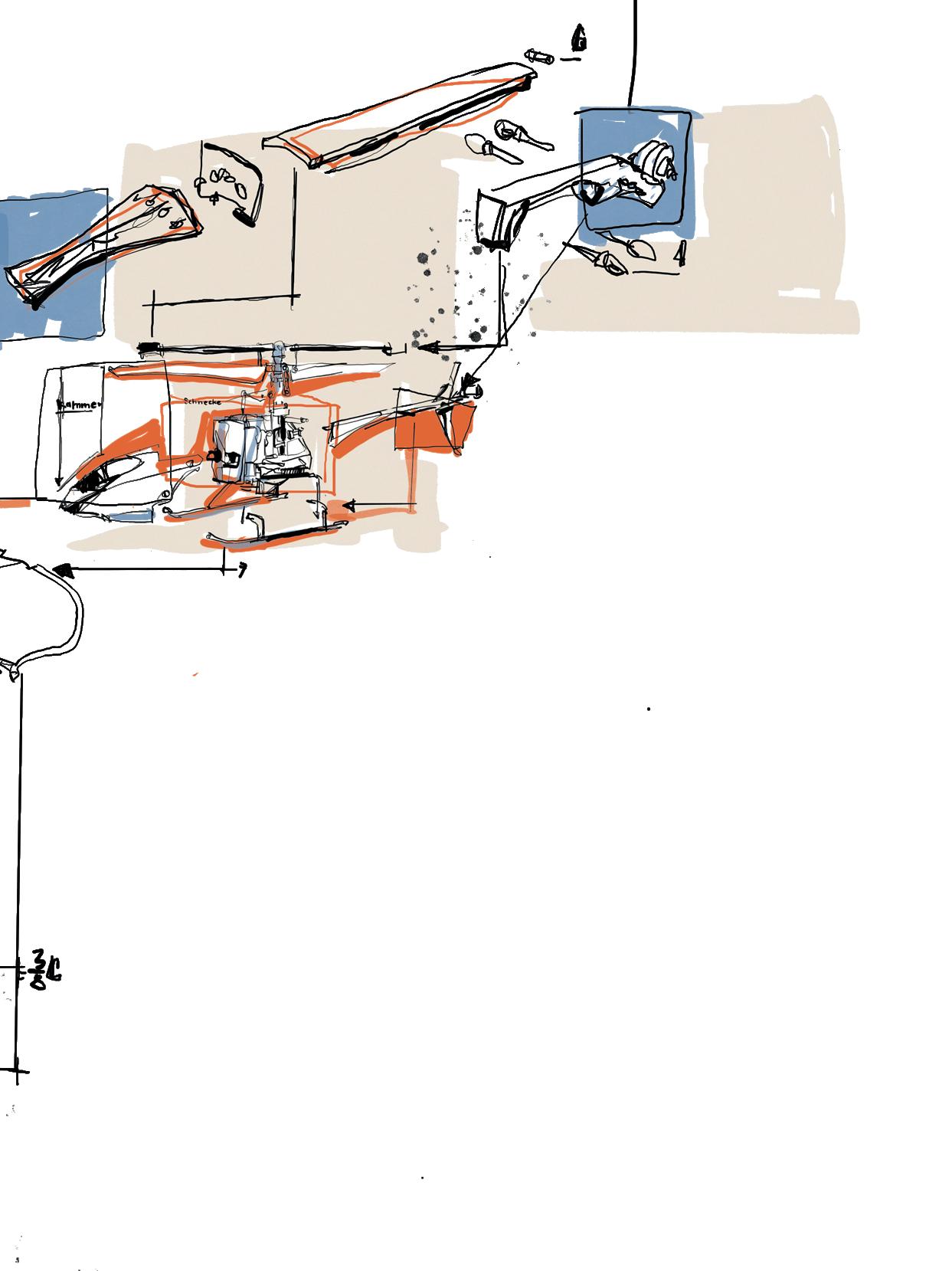
PIONIERTATEN AUF SECHZEHN SAITEN
Es ist ein schöner Sommernachmittag, 26. Juni 1995, als im Norden von Amsterdam vier weißrote Helikopter abheben, das Grasshoppers Show Team der niederländischen Luftwaffe, in jeder Maschine ein Pilot und ein Musiker, eine Kamera und diverse Mikros. Unten in der Westergasfabriek, einem ehemaligen Gasbehälter im Stil der Neorenaissance, sitzt der 66jährige Karlheinz Stockhausen mit der Hand am Regler und mischt ab, was das Publikum hier zu den Livebildern aus den Hubschraubern hört. Vertrackte Rhythmen und filigrane Gewebe spielen die Herren vom Arditti String Quartet da oben, jeder mit Headset versehen, und die Töne der auf die Zehntelsekunde genau notierten Partitur verbinden sich mit dem unberechenbaren Lärmen der Rotoren. Die gut 21 Minuten des »HelikopterQuartetts« –Stockhausen hatte die Idee dazu im Traum – werden zur Ikone der Avantgarde des späten 20. Jahrhunderts. Sie machen aus der Kammermusik ihr Gegenteil. Schon das ist eine Tat. Der Begriff »Kammermusik« wird regelrecht in die Luft gejagt. Er hat seine historischen Gründe, wirkt aber tatsächlich viel zu eng gegenüber all den Pioniertaten und Differenzierungen, die in flexiblen kleinen Besetzungen von jeher eher möglich waren als in institutionsabhängigen großen. Stockhausen will immer nur etwas komponieren, »was noch nie gespielt werden konnte«. Und doch bewegt er sich in mehreren Traditionslinien. Zum einen, indem er die Besetzung Streichquartett wählt, die olympische Disziplin der Kammermusik.
Zum andern ist gerade diese Besetzung seit ihrer Etablierung im 18. Jahrhundert für Komponisten das Mittel der Wahl, wenn es um die Spitze der Avantgarde geht. Die nannte sich im Wien der 1780er zwar nicht so, aber der 28jährige Wolfgang Amadeus Mozart wusste genau, dass er Grenzen durchbrach, als er 1785 sein neues CDurQuartett schrieb. Er ließ es mit einer AdagioEinführung beginnen, wie sie bis dahin Sinfonien vorbehalten war, und in diesen 22 Takten drängte er die Linien der vier Instrumente, mit Halbtonschritten und Vorhalten arbeitend, zu einer Harmonik zusammen, die sich bis heute dem unmittelbaren Begreifen entzieht. Legitimiert werden die extremen Dissonanzen vor allem durch die Polyphonie der vier Stimmen. Löst man aber einen Akkord heraus wie hgcisa, ist man schon bei Arnold Schönberg, noch einem Extremisten der Quartettkunst.
Mozarts Zeitgenossen sind überwiegend schockiert, manche Käufer senden die gedruckten Noten zurück, weil sie sie für fehlerhaft halten. Der Spitzname »Dissonanzenquartett« hält sich bis heute, und der Widmungsträger Joseph Haydn braucht sechs Jahre, ehe er wieder die Führung der Avantgarde an sich reißt und in seinem Opus 55 Nr. 6 ein DDurQuartett mit dem einsamen und irreführenden E einer Geige startet. Bei Ludwig van Beethoven wird es dann schwierig zu sagen, wo in seinen sechzehn Streichquartetten eigentlich kein Konventionsbruch, keine Versuchsanordnung, keine Kühnheit zu finden ist. Dem Opus 95 des 39Jährigen kann man noch heute so ratlos (wenn auch begeistert) lauschen, als versuche jemand, einem Laien die Quantenphysik zu erklären. Beethoven verbot öffentliche Aufführungen des Werks, weil er fürchtete, nicht verstanden zu werden. So geht es mit den Experimenten für vier Streicher immer weiter, nicht nur bis zum schon erwähnten Arnold Schönberg, der 1908 in seinem Opus 10 zum Quartett eine Sopranstimme treten lässt und die Bindungen der Tonalität weitgehend ignoriert (s. S. 10).
Natürlich ist auch beim Streichquartett der »Fortschritt« – wertfrei gesagt, die Veränderung der Mittel und Formen – nur ein Aspekt von vielen. Aber im Medium dieser Besetzung gewinnt jedes Statement, jedes Wagnis besondere Verbindlichkeit und Vergleichbarkeit. Nicht zufällig wird es auch zum Medium der Bewusstmachung. ›
Robert Crumb schreibt 1970 »Black Angels« als Reaktion auf den Vietnamkrieg. Einmal kippen die Musiker, elektronisch verstärkt, ihre Instrumente nach unten, Schnecken zwischen die Beine, Bogen auf dem Griffbrett, und zitieren Schuberts Quartett »Der Tod und das Mädchen«. Es klingt, als erinnerten sich halbverschrottete Gamben an die Zeit vor einer Katastrophe. 1988 kombiniert Steve Reich ein Streichquartett mit OTönen vom Band, um sich in »Different Trains« mit dem Holocaust auseinanderzusetzen.
Stockhausen ist als Erneuerer also nicht allein auf weiter Flur, als er die vier Helikopter abheben lässt. Was die Musiker oben über Amsterdam zusammenhält, sind nicht nur die Partitur und ihre Headsets. Es ist das Projekt Streichquartett, an dem die Komponisten seit Jahrhunderten arbeiten.
KLEINE BESETZUNGEN IN GRO � ER LITERATUR
»Und vollends dann das Trio für Geige, Viola und Violoncell, das, kaum spielbar, in der Tat nun von drei Virtuosen allenfalls technisch zu bezwingen, ebenso durch seinen konstruktiven Furor, die Hirnleistung, die es darstellt, wie durch die ungeahnten Klangmischungen in Erstaunen setzt, die ein das Unerhörte begehrendes Ohr, eine kombinatorische Phantasie sondergleichen den drei Instrumenten abgewonnen hat.«
Tja, was für ein Trio? Von wem? Mozarts berühmtes »Divertimento« von 1788 ist nicht gemeint. Es handelt sich um ein fiktives Werk, und es sei hier, zusammen mit einer fiktiven Violinsonate, stellvertretend für den Ozean realer Kammermusik präsentiert, die für die unterschiedlichsten Besetzungen geschrieben wurde. Und die natürlich einfloss in die klein besetzten Stücke, die zwei Große der Weltliteratur in ihren Romanen »komponiert« haben. Beide gehören zur selben Generation: Thomas
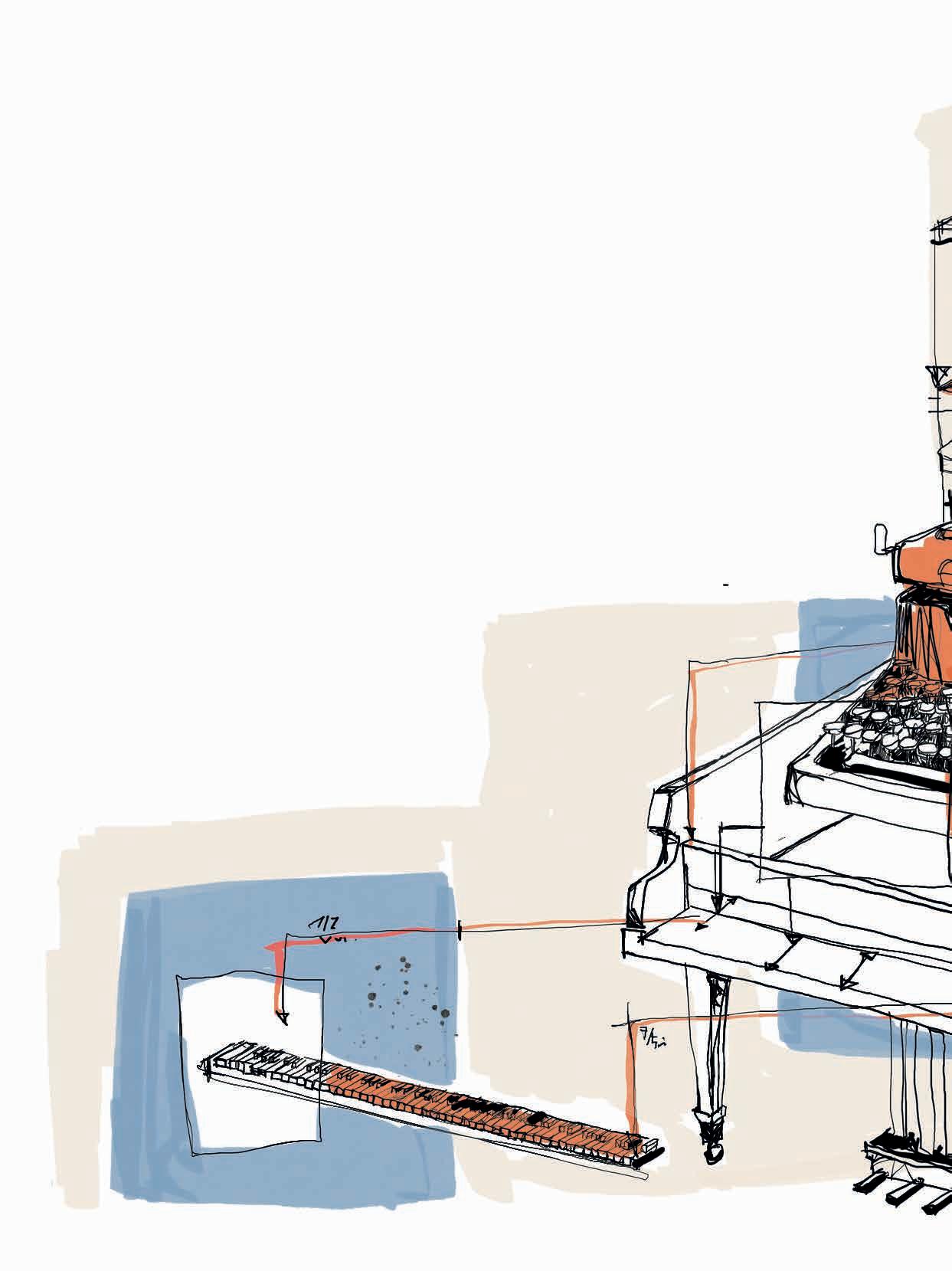
Mann, 1875 geboren, und Marcel Proust, Jahrgang 1871. Beide zählen, so diametral verschieden sie sind, zu den wenigen Romanautoren, denen Musik wirklich viel bedeutet. Und beide haben sich einen Komponisten ausgedacht.
Bei Mann ist es Adrian Leverkühn, Held des »Doktor Faustus«, der sein Streichtrio selbst »unmöglich, aber dankbar« findet und uns damit auf die Spur des Vorbilds bringt. Thomas Mann erinnert sich 1949 an den Spätsommer 1946 in Los Angeles und einen Besuch seines Nachbarn Arnold Schönberg, »bei dem er mir von seinem neuen, eben vollendeten Trio und den Lebenserfahrungen erzählte, die er in die Komposition hineingeheimnisst habe …« Schönberg, 71, Exilant wie Mann, hatte eine Herzattacke überlebt und danach das Stück geschrieben. »Übrigens sei die Aufführung äußerst schwierig, ja fast unmöglich, oder nur für drei Spieler von Virtuosenrang möglich, dabei aber sehr dankbar vermöge außerordentlicher Klangwirkungen.« Das genügte dem Schriftsteller, um seinem Helden für das Jahr 1927 rasch noch ein Trio unterzuschieben, das er nie gehört hat, aber sich – und uns – bestens vorstellen konnte.
Bei Marcel Proust ist es anders. Er beschreibt in der »Suche nach der verlorenen Zeit« eine Violinsonate, die Charles Swann in einem Pariser Salon um 1900 hört, ganz offenkundig nach einem eigenen Hörerlebnis, »… als er
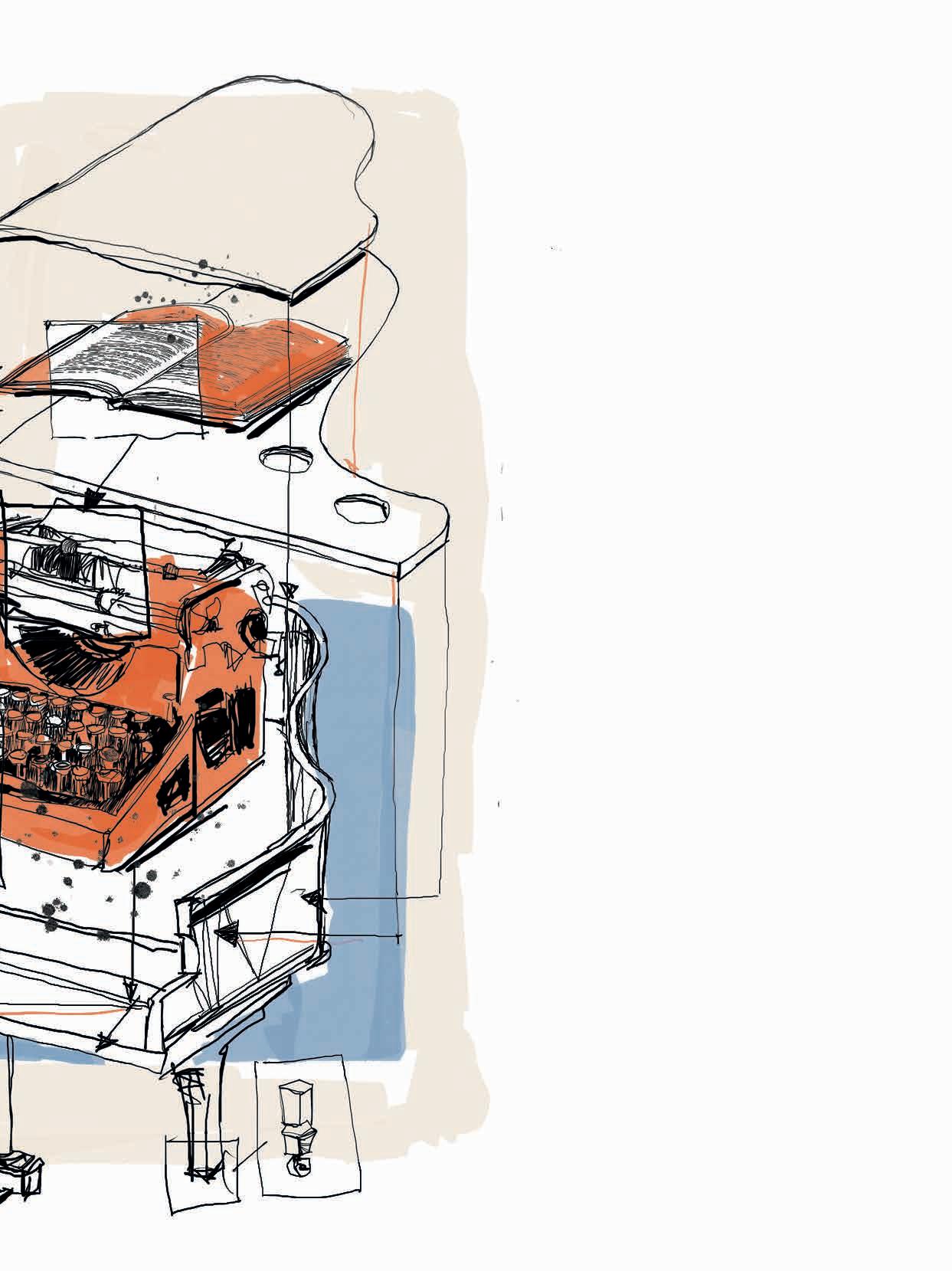
unter der zarten, widerständigen, dichten und führenden Linie der Geige plötzlich sah, wie der Klavierpart sich körperhaft zu erheben begann, mit einem flüssigen Plätschern, vielgestaltig, ungeteilt, ineinandergreifende Flächen wie die malvenfarbenen Wellenbewegungen, die der Mondschein bezaubert und besänftigt«. Dann kommt jener Moment, als eine unbestimmbare Wendung, eine Harmonie »ihm die Seele noch weiter öffnete, so wie gewisse Rosendüfte in der feuchten Abendluft uns dazu bringen können, die Nase zu weiten«.
Es ist, so stellt sich bald heraus, das Andante der Violinsonate eines gewissen Vinteuil, eines Komponisten, dessen Vorname nie genannt wird, bei mehr als 300 Erwähnungen im Riesenwerk. Die besondere Wendung in diesem Andante verbindet sich mit Swanns Liebe, mit seinen Erinnerungen, sie wird zur musikalischen Entsprechung jener Madeleine, des Gebäckstücks, dessen Geschmack den Erzähler zu Beginn in seine Kindheit führt. Rund um die »petite phrase« entfaltet sich im Laufe der »Recherche« ein ganzes Œuvre: Der rätselhafte Vinteuil hat auch ein Sextett, ein Septett, sogar eine Sinfonie geschrieben, natürlich auch – wie Leverkühn! – ein Streichquartett.
Doch nur die FisDurViolinsonate wird von Proust über Jahre hinweg immer weiter erschlossen – ein Hybrid aus Eindrücken von Franck, Fauré, auch Wagner, wie der Autor selbst sagt. Fast widerstrebend aber räumt er ein, dass er die früheste Keimzelle einem Komponisten verdankt, »den ich nicht liebe«: Es ist (ganz genau hat es 2021 der Musikwissenschaftler Oliver Huck ermittelt) das kinderliedhafte zweite Thema im ersten Satz der dMollViolinsonate von Camille SaintSaëns (1885), die Marcel Proust zuerst mit dem Geiger Jacques Thibaud hörte. Die fiktive Sonate ist dann die weitaus berühmtere geworden.
EIN KOMPONISTENLEBEN LANG
Trotz zehntausender Duos und Trios – keine Kammermusikform hat eine so ununterbrochene Präsenz bis zum Komponieren im 21. Jahrhundert erreicht wie das Streichquartett. Selbst neben der weitaus älteren Oper ist es in seiner Identität von »Werkgattung« und Besetzung das stabilste Musikformat, das es je gab. Was dazu führt, dass bei einigen Komponisten deren Streichquartette sogar eine eigene klingende Biografie bilden können. Wolfgang Rihm etwa hat, wenn man die frühesten Versuche mitzählt, in
Thomas Mann und Marcel Proust zählen zu den wenigen Autoren, denen Musik wirklich viel bedeutet. Und beide haben in ihren Romanen ein Stück Kammermusik »komponiert.« ›
einem halben Jahrhundert 23 Werke für diese Besetzung geschrieben und sitzt heute, mit 72 Jahren, womöglich an einem weiteren. Doch der erste, der »von früh bis spät« für die sechzehn Saiten schreibt, ist Joseph Haydn, 1732 geboren.
Haydn liefert mit 25 Jahren die erste Streichquartettsammlung überhaupt, und diesem Sechserpack folgen in vier Jahrzehnten mehr als sechzig Werke. Er beginnt als Unterhaltungsmusiker und zählt erst Opus 9, in dem er persönlich und kontrastreich wird, als echte Streichquartettkomposition. Bis zum nächsten großen Schritt folgen schon ein Dutzend Werke, die bis heute im Repertoire sind. Mit knapp fünfzig dann ist Haydn seiner Kunst so sicher, dass er mit Dekonstruktionen Scherze treibt und im Opus 33 die Spieler auch dialogisieren lässt. Die ganze Sammlung, auf »gantz Neu besondere Art« geschrieben, ist eine Herausforderung an alle Kollegen – Mozarts Antwort kennen wir ja schon.
Es kommt Haydns Experimentierlust entgegen, dass er jahrzehntelang eine feste Anstellung beim Fürsten Esterházy hat. Er muss nicht für den Markt schreiben, der ihn gleichwohl feiert. In London kann der seit 1790 Selbstständige seine Stücke in vollen Sälen erleben, er beginnt, »populärer« zu schreiben, aber die Raffinesse gewöhnt er sich nicht ab. Im CDurQuartett von 1793 huldigt Haydn dem verstorbenen Freund Mozart, indem er ein Thema nach dem Finale der »Jupitersinfonie« modelliert und es entlegensten Modulationen unterzieht. Und das Menuett im letzten vollendeten Streichquartett FDur von 1799 gleicht der endgültigen Demontage dieser höfischen Tanzweise. Der Dreiertakt wird sabotiert, die Harmonik getrübt – wie oft bei Haydn so, dass zwischen Melancholie und Ironie kaum zu unterschieden ist. Zur selben Zeit startet Ludwig van Beethoven, keine dreißig Jahre alt, fulminant ins Genre. Sein Opus 18, 1801 erschienen, ist das letzte bedeutende Sixpack für Streichquartett, aufgekratzt an Haydn anknüpfend, ein legendäres Debüt. Beethovens Weg bis zum letzten seiner sechzehn Streichquartette ist der in einen Kosmos des Inneren, in dem größte Freiheit herrscht – anders als im repressiven Wien des Staatskanzlers von Metternich. Das Finale des letzten Quartetts, FDur

In der Kammermusik stacheln Haydn und Mozart einander an, ringt Beethoven um die Freiheit, findet Schostakowitsch zu sich selbst und Rihm zu packender Unmittelbarkeit.
Opus 135, vereint apokalyptische Dissonanzen und triviale Weisen. Zwar hinterlässt Beethoven mit seinen Sinfonien und 32 Klaviersonaten nicht weniger »lebenslange« Werkkomplexe, doch der Kosmos seiner Quartette ist wohl der einzige, an dem auch heute niemand so leicht vorbeikommt, der überhaupt komponiert.
Dmitri Schostakowitsch wagt sich erst mit 32 Jahren ans Streichquartett, nach seiner Jahrhundertoper »Lady Macbeth von Mzensk«, und gibt sich zuerst so ironisch klassizistisch, als wollte er sich die Auseinandersetzung mit Beethoven ersparen. Sie findet 1952 im fünften seiner Quartette statt – einem Entwicklungsroman, unter Stalin unaufführbar. Von da an werden seine Quartette auch zu Tagebüchern, das berühmte achte von 1960 zum existenziellen »Requiem auf mich selbst«. Noch 1968, als in der westlichen Avantgarde das Genre Streichquartett – Inbegriff traditionsgebundenen Komponierens –vor übergehend auf den Sperrmüll kommt, setzt sich Schostakowitsch im 12. Quartett mit der in der Sowjetunion als volksfern verpönten Zwölftonmusik auseinander. In der Nummer 15 aus dem Jahr 1975 weiß der Komponist, schwer krank nach Jahrzehnten zwischen Staatsdoktrin und Wahrhaftigkeit, dass das Ende naht: Das Werk besteht aus sechs Adagios.
Zu der Zeit hat Wolfgang Rihm schon seinen ersten autarken Beitrag für die Besetzung geliefert, mit achtzehn,
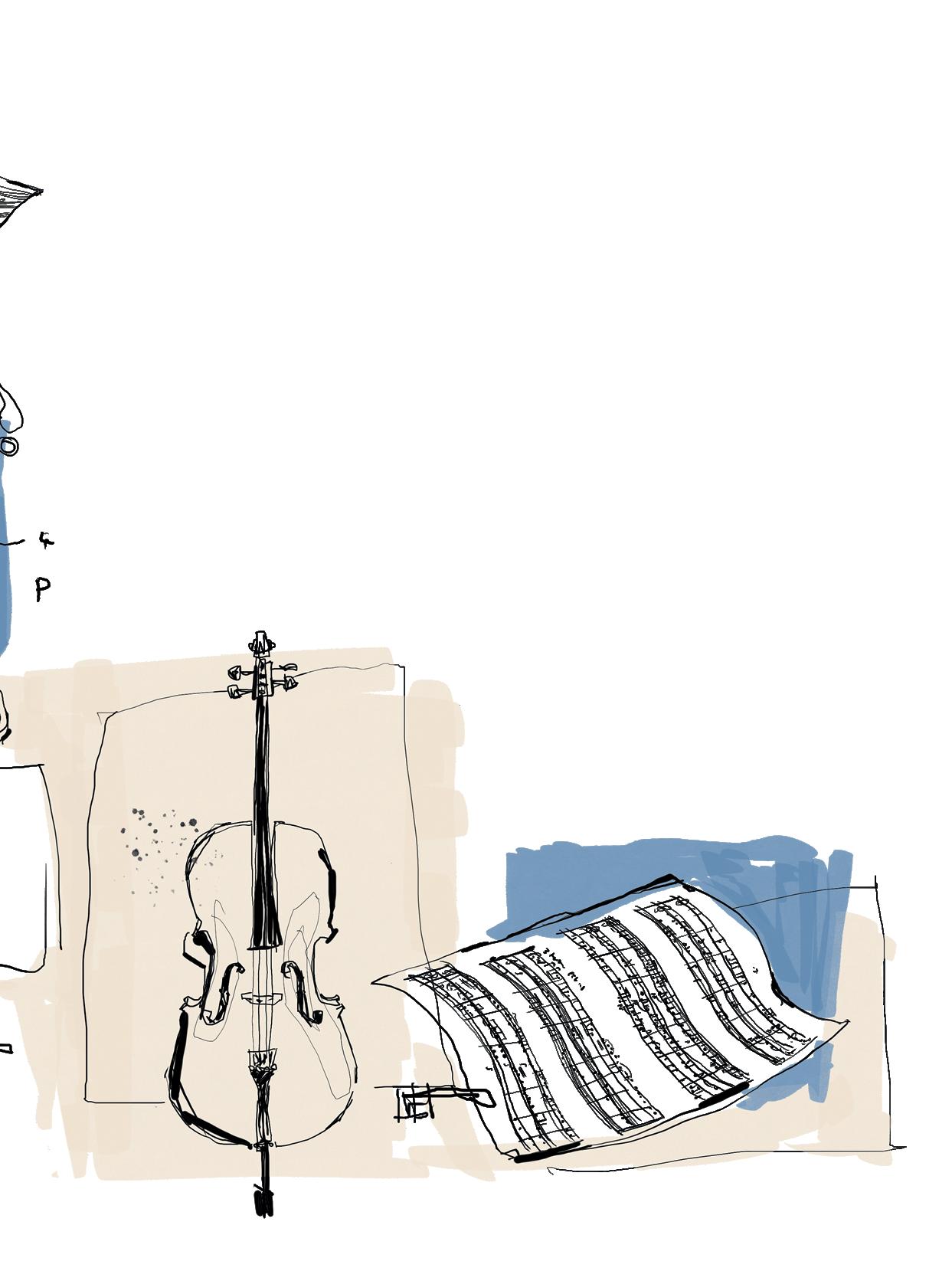
ein kleines Wunderwerk. Sein Streichquartett Nr. 1 klingt, als habe er in den eigenen Kopf hineingelauscht und die Bewegung der Gedanken und Gefühle Klang werden lassen. Man wundert sich, dass 1970 schon (wieder) so »selbstverständlich« komponiert werden konnte und dabei so autonom. Rihm folgt dann über Jahrzehnte hinweg immer neuen Wegen und Positionen, alle zusammengehalten durch die Unmittelbarkeit, die ihn so unvergleichlich macht. Er meißelt und schwelgt, kämpft gegen Zwänge, träumt von der Romantik, wechselt zwischen Steinbruch und Horizont. Das bislang letzte nummerierte Streichquartett, Nr. 13 (2011), ein Satz von 23 Minuten, ist ein Meisterwerk von Fläche und Bewegung, minimalistischer Motorik und grenzenlosem Anspielungsreichtum – und spannend wie ein Roadmovie.
RESET: EIN NEUES KLAVIERTRIO ENTSTEHT
Und nun vergessen Sie mal alles, was hier zur überwiegend abendländischen Entwicklung der Kammermusik und epochenübergreifenden Dialogen von Genies gesagt wurde. Gerade da nämlich knüpft Isabel Mundry, 1963 geboren, in München lebend und lehrend, eine der renommiertesten Komponistinnen unserer Zeit, eben nicht an, auch wenn sie derzeit ein Klaviertrio schreibt, also Musik für die nach dem Streichquartett bedeutendste Kammermusikbesetzung der Klassik und Romantik. »Mit diesem Repertoire werde ich mich, ehrlich gesagt, nicht groß beschäftigen. Ich tue so, als ob es eine völlig neue Besetzung wäre.« Das tut Isabel Mundry in dem etwa 15minütigen Auftragswerk für das junge Trio E.T.A. auch deswegen, weil ihr das Paradigma des »Fortschritts«, mit dem sie groß wurde, längst zu eng und zu ausschließlich geworden ist. »Mich interessiert seit Längerem das Phänomen Oralkultur, in der nichts aufgeschrieben ist und es deshalb Formen gibt, die Mündliches aufgreifen und weitertragen, völlig anders als die architektonischen Formen von Klassik und Romantik.« ›
Ein Weg dorthin, weit zurück, im Grunde bis zu Homer, führt für die Komponistin über den gregorianischen Gesang, ein anderer zu den Gesängen Nordafrikas, aber auch zu den gesungenen Phrasen und Gebeten, die sie mitten in München von Geflüchteten aus aller Welt hört, mit denen sie sich einen Innenhof teilt. »Darum interessiere ich mich so für das Thema Hören, Geste, Einfühlen, für das SichEinstimmen, das Ausklingenlassen.« Schon im Trio »Sounds, Archeologies« für Bassetthorn, Cello und Klavier hat Isabel Mundry sich 2017 mit Archetypen von Musik beschäftigt, etwa mit »Responsorialität«, also dem AufeinanderAntworten, und mit Resonanz. Da habe sich für sie eine neue Tür geöffnet, auch die zu den Ressourcen nicht schriftlich fixierter Musik. Dass Mundry ihre Sprache gerade mit einer kleinen Besetzung neu (er) fand, das vereint sie dann doch mit Kollegen aller Zeiten. Im neuen Werk möchte sie Violine und Violoncello »in einer Art DuoKonstellation« aufeinander beziehen. Mit Themen arbeitet sie nicht, aber es gibt »eine Mehrstimmigkeit im Detail«. Das Klavier wird dabei zum »Klangraum«, und für alle Instrumente möchte Mundry Nuancen finden, »die mit der Archaik des Spiels verbunden sind«, vom Bogendruck der Streicher bis zur »Schwere des Körpers« im Klavierklang. »Ich finde es – auch in den Gesängen anderer Kulturen – extrem faszinierend, wie der Beginn und das Ende von Phrasen und Klängen ausdifferenziert sein können. Was heißt es, die Nuance in die Linearität mit hineinzunehmen? Man könnte sagen, dass das Hören selbst strukturbildend wird.«
Da ist Isabel Mundry der unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmung von Klängen bei Marcel Proust deutlich näher als dem Bestaunen und Beraunen einer »Hirnleistung«
bei Thomas Mann. Von Ehrfurcht vorm Reigen großer Geister hält sie ohnehin wenig: »Der Geniekult ist ein Desaster.« Was keineswegs gegen die Stücke von Schubert und Schumann geht, mit denen das Trio E.T.A. ihre Musik verbindet, sondern gegen das Ausschließen ganz anderer Arten von Musikentstehung, von den enormen Ressourcen so vieler Kulturen. »Meine Musik«, meint sie, »ist weiterhin nicht leicht zu spielen! Aber ich möchte mit ihr im Musizieren selbst einen kleinen sozialen Raum kreieren.«
SAISONERÖFFNUNG
Do, 5.9.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal leonidas Kavakos (Violine) yo-yo Ma (Cello) Emanuel ax (Klavier) ludwig van Beethoven: Klaviertrio D-Dur op. 70/1 »Geistertrio«; Sinfonie Nr. 1 (Bearbeitung für Klaviertrio); Klaviertrio Es-Dur op. 70/2
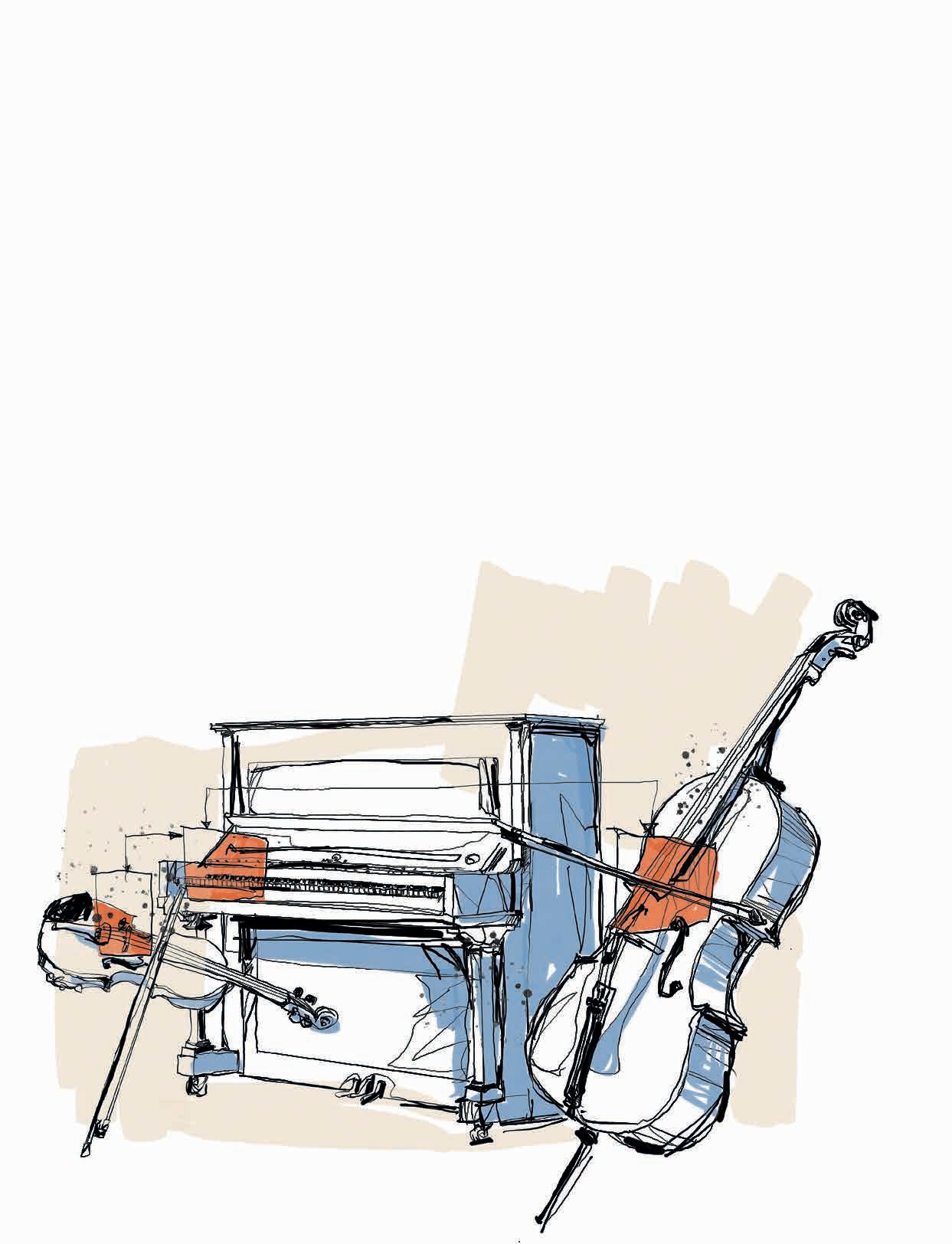
ISABEL MUNDRY
Do, 13.3.2025 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal trio E.t a
Joseph Haydn: Klaviertrio Es-Dur Hob. XV:29; isabel Mundry: Klaviertrio (ua); Franz Schubert: Klaviertrio Es-Dur D 929
Weitere KammermusikKonzerte in Elbphilharmonie und Laeiszhalle finden Sie unter: ELPHI.ME/KAMMERMUSIK
M MEHR ZUM THEMA KAMMERMUSIK FINDEN SIE UNTER: WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK
Wir gestalten Lebensqualität, sodass eine gesunde, lebendige und gerechte Welt für uns alle entsteht. Eine Welt, in der ein ökologisch sinnhaftes Leben und Wirtschaften zur kollektiven Selbstverständlichkeit wird.


www.melitta-group.com
Es
gibt nichts, wozu die Musik nichts zu sagen hätte.
Diesmal …
VON CLEMENS MATUSCHEK ILLUSTRATIONEN LARS HAMMER

HUGO WOLF: KENNST DU DAS LAND?
»Kennst du das Land, wo die Zitronen blüh’n / Im dunkeln Laub die Goldorangen glüh’n …« Beginnend mit diesen Zeilen schuf Goethe nicht nur ein außergewöhnlich schönes Gedicht, sondern ein Synonym für die deutsche ItalienSehnsucht schlechthin. Denn wer damals etwas auf sich hielt, bereiste die Heimat der Römischen Antike und der Renaissance, mithin die Wiege von Kunst und Kultur überhaupt (Griechenland war osmanisch besetzt und daher nicht so zugänglich). Seine Eindrücke überlieferte Goethe im Tagebuch seiner »Italienischen Reise«, doch eine Rolle spielt das Land auch in seinem Bildungsroman »Wilhelm Meister«, in dem er der rätselhaften Mignon –selbst eine Chiffre für die Sehnsucht nach dem Süden –ebendieses Gedicht in den Mund legt. Mehr als hundert Mal wurde es in der Folge vertont, etwa von Beethoven, Schubert, Schumann, Liszt, Tschaikowsky – und eben 1888 Hugo Wolf, dessen hochromantischer Stil ein Solitär der Musikgeschichte bleiben sollte.

RENATO CAROSONE: TU VUÒ
Wenn Italien das Land der Musik ist, dann ist Neapel seine HitSchmiede. Schon im Mittelalter entstanden hier zahlreiche Tänze und Lieder im lokalen Dialekt, später Schlager wie »’O sole mio«. Die lange Tradition des »Canta Napoli« führte nach dem Zweiten Weltkrieg unter anderem der schneidige Renato Carosone fort, der die alten Balladen und Instrumente wie Mandoline und Okarina gut gelaunt mit Rock’n’Roll kombinierte. Das Ergebnis sind swingende Songs wie »Du willst einen auf Amerikaner machen«, ein charmanter Spott über einen allzu trendigen Zeitgenossen, der nur noch Camel raucht und Baseball spielt, dem aber von Whisky Soda schlecht wird und der noch immer seiner Mutter auf der Tasche liegt. Immerhin zeigt er, dass offenbar auch Italiener auswärtige Sehnsuchtsländer haben.
ALBERTO GINASTERA: ESTANCIA
In vormals kolonialisierten Erdteilen wie Südamerika standen Komponisten klassischer Musik stets vor derselben Frage: Sollte man sich der europäischen Tradition unterwerfen, um anschluss und aufführungsfähig zu sein? Oder doch lieber den Klang der Heimat pflegen, auf die Gefahr hin, von den Kultureliten der Alten Welt belächelt zu werden? Der Argentinier Alberto Ginastera entschied sich für den goldenen Mittelweg. Seine Werke basieren auf lokalen Themen und Tänzen, allerdings gekleidet in avancierte Klänge wie die seiner Zeitgenossen jenseits des Atlantiks. Sein Ballett »Estancia« von 1941 etwa spielt auf einer Ranch im Milieu der Gauchos, der argentinischen Cowboys. Insbesondere die rohe rhythmische Energie des finalen StampfTanzes »Malambo«, gepaart mit rücksichtslos dissonanter Harmonik, steht Igor Strawinskys »Sacre« in nichts nach.


MIRIAM MAKEBA: PATA PATA
»Wer würde nicht Widerstand leisten, wenn er wegen seiner Hautfarbe in seinem eigenen Land keine Rechte hätte und schon für den Ruf nach Gleichberechtigung bestraft würde? Ich appelliere an alle Länder der Welt, diese Tragödie zu beenden.« Als die gerade 30jährige Sängerin Miriam Makeba diese eindringlichen Worte 1963 an die UNVollversammlung richtete, war sie vor dem brutalen ApartheidRegime ihrer südafrikanischen Heimat bereits ins Exil in die USA geflohen, wo sie unter anderem bei Kennedys 45. Geburtstag auftrat.
Kurz darauf landete sie ihren größten Hit »Pata Pata«, benannt nach einem Tanz aus Johannesburg. Mit seinem gut gelaunten Groove (und trotz der für Europäer und Amerikaner ungewohnten isiXhosaSprache) setzte er sich sofort im Ohr und in den Hitparaden fest und bescherte Makeba den Ehrentitel »Mama Africa«. In ihr Land zurückkehren konnte sie dennoch erst nach dem Ende der Apartheid 1990, auf per sönliche Einladung von Nelson Mandela.

NEIL YOUNG: SOUTHERN MAN
Das muss man auch erstmal schaffen: Mit Akustikklampfe und Mundharmonika als Ikone des sanften CountryFolk zu gelten und gleichzeitig als Wegbereiter des Grunge mit seinen rotzig krachenden EGitarren. Neil Young vereinte in mehr als 60 Jahren und ebenso vielen Alben tatsächlich beide Pole, wobei ihm jede Art von Klassifikation ohnehin wurscht sein dürfte. Der Mann boykottierte ja auch die StreamingPlattform Spotify, warb für EAutos und Bernie Sanders. Mit dem bis heute mehr oder weniger latenten Rassismus der USSüdstaaten – immerhin ein Kernland des FolkRock – rechnete er in seinem Song »Southern Man« von 1970 ab: »Ich sah Baumwolle und Schwarze, weiße Herrenhäuser und Hütten, ich hörte Peitschen knallen und Schreie. Southern Man, wann begleichst Du Deine Schuld?« Woraufhin sich die Band Lynyrd Skynyrd so auf den Schlips getreten fühlte, dass sie zur Ehrenrettung der Südstaaten ihren Hit »Sweet Home Alabama« schrieb.
RALPH VAUGHAN WILLIAMS:
SINFONIA ANTARTICA

»Am Südpol, denkt man, ist es heiß. Ganz falsch gedacht! Nur Schnee und Eis!« Diese von Elke Heidenreich formulierte Erkenntnis ereilte 1912 offenbar auch den britischen Expeditionsleiter Robert Falcon Scott. Nicht nur musste er sich beim symbolträchtigen Wettlauf zum Südpol dem deutlich besser vorbereiteten Norweger Roald Amundsen geschlagen geben, auf dem Rückweg erfror er zusammen mit seinen Männern. Das Empire verehrte ihn trotzdem als Helden, gipfelnd im Kinofilm »Scott of the Antarctic« (1948). Den Soundtrack steuerte Ralph Vaughan Williams bei, allgemein anerkannt als jener Komponist, der die seit Händels Zeiten währende Vorherrschaft deutscher Tonsetzer auf der Insel brach. Da im Film nur die Hälfte seiner 996 Takte Verwendung fand, legte er gleich noch eine epische SüdpolSinfonie nach, die sowohl die unwirtliche Weite als auch die heroische Dimension der Expedition spiegelt. Sogar Walgesang hört man – in Form von Vokalisen eines Frauenchores.
IDEAL: MONOTONIE
Hach, die Südsee! Allein diese Namen: Bora Bora, Tahiti, Hawaii. Den ganzen Tag bei tropischen Temperaturen in der Hängematte liegen und dösen, wie ungeheuer – öde! So jedenfalls sah es die Band Ideal. Ihr Song »Monotonie« (1982) schaukelt zwar in BeachClubkompatiblem Reggae daher, spießt im Text aber gnadenlos den aufkommenden Pauschaltourismus und die privilegierte Langeweile am Hotelpool auf. Passend dazu singt Frontfrau Annette Humpe dermaßen sediert ins Mikro (bzw. schaut im Video in die Kamera), dass sich jedwedes Fernweh auflöst wie Eiswürfel in einem zu warmen Cocktail. Nicht zuletzt aufgrund dieses Songs avancierte Ideal zu einer der prägenden Bands der Neuen Deutschen Welle – und Humpe zu einer festen Größe im Musikbusiness, die unter anderem für Rio Reiser, Die Prinzen, Udo Lindenberg und das Duo Ich + Ich komponierte und produzierte.
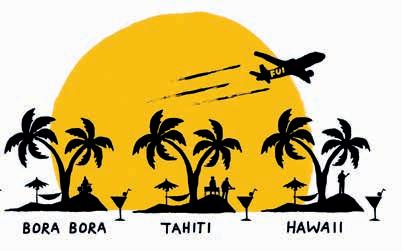
M DIE PLAYLIST ZUM LEXIKON FINDEN SIE UNTER: ELPHI.ME/PLAYLIST


Cotillard (2024); Reiterstandbild der Jeanne d’Arc, Place des Pyramides, Paris (Emmanuel Frémiet, 1874)
Mit »Jeanne d’Arc au bûcher« schuf Arthur Honegger ein bewegendes Porträt der französischen Nationalheiligen. Nun ist das Oratorium in der Elbphilharmonie zu erleben –mit Marion Cotillard in der Titelrolle.
VON SIMON CHLOSTA
Frankreich im 15. Jahrhundert: Es tobt der Hundertjährige Krieg, die französische und die englische Krone kämpfen um die Vorherrschaft. Da tritt ein 17jähriges Bauernmädchen auf den Plan und behauptet, göttliche Visionen zu empfangen, die ihr befehlen, ihre Heimat von den Engländern zu befreien. Sie verlangt, beim Thronfolger vorzusprechen, und überzeugt ihn von ihrem gottgegebenen Auftrag. In Männerkleidung und mit einem Schwert bewaffnet stellt sie sich an die Spitze des französischen Heeres – und kann tatsächlich die Engländer aus dem besetzten Orléans vertreiben. Es folgen weitere kleinere Siege, dann kommt es zur Niederlage. Sie wird verletzt und gefangengenommen, der inzwischen zum König gesalbte Thronfolger lässt sie fallen und liefert sie an die Engländer aus. Ihr wird der Prozess gemacht, an dessen Ende sie als Ketzerin verurteilt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird. Was nach der neuesten FantasySerie eines beliebigen StreamingAnbieters klingt, ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Denn natürlich geht es hier um Jeanne d’Arc, im deutschen Sprachraum besser bekannt als Johanna von Orléans. Geboren wurde sie um 1412 in Lothringen, und ihre Geschichte einer Frau aus dem Volk, die das schier Unmögliche schafft, dazu ihr aufsehenerregender Prozess, dessen Akten vollständig erhalten geblieben sind, und vor allem ihre postume Bedeutung als Wegbereiterin eines französischen Nationalstaats machen sie zu einer der spannendsten Figuren des Mittelalters, weit über Frankreich hinaus. Schon bald nach ihrem Tod 1431 wurde Jeanne d’Arc rehabilitiert und das Urteil gegen sie aufgehoben. 1920 spricht Papst Benedikt XV. sie heilig;
bis heute gilt sie als Nationalheilige Frankreichs, jährlich geehrt mit einem eigenen Festival in Orléans. Auch wenn Netflix & Co. noch nicht zugegriffen haben – das in jeder Hinsicht außergewöhnliche Leben der Jeanne d’Arc diente bereits als Vorlage unzähliger Kunstwerke, Filme, Opern und sogar Computerspiele; von William Shakespeare bis Giuseppe Verdi, von Leonard Cohen bis Kate Bush ließen sich Künstler und Künstlerinnen unterschiedlicher Genres von ihrer Geschichte inspirieren.
HISTORISCHE PARALLELEN
Eine der (musikalisch) stärksten Umsetzungen gelang dabei dem Schweizer Komponisten Arthur Honegger (1892–1955) mit seinem Oratorium »Jeanne d’Arc au bûcher« (»Johanna auf dem Scheiterhaufen«). Es zeichnet nicht nur ein anrührendes Porträt der Jeanne d’Arc. Komponiert in Zeiten faschistischer Diktaturen, zieht es auch Parallelen zwischen den Jahrhunderten, erst recht,nachdem das zunächst 1935 vollendete Werk nach der Befreiung Frankreichs 1944 – diesmal von den Deutschen – um einen Prolog erweitert wurde, der Jeanne d’Arc als Retterin Frankreichs preist.
Den Auftrag zur Komposition gab 1934 die wohlhabende russische Tänzerin und Schauspielerin Ida Rubinstein, die mit Komponisten wie Claude Debussy und Igor Strawinsky regelmäßig verkehrte und auch mit Arthur Honegger schon mehrfach zusammengearbeitet hatte. Auf sie geht auch die ungewöhnliche Anlage derKomposition zurück, denn da Rubinstein selbst keine Sängerin war, wünschte sie sich für die Hauptrolle der Jeanne d’Arc eine Sprechpartie. Das hat den schönen Nebeneffekt, dass seit der Uraufführung 1938 in Basel bereits zahlreiche prominente Schauspielerinnen die Titelrolle auf der Bühne verkörperten, darunter Ingrid Bergman, die Jeanne d’Arc auch in gleich zwei Verfilmungen spielte. Wenn nun »Jeanne d’Arc au bûcher« erstmals in der Elbphilharmonie aufgeführt wird, ist Marion Cotillard als Johanna von Orléans zu erleben.
Die französische Schauspielerin, die für ihre Darstellung von Edith Piaf im Film »La vie en rose« 2008 den Oscar erhielt, begleitet diese Rolle schon seit fast zwanzig Jahren. Sie hat sie an der Seite verschiedener Orchester und Dirigenten interpretiert, konzertant und, wie jüngst in Berlin, szenisch aufgeführt, und dabei immer wieder neue Facetten entdeckt. »Vom ersten Moment an hat mich Jeanne d’Arc zutiefst berührt. Sie war eine Frau mit echten Überzeugungen. Sie muss etwas geradezu Magisches ausgestrahlt haben, dass es ihr gelingen konnte, tatsächlich all das zu erreichen, wovon sie überzeugt war«, so Cotillard in einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur. ›
Der Clou des Stücks besteht nicht nur in der Sprechpartie als Titelrolle, sondern auch in seiner dramaturgischen Anlage.

Besonders zeigt sich Cotillard von der Partitur zu »Jeanne d’Arc au bûcher« fasziniert: »Musik und Text sind so kraftvoll, wecken so viele Emotionen. Das Tolle ist, dass ich beim Spielen von der Musik begleitet werde. Es gibt Passagen ohne Musik, dann aber auch prosodische Abschnitte, in denen der Rhythmus der Worte sehr präzise gesetzt werden muss. Das muss alles im Moment der Aufführung zusammenpassen. Die Musik ist so genau austariert, so penibel notiert, und jeder Dirigent bringt mit seiner Lesart etwas anderes zum Vorschein. Das überrascht mich immer wieder.«
Ungewöhnlich sei für sie außerdem, bei der Aufführung »wie ein Musikinstrument behandelt zu werden und agieren zu müssen – eine ziemlich seltene Erfahrung«. Und noch einen wesentlichen Unterschied zwischen ihrer Arbeit beim Film und im Konzertsaal ist für sie von Bedeutung: »Wenn man einen Film sieht, dann macht die Musik ja eine Menge aus. Sie soll an bestimmten Stellen bestimmte Emotionen transportieren, eine bestimmte Wirkung erzielen. Aber wir Schauspieler hören die Musik bei den Dreharbeiten nicht, wir haben während der Aufnahmen nicht diese Unterstützung durch die Musik. Und hier ist es ganz anders. Das ist so – um im Bild zu bleiben –, als ob man Dreharbeiten mit der Filmmusik gleichzeitig machen würde. Die Melodie, die Musik ist bereits da und unterstützt alles, was man macht.«
Die Textgrundlage zu »Jeanne d’Arc au bûcher« schuf auf Wunsch des Komponisten der französische Schriftsteller Paul Claudel (1868–1955). Dieser hatte zunächst noch abgelehnt, da er sich der Aufgabe, »die historische Gestalt der Jungfrau von Orléans in einen fiktiven Rahmen zu stellen«, nicht gewachsen sah. Angeblich, so will es die Legende, stimmte Claudel erst eine »mystische Vision« während einer Zugfahrt nach Brüssel um. (Der Wahrheitsgehalt dieser Aussage muss wohl so unüberprüfbar bleiben wie die Visionen der Jeanne d’Arc selbst.)
Neben der Wahl einer Sprechpartie als Titelrolle besteht der Clou des Oratoriums in seiner dramaturgischen Anlage. Im Libretto erzählt der Dichter die Geschichte nämlich nicht chronologisch. Stattdessen setzt er kurz vor der Hinrichtung auf dem Scheiterhaufen an und erzählt Jeannes Leben in (teils fiktiven) Rückblenden. Dabei scheut er auch vor surrealen Elementen nicht zurück. So muss Johanna erfahren, dass sie nicht vor ein Menschengericht treten soll, sondern vor Tiere. Das Schwein übernimmt den Vorsitz als Richter, die Schafe fungieren als Beisitzer, und ein Esel bekommt das Amt des Schreibers. Ihr wird erklärt, dass ihre Verurteilung das Resultat eines politischen Kartenspiels sei – die zentrale Szene des Oratoriums. Bei dem Spiel treten die Könige von Frankreich und England sowie der Herzog von Burgund auf, die zugleich die allegorischen Figuren Torheit, Hoffart und Habsucht repräsentieren. Auch der Tod ist mit seiner Gattin, der Wollust, dabei. Am Ende wird Johanna dem Sieger des Spiels, England, ausgeliefert.

Für sein Libretto suchte Claudel eine äußerst vielgestaltige Mischung aus französischen und lateinischen Texten, Bibelzitaten und Volksliedern aus, die die Grundlage für Honeggers Musik bilden. Der Komponist zeigte sich derart begeistert von Claudels Arbeit, dass er ihn später als den eigentlichen Schöpfer des Werkes bezeichnete: »Tatsächlich war Claudels Anteil an ›Jeanne d’Arc au bûcher‹ so groß, dass ich mich nicht als den eigentlichen Autor des Werkes betrachte, sondern nur als einen bescheidenen Mitarbeiter. Der Komponist braucht sich nur führen zu lassen, um all das Klang werden zu lassen. Es genügt, Claudel wieder und wieder seinen Text lesen zu hören. Er tut dies mit einer so plastischen Kraft, dass sich für jeden, der auch nur ein bisschen musikalische Fantasie besitzt, das ganze musikalische Relief daraus ergibt.«
ANRÜHRENDES KINDERLIED
Und so folgte Honegger den Anweisungen des Textdichters denn auch sehr genau. Äußerst plastisch ist etwa das Hundegeheul der ersten Szene durch die lautmalerischen Klänge eines Ondes Martenot dargestellt, eines frühen elektronischen Instruments. In der Flöte erklingt Vogelgesang, und noch weitere Tierstimmen ziehen sich durch die Partitur. Zudem hat Honegger verschiedene musikalische Gattungen und Stile in die Partitur integriert. Anklänge an die Unterhaltungsmusik seiner Zeit finden sich ebenso wie vom Jazz inspirierte Passagen, französische Volkslieder mischen sich mit barocken Tänzen oder mittelalterlichen Kirchengesängen. All das steht aber nicht beiläufig oder gar beliebig nebeneinander; vielmehr werden die Themen und Motive durch Wiederholungen und Variationen ständig miteinander verknüpft. Ein besonders anrührender und eindringlicher Moment ist Honegger gegen Ende des Oratoriums gelungen. Johanna versetzt sich hier zurück in ihre Kindheit in
Arthur Honegger, Ingrid Bergman und Paul Claudel nach einer Aufführung in der Pariser Oper (1954)
der lothringischen Heimat, wo sie erstmals die Stimmen vernommen und mit ihren Spielgefährten das Lied »Trimazô« gesungen hat, das innerhalb des Oratoriums als Symbol für kindliche Geborgenheit steht. Tatsächlich wird die Sprecherin an dieser Stelle, wenn auch nur für einen kurzen Moment, zur Sängerin. Doch dann holt Johanna die Gegenwart ein und ihr versagt die Stimme. Sie steht auf dem Scheiterhaufen, während die laut schreienden Gegner ihren Tod fordern. Ein Priester versucht, sie zum Widerruf ihrer Aussage zu bewegen. Johanna bleibt standhaft. In Flammen aufgehend, fährt sie hinauf in den Himmel und wird von ihren Schutzheiligen empfangen.
M MEHR ZU GESANGSPROJEKTEN IN ELBPHILHARMONIE UND LAEISZHALLE FINDEN SIE UNTER: WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK
JEANNE D’ARC AU BÛCHER
Mi, 18.12.2024 | 20 Uhr Elbphilharmonie Großer Saal hr-Sinfonieorchester Frankfurt
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde Wien Hamburger alsterspatzen Hamburger Knabenchor Solisten: Marion Cotillard, Éric Génovèse u.v.a. alain altinoglu (leitung) arthur Honegger: Jeanne d’arc au bûcher / Dramatisches Oratorium Konzertante aufführung in französischer Sprache mit deutschen Übertiteln







Der Bratschist Antoine Tamestit im Gespräch über den besonderen Charakter seines Instruments, das Zentrum der Harmonie und atemlos gespannte Stille.
VON BJØRN WOLL
Antoine Tamestit, Sohn des Geigenpädagogen und Komponisten Gérard Tamestit, trat zunächst in die Fußstapfen seines Vaters, ließ die Violine aber schnell links liegen – zugunsten der Viola. Später studierte er in Yale bei Jesse Levine, danach in Berlin bei Tabea Zimmermann, der vielleicht größten Bratschistin unserer Zeit. Doch längst gehört der 1979 in Paris geborene Musiker selbst zur Weltklasse auf seinem Instrument. Als Solist gastiert er auf nahezu allen wichtigen Bühnen dieser Welt, und das mit einem enorm breiten Repertoire, das vom Barock bis zu Zeitgenössischem reicht. Immer wieder schreiben wichtige Tonschöpfer neue Werke eigens für ihn, darunter Olga Neuwirth, Bruno Mantovani und Jörg Widmann. Hinzu kommt ein ausgeprägtes Faible für Kammermusik, gerne im Verbund mit langjährigen Vertrauten, zu denen Isabelle Faust, YoYo Ma, das Quatuor Ébène und JeanGuihen Queyras zählen; mit Frank Peter Zimmermann und Christian Poltéra gründete Tamestit außerdem das Trio Zimmermann. Daneben war er zehn Jahre lang Programmdirektor des Viola Space Festivals in Japan und unterrichtete als Professor an der Musikhochschule in Köln und am Pariser Konservatorium. Als Residenzkünstler der Elbphilharmonie gibt Antoine Tamestit in der kommenden Spielzeit gleich mehrfach Einblicke in seine faszinierendfacettenreiche Künstlertätigkeit. Immer mit dabei: die älteste erhaltene Bratsche von Antonio Stradivari aus dem Jahr 1672, die ihm von einer Stiftung zur Verfügung gestellt wird. Gleich das erste Konzert der Residenz hält eine besondere Überraschung bereit, denn Alan Gilbert, der Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters, ist nicht nur am Pult zu erleben, sondern spielt in Bachs Brandenburgischem Konzert Nr. 6 auch die zweite Solobratsche.
Die Bratsche wird oft als vernachlässigtes Soloinstrument bezeichnet. Aber stimmt das überhaupt noch? Immerhin gibt es längst prominente Künstler wie Tabea Zimmermann, Kim Kashkashian, Nils Mönkemeyer, Maxim Rysanov und natürlich Sie. Wie viel müssen Sie für das Image der Bratsche denn noch tun?
Antoine Tamestit: Vielleicht hatte ich Glück, aber ich spüre an meinem Instrument keine Benachteiligung mehr. Ich bin jetzt Mitte 40 und habe musikalisch schon mehr erreicht, als ich mir jemals erträumt hätte. Sowohl die großen Orchester als auch prominente Dirigenten sind daran interessiert, mit mir als Bratschist zu arbeiten. Das zeigt das konstante Interesse an diesem Instrument. Das haben wir den Namen zu verdanken, die Sie gerade genannt haben, denn sie haben den Weg geebnet, haben für das Ansehen der Bratsche gekämpft, neue Werke in Auftrag gegeben und damit das Repertoire erweitert.
Was mögen Sie selbst am meisten an der Bratsche? Als Kind habe ich ein paar Jahre lang Geige gespielt, wollte dann aber Cello lernen, nachdem ich mich in Bachs Cellosuiten verliebt habe. Weil ich aber schon einige Kenntnisse auf der Geige hatte, wechselte ich doch zur Bratsche. Für mich war das die natürliche Erweiterung der Violine zu einer tieferen, wärmeren, dunkleren Persönlichkeit. Die Grenzen des Repertoires lernte ich erst später kennen: die Tatsache zum Beispiel, dass eines der besten Stücke, Mozarts »Sinfonia concertante«, kein reines Bratschenkonzert ist, sondern eines für Violine und Viola. Oder »Harold en Italie« von Berlioz, das kein Solokonzert ist, sondern eine Sinfonie, in der die Solobratsche immerhin eine wichtige Rolle spielt. Oder Hindemith, der das Instrument zwar meisterhaft beherrschte, in seinem Konzert aber eine »unvollständige« Orchesterbesetzung vorsieht, weil er die Geigen und Bratschen aus dem Orchester rausnimmt.
Das klingt schon ein bisschen frustrierend, oder? Überhaupt nicht, zumindest nicht für mich. Die Bratsche kann ein Soloinstrument sein, wenn auch auf ihre eigene Art. Zu ihrer Persönlichkeit gehört es aber ebenso, dass sie im Quartett oder im Orchester meist nicht die führende, sondern eine unterstützende Stimme spielt, sozusagen den Kern in der Mitte zwischen Bass und Melodie. Oder wie Bach sagte, das Zentrum der Harmonie. Rund drei Viertel meiner Auftritte im Jahr sind mit Orchester. Aber selbst da geht es nicht nur darum, vorne an der Rampe zu stehen und möglichst viel Virtuosität zu demonstrieren. Man muss auch wissen, wie man Teil des Orchesters werden kann, dass man als Solist auch Kammermusiker sein muss, dass man manchmal auch im Schatten steht. Oder dass man als eine Art großer Bruder agiert, wie in Mozarts »Sinfonia concertante«. Das ist die Persönlichkeit der Bratsche: nicht immer nur glänzen zu wollen, sondern auch mal die Nebenrolle zu spielen. Oder wie es bei der OscarVerleihung immer heißt: »Best Supporting Actor«.
Finden Sie etwas von diesem Charakter der Bratsche auch in Ihrer eigenen Persönlichkeit?
Was ich da schon sehe, ist der Humor, die Fähigkeit, über sich selbst Witze zu machen und sich selbst nicht ganz so wichtig zu nehmen: diese Art von Demut, dass man eigentlich ein besserer Mensch ist, wenn man jemand anderen begleitet. Als Menschen brauchen wir die Interaktion, um existieren zu können. Das ist eine Seite meiner Persönlichkeit, die der Bratsche sehr nahe steht, denn ich liebe die Interaktion mit anderen. Das beschreibt Jörg Widmann sehr schön in seinem Violakonzert, das er für mich geschrieben hat, und in dem ich durch das Orchester wandere und in Dialog mit verschiedenen Instrumenten trete. ›

In Hamburg spielen Sie Bachs Brandenburgisches Konzert Nr. 6 mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester, vor ein paar Jahren haben Sie dieses Werk mit der Akademie für Alte Musik Berlin aufgenommen. Macht es für Sie einen Unterschied, ob Sie mit einem modernen oder einen historisch informierten Orchester spielen?
Ich hatte schon während des Studiums Unterricht bei einem Barockcellisten und habe mir damals meinen ersten Barockbogen gekauft. Und als ich vor über zehn Jahren Bachs Cellosuiten auf der Bratsche aufgenommen habe, habe ich Darmsaiten aufgezogen. Damit klang das Instrument ganz anders, viel wärmer und flexibler. Für mich haben Darmsaiten und Barockbögen etwas Aufregendes an sich, sie geben dem Klang eine besondere Farbe und einen hinreißenden Glanz. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Ich spiele ebenso gerne mit OriginalklangEnsembles wie mit modernen Orchestern – auch weil deren Musiker heute bestens mit den Erkenntnissen der historisch informierten Aufführungspraxis vertraut sind.
Im selben Konzert steht mit Paul Hindemith einer der wichtigsten Komponisten für Bratsche überhaupt auf dem Programm. Der ist ein seltsames Paradox: Sein Name ist zwar recht bekannt, aber seine Musik wird nicht gerade oft gespielt. Haben Sie dafür eine Erklärung? Nicht so richtig, aber es ist eine gute Frage. Vielleicht liegt es daran, dass er von den Nazis brutal ins Abseits gedrängt und seine Musik als entartete Kunst diffamiert wurde. Er verließ Deutschland, emigrierte in die Vereinigten Staaten, und seine Musik wurde kaum noch aufgeführt. Als er später zurückkam, war der Kontakt zum Publikum irgendwie abgerissen. Dabei ist er für die Bratsche immens wichtig, vergleichbar mit dem, was Paganini für die Geige oder Liszt und Chopin fürs Klavier getan haben: Es sind
»Hindemith ist für die Bratsche immens wichtig, vergleichbar mit dem, was Paganini für die Geige oder Liszt und Chopin fürs Klavier getan haben.«
Wendepunkte, an denen plötzlich jemand die Möglichkeiten eines Instruments ausschöpft und damit die Technik auf eine neue Ebene katapultiert.
Was war Paul Hindemith für ein Typ? Als ich an der Yale University studierte habe, bekam ich Bratschenunterricht in dem Raum, in dem auch Hindemith unterrichtet hat. Später zeigte mir meine Lehrerin Tabea Zimmermann Briefe von ihm. Ich kam dieser Persönlichkeit dadurch immer näher und lernte einen Menschen kennen, der Walt Disney liebte, der ein ganzes Zimmer voller Modelleisenbahnen zu Hause hatte und in surrealistischen Filmen mitspielte. Er hat sich offenbar einen kindlichen Geist bewahrt und besaß eine Menge Humor. Das müssen wir als Künstler bedenken, wenn wir seine Musik spielen. Außerdem war er ein Spezialist für Barockmusik, die ihm als Ideal galt. Deshalb spielen wir Hindemith im Konzert auch direkt nach Bach, denn seine Kammermusik Nr. 5 ist ein direkter Verweis auf Bachs Brandenburgisches Konzert Nr. 6.
Wie sieht es mit dem Repertoire in der zeitgenössischen Musik aus? Welche Möglichkeiten der Bratsche nutzen die Komponisten heute?
In der Entwicklung des Repertoires gibt es eine Verzögerung im Vergleich zur Geige und zum Klavier. Was Paganini für die Geige bereits Anfang des 19. Jahrhunderts angestoßen hat, passierte für die Bratsche erst ein Jahrhundert später mit Hindemith: Er sprengte die Fesseln des Instruments. Doch dann dauerte es eine Weile, bis das weitere Komponisten beeinflusst hat. 1929 schrieb William Walton sein Bratschenkonzert, 1945 hat auch Béla Bartók mit seinem Konzert die Möglichkeiten des Instruments weiterentwickelt, besonders den Tonumfang in der hohen Lage. Danach folgten Komponisten wie Bernd Alois Zimmermann, Alfred Schnittke, Sofia Gubaidulina, György Kurtág und György Ligeti. Auch die Konzerte und Stücke,
die für Tabea Zimmermann geschrieben wurden, haben das Repertoire erweitert, denn mit ihrer so brillanten und flexiblen Technik hat sie den Tonschöpfern gezeigt, was auf der Bratsche alles möglich ist.
Apropos, von Sofia Gubaidulina spielen Sie im Rahmen der Residenz das Violakonzert. Was ist das für ein Stück?
Sie komponiert in einer ganz persönlichen musikalischen Sprache, die eine unglaubliche Spiritualität besitzt. Ähnlich wie der Maler Mark Rothko mit seinen Bildern Spiritualität ausdrückt, gelingt das Gubaidulina mit Tönen. Wenn die Streicher unisono spielen, ist das wie ein Gebet aus weiter Ferne. Außerdem nutzt sie den ganzen Tonumfang der Viola, schafft so einen weiten Raum – einen Bratschenkosmos, eine Art Universum, auf das wir blicken können. Es ist ein ganz und gar spezielles Konzert, in dem es auch um die Beziehung zwischen Orchester und Solist geht, das zeigt sich schon an den ungewöhnlich zahlreichen Solokadenzen. Ich hatte das Glück, einmal mit ihr arbeiten zu können. Und selbst wenn wir uns mit Sprache nicht richtig verständigen konnten, weil sie kaum Englisch spricht, war es beeindruckend, wenn sie mir zum Beispiel eine Stelle vorgesungen hat.
Mit einem reinen SchubertProgramm zeigen Sie in Hamburg auch Ihre Leidenschaft für die Kammermusik. Was reizt Sie daran so sehr?
Ich liebe Kammermusik, weil man in gewisser Weise Freundschaften schließt, ohne zu reden. Man kann sogar Freundschaft mit jemandem schließen, mit dem man im wirklichen Leben gar nicht befreundet ist. Es geht dabei um eine subtile Kommunikation und auch darum, Kompromisse zu finden: Man muss aufeinander zugehen, um sich zu verstehen. Meine Kammermusikpartner sind für mich aber immer auch Lehrer: Ich muss daran interessiert sein, was sie sagen oder was sie über ein Musikstück denken. Ich möchte herausgefordert werden. Es ist wie eine Liebesgeschichte, in der man aufeinander zugeht, in der man sich gegenseitig herausfordert, in der man sich anzieht. So entstehen auch für das Publikum besondere Momente.
An einen dieser Moment erinnere ich mich sehr gut, da haben Sie Schönbergs Streichsextett »Verklärte Nacht« gespielt. Ich habe selten einen derart mucksmäuschenstillen und erwartungsvollen Saal gesehen. Wie erleben Sie solche Momente als Musiker auf der Bühne?
Ich bin kein besonders religiöser Mensch, zumindest glaube ich nicht an eine bestimmte Religion. Aber ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass es etwas gibt, das ich wirklich spirituell finde: den Raum zwischen dem Künstler und dem Publikum. Das, womit die Luft gefüllt ist, was die Stille erzeugt, was die Reaktion des Publikums hervorruft. Diese Fragen werden immer wichtiger für mich: Was ist es in unserem Timing, in unseren Farben, in unserem Aus
druck, was das Publikum dazu bringt, zu reagieren?
Vielleicht sogar atemlos zu sein, sodass die Zeit für ein paar Minuten stillsteht. Das sind für mich die schönsten Momente als Musiker.
Die Gretchenfrage bei Streichern lautet oft: ein altes oder ein neues Instrument? Sie selbst spielen die Viola Stradivarius »Gustav Mahler« von 1672. Tabea Zimmermann hat mir einmal erzählt, dass die alten Bratschen oft einen dunklen Tenorklang hätten, etwas größer und unhandlicher seien und deshalb nicht ganz so beweglich, also weniger geeignet für solistische Aufgaben. Stimmen Sie zu?
Der einzige »Nachteil« meiner StradivariViola ist der, dass sie relativ große »Schultern« hat. Da musste ich am Anfang ein bisschen ausprobieren, um eine gute Position zu finden. Außerdem kann man auf einem alten Instrument nicht unbedingt nur das machen, was man selbst möchte: weil es vorher schon von anderen gespielt wurde, die es geformt haben. Das Holz hat sich bewegt, der Lack hat sich verändert, ein spezifischer Klang hat sich entwickelt. Nach 16 Jahren mit »meinem« Instrument kann ich aber sagen, dass das eine besondere Qualität ist und keinesfalls ein Nachteil. Wenn ich auftrete, habe ich das Gefühl, dass zwei Personen auf die Bühne gehen: ich selbst und mein Instrument. Ich weiß, es klingt verrückt, aber manchmal scheint mir, dass meine Bratsche mir sagt: »Spiel mehr so, geh mehr in diese Richtung – und dann kriegen wir, was Du willst.« Noch heute werde ich regelmäßig überrascht, welche Farben und Resonanzen in ihr stecken.
M WEITERE KÜNSTLERINTERVIEWS FINDEN SIE UNTER: WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK
RESIDENZ ANTOINE TAMESTIT
Do, 19.9.2024 | 20 Uhr
So, 22.9.2024 | 11 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal NDR Elbphilharmonie Orchester antoine tamestit (Viola) alan Gilbert (leitung)
J. S. Bach: Brandenburgisches Konzert Nr. 6
Paul Hindemith: Kammermusik Nr. 5 ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 1
Mi, 23.10.2024 | 20 Uhr
Laeiszhalle Kleiner Saal isabelle Faust (Violine), anne Katharina Schreiber (Violine), antoine tamestit (Viola), Jean-Guihen Queyras (Cello), Christian Poltéra (Cello)
Franz Schubert: Streichquartett G-Dur D 887
Streichquintett C-Dur D 956
Fr, 30.5. & Sa, 31.5.2025 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
NDR Elbphilharmonie Orchester antoine tamestit (Viola)
Pablo Heras-Casado (leitung) Sofia Gubaidulina: Konzert für Viola und Orchester
Richard Wagner / lorin Maazel: Der Ring ohne Worte für Orchester (auszüge)
So, 8.6.2025 | 18 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
NDR Elbphilharmonie Orchester James Ehnes (Violine), antoine tamestit (Viola), thomas Cornelius (Orgel) louis langrée (leitung)
Maurice Ravel: Ma mère l’oye / Suite für Orchester
W. a. Mozart: Sinfonia concertante KV 364 Camille Saint-Saëns: Sinfonie Nr. 3 »Orgelsinfonie«

Es ist natürlich nicht die Sonne des Südens, die hier die Elbphilharmonie so ungewohnt beleuchtet. Es ist das tatsächlich vorhandene Licht – von dem unser Fotograf allerdings mehr eingefangen hat als üblich. Durch gezielte Überbelichtung entsteht eine Reduktion, die die Formen verdichtet und den Blick für architektonische Details abseits des sonst Ersichtlichen schärft.
FOTOS ARAS GÖKTEN








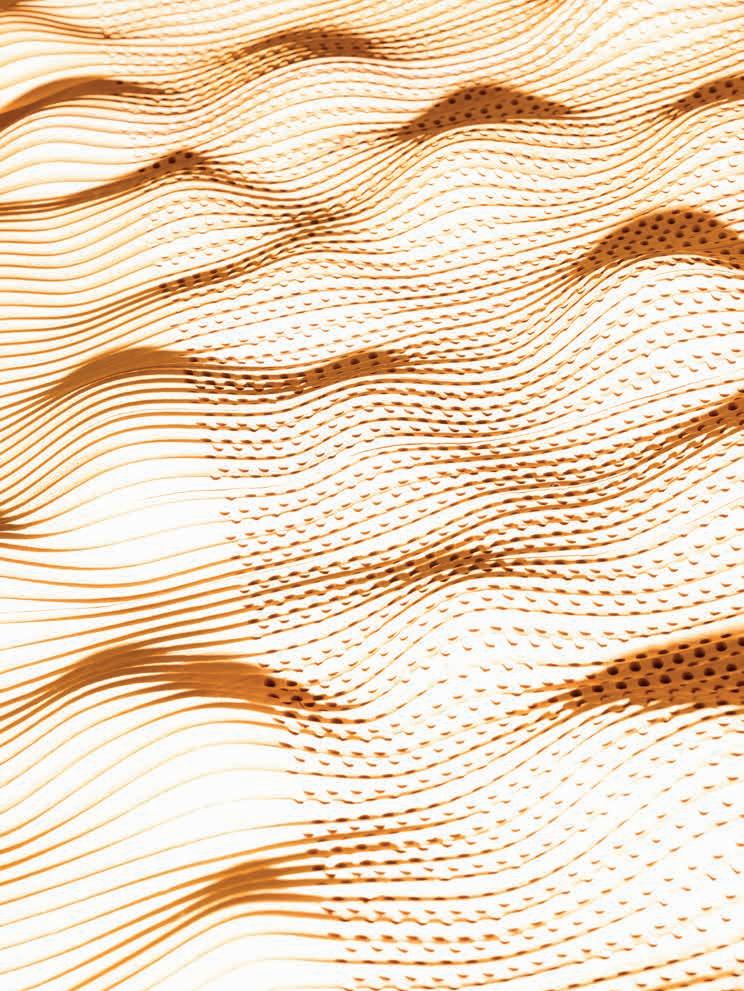

Neapel! Traumstadt für Viele, geheimnisvolles Urlaubsziel, legendenumwittert.
Romantik, Morde, Müllskandale. Und großartige Musik.
VON PETER REICHELT
Die EUWahl liegt noch nicht so lange zurück, und sie hat uns wieder Angst eingejagt vor der massiven Reaktion der Wählerschaft auf Zuwanderung und Migration, die ja immer schon da waren und immer schon wichtig für die gegenseitige Befruchtung der Kulturen und deren jeweiliges Fortkommen. (Eine Hanse und also Hafen und Handelsstadt wie Hamburg muss da ja ein Lied von singen können.)
Nun, im Falle Neapels war das noch ein bisschen anders.
Doch beträchtlich älter als Hamburg und viel stärker besonnt, hat die Stadt mit Bestblick auf den Vesuv seit Langem schon ganz andere Migrationsbewegungen erlebt. Oberirdisch wie unterirdisch. Diffundierend, sozusagen. Letzten Endes verwundert es nicht, dass eine Metropole auf derart geoaktivem Terrain auch derart vitale interkulturelle Symbiosen gezeitigt hat.
Wenn es zur Alltäglichkeit gehört, dass das »Unterste« jederzeit »nach oben« geworfen werden kann, dann stellt sich natürlicherweise ein ganz anderes Verhältnis zur Wandelbarkeit des Lebens ein, als das in den mehr oder weniger stabilen Regionen Mitteleuropas der Fall ist. Tief


unter den lebhaften Gassen von Neapel schlummert »eine Stadt unter der Stadt«. Ein etwa achtzig Kilometer langes Labyrinth aus eindrucksvollen Höhlen, Zisternen und Brunnen zieht sich durch den gesamten Untergrund. Die Tuffsteinhöhlen liegen vierzig Meter unter der Erde und werden seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. für die unterschiedlichsten Zwecke genutzt: Sie dienten als geheime Zufluchtsorte, Kulträume, Katakomben und Abfallhalden. Während des Zweiten Weltkriegs boten sie der Bevölkerung Schutz vor Bombenangriffen und retteten vielen Menschen das Leben.
Hervorgegangen aus einer griechischen Kolonie (Neápolis, die neue Stadt), kam Neapel 1265 unter die französische Herrschaft der Anjou, 1442 bis 1707 unter die Herrschaft Spaniens. Und zwischen diesen beiden Kolonialherren ging es – mit österreichischer Beteiligung – immer hin und her bis 1860, als sich Neapel und Sizilien dem neuen Königreich Italien anschlossen. Heute ist die Stadt Verwaltungssitz der Region Kampanien. Ein parteiloser Bürgermeister regiert eine Mittelinksorientierte Stadtverwaltung für knapp eine Million Einwohner.
Neapel ist aber auch das Zentrum der Camorra, einer der ältesten und größten kriminellen Organisationen Italiens, deren Anfänge bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen.
FOLKLORE UND CANZONE
Etwa um diese Zeit schwang sich das offizielle Musikleben der Stadt (nach einer ersten Hochblüte im 14. und 15. Jahrhundert und einer kürzeren Phase der Stagnation) wieder neu auf: Diego Ortiz, Francisco Martínez de Loscos und Giovanni de Macque lieferten als Kapellmeister der seit 1444 bestehenden königlichen Kapelle wichtige Impulse für diese musikalische Renaissance Neapels.
Fragt man nach den ursprünglich distinkten Lebensräumen von Volks und Kunstmusik, muss man genau zwischen den Erscheinungsformen der echten musikalischen Folklore und denen des neapolitanischen Liedes unterscheiden. Spuren der Ersteren finden sich in den Rufen der Straßenverkäufer (die heute fast verschwunden sind) und in den Ritualen einiger religiöser Feste wie dem der Madonna dell’Arco, die unter einer christlichen Fassade einen im Grunde heidnischen Kern verbergen; Letzteres gehört, obwohl heute quer durch alle Gesellschaftsschichten verbreitet, ursprünglich einer höheren kulturellen Sphäre an.
Im neapolitanischen Lied vermischt sich die volkstümliche Tradition mit Elementen aus Romanze, Opera buffa und dem Salonlied des 19. Jahrhunderts. Es ist daher bezeichnend, dass der Hauptvertreter seiner goldenen Ära rund um 1900 ein raffinierter Dichter wie Salvatore Di Giacomo war (sogar Gabriele d’Annunzio schrieb den Text für ein neapolitanisches Lied), und seine Musiker zwar überwiegend talentierte Improvisatoren, aber doch auch
Neapel, die »neue Stadt« mit ihrem Bestblick auf den Vesuv, hat schon viele interkulturelle Symbiosen hervorgebracht.
›

Im Kern seit Jahrhunderten unverändert: das Fest der Madonna dell’Arco (Gemälde von Louis Léopold Robert, 1825)
Künstler waren, die die Technik der Komposition perfekt beherrschten, wie Paolo Tosti, Luigi Denza und Enrico de Leva.
Die authentischste neapolitanische Volksmusik ist die der ländlichen Umgebung der Stadt, wie sie seit den 1970ern wiederbelebt wurde, vor allem durch die ethnomusikologischen Forschungen von Roberto De Simone und durch moderne Bearbeitungen, etwa durch die Nuova Compagnia di Canto Popolare sowie in verschiedenen Bühnenwerken (das bekannteste ist Roberto De Simones »La gatta Cenerentola«, 1976). Dies hat unter anderem zu einer Wiederentdeckung der Villanella beigetragen, eines Strophenlieds aus dem 16. Jahrhundert, das selbst wiederum aus dem Strambotto, einer im 15. Jahrhundert beliebten StegreifForm des Lautenlieds, hervorgegangen war.
SPOTT IM DIALEKT
Der Erfolg der Villanella – der vielleicht einzigen musikalischen Gattung, die in Neapel vor der Opera buffa erfunden wurde – verdankt sich seit den 1550ern vor allem der Verwendung des neapolitanischen Dialekts, um das elaborierte Madrigal und seine Konventionen auf die Schaufel zu nehmen. Die Villanella fand Eingang in viele musikalische Gattungen und tauchte an den kuriosesten Stellen auf: in den geistlichen Dramen, die in den Konservatorien aufgeführt wurden, in Kammerkantaten und in der Oper.

Die einzige erhaltene komische Oper des Komponisten Leonardo Vinci, »Li zite ’ngalera« (1722), beginnt tatsächlich mit einer Villanella.
Der neapolitanische Dialekt war ein Aspekt der Tradition der Commedia dell’arte, der in die Opera buffa, die komische Oper überging und einen unverwechselbaren neapolitanischen Stil begründete. Zeitgenössische Quellen liefern wertvolle Beschreibungen der Art und Weise, wie Opern zu jener Zeit in Neapel aufgeführt wurden, und geben auch über die wechselseitigen Einflüsse zwischen Komödie, geistlichem Oratorium und heroischer Oper Auskunft. Giulia de Caro, Sängerin und von 1673 bis 1675 Leiterin des Teatro San Bartolomeo, des ersten Opernhauses in Neapel, hatte ihre Karriere in der Commedia dell’arte begonnen – ebenso wie schon ihre ImpresariaVorgängerin, die Schauspielerin Cecilia Siri Chigi.
Für die Opera buffa des 18. Jahrhunderts übrigens, in der sich ein volkstümlicher Aspekt auch im Einsatz bestimmter assoziierter Instrumente wie der Hirtenflöte Zampogna oder der süditalienischen Laute Colascione
prägen
manifestierte, geriet dieses Festhalten am neapolitanischen Dialekt später zu entschiedenem Nachteil, wurde ihre Verbreitung nach Norditalien oder gar ins Ausland dadurch doch erheblich erschwert.
Noch heute am aufschlussreichsten für die unverwüstliche stilistische Ambiguität neapolitanischer Musikalität sind die beeindruckenden religiösen Feste und Prozessionen wie der Kult der Madonna dell’Arco. Er ist in der gesamten Provinz und in der Stadt Neapel verbreitet und wird von etwa 150.000 Anhängern verfolgt, die jedes Jahr am Ostermontag an der Wallfahrt in das Santuario della Madonna dell’Arco in Sant’Anastasia teilnehmen. Ferner beteiligen sich rund 30.000 battenti, die in den Monaten vor dem eigentlichen Fest einen Zyklus außerkirchlicher öffentlicher Riten abhalten.
Getragen wird der Kult überwiegend von den ärmeren und ärmsten Teilen der Bevölkerung Neapels, das aktuell eine Arbeitslosenquote von über zwanzig Prozent aufweist. Zu den rituellen Praktiken gehören die questue, eine rituelle Form des Bettelns, und die funzione, bei der die Verehrer der Jungfrau Maria eine öffentliche Huldigung auf der Straße darbringen, die streng kodifizierten choreografischen Abläufen folgt.
Insbesondere diese funzione findet in Anwesenheit einer Musikkapelle statt, der divisione musicale, die das Ritual und die koordinierten Aktionen der battenti begleitet. Die funzioniare werden von mehr als 600 kultischen Vereinigungen organisiert und durchgeführt, die in verschiedenen neapolitanischen Stadtvierteln und Provinzstädten angesiedelt sind und ihre eigenen Rituale fast völlig unabhängig voneinander planen. Diese Umstände sowie die Verpflichtung zu einem rituellen Zeitplan erlauben eine grobe Schätzung der Anzahl der Mitwirkenden: Wenn man bedenkt, dass jede »Abteilung« aus fünf bis zwanzig Musikern besteht, könnte man sagen, dass sich an diesem Großevent mehr als 1.000 Musiker in der gesamten Provinz Neapel beteiligen.
Ein Teil ihres Repertoires gehört zum komponierten Standardrepertoire aller Prozessionen und anderer Riten, bei denen Kapellen in Süditalien nicht wegzudenken sind, beispielsweise populäre religiöse Hymnen wie »Noi vogliam Dio«, »O Maria, quanto sei bella«, »Mira il tuo
popolo, bella Signora« oder lokal bekannte Lieder wie die den regionalen Schutzheiligen gewidmeten Gesänge. Hinzukommen aber sehr unterschiedliche Stücke, die zusammen mit den traditionellen Nummern aufgeführt werden, etwa Adaptionen von Filmmusik oder Popsongs, die wiederum die musikalische Sozialisation der überwiegend jungen Bandmitglieder (zwischen 14 und 20 Jahren!) reflektieren.
NICHTS IST TABU
Ein anderes Beispiel sind die Feste dei Gigli, öffentliche Festveranstaltungen, die jeden Sommer in vielen Städten der Provinz Neapel und in einigen Gebieten des Hinterlandes stattfinden. Die formalen und ästhetischen Merkmale sowie die Praktiken der verschiedenen Feste ähneln einander stark und folgen getreu dem Modell von Nola, das am längsten besteht und am weitesten verbreitet ist. Die Festa dei Gigli in Nola, immaterielles Kulturerbe der UNESCO, feiert den Heiligen Paolino di Nola und seine Heimkehr nach langer Gefangenschaft im vierten Jahrhundert. Der andächtige Charakter der Veranstaltung dient heute jedoch als Hintergrund für ein aufsehenerregendes und unterhaltsames Spektakel: Das Fest besteht aus einem 24stündigen Umzug, der am Sonntag nach der Sommersonnenwende stattfindet und dem mehrere Veranstaltungen in den Monaten zuvor vorausgehen. Während der Parade werden imposante, bis zu 25 Meter hohe Architekturen, die gigli, von etwa hundert Trägern, den paranze, auf Schultern durch die Straßen der Stadt getragen. Wo eine Gruppe von Menschen ein solches Bauwerk dergestalt mit Leibeskräften bewegt, wird von den Trägern naturgemäß ein hohes Maß an Koordination und Konzentration verlangt. Für Sicherheit und Effektivität garantieren hierbei auf den transportierten gigli positionierte Ensembles, die den Fortgang rhythmisch stabilisieren. ›
Rhythmische Stabilisatoren: Kapelle auf einem Giglio in Nola (um 1965)


Atemberaubendes Spektakel: die Festa dei Gigli auf der Piazza Duomo in Nola
Die Festa dei Gigli weist bemerkenswerte Besonderheiten auf, die sie deutlich von ähnlichen Veranstaltungen unterscheidet, etwa die an der Parade beteiligten Ensembles. Obwohl bis in die 1980erJahre hinein Bläser und Schlagzeuggruppen auf den gigli spielten, ist die Anzahl der Trompeten und Saxofone heute auf ein oder zwei Stück geschrumpft und andere typische Instrumente der Bands wie Klarinetten und Posaunen wurden entfernt, während die in der Popmusik üblichen EGitarren, EBässe und Keyboards hinzugekommen sind und nun über imposante Beschallungsanlagen ertönen, die tatsächlich auf dem giglio aufgebaut sind und von Generatoren gespeist werden. Das einzige Element, das von den »traditionellen« Bands übernommen wurde, ist ein Schlagzeug.
Die großen Diskontinuitäten in der Spielweise der Musiker entsprechen den radikalen Neuerungen des Repertoires, das während der Parade aufgeführt wird. Jedes Jahr kommen neue, eigens geschriebene und orchestrierte Kompositionen hinzu. Sie folgen den spezifischen Erfordernissen der verschiedenen Phasen des giglioTransports und weisen jeweils bestimmte rhythmische Muster auf, die die koordinierten Bewegungen der paranze erleichtern. Doch bilden sie nur einen eher kleinen Teil der gesamten Parademusik. Die meiste Zeit über erklingen lange Medleys, die Liedausschnitte unterschiedlicher Herkunft enthalten: TV und ZeichentrickTitelmelodien, Jingles, Soundtracks, Themen aus Pop, Jazz, Disco, Funk – nichts ist tabu.
EIN LIED GEHT UM DIE WELT
Wussten Sie eigentlich, dass die berühmteste Canzone napoletana, »’O sole mio«, gar nicht in Neapel, sondern in einer politisch heute sehr prekären Gegend entstanden ist? Der Komponist Eduardo Di Capua befand sich 1898 mit dem Neapolitanischen Staatsorchester auf Tournee. Eines Nachts in der zu dieser Zeit südrussischen –heute (noch?) ukrainischen – Hafenstadt Odessa konnte Di Capua der Kälte und seines Heimwehs wegen nicht schlafen. Als am Morgen die Sonne aufging und durch das Hotelzimmer schien, kam ihm die Melodie zu »’O sole
Pop, Jazz, Disco, Funk: Instrumente und Repertoire der Gigli-Kapellen gehen mit der Zeit

Heimweh und Kälte am Schwarzen Meer inspirierten die berühmteste Canzone napoletana.
mio« in den Sinn. Di Capua unterlegte sie mit Versen des neapolitanischen Dichters Giovanni Capurro. »’O sole mio« ist also ungeachtet seines fernen Entstehungsorts ein neapolitanisches Volkslied, das in der Interpretation von so volksnahen Repräsentanten der Hochkultur wie Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Fritz Wunderlich oder Luciano Pavarotti um die Welt gehen sollte.
Di Capua schuf auch das berühmte Lied »O, Marie« und starb wie Capurro verarmt, weil es seinerzeit noch kein Urheberrecht, mithin keine entsprechenden Tantiemen gab. Die Rechte seines Welthits hatte das Autorenduo einst für 25 Lire an einen Verlag verkauft. Dieser – aus Sicht der Schöpfer jedenfalls – bitteren Erfolgsgeschichte ist es aber nicht zuletzt zu danken, dass es heute fast überall ein bisschen Neapel gibt.
VIVA NAPOLI
LEONARDO VINCI
Do, 21.11.2024 | 20 Uhr
Laeiszhalle Großer Saal arsenale Sonoro Francesca aspromonte, Nicolò Balducci, Sonia Prina, Mauro Borgioni (Gesang)
Boris Begelman (Violine und leitung)
leonardo Vinci: Oratorio per la Madonna del Rosario (um 1723)
NAPOLI ARAGONESE
Fr, 22.11.2024 | 19 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal Ensemble Micrologus Werke aus der Blütezeit höfischer Musik im Neapel des 15. Jahrhunderts
ENZO AVITABILE
Fr, 22.11.2024 | 21 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
Enzo avitabile (Saxofon, Gesang) i Bottari di Portico Neapolitanische Festmusik mit Holztrommeln und Bläsern
ARS NOVA NAPOLI
Sa, 23.11.2024 | 20:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
Ensemble ars Nova Napoli »E senza acqua la terra more« – traditionelle neapolitanische Musik
FLO
So, 24.11.2024 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal Flo (Gesang) Federico luongo (Gitarre) Francesco Di Cristofaro (Bouzuki, akkordeon, Flöten) »Canzoni di sale« – neapolitanischer Folk
24.8. 18.9.2024
Eröffnungskonzerte
São Paulo Symphony Orchestra / São Paulo Big Band
Thierry Fischer / Daniel D’Alcântara
Oslo Philharmonic
Klaus Mäkelä
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
Sir Simon Rattle
Berliner Philharmoniker
Jonathan Nott / Kirill Petrenko
Wiener Philharmoniker
Christian Thielemann
und viele weitere Gastorchester, Ensembles und Solist*innen

Cat Power hat Dämonen bekämpft und Vorbilder gefeiert. Nun spielt sie ein denkwürdiges Bob-DylanKonzert eins zu eins nach –schnörkellos und ohne Ego.
VON JAN PAERSCH
England in den sehr frühen Sechzigern. Die Stones eifern Bo Diddley nach, die Fab Four Ray Charles, und beide Bands vergöttern Chuck Berry.
Die Erfolgsgeschichten der Beatles und der Rolling Stones hätte es, da sind sich die Experten einig, so nicht gegeben, hätten diese britischen Jungspunde sich nicht kräftig aus der randgefüllten Schatztruhe des schwarzen Rock’n’Roll made in USA bedient.
Die Tricks der Vorbilder studieren, die eigenen Fähigkeiten verbessern, indem man die Werke der Großen nachschrammelt, an ihnen herumprobiert – diese Praxis ist so alt wie die ersten Saiteninstrumente. Aber im letzten Jahrhundert nahm sie ganz neue Formen an, auch in den Vereinigten Staaten.
Zum einen ist da ein junger Mann namens Robert Allen Zimmerman. In den Jahren, bevor er seinen Namen in Bob Dylan ändern wird, leiht er sich, so oft es geht, von Freunden LPs mit Folksongs und Traditionals aus; er spielt diese Musik in den dunklen Bars und muffigen
Kaffeehäusern von New York City. Der Mann, dem viel später für seine eigene Kunst der LiteraturNobelpreis verliehen werden sollte, wagt sich 1961 in keine GreenwichVillageSpelunke, ohne dort jahrzehntealte Bluessongs zu verkrächzen. Bukka White, Blind Lemon Jefferson, Woody Guthrie sind seine Idole.
Zum anderen – gewagter Sprung – lebt in den späten Neunzigern in derselben Stadt eine Frau namens Chan Marshall. Sie hat gerade »Moon Pix« veröffentlicht, ein bemerkenswertes Album, das sie auf dem Höhepunkt ihrer Kunst zeigt. Nun arbeitet sie, obwohl ihre eigenen Songs gut aufgenommen werden, an einer neuen Platte, die ausschließlich Coversongs enthält – dazu gleich mehr.
Seit ihrer Ankunft in New York City 1992 ist Marshall ständig unterwegs, raucht viel, trinkt viel. Mal sind ihre Haare militärisch kurz geschoren, dann trägt sie sie wieder lang, dazu kajalschwarze smoky eyes. Und diese leicht raspelige, tiefe Stimme! Ihre Songs klingen, als seien sie »im Mondlicht auf einer wackeligen Veranda im tiefen Süden während einer ›Dunklen Nacht der Seele‹ entstanden«, so beschreibt das ihre Biografin, den spanischen Mystiker Johannes vom Kreuz zitierend. Auch Chan Marshall nimmt einen Künstlernamen an. Bei einem Konzert sieht sie einen Mann mit einer Kappe des Maschinenbauunternehmens Caterpillar: »Cat Diesel Power«. Von nun an nennt sie sich Cat Power.
Charlyn Marshall wurde 1972 in Atlanta geboren und verbrachte ihre Kindheit in verschiedenen Südstaaten. Manchmal liest man, das Mädchen sei bei der Großmutter aufgewachsen, weil ihre »HippieEltern« mit dem Baby überfordert gewesen seien – die Wahrheit dürfte komplizierter sein. Die Bezugspersonen in ihrer Kindheit haben offenbar häufig gewechselt. Prägende Figuren sind neben der Oma auch ihr Stiefvater mit seiner großen Plattensammlung. Die Mutter liebt David Bowies Kunstfigur Ziggy Stardust so sehr, dass sie sich »Ziggy« nennt und die Haare rot färbt; der Vater singt in einer Band. Er besitzt auch einen Stutzflügel, den Chan nicht berühren darf – sie tut es dennoch, heimlich. Mit 16 kauft sie sich eine Silvertone EGitarre. Das Instrument steht jahrelang ungenutzt in der Zimmerecke. »Ständig versprachen irgendwelche Typen, dass sie es mir beibringen würden, und nach ein paar Jahren sollte ich dann halbwegs passabel spielen können«, erinnerte sich Marshall in einem Interview. »Eines Nachmittags nahm ich das Ding dann selbst in die Hand und dachte mir: ›Das ist echt nicht so schwer.‹«
Sie zieht von zu Hause aus, treibt sich in der Punkund Experimentalszene von Atlanta herum. Ein Umfeld mit schlechtem Einfluss, nüchtern ist sie selten. »Alkohol war ein Teil meiner Erziehung«, gibt sie später in typischer Freimütigkeit zu Protokoll. »Als ich 1992 nach New York City kam, hatte ich das Gefühl, etwas überlebt zu haben.«
Drei Jahre später nimmt Cat Power in Chinatown ihre ersten drei Alben quasi in einem Rutsch auf, die Kritik lobt ihr raues LoFiSongwriting. Dann kommt das vierte Album. »Moon Pix« entsteht zum Teil nach den Erfahrungen einer psychotischen Episode; die Künstlerin ist psychisch so angeschlagen, dass sie nach Australien flieht und dort in ein Tonstudio geht. »Mir war gar nicht klar, dass andere Künstler keine Songs schreiben, die derart persönlich sind. Das wusste ich einfach nicht«, kommentierte sie später. »Das Album hat mich als sehr verwirrten jungen Menschen geheilt.«
»Moon Pix« zeigt eine Verwundbarkeit und Rohheit, wie sie im PopBusiness selten sind. Zumal von Frauen wird in den Neunzigern Anderes erwartet; Ähnliches kennt man nur von PJ Harvey. Kritikern gilt die Platte bis heute als Cat Powers Opus magnum. Die Lobeshymnen bekommen der Künstlerin keineswegs gut. »Von den ersten Konzerten an war ich nie wirklich präsent, ich hatte immer irgendetwas im Blut. Ich fühlte mich in meinem Körper nicht wohl, hatte Depressionen.«
Am Ende des Jahrzehnts traut sie sich nur noch auf die Bühne, wenn sie Scotch und angsthemmende Tabletten intus hat. Cat Power spielt SoloKonzerte und lässt dazu einen Stummfilm laufen, um von sich abzulenken. Ihr Repertoire besteht ausschließlich aus Coverversionen: von den Stones, von Velvet Underground, von Bob Dylan.
Die SongwritingKünste ihrer Vorbilder sind im doppelten Sinne Cat Powers Rettung: Sie bauen ihr kaputtes Selbstwertgefühl auf, und sie helfen ihr, den nächsten ›

Bob Dylan ist bei Cat Power immer präsent. Zum Glück übertreibt sie es nicht mit der Werktreue.
Karriereschritt zu setzen: »The Covers Record« erscheint im Jahr 2000. Es ist bis heute ihr erfolgreichstes Album, zumindest im Streaming, und ihr erstes von mehreren Alben ausschließlich mit Fremdrepertoire. Bob Dylan istimmer präsent, selbst in ihren eigenen Songs: »Song to Bobby« ist eine unverhohlene Liebeserklärung an den großen Singer/Songwriter: »I wanna tell you / I’ve always wanted to tell you / But I never had the chance to say / What I feel in my heart from the beginning til my dying day.«
»Ich hatte nie einen Lieblingskünstler, abgesehen von Bob«, erklärte sie einmal in einem Interview. Nie zuvor habe sie einen Mann gehört, der so beschützend über Frauen singt. Mit 23 ist Cat Power auf Tour in England, raucht in London vor der Royal Albert Hall eine Zigarette und stellt sich vor, dass Dylan auftaucht und sie mit hinein nimmt. Fast 30 Jahre später bekommt die Künstlerin einen Anruf: Innerhalb kürzester Zeit muss sie sich entscheiden, ob sie selbst in dem ehrwürdigen Konzertsaal spielen will. »Fuck, yeah! Aber nur Dylan!«, sei ihr erster Impuls gewesen. »Lasst uns etwas Schönes, Elegantes machen. Keine Improvisation, keine verdammte Dekonstruktion. Lasst es uns echt und einfach machen.«
Cat Power und ihre sechsköpfige Band planen etwas Ungewöhnliches: die Wiederaufführung eines kompletten Konzerts, Song für Song. Es geht um Bob Dylans »Royal Albert Hall Concert – May 27, 1966«, das seinen Namen aufgrund eines falsch beschrifteten Bootlegsbekam (der zunächst schwarz herausgebrachte Livemitschnitt stammt tatsächlich von dem Auftritt in Manchester zehn Tage zuvor und wurde bereits 1998 auch offiziell veröffentlicht, allerdings unter dem gewohnten »falschen« Namen). Es ist ein legendäres Konzert, weil Dylan hier erstmals an der EGitarre zu hören war und dafür von Teilen des Publikums ausgebuht wurde.
Im November 2022 ist es soweit, Cat Power spielt in der Royal Albert Hall das denkwürdige Konzert nach, alle 15 Songs von damals, in derselben Reihenfolge und wie einst allesamt doppelt: im ersten Set akustisch, im zweiten dann elektrisch. Sogar der berühmte »Judas«Zwischenruf, der Dylan ereilte, weil er mit den puristischen Traditionen der Folk Music gebrochen hatte, ist aus dem Publikum zu hören.
Ende 2023 erscheint die CatPowerVersion auch als Album: »Cat Power Sings Dylan«. Zum Glück übertreibt sie es darauf nicht mit der Werktreue. Dylans »She

Belongs to Me« singt sie – eine echte Selbstermächtigungsgeste – nicht in der dritten Person, sondern aus der IchPerspektive: »I’ve got everything I need / I’m an artist / don’t look back.« Und das MundharmonikaSpiel des damals 24jährigen Dylan wirkt geradezu dürftig im Vergleich mit Cat Powers tiefempfundenem, bluesigem Howl. Dazu faucht die HammondOrgel, jault die Gitarre auf.
Und dann ist da ihre Stimme. Charakteristisch tief und rau, fast brüchig, jeder Ton sitzt, ganz anders als beim Original. Dennoch lässt Cat Power keine Kritik an der Gesangsperformance von His Bobness gelten: »Ich liebe den Kerl einfach. Wenn ich seine Songs höre, fällt mir nie auf, dass seine Stimme irgendwie schlecht klingt. Mir fällt auf, dass seine Texte Spaß machen.«
Seit 2023 ist Cat Power weitgehend nüchtern. Fast das ganze Jahr 2024 wird sie auf Tour verbringen und dabei nichts als Dylan spielen. Dabei braucht sie längst keine Vorbilder mehr, um ihr Ego aufzubessern. »Mir war es wichtig, dass ich mich selbst nicht in den Vordergrund stelle. Ich will mich in erster Linie Bob nahe fühlen.«
CAT POWER SINGS DYLAN
Sa, 24.8.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
Cat Power (Gesang), Henry Munson (Gitarre), adeline Jasso (Gitarre), Chris Joyner (Klavier), Jordan Summers (Orgel), Erk Paporazi (Bass), Josh adams (Schlagzeug) »the 1966 Royal albert Hall Concert«

Freuen Sie sich auf einzigartige Konzert-Pakete der Saison 2024/2025 in der Elbphilharmonie! Das erwartet Sie:
Zwei Übernachtungen inklusive Frühstück im Louis C. Jacob Transfer zum CARLS an der Elbphilharmonie Dinner im CARLS an der Elbphilharmonie inklusive Aperitif, begleitende Weine und Wasser Karte der PK 1 für ein ausgewähltes Konzert in der Elbphilharmonie Rückfahrt zum Hotel mit der MS Jacob bei Käse und Wein

Sichern Sie sich jetzt die besten Plätze! Sie finden all unsere Elbphilharmonie-Pakete auf unserer Website.
hotel-jacob.de


Der Musiker und Projektentwickler Kian Jazdi weiß genau, wofür er sich in der Elbphilharmonie engagiert.
Seit 2021 arbeite ich für die CommunityProjekte der Elbphilharmonie. Ich werde als Freelancer gebucht und entwickle dann gemeinsam mit dem EducationTeam des Hauses die Projekte. Zuletzt fand etwa die AbschlussPerformance des Projekts »Imagine Freedom« in Kooperation mit Lukulule und der Regisseurin Mable Preach statt, bei der kreative Menschen zwischen 16 und 30 Jahren mit Schauspiel, Tanz, Gesang und Musik die Ergebnisse eines mehrmonatigen Workshops zum Thema »Freiheit« präsentierten und dabei über sich hinauswuchsen. Das war für mich institutionsübergreifend eines der gelungensten CommunityProjekte, an denen ich jemals mitgearbeitet habe. Es ist immer wieder spannend und berührend zu sehen, wie Menschen, die zuvor noch nie auf einer Bühne gestanden und manchmal auch noch keine Veranstaltung in der Elbphilharmonie besucht haben, sich nach und nach mit dem Haus verbunden fühlen und sich schließlich ganz natürlich und selbstbewusst durch die Räume bewegen.
Ich arbeite im DACHRaum für Kulturinstitutionen und die freie Szene als Musiker und Projektentwickler, bin Mitglied des Fachbeirats des netzwerk junge ohren und unterrichte an der Universität für Darstellende Kunst und Musik in Wien. Ich schaue immer, was ich beitragen kann, um einen kreativen Erneuerungsprozess anzustoßen, dem ein Kulturbetrieb verpflichtet ist. Essenziell dafür sind das Wagnis, das Unerprobte, das Mutige – überhaupt ist mir Mut als Qualität in Projekten und der Konzertgestaltung sehr wichtig. Auch wenn etwas mal nicht hundertprozentig aufgeht, kann ich das honorieren.
In diesem Zusammenhang fällt mir der Begriff »Integration« ein, integratio heißt unter anderem Erneuerung. Was ich mache, ist integrativ, und zwar nicht nur bezogen auf eine vielfältige Gesellschaft, sondern auch auf Kunstformen und Repräsentationsfragen. Ich finde, in derxElbphilharmonie bestehen eine große Offenheit und echtes Interesse am Wandel, an neuen Programmideen und Formaten, gleichzeitig wird auch das Tradierte gepflegt. Beides hat seine Berechtigung und besteht nebeneinander – in einer Qualität und Strahlkraft, die über die Stadt und die Region weit hinauswirken.
Ich suche ständig nach neuen Verbindungen zwischen Kunstformen, Musiken, Kulturen, Orten und Menschen. Derzeit etwa beim »Liedstadt«Festival, dessen künstlerische Leitung ich mir mit der Artdirektorin Catherine Pisaroni und dem Tenor Julian Prégardien teile. Die erste Ausgabe
wird vom 3. bis zum 13. Oktober an den unterschiedlichsten Orten in Hamburg stattfinden.
Das Lied ist die Gattung, die mich als Jugendlichen in den Klassikkosmos hineingesogen hat. Ich liebe diese Kunstform: seine Dichte, seine Aura, die Intimität. Es fasziniert mich, dass verschiedene Kulturen in ihren Liedern die gleichen Themen behandeln. Der traditionelle Liederabend hat seine Berechtigung und seinen Glanz. Ich habe aber den Eindruck, es bedarf umfassender Vorkenntnisse, um ihn genießen zu können. Wir wollen Menschen fürs Lied begeistern, indem wir weitere Präsentationsformen anbieten, zum Beispiel die Konzerte moderieren, kostenlose Konzerte veranstalten, Licht mit einbeziehen und außereuropäisches Lied oder Popsongs ins Festivalprogramm integrieren.
Ich frage mich oft, wie ich zu dem gekommen bin, was ich mache, denn Kultur hatte in meiner Familie keinen dezidierten Stellenwert. Natürlich gibt es bei den Themen, die ich behandle, biografische Bezüge. Meine Mutter leitet das Kinderschutzzentrum in Stuttgart und war in der Asyl und Frauenhilfe tätig. Mein Vater ist ein geflüchteter Iraner. Migrationsfragen sind in meiner Familie omnipräsent. Ohne es zu realisieren, wurde ich schon früh mit sozialpolitischen Fragen konfrontiert. Eine Rolle spielt sicherlich auch, dass ich erst in meinen Zwanzigern den klassischen Kulturbetrieb kennengelernt und mich in ihn »reingefuchst« habe. Ich kann gut nachvollziehen, wenn Menschen zunächst denken, das geht mich doch nichts an, und sich erst allmählich oder auch gar nicht darauf einlassen können. Aber vielleicht lernen sie irgendwann zu schätzen, was da mit ihnen passiert.
Anfangs empfand ich große Ehrfurcht vor der Elbphilharmonie, sie strahlte für mich eine große Erhabenheit aus. Der Moment, als ich das erste Mal über den Künstlereingang das Haus betreten habe, hat mich schon bewegt. Wenn du dann aber das Haus von innen kennenlernst, fühlst du dich willkommen und verlierst die Scheu. Ich schätze die HausKultur sehr, den professionellen und zuvorkommenden Umgang, den das ElbphilharmonieTeam auszeichnet.
AUFGEZEICHNET VON CLAUDIA SCHILLER FOTO GESCHE JÄGER

Marc Ribot vereint in sich die Rohheit des Punk, die Cleverness des Jazz und die Sensibilität eines Künstlers, den das Leben nicht glattzuschleifen vermochte.
VON TOM R. SCHULZ
Seine Spieltechnik ist zum Niederknien, auch das musiktheoretische Rüstzeug hat er voll drauf. Die Finger seiner Linken laufen wie ferngesteuert und dennoch zielbewusst übers Griffbrett. In der Rechten hält er kein Plektrum, sondern er versetzt die Saiten mit den bloßen Fingern in Schwingung, auch mit dem Daumen, wie ein Konzertgitarrist. Das macht auf der EGitarre fast niemand. Auch wenn er damit rekordverdächtige Geschwindigkeiten erreicht, bringt nichts ihn ins Schwitzen.
Matteo Mancuso, 27 Jahre alt, Sohn eines Gitarristen aus Palermo, ist derzeit das Phänomen schlechthin in der Welt der schwirrenden sechs Saiten, und die ist seit mindestens sechzig Jahren wahrlich dicht bevölkert von außergewöhnlichen Spielern, zunehmend auch von Spielerinnen. Der Rockgitarrist Steve Vai nennt Mancuso die Zukunft der elektrischen Gitarre. Auch andere namhafte Profis schwärmen von ihm als der neuen Offenbarung. Sogar Al Di Meola, der von der eigenen Grandiosität stets restlos überzeugte Hypervirtuose des Fusionjazz.
Seine Technik dagegen sieht nach Arbeit aus. Marc Ribot, 42 Jahre älter als Mancuso, ringt noch heute um jeden Ton, den er artikuliert. Coolness, gar Eleganz beim Spiel? Kümmert ihn nicht. Dafür bringt der Großmeister der Noise Music, der viel im Sitzen spielt, seinen Kopf oft so nah an den Korpus des Instruments, dass die Grenze zwischen beiden manchmal zu verschwimmen scheint. Auch und gerade Töne, die schief und krumm klingen, haut er voller Absicht und mit Wucht raus. Überhaupt, was sind schon richtige Töne? Richtige Töne, sagt Marc Ribot in einem schönen Film, den eine französische Regisseurin über
ihn gedreht hat (»La corde perdue«, 2007), das seien fünf Prozent von dem, worauf es beim Spielen ankomme. Die restlichen 95 Prozent seien der semiotische Kontext. Aha. Tempo auf der Gitarre, um Eindruck zu schinden? Wenn er es darauf anlegt, kann er ziemlich schnell sein, aber in einem Rennen gegen Matteo Mancuso wäre er chancenlos. Was ganz egal ist, denn auf einen solchen Wettlauf würde sich Marc Ribot wegen völliger Abwegigkeit desselben sowieso niemals einlassen. Und Mancuso besser auch nicht. Er wäre der Hase, Ribot der Igel. Marc Ribot vereint in sich die Rohheit des Punk, die Cleverness des Jazz, die unbändige Lust an ungefähr fünfzig weiteren Spielarten der Musik und die Sensibilität eines Künstlers, den all die Rauheit des Lebens nicht glattzuschleifen vermochte. Wie bei Mancuso schwingt natürlich auch bei ihm die Geschichte des Instruments mit, aber sein Horizont ist eher »From Hank to Hendrix« aufgespannt, wie Neil Young einmal den seinen umriss.
Ribot beherrscht die Kunst der krachenden Rockgitarre, ohne je ins berüchtigte Gniedeln zu verfallen. Er ist aber auch ein grandioser Minimalist. »La corde perdue« beginnt mit einer Szene aus einem Clubkonzert in Frankreich, wo er als Sologitarrist gastiert. Minutenlang zelebriert er fein austarierten Lärm in Zeitlupe, der einen augenblicklich in seinen Bann zieht. Da entsteht aus ein paar lang gehaltenen und wie zufällig gefundenen Tönen aus gMoll –abgenommen nicht nur über die Tonabnehmer der EGitarre, sondern auch mit einem Kontaktmikrofon, das Ribot in der rechten Hand dicht über den Saiten hält, und klanglich noch intensiviert über ein paar Effektgeräte, die er mit dem Fuß bedient – ein Klang von gewaltiger hypnotischer Kraft. Ein Klang, der wie eine Skulptur aus langsam fließender, immaterieller Lava in den Raum wächst und ihn bis in den letzten Winkel erfüllt. Reine Gegenwartskunst, augenscheinlich frei improvisiert.
Bei anderer Gelegenheit kneten die Finger seiner Linken in einem ausdauernden Kraftakt das Griffbrett, um ihm eine kapriziöse Figur zu entwinden, die nur aus ein paar eckigen, sich wiederholenden Tönen besteht. Dabei wringt er diese paar Töne mit einer knochenbrecherischen Intensität, als gelte es, aus einer schon ausgepressten Zitrone noch den allerletzten Tropfen zu extrahieren.
Bei Marc Ribot kommt nichts weg. Jeder sieht und hört, dass er keine Technikmaschine ist, sondern seine Klänge modelliert, mit groben Klötzen, groben Keilen und vor allem mit einem Gewissen. Beim Spielen benutzt er sowohl ein Plektrum als auch seine Finger, seine ›

Akkordarbeitertechnik gehorcht ihm blind. Ribot ist der vielleicht plastischste Tonerzeuger, den die EGitarre je gesehen hat. Ein Klangbildhauer.
Sieht man Matteo Mancuso spielen, ist man geneigt, das eigene Instrument an den Nagel zu hängen. Der Mann ist technisch so unerreichbar gut. Sieht man Marc Ribot spielen, nimmt man es gleich wieder von der Wand und fühlt sich ermutigt, darauf etwas zu probieren, was man vorher noch nicht gewagt hat. Ribot inspiriert, weil ihm alles GustavGanshafte der technisch so glattpolierten Gitarristen abgeht. Seine Ästhetik ist die einer Armutsmusik, die sich aus dem Dreck erhebt, nicht um es irgendwo irgendwie »zu schaffen«, den Dreck gegen Luxus einzutauschen und sich nie wieder nach der Vergangenheit umzudrehen. Sondern weil die Würde es dem Menschen gebietet, dass er sich aus der Erniedrigung erhebt, aus eigener Kraft. Dass er sich mit den Widerständen nicht abfindet, sondern sie fruchtbar macht, weil es ihm dann besser geht.
»Meine Beziehung zur Gitarre gleicht einem Kampf«, schreibt Ribot in seinem herrlich eigensinnigen Buch »Unstrung«. »Ich zwinge sie dauernd dazu, etwas anderes zu sein – ein Saxofon, ein Schrei, eine Karre, die einen Hügel runterrollt. Manchmal gehorcht sie. Manchmal gebe ich auf und spiele SurfMusik (das wollen sowieso alle EGitarristen). SurfMusik geht in Ordnung, für eine Weile. Aber dann passiert irgendwas, das nach Übersetzung schreit, und dann beginnt alles wieder von vorne … Gitarren macht Kampf nichts aus. Gitarren sind Kampf. Ich habe lange mit Gitarren gelebt. Ich habe sie zurechtgebogen. Und sie mich.«
»Gitarren macht Kampf nichts aus. Gitarren sind Kampf. Ich habe lange mit Gitarren gelebt. Ich habe sie zurechtgebogen. Und sie mich.«
Hätte der Junge aus Orange in New Jersey, dem Bundesstaat gegenüber von New York auf der anderen Seite des Hudson River, nicht einst eine Zahnspange verpasst bekommen, dann hätte er wohl weiter Trompete gespielt. Weil das aber mit Spange nicht möglich ist, fing Marc Ribot als Elfjähriger mit der Gitarre an. Ein Freund der Familie, Frantz Casseus, gab ihm Unterricht, jeden Sonntagmittag, in seiner mit lauter Zeug vollgestopften kleinen Wohnung in Manhattan. Er war der einzige Lehrer, den Ribot je hatte.
Frantz Casseus war 1946 aus Haiti nach New York City gekommen und spielte eine wunderschöne, eigenwillige, komplexe, dabei nicht sehr virtuose Musik, in der er haitianische Folkmelodien und Tanzrhythmen mit Elementen klassischer Musik verband, ähnlich wie Heitor VillaLobos das zuvor mit brasilianischer Musik getan hatte. Der Gipfelpunkt seines Erfolgs in den USA war erreicht, als Harry Belafonte seinen Song »Merci Bon Dieu« coverte. Doch gesundheitliche Probleme und vorenthaltene Verlagsrechte machten ihm schwer zu schaffen.
Marc Ribots Mutter Harriet brachte schließlich Ordnung in Casseus’ Finanzen. Und Ribot selbst sprang für seinen Lehrer in die Bresche, als der wegen einer Sehnenmalaise in den Händen kaum mehr spielen konnte. In Casseus’ letzten Lebensjahren nahm Ribot auf dessen Bitte viel von der Musik für akustische Gitarre auf, die sein Lehrer komponiert hatte. »Obwohl ich bei Herrn Casseus Gitarre studiert hatte«, schreibt Ribot in den Liner notes, »hat mich meine eigene Entwicklung (oder vielleicht meine Rückentwicklung) von diesen Studien ziemlich weit entfernt.«
Tatsächlich hatte Ribot seit den frühen Achtzigern als einer der schillerndsten Repräsentanten der Krachmachermusik New Yorker Provenienz längst Legendenstatus auf einem ästhetisch ganz anderen Feld erreicht. Doch auf dem 2021 neu veröffentlichten und um einige Bonustracks ergänzten Album »Marc Ribot plays solo guitar works by Frantz Casseus« zeichnet der Klangbildhauer Ribot den poetischverspielten Flow der Musik seines Lehrers mit feinem Strich nach, reich an subtilen Zwischentönen und frei von aller Rebellion. Das Album war ein Liebesdienst. Er zeigt viel von der Integrität des Charaktermusikers Marc Ribot, der 2012 gemeinsam mit Alberto Mesirca auch die Notenausgabe vieler Stücke von Casseus besorgte.
EXPERIMENTELL EXTRAVAGANT
Als Marc Ribot so alt war wie Matteo Mancuso heute, mit 27 Jahren, gehörte er zu den Realtones, der Begleitband des SoulStars Solomon Burke und anderer USPopHeroen wie Wilson Pickett und Chuck Berry. Vier Jahre später, 1985, spielte er auf dem Album »Rain Dogs« von Tom Waits eine zentrale Rolle. Schon mit dem Vorgängeralbum »Swordfishtrombones« (1983) hatte sich Waits, für viele der Charles Bukowski des American Song, als Diseur im Stile des Cabaretnoir und experimentell instrumentierter Songs à la Kurt Weill empfohlen und damit die Fans extravaganter Musik entzückt.
In Ribots Buch »Unstrung« kommt Waits nicht vor. Dafür findet sich ein besonders berührendes musikalisches Dokument mit Waits und ihm auf dem großartigen Album
»Songs of Resistance 1942–2018«, mit dem Ribot seiner ohnmächtigen Wut über die Wahl Donald Trumps zum USPräsidenten wenigstens die Macht politischer Widerstandslieder entgegensetzen wollte. Zartbesaiteten kann es durchaus die Tränen in die Augen treiben, wie Waits da mit seinem arg schütter gewordenen Kämpferorgan, ungeschönt von jeder tontechnischen Kosmetik, das alte Partisanenlied »Bella Ciao« intoniert, zu sparsam arrangierten Klängen auf der Gitarre, dem Banjo und der Mundharmonika.
»Ribot schreibt und spielt freilaufende Musik. Er unterdrückt keinen einzigen seiner musikalischen Impulse, lässt aber auch niemals einen einzelnen Instinkt allein das Steuer übernehmen. Man könnte sagen, dass sein Humor sehr hohen moralischen Standards genügt.« Diese Charakterisierung verdankt Marc Ribot einem Wahlverwandten, dem Gitarristen und Sänger Arto Lindsay, der mit seinen splitterscharfen GlasbruchSounds auf der EGitarre noch viel intellektueller und dekonstruktivistischer zu Werke geht als Ribot selbst, dafür aber mit glockenheller Tenorstimme schönste, zarteste BossaSongs singt. Der »hohe moralische Standard« von Ribots Humor, auch sein besonderer Witz, haben gewiss auch mit seiner jüdischen Herkunft zu tun. Ein Urgroßvater sei Rabbi in einer Kleinstadt nahe Minsk in Belarus gewesen, berichtet Ribot, und »meine Großeltern haben Brüder, Schwestern, Cousins und Cousinen, Onkel und Tanten im Holocaust verloren«. Seine jüdische Identität lebt Marc Ribot nicht orthodox aus, aber doch sehr bewusst.


So war er eine der prägenden Figuren der Radical Jewish Culture, einer Kunstbewegung im New York der Neunzigerjahre, deren Aktionszentrum die Knitting Factory in der Lower East Side und deren Galionsfigur der Saxofonist John Zorn war. Zum illustren Kosmos der ZornMusiker gehört Ribot weiterhin. Unvergessen, wie er bei dessen »BagatellesMarathon« wenige Wochen nach Eröffnung der Elbphilharmonie im März 2017 unter dem ekstatischen Dirigat des Komponisten, der ihm förmlich beinahe auf dem Schoß saß, einige der scharfkantigen Zorn’schen Musikminiaturen aus seiner Gitarre meißelte.
UNBERECHENBAR UND UNANGEPASST
Wandlungsfähig sein und doch unverwechselbar bleiben –in dieser ästhetischen Disziplin brillieren auch Ribots Reisegefährten auf seinem »Reflektor«Abenteuer in der Elbphilharmonie. Mit einigen von ihnen ist er seit Jahrzehnten verbunden. So hat er hat extra für dieses Festival seine legendären Bands Rootless Cosmopolitans und Los Cubanos Postizos revitalisiert. In beiden spielt wie vor 30 Jahren Anthony Coleman Keyboards, der ein sehr eigenes Terrain zwischen Abstraktion, Blues und Groove bestellt, ein nicht nur musikalisch eminent kluger RibotKampfgenosse aus den Tagen der Radical Jewish Culture
Die beiden Schlagzeuger Ches Smith und Chad Jones, gleich in vier Bands des »Reflektors« zu hören, sind wahre Wunderwesen in Sachen Präzision und Unberechenbarkeit. Der Bassist und Elektronikmusiker Shahzad Ismaily unterläuft mit Ideenreichtum und mysteriösen Klangerfindungen alle Erwartungen an die herkömmliche Rolle eines Begleiters. Mit Tomeka Reid, Mary Halvorson und Silvia Bolognesi bringt Ribot auch drei starke Improvisatorinnen mit nach Hamburg. Sie alle dürften die Herzen von Menschen, die das Unangepasste lieben und die Disziplin wahrer Freigeister zu schätzen wissen, im Sturm erobern.
Wahre Freigeister: Ceramic Dog
REFLEKTOR MARC RIBOT
CERAMIC DOG
Fr, 15.11.2024 | 19:30 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
Marc Ribot (Gitarre), Shahzad ismaily (Bass), Ches Smith (Schlagzeug)
1. Set: Marc Ribot solo
2. Set: Ceramic Dog »Connection«
MARC RIBOT TRIO / RED LILY QUINTET
Sa, 16.11.2024 | 18 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
Marc Ribot trio: Marc Ribot (Gitarre), Hilliard Greene (Bass), Chad taylor (Schlagzeug)
Red lily Quintet: James Brandon lewis (Saxofon), Kirk Knuffke (trompete), tomeka Reid (Cello), Silvia Bolognesi (Bass), Chad taylor (Schlagzeug)
1. Set: Marc Ribot trio mit James Brandon lewis
2. Set: Red lily Quintet
»For Mahalia, with love«
LOS CUBANOS POSTIZOS
Sa, 16.11.2024 | 21 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
Marc Ribot (Gitarre), anthony Coleman (Keyboards), Brad Jones (Bass), Horacio »El Negro« Hernandez (Schlagzeug),
E. J. Rodriguez (Perkussion) »y los Cubanos Postizos«
THUMBSCREW
So, 17.11.2024 | 17 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
Mary Halvorson (Gitarre), Michael Formanek (Bass), tomas Fujiwara (Schlagzeug) »Multicolored Midnight«
ROOTLESS COSMOPOLITANS
So, 17.11.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Kleiner Saal
Marc Ribot (Gitarre), anthony Coleman (Keyboard), Brad Jones (Bass), Ches Smith (Schlagzeug)
1. Set: »Shadows Choose their Horrors« (Regie: Jennifer todd Reeves, uSa 2005) mit livemusik von Marc Ribot
2. Set: »Rootless Cosmopolitans«

Nutzen Sie die Vorteile eines Abonnements und lassen Sie sich die nächsten Ausgaben direkt nach Hause liefern. Oder verschenken Sie das Magazin-Abo.
3 Ausgaben zum Preis von € 15 ( ausland € 22,50) Preis inklusive MwSt. und Versand
Unter-28-Jahre-Abo: 3 ausgaben zum Preis von € 10 (bitte altersnachweis beifügen)
Jetzt Fan der Elbphilharmonie Facebook-Community werden: www.fb.com / elbphilharmonie.hamburg
Senden Sie uns das ausgefüllte Formular zu:
ELBPHILHARMONIE M a G a Z i N leserservice, Pressup GmbH Postfach 70 13 11, 22013 Hamburg
Oder nutzen Sie eine der folgenden Alternativen: tel: +49 40 386 666 343, Fax: +49 40 386 666 299 E-Mail: leserservice@elbphilharmonie.de internet: www.elbphilharmonie.de
Für wen ist das Abonnement? Für mich selbst Ein Geschenk
Rechnungsanschrift:
Das Abo soll starten mit der aktuellen ausgabe der nächsten ausgabe Name Vorname
Zusatz
Straße / Nr.
E-Mail (erforderlich, wenn Rechnung per E-Mail)
Mit der Zusendung meiner Rechnung per E-Mail bin ich einverstanden.
HamburgMusik gGmbH darf mich per E-Mail über aktuelle Veranstaltungen informieren.
Ggf. abweichende Lieferadresse (z. B. bei Geschenk-Abo):
Zusatz
Straße / Nr.
Jederzeit kündigen nach Mindestfrist: Ein Geschenk-abonnement endet automatisch nach 3 ausgaben, ansonsten verlängert sich das abonnement um weitere 3 ausgaben, kann aber nach dem Bezug der ersten 3 ausgaben jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Ende der verlängerten laufzeit gekündigt werden. Widerrufsrecht: Die Bestellung kann innerhalb von 14 tagen ohne angabe von Gründen in textform (z. B. Brief, Fax oder E-Mail) oder telefonisch widerrufen werden. Die Frist beginnt ab Erhalt des ersten Hefts. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige absendung des Widerrufs (Datum des Poststempels) an: Elbphilharmonie Magazin leserservice, Pressup GmbH, Postfach 70 13 11, 22013 Hamburg tel: +49 40 386 666 343, Fax: +49 40 386 666 299, E-Mail: leserservice@elbphilharmonie.de
Elbphilharmonie Magazin ist eine Publikation der HamburgMusik gGmbH Platz der Deutschen Einheit 4, 20457 Hamburg, Deutschland Geschäftsführer: Christoph Lieben-Seutter (Generalintendant), Jochen Margedant
Zahlungsweise:
Bequem per Bankeinzug Gegen Rechnung
Kontoinhaber
BiC (bitte unbedingt bei Zahlungen aus dem ausland angeben) Geldinstitut
SEPA-Lastschriftmandat: ich ermächtige die HamburgMusik gGmbH bzw. deren beauftragte abo-Verwaltung, die Pressup GmbH, Gläubiger-identifikationsnummer DE32ZZZ00000516888, Zahlungen von meinem Konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der HamburgMusik gGmbH bzw. deren beauftragter abo-Verwaltung, die Pressup GmbH, auf mein Konto gezogenen lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenz wird mir separat mitgeteilt.
Hinweis: ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Die Einzugsermächtigung erlischt automatisch mit ablauf des abonnements.
Eine Frage, sieben Antworten: »Wie klingt der Süden für Sie?«
VON IVANA RAJIC ˇ

»Der Süden klingt für uns nach Fest und Jubel und auch nach Melancholie und Nostalgie, nach einer reichen Palette von Farben und Rhythmen – Reflex einer harmonischen Verbindung von Traditionen und Kulturen«, so formuliert es das Streichquartett Latin Strings. Der EnsembleName ist Programm: 2015 in Lübeck gegründet, widmen sich die vier jungen Musikerinnen und Musiker aus Chile und Venezuela besonders der Musik ihrer Heimat –von traditionellen Tänzen und Musikstilen wie dem Joropo, dem Merengue und der Cueca bis hin zu Werken klassischer Musik.

ALEX NANTE
Überall in der Stadt wird getanzt, und die Musik ist allgegenwärtig: Alex Nante, einer der bedeutendsten lateinamerikanischen Komponisten seiner Generation, ist in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires aufgewachsen – »der Ort, den meine Großeltern wählten, als sie Europa hinter sich ließen und sich der Nostalgie hingaben«, verrät er. Von der pulsierend rhythmischen Chacarera bis hin zu den BagualaGesängen mit ihrem charakteristischen Falsett genießt der 32Jährige »den Klang der schönen Folklore meines Landes«. Dazu gehört natürlich auch der Tango. »Mein Schwiegervater spielt ihn auf der Gitarre. Sein Instrument begleitet alle Familientreffen.« Und wenn Nante der Klangkulisse der 16MillionenMetropole entkommen möchte, fährt er hinaus aufs Land und genießt »die Geräusche der Pampa, die Brise, die die Bäume streichelt, den Klang der Tiere hier und da – besonders den Gesang des ›Tero‹, ein großer Regenpfeifer, der in dieser Region vorkommt.«
»Die klassische oder akademische Musik in Lateinamerika enthält Kompositionselemente der europäischen Klassik, ist aber auch von allen typischen Klängen aus Lateinamerika beeinflusst«, erklären die vier, die gern Werke von Heitor VillaLobos, Alberto Ginastera, Orlando Cardozo, Astor Piazzolla und Arturo Márque aufs Programm setzen und damit ihre »reiche Musiktradition auch in Deutschland und Europa bekannter machen« möchten.

ZUBIN KANGA
Die zeitgenössische Musik Australiens zeichne sich durch vielfältige Klangwelten aus, denn sie sei »ein komplexer Schmelztiegel globaler Musikkulturen«, sagt der Pianist und Komponist Zubin Kanga: »Im letzten Jahrhundert hatten viele Komponisten eine enge Beziehung zu den zeitgenössischen klassischen Traditionen Europas und Nordamerikas. In jüngerer Zeit gibt es immer mehr Komponisten mit Migrationshintergrund, die sich auf die Kultur ihrer Vorfahren stützen, vom indonesischen Gamelan bis hin zur traditionellen Musik der peruanischen Anden. Zurzeit gibt es viele Zusammenarbeiten mit Komponisten und Interpreten der australischen First Nations, die auf ihre eigenen Jahrtausende alten Musikkulturen zurückgreifen.« Und dann gibt es noch solche Komponisten, die den Blick in die Zukunft richten und modernste Technologien für ihre Werke nutzen – wie Kanga selbst, der seinen klassischen Konzertflügel mit vielen TechGadgets verkabelt, um dem Instrument nie gehörte Klänge zu entlocken.
SIOBHAN STAGG
Ihr Vorname mag irisch sein, doch Siobhan Stagg kam im australischen Bundesstaat Victoria zur Welt, dessen Klangkulisse sie immer noch – auch in ihrer Wahlheimat Berlin – begleitet: »Ich wuchs in der südlichen Hemisphäre auf, wo der Soundtrack zur Natur australischer Vogelgesang ist«, erklärt die charismatische Sopranistin. »Lachende Kookaburras, zwitschernde Elstern, heitere Möwen, die sich an FishandChipsEinpackpapier abarbeiten, während die Wellen des Ozeans an den Sandstrand schlagen. Barbecues brutzeln, Klimaanlagen dröhnen, Kinder kichern, Tennisbälle prallen bei den Australian Open auf. Das sind die Geräusche des Sommers in Down Under.« Auch das Konzertleben dort sei mindestens so vielseitig: »Musikalisch hat Australien die Klänge der Welt übernommen«, sagt Stagg. »Vor Konzerten würdigen wir die Indigenen des Landes, das wir unser Zuhause nennen. Die warmen, erdigen Klänge des Didgeridoos und der Clapsticks können ertönen, wenn ein angesehenes Mitglied der First Nations Community ein ›Welcome to Country‹ anstimmt.«

ARUNA SAIRAM
»In der Stadt Chennai, auch bekannt als Madras, in der ich lebe, sind die Straßen immer voller Menschen«, erzählt Aruna Sairam, eine der wichtigsten Stimmen der klassischen indischen Musik. Eine dieser Straßen führt zu einem mehr als tausend Jahre alten Tempel und einer ganz anderen Klangkulisse: »Man hört Tempelglocken, die Gesänge der Priester, die Nadaswaram, ein außergewöhnliches oboenähnliches Instrument, das im Innenhof der Tempel gespielt wird.« Dort – wie auch in klassischen Konzertsälen – erklingt die karnatische Musik Südindiens, die sich aus alten HinduTraditionen entwickelt hat und von der Vokalkünstlerin selbst praktiziert wird. »Diese Klangwelt ist geprägt von virtuosen Verzierungen und Improvisationen«, erklärt die 71Jährige. »Man muss jahrelang üben, um die Grammatik und das Idiom der Musik zu lernen. Gleichzeitig ist sie ein Ausdruck von starken Gefühlen und spirituellen Neigungen. Ich finde es einzigartig, dass eine so virtuose und akademische Musik auch ein Weg zu tiefster Andacht sein kann.«
RAMADU
Egal, ob beim Wetter oder in der Musik: »Für mich geht es im Süden immer um Wärme«, verrät der in Simbabwe aufgewachsene und in Wien lebende Sänger, Songwriter und Produzent Ramadu.
Während die Temperaturen dort (zumindest aus Hamburger Sicht) ganzjährig angenehm sind, zeichnet die Klänge des südlichen Afrika eine extreme Vielfalt aus. »Das hängt von den Provinzen und den verschiedenen Stämmen ab«, erklärt Ramadu. Bei den Shona im Osten Simbabwes seien die metallischen Klänge der Mbira oft zu hören. Im Südwesten bei den Ndebele hingegen dominiere rhythmisch begleiteter Chorgesang. »Die zeitgenössische Musik in Simbabwe ist von all diesen Traditionen inspiriert: Künstler wie Mokoomba aus Victoria Falls sind von den Tonga im Dreiländereck zwischen Simbabwe, Sambia und Botswana geprägt, wir im Süden aber stärker von Südafrika, von der ZuluMusik«. Letztere hat Ramadu in seinem Projekt MoZuluArt mit Mozart fusioniert und dem so »ein wenig Groove« verpasst.



Die Antwort auf die Frage, welchen Klang die Mitglieder des Elbphilharmonie GamelanEnsembles mit dem Süden verbinden, fällt einstimmig aus: das Gamelan natürlich – ein Instrumentarium aus indonesischen Gongs, Trommeln und Metallofonen, das vor Jahrhunderten auf den Inseln Bali und Java entstand und das für Ronald Monem »Helligkeit, Wärme und eine Prise Faszination« ausdrückt. »Der Klang ist mal zart, ätherisch, hypnotisch –um sich im nächsten Moment in eine Welle unbändiger Energie zu verwandeln«, ergänzt Mario DütschWillmann. Xin Wei Thow wiederum studiert die GamelanMusik in Surakarta, Zentraljava, und assoziiert mit ihr auch ein »hektischen Treiben, das tagsüber in den Straßen der Stadt herrscht«. Ähnliche Assoziationen hat der EnsembleLeiter Steven Tanoto, der in NordSumatra aufgewachsen ist. Er denkt an den »Klang hupender Autos ebenso wie an schimpfende Frauen der indigenen Batak auf dem Markt, an Gebetsrufe aus den verschiedenen Moscheen, die sich kontrapunktisch miteinander verzahnen, und die Terzharmonien des Chors in der BatakKirche«.
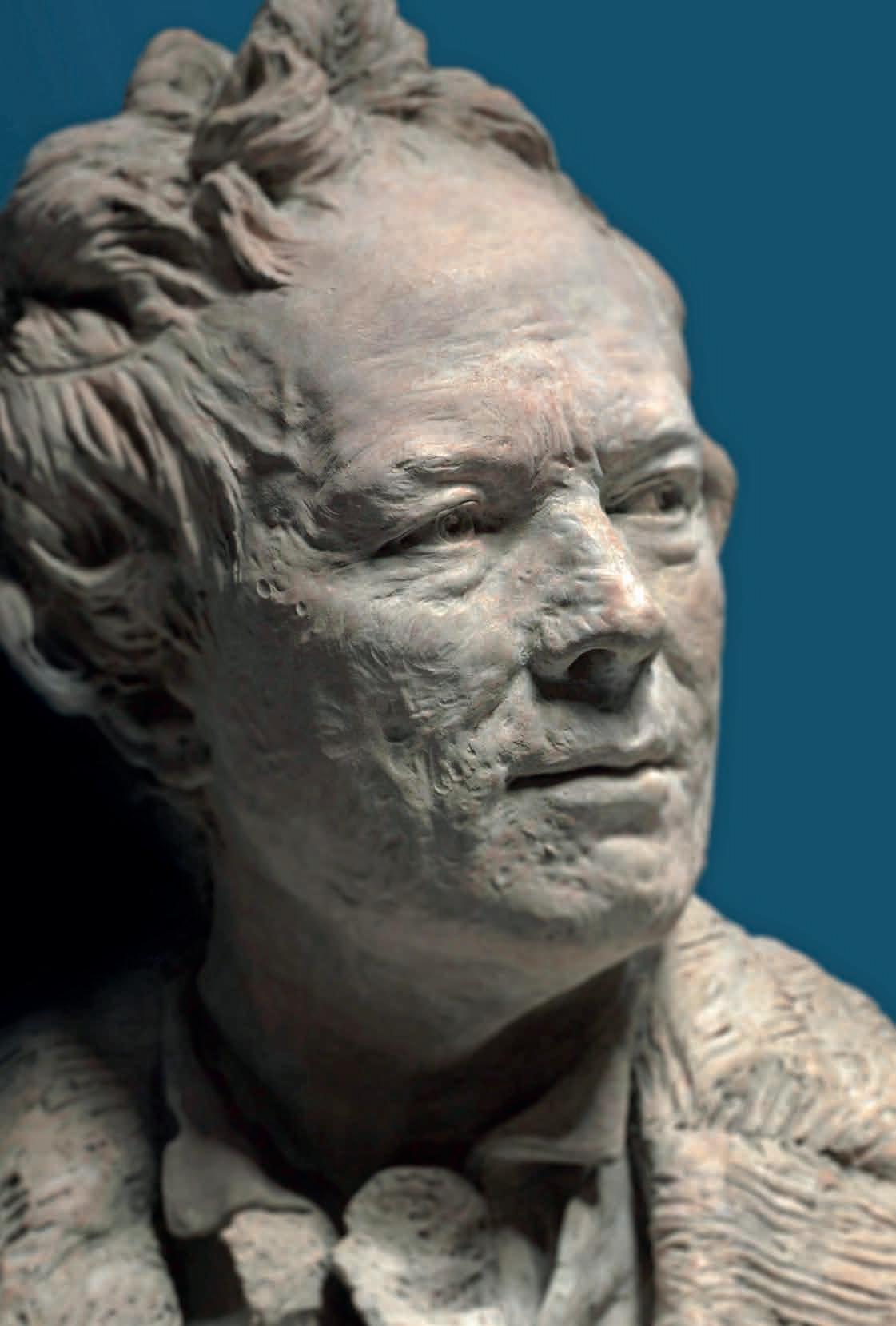
Ohne Perücke, mit Pockennarben: Die Büste von Jean-Antoine Houdon zeigt Gluck ganz privat (um 1775)
Das rasante Leben des Opernreformers Christoph
Willibald Gluck
VON REGINE MÜLLER
Das ehrwürdige Wiener Antiquariat Inlibris hat jüngst einen Brief von Christoph Willibald Gluck angeboten. Das auf den 29. November 1776 datierte Autograph, angepriesen als ein »Dokument des Gluck’schen Geschäftssinns«, war an Franz Kruthoffer gerichtet, seines Zeichens Sekretär an der Kaiserlichen Botschaft zu Paris, zugleich Glucks Privatsekretär und Freund. Gluck sagt Kruthoffer in dem Schreiben zu, den Honorarvorstellungen seines Verlegers Peters entgegenkommen zu wollen, behält sich dafür aber etliche Autorenexemplare vor und besteht darauf, aus dieser Zusage keinen Präzedenzfall für künftige Honorarverhandlungen konstruieren lassen zu wollen. Außerdem klagt der Komponist über die Flut unverlangt zugesandter Opernlibretti und verbietet Kruthoffer, weitere anzunehmen: »Dan ich werde grausamb desentwegen bombardirt«.
Der eilig hingeworfene Brief skizziert schlaglichtartig Persönlichkeit und Lebensumstände seines Autors: So schreibt ein selbstbewusster, viel beschäftigter Komponist, der vom Erfolg verwöhnt ist und dessen Geschäftstüchtigkeit ihn zu einem wohlhabenden Mann gemacht hat. Der Brief ist interessant, aber, obgleich noch nie gedruckt, keine wissenschaftliche Sensation – und wohl auch kein Fall für Bietergefechte in internationalen Auktionshäusern. Auch deshalb, weil die Nachwelt sich bis heute viel mehr für Zeugnisse aus bewegtem, krisenhaftem Künstlerleben interessiert als für Einblicke in eine gewisse Normalität, wie sie für Glucks Leben die Regel war. Gluck gilt gemeinhin als Glückskind; er kam ohne existenzielle Nöte und Verwerfungen aus, sein Privatleben scheint stabil gewesen zu sein, von dramatischen Schaffenskrisen ist nichts bekannt.
Womöglich ist es also Glucks Normalität und damit seine mangelnde Eignung zum Ideal des romantischen GenieKünstlers, die ihn irgendwie doch in der zweiten Reihe der Komponisten verharren lässt. Aber ist es nicht ungerecht, einen ausnahmsweise mal nicht von Geldnöten geplagten Komponisten ein bisschen langweilig zu finden, auch wenn er in Wahrheit eine hochkomplexe Figur war? Tatsächlich ist Glucks Biografie die Geschichte eines rasanten und äußerst zielbewussten Aufstiegs.
Geboren wurde Christoph Willibald Gluck am 2. Juli 1714 bei Neumarkt in der Oberpfalz als Sohn eines Försters. Die Familie zog 1717 nach Nordböhmen; in Eisenberg (heute Jezerˇí) soll der hochbegabte Knabe auf der Jesuitenschule ersten musikalischen Unterricht erhalten haben. Förster wollte er nicht werden, bereits als Teenager verließ er um 1731 heimlich das Elternhaus und wanderte auf Umwegen in Richtung Wien; Kost und Logis erspielte er sich auf der Straße und in Kirchen. In Prag begann er ein Studium der Logik und Mathematik, das er jedoch bald abbrach, um stattdessen am reichen Musikleben der böhmischen Hauptstadt aktiv teilzunehmen.
Vermutlich 1734 kam Gluck in Wien an. Und schon 1737 zog es ihn weiter nach Mailand, wo er, inzwischen 23 Jahre alt, bei Giovanni Battista Sammartini Komposition studierte und 1741 seine erste Oper, »Artaserse«, zur Uraufführung bringen konnte. Ihr sollten bis ans Ende seines Lebens 1787 rund 50 weitere Opern folgen, dazu ein Dutzend anderer Bühnenwerke wie Ballette und Pasticci. Natürlich schrieb Gluck auch einiges an Orchester, Kirchen und Kammermusik, dennoch war früh klar: Seine Leidenschaft galt der Oper – die er auf dem Höhepunkt seines Schaffens so kühn wie folgenreich reformieren sollte.
Zunächst aber setzte Gluck seine ruhelose Reisetätigkeit fort. Nach Mailand besuchte er Venedig und Turin. Er war im mitteleuropäischen Raum unterwegs, reiste nach Hamburg, Kopenhagen, Dresden, Prag und Neapel, sog wie ein Schwamm nationale und lokale musikalische Gepflogenheiten sowie unterschiedliche Personalstile auf. Musiker waren schon damals äußerst reisefreudig, und das nicht nur aus purer Neugierde. Als Freiberufler waren sie stets auf der Suche nach einträglichen Aufträgen im bereits internationalisierten Opern und Musikbetrieb; unter den ständig sich wandelnden MachtKonstellationen der überwiegend feudalen Auftraggeber waren Flexibilität und Wendigkeit gefragt.
Besonders prägend für Glucks Entwicklung wurde sein Aufenthalt in London 1745/46, wo er auch Georg Friedrich Händel begegnete. Durch die Erfahrungen in England veränderte sich insbesondere sein Umgang mit der menschlichen Stimme, was später zur Basis seiner Opernreform wurde. Der britische Musikhistoriker Charles Burney berichtet in seinem 1772/73 ins Deutsche übersetzten »Tagebuch seiner Musikalischen Reisen« wiederholt von Begegnungen mit Gluck: »Er sagte mir, ›

England habe ihn darauf gebracht, bey seinen dramatischen Kompositionen sich auf das Studium der Natur zu legen.« Angesichts der Londoner Erfolge Händels habe er »den Geschmack der Engländer« studiert: »und da er fand, daß die planen und simplen Stellen die meiste Wirkung auf sie [die Zuhörer] thaten: so hat er sich seit der Zeit beständig beflissen, für die Singstimme mehr in den natürlichen Tönen der menschlichen Empfindungen und Leidenschaften zu schreiben, als den Liebhabern tiefer Wissenschaft, oder grosser Schwierigkeiten zu schmeicheln«.
RITTER UND REFORMATOR
Glucks eigentlicher Aufstieg zu einem der erfolg und einflussreichsten Opernkomponisten der Zeit begann in Wien, wohin er 1748 zurückkehrte und wo er mit »La Semiramide riconosciuta« noch im selben Jahr erstmals eine Oper im Auftrag des kaiserlichen Hofs auf die Bühne brachte.
1750 wurde er bereits als ein »famoser musiccompositor« und »in gutten Ruff stehender virtuos, auch gutter oeconomus und von guter Aufführung« bezeichnet. Und konnte als solcher mit 36 Jahren die 18jährige Kaufmannstochter Maria Anna Bergin heiraten, die, früh verwaist, nicht nur eine sehr ansehnliche Mitgift in die Ehe einbrachte, sondern auch wirtschaftlichen Sachverstand und beste gesellschaftliche Beziehungen. Sie begleitete ihren Mann auf vielen Reisen, und als das Paar im Laufe der Jahre seinen Wohlstand mit Immobiliengeschäften mehrte, trat meist Frau Gluck als Käuferin auf. Zudem war ihre Schwester eine enge Kammerfrau von Kaiserin Maria Theresia, was Gluck weiteren Zugang zu höchsten Kreisen erleichterte.
1754 erlangte der nun 40Jährige mit der Festoper »Le Cinesi« endgültig die Gunst des Kaiserhofs: Er wurde Hofkapellmeister Maria Theresias und zum Musiklehrer ihrer Kinder ernannt, die 1765 seine Oper »Il Parnaso confuso« aufführten. Da war er durch Papst Benedikt XIV.
Die Sommerfrische verbrachte das Ehepaar Gluck gern im Weinort Perchtoldsdorf südlich von Wien.
Gemälde von Georg Weikert (um 1772)
bereits zum »Ritter vom goldenen Sporn« erhoben worden, kurz: Viel höher konnte man als bürgerlicher Künstler auf der Karriereleiter im vorrevolutionären Wien kaum steigen.
In Wien feierte man vor allem seine Opern; aber auch das »Don Juan«Ballett von 1761 sorgte für Furore, denn es war sein erster Schritt zur großen Opernreform, wie er sie schon im Jahr darauf mit »Orfeo ed Euridice« endgültig umsetzen sollte. Ausgehend von der in England entdeckten Natürlichkeit und der Wirkung schlichter Melodien, verabschiedete sich Gluck von der Nummernoper mit ihrem starren Schema von Rezitativ und Arie und ihrer Vorliebe für virtuose Schnörkel – zugunsten des durchkomponierten Dramas, in dem nichts die Handlung aufhalten durfte: »Schluss mit den kalten Schönheiten der Konvention, an denen die Tonsetzer festzuhalten sich verpflichtet fühlten. Die wahre Aufgabe der Musik ist es, der Dichtung zu dienen, ohne ihre Aktionen zu unterbrechen oder zu hemmen!«
Auf Einladung seiner ehemaligen Schülerin Marie Antoinette konnte Gluck seine Reformideen zwischen 1774 und 1779 auch in Paris präsentieren. Die französische Oper dieser Zeit war, weit mehr noch als die Oper in Wien, vor allem ein großes Spektakel mit viel Tanz und technischem Aufwand. Gluck rüstete in den sechs Opern, die er in Paris schrieb, den Pomp systematisch ab, um Raum für die dramatische Handlung zu schaffen. Zum größten Triumph wurde dabei die 1779 uraufgeführte »Iphigénie en Tauride«.
Glucks Reformideen wurden später für Beethoven ebenso bedeutsam wie für Giuseppe Verdi und Richard Wagner, die großen Opernkomponisten des 19. Jahrhunderts; Wagner bearbeitete 1847 gar Glucks »Iphigenia in Aulis« aus dem Jahr 1774. Auch Hector Berlioz würdigte Gluck: »Begabt mit einer außerordentlichen Empfindungskraft, mit
seltener Kenntnis des menschlichen Herzens, verwandte er sich ausschließlich darauf, den Leidenschaften eine wahre, tiefe und kraftvolle Sprache zu verleihen, und auf dieses einzige Ziel hin setzte er alle musikalischen Mittel ein.«
Bereits Glucks Zeitgenosse Charles Burney empfand dessen Tonsprache als allerhöchster Vergleiche würdig: »da giebt er den Leidenschaften solche herzdurchdringende Sprache, solche Farben, daß man an ihm zugleich den Dichter, den Mahler und den Tonkünstler erkennt. Er scheint in der Musik ein Michel Angelo zu seyn«. Und Gluck als Mensch? Von Zeitgenossen wird seine Persönlichkeit als leicht aufbrausend beschrieben, ansonsten scheint er überwiegend beliebt gewesen zu sein. Allerdings war sein Perfektionismus gefürchtet, wie Burney zu berichten weiß: »Er ist ein strenger Zuchtmeister, und eben so furchtbar als Händel zu seyn pflegte, wenn er ein Orchester dirigirte; dennoch versicherte er mich, daß er seine Brigade niemals widerspenstig befunden habe«.
Bei aller Durchsetzungskraft und Disziplin – wiederum bei Burney findet sich ein Zeugnis, das den Ritter Gluck als Menschen mit sympathischen Schwächen zeichnet: »Diesen Morgen ging ich zum Chevalier Gluck, um Abschied von ihm zu nehmen; und ob es gleich schon eilf



Uhr war, als ich hinkam, lag er doch noch, wie ein wahres grosses Genie im Bette. Madame sagte zwar zu mir, er pflege spät in die Nacht zu schreiben, und bliebe deswegen lange im Bette, um sich zu erholen; allein Gluck, als er zum Vorschein kam, brachte keine so gute Entschuldigung vor, sondern gestund ganz offenherzig seine Faulheit: Je suis un peu poltron ce matin (Ich bin ein bisserl ein Faullenzer heut morgen).«
ORFEO
Fr, 8.11.2024 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal
Cecila Bartoli (Orfeo), Mélissa Petit (Euridice, amore) les Musiciens du Prince –Monaco il Canto di Orfeo Gianluca Capuano (leitung) Christoph Willibald Gluck: »Orfeo ed Euridice« Konzertante aufführung in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln




IPHIGÉNIE EN TAURIDE
Sa, 3.5.2025 | 20 Uhr
Elbphilharmonie Großer Saal Carolina lópez Moreno (iphigénie), armando Noguera (thoas), Domen Križaj (Orest), Paolo Fanale (Pylades), Marianne Croux (Diana) Balthasar-Neumann-Chor und -Orchester thomas Hengelbrock (leitung) Christoph Willibald Gluck: »iphigénie en tauride« Konzertante aufführung in französischer Sprache mit deutschen Übertiteln





Unser Kolumnist fragt sich, warum der Süden eigentlich immer unten sein muss, und wann ihm endlich wieder ein Kopfstand gelingt.
VON TILL RAETHER ILLUSTRATION NADINE REDLICH
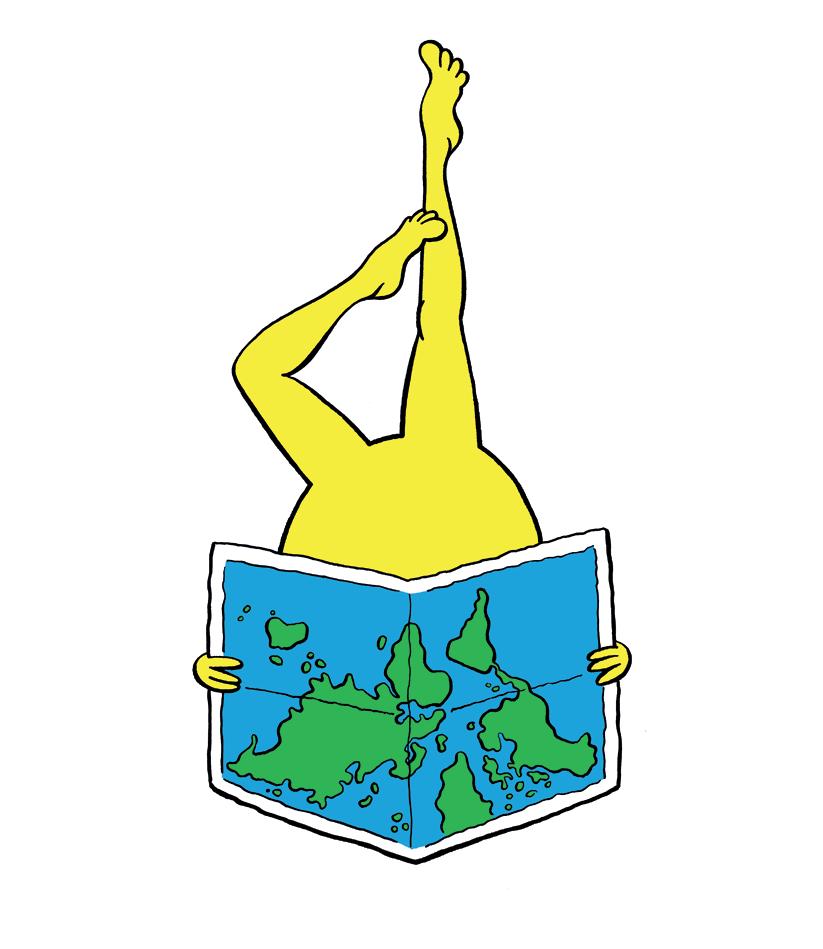
Vor einigen Jahren sah ich im Büro einer Kollegin eine merkwürdige Landkarte. Sie schien einen sehr großen See zu zeigen, an dessen unteren Rändern sich einige Inseln mit zerklüfteten Ufern drängten. Vielleicht eine skandinavische Schärenlandschaft? Viele Menschen, die in den Medien arbeiteten, hatten damals noch Ferienhäuser in Schweden, es war eine ganz andere Zeit.
Auf den zweiten Blick sah ich, dass es eine auf den Kopf gestellte Weltkarte war, mit dem Pazifik im Zentrum und Europa ganz unten rechts: McArthur’s Universal Corrective Map of the World. Der Australier Stuart McArthur hat sie 1979 erfunden, nachdem er bei einer Japanreise für seinen Geschmack einmal zu oft damit aufgezogen wurde, »vom unteren Ende der Welt« zu kommen. Deshalb ist bei ihm Australien nicht nur ganz oben, sondern auch fast in der Mitte der Karte. Neben dem Song »Down Under« von Men at Work ist dies meines Wissens nach der einzige popkulturelle MegaErfolg, der auf geografischen Darstellungen beruht: Die Karte wurde millionenfach verkauft.
Man spricht in so einem Fall von »gesüdeten Karten«; es gibt noch viele andere Varianten, etwa mit Afrika oben im Zentrum, oder, aus dem Mittelalter, der islamischen Welt. Diese Karten faszinieren mich, weil sie so irritierend sind. Beim Betrachten wird man auf ganz wunderbare Weise auf sich selbst und die eigenen Vorurteile zurückgeworfen. Ich erinnere mich, dass ich beim ersten Betrachten der McArthurKarte dachte: Was für ein Spinner, warum will er unbedingt im Zentrum der Welt stehen? Zugleich war ich dabei, mir den Hals zu verrenken, um Deutschland unten rechts in Europa zu finden und so mein vertrautes Weltbild wiederherzustellen. Ich halte mich für durchschnittlich intelligent, umso alarmierter war ich, dass es ein paar Augenblicke dauerte, bis mir klar wurde: Ich bin selbst aufgewachsen mit den Karten von anderen, nur eben europäischen Spinnern, die unbedingt ihre Welt im Zentrum der Karte und oben sehen wollten.
Seitdem liebe ich gesüdete Karten. Eine solche Weltkarte sieht aus, als würde sie einen anderen, interessanteren Planeten zeigen, in einem Paralleluniversum, wo Europa und ich nicht ganz so wichtig sind, wie es mir beigebracht wurde. Sie sehen aus wie die Karten in Fantasy
Büchern, in den »Game of Thrones«Romanen von George R. R. Martin oder in Tolkiens »Der Herr der Ringe«: fremd und doch vertraut, abenteuerlich.
Das eigentliche Abenteuer ist, dass durch den gewendeten Blickwinkel die Machtverhältnisse auf den Kopf gestellt werden. Ich bin mit der Vorstellung aufgewachsen, dass es eine Hierarchie von oben und unten gibt. Indem die gesüdete Karte diese Hierarchie umkehrt, führt sie sie ad absurdum. Schon bei einem umgedrehten HamburgStadtplan stellt sich dieser Effekt ein: Plötzlich sind die wohlhabenden Stadtteile Othmarschen, Nienstedten und Blankenese da, wo doch eigentlich die eher nicht so wohlhabenden Hamm, Horn und Billstedt hingehören. Irritierend, denn sofort muss man sich fragen, was eigentlich »hingehören« bedeutet, und warum der Wohlstand und das Schnöseltum in Hamburg geografisch so ungleich verteilt sind.
Seit ich gesüdete Karten kenne, arbeite ich auch wieder intensiver an einem YogaKopfstand, den man eine Weile halten und dabei ganz in Ruhe (auf die Atmung vertrauen!) eine neue Perspektive auf die Welt bewundern kann. Er ist mir einmal gelungen, vor fünfzehn Jahren, leider hat seitdem die Schwerkraft zugenommen, darüber wird zu wenig gesprochen. Jedenfalls erinnere ich mich, wie ich damals sofort so ein glückliches Kindheitsgefühl hatte: In meiner Welt gibt es eine zweite, versteckte Welt, und da hängt alles umgekehrt und mittendrin ich.
Gern würde ich noch mehr Dinge auf den Kopf stellen. Georg Baselitz hat seit 1969 seine Bilder so gemalt, dass die Motive auf dem Kopf stehen. Leider lässt sich dies beim Schreiben nicht reproduzieren, obwohl sich durchaus manche Texte, gerade zur aktuellen politischen Lage, so lesen, als wären sie bei umgedrehtem Laptop mit Blick von hinten auf den Deckel und nicht aufs Display geschrieben worden.
Meine Tochter hat mir neulich gesagt, ich würde immer nur tragen, »was obenauf liegt«, obwohl ich so viele TShirts und Pullover hätte, und dann hat sie die beiden Stapel umgedreht. Ich bin seitdem ein ganz neuer Mensch, zumindest sehe ich dank meiner alten TShirts so aus.
TILL RAETHER lebt und arbeitet als freier Journalist und Autor in Hamburg.

Die Redaktion der Elbphilharmonie produziert Information über Musik in jedem nur denkbaren Format.
VON HANNO GRAHL
FOTOS GESCHE JÄGER
Johannes Brahms, der alte Gourmand, soll einmal gesagt haben, über Musik zu schreiben, sei wie ein Abendessen zu erzählen. Ob’s stimmt? Jedenfalls ist es das täglich Brot für die Redakteure und Redakteurinnen der Elbphilharmonie, und die empfinden es ganz und gar nicht als irgendwie unbefriedigend, Tag für Tag Text um Text für die verschiedenen Medien des Hauses zu verfassen. Zumal die Vielfalt der Veranstaltungen, über die sie schreiben, Herausforderung und schöne Abwechslung zugleich darstellt: Heute ein Abendprogramm über eine MahlerSinfonie, morgen eine Einführung in hindustanische Ragas, dann ein Heft zu
HaydnStreichquartetten und eines über einen JazzNewcomer. Dazwischen vielleicht noch eine Ankündigung für ein Familienkonzert, ein Interview mit dem Komponisten einer Uraufführung – und immer wieder auch Beiträge für dieses Magazin.
Dabei hat alles ganz überschaubar angefangen: Vor der Eröffnung der Elbphilharmonie 2017, als noch alle Konzerte des hausinternen Veranstalters HamburgMusik in der Laeiszhalle stattgefunden haben, bestand die Redaktion nur aus einer einzigen Person, dem heutigen Teamleiter Clemens Matuschek. 2014 kam Simon Chlosta dazu: Als Volontär hat er angefangen, kurz bevor es im neuen Haus losging, wurde er übernommen, mittlerweile ist er der stellvertretende Redaktionsleiter. Sein Kerngeschäft sind die weißen Programmhefte geblieben, die bei den Konzerten an jedem Saaleingang kostenlos verteilt werden. Waren es vor der Eröffnung der Elbphilharmonie zwischen fünfzig und sechzig Hefte pro Saison, sind es mittlerweile rund zweihundert. Dementsprechend ist das Redaktionsteam über die Jahre auf sieben Mitglieder angewachsen.
Wichtig ist für Chlosta vor allem eines: »Wir legen viel Wert auf die Verständlichkeit der Texte. Sie sollen absoluten Einsteigern, die zum ersten Mal in so einem Konzert sind, die Musik näherbringen, aber auch unser

erfahrenes Publikum ansprechen. Es geht also darum, eine gute Balance zu halten und interessante Geschichten zu erzählen. Wir möchten den Leuten etwas mitgeben, das sie einerseits unterhält und andererseits die Hintergründe des Konzerts erklärt. Denn es gibt genügend Stücke und Programme, die relativ anspruchsvoll sind, wo viel dahintersteckt, und das wollen wir den Besuchern, so gut es geht, vermitteln.«
Der Umfang der Hefte reicht vom vierseitigen Programm für Kinderkonzerte über die typischerweise sechzehn bis zwanzig Seiten für den klassischen Sinfonieabend bis hin zum ausgewachsenen Festivalkatalog.
Den Rekord brach jüngst die Begleitpublikation zu André Hellers ReflektorFestival, die mit ihren 92 Seiten fast schon Buchformat hatte. Solche großen Hefte haben dann auch schnell eine Auflage von 7.000 bis 11.000 Exemplaren. Seit der Eröffnung 2017 wurden mehr als 1,5 Millionen Programmhefte gedruckt. Für manche Besucher sind sie richtige Sammlerstücke. Ein Gast konnte beim letzten ReflektorFestival nicht nach Hamburg reisen; weil er aber bisher bei jedem vorherigen dabei war, bat er die Redaktion um ein Exemplar für seine Sammlung. »Solche Anfragen bekommen wir relativ häufig«, sagt Simon Chlosta, »gerade auch von Abonnenten und Touristen, die ihr Heft vielleicht verloren haben, es aber gern als Andenken mit nach Hause nehmen möchten. Das freut mich natürlich.«
Ab und zu erreichen die Redaktion aber auch skurril anmutende Leserbriefe. »Einmal hat sich jemand beschwert, dass unsere Programmhefte schlecht riechen würden. Tatsächlich lag das an der roten Farbe, die sehr geruchsintensiv ist. Die haben wir seither nicht mehr benutzt«, erzählt Chlosta. Andere Hinweise führten sogar zu einer Änderung im Layout: »Es gab aus dem Publikum Rückmeldungen, dass die Gesangstexte schlecht lesbar wären. Die waren früher grau hinterlegt – das haben wir dann geändert.«
Mit den meisten Komponisten, über die Chlosta im Alltag schreibt, kann er naturgemäß nicht mehr selbst über ihre Musik sprechen. Gerade deswegen zählen persönliche Begegnungen mit noch lebenden Künstlern oft zu den schönsten Erlebnissen. So durfte er seine Lieblingskomponistin Sofia Gubaidulina für ein Interview in ihrem Haus vor den Toren Hamburgs besuchen. Und von Arvo Pärt bekam er für ein Porträt, das er über den großen estnischen Komponisten geschrieben hatte, durch dessen Verleger ein Kompliment vermittelt. »Da habe ich mich sehr geehrt gefühlt.«
»Wir legen viel Wert auf die Verständlichkeit der Texte.«


»Ich führe sehr gerne Interviews, weil man immer eine neue Perspektive gewinnt.«
ZWISCHEN PRINT UND AUDIO: IVANA RAJIC ˇ
In der Redaktion, die Teil der MarketingAbteilung ist, werden nicht nur Abendprogrammhefte erstellt. Auch Monatsvorschauen, Newsletter, Flyer, Ankündigungstexte für die Webseite oder das Jahrbuch werden hier geschrieben oder bei externen Autoren in Auftrag gegeben. Und die digitale Sparte wird immer umfangreicher.
Ivana Rajicˇ ist seit März 2023 Teil der Redaktion und brachte ihre Erfahrung vom PierreBoulezSaal in Berlin mit, wo sie zuvor gearbeitet hat. »Vor allem die Elbphilharmonie, ihre besondere Architektur und das tolle Programm, aber auch die Stadt selbst«, hätten sie nach Hamburg geführt: »Ich habe sieben Jahre in Berlin gewohnt und hatte einfach mal Lust auf einen Tapetenwechsel.«
Neben den Texten für die Printprodukte produziert Rajicˇ auch das neue Audioformat »Auftakt« und gibt gelegentlich unmittelbar vor den Konzerten Einführungen fürs Publikum. Grundsätzlich geht sie an all ihre Formate ähnlich heran: »Ich höre mir erst einmal die Musik an und notiere mir Dinge, die ich selbst interessant finde. Die verschiedenen Medien bieten einem dann aber ganz unterschiedliche Möglichkeiten.« Der Vorteil der Audioformate etwa sei es, dass man die besprochenen Beispiele direkt einspielen kann. »Außerdem kann man mit Klängen, Effekten und sprecherischen Mitteln arbeiten, um eine
Stimmung hervorzurufen. Die Schwierigkeit bei den AudioEinführungen wiederum ist, dass man sich sehr knapp halten, den Inhalt wirklich auf den Punkt bringen muss.«
Auch im »Elbphilharmonie Magazin« ist Rajicˇ regelmäßig präsent: In der Rubrik »Umgehört« stellt sie jeweils sieben ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern eine Frage zu einem bestimmten Thema (s. S. 64). Da kommen die unterschiedlichsten Antworten und Ansichten zurück – und genau das reizt sie daran. »Ich führe sehr gerne Interviews und Gespräche, weil man immer etwas Neues dazulernt und eine neue Perspektive gewinnt, was ich sehr bereichernd finde.«
Ein ganz besonderes Interview kam im Vorfeld einer Uraufführung von Jörg Widmann zustande, für das sie mit dem Komponisten telefonierte. »Das Gespräch war auf jeden Fall ein Highlight im letzten Jahr. Als wir uns unterhielten, arbeitete er noch an der Komposition seiner ›Schumannliebe‹, deswegen hatte er auch wirklich nur eine Stunde Zeit für mich.« Und daraus entstanden das Programmheft, ein Interview für die Mediathek sowie eine AudioEinführung. Rajicˇ versucht, möglichst ökonomisch mit solchen Geschichten umzugehen, und denkt immer gleich mit, welche Kanäle noch von einer Recherche profitieren könnten.
Diese Frage beschäftigt vor allem Julika von Werder. Sie ist für das zuständig, was man heutzutage Storytelling und Content Management nennt. Das bedeutet konkret: Sie überlegt, welche inhaltlichen Schwerpunkte in der Kommunikation gesetzt und welche Projekte medial begleitet werden sollten. Für manche Konzerte ist vielleicht ein erklärendes Video hilfreich, bei anderen bietet sich ein Livestream an.
Ausgerechnet während der CoronaPandemie begann sie ihr Volontariat in der Redaktion: »Das war genau zum Lockdown im November 2021, als gerade alles wieder dicht war. Ich war komplett im Homeoffice und habe viele Kolleginnen und Kollegen nur per Zoom kennengelernt. Und meine ersten beiden Programmhefte habe ich für die Tonne geschrieben.« Durch die Pandemie wurden Livestreams von Konzerten und digitale Inhalte, die das Kulturleben aufrechterhalten sollten, immer wichtiger. Nach und nach übernahm von Werder mehr Aufgaben im digitalen Bereich; mittlerweile leitet sie redaktionell die Mediathek.
Als Frau an der Schnittstelle zwischen Print, Videound OnlineRedaktion, Marketing und Künstlerischer Planung geht es für von Werder immer darum, die Kräfte der Abteilung zu bündeln, Synergien zu schaffen. »Welche Kanäle profitieren von den verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten des Programms? Wenn ich ein Interview für ein Videoformat führe, überlege ich, wie wir das

vielleicht in der Redaktion zurückspielen können.« Es geht also immer auch um die medienübergreifende Kommunikation.
»Ich liebe die Vielfalt des Hauses und finde es unglaublich bereichernd, so tollen Menschen zu begegnen. Ich bin begeistert von dem, was hier passiert, und brenne dafür, dass möglichst viele Leute das mitbekommen.« In Interview und Einführungsformaten, Konzertmitschnitten, Artikeln und Podcasts wird das kulturelle und musikalische Spektrum der Elbphilharmonie präsentiert. Ein Beispiel sind die »Elbphilharmonie Sessions«, bei denen von Werder auch die Produktionsleitung übernimmt. In diesem Format spielte schon die TechnoMarchingBand Meute auf dem Dach der Elbphilharmonie, der französische Pianist Alexandre Kantorow im Flügellager, und die multimediale Künstlerin Rosaceae erschuf im Kleinen Saal ihre elektronischen Klangwelten. Der Prozess von der Künstleranfrage über die Buchung der Location, des Filmteams und des Caterings bis hin zur Inszenierung vor Ort liegt dabei mit in den Händen von Julika von Werder. Aber auch die analoge Welt hat von Werder nicht ganz verlassen, sie schreibt Artikel für das Magazin, Texte für die Monatsprogramme und auch einige Abendprogramme: »Ich habe Lust auf die Vielfalt der Formate. Es macht auch immer wieder Spaß, bei einem Printprodukt dabei zu sein.«
M WEITERE GESCHICHTEN AUS DEM TEAM DER ELBPHILHARMONIE FINDEN SIE UNTER: WWW.ELBPHILHARMONIE.DE/MEDIATHEK
»Es geht immer auch um die medienübergreifende Kommunikation.«

Man sagt Hamburg nach, dass es kein einfacher Ort für Menschen von außerhalb sei. Aber wie fühlt sich dieses neue Zuhause an, wenn man von weit weg herzieht?
VON STEPHAN BARTELS
FOTOS HAYLEY AUSTIN
Wenn man ihn fragt, wie das so ist in Neapel, dann antwortet Francesco Damigella: Es ist ein Leben auf dem Vulkan, und zwar wortwörtlich. »Pass auf«, sagt er und öffnet Google Maps auf seinem Handy. Sucht Italien und Neapel und zieht den Bildschirm auf. Malt mit dem Zeigefinger einen Kreis um ein Stück Land an der Küste und ein bisschen Golf von Pozzuoli. Das, sagt er, seien die Campi Flegrei, die Phlegräischen Felder, ein unterirdisches Vulkangebiet im Westen Neapels, »das ist nach Yellowstone in den USA das erdbebengefährdetste Gebiet der Welt«. Da würden Wissenschaftler seit Jahren besorgniserregende Aktivität beobachten. Dann tippt er auf einen Punkt am Rand des Kreises. »Da wohnen wir«, sagt er. Also jetzt noch seine Eltern und Geschwister. Er lebt dort nicht mehr. Er wohnt in HamburgPoppenbüttel, 1.450 Kilometer Luftlinie nordwärts vom Tanz auf dem Vulkan. Francesco ist in Sicherheit.
Jetzt sitzt er in Sierichs Biergarten im Stadtpark, blinzelt in die tiefstehende Sonne überm Stadtparksee und nippt am Wein, Bier ist nicht so sein Ding. Der Tempranillo hier allerdings auch nicht. Francesco versucht, seine widerstrebenden Gefühle zu sortieren, die er zu seiner alten Stadt hat. Und zu seiner neuen. »Neapel ist nicht nur eine Heimat«, sagt er, »die Stadt ist mehr. Sie ist Identität.« Seine Identität, tief verankert, weil alles, was Neapel ausmacht, auch in ihm steckt: Tradition, Widersprüche, Resilienz. Trotzdem ist er seit neun Jahren in Hamburg, und er ist – vielleicht ein großes Wort, aber ja: Er ist glücklich hier. Das hat mit Mangel auf der einen Seite zu tun und mit Geborgenheit auf der anderen.
Francesco ist 1986 in Neapel geboren, mitten hinein in die Regentschaft von Diego Maradona. Sieben Jahre hat das FußballGenie für den SSC gespielt, bis 1991. »Er ist unglaublich wichtig für die Stadt, noch heute«, sagt Francesco, »Maradona hat so viel für Neapel getan. Nicht nur auf dem Platz. Wie er als NichtItaliener Neapel gegen alles und jeden verteidigt hat, das hat niemand dort vergessen.« Bei Auswärtsspielen wird der SSC auch heute noch überall mit Bannern begrüßt, auf denen »Willkommen in Italien« steht. So sieht man Neapel in Italien: als etwas, das nicht zum Land gehört.
In Neapel grassierte in den 1970ern für ein paar Wochen die Cholera, das hat den Ruf der Stadt verfestigt, als Schmuddelkind, als Armenhaus, als lauter, ungewaschener Nachbar. Francesco nimmt das mit einer Mischung aus Trotz, Stolz und Schmerz wahr. Und spürt an sich einen typisch neapolitanischen Reflex: außerhalb der Stadt seine südlichen Wurzeln zu verleugnen, die anderswo als rückständig und unhöflich gelten. Aber er wächst auch an diesem Problem. »Ich bin Lokalpatriot«, sagt er. »Meine Heimat bedeutet mir etwas.«
In dieser Heimat hat Francesco Kunstgrafik studiert, fünf Jahre lang. Er liebt Radierungen, er ist gut. Er versuchte, Arbeit als Grafikdesigner zu finden, er stellte aus, aber es reichte nicht. Ein Cousin, der in Hamburg einen Sommerjob in einem italienischen Restaurant hatte, sagte ihm: Komm her, die suchen Leute. Also kam Francesco. Ist ja nicht für immer, hat er damals gedacht.


»Du bist nie allein in Hamburg, wenn du ein Problem hast. Es gibt immer jemanden, der dir hilft.«
Deutsch konnte er gar nicht. Jetzt stand er hinter dem Tresen, putzte Gläser, schenkte Wein aus und lernte die Sprache. Ging irgendwann zusätzlich in die Volkshochschule, als er ahnte, dass er länger bleiben würde. Drei Jahre arbeitete er in dem Restaurant. Doch das war nicht das, was er sein Leben lang machen wollte. »In der Agentur für Arbeit war ein ganz netter Typ«, sagt Francesco, »der hat mit sehr geholfen mit einer Kunsttherapeutenausbildung.« Fand er super. Dass da noch der Heilpraktiker dranhing, Fachrichtung Psychologie, hatte Francesco zuerst nicht komplett verstanden. Aber es passte für ihn. Und er hatte etwas festgestellt: Du bist nie allein in dieser Stadt, wenn du ein Problem hast. »Es gibt immer jemanden, der dir hilft.«
Zwei Jahre dauerte die Ausbildung, dazu 600 Stunden Praktikum, die Hälfte absolvierte er bei »Krass e.V.«, einem Verein, der Bildung mit Kunst verbindet. Ende 2019 machte Francesco seine Abschlussarbeit. Doch dann kam Corona, die Prüfung wurde mehrfach verschoben. »Es gibt in Italien ein Sprichwort: Prendi l’arte e mettila da parte«, sagt er. Heißt so viel wie: Nimm die Kunst und mach was draus. »Es ist das Wissen, das du gesammelt hast«, sagt Francesco, »das bleibt dir, das verlässt dich nicht.«
So suchte er sich etwas anderes. Fing in der Ganztagesbetreuung einer Grundschule an. Und arbeitet heute zusätzlich mit Geflüchteten. Die alte PostbankZentrale in der City Nord ist dieser zweite Arbeitsplatz, tausende
Geflüchtete aus der Ukraine leben dort in den ehemaligen Büros. Die Geschichten der ukrainischen Kinder bewegen ihn. »Die erinnern mich an die Kinder aus meinem Stadtviertel, das ist die Bronx von Neapel«, sagt Francesco. Und meint: Das sind Straßenkinder, die haben nicht viel. Aber sie sind auch widerstandsfähig und lebhaft, bei aller Armut. Das ist ihm nahe. »Außer der Kunst und dem Spaß, den sie bei mir haben, fühle ich meine soziale Rolle«, sagt er. »Bei mir machen sie etwas anderes als sonst, und ich spüre, wie sehr sie das freut.«
Francesco ist längst angekommen hier im Norden. Er mag die Kontraste zu seinem alten Leben: Das Meer vor Neapel, das Grün in Hamburg. Den Lärm dort, die
›

Ruhe hier. »Ich freue mich, wenn ich in Neapel bin, es ist schön, meine Freunde, meine Familie zu sehen«, sagt er, »aber da ist noch eine andere Freude: die, nach ein oder zwei Wochen wieder nach Hamburg zurückzukehren.« Neapel ist für die Schönheit, Hamburg für die Stabilität. »Ich bin sehr glücklich, dass das Leben mich hierher gebracht hat«, sagt Francesco. Er hat andere Italiener in der Stadt kennengelernt, »das Heimweh verteilt sich so besser. Aber es geht nicht weg.« Auch deshalb fragt er sich selbst nach seinem Platz in der Welt. Hamburg ist für ihn voller Möglichkeiten, die es im Süden Italiens nicht gibt. »Aber ich habe noch nicht zu hundert Prozent meinen Platz gefunden«, sagt er. »Nur: Einen Platz in Neapel habe ich auch nicht mehr.« Das ist eine Feststellung. Aber kein Problem. Das Pendeln zwischen Norden und Süden, es hat ihn stärker gemacht in den vergangenen neun Jahren. Bewusster.
Sein Handy klingelt. Seine Mutter ruft jeden Abend um halb neun an, ein Videocall, »ich finde, das ist okay. Es kostet mich nur zwei Minuten, damit wir uns einander ein bisschen nahe fühlen.« Und das tut auch ihm gut. Ein bisschen Nähe, bei all der Entfernung.
IN FARBE: TITA DO RÊGO SILVA
Ganz vorsichtig legt sie es auf den Tisch, dieses besondere Buch. Groß ist es, wuchtig und schwer, ein Unikat. Tita do Rêgo Silva hat es vor elf Jahren selbst gemacht, es ist ihr wichtig. Weil es zum einen die Essenz ihrer Kunst ist – Holzschnittdrucke, bunt, wild, mit den von ihr erfundenen unverwechselbaren Tierkopfmenschen als Protagonisten. Und zum anderen, weil es auf einem Buch beruht, das als Essenz Brasiliens gilt. Ihrer Heimat.
João Guimarães Rosa hat in den 1950ern das Original geschrieben. »Grande Sertão: Veredas« heißt es auch in der deutschen Übersetzung, was etwa »Das große Hinterland« bedeutet, es gilt als eines der literarischen Schlüsselwerke Brasiliens, zählt zur Weltliteratur. Tita do Rêgo Silva liebt dieses Buch. »Wie die Menschen in Brasilien leben, wie sie lieben, was sie essen, was sie fühlen, das alles steckt in dieser Geschichte«, sagt sie und streicht sanft über die Seiten ihrer Adaption. »Sertão Travessia Amor« heißt sie, Tita hat darin das Hinterland um eine Reise ergänzt und um die Liebe, »denn eigentlich ist es auch eine Liebesgeschichte«.
Der Tisch, auf dem das Buch liegt, steht in der Koppel 66 in St. Georg. Eine Maschinenfabrik war früher in diesem Haus, seit 1981 ist es ein Zentrum für Kunsthandwerk. Tita ist hier Mitte der Neunziger eingezogen. Ihr Raum ist so hoch wie breit und lang, neben dem Eingang ein paar Kästen mit Karten zum Verkauf. Ein Glasbausteinfenster, was dahinter ist? Wer weiß das schon. Es ist eine eigene Welt hier drinnen mit der schweren Holzschnittdruckmaschine, den vielen Büchern, den Drucken, all den vermenschelten Tieren an der Wand. Was hinter diesen Figuren steckt? Nicht viel. Einmal hat sie aus Versehen einen Menschen mit Tierkopf gemacht. Es hat ihr gefallen, seitdem ist es halt so.
Es gibt in diesem Raum auch die brasilianische Ecke, mit Bildern ihrer Eltern und gebastelten Altären, christlich, naturreligiös, diabolisch – ihre Art der Auseinandersetzung mit der Spiritualität ihrer Heimat, die sonst gar nicht so ihr Ding ist. Tita klappt das Buch zusammen. Sie verdient ihr Geld damit, ihre gedruckte Kunst zu verkaufen, aber dieses Buch hat sie nicht verlassen. »Für 5.000 Euro würde ich es verkaufen«, sagt sie, »aber ganz ehrlich: Manche Sachen möchte ich eigentlich viel lieber behalten. Das hier gehört dazu.«
64 Jahre alt ist diese Frau, sie hat weit mehr als ihr halbes Leben in Deutschland verbracht. Die Zeit davor war sie im Norden Brasiliens. 1959 ist Tita in Caxias geboren, mitten im Bundesstaat Maranhão. Eine Stadt mit etwas über 150.000 Einwohnern – Tita sagt, sie sei auf dem Lande aufgewachsen. Sie ist das jüngste von sieben Kindern. Ihre beiden ältesten Brüder sind 1968 zum Studium nach Brasilia gegangen, nach und nach haben sie ihre vier jüngeren Schwestern zu sich geholt, der besseren Bildungschancen wegen. Tita war die letzte, sie zog mit 14 in die Hauptstadt und ließ ihre Eltern in Caxias zurück. »Sie wollten nicht in die Hauptstadt ziehen«, sagt sie, »sie hatten ihr Leben dort, das sie mochten. Aber für mich war das sehr hart.« Tischler war der Vater, er hatte die Bauaufsicht auf Baustellen, die Mutter war Näherin. »Wir Töchter sind deshalb verrückt nach Kleidern.«


»Mir gefällt die Mentalität hier. Dass es eine große Stadt ist, ohne riesig zu sein.«

Brasilia war eine einzige Baustelle, als sie 1974 dort hinzog. Sie mochte es nicht, das änderte sich erst, als sie genauer hinsah und sich mit der außergewöhnlichen Architektur der Hauptstadt beschäftigte. Das war, nachdem sie ihr Touristikstudium begonnen hatte und als Bodenstewardess arbeitete. In den Achtzigern wollte sie dann Architektur studieren. Es wurde ein Kunststudium an der Universität von Brasilia draus, weil jemand auf dem Bewerbungsformular einen Zahlendreher eingebaut hatte. 1985 war das, sie ging hin. Und stellte fest, dass sie eine Leidenschaft für Holzschnitt hat.
Tita war zuvor schon ein paar Mal in Europa gewesen, für Flüge musste sie dank ihres Jobs bei der Airline nicht viel bezahlen. Aber 1988 war die Sache anders. Da lud sie das GoetheInstitut über die Universität nach Deutschland ein, weil sie mit ihrer Kunst Aufsehen erregt hatte. Drei Monate Deutschkurs in Schwäbisch Hall, so begann ihr Abenteuer hier. Sie kam gut an in Deutschland, es war eine gute Zeit für jemanden wie sie – Holzschnitt machten nur ältere Männer, da kam eine junge Frau gerade recht. Tita hatte gleich viele Ausstellungen im ganzen Land. Knüpfte schnell Kontakte in der Kunstszene, konnte sich gut verkaufen und ihre Bücher und Bilder auch. Sie konnte von ihrer Kunst leben, undenkbar in Brasilien! Und trotzdem hatte sie Heimweh. »Als ich weggegangen bin, hatte ich meine schönste Zeit in Brasilien«, sagt sie, »und ich wäre auch wieder zurückgegangen. Aber dann habe ich mich verliebt.«
Also ist sie geblieben, in Hamburg. Hat geheiratet, 1993 einen Sohn bekommen. Ihr Mann, das sei ein wunderbarer Mann gewesen, der tollste, der beste Mann der Welt, »bis es dann vorbei war«, sagt sie und lacht. 23 Jahre lang war sie mit ihm verheiratet. Heute sind sie immer noch gut befreundet.
Sie hat sich an die Winter in Deutschland gewöhnt. »Als ich kam, hat mir das Licht im November gefehlt«, sagt sie, »aber ich bin ganz viel in diesem Atelier, da stört mich nicht, was draußen passiert.« Der Raum ist der Mittelpunkt ihres Lebens, auch wenn sie seit über 30 Jahren ihre Wohnung gleich nebenan in der Langen Reihe hat. Sie verlässt auch den Stadtteil selten. Geht sehr gern ins »Barca« auf einem Steg an der Alster, ein Bier trinken, »da ist der schönste Sonnenuntergang Hamburgs«. Und manchmal, wenn es warm ist, trifft sie sich mit einer Freundin spät am Abend auf der Langen Reihe. St. Georg ist ihr Dorf, ist eine Heimat, genau wie Brasilien. Mit kleinen Unterschieden. »Dort habe ich die Freiheit, meine Meinung rauszubrüllen«, sagt sie, »in Deutschland habe ich immer noch das Gefühl, aufpassen zu müssen.« Eine Deutsche sei sie, aber eine besondere. Und nach Brasilien hat sie eine Standleitung, mit manchen ihrer Geschwister redet sie täglich. Sie hat dasselbe Gefühl wie Francesco: irgendwie zurückgehen zu wollen und irgendwie auch nicht. In Brasilien wäre es ein aufgehobenes Leben in der Familie, »aber ich würde so viel aus Deutschland vermissen. Die Gemütlichkeit, die Sicherheit. Ich kann meine Werkstatt ›

»Ich bin zurückhaltend, deshalb fällt es mir nicht so schwer, mich mit der Mentalität hier zu identifizieren.«

nicht mitnehmen.« Und ihr Sohn, der würde auch nicht nach Brasilien ziehen. Das heißt auch für Tita: Sie wird bleiben. Nicht schlimm. Hamburg ist ihr Zuhause geworden. »Mir gefällt die Mentalität hier. Dass es eine große Stadt ist, ohne riesig zu sein«, sagt sie. »Hamburger sind sehr ehrlich und hilfsbereit, wenn du ihnen näherkommst. Versprochen und gemacht, das habe ich hier so oft erlebt.«
Einmal hat ihre Mutter sie besucht, das war, als ihr Sohn geboren wurde. Es hat der alten Dame nicht so richtig gefallen, »sie hat danach überall erzählt, dass sie zehn Kilo abgenommen hätte, weil das Essen in Deutschland so schlecht sei«. Tita lacht. Es gibt nichts, was sie aus dem Land treiben würde. Das Essen schon gar nicht.
IN BEWEGUNG: ALEJANDO SANGUINETI
Beim Tango, sagt Alejando Sanguineti, geht es um Liebe. Ja, klar, auch um Schrittfolgen, um Bewegungsabläufe, um Haltung. »Aber wenn Tango gut ist, bist du für ein paar Minuten verliebt in den Menschen, mit dem du gerade tanzt. Danach geht man wieder auseinander und lebt sein Leben weiter.«
Alejandro ist Lehrer, eigentlich schon sein ganzes Erwachsenenleben lang. Tango tanzt er schon ein bisschen länger, na ja, er kommt aus Almagro, einem Viertel mitten in Buenos Aires, man könnte sagen: Er hat dieselbe
Heimat wie der Nationaltanz der Argentinier. Irgendwann hat er beides vereinigt und zum Beruf gemacht. Vor allen Dingen in Deutschland, genauer in Hamburg. Dort betreibt er ein Tangostudio, das »Universo Tango«, auf der Grenze von St. Pauli zum Schanzenviertel. Aber bis dorthin hat er ein paar krumme Wege genommen.
Mit seiner Mutter und seiner Schwester ist er in Buenos Aires aufgewachsen. Sein Vater, einer der bekanntesten Radiomoderatoren Argentiniens, hat die Familie verlassen, als er noch nicht mal zur Schule ging. Kontakt hatte er lange gar keinen. Mit sechs hat Alejandro angefangen zu tanzen, meist argentinische Folklore. Es lag ihm irgendwie, jede Form von Bewegung war sein Ding –Leichtathletik, Basketball, Fußball, natürlich. Mit zwölf jobbte er in einem Feinkostladen. Der Besitzer war ein alter, preisgekrönter Tangotänzer. Der hat ihm ein paar Schritte gezeigt. Ein anderer Milonguero hat ihm dann richtig Unterricht gegeben. In einer Disziplin, die während der argentinischen Militärdiktatur in den 1970ern verboten war. Es gab wenige Plätze für Tango, alle halboffiziell. Alejandro hat sie gefunden.
Er wurde Sportlehrer und Multijobber, »so wie alle Sportlehrer in Argentinien«. Er arbeitete an einer Schule, gründete einen Sportverein für Kinder aus ärmeren Vierteln, war daneben Athletiktrainer bei Vélez Sársfield,
einem Erstligaverein im fußballbekloppten Buenos Aires (»Aber Boca Junior ist der größte Verein der Welt«, stellt Alejandro seine Vorlieben deutlich klar.)
Und er tanzte. Ging in die Clubs, auf Milongas, wie die Tanzveranstaltungen im Tango heißen. Gab auch ein bisschen Unterricht. Und begegnete 1990 einer Touristin aus Hamburg. »Sie war für zwei Wochen da, mit ihrem Freund, aber ich habe gleich gemerkt: Da war nicht alles in Ordnung bei den beiden«, sagt er. Sie hat für eine Woche verlängert. Ihr Freund nicht. Und Alejandro ist dieser Frau nach Deutschland gefolgt. »Ich habe drei Monate in dieser Dreiecksbeziehung verbracht«, sagt er. Da war Leidenschaft, Drama, Unentschlossenheit. Er hat das irgendwann nicht mehr ausgehalten. Ist zurückgegangen nach Argentinien. Und bekam ein Telegramm: Ich kann ohne dich nicht leben. »Da habe ich meine Jobs gekündigt und bin nach Deutschland gegangen.«
Mit der Frau hat es am Ende nicht geklappt, natürlich nicht. Und klar hätte das das Ende seines Ausflugs nach Deutschland sein können. Aber auf der anderen Seite war da sein angekratztes Ego. »Ich bin ein Kämpfer«, sagt er, »mir hat die Idee nicht gefallen, als Verlierer zurückzugehen.« Also blieb er, obwohl sein Herz blutete. Alles war so anders in Deutschland. Als er hier mit dem Zug ankam, blieb er unvermittelt am Bahnsteig stehen. Es lag kein einziger Zigarettenstummel auf dem Asphalt. Da hat Alejandro begriffen, dass er in einem fremden Land ist. Er hat angefangen, in Deutschland zu arbeiten – nur mit Tango, sagt er. Hat Unterricht gegeben, hat auf Shows getanzt. Wurde 1997 Mitbesitzer des »Universo Tango«, wo er zuvor schon als Lehrer gearbeitet hatte. Sein Freund José Gordóbil hatte den Laden mit ihm übernommen. José, deutlich älter als Alejandro, ist inzwischen in Rente. Jetzt bringt Alejandro den Tango im Alleingang nach Hamburg.
Beim Grünen Jäger liegt diese Tangowelt, versteckt hinter einem Hinterhofdurchgang, im Souterrain. Eine Bar, ein paar Stühle und Tische am Rand, große Spiegel und enorm viel Tanzfläche – hier also lebt Alejandro seine Leidenschaft aus. »Tango ist eine Passion«, sagt er. »Und das Lehrersein ist eine Passion, ich liebe es, Menschen etwas beizubringen. Und zu erkennen, wer was braucht, wer wie lernt, bei wem ich ein Gefühl auslösen kann.«
Seine Gefühle zu seiner neuen Heimat sind inzwischen ziemlich zementiert. Es gab eine Zeit, so um die 15 Jahre her, da hat er mit dem Gedanken gespielt, zurück nach Buenos Aires zu gehen. Aber er stellte verblüfft fest, dass er sich »adaptiert« hatte, so nennt er das. Sein Leben in Deutschland war gut, er hatte Freunde, eine Berufung, ein eigenes Business. Und dann hatte er Julia. Sie war seine Schülerin im »Universo Tango«. Zuerst mit ihrem Freund, dann ohne, Geschichte wiederholt sich manchmal doch. Sie wurden ein Paar, dann wurde Julia schwanger. Alejandro wurde Papa, mit 53, drei Jahre später kam die zweite Tochter. »Als meine Töchter kamen«, sagt er, »war Hamburg meine Heimat.« Was
aber nicht bedeutet, dass er zu Hause nicht doch traditionelle südamerikanische Verhältnisse bevorzugt. »Ich bin dann doch sehr Argentinier: Der Mann verdient das Geld, die Frau kümmert sich um die Familie«, sagt er. »Meine Sachen sind auch ihre Sachen, ich mache keine Verträge mit meiner Frau.«
Alejadro vermisst nicht mehr viel in Hamburg. »Ich bin zurückhaltend, deshalb fällt es mir nicht so schwer, mich mit der Mentalität hier zu identifizieren«, sagt er. Und auch er betont, dass Deutsche ihm viel geholfen haben. Er weiß das zu schätzen. Und hilft selbst – beim Heimweh anderer. »Wir sind nicht nur ein TangoStudio. Wir sind auch das zweite Zuhause für Südamerikaner, die sich in Hamburg allein fühlen.«
Neulich war er in Buenos Aires und hat seine Mutter besucht. Als sie sich voneinander verabschiedeten, weinte sie mehr als sonst. »Da wusste ich: Das wird das letzte Mal gewesen sein«, sagt er. Zwei Wochen später ist sie gestorben, mit 87. Jetzt hat Alejandro Sanguineti gar keine Wurzeln mehr in Argentinien. Die sind alle in Hamburg.


Große Visionen brauchen ein starkes Fundament. Deswegen unterstützen namhafte Partner aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik die Elbphilharmonie. Gemeinsam bilden sie ein Netzwerk, das die Elbphilharmonie als Konzerthaus von Weltrang begleitet. So ermöglichen sie ein Konzertprogramm mit einem unverwechselbaren musikalischen Profil, Musikvermittlungsideen für alle Generationen sowie innovative Festivalkonzepte, die Maßstäbe im internationalen Konzertbetrieb setzen.
DER S ti F tu NG E l BPH il H a RMON i E

MÄZENE
ZUWENDUNGEN AB 1.000.000 EURO
Prof. Dr. Dr. h. c. Helmut und Prof. Dr. h. c. Hannelore Greve
Prof. Dr. Michael Otto und Christl Otto
Hermann Reemtsma Stiftung
Christine und Klaus-Michael Kühne
Körber-Stiftung
Peter Möhrle Stiftung
Familie Dr. Karin Fischer
Reederei Claus-Peter Offen (GmbH & Co.) KG
Stiftung Maritim Hermann & Milena Ebel
Hans-Otto und Engelke Schümann Stiftung
Christiane und Klaus E. Oldendorff
Prof. Dr. Ernst und Nataly langner
PLATIN
ZUWENDUNGEN AB 100.000 EURO
ian und Barbara Karan-Stiftung
Gebr. Heinemann SE & Co. KG
Bernhard Schulte GmbH & Co. KG
Deutsche Bank aG
M. M. Warburg & CO
Hamburg Commercial Bank a G
lilli Driese
J. J. Ganzer Stiftung
Claus und annegret Budelmann
Berenberg – Privatbankiers seit 1590
Mara und Holger Cassens Stiftung
Christa und albert Büll
Christine und Heinz lehmann
Frank und Sigrid Blochmann
Else Schnabel
Edel Music + Books
Dr. Markus Warncke
Berit und Rainer Baumgarten
Christoph lohfert Stiftung
Eggert Voscherau
Hellmut und Kim-Eva Wempe
Günter und lieselotte Powalla
Martha Pulvermacher Stiftung
Heide + Günther Voigt
Gabriele und Peter Schwartzkopff
Dr. anneliese und Dr. Hendrik von Zitzewitz
Prof. Dr. Hans Jörn Braun †
Susanne und Karl Gernandt
Philipp J. Müller
ann-Mari und Georg von Rantzau
Dr. Gaby Schönhärl-Voss und Claus-Jürgen Voss
lennertz & Co.
Familie Schacht
GOLD
ZUWENDUNGEN AB 50.000 EURO
Rainer abicht Elbreederei
Christa und Peter Potenberg-Christoffersen
HER i S tO a G
Christian Böhm und Sigrid Neutzer
amy und Stefan Zuschke
SILBER
ZUWENDUNGEN AB 10.000 EURO
ärzte am Markt: Dr. Jörg arnswald, Dr. Hans-Carsten Braun
Baden-Württembergische Bank
Hans Brökel Stiftung für Wissenschaft und Kultur
Jürgen und amrey Burmester
Rolf Dammers OHG
Deutsche GigaNetz GmbH
EDEK aBaNK aG
FR oS ta a G
Katja Holert und thomas Nowak
Knott & Partner VD i
Jürgen Könnecke
Dr. Claus und Hannelore löwe
Stiftung Meier-Bruck
Steinway & Sons
BRONZE
ZUWENDUNGEN AB 5.000 EURO
ilse und Dr. Gerd Eichhorn
Hennig Engels
Dr. t Hecke und C. Müller
Marga und Erich Helfrich
Familie Klasen
Hannelore Krome
MedConsult Dr. R. J. Panny
Mercedes-Benz Hamburg
Carmen Radszuweit
Colleen B. Rosenblat
DES FRE u NDESKRE i SES E l BPH il H a RMON i E + la E i SZH all E

Jürgen abraham | andreas ackermann | anja ahlers |
Margret alwart | Karl-Johann andreae | Cornelius Back | undine Baum | Rainer und Berit Baumgarten |
Florian Baumgartner | Gert Hinnerk Behlmer | Michael Behrendt | Robert von Bennigsen | Joachim von Berenberg-Consbruch | Prof. Dr. Wolfgang Berlit | tobias Graf von Bernstorff | Peter Bettinghaus | Marlis und Franz-Hartwig Betz | Wolfgang Biedermann | alexander Birken | Dr. Frank Billand | Dr. Gottfried von Bismarck | Dr. Monika Blankenburg | ulrich Böcker | Birgit Bode | andreas Borcherding | tara Bosenick | Vicente Vento Bosch | Verena Brandt | Beatrix Breede | Heiner Brinkhege |
Nikolaus Broschek | Marie Brömmel | tobias Brinkhorst |
Claus-G. Budelmann | Engelbert Büning | amrey und Jürgen Burmester | Dr. Christian Cassebaum | Dr. Markus Conrad | Dr. Katja Conradi | Dierk und Dagmar Cordes | Familie Dammann | Carsten Deecke | Jan F. Demuth | ulrike und Karl Denkner | Dr. Peter Dickstein | Heribert
Diehl | Detlef Dinsel | Kurt Dohle | Benjamin Drehkopf | thomas Drehkopf | Oliver Drews | Klaus Driessen | Christian Dyckerhoff | Hermann Ebel | Stephanie Egerland | Claus Epe | Norbert Essing | Heike und John Feldmann | alexandra und Dr. Christian Flach | Dr. Peter Figge | Jörg
Finck | Gabriele von Foerster | Dr. Christoph Frankenheim |
Dr. Christian Friesecke | Sigrid Fuchs | Manhard Gerber |
Dr. Peter Glasmacher | Prof. Phillipp W. Goltermann | inge
Groh | annegret und Dr. Joachim Guntau | amelie Guth |
Michael Haentjes | Dr. Michael Halévy | Petra Hammelmann | andreas Hanitsch | Jochen Heins | Dr. Christine Hellmann |
Dr. Dieter Helmke | Jan-Hinnerk Helms | Kirsten Henniges | Rainer Herold | Gabriele und Henrik Hertz | Günter Hess |
Prof. Dr. Dr. Stefan Hillejan | Bärbel Hinck | Joachim Hipp |
Dr. Klaus-Stefan Hohenstatt | Christian Hoppenhöft |
Prof. Dr. Dr. Klaus J. Hopt | Dr. Stefanie Howaldt | Maria illies |
Dr. ulrich t Jäppelt | Dr. Johann Christian Jacobs | Heike
Jahr | Martin Freiherr von Jenisch | Roland Jung | Matthias Kallis | ian Kiru Karan | tom Kemcke | Klaus Kesting |
Prof. Dr. Stefan Kirmße | Renate Kleenworth | Dr. Saskia Kleier |
Jochen Knees | annemarie Köhlmoss | Matthias Kolbusa | Prof. Dr. irmtraud Koop | Petrus Koeleman | Bert E. König | Sebastian Krüper | arndt Kwiatkowski | Christiane lafeld | Dr. Klaus landry | Günther lang | Dirk lattemann | Per H. lauke | Hannelore lay | Dr. Claus liesner | lions Club Hamburg Elbphilharmonie | Dr. Claus löwe | Prof. Dr. Helgo Magnussen | Sibylle Doris Markert | Franz-Josef Marxen | thomas J. C. und angelika Matzen Stiftung | Helmut Meier | Gunter Mengers | axel Meyersiek | Dr. thomas Möller | Christian Möller | Karin Moojer-Deistler | ursula Morawski | Katrin Morawski-Zoepffel | Jan Murmann | Dr. Sven Murmann | Dr. ulrike Murmann | Julika und David M. Neumann | Michael R. Neumann | Franz Nienborg | Dr. Ekkehard Nümann | thilo Oelert | Dr. andreas M. Odefey | Dr. Michael Ollmann | Dr. Eva-Maria und Dr. Norbert Papst | Dirk Petersen | Dr. Sabine Pfeifer | Sabine Gräfin von Pfeil | aenne und Hartmut Pleitz | Bärbel Pokrandt | Hans-Detlef Pries | Karl-Heinz Ramke | Horst Rahe | ursula Rittstieg | Sibylle von Rauchhaupt | Prof. Dr. Hermann Rauhe | ursula Ross | Eberhard Runge |
Prof. Michael Rutz | Bernd Sager | Jens Schafaff | Birgit Schäfer | Mattias Schmelzer | Vera Schommartz | Katja Schmid von linstow | Dr. Hans ulrich und Gabriele Schmidt | Nikolaus H. Schües | Nikolaus W. Schües | Gabriele Schumpelick | ulrich Schütte | Dr. Susanne Staar | Henrik Stein | Prof. Dr. Volker Steinkraus | Wolf O. Storck | Dr. Patrick tegeder | Jörg tesch | Ewald tewes | ute tietz | Dr. Jörg thierfelder | Dr. tjark thies | Dr. Jens thomsen | tourismusverband Hamburg e. V. | Prof. Dr. Eckardt trowitzsch | John G. turner und Jerry G. Fischer | Resi tröber-Nowc | Hans ufer | Dr. Sven-Holger undritz | Markus Waitschies | Dr. Markus Warncke | thomas Weinmann | Peter Wesselhoeft | Dr. Gerhard Wetzel | Erika Wiebecke-Dihlmann | ulrich Winkel | Dr. andreas Witzig | Dr. thomas Wülfing | Christa Wünsche | Stefan Zuschke
Sowie weitere Kuratorinnen und Kuratoren, die nicht genannt werden möchten.
VORSTAND: alexander Birken (Vorsitzender), Roger Hönig (Schatzmeister), Henrik Hertz, Bert E. König, Magnus Graf lambsdorff, Katja Schmid von linstow und Dr. ulrike Murmann
EHRENMITGLIEDER: Christian Dyckerhoff, Dr. Karin Fischer †, Manhard Gerber, Prof. Dr. Dr. h. c. Helmut Greve †, Prof. Dr. h. c. Hannelore Greve †, Nikolaus H. Schües, Nikolaus W. Schües, Dr. Jochen Stachow †, Prof. Dr. Michael Otto und Jutta a Palmer †
DER u N t ERNEHMERKRE i S DER E l BPH il H a RMON i E
a B a C u S a sset Management GmbH
a ddleshaw Goddard ll P
a HN & S i MROCK Bühnen- und Musikverlag GmbH
allC u R a Versicherungs- a ktiengesellschaft
a llen Overy ll P
apoproject GmbH
a-tour a rchitekturführungen
Bankhaus DONNER & RE u SCHE l Barkassen-Meyer
BBS Werbeagentur
BDV Behrens GmbH
Bornhold Die Einrichter
Braun Hamburg
British a merican tobacco Germany
C. a . & W. von der Meden
C lay StON
Company Companions
Dienstleistungsgesellschaft der Norddeutschen Wirtschaft
Drawing Room
Dungeon Deutschland GmbH
ENERPa RC
Engel & Völkers Hamburg Projektvermarktung
Engel & Völkers Holding GmbH
Esche Schümann Commichau
Eventteam GmbH
Fortune Hotels
FR a NK -Gruppe
Freshfields Bruckhaus Deringer
FR i Ba i nvestment
G a RBE
Germerott i nnenausbau GmbH & Co. KG
GERRESHE i M serviert GmbH & Co. KG
Gese & Cie Personalberatung GmbH
Grundstücksgesellschaft Bergstrasse
Hamburg team
Hanse l ounge, t he Private Business Club
Heinrich Wegener & Sohn Bunkergesellschaft
Hermann Hollmann GmbH & Co.
HH la
Hotel Wedina Hamburg
i K i nvestment Partners
i NP Holding aG
i ris von a rnim
J a R a HO l D i NG GmbH
i N t ERN ati ON al ES M u S i KFES t H a MB u RG
Jürgen a braham
Corinna a renhold- l efebvre und Nadja Duken i ngeborg Prinzessin zu Schleswig-Holstein und Nikolaus Broschek a nnegret und Claus-G. Budelmann
Christa und a lbert Büll
Gudrun und Georg Joachim Claussen
Birgit Gerlach u lrieke Jürs
Ernst Peter Komrowski
Dr. u do Kopka und Jeremy Zhijun Zeng
Helga und Michael Krämer
Christine und Heinz l ehmann
Martha Pulvermacher Stiftung
Joop!
Kahl Holding
Kesseböhmer Holding KG
K l B Handels GmbH
Klinische Forschung Beteiligungsgesellschaft mbH
Konzertdirektion Dr. Rudolf Goette GmbH
l auenstein & l au i mmobilien
l ehmann i mmobilien
l ennertz & Co. GmbH
loved GmbH
l upp + Partner
Madison Hotel
Malereibetrieb Otto Gerber GmbH
Miniatur Wunderland
MRH trowe aG Holding nordwest Factoring und Service GmbH
Notare am Gänsemarkt
Oppenhoff
Otto Dörner GmbH & Co. KG
P lat H Corporation GmbH
print-o-tec GmbH
Rosenthal Chausseestraße GbR
ROX all Group
Schlüter & Maack GmbH
Service-Bund GmbH & Co. KG
Seydlitz GmbH
SHP Primaflex GmbH
Steinway & Sons
Stolle Sanitätshaus GmbH
S t R a H l ENZEN t R u M H a MB u RG MVZ
Strebeg Verwaltungsgesellschaft mbH
taylor Wessing
t he Fontenay Hotel
trainingsManufaktur Dreiklang u BS Europe SE Hamburg u nger Hamburg
Vladi Private i slands
Weischer.Media
Worlée Chemie GmbH Wünsche Handelsgesellschaft
Sowie weitere u nternehmen, die nicht genannt werden möchten.

Marion Meyenburg
K. & S. Müller
Christiane und Dr. l utz Peters ä nne und Hartmut Pleitz
Bettina und Otto Schacht
Engelke Schümann
Margaret und Jochen Spethmann
Birgit Steenholdt-Schütt und Hertigk Diefenbach a nja und Dr. Fred Wendt
Susanne Wogart
Sowie weitere Förderer, die nicht genannt werden möchten.
D i E Pa Rt NER DER E l BPH il H a RMON i E
PRINCIPAL SPONSORS


PRODUCT SPONSORS




FÖRDERSTIFTUNGEN





Herausgeber HamburgMusik gGmbH
Geschäftsführer: Christoph lieben-Seutter (Generalintendant), Jochen Margedant
Platz der Deutschen Einheit 4, 20457 Hamburg magazin@elbphilharmonie.de www.elbphilharmonie.de
Chefredakteur Carsten Fastner
Redaktion Katharina allmüller, Melanie Kämpermann, Clemens Matuschek, tom R. Schulz; Gilda Fernández-Wiencken (Bild)
Formgebung GROOt H ui S . Gesellschaft der ideen und Passionen mbH für Kommunikation und Medien, Marketing und Gestaltung; groothuis.de Gestaltung lina Jeppener (leitung), Janina lentföhr, lars Hammer; Bildredaktion angela Wahl; Herstellung Sophie Gabel; Projektleitung alexander von Oheimb; CvD Rainer Groothuis
Beiträge in dieser Ausgabe von Stephan Bartels, Simon Chlosta, Stefan Franzen, aras Gökten, Hanno Grahl, Volker Hagedorn, lars Hammer, anselm M. Hirschhäuser, Gesche Jäger, Clemens Matuschek, Regine Müller, Jan Paersch, till Raether, ivana Rajicˇ, Nadine Redlich, Peter Reichelt, Claudia Schiller, tom R. Schulz, albrecht Selge, Bjørn Woll
Lithografie alexander langenhagen, edelweiß publish, Hamburg
Druck Gutenberg Beuys Feindruckerei GmbH
Dieses Magazin wurde klimaneutral auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft produziert.
Korrektorat Ferdinand leopold
Anzeigenleitung
antje Sievert, anzeigen Marketingberatung Sponsoring tel: 040 450 698 03, office@kultur-anzeigen.com
Vertrieb Pressup GmbH, Hamburg
Leserservice / Abonnement
Elbphilharmonie Magazin leserservice Pressup GmbH
Postfach 70 13 11, 22013 Hamburg
leserservice@elbphilharmonie.de tel: 040 386 666 343, Fax: 040 386 666 299
Das Elbphilharmonie Magazin erscheint dreimal jährlich.
Bild- und Rechtenachweise
Cover: aras Gökten; S. 1 Michael Zapf; S. 2 links: picture alliance / REutERS / ERiC GaillaRD, mitte oben: Julien Mignot for harmonia mundi, mitte unten: inez & Vinoodh, S. 3 oben: M-Production / alamy Stock Foto, unten links: arnold Schönberg Center / Wien, unten rechts: Ebru yildiz; S. 4 Folhapress, S. 5 oben und unten: Historic Collection / alamy Stock Foto, mitte: Keystone Press / alamy Stock Foto, S. 6 oben: World History archive / alamy Stock Foto, mitte: iMaGO / Everett Collection , S. 7 unten: picture alliance / KEyStONE / JEaN-Guy PytHON, mitte: picture alliance / KEyStONE / StR, S. 8 mitte: picture alliance / age fotostock Spain / Rafael De la Camara, unten: ullstein bild / arenaPal / Jak Kilby, S. 9 picture alliance / Photoshot; S. 10-16 arnold Schönberg Center / Wien; S. 18-24 anselm M. Hirschhäuser; S. 26-27 lars Hammer; S. 28 links: picture alliance / REutERS / JOHaNNa GERON, rechts: picture alliance / aFP Creative / JOEl SaGEt, S. 30 Smith archive / alamy Stock Foto, S. 31 picture alliance / aSSOCiatED PRESS; S. 34 Julien Mignot, S. 36 Daniel Dittus; S. 38-45 aras Gökten; S. 46 donato r / alamy Stock Foto, S. 48 oben: akg-images / andré Held, mitte: picture alliance / Pacific Press / Fabio Sasso, S. 49 ZuMa Press, inc. / alamy Stock Foto, S. 50 oben: antonio Busiello / alamy Stock Foto, unten: Enrico Della Pietra / alamy Stock Foto; S. 52 Edd Westmacott / alamy Stock Foto, S. 53 Mark Makin, S. 54 Mario Sorrenti; S. 56 Gesche Jäger; S. 58 und 62 Ebru yildiz, S. 60 lisa Rinzler, S. 61 Claudia Höhne; S. 64 oben: privat, mitte: Marco Dalbon, unten: Raphael Neal, S. 65 oben links: Dylan Coker, oben rechts: 10th District Music / tswarelo Mothobe, unten links: Studio 52 / london, unten rechts: Claudia Höhne; S. 66 picture alliance / Heritage art / Heritage images, S. 68 bpk / lutz Braun; S. 70 Nadine Redlich; S. 72-75 Gesche Jäger; S. 76-81 Hayley austin; S. 82 trigger Photo / istockphoto, S. 84 alexander tarassov / istockphoto, S. 86 Robert Hoetink / istockphoto; S. 88 aras Gökten
Redaktionsschluss 10. Juli 2024 änderungen vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Printed in Germany. alle Rechte vorbehalten.
träger der HamburgMusik gGmbH:


Der neue Taycan und die Elbphilharmonie sind mit der gleichen Vision erschaffen worden. – Alle Teile wirken perfekt orchestriert zusammen, um uns dieses eine Erlebnis zu schenken: Overfeel. OVERFEEL. IM NEUEN VOLLELEKTRISCHEN TAYCAN.
Tierversicherungen
Mit unserem Gesundheitsschutz für Hunde und Katzen ist Ihr treuer Begleiter jederzeit optimal abgesichert. Denn die HanseMerkur übernimmt bis zu 100 Prozent der Kosten für Behandlung, OP, Nachsorge und Medikamente – und das weltweit und bei jeder Rasse. Das zeigt: Hand in Hand ist HanseMerkur.

