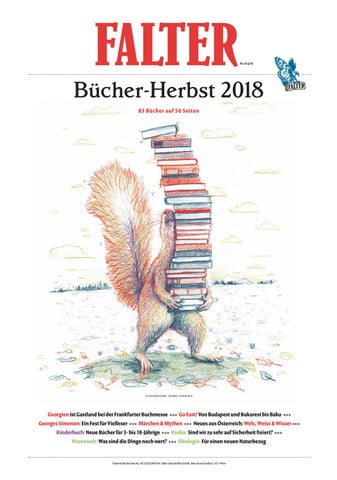FALTER
Nr. 41a/18
Bücher-Herbst 2018 83 Bücher auf 56 Seiten
ILLUSTR ATION: GEORG FEIERFEIL
Georgien ist Gastland bei der Frankfurter Buchmesse +++ Go East! Von Budapest und Bukarest bis Baku +++ Georges Simenon: Ein Fest für Vielleser +++ Märchen & Mythen +++ Neues aus Österreich: Wels, Weiss & Wisser +++ Kinderbuch: Neue Bücher für 3- bis 18-Jährige +++ Risiko: Sind wir zu sehr auf Sicherheit fixiert? +++ Warenwelt: Was sind die Dinge noch wert? +++ Ökologie: Für einen neuen Naturbezug
Österreichische Post AG, WZ 02Z033405 W, Falter Zeitschriften GmbH, Marc-Aurel-Straße 9, 1011 Wien
BILDUNG & SOZIALES
GESUNDHEIT & NATURWISSENSCHAFTEN
INTERNATIONALES & WIRTSCHAFT
KOMMUNIKATION & MEDIEN
RECHT
Jeder Tag ist eine neue Chance, das zu tun, was du möchtest. Friedrich von Schiller
Weiterbilden an der Universität Wien • Masterprogramme • Universitätslehrgänge • Zertifikatskurse
www.postgraduatecenter.at
e d i t o r i a l s & I n h a l t F A L T E R 4 1 / 1 8 Klaus Nüchtern begab sich diesmal in die Wirren des Russischen Bürgerkriegs
Kirstin Breitenfellner betreut neben dem Sachbuch auch das Kinderbuch
Belletristik
Sachbücher
Unser belletristischer Blick schweift diesmal weit nach Osten – das liegt nicht nur daran, dass Georgien Gastland bei der Buchmesse ist. Es wird beherzt alliteriert (Wels, Wisser, Weiss), Georges Simenon wird gewürdigt, und einen kleinen Mythen/Märchen-Schwerpunkt gibt’s auch noch
Wir leben in Umbruchszeiten, in denen das Sicherheitsbedürfnis steigt. Aber Leben bedeutet Risiko – damit befasst sich der Aufmacher dieses Teils. Zahlreiche Neuerscheinungen widmen sich dem Umbruch selbst. Weitere Themen: Ökonomie der Dinge, Ökologie der Angst, Autismus.
Liter atur
Kinderbuch
Der weite Osten Russische Revolutionsliteratur Michail Bulgakows „Weiße Garde“ wurde neu übersetzt, „Die Reiterarmee“ von Isaak Babel neu aufgelegt ��������������������������� 4 Lew Tolstoi und Essad Bey begeben sich in den Kaukasus ����������� 6 Postjugoslawischer Pallawatsch: Goran Vojnovićs Familienroman „Unter dem Feigenbaum“ ������������������������������������� 7 Zweimal Ungarn Andor Endre Gelléri und Lászlo Krasznahorkai ��� 8 Ein rumänischer Klassiker „Verlorener Morgen“ �������������������� 9
Bilderbuch Schlechtwetter, Wölfe, Wale und Berge ������������������� 28 Kinderbuch Schlossgespenster, Dachse und Mäuse ������������������ 30 Jugendbuch Coming-of-Age-Geschichten ab 12 Jahren ������������� 31
Literatur aus Georgien Nino Haratischwili liefert „Die Katze und der General“ ������������ 10 Guram Dotschanaschwili schrieb „Das erste Gewand“............. 11 Dawit Kldiaschwili und Zaza Burchuladze ������������������������ 12 Poesie der Roma und Sinti .................................................... 13 Claus Philipp würdigt Georges Simenon ���������������������������� 14 Romane von Delphine de Vigan und Eckhart Nickel . �������������������������������������������������������������������� 16 Man/frau schreibt Deutsch „Nachtleuchten“ von Maria Cecilia Barbetta ������������������������� 17 Karen Duve widmet sich Annette von Droste-Hülshoff �������������� 18 „Königin der Berge“ ist das Opus magnum von Daniel Wisser ��� 19 Neues von Julian Schutting, Erstes von Marie Gamillscheg �� 20 „Edelweiß“, ein Roman über das Kriegsende, von Günter Wels ��� 21 1 Roman, 5 Bücher, 1000 Seiten: Das Debüt von Philipp Weiss 22 Märchen und Mythen Die Gebrüder Grimm, neu gemixt von Franz Josef Czernin 23 Sagen des Altertums, nacherzählt von Stephen Fry ������������ 24 „Anansi Boys“ von Neil Gaiman ���������������������������������������������� 25 In English, please! „Mein Jahr der Ruhe und Entspannung“ – Ottessa Moshfegh ��� 26 „Im Kern eine Liebesgeschichte“ von Elizabeth McKenzie ��� 26 Stan Laurel ist der Protagonist von John Connollys „Stan“ ���������� 27
Sachbuch Lebenskunst Anne Dufourmantelle und Nassim Nicholas Taleb brechen eine Lanze für das Risiko ������������������������������������������������ 32 Kulturtheorie Alessandro Baricco kann mir Barbaren leben �������� 34 Wirtschaft Shoshanna Zuboff über den Überwachungskapitalismus 35 Warenwelt Drei neue Bücher über Waren im Kapitalismus ����������� 36 Kulturtheorie Hannelore Schlaffer und Alexander Grau konstatieren einen Niedergang des Intellektuellen und der Hochkultur ��� 38 Philosophie Rudolf Burger legt einen überarbeiteten geschichtstheoretischen Essay vor �������������������������������������������� 39 Medienkultur Caspar Hirschi analysiert die Funktion von Experten in der Öffentlichkeit �������������������������������������������������� 40 Kulturgeschichte Valentin Groebner untersucht die Sucht nach Authentizität im Geschichtstourismus �������������������������������� 41 Literaturbetrieb Tipps für angehende Literaten ���������������������� 42 Sport Ernst Peter Fischers Geschichte des Sports scheitert ���������� 42 Philosophie Axel Honneth analysiert den Anerkennungsbegriff �� 43 Ökologie Jens Soentgen, Susanne Dohrn und Birgit Schneider plädieren für mehr Naturbezug und gegen Endzeitstimmung ������ 44 Soziologie Elisabeth von Thadden untersucht Berührungen ������� 46 Architektur Roma Agrawal singt ein Loblied der Bauingenieure �� 46 Integration Max Czollek stellt Fragen zum Thema Integration ���� 47 Autismus Hans Asperger und Henry Makram bilden die entgegengesetzten Pole der Autismusforschung ������������������������� 48 Biografie Zum 50. Todestag würdigt eine Biografie von David Rennert und Tanja Traxler die Kernphysikerin Lise Meitner ��� 49 Utopien Alberto Manguel führt in einem Prachtband durch 500 Jahre utopisches Denken ���������������������������������������������������� 49 Biologie Peter Iwaniewicz und Helmut Höge beobachten Tiere ��� 50 Biografie Volker Reinhardt legt eine Leonardo-Biografie vor ������� 51 Südosteuropa Kapka Kassabova im Interview über die Geschichte der Grenzregion Bulgarien-Griechenland-Türkei ���������� 52 Geschichte Juri Slezkine schreibt 1300 Seiten über ein Moskauer Haus ����������������������������������������������������������������������� 53 Kochen Rezepte, Rezepte, Rezepte ������������������������������������������ 54
Frauen. Wahl. Recht. ANTHOLOGIE Die Literaturedition Niederösterreich setzt sich mit einer Neuerscheinung im Herbst 2018 mit dem 100jährigen Bestehen des Frauenwahlrechts auseinander. Die Anthologie „Frauen.Wahl. Recht“ versammelt literarische und essayistische Texte in beglückender Vielfalt von Schriftstellerinnen
unterschiedlicher
Generationen aus Niederösterreich. Mit Beiträgen von: Zdenka Becker, Gudrun Büchler, Sandra Gugić, Simone Hirth, Katharina
Peham,
Corinna
Oesch, Eva Rossmann, Elisabeth v. Samsonow, Lydia Steinbacher, Marlene Streeruwitz, Cornelia Travnicek und Magda Woitzuck Hrsg. Isabella Feimer 168 Seiten Hardcover, 19 x 28 cm
Illustrationen Schorsch Feierfeil gestaltet CD-Covers, animiert Musikvideos, erledigt Grafikjobs, organisiert intertonale Musikseminare mit und leitet Workshops. Vor allem aber illustriert er seit nunmehr knapp einem Sechstel seiner Lebensjahre für den FALTER. Er lebt und arbeitet in Wien. I m pr e s s u m Falter 41a/18 Herausgeber: Armin Thurnher Medieninhaber: Falter Zeitschriften Gesellschaft m.b.H., 1011 Wien, Marc-Aurel-Str. 9, T: 01/536 60-0, F: 01/536 60-912, E: wienzeit@falter.at Redaktion: Kirstin Breitenfellner, Klaus Nüchtern Herstellung: Falter Verlagsgesellschaft m.b.H.; Layout: Barbara Blaha, Reini Hackl, Andreas Rosenthal; Korrektur: Helmut Gutbrunner, Patrick Sabbagh, Rainer Sigl; Geschäftsführung: Siegmar Schlager; Anzeigenleitung: Sigrid Johler Druck: Passauer Neue Presse Druck GmbH, 94036 Passau DVR: 047 69 86. Alle Rechte, auch die der Übernahme von Beiträgen nach § 44 Abs. 1 und 2 Urheberrechtsgesetz, vorbehalten. Die Offenlegung gemäß § 25 MG ist unter www.falter.at/offenlegung/falter ständig abrufbar Bücher-Herbst ist eine entgeltliche Einschaltung aufgrund einer Subvention durch das
ISBN 978-3-902717-47-4 € 20,--
www.literaturedition-noe.at www.kultur.noe.at
3
4
F A L T E R 4 1 / 1 8 L i t e r a t u r
Sonne, Mond und Pferde Michail Bulgakow und Isaak Babel haben der Literaturgeschichte zwei ambitionierte und aufwühlende Aufarbeitungen des Russischen Bürgerkriegs hinterlassen
E
die Fronten klar gewesen, so sah sich die Zivilbevölkerung, die schon davor durch Bombardements und Hungerblockaden unmittelbar zum Zielobjekt der Kriegsführung geworden war, im Bürgerkrieg, der ein Vielfaches an Todesopfern forderte, der brutalen und anarchischen Willkür aller Seiten ausgesetzt – ob nun das Rassen- oder Klassenressentiment ein ideologisches Mäntelchen trug oder sich Raub- und Mordlust ganz ohne ein solches austoben mochte. Bei Bulgakow (der im Übrigen von der Roten Armee zu den Weißen übergelaufen war) manifestiert sich die ständig präsente und paranoid ausufernde Bedrohung in einem Namen, Waren im Weltkrieg wenigstens
der wie ein Gespenst durch den ganzen Roman spukt: „Petljura“- bzw. „Päturrah!“-Rufen hallen durch die Gassen Kiews (hier stets als „die große Stadt“ geführt), ohne dass sich der Vielbeschworene je zeigen würde: „Es heißt, Petljura ist auf dem Platz. Los, wir wollen Petljura sehen. – Dumme Kuh, Petljura ist in der Kathedrale. – Selber dumme Kuh. Es heißt, er kommt auf einem weißen Pferd.“ Symon Petljura, der in den wohl zu Recht so genannten „Wirren“ des Bürgerkriegs gegen die Roten, aber auch gegen die Weißen, die Polen und den ukrainischen, von der deutschen Interventionsarmee eingesetzten Hetman Pawlo Skoropadskyj kämpfte, war
im Februar 1919 von den Bolschewiki schon wieder aus Kiew vertrieben worden. Die knapp zwei Monate davor bilden den zeitlich eng begrenzten Rahmen für die alles andere als lineare Handlung des Romans. Das weiße Pferd aber, auf dem der Vielbeschworene angeblich einreiten soll, weckt Assoziationen an die apokalyptischen Reiter der Offenbarung, die in der „Weißen Garde“ wiederholt ganz explizit zitiert wird und in der russischen Literatur der damaligen Zeit überhaupt eine große Rolle spielt. So tragen die Romane des Anarchisten, Terroristen, Politikers und Publizisten Boris Sawinkow – im übri-
gen ebenfalls von Alexander Nitzberg übersetzt – die Titel „Das fahle Pferd“ und „Das schwarze Pferd“. Zugleich steht das Pferd für die geschundene Kreatur schlechthin. Einer unbewiesenen Legende zufolge hatte sich Friedrich Nietzsche in Turin unter Tränen buchstäblich an den Hals eines vom Kutscher misshandelten Pferdes geworfen, und ein solches steht bekanntlich auch im Zentrum von Pablo Picassos Monumentalgemälde „Guernica“ (1937), das die Zerstörung der gleichnamigen Stadt durch das Bombardement der Legion Condor im Spanischen Bürgerkrieg zum Thema hat. Und in Sergej Eisensteins Revolutionsfilm „Oktober“
Illustr ation: georg feierfeil
in gewaltiges Jahr, ein furchtbares Jahr war nach Christus das Jahr 1918, nach der Revolution das Jahr 2. Viel Sonne im Sommer, viel Schnee im Winter, und höher als sonst standen am Himmel zwei Sterne: Der Stern der Hirten – die abendliche Venus – und der rot zitternde Mars.“ So beginnt – wuchtig, biblisch, unheilschwanger – Michail Bulgakows Debütroman „Die weiße Garde“; zunächst in Teilen abgedruckt 1924 in der bald darauf eingestellten Zeitschrift Rossija; in der Sowjetunion erst 1966 vollständig in Buchform erschienen; soeben in einer Neuübersetzung Alexander Nitzbergs herausgekommen (der davor bereits Bulgakows „Meister und Margarita“, „Das hündische Herz“ und „Die verfluchten Eier“ neu übertragen hat). Zugrunde gelegt sind dem Roman persönliche Erfahrungen des Autors. Wie sein Protagonist Alexej, mit 28 Jahren der älteste der Geschwister Turbin, war Bulgakow Arzt von Beruf und als solcher zur ukrainischen Armee eingezogen worden. Im Gegensatz zu diesem aber kämpfte er aufseiten der „Weißen“ gegen die Bolschewiki. Der US-Historiker George F. Ken nan hat den Ersten Weltkrieg als die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet. So gesehen kann man die vielfach verklärte Russische Revolution, also den lange vor Stalin in Terror mündenden bolschewistischen Putsch und den anschließenden Bürgerkrieg, durchaus als Teil dieser Katastrophe betrachten.
LITER ATUR
»
Das Pferd in der russischen Literatur des frühen 20. Jahrhunderts spielt vielfach auf die apokalyptischen Reiter der Offenbarung an und steht zugleich ganz generell für die geschundene Kreatur
(1928) verkörpert der Leichnam eines von der hochgezogenen Brücke stürzenden Kutschengauls die (proletarischen) Opfer der Revolution. Auch „Die Reiterarmee“ partizipiert an diesem keineswegs nur symbolisch gestifteten Zusammenhang. Der nun wieder aufgelegte Text in der Übersetzung Peter Urbans, der mit „Erzählband“ nur sehr unzureichend charakterisiert wäre und von seinem Verfasser, dem aus Odessa gebürtigen und den „Säuberungen“ Stalins zum Opfer gefallenen Isaak Babel (1849–1940), nicht zu Unrecht als „Gedichte in Prosa“ apostrophiert wurde, ist ein Stationendrama des Bürger- und des sowjetisch-polnischen Krieges. In beiden befehligte der ursprünglich in der Armee des Zaren dienende, unter seinem Freund Stalin aufgestiegene und zum Helden verklärte General Semjon Budënnyj die nicht minder mythenumrankte Reiterarmee. Babel, der sich freiwillig zur Roten Ar-
FOTOS: PUBLIC DOMAIN
Michail Bulgakow (1891–1940), in Kiew geboren, war Arzt und kämpfte aufseiten der Weißen gegen die Bolschewiki Michail Bulgakow: Die weiße Garde. Roman. Aus dem Russ. übersetzt, kommentiert und mit einem Nachwort von Alexander Nitzberg. Galiani Berlin, 544 S., € 30,90
mee gemeldet hatte, hat viele der meist nur wenigen Seiten umfassenden literarischen Berichte mit Ort und Datum versehen. „Novograd-Volynsk, Juli 1920“ steht am Ende des ersten Stücks „Die Überschreitung des Zbruč“ (ehemals Grenze zwischen dem Königreich Polen und dem russischen Reich), in dem Babel alle Register seiner poetischen Imaginationskraft zieht, die mitunter auch die Grenzen zum Geschmäcklerischen überschreitet: „Das stille Wolhynien windet sich, Wolhynien verschwindet vor uns in den perlgrauen Nebel der Birkenwälder (…) Die orangefarbene Sonne rollt über den Himmel, wie ein abgehackter Kopf, zärtliches Licht entbrennt an den Wolkenschluchten, und die Standarten des Sonnenunterganges wehen über unseren Köpfen. Der Geruch von gestrigem Blut und getöteten Pferden tropft in die Abendkühle.“
Babel, bei dem der Mond schon mal einem billigen Ohrring oder einer grünen Eidechse gleicht, neigt mitunter auch zu einer Ästhetisierung des Entsetzlichen, die ihn indes nicht dazu verleitet, das Entsetzen zu verschweigen oder zu beschönigen. Auch wenn Klarnamen der Beteiligten oder einschlägige Stellen später geändert respektive getilgt wurden, ist es erstaunlich, was die Zensur dem unter dem russischen Namen Kirill V. Ljutov als „embedded journalist“ agierenden Babel alles hat durchgehen lassen. Über die am Rande des hauptsächlich von Juden bewohnten Ortes Berestečko lebenden russischen Kleinbürger etwa heißt es: „Die Nachbarschaft dreier Volksstämme, arbeitsamer und geschäftstüchtiger, hat in ihnen einen sturen Arbeitseifer geweckt, der dem Russen bisweilen eignet, wenn er noch nicht verlaust, noch nicht verzweifelt und dem Suff noch nicht ergeben ist.“ Seine eigene Aufnahme in den Verband der unter dem Schlachtruf „Schlagt die Kommunisten, Kommissare und Juden – rettet Russland!“ an die polnische Front ziehenden Reiterarmee schildert der Jude Babel in „Meine erste Gans“. Dass so einer wie er dort kein leichtes Leben haben wird, macht ihm nach den ersten Erniedrigungsritualen der Quartiermeister unmissverständlich klar: „Eine Schinderei ist das bei uns mit Brille, da ist nichts zu machen. Einer mit höherer Einbildung, dem ärgern sie hier die Seele aus dem Leib. Aber missbrauchen Sie eine Dame, eine ganz reine Dame, dann tragen euch die Kämpfer auf Händen …“ Vergewaltigung ist ebenso an der Tages-
ordnung wie die Misshandlung oder Ermordung von Menschen, die mehr oder weniger nach Gusto als Verräter, Klassenfeinde oder Juden identifiziert werden. Zum Glück für den Neuling und Pech für diese kreuzt eine Gans dessen Weg: „Ich holte sie ein und drückte sie zu Boden, der Gänsekopf krachte unter meinem Stiefel, krachte und begann zu bluten. Der weiße Hals lag ausgestreckt im Mist, und die Flügel senkten sich über dem getöteten Vogel. – Himmelmuttergottesverdammich, – sagte ich, mit dem Säbel in der Gans stochernd, – brat sie mir, Bäurin.“ Damit hat sich das g’studierte Bürscherl rascher Respekt verschafft, als es hoffen durfte: „– Der Knabe passt zu uns, – sagte einer von ihnen über mich, zwinkerte und teilte mit dem Löffel Suppe aus.“ Babel, dieser „Thukydides des letzten europäischen Reiterkriegs“, sei weit davon entfernt, „im Kosaken den edlen Wilden entdecken zu wollen“, und rühre, so schreibt Ulrich Rauff in seinem Buch „Das letzte Jahrhundert der Pferde“, „an eine Ebene, auf der sich Kosaken, Juden und Pferde begegnen. Es ist die Ebene des Kreatürlichen, die Zone derer, denen zu sterben bestimmt ist, früher oder später, wahrscheinlich schon bald.“ Der Tod ist im Leben immer möglich, gewinnt im (Bürger-)Krieg aber plötzlich grausam konturierte Wahr-
F A LT E R 41/ 18
5
scheinlichkeit. Davon handelt auch „Die weiße Garde“, in dem der erst 17jährige Nikolka den Tod eines gegen Petljura kämpfenden Generals (dessen Leiche später in einer zutiefst grusligen Szene im Anatomischen Theater identifiziert wird) gleichsam live miterlebt; sein von fantastisch dargestellten Fieberdelirien heimgesuchter Bruder Alexej beinahe am Typhus abkratzt; und ein gewisser Wassilij Lissowitsch, „Wassilissa“ genannt, nur mit knapper Not der Ermordung durch plündernde Soldaten entgeht. Im Unterschied zu Babel, der seinen lyrischen Expressionismus mit dem Jargon der Bolschewiki und der Umgangssprache bildungsferner Schichten zu einem idiosynkratischen, aber überzeugenden Stilmix zu amalgamieren versteht, ergeben die idiomatischen und syntaktischen Lizenzen, die sich der zu allerlei avantgardistischer Allotria aufgelegte Bulgakow selbst erteilt, kein Ganzes. Grandios in einzelnen Szenen und vor allem in seinen Rauminszenierungen ist der Roman nicht nur eine „fordernde Lektüre“ – wie’s dann gerne beschönigend heißt –, sondern stellenweise schlicht gaga. Weil aber Neuübersetzungen so tun müs-
sen, als seien alle anderen rettungslos veraltet, geglättet, überholt, hat der Übersetzer, der statt eines brauch- und lesbaren Nachworts eine editionshistorische Diplomarbeit verfasst und seine Fußnoten mit überflüssigem Wissen vollgestopft hat (Bulgakows „Akazie“ ist botanisch korrekt als „Scheinakazie“ zu identifizieren!), es sich angelegen sein lassen, die Manierismen noch auf die Spitze zu treiben. Bei ihm ist es nicht damit getan, dass die Fenster „klirren“ wie in der Übersetzung von Larissa Robiné (1992), sie müssen „schlottern“. Und wenn der erwähnte Plünderer Wassilissa zur Rede stellt, liest sich die bei Robiné in kolloquiales Hochdeutsch übertragene Rede bei Nitzberg so: „Gucken sollse! Dem seine Füße sin’ näm’ch abgefror’n, zerlumpt, er verrottet für dich im Schütz’ngr’m, währ’nd du in der schicken Bude sitzt und auf so ’nem Grammophon klimperst.“ Das mag Ernst Jandl auf seiner Wolke ein Schmunzeln entlocken, dem gemeinen Leser kann dergleichen forciertes und eitles Bildungsgeklimper dann aber doch ein wenig auf die Nerven gehen. K L AUS NÜCHTERN Isaak Babel (1894–1940), in Odessa geboren, diente in der Roten Armee und fiel den Säuberungen Stalins zum Opfer Issak Babel: Die Reiterarmee. Aus dem Russischen übersetzt, kommentiert und herausgegeben von Peter Urban. Friedenauer Presse, 320 S., € 20,60
F A L T E R 4 1 / 1 8 L i t e r a t u r
6
Der Kaukasus bleibt eine harte Nuss Der empathische Lew Tolstoi und der hallodrihafte Essad Bey nähern sich einer konfliktreichen Völkerwelt
G
änzlich unbekannt sind Lew Tolstois vier Erzählungen über den „Krieg im Kaukasus“ nicht. Auch Übersetzungen ins Deutsche wurden schon vor langer Zeit veröffentlicht. Und doch haben die von Rosemarie Tietze herausgegebenen, neu übersetzten und kommentierten Prosastücke durchaus das Zeug, eine heutige Leserschaft von neuem zu interessieren und zu faszinieren. Denn Tolstoi erweist sich auch abseits seiner großen Romane als packender Erzähler, scharfer Beobachter und kritischer Analytiker. „Krieg im Kaukasus“ ergibt keine runde Geschichte über die bis 1864 stattfindende russische Landnahme und deren größere und kleinere Verbrechen. Tolstoi greift sich in diesen Erzählungen aus unterschiedlichen Schaffensjahren einzelne Episoden heraus, liefert kräftige Psychogramme und starke Schicksale und schildert – ergänzt durch Zeichnungen – wie ein Ethnograf das Dorfleben in den Bergen des Kaukasus. Schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts waren die bis heute kursierenden Kaukasuslegenden wirksam; und auch Tolstoi kann und will sich als Erzähler einer gewissen Mythisierung nicht entziehen. Tüchtige Reiter, kaltblütige Krieger, stolze, schöne Frauen (meist mit „schwarzen Johannisbeeraugen“), launige Greise erscheinen auf dieser grandiosen Naturbühne, die Tolstoi auch idyllisiert, indem er Sprichwörter, Lieder und Legenden einbringt. Vor solch einer Kulisse fällt die Charakterisie-
rung der russischen Zivilisatoren ziemlich übel aus. Der Zar in Petersburg bekommt erstaunlich böse Breitseiten ab, die russischen Offiziere schieben sich als selbstverliebte Kohorte ins Bild, die – feig, versoffen und korrupt – einzig auf Auszeichnungen und Karriere bedacht ist. Der Krieg vollzieht sich mehr en passant als in gewaltigen Schlachten, die russische Armee schließt Bündnisse mit einzelnen Ethnien (etwa den Kosaken), arbeitet sich mit Festungen oder großflächigen Rodungen in die unwegsamen Regionen vor. Als fatal erweisen sich die achtlosen Brandschatzungen der Besatzer, die Behausung, Ernte und Infrastruktur der geflüchteten Bergbevölkerung vernichten und weiter an der Spirale von Elend, Verbitterung und Widerstand drehen. Tolstois unvoreingenommener, fast postkolonialer Blick auf die Psychologie des Despotismus erweist als erstaunlich aktuell, wenn er sich den Nimbus der kulturellen Überlegenheit vorknüpft und die latente bis offene Überheblichkeit attackiert. Auch für die russischen Aussteiger, für die bei den Tartaren, Tscherkessen, Tschetschenen oder Kosaken das „wahre, wirkliche Leben“ beginnt, hat Tolstoi wenig schmei-
Über 1,5 Mio. Bücher, DVDs & CDs mit gutem Gewissen bestellen.
chelnde Worte übrig. Deren Begeisterung über die unwiderstehliche Grandezza der hart arbeitenden Frauen oder für die elementare Plage der Mückenschwärme wirkt vollkommen überdreht. Dabei reflektiert Tolstoi seine eigene Biografie: 1851 folgte er seinem Bruder und floh vom luxuriösen Petersburger Bonvivant-Dasein in den Militärdienst im Kaukasus. Sein Alter Ego, der unverbesserlich romantisierende Olenin, bekommt in der Langerzählung „Die Kosaken“ eine fast persiflierende Tönung. Es zeugt von Tolstois Souveränität und Weitblick, wenn er bei aller russischen Selbstkritik die Sympathie mit den kaukasischen Völkern nicht überspannt. Mit Befremden verfolgt er, wie zu ihrem hochmoralischen Kosmos auch Rachsucht und Grausamkeit gehören. Und die fundamentalistische Welt, mit der ein islamistischer Autokrat die abgelegenen Bergdörfer gegen die russische Zivilisation in Stellung bringt, ist dem Berichterstatter aus dem Kaukasus sichtlich zutiefst zuwider. Die schönste Geschichte ist die letzte. In „Hadschi Murat“, einem postum erschienen Spätwerk ist, zieht Tolstoi alle Register seiner Erzählkunst und präsentiert uns die bewegende, tragische Lebensgeschichte eines in vielerlei Hinsicht imposanten Tschetschenen, der zwischen die Fronten gerät. Der Held, der zu den russischen Eroberern überläuft, entspricht klischeehaft so ziemlich allen romantischen Vorstellungen vom vitalen, ebenso edelmütigen wie kriegerischen Naturmenschen, und doch ist dieses Charakterbild so stark, dass wir als Leser mit Bangen dem sich abzeichnenden tödlichen Finale entgegenblicken. Rosemarie Tietze verrät uns im Nachwort, dass die reale, historisch verbürgte Geschichte des kaukasischen Helden auch 2018 kein Ende hat: Sein abgeschlagener Kopf wird bis heute im Petersburger Institut für Anthropologie und Ethnografie als Trophäe des Sieges aufbewahrt. Die Nachfahren des Hadschi Murat verlangen die Herausgabe und Bestattung.
reißerischen Story, in deren Mittelpunkt Baku und Aserbaidschan stehen, liest sich gut, schnell und amüsant, aber vertrauen kann und soll man dem vielfach flunkernden Autor keineswegs. Der Plot folgt den turbulenten Jahren vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg, als auch die Ölvorkommen am Kaspischen Meer zu einem globalen Politikum wurden und kurzlebige merkwürdige Staatengebilde entstanden. Bürgerkriege, Besetzungen, Aufstände, Revolutionen setzten Baku, dem Wüstenkaff, das innerhalb weniger Jahrzehnte einen sagenhaften Aufstieg zur begehrten Ölmetropole hinlegte, aufs Heftigste zu. In beinahe flapsigem Ton konfrontiert uns der
Lew Tolstoi: Krieg im Kaukasus. Die kaukasische Prosa, neu übersetzt und kommentiert von Rosemarie Tietze. Suhrkamp, 592 S., € 28,80
Im Vergleich zum großen, klassisch-realisti-
schen Tolstoi ist Essad Bey (1905–1942) eine geschwätzige Plaudertasche. Sein erstmals 1929 bei der Deutschen Verlagsanstalt erschienenes, autobiografisch inspiriertes Buch öffnet die seltsame Wunderkammer des Kaukasus, erzählt von Teufelsanbetern und Lepradörfern, von Dolchtänzen, Dichterwettbewerben und Zarathustras Feueranbetern. „Blut und Öl im Orient“ gefällt sich in maßlosen Übersteigerungen, kulturhistorischen Ausflügen und politischen Botschaften, kuriosen Beobachtungen und komischen Charakterbildern. Das Buch mit der
Essad Bey: Öl und Blut im Orient. Autobiographischer Bericht. Die Andere Bibliothek, 358 S., € 43,20
Autor mit der wechselhaften Geschichte, die schließlich in die mörderische Inbesitznahme durch das Terrorregime der Bolschewiki mündete. Essad Bey flieht mit seinem Vater, dem Besitzer einer sprudelnden Ölförderanlage, aus Baku. „Blut und Öl im Orient“ breitet mit Vergnügen das abenteuerliche Versteckspiel und die vielen abenteuerlichen Zwischenfälle der Flucht aus, die schließlich in Georgien ein Happy End findet. Darüber, inwieweit die Geschichte tatsächlich den eigenen Erlebnissen und Erfahrungen des Autors entspricht, dürfen die Literarhistoriker heute rätseln. Die Biografie des 1905 als Lew Abramowitsch Nussimbaum geborenen Autors ist voller Widersprüche und Lücken. So ist etwa unklar, ob er nun in Kiew, in Baku oder im Zug zwischen den beiden Städten geboren wurde. 1922 kam er jedenfalls zusammen mit seiner Familie als Flüchtling in Berlin an, dockte an russischen Emigrantenkreisen um Nabokov an, konvertierte vom Judentum zum Islam, legte sich als Orientspezialist einen neuen Namen zu und tat sich als begehrter Beiträger der renommierten Literarischen Welt hervor. Der Versuch, sich mit seinem Antibolschewismus dem Nationalsozialismus anzudienen, misslang, weshalb der Schriftsteller 1936 nach Wien übersiedelte und in Wiener Verlagen unter anderem seinen in Aserbaidschan ungemein populären Roman „Ali und Nino“ publizierte. Vergleicht man die beiden Bücher, könnten die Zugänge unterschiedlicher nicht sein, und doch haben sie so manche Gemeinsamkeit. Tolstoi und Essad Bey, der einfühlsame Realist und das satirische Großmaul, sind Beispiele dafür, dass sich die wunderbare, widersprüchliche, höchst konfliktreiche Völkerwelt des Kaukasus als harte Nuss erweist. Der fremde, europäische literarische Blick von außen legt zwar so manches frei, durchdringt aber bei weitem nicht alles. ALFRED PFOSER
LITER ATUR
F A LT E R 41/ 18
7
Schwelende Zwietracht unter Schwestern Goran Vojnović folgt den ethnischen Verwerfungen Post-Jugoslawiens bis in die familiären Verästelungen
N
iemand würde es dem jungen slowenischen Autor Goran Vojnović verübeln, wenn er mit den archaischen Stammesfeindschaften und ethnischen Säuberungen, die in den 1990erJahren den Vielvölkerstaat Jugoslawien zerstörten, nichts mehr zu tun haben wollte. Vojnović, 1980 in Ljubljana geboren, war noch ein Kind, als Slowenien sich für unabhängig erklärte und damit den Anstoß gab für den Zerfall Jugoslawiens in lauter verfeindete Teilstaaten. Seine Generation weltoffener junger EU-Bürger blickt nach Europa, wo ihre Zukunft liegt. Was gehen sie die finsteren jugoslawischen Urfehden und Blutmythen an, mit denen die ältere Generation die Völker auf dem Balkan vergiftete? Goran Vojnović sieht das anders – zum Glück für die Literatur. Ihn bedrückt und bedrängt die Vergangenheit. Er spürt, dass die Wahnidee ethnischer Stammesreinheit in den Köpfen der Älteren immer noch weiterwirkt und ebenso wie die ungesühnten Kriegsverbrechen das Zusammenleben auf dem Balkan ruiniert.
»
Kaum hat sich Slowenien als Staat selbstständig gemacht, vergiften Nationalismen das Klima
Was ihn in seinen bisher drei Romanen um-
trieb, ist die Frage: Woher kommt dieser ethnische Hass und wie wirkt er sich in den Staatsvölkern und in den einzelnen Familien bis heute aus? In „Unter dem Feigenbaum“ sucht Vojnović erneut eine Antwort. Er entwirft ein großes historisches Panorama und orientiert sich dabei erkennbar an seiner eigenen komplexen Familiengeschichte. Die schiere Anzahl des Personals und die Masse des Stoffes machen dem Autor allerdings zu schaffen. Er ringt mit der Organisation seines ausufernden Materials, greift bis in den Zweiten Weltkrieg zurück und erzählt von einer weitverzweigten Familie in Ljubljana, in der sich die unterschiedlichsten ethnischen Herkünfte mischen. Man versteht sich als slowenische Familie, auch wenn man ursprünglich aus der
Goran Vojnović: Unter dem Feigenbaum. Roman. Aus dem Slowenischen von Klaus Detlef Olof. Folio, 334 S., € 25,–
»Dieser Tausendseiter ist ein beeindruckendes Debüt.« Frankfurter Allgemeine Zeitung
Zwischen Frankreich und Japan, zwischen dem 19. und dem 21. Jahrhundert, mittels Enzyklopädie, Comic, Erzählung, Audiotranskription und Notizheft entwirft dieser kühne Roman ein Panoptikum unserer fliehenden Wirklichkeit.
serbisch-ungarischen Vojvodina stammt, jüdische und ukrainische Vorfahren hat und zudem einen angeheirateten bosnischen Schwiegersohn. Der Roman zeigt: Ethnische Mischungen, nicht ethnische Reinheit sind die gelebte Norm. Das Stammhaus der Familie, vom Großva-
ter Aleksandar eigenhändig neben dem titelgebenden Feigenbaum gebaut, liegt in Nord-Istrien an der slowenisch-kroatischen Grenze, in einem ursprünglich italienischen Dorf, aus dem die ansässige Bevölkerung 1945 vertrieben wurde. Als sich Slowenien 1991 zum unabhängigen Staat erklärt, liegt das Anwesen plötzlich im Ausland: in Kroatien. Das großväterliche Haus ist das heimliche Zentrum des Romans, das Bild des unermüdlich Früchte tragenden Feigenbaums prägt die Geschichte. Die längste Zeit bereitet die multiethnische Herkunft der Familienmitglieder keinerlei reale Probleme. Sie ist den Familienmitgliedern zwar unterschwellig bewusst, kommt aber nur gelegentlich zur Sprache, etwa in Form innerfamiliärer Hänseleien zwischen dem slowenischen und dem bosnischen Schwiegersohn. Doch kaum hat sich Slowenien als Staat selbständig gemacht, wird die Frage der Abstammung plötzlich virulent, vergiften Nationalismen das Klima, spalten Abstammungskonflikte die Gesellschaft. Ethnische Reinheit steht nun im Zentrum der Identitätspolitik des jungen Staates, die falsche Herkunft kann zum lebensgefährlichen Problem werden. Auch innerhalb der Familie wird die Frage des „echten“ Slowenentums auf einmal zum Anlass erbitterter Auseinandersetzungen. Erzählt wird „Unter dem Feigenbaum“ aus der Perspektive von Aleksandars Enkelsohn Jadran, der wie auch der Autor selbst ein Schriftsteller Mitte 30 ist. Der Tod des Großvaters ist für ihn der Auslöser, um Herkunft und Geschichte seines
buntscheckigen Clans zu erforschen und sich damit auch die Frage nach der eigenen Identität zu stellen. Was dem Ich-Erzähler vor allem zu schaffen macht, sind die irritierenden Leerstellen und Lücken in der Geschichte der Familien. Drei ihrer Angehörigen sind zu unterschiedlichen Zeiten abrupt fortgegangen und eine – ohne jede Erklärung – eine Zeitlang weggeblieben. Warum etwa verschwand Jadrans Großvater in den 1970erJahren für ein Jahr nach Ägypten? Warum hat Jadrans bosnischer Vater es zugelassen, dass der junge Staat Slowenien ihn ausbürgerte, wo er doch durch Heirat de facto slowenischer Bürger war? Und warum verschwindet Jadrans Ehefrau und lässt diesen mit den Zweifeln über die Gründe ihres Fortgehens allein? In dieser Familie wird viel geschwiegen und nur wenig aufgearbeitet oder erklärt. Letztendlich bleiben die Beweggründe ihres Handelns rätselhaft. Am Ende hat Jadran das Gefühl, in seinem Be-
streben gescheitert zu sein: Die Lücken in der Familiengeschichte wollen sich nicht schließen lassen. Das Schreiben aber ist, so vermutet dieser Romancier im Roman, eine große Verschwörung zur Sinnstiftung, um dem Chaos eine Ordnung abzutrotzen und den Zufällen einen Sinn aufzuzwingen. Jadran betrauert seinen jüdisch-ukrainischen Großvater, der schuldbewusst an der Seite seiner dementen Ehefrau ausharrte und seine unerfüllten Freiheitsträume in sich begrub. Und er betrauert das Lebensunglück und die Entwurzelung seines Vaters, den die falsche Herkunft zwang, auf bosnischer Seite gegen seine Wahlheimat Slowenien zu kämpfen, und der sich danach 20 Jahre lang trostlos in der bosnischen Hinterwelt verkroch. Die Vergangenheit liegt wie Mehltau auf dieser Familie. Und es bleibt fraglich, ob sich der Enkel davon befreien wird können. SIGRID LÖFFLER
Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen von Philipp Weiss 5 broschierte Bände im Schuber 1064 Seiten. € 48,–
Suhrkamp
www.suhrkamp.de
8
F A L T E R 4 1 / 1 8 L i t e r a t u r
Ein feenhafter Realist in fragwürdigen Vierteln
Thomas Bernhard trifft Tschechow in der Provinz
Die neue Übersetzung der Erzählungen von Andor E. Gelléri (1906–1945) laden zur Wiederentdeckung des Autors ein
Lászlo Krasznahorkai zeichnet ein unbarmherziges, ungerechtes und eindringliches Bild seiner Heimat
ie viele Väter hatte auch der von Andor Endre Gelléri keiW nen Sinn für die Träumereien seines
or den Beginn seines Romans über die Rückkehr des Barons V Wenckheim hat Lászlo Krasznahor-
Sohnes. Papa Gelléri, der Schlosser war und mit Panzerschränken reüssieren wollte, nötigte seinen 15-jährigen Filius, etwas Anständiges zu lernen. Der hat sich stattdessen in allerlei Berufen verdungen – ein Fluch, der zugleich auch ein Segen war. Denn was er unter Arbeitern erlebte, floss direkt in seine Texte ein. Die schlecht beleumundeten Viertel Budapests kannte er von klein auf. Er wusste, wie rau und elend diese waren, dass dort aber auch Wünsche und Fantasien gediehen. Er machte diese Welt literaturfähig. Die 20er- und 30er-Jahre, in denen Gelléris Geschichten entstanden, waren eine Zeit der wirtschaftlichen Krisen und Nöte. Wer Arbeit hatte, wurde schamlos ausgebeutet. In seinen Erzählungen und Novellen – mehr als 100 davon sollte er bis zu seinem Tod verfassen – wandte Gelléri sich diesem proletarischen Milieu zu. Aber nicht als Ankläger, sondern als Beobachter. Und sparte nicht mit Witz und Ironie, denn in allem Leid sah er immer auch das Absurde, das Bizarre, manchmal sogar das Glück. Dieses war auch dem Autor selbst zunächst durchaus hold. Redakteure einflussreicher Literaturzeitschriften wurden auf diesen aufmerksam. Gelléri hatte mit seinen Erzählungen Erfolg. Er veröffentlichte kontinuierlich, und auch wenn er davon nicht leben konnte, so pries man doch sein Talent. Der Schriftsteller Dezső Kosztolányi lobte den „feenhaften Realismus“ des Kollegen. Was diese seltsam paradoxe Kombination bedeutet, kann man gerade in seinen Erzählungen entdecken. Sie liegen nun in einer Auswahl und in der Übersetzung von Timea Tankó vor. Gelléris Geschichten handeln von Ar-
beitern und kleinen Angestellten wie Vera, die in einem Musikgeschäft tätig ist, von der eigenen Mutter vernachlässigt und von ihrem Chef schikaniert wird, bis sie eines Tages die Ungerechtigkeit nicht länger erträgt und diesem die Meinung geigt – was natürlich ihre Entlassung zur Folge hat. Vera erlebt sie als Befreiung. Und befreiend wirkt auch der Gedanke, nun endlich das Unvorstellbare tun zu können und Tänzerin zu werden. Auch wenn es gewiss eine Illusion bleiben wird – es ist ein Moment der Selbstermächtigung, der dem schreibenden Schlossersohn Andor Endre Gelléri recht vertraut gewesen sein dürfte. Immer wieder beschreibt er den Augenblick, in dem die detailgenau gezeichnete Wirklichkeit ins, pathetisch ausgedrückt, Utopische um-
schlägt. Und es gibt jene Kippmomente, die vom Realistischen unvermittelt ins Groteske führen. Oder ins Poetische. Ins Verzauberte. Dass die Wirkung dieser Texte so stark
und frisch ist, hat aber auch mit der Übersetzung zu tun. Das merkt man, wenn man sie mit einer Auswahl von Erzählungen vergleicht, die 1969 unter dem Titel „Budapest und andere Prosa“ erschienen ist. Übertragen hat diese Barbara Frischmuth, und nicht immer sind Schriftsteller auch die besseren Übersetzer. Vielleicht, weil sie zu sehr ihrem eigenen Ton verhaftet bleiben. Timea Tankó jedenfalls nimmt sich größere sprachliche Freiheiten, ihre wagemutigere Übersetzung besticht durch Rhythmus und Eleganz.
»
In über 100 Erzählungen und Novellen wandte sich Gelléri dem proletarischen Milieu im Budapest der 20er- und 30er-Jahre zu
Man müsse, so hat Tankó angemerkt, Gelléris Texte nicht aus dem Ungarischen, sondern aus dem Gellérischen übersetzen. Das gilt auch für den einzigen Roman des Autors, „Die Großwäscherei“, der vor drei Jahren im Guggolz Verlag erschienen ist. Als dieses Buch erstmals herauskam, war der 1906 in Budapest geborene Gelléri gerade einmal 24 Jahre alt. Nur 15 Jahre sollte er da noch zu leben haben. Als Jude musste Gelléri ab 1940 Zwangsarbeit leisten. Damals begann er, an einem autobiografischen Roman zu schreiben. Er starb kurz nach der Befreiung des KZs Mauthausen, in das er nach der deutschen Besetzung Ungarns deportiert worden war, an einer Typhusinfektion. Es ist ein schmales Werk, das er hinterlassen hat. Aber es ist ein großes Vermächtnis – das hoffentlich bald zur Gänze auf Deutsch vorliegen wird. ULRICH RÜDENAUER
Andor Endre Gelléri: Stromern. Aus dem Ungarischen von Timea Tankó. Nachwort von György Dalos. Guggolz, 280 S., € 24,70
kai eine Warnung gestellt: den Monolog eines misanthropischen Kapellmeisters, der, noch bevor der erste Ton erklungen ist, seinen Musikern weitschweifig klarmacht, was er von ihnen hält – rein gar nichts. Darauf folgen die Seiten, mit denen ein Buch normalerweise beginnt: die Titelei, das Impressum, die Widmung – und dann, endlich, das erste Kapitel: „TRRR... Dich mache ich fertig, Oberheini.“ Wer sich dazu von einem Inhaltsverzeichnis nähere Aufschlüsse erhofft, findet am Ende des Buches eine „Tanzkarte“, die auch nicht so recht weiterhilft. Auf TRRR nämlich folgen RAM und dreimal PAM, dann HMMM, RARIRA, RI und ROM: Das klingt nach einem robusten Bass und einem kräftigen Schlagzeug. Solch ein Instrumentarium mag noch heute in der tiefsten ungarischen Provinz zum Tanz aufspielen – und es ist die tiefste ungarische Provinz, in die Baron Wenckheim aus Buenos Aires heimkehrt. Dort hatte er sein Geld verspielt, und weil die Wiener Verwandtschaft sich Sorgen machte, der Pleitier könnte das Ansehen der Familie beschmutzen, hat sie ihm die Reise in die alte Heimat finanziert – auf dass er dort aus der Öffentlichkeit verschwinde. Der Baron, ein liebenswürdiger Greis, ist nicht mehr so ganz klar im Kopf und kapiert nicht recht, was ihm eigentlich geschieht, aber er hofft, am Ziel seiner Reise seine alte Jugendliebe wiederzusehen, was ihn in eine melancholisch getönte Vorfreude versetzt. Sollte die Wiener Verwandtschaft aber
geglaubt haben, ihren peinlichen Verwandten unauffällig im tiefen Osten entsorgen zu können, hat sie sich gründlich getäuscht. Weil irgendjemand geplaudert hat, verbreitet sich in Windeseile die Nachricht von der bevorstehenden Heimkehr des Barons. Ganz sicher wird er seine Heimatstadt mit seinem Vermögen vom postsozialistischen Elend erlösen. Auf die Idee, dass der ein armer Schlucker sein könnte, kommt niemand. Die Stimmung erinnert an Dürrenmatts Güllen, kurz bevor die berühmte alte Dame zu Besuch kommt. Aber die war ja nun wirklich eine Milliardärin. Der feierliche Empfang am Bahnhof verschreckt den Baron zutiefst, er will eigentlich nur seine Ruhe haben und seine Jugendliebe sehen. Die aber ist beim eilig anberaumten Rendezvous viel zu nervös, um nur einen vernünftigen Satz herauszubringen, während er sie nach so vielen Jahren der Trennung nicht wiedererkennt. Und auch sonst nimmt die Geschichte einen desaströsen Verlauf. Sobald man
um die Erkenntnis nicht mehr herumkommt, dass man keinen großherzigen Gönner, sondern einen charmant vertrottelten, aber eben völlig mittellosen Greis willkommen geheißen hat, kippt die Stimmung. Kippt? Das ist eine gehörige Untertreibung, denn Krasznahorkai inszeniert nun einen Showdown, der auf die größtmögliche Katastrophe zuläuft. Schließlich bleibt nichts mehr übrig als eine „Notensammlung“ genannte Liste von Personen und Gegenständen, die im Furor des Untergangs verschwunden sind oder vernichtet wurden: Apokalypse und Totentanz zugleich, ein Sprachgewitter, von dem am Ende nur noch ein dadaistisches Echo zu hören ist: PARIRA, RIRAROM TRRR. Doch auch damit ist noch immer nicht Schluss: Denn die „Tanzkarte“ verlangt ein Da capo al fine, was man wohl so zu verstehen hat, dass sich eine solche Geschichte der verlorenen Illusionen beliebig oft erzählen lässt, bis zum bitteren Ende. Erzählt wird auch und aktuell die Geschichte der Verlierer im Osten, die vor 30 Jahren auf ein besseres Leben hofften, aber irgendwann den Anschluss verloren haben, nicht nur den an den Westen, sondern auch an die Hauptstadt, die so unendlich weit in der Ferne liegt wie Moskau für Tschechows Dorfbewohner. Krasznahorkai präsentiert diese Welt als ein detailliertes barockes Gemälde: den feisten Bürgermeister, den verschlagenen Hauptmann, den eitlen Bibliothekar, die selbsternannte „Ortswache“ auf 50 Motorrädern, dazu der rätselhafte Moosforscher, der nichts von seiner Tochter wissen will und seinem Leben auf bizarre Weise ein Ende setzt. Vieles in diesem schwarzen Provinzroman erinnert an Thomas Bernhard, allem voran die Unfähigkeit der Figuren, miteinander zu reden. Stattdessen schwingen sie sich zu rhetorisch brillanten Monologen und Schimpftiraden auf, die Ungarn und alles, was ungarisch ist, in Grund und Boden verdammen. Das ist bitter, das ist komisch. Das ist aber auch, eine große, illusionslose Erzählung über die toten Winkel Europas, unsentimental, ungerecht – und gerade deshalb so eindringlich. TOBIAS HE YL
Lászlo Krasznahorkai: Baron Wenckheims Rückkehr. Roman. Aus dem Ungarischen von Christina Viragh. S. Fischer, 496 S., Euro 25,70
L i t e r a t u r    F A L T E R   4 1 / 1 8  
9
Mit der Bim durch Bukarest Gabriela AdameĹ&#x;teanu erzählt von der gewalttätigen Geschichte Rumäniens in und vor der CeauČ™escu-Ă„ra
V
erlorener Morgen“ gilt als Klassiker der modernen rumänischen Literatur, vergleichbar den groĂ&#x;en Romanen Marcel Prousts oder dem „Ulysses“ von James Joyce. Allerdings ist eine solche Adelung immer auch eine etwas zwiespältige Auszeichnung, verbinden sich damit doch Attribute wie „bedeutungsschwer“ oder „schwierig“. Tatsächlich verlangt der meisterlich erzählte Roman seinen Lesern Aufmerksamkeit, Zeit und manchmal auch einen langen Atem ab. Er handelt vom langen, gewalterfĂźllten rumänischen 20. Jahrhundert bis Anfang der 1980er-Jahre (der Entstehungszeit des Buches) und verarbeitet eine FĂźlle an historischen Details, soziologischen Analysen, politischen Systemwechseln und Alltagsbeschreibungen als groĂ&#x;en Bewusstseinsstrom, der von beschreibenden Passagen Ăźber die groĂ&#x;bĂźrgerliche Lebenswelt vor dem Ersten Weltkrieg und von einem Tagebuch zum Kriegsterror in Bukarest des Jahres 1916 unterbrochen wird.
Âť
Ăœberraschend ist, dass dieser so wenig linientreue Roman die Zensur passieren konnte
Der „Verlorene Morgen“ erstreckt sich bis zum
Abend. In diese kurze Zeitspanne der Erzählung passen ungefähr 70 Jahre an erzählter Zeit. Eine alte Frau namens Vica Delça bricht nach deftigen Wortwechseln mit ihrem Mann zu einem beschwerlichen Gang durch Bukarest auf: „Vorsichtig meidet sie die schiefen Steine im Hof, auf die am Morgen der Raureif gefallen ist. Die geschwollenen Beine bereiten ihr stechende Schmerzen, obwohl sie sich gestern Abend mit Benzin eingesprĂźht hat, und heute trägt sie dicke WollstrĂźmpfe. Anscheinend steht ein Wetterwechsel bevor.“ Als sich Vica Delça auf ihren langen Weg durch Bukarest aufmacht, sind die letzten Jahre des groĂ&#x;en FĂźhrers Nicolae CeauČ™escu bereits angebrochen. Nach Jahren der Ă–ffnung und einer Annäherung an den Westen verfiel das „Genie der Karpaten“ immer stärker seinem GrĂśĂ&#x;enwahn, während rundum die Mauern brĂśckelten und
Gabriela AdameĹ&#x;teanu: Verlorener Morgen. Roman. Aus dem Rumänischen Ăźbersetzt von Eva Ruth Wemme. Die Andere Bibliothek, 561 S., â‚Ź 43,20
die wirtschaftliche Situation unerträglich wurde. Die schnaufende, schimpfende, sich erinnernde und alles kommentierende Vica absolviert zuerst einen wenig zielfĂźhrenden Besuch bei ihrer Schwägerin und fährt dann mit der StraĂ&#x;enbahn quer durch die Stadt, um die ebenfalls nicht mehr junge Ivona zu besuchen, mit deren Familie sie – als Schneiderin in einem mondänen Modeatelier der Vorkriegszeit, als Haushaltsgehilfin, als stundenlange Gesprächspartnerin – eng verbunden ist. Was die Figuren denken, was sie fĂźhlen, wie
die historischen Ereignisse Gewalt erlangen Ăźber die KĂśrper, GefĂźhle und das Denken der Menschen – das alles wird Teil des Bewusstseinsstroms der Figuren. Der Terror der späten CeauČ™escu-Jahre färbt in der Erzählung auch noch auf die Schilderungen von frĂźher ab, etwa wenn immer wieder von den Emigranten die Rede ist, vor allem von Ivonas Sohn Tudor, der, wegen seiner Familie gebrandmarkt, in den 1970er-Jahren in den Westen ging. Die vor sich hin räsonierende Vica fĂźhrt das Schicksal Tudors zu Ăœberlegungen, die im scharfen Gegensatz stehen zur brutal durchgesetzten Vielkind-Politik CeauČ™escus: „Wenn man Kinder hat, hat man nur Ă„rger ‌ Und jetzt haben sogar die Kinder schon Ă„rger mit den Eltern, den Kindern geht’s jetzt sogar schlecht wegen der ganzen Familie. Von Generation zu Generation, bis ins neunte Glied, so ist das jetzt bei den Kommunisten Gesetz. Und dann muss man wer weiĂ&#x; wen haben, der da noch ein gutes Wort fĂźr den ZĂśgling einlegt, damit es nicht so schlimm wird.“ Es ist Ăźberraschend, dass dieser so wenig linientreue Roman die Zensur passieren konnte; zumal die Schilderungen einer untergegangenen beziehungsweise nur mehr in Ăźberkommenen Ritualen und heruntergekommenen Häusern präsenten groĂ&#x;bĂźrgerlichen Schicht groĂ&#x;en Raum einnehmen. Vielleicht wurde die Systemkritik von der
äuĂ&#x;erst expliziten Ausdrucksweise vor allem Vicas und ihrer Umgebung Ăźberdeckt. Ihren Mann, der, dick und bewegungsunfähig, seine Tage fernsehend verdämmert, bezeichnet sie durchgängig als „altes Rindviech“ oder auch „ScheiĂ&#x;kerl“. Sie bleibt ihm nach so vielen gemeinsam verbrachten Jahren aber doch verbunden und räumt nach dessen Tod die Wohnung fast komplett aus, so, als wollte sie ihr eigenes Verschwinden vorbereiten. In den Nischen einer vĂśllig abgewirtschafteten totalitären Gesellschaft blĂźhen die eigenartigsten privaten Subsysteme. Je kollektiver das Ganze sein soll, desto individualistischer reagieren Menschen aller Gesellschaftsschichten. Wie soziale Distinktionen Ăźber die Systemwechsel hinweg sich verändern und doch erhalten bleiben, das beschreibt die Autorin sehr eindrĂźcklich. Die 1942 geborene Gabriela AdameĹ&#x;teanu war eng mit der Dissidentenszene verbunden. Nach dem Sturz CeauČ™escus arbeitete sie als Journalistin und setzte sich vor allem fĂźr Frauenrechte ein. Ihr DebĂźt „Der immergleiche Weg eines jeden Tages“ von 1975 erzählt das Leben eines jungen Mädchens in den 1960erJahren zwischen „Êducation sentimentale“ und gesellschaftlicher Selbstbehauptung. Der Roman „Die Begegnung“ von 2003 hat das schwierige Verhältnis zwischen einem Auswanderer und seinem von langen Jahren der Diktatur geprägten ehemaligen Heimatland zum Thema. Der Klassiker-Werdung hat die Autorin Ăźbri-
gens selbst versucht vorzubeugen. Ăœber den emigrierten Tudor sagt Vica: „Das ist doch verdreht, wenn man immer nur die Nase in die BĂźcher steckt! Da kann man ja kein verständiger Mensch werden.“ Wenn man die richtigen BĂźcher erwischt, stehen die Chancen hingegen nicht schlecht. „Verlorener Morgen“ ist ein Buch, das verständiger und empathischer macht. BERNHARD FE T Z
Stille Nacht Ç?ÇŽÇ?ȳNJȳÇ?ÇŠÇ?ljȳljNJNJÇ?ȳLJ Č• LjNjČ?NjLJ dž
.....................................
Der Krimi zum ljLJLJȳ !(2ȳ 5"),¼5 ȓ ȳ ȓ
Wir machen’s spannend
10  
F A L T E R   4 1 / 1 8    L i t e r a t u r
Schuld und Sßhne auf etwas breiter Bßhne Nino Haratischwili liefert ein packendes Porträt der Post-Perestroika – und eine tolle Rolle fßr James Mason
V
or vier Jahren lieĂ&#x; Nino Haratischwili, 1983 in Tiflis geboren, mit ihrem dritten Roman, „Das achte Leben“, aufhorchen – einer ausufernden Familienchronik, die 100 Jahre georgische Geschichte umfasst und eine Reihe faszinierender, vorwiegend weiblicher Gestalten zu einer Generationensaga zusammenschweiĂ&#x;t. Daran knĂźpft die auf Deutsch schreibende Autorin nun mit „Die Katze und der General“ an, und wieder gelingt es ihr, im familiären Strang der Geschichte einfĂźhlsam Porträts zu gestalten: von einer GroĂ&#x;mutter, die wissenschafts- und fortschrittsgläubig die besten Seiten der kommunistischen Vergangenheit in die georgische Verfallsgeschichte zu retten versucht, Ăźber eine von Politik und Passion durchgebeutelte Mutter bis hin zu den in der Berliner Exilantenszene mĂźhsam FuĂ&#x; fassenden Enkelinnen. Die eine ist Schauspielerin und versucht sich mit wechselndem Erfolg zwischen Film und Theater (unschwer lassen sich da Facetten aus dem Leben der Autorin erkennen, die selbst Erfahrung in beiden Domänen gesammelt hat). Sie ist die Katze des Titels, was sich dort gut macht – im Roman selbst, der sie durchgängig so nennt, wirkt das etwas mĂźhsam. In scharfem Kontrast zur georgischen Zeitgeschichte aus weiblicher Sicht steht das Eingangskapitel in der fĂźr groĂ&#x;russi-
sche Verhältnisse nur einen Katzensprung entfernten Gegend, dem tschetschenischen Grenzgebirge. Die 17-jährige Noura lebt in einer von inneren Spannungen und äuĂ&#x;erer Bedrohung niedergedrĂźckten Gesellschaft. Sie ersehnt sich ein wenig Luft, Licht und Freiheit im finsteren Tal. Sie will weg – und sei es auch nur „in die Stadt“, was in der Zeit vor dem ersten Tschetschenienkrieg wohl Grosny bedeutet. Von Anfang an lässt die vom Roman evozierte Stimmung keinen Zweifel daran, dass Noura das Opfer sein wird. Ein Opfer, das freilich exemplarisch fĂźr viele andere steht. In einem Interview mit dem Spiegel hat Haratischwili darauf hingewiesen, dass das im Buch beschriebene individuelle Schicksal und die allgemeinen Zustände in Tschetschenien vor und während der beiden Kriege auf Schilderungen der ermordeten Journalistin und BĂźrgerrechtlerin Anna Politkowskaja beruhen. Die chaotischen Verhältnisse in Georgien wirken
im Kontrast zur unheilschwangeren Witterung dort fast wie ein bukolisches Zwischenspiel. Der Stimmungswechsel in der Beschreibung der Nachbarregionen sorgen fßr starke Momente; ßberhaupt ist es eindrucksvoll, wie es Haratischwili gelingt, Räume und Atmosphären zu evozieren. Eingebettet ist das Geschehen in den beiden Sowjetrepubliken in eine allgemeine Ver-
Âť
Selten wurden die Anarchie und die Korruption in der Periode nach der verunÂglĂźckten Perestroika so plastisch dar gestellt
Um die Macht des Oligarchen zu versinnbild-
*$)"&, !""%3 &.2 $+&1
*3 +8&03".8 4.% $)32"-+&*3 %&. &4'&,2+1&*2 %41$)#1&$)&. *3 &*.&- /16/13 5/. 3&5&. "7&2
"+34", 49 ## 3 < 4$) ",2 & //+ &1);,3,*$) "2 41./43 7.%1/- 31*''3 *--&1 -&)1 &.2$)&. *. 4.2&1&1 )&+3*2$)&. 4.% "4' &*234.( (&31*--3&. !&,3 *& 43/1&. 8&*(&. &123-",2 6*& & 31/''&.&. -*3 %&1 +8&03".8 4.% /--*3-&.3 )&1"0*& ."$))",3*( (&)/,'&. 6&1%&. +".. : 4.% 6*& -". (&8*&,3 &*.&- %1/)&.%&. 41./43 5/1#&4(&. +"..
Nino Haratischwili: Die Katze und der General. Roman. Frankfurter Verlagsanstalt, 750 S., â&#x201A;Ź 30,90
666 )/(1&'& $/-
Unbenannt-4 1
05.10.2018 16:03:41 Uhr
fallsgeschichte des sie einst zusammenhaltenden Reiches. Ă&#x153;berzeugend verknĂźpft die Autorin politologische Prozessanalysen mit individuellen Porträts. Selten wurden die Anarchie und die Korruption in der Periode nach der verunglĂźckten Perestroika so plastisch dargestellt. Das Unterste kehrte sich zuoberst, ein neues, oft mĂśrderisches Zusammenspiel zwischen Unter- und Immer-noch-Privilegierten entstand. Glaubhaft wird den Spuren dieser wirren Zeit bis in die Gegenwart der Neureichen, Bonzen und Sowjetruinen nachgegangen. Eine virtuose Schnitttechnik verschränkt die Zeitebenen ineinander, Ăźberblendet von Ort zu Ort. All das ist, wie gesagt, Ăźberzeugend und eindrucksvoll â&#x20AC;&#x201C; aber leider nicht alles. Denn da ist ja noch die zentrale Figur des Romans, der General des Titels. UrsprĂźnglich ein schĂśngeistiger JĂźngling, der unter dem Andenken an seinen Heldenvater leidet, entgeht er trotz aller Fluchtversuche der militärischen Karriere nicht und versucht schlussendlich, die Schuld, der er diese verdankt, zu begleichen. Sein Wille zur Abrechnung hält die Handlung zusammen und treibt diese voran. In die dostojewskischen Motive von Schuld und SĂźhne mischen sich aber bald ganz andere TĂśne, der in der Gegenwart spielende Handlungsstrang nimmt mehr und mehr ZĂźge eines Thrillers an. Die Tonart wechselt so brĂźsk, dass den Leser das GefĂźhl beschleicht, er wäre besser im Kino aufgehoben. FĂźr ein literarisches Werk, das viele fast lyrische und packend dramatische Momente aufweist, erscheint manches dann Ăźberinstrumentiert, dick aufgetragen, schlicht fehl am Platz. lichen, wird eine Villa mit Pool in Berlin aufgefahren; fĂźr das TĂśchterchen muss es ein Palazzo in Venedig sein. Zu einem Spa in Marrakesch geht es im Privatjet, Ăźberhaupt wird wild herumgeflogen (apropos â&#x20AC;&#x17E;wild herumâ&#x20AC;&#x153;: Exaltierte Sexszenen mag man vielleicht im Film â&#x20AC;&#x201C; hier geraten sie einfach zu Kitsch). Figuren werden eingefĂźhrt, bei denen man den Verdacht nicht los wird, dass sie nur da sind, um Stereotype zu bedienen: Ein deutscher Rucksacktourist mutiert zum pazifistischen Kriegsreporter und schleicht sich recht stĂśrend als Ich-Erzähler ein. Vollends fragt man sich, was ein Ăśsterreichischer Komponist als verunglĂźckte Liebschaft der â&#x20AC;&#x17E;Katzeâ&#x20AC;&#x153; hier zu suchen hat â&#x20AC;&#x201C; in seiner neurotischen Mischung aus Autismus und Mondänität soll er vielleicht ein typischer Wiener sein. Oder dienen diese Figuren lediglich dazu, die Handlung zu â&#x20AC;&#x17E;streckenâ&#x20AC;&#x153;, um den Umfang des â&#x20AC;&#x17E;Achten Lebensâ&#x20AC;&#x153; nicht allzu weit zu verfehlen? Nichtsdestoweniger lesen sich die 750 Seiten zĂźgig bei anhaltender Spannung, sie schwanken nur allzu sehr zwischen gut und gut gemacht. Immerhin kĂśnnten selbst die schwächeren Teile einen passablen Film ergeben, und der â&#x20AC;&#x17E;Generalâ&#x20AC;&#x153; wäre eine groĂ&#x;artige Rolle fĂźr James Mason gewesen. So ist es â&#x20AC;&#x17E;nurâ&#x20AC;&#x153; der zweitbeste Roman von Nino Haratischwili geworden, der man anraten mĂśchte, sich auch einmal in einem bescheideneren Format â&#x20AC;&#x201C; 400 Seiten? - zu versuchen. THOMAS LEITNER
L i t e r a t u r F A L T E R 4 1 / 1 8
11
Stolpern über einen bunten Teppich Guram Dotschanaschwilis „Das erste Gewand“ (1978) ist das Lieblingsbuch der Georgier. Aber warum?
Roman durch seine feinen Beobachtungen, seine plastischen Beschreibungen und seine geschliffene Dialogkunst gefangen. Er schildert die Ankunft eines Flüchtlings in dieser abgeschotteten Welt, dessen Geschichten den Protagonisten des Romans, den 17-
«Jeder, der die politische Krise verstehen will, die gegenwärtig die Welt erfasst hat, sollte diese brillante Analyse lesen.» Yuval Noah Harari «Brillant. Düster. Wortgewaltig.» The Times
Guram Dotschanaschwili: Das erste Gewand. Roman. Aus dem Georgischen von Susanne Kihm und Nikolos Lomtadze. Hanser, 696 S., € 32,90
Obwohl allerhand passiert, stellt sich bei der Lektüre aber schon bald Ermüdung ein, denn eine Handlung im herkömmlichen Sinne gibt es so wenig wie eine psychologische Entwicklung des naiven Helden. Man ist erleichtert, als sich Domenico endlich in eine neue Stadt aufmacht. Hier in Kamora herrschen Willkür, Verrat, Folter und Mord. Alles ist „mit Misstrauen und Blut getränkt“, die Schergen des Tyrannen Marschall Bittencourt tragen schwarze Umhänge und Holzmasken mit Augenschlitzen. Zum Schluss schließt sich Domenico den Freiheitskämpfern der Lehmstadt Canudos an (eine Anspielung auf den Aufstand in der gleichnamigen brasilianischen Stadt 1896–97). Um den Widerstand der Rebellen aus Canudos zu brechen, vergiften die Kamoraner den Fluss. Es kommt zum finalen Kampf. Dotschanaschwilis erklärte Absicht ist es, „bunte Geschichten wie einen Teppich“ zu den Füßen der Leserschaft auszubreiten und er fordert diese direkt auf, davon Ge-
376 S., 4 Abb., 10 Ktn. Geb. € 25,70[A] ISBN 978-3-406-72501-2
Schon auf den ersten Seiten nimmt einen der
jährigen Domenico, dazu anregen, sich sein Erbe auszahlen zu lassen und in die Welt zu ziehen. Es ist die Geschichte des verlorenen Sohns aus dem Lukas-Evangelium. Domenico muss denn auch als Schweinehirt arbeiten, bevor er nach seiner Rückkehr ins Dorf das titelgebende erste Gewand, ein edelsteindurchwirktes Ornat, verbrennen und zu einer entscheidenden Erkenntnis gelangen wird. Die Stationen dieser Heimkehr sind allesamt allegorische Orte: Zuerst kommt Domenico nach Feinstadt, in ein Städtchen mit pastellfarbenen Häusern, in dem niemand zu arbeiten scheint, dessen Bewohner einem oberflächlichen Hedonismus und Eskapismus anhängen. Durch die attraktive, aber heiratsunwillige dunkelhaarige Theresa lernt er die Sexualität, durch die stets weiß gekleidete Musikerin Ana Maria die Liebe kennen.
«Napoleon ist ein Meisterwerk durch und durch und Lesevergnügen pur.» Antony Beevor «Adam Zamoyski entrümpelt zwei Jahrhunderte voller Mythen, räumt mit apokryphen Geschichten und Legenden auf und schenkt uns endlich den wirklichen Napoleon.» Anne Applebaum
brauch zu machen: „Bitte laufen Sie doch drüber“. Dotschanaschwili ist ein sprachgewaltiger Autor, das spürt man in jeder Zeile, auch wenn die formidable Übersetzung von Susanne Kihm und Nikolos Lomtadze nur einen unvollständigen Eindruck von der Innovationskraft seiner Sprache zu vermitteln vermag. Viele der Neologismen und Wortumdeutungen sind, so kann man dem Begleitheft entnehmen, in die georgische Alltagssprache eingegangen. In einem Interview zeigte sich Dotschanaschwili mit einem „Faust“-Zitat auch augenzwinkernd versöhnt mit den widrigen Produktionsbedingungen, unter denen sein Roman entstanden ist: „Bei den damaligen Zensoren will ich mich, ungeachtet ihrer Unbarmherzigkeit und Kaltherzigkeit, herzlichst bedanken für ihre Gemeinheit, die uns dazu zwang, geschicktere Ausdrucksformen zu finden. Dank ihnen haben wir emsig an unserem Stil gewoben. Sehr gebildet waren sie nicht, und was sie nicht verstanden haben, konnten sie nicht aufhalten. Somit waren sie ,Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft‘.“ Die Strategie verfängt freilich nicht, erst recht nicht bei Lesern mit westlich-demokratischem Background. Dass es so mühselig ist, über den farbenfrohen Teppich zu gehen, liegt vor allem daran, dass Dotschanaschwili das, was er unter Freiheit versteht – und somit das eigentliche Thema seines Werks–, aus Zensurgründen im Dunklen lassen muss. Die Botschaften, mit denen er zum Schluss aufwartet, bleiben abstrakt, um nicht zu sagen kitschig: Wer im Dreck, sprich unter Terror und Willkür lebt, hat die Möglichkeit, sich zu erheben; auch die größten Schurken sterben irgendwann einmal durch „fremde Hand“; der Einzelne zählt. Und vor allem: „Es ist die Liebe, die die Erde zum Drehen bringt.“ K IR STIN BREITENFELLNER
863 S., 39 Abb., 28 Ktn. Geb. € 30,80[A] ISBN 978-3-406-72496-1
G
uram Dotschanaschwilis monumentales Epos „Das erste Gewand“ gilt als Parabel über die politische Tyrannei. Als solche bleibt es so allgemein, dass keine Kenntnisse der Gewaltherrschaft der Sowjets im Allgemeinen und ihrer Ausprägung in der Teilrepublik Georgien im Besonderen erforderlich sind, um seine Symbolik zu entschlüsseln. Da sich von der georgischen Nomenklatura offenbar niemand wiedererkannt hat, konnte der Roman, an dem der 1939 in Tiflis geborene Autor seit 1966 gearbeitet hatte, 1978 erscheinen. Das Buch avancierte zum Kultroman einer ganzen Generation und zum meistgelesenen Buch Georgiens. 2014 wurde es bei einer Umfrage der Fernsehsendung „Chemi zigni“ (Mein Buch) mit großem Vorsprung zum Lieblingsbuch der Nation gewählt. Die Übersetzung ins Russische war Ende der 1970er-Jahre nur möglich gewesen, weil die Übersetzerin die „gefährlichen Stellen“ des Textes weggelassen hatte, worauf die zuständige Kommission diesen als Kriminal- und Abenteuerliteratur klassifizierte. Erst nach der Perestroika konnte er unzensiert erscheinen. Dass der Roman den Kampf um Freiheit zum Thema machte, war in der Sowjet union davor, wo man offiziell bereits auf dem Gipfel der Freiheit lebte, ein absolutes Tabu gewesen. Es bedurfte also einiger Fantasieanstrengung seitens des Autors, die Geschichte so zu erzählen, dass ihr politischer Gehalt nicht zu offenkundig zutage trat. Dotschanaschwili verlegte die Handlung in eine nicht näher bestimmte Zeit und ein von archaischen Sitten und Gebräuchen geprägtes Dorf.
12
F A L T E R 4 1 / 1 8 L i t e r a t u r
Wenn ein Autor das gleiche Pech hat wie sein Held Dawit Kldiaschwilis tragikomischer Klassiker „Samanischwilis Stiefmutter“ erscheint erstmals auf Deutsch er tüchtigste aller jüngeren Erzähler D ist ohne Zweifel Dawit Kldiaschwili, welcher mit Humor das Landleben in sei-
ner Heimat Imeretien malt“, schrieb ein in Tiflis lebender deutscher Journalist 1903 in seinem Buch über „das georgische Volk“. Im Museum, das dem Autor in Georgien gewidmet ist, kann man heute noch Manuskripte, Fotos und Möbel sehen. Sein populärer Roman „Samanischwilis Stiefmutter“ von 1897 wurde nun erstmals ins Deutsche übersetzt. Kldiaschwilis Werke spielen in dem Milieu, aus dem er selbst stammte. Im Jahr 1862 wurde er in eine Familie absteigender Kleinadeliger hineingeboren. Im Nachwort schreibt Übersetzerin Rachel Gratzfeld, dass man solche verarmten Aristokraten als „Herbstfürsten“ bezeichnete, weil diese das ganze Jahr von dem zehren mussten, was ihnen von der herbstlichen Ernte blieb. Bei Platon, wie der Autor seine Hauptfigur
spöttisch getauft hat, erinnert nur mehr der Name an dessen noble Herkunft. Der Sohn des verwitweten Bekina ist fleißig und bringt mit seinen kargen Einkünften gerade die kinderreiche Familie über die Runden. Das Drama setzt ein, als sein Vater ihm eröffnet, wieder heiraten zu wollen. Der einzige männliche Nachkomme ist schockiert; mit einem Spross aus neuer Ehe müsste er sein ohnehin bescheidenes Erbe teilen.
Nachdem er seinem Vater eine neue Ehe schwer verbieten kann, beschließt Platon, dem Alten selbst eine Frau zu suchen. Wobei die Braut im besten Falle eine zweifache Witwe ohne Kinder sein sollte, denn nur bei einer offensichtlich Unfruchtbaren kann der Filius sichergehen, dass ihm keine späte Konkurrenz erwächst.
Während die Männer in Achaluchi (Hemd), Tschocha (Mantel) und Papachi (Pelzhut) stets nur den Tunnelblick auf ihre eigenen Wünsche und Ziele richten, halten Kldia schwilis weibliche Romanfiguren Tugenden wie Geduld, Hilfsbereitschaft gegenüber Schwächeren oder Gastfreundschaft hoch. Klarerweise steigen sie damit schlechter aus. „Gesegnet sei mir Gottes Allmacht, ich bin in seiner Hand. Er hat mich geschaffen, um Schmerz und Leid zu erdulden“, ruft die geschwängerte Elene am Gipfel ihres Unglücks aus. Voll Witz und fatalistischer Entschlossenheit treibt Kldiaschwili den Untergang von Platon voran. Der Antiheld sieht keine Alternative zu dem von ihm imaginierten Unheil und macht doch erst durch diese fixe Vorstellung alles kaputt.
Die darauffolgende Irrfahrt steckt voll schwar-
zem Humor. Nichts Gutes verheißt schon der dürre, schwache Gaul, neben dem Platon hergeht, weil ein Aristokrat standesgemäß mit Pferd unterwegs sein muss. Begleitet wird er von seinem Schwager Kiril, dem Klischee des trunk- und streitsüchtigen Kaukasiers. Der Saufbold bringt Platon aber weniger Unheil als der hinterlistige Schnorrer Aristo, der ihm seine verwitwete Tante Elene als Stiefmutter andreht. In der Theaterfassung zählt „Samanischwilis Stiefmutter“ zu den beliebtesten Stücken in Georgien; 1926 und dann noch einmal 1977 wurde der tragikomische Roman verfilmt. Seinen kritischen Realismus charakterisierte der Schriftsteller selbst als „Lachen durch Tränen hindurch“. So kommt etwa einmal ein demoliertes Haus vor, das zwei Brüder im Erbstreit „geteilt“ haben. Sehr zu ihrer Überraschung konnten sich die beiden Streithansln aus dem Baumaterial aber keine zwei neuen Häuser bauen.
Dawit Kldiaschwili: Samanischwilis Stiefmutter. Roman. Deutsch von Rachel Gratzfeld. Dörlemann, 160 S., € 20,60
Interessanterweise erlebte, wie man dem Nachwort entnehmen kann, der Schriftsteller selbst ein ähnliches Schicksal. Auch Kldiaschwilis betagter Vater heiratete noch einmal und brachte den Sohn damit in Bedrängnis. Na kein Wunder, dass der Autor die Psychologie seinen Protagonisten so gut verstanden hat, denkt man da. Die Ironie besteht freilich darin, dass Kldiaschwilis Stiefmutter erst 15 Jahre nach dem Erscheinen seines Erfolgsromans auf den Plan trat. NICOLE SCHE YERER
Georges Gurdjieffs Geist geht Gassi Zaza Burchuladzes „Der aufblasbare Engel“ ist eine Satire auf georgische Verhältnisse ebenso wie auf Aber- und Wunderglauben eit Anfang 2014 lebt Zaza Burchuladze S in Berlin. Sein recht wehmütiger letzter Roman „Touristenfrühstück“ (2017) han-
delt von den ambivalenten Erfahrungen des Exils. In Deutschland ist der Autor zwar sicher vor den religiösen Extremisten Georgiens, die seine Bücher verbrennen und ihn zusammenschlagen. Aber er ist auch fern der Heimat, die ihn geprägt und an der er sich literarisch abgearbeitet hat. „Der aufblasbare Engel“ ist noch vor Burchuladzes Flucht nach Deutschland entstanden. Der Roman erzählt die absurde Geschichte eines Paars, das sich an einer Geisterbeschwörung versucht und damit eine Kettenreaktion auslöst. Nino und Niko sind eigentlich ein ganz durchschnittliches Pärchen. Als 20-Jähriger hegte er den Wunsch, Filme zu drehen. Mittlerweile lebt er von dem, was seine Frau als einfache Beamtin nach Hause bringt. Niko sagt daher „in Ninos Gegenwart nicht immer das, was er sagen, sondern das, wovon er annahm, dass sie es hören wollte“. Aus Jux und Langeweile rufen die beiden im
Rahmen einer nächtlichen Séance den Geist von Georges I. Gurdjieff (1866–1949) an. Es handelt sich dabei um einen Schriftsteller und Komponisten griechisch-armenischer Herkunft, der in jungen Jahren in Tiflis lebte und dessen zusammengestoppellte esoterische Lehren ihm eine weltweite Anhängerschaft sicherte.
Zur Überraschung von Nino und Niko materialisiert sich Gurdjieff tatsächlich in ihrem Wohnzimmer. Sie wissen erst nicht so recht, was sie mit dem alten Zausel anstellen sollen, zumal er auch keine Anstalten macht weiterzuziehen. Er brabbelt den lieben langen Tag unverständliches Zeug vor sich hin: „Sie wussten nicht nur nicht, was die vielen kleinen ,Ichs‘, ,die Mensch-Maschine‘ oder ,der vierte Weg‘ bedeuteten, sie bezweifelten auch, dass Gurdjieff selbst genau wusste, wovon er sprach.“ Immerhin braucht er nicht viel zu essen und geht mit dem Hund Gassi. Mehr als fürs Spirituelle interessiert sich das Paar fürs Materielle. Und so beschließt es, mit Unterstützung von Gurdjieff den reichen Liebhaber einer Nachbarin zu kidnappen. Erfolgreich: Der Mann leistet nicht nur keine Gegenwehr, er zahlt bereitwillig eine Million Lösegeld und hat obendrein noch ein offenes Ohr für Gurdjieffs Lehren. Der macht ihn in der Folge zu seinem Homunculus. Die beiden bleiben in der Wohnung zurück, während deren ehemalige Bewohner ein Luxusheim beziehen. Darüber hinaus erfüllt Niko sich noch den Traum von der eigenen Konditorei und eröffnet ein Tortenparadies in Tiflis. „Der aufblasbare Engel“ funktioniert auf zwei Ebenen: Es lässt sich als spritzige Satire auf Esoterik, Aber- und Wunderglauben lesen; oder als – womöglich gar nicht so grelle – Satire auf gegenwärtige Verhält-
nisse. Bis heute ist die orthodoxe Kirche in Georgien extrem mächtig. Sie verfügt über einen starken Einfluss auf die Politik sowie den Polizeiapparat, vor allem jedoch auf das einfache Volk. Wiederholt hat Burchuladze in Interviews die
Zaza Burchuladze: Der aufblasbare Engel. Aus dem Georgischen von Maia Tabukashvili. Blumenbar, 192 S., € 20,60
Meinung geäußert, dass das Bildungswesen in seiner Heimat bewusst kurz gehalten werde: Wer etwas weiß, würde schließlich nicht mehr alles glauben. Der Witz an der Sache ist, dass Nino und Niko eigentlich der gebildeten Mittelschicht angehören. Sie haben zumindest eine solide Halbbildung genossen, ansonsten würde ihr Hund auch nicht Foucault heißen. Ihre Träume reichen dennoch über ein langweiliges „Schöner wohnen“-Glück nicht hinaus. Nicht mal in Einrichtungsfragen haben sie eigene Ideen: „In einem Wohnzimmer darf ein pastellfarbener Teppich (…) nicht fehlen oder eine mit verschiedenfarbigen Sandschichten gefüllte Bodenvase. Auf den Regalen sollten ein paar geometrische Figuren stehen, locker verteilt zwischen DVDs und einer fast baumstammdicken Aromakerze. Zudem ist es wünschenswert, das Foto einer Straßenszene einer nicht zu erratenden Metropole an der Wand hängen zu haben (…).“ Offenbar gibt es in Georgien lediglich zwei Arten von Menschen: radikale Gottesfürchtige und verwestlichte Einheitswesen. SEBASTIAN FASTHUBER
L i t e r a t u r F A L T E R 4 1 / 1 8
13
Das Z-Wort ist ein No-Go und kommt dennoch vor Eine Anthologie versammelt Gedichte von Roma und Sinti, übersetzt aus dem Romanes und 21 weiteren Sprachen inzahl: der Rom, die Romni, der Sinto, E die Sintezi. Mehrzahl: Roma und Sinti. Gegenteil: Non-Rom, Non-Sinti. Gleich zu
Beginn der Anthologie „Die Morgendämmerung der Worte. Moderner Poesie-Atlas der Roma und Sinti“ wird zuerst einmal definiert und klargestellt. „Zigeuner“ ist ein No-Go, gilt als „Z-Wort“, obgleich manche Roma und Sinti diesen Begriff bewusst benutzen, um zu provozieren „oder gar ein eigenes ,Zigeuner‘ oder ,Gipsy‘-Label zu verwalten“. Das schreibt Dotschy Reinhardt, Vorsitzende des Landesrats der Roma und Sinti in Deutschland, in seinem Vorwort. Dennoch kommt das Z-Wort in vielen Gedichten dieses Bandes vor. Weil viele der Übersetzungen vor 1990 entstanden sind, als das Wort noch gang und gäbe war – erklärt der Herausgeber Wilfried Ihrig. Es ist alles im Fluss. Vor etwa tausend Jahren wanderte die ethnische Minderheit der Roma aus Indien in Europa ein. Roma ist der Überbegriff für Roma und Sinti. Die Roma geben keinen konkreten Herkunftsort an, die Sinti nennen Sindh, ein Gebiet im heutigen Pakistan. Die Aufnahmekriterien für die Anthologie
erklärt Reinhardt so: „Wir finden in diesem Atlas eine Sammlung von Autorinnen und Autoren, die sich irgendwann zu ihrem Hintergrund als Sinteza und Sinto oder Romni und Rom geäußert haben oder deren Romno-Hintergrund mehr oder we-
niger glaubhaft über Dritte (oft Angehörige) dokumentiert wurde. Hinzu kommen Gedichte der Jenischen und Traveller, die aber ohne diesen Sinti- oder Roma-Hintergrund sind.“ Es gibt einen kulturellen Internationalismus der Roma, was aber keineswegs bedeutet, dass sie sich von den Ländern, in denen sie leben, separatistisch absetzten. Im Gegenteil. Roma sind integriert, wenn auch oft nicht akzeptiert. Sie schließen sich den jeweils dominanten Religionsgemeinschaften an, es gibt katholische, muslimische und evangelische Roma. Atheistische Roma gibt es hingegen kaum. Dass die Gedichte dieser Sammlung inhomogen ausfallen, wenn die Kriterien so allumfassend sind, versteht sich. Wie es keine Roma-Religion gibt, so gibt es auch keine Roma-Lyrik, wohl aber von Roma verfasste Lyrik. Was alle Roma eint, ist ihre Verfolgung und ihre Ausgrenzung, die historische durch die Nationalsozialisten und die aktuelle durch die neonationale Rechte. 500.000 Roma wurde von den Nazis ermordet; der Völkermord an ihnen wurde erst 1982 anerkannt. Viele Gedichte der älteren Generation kommen davon nicht los, so auch Österreichs bekannteste Roma-Dichterin Ceja Stojka: „Ich / Ceija / sage / Auschwitz lebt / und atmet / noch heute in mir“. Manche Roma sind uns nicht als solche bekannt. Selbst Dotschy Reinhardt
Donald Trump liest nicht gern. Welt, bleib wach.
war überrascht, als sie erfuhr, dass Charlie Chaplin ein Rom war. Sein Sohn Michael behauptet, Beweise dafür zu haben. Im Abschiedsgedicht des kanadischen Dichters Ronald Lee an Yul Brynner ist davon die Rede, dass sich Brynner als Roma bekannt habe: „Du hast dich geoutet, / um unsere Brüder und Schwestern zu repräsentieren, / als du am meisten gebraucht wurdest.“ Die Herausgeber Wilfried Ihrig und Ulrich
Ulrich Janetzki, Wilfried Ihrig: Die Morgendämmerung der Worte. Moderner PoesieAtlas der Roma und Sinti. Die Andere Bibliothek, 392 S., € 43,20
Janetzki haben Beträchtliches im Sammeln geleistet. Schriftlich äußern sich Roma erst seit etwa 1900, die meisten schreiben nicht auf Romanes, sondern in der jeweiligen Landessprache. Und selbst bei diesen Sprachen lässt sich erkennen, wie sehr die europäischen Dinge im Fluss sind. Das Buch ordnet die Gedichte nach Landessprachen; im Kapitel Jugoslawien und Nachfolgestaaten (das einige der besten Gedichte enthält) gibt es Übersetzungen aus dem Kroatischen, Serbischen und Serbokroatischen, dem Romanes und dem Englischen. Insgesamt wird aus 21 Sprachen und dem Romanes übersetzt. Die Herausgeber verzichten auf poetologische Einordnungen (die wären kaum möglich) und trösten uns dafür mit einem detaillierten Register der Autorinnen und Autoren und einem Blick auf einen dichterischen Kontinent, von dem die meisten von uns bisher nichts geahnt haben. AR MIN THURNHER
F A L T E R 4 1 / 1 8 L i t e r a t u r
Die Welt ist Immer der Pfeife nach: Innerhalb
D
a sind ja nur Neger zu sehen.“ Ein harter, heute sagt man: unkorrekter Auftakt für ein Buch, das auch in der Neuüberarbeitung seiner Übersetzung nicht um das auf den weiteren 200 Seiten in geballter Häufung zu findende N-Wort herumkommt. „Die Schwarze von Panama“, 1935 geschrieben und im Frühwerk von Georges Simenon einer der weniger bekannten Romane des Autors, ist eine Etüde über eine sich auch sprachlich manifestierende Verwahrlosung in einem kolonialistischen Sumpf, aus dem die Protagonisten, egal, ob schwarz oder weiß, kaum jemals herausfinden. Joseph Dupuche, ein französischer Geschäftsmann, bleibt nach einer Firmenpleite in Panama hängen. Seine jüngst Angetraute will sich mit dem sich anbahnenden Misserfolg nicht abfinden, ihr Mann aber lässt sich in einer Endlosschleife aus Alkohol, Hitze und Sinnentleerung im freien Fall nicht bremsen und verliebt sich auch noch in eine schwarze Minderjährige. Am Ende erhält der Leser die folgende Information: „Dupuche starb zehn Jahre später an einer akuten Harnblutung. Er hatte seinen Wunschtraum verwirklicht: das Leben in einer der Hütten am Meer, gleich hinter dem Bahnhof, inmitten von wucherndem Unkraut und Abfällen. Er hatte sechs Kinder, von denen drei ganz schwarz und zwei Mestizen waren, während das jüngste eine fast weiße Haut hatte und nur eine bläuliche Verfärbung der Fingernägel seine Abkunft verriet.“ Der Fall Dupuche ist letztlich ein „klassischer Fall“ – zumindest für Simenon-Leser, denen der Autor in 192 Romanen und wer weiß wie vielen Erzählungen immer wieder die Schicksale von Menschen zumutet, für die eigentlich alles wunderbar laufen müsste, die irgendwann aus der Spur ausscheren, während scheinbar offenkundige Verlierer durchaus Gewinne machen. In der dieser Tage startenden SimenonGesamtedition, die der ehemalige Diogenes-Verleger Daniel Kampa gemeinsam mit Hoffmann und Campe bis Herbst 2020 zu stemmen gedenkt, ist „Die Schwarze von Panama“ denn auch so etwas wie ein x-beliebiger möglicher Start in das System Simenon, in dem gilt, dass die Schwere vieler „Fälle“ durch das Lapidare des spürbar schnell Dahingeschriebenen in Balance gehalten wird. Die Geschichte des Joseph Dupuche ist defini-
tiv kein großer literarischer Wurf wie zum Beispiel Malcolm Lowrys „Unter dem Vulkan“ oder die Romane von William Faulkner. Aber gerade im für Simenon typischen Duktus einer Verweigerung von Einzigartigkeit verdichtet sich die Gewissheit, dass gerade Schicksale und Geschichten, die sich jeden Tag, überall, in vielen Büchern ereignen können, massiv ins Gewicht fallen. Nicht wenige Artikel über Georges Simenon beginnen mit der Feststellung, dass Artikel über Georges Simenon schwer zu schreiben seien und dass es noch schwerer sei, einen Anfang zu finden. Mitunter behelfen sich die Verfasser solcher Artikel mit Zitaten sehr berühmter Autoren, die viele wichtige Preise erhalten haben, aber de-
Illustr ation: georg feierfeil
14
L i t e r a t u r F A L T E R 4 1 / 1 8
15
alles, was ein Fall ist von zwei Jahren soll das Gesamtwerk des Vielschreibers Georges Simenon auf Deutsch erscheinen mütig einknicken vor einem „Titanen“ und „Menschenkenner“, der seinerseits nie einen wichtigen Preis erhalten habe, aber halt doch einer der wichtigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts sei. Sehr gerne wird auch behauptet, dass Sime-
nons Œuvre – darunter allein 75 Romane rund um den Serien-Kommissar Jules Maigret – quasi eine Wiederaufnahme von Honoré de Balzacs „Menschlicher Komödie“ sei und auch für ihn gelte, was Marcel Proust einmal über Balzac geschrieben hat (wir zitieren ihn aus dem Gedächtnis heraus sicher falsch): Selten glänze einer der Texte für sich, vielmehr entfalte sich deren Wirkung aus dem Ensemble heraus, als bewege man sich entlang von Bildern einer Ausstellung. Niemand, der gern und viel liest, kommt darum herum, Simenon in Serie zu lesen. Es entsteht – Stichwort „binge-reading“ – eine Sucht, die sich kaum noch aufhält mit (vorher eifrig aufgelesenen) Details, obwohl gerade in denen der Teufel sein Unwesen treibt. Man lässt sich ein auf eine Betrachtung größerer Flächen. Auf größere Geschwindigkeiten. Betrachtungen zum einen Buch ergeben Grundierungen für die Lektüre des nächsten, bis sich die Plots und Titel heillos ineinander verzwirbeln. Kann selbst und gerade ein vielbelesener Mensch aus dem Stand heraus sagen, worum es etwa in „Maigret bei den Belgiern“ oder in „Maigret zögert“ geht? Ist „Betty“ jetzt das Buch über eine Alkoholikerin, die alles rund um sich förmlich einweicht, oder waren da nicht noch viele andere Texte von Simenon über Trinkerinnen und Trinker, mit denen wir jetzt in unserer Erinnerung die Geschichte von Betty anreichern? Anders als die Rezensenten, die davon ausge-
hen, dass es der Plot und das Thema seien, die zu interessieren hätten, halten zumindest wir Simenon-Leser es lieber mit einem
Ab sofort erscheinen alle 75 Maigret- und alle 117 großen Romane von Georges Simenon (circa 20 Romane pro Halbjahr) in revidierten oder vollständig neuen Übersetzungen. Das Projekt ist eine Kooperatiom der Verlage Kampa und Hoffmann und Campe und soll im Herbst 2020 abgeschlossen sein
Sound der Sprache, einer Haltung und also auch einer Form, aus der heraus sich begreifen ließe, warum wir uns zum Beispiel von einem Textkonvolut angezogen fühlen. War es der Sänger von Wanda, der seine manische Vorliebe für Columbo mit der Art begründete, in der Peter Falk die Nähe zu Tätern förmlich körperlich suche? Egal. So geht es einem jedenfalls auch bei Maigret, bei dem viele Ermittlungen zu einer einzigen werden. Die Welt ist alles, was ein Fall ist, während Maigrets Kompagnon, Inspektor Lucas, immer wieder gerne zum nächsten Bier abschweift und der Kommissar unter dem phlegmatischen Motto „Immer der Pfeife nach!“ Menschen zu verstehen versucht bzw. sehr oft auch so etwas wie Verständnis aufbringt. Für Notlagen, aus denen heraus Abweichungen von der Norm entstehen. Fortwährend verändern sich Simenons Werk-
zusammenhänge im Auge des Betrachters/ Lesers, der seine eigenen Prioritäten setzt. Franz Schuh hat es einmal unter dem Topos „tropfenförmiges Weltbild“ so versucht: „Bei Simenon sammle ich (ich weiß, ich bin nicht der einzige) Regentropfen, denn er ist unter den Schriftstellern der beste Regenmacher. (...) Große Schriftsteller, und Simenon ist für mich einer der größten, haben nicht selten einfache Motive, von denen sie zum Wiederholen gezwungen werden: Immer wieder vom Regen schreiben; so kann man niemals mit dem Schreiben aufhören, und jedes Wetter ist ja nichts anderes als eine condition humaine, die sich auch in den Regentropfen spiegelt.“ Es ist nun durchaus nicht so, dass es in Simenons Büchern immer regnet. Manchmal ist der Himmel über Paris oder Flandern einfach nur verhangen, oder an der Côte d’Azur scheint eine relativ brutale Sonne (einige der besten Bücher von Simenon spielen zwischen Cannes und Antibes). Aber der meteorologische Zwang zur
Wiederholung: Er fasst sehr gut, was Simenons Bücher ausmacht, von denen wohl kaum allzu viele je alle, aber nicht wenige viele gelesen haben. Sie queren gewissermaßen eine Großwetterlage. Vor lauter Regentropfen und prismatischen Spiegelungen sieht man kaum noch, ob sich die bei Simenon vermittelte Menschenkenntnis lakonischer Abstraktion verdankt, die seine Romane meist wirklich zeitlos erscheinen lässt, oder nicht doch viel eher einer nachgerade journalistischen Präzision in der Wiedergabe von spezifischen, zeitverhafteten Milieus, aus denen heraus das Allgemeinmenschliche erst zu strahlen beginnt. Von Balzac wird überliefert, er habe sich bemüht, „wie ein Maler“ zu schreiben. Auf Simenon übertragen könnte man behaupten: Er war der Fotograf in einer schreibenden Zunft. Was wiederum unterschlägt, dass Simenon zwar in der Tat sehr schnell geschrieben (ein Kapitel pro Tag bei durchschnittlich neun bis elf Kapiteln), gleichzeitig vor dem Schreiben aber ausgiebig recherchiert hat, welche Menschen es sind, auf die er sich da einlässt. Wie heißen sie? Wie viel verdienen sie? Wie se-
hen ihre Wohnungen aus und was sehen sie, wenn sie aus dem Fenster blicken? War der Rahmen erst einmal vorgegeben, dann erledigt sich die Sache quasi von selbst. Ein Druck auf den Auslöser, und selbst wenn das Sujet fade oder etwa unscharf gerät: Im Rahmen der Vorgaben oder Auftrags „passt“ es, ist stimmig. Momentaufnahmen für die Ewigkeit: „Dupuche saß im fahrenden Zug. Er blickte auf die vorüber gleitenden Wälder, die für den Menschen undurchdringlich waren. Er befand sich auf der Schattenseite. Er rauchte eine Zigarette und fühlte sich überaus wohl. Nicht eigentlich glücklich, aber es war ihm leicht ums Herz.“ CL AUS PHILIPP
Wenn Recht nicht Gerechtigkeit ist Die Geschichte einer lebenshungrigen Frau, die um Gerechtigkeit für ihre Geschwister kämpft. »Mechtild Borrmann erzählt unaufgeregt die aufregendsten Menschengeschichten.« WAZ
droemer-knaur.de
288 Seiten | € [A] 20,60
Der neue Roman von Mechtild Borrmann
16
F A L T E R 4 1 / 1 8 L i t e r a t u r
Wer sich in Familie begibt, kommt darin um In ihrem jüngsten Roman erzählt Delphine de Vigan von der destruktiven Macht kindlicher Loyalität gegenüber den Eltern igentlich ist er die Unauffälligkeit in E Person, fast verschmilzt er mit seiner Umgebung. Und doch meint seine Lehrerin
Helène zu spüren, dass Théos „besondere Art, sich der Aufmerksamkeit zu entziehen“, einen anderen Grund hat als die allgemeine Verlorenheit eines Zwölfjährigen im vagen Niemandsland zwischen Kindheit und Jugend. In der Klasse wird Théo trotz seiner Schweigsamkeit respektiert, mit seinem besten Freund Mathis bildet der blasse, dünne Junge mit dem Engelsgesicht eine symbiotische Einheit, „eine Art Qualle, die sich plötzlich zusammenzieht, wenn sich jemand nähert, um sich dann, wenn die Gefahr vorüber ist, wieder auszudehnen“. Mit Mathis versteckt sich Théo ab und zu in einer schwer zugänglichen Nische unter der Treppe zur Mensa. Dort schwänzen sie den Unterricht und trinken zusammen Wodka, jedes Mal ein bisschen mehr. Théo liebt das Gefühl der Wärme, das der Alkohol auslöst, „die Raubvogelklauen, die seine Brust ständig zusammendrücken“, sie lösen sich. Doch Théos Auffälligkeiten häufen sich, er
schläft im Unterricht ein, sein Gang ist unsicher. Bei einem Test blickt er nur starr vor sich hin und beantwortet keine einzige Frage. Seine Lehrerin bespricht sich mit einem Kollegen und mit dem Rektor, schickt Théo zur Schulkrankenschwester,
spricht mit dessen Mutter. Helène vermutet, dass Théo Misshandlungen ausgesetzt ist. Aber hat sie diesen Verdacht nur, weil sie selbst als Jugendliche von ihrem Vater geschlagen und missbraucht wurde? Es ist ein leises, packendes Kammerspiel der Bedrückung, welches Delphine de Vigan in ihrem neuen Roman „Loyalitäten“ inszeniert. Seite für Seite des schmalen Buches sieht man der Hauptfigur beim selbstgewollten Verlöschen zu. Wird Helène es noch rechtzeitig schaffen, den Kokon, den Théo um sich gesponnen hat, aufzureißen? Oder wird sie sich von den Beschwichtigungen ihrer Umgebung einlullen lassen? Erzählt wird die Geschichte nicht nur aus Théos Perspektive, sondern auch aus jener der Lehrerin, seines Freundes Mathis und dessen Mutter Cécile (wobei es etwas unstimmig wirkt, dass die Autorin für die Frauen die Perspektive der Ich-Erzählerin und für die beiden Buben die des auktorialen Erzählers gewählt hat). Mit jedem der kurzen Kapitel beginnt sich der nebelhafte Hintergrund der stillen Selbstauslöschung Théos ein wenig zu klären. Man erfährt von der frühen Trennung seiner Eltern, vom Scheidungskrieg, in dem der Bub zur stummen Geisel wird. Die Mutter empfängt den Jungen nach seinen Aufenthalten bei ihrem Exmann wie ein kontaminiertes Objekt: Théo muss erst
einmal unter die Dusche. Nachdem der Vater die Arbeit verloren hat, wagt der loyale Sohn, der ihm den Haushalt führt, es nicht, jemand von dessen Verwahrlosung zu erzählen. „Ich weiß, dass Kinder ihre Eltern schützen und dass dieser Pakt des Stillschweigens sie manchmal sogar das Leben kostet“, weiß die leidgeprüfte Helène. Wie schon in einigen vorangegangenen, stark
Delphine de Vigan: Loyalitäten. Roman. Aus dem Französischen von Doris Heinemann. DuMont, 174 S., € 20,60
autobiografisch grundierten Romane beschäftigt sich Delphine de Vigan auch in „Loyalitäten“ mit der emotionalen Prägeanstalt namens Familie. In ihrem Debütroman „Tage ohne Hunger“ setzte sie sich mit ihrer Magersucht auseinander, in ihrem Bestseller „Das Lächeln meiner Mutter“ nahm sie den späten Selbstmord ihrer Mutter Lucille zum Anlass, hinter die Fassade ihrer Familie zu blicken und die Weitergabe emotionaler Traumata an die nächste Generation zu thematisieren: „Lucilles Schmerz war Teil meiner Kindheit und später unseres Erwachsenenlebens, vermutlich macht Lucilles Schmerz einen Teil unserer Persönlichkeit aus.“ Emotionale Dissonanzen im Leben der Eltern hallen auch in Vigans jüngstem Roman als Echos im Leben ihrer Kinder nach. Die Selbstaufgabe seines Vaters findet in Théos Verhalten ihre Fortsetzung. Seine Loyalität wird den Jungen womöglich das Leben kosten. STEFAN ENDER
Wenn die Himbeeren durchdrehen „Hysteria“ hätte ein Bio-Thriller werden können, aber Eckhart Nickel betätigt sich als Adalbert Stifter des 21. Jahrhunderts er Mann war Pop. Er hat für das ZeitD geist-Magazin Tempo geschrieben, gemeinsam mit Christian Kracht die Litera-
turzeitschrift Der Freund herausgegeben, war Mitglied des popkulturellen Quintetts Tristesse Royal. Jetzt aber, mit seinem neuen Roman, geht es in eine ganz andere Richtung. Eckhart Nickel präsentiert sich in „Hysteria“ als eine Art Adalbert Stifter des 21. Jahrhunderts. Was findet man da? Alles ist bio, aber: „Mit den Himbeeren stimmte etwas nicht.“ Mit einem Text, der mit diesem Satz begann, hat Nickel im Vorjahr beim Bachmann-Wettlesen in Klagenfurt den Kelag-Preis gewonnen. Inhalt der Geschichte: Ein Mann schöpft Verdacht. Am Biobauernmarkt stellt er fest, dass die Früchte eine seltsame Konsistenz und einen leicht abweichenden Geschmack haben. Auch mit dem Rindvieh stimmt etwas nicht. Es reibt sich am Gatter das Hinterbein wund. Unter dem Fell wird etwas sichtbar, was wie künstliches Fleisch aussieht. Jetzt liegt der Roman vor, den Nickel aus die-
sem gloriosen Auftakt gemacht hat. Der Protagonist des Buches, Bergheim genannt, geht der Sache auf den Grund und besucht die Kooperative, die die Früchte auf den Markt gebracht hat. Gerät dabei an immer seltsamere Betriebstätten. Das vermeintlich Natürliche scheint hier ausschließlich auf künstlichem Weg produziert zu sein
und eine Vereinigung namens „Das spurlose Leben“ dabei eine zentrale Rolle zu spielen. Die Ideologie der Gruppe ist radikal: Kein Mensch soll auf Mutter Erde mehr Abdrücke hinterlassen als absolut nötig; kein Tier darf geschlachtet und keine Frucht von Baum, Strauch oder Wurzel genommen werden.
im großen Stil und geht in seinem Buch so nahe an die Dinge heran, dass man vor lauter Hypersensibilität bald gar keinen Zusammenhang mehr sieht. So eine Literatur muss man mögen, und man
Innerhalb der Gruppe der radikalen Frutarier,
die im Unternehmen arbeiten und es wohl auch leiten, trifft Bergheim auf ehemalige Studienkollegen, die ihre Bekanntschaft großteils verleugnen, in Bergheim aber Erinnerungen an vergangene Zeiten wecken. Treffpunkt war damals eine sogenannte „Aromabar“. Ein Ort, der wie die Biovariante der Korova Milk Bar aus Stanley Kubricks Film „Clockwork Orange“ anmutet. Nicht nur die Menschen, auch die Drogen haben sich verändert. Der schnelle Flash in andere Welten ist nicht mehr gefragt. Jetzt geht es darum, feinsten Nuancen in gewagten Aromamischungen nachzuschnuppern. Die Wirkung: dennoch famos. Bergheim durchschaut die Dinge, die er in der Kooperative zu sehen, spüren und riechen bekommt, niemals vollständig. Und je präziser Nickel die Beobachtungen seiner Hauptfigur beschreibt, desto rätselhafter werden diese. Das ist ein bekanntes Phänomen des literarischen Naturalismus, an dem schon die Stifter’schen Welten ins Unheimliche kippten. Nickel nutzt den Effekt
Eckhart Nickel: Hysteria. Roman. Piper, 240 S., € 22,70
braucht dafür einen etwas längeren Atem. Es ist ein Schreiben der Entschleunigung und Akribie. Gut hätte sich aus dem Stoff auch ein Biothriller drechseln lassen. Den Autor aber interessiert das nicht. Spannungsmomente nimmt er eher billigend in Kauf, als dass er sie bewusst herstellen und für einen stringenten Fortgang der Handlung nutzen würde. Alles, was nach Pop und schnellem Rhythmus klingt, scheint geradezu vorsätzlich aus dem Buch verbannt und Chancen auf einen höheren Entertainmentfaktor bewusst vergeben. Dafür gewinnt „Hysteria“ auf der anderen Seite Neues hinzu. Dieses Buch ist eben nicht bloß ein Traktat über Bio und Bauernmarkt, mit der bissigen Vorstellung im Rücken, dass sich die Natur nur retten lässt, wenn man sie künstlich reproduziert. Sein eigentliches Thema ist ein anderes, nämlich die Allmacht der Gegenwart. Zur Vergangenheit führt kein Weg mehr zurück, es sei denn in der Hysterie der Erinnerung. Bergheim ist so ein Hysteriker der Erinnerung. Ein Wirrkopf einer Welt von gestern. Heillos veraltet im Jetzt. Kurzum: Etwas mit ihm stimmt nicht. K L AUS K ASTBERGER
L i t e r a t u r F A L T E R 4 1 / 1 8
17
Roll over Ballester, Barbetta! Mit kühnem Überschwang nähert sich Maria Cecilia Barbetta einem Vorort von Buenos Aires im Jahre 1974
V
iele Jahre muss Maria Cecilia Barbetta an diesem Roman laboriert haben, ihrem zweiten nach der viel gelobten „Änderungsschneiderei Los Milagros“, der 2008 erschienen ist. Die vielen Stipendien- und Residenzgeber, denen die Autorin eingangs dankt, bezeugen die Länge und vielleicht auch Mühe der Strecke, an deren Ende nun „Nachtleuchten“ steht, das fertige Werk und zugleich das Protokoll seiner Probleme. Noch einmal hat sich Barbetta, 1972 in Buenos Aires geboren, thematisch in ihre Geburtsstadt vertieft, genauer in den nördlichen Vorort Ballester, in dem sie selbst aufgewachsen ist. Und wieder ist ihr Schreiben befeuert von einer großen Begeisterung, einerseits für die deutsche Sprache, andererseits für die literarischen Traditionen Südamerikas, die mit dem Schlagwort „Magischer Realismus“ unzureichend beschrieben wären. Mit den Schrumpfformen dieser Schule – man denke an Isabel Allende – hat Barbetta jedenfalls nichts im Sinn; dann eher schon mit Julio Cortázar und einem Hang zum Imaginativen und Übersinnlichen, der ohne Verankerung im Katholizismus nicht zu denken ist. Aber der Spuren, Fährten und Verweise sind so viele in diesem Roman, dass man sie in einer Lektüre ohnedies nicht alle verarbeiten kann.
»
Der Roman kreist in sich, aber auf jeder der 522 mit wunderschöner Prosa gefüllten Seiten passiert Aufregendes
Im Zentrum des Romans steht, nun ja, was ge-
nau? Eigentlich hat Barbetta drei kürzere Romane geschrieben, die von den Leuten im Ballester des Jahres 1974 erzählen, jenem Jahr, in dem der eben erst aus dem Exil zurückgekehrte Diktator Juan Perón stirbt. Dessen Witwe Isabel, bar jeder Eignung, aber ausgestattet mit spiritistischen Neigungen, wird ihm ohne Wahlen nachfolgen. Ein Schauspiel, das die Militärs zwei Jahre später brüsk beenden sollten. Von all diesen Vorgängen erfährt man in dem Roman allerdings nichts, denn dieser bleibt in Ballester und bei den sogenann-
Maria Cecilia Barbetta: Nachtleuchten. Roman. S. Fischer, 522 S., € 24, 70
Bücherstube Joachim Baumann empfiehlt
buecherstube.baumann@chello.at www.buecherstube.biz Telefon: 01 369 54 32 WhatsApp: 0660 123 8005 Gymnasiumstraße 58, 1190 Wien Mo–Fr: 9.00–18.00, Sa: 9.00– 13.30
ten kleinen Leuten, ihren Sorgen und Nöten, vor allem aber bei ihren Wünschen und Hoffnungen. Es gärt in Ballester und anderswo, wir sehen uns versetzt in ein Laboratorium der gesellschaftlichen Umwälzung, in dem sich vielerlei Impulse mischen, realistische ebenso wie fantastische. Der Reihe nach geht es um eine katholische
Mädchenschule, in der ein paar Schülerinnen das Zweite Vatikanum auf eigene Faust verwirklichen wollen, etwa in Gestalt einer nachts von Haus zu Haus wandernden fluoreszierenden Madonnengestalt, die das titelgebende „Nachtleuchten“ erzeugt. Wir beobachten einige Kleingewerbetreibende, Automechaniker, Friseure bei ihren Verrichtungen und lauschen mehr noch ihren Unterhaltungen. „Autopia“ heißt bezeichnenderweise die Autowerkstatt, nebenbei oder hauptsächlich eine Brutstätte dissidenter politischer Ideen. Im dritten und letzten Teil schließlich macht sich eine Gruppe von Schulkollegen daran, die Geheimnisse des Spiritismus zu lüften, auch das eine politische Angelegenheit, wenn schon die Präsidentin selbst ihre Inspiration aus Séancen bezieht. Man stellt bald fest, dass die einzelnen Teile nur lose zusammenhängen. Keine spannende Handlung verbindet sie, kein Rätsel drängt nach Auflösung. So dicht das Motivnetz des Romans auch geflochten ist, so sehr das ganze Geschehen auch um Fragen des Wunders und seiner Realisation im Alltag kreist: Es kreist eben statt sich zu entwickeln. Dass Barbetta am Ende einen Roman in drei Büchern verfasst hat, mag damit zu tun haben, dass keine der drei Geschichten wirklich das Zeug zum „großen“ Roman hat: Es passiert ja auf den 522 Seiten vor allem auf der Mikroebene Aufregendes. Und zwar auf jeder Seite, die Barbetta mit ihrer tatsächlich wunderschönen deutschen Prosa füllt. Die Autorin bekennt
ja gerne, dass sie die deutsche Sprache, die nicht ihre Muttersprache ist, liebt und dass sie in keiner anderen Sprache, auch nicht in Spanisch, schreiben möchte. Die geliebte deutsche Sprache jedenfalls vergilt es Maria Cecilia Barbetta in gleicher Weise. Es gibt nicht viele Gegenwartsautorinnen, die so erfinderisch, farbig und kühn schreiben können wie sie. Unweigerlich drängt sich das Sprachliche vor jeden Inhalt, einfach weil es so reich und dicht ist. Der Roman lebt von diesem Überschuss in der Artikulation, der sich in typografischen Experimenten, Illustrationen, Löschungen oder der aparten Einteilung in drei mal dreiunddreißig plus einem finalen Kapitel niederschlägt. Man kann dem Text vorhalten, dass er überelaboriert wäre. Aber hier begrüßen wir das Manierierte als Stil, als Manierismus, Ausdruck eines überbordenden Gestaltungswillens, hinter dem das Gestaltete ein bisschen verblassen muss. So gesehen tut es einem ein bisschen leid um die Leute von Ballester, die von Barbettas Sprach- und Formfuror beinahe überrollt werden. Sollte man die eigene Darstellungsfreude nicht
besser in den Dienst der Sache stellen, kürzer werden, prägnanter und asketischer und einfach auch mal die eigene Erzählkirche im Dorf der Tatsachen lassen? Aber vielleicht funktioniert ja Barbettas Schreibimpuls genau so und nicht anders. Die Form des Romans taugt dafür freilich nur bedingt, und wahrscheinlich wurden schon jene von Barbettas Vorbild Cortázar seinerzeit eher gepriesen als tatsächlich gelesen. Man braucht Geduld, um sich durch diesen langen Roman zu arbeiten, der einen Seite für Seite mit seiner unermüdlichen Erzähl- und (hier passt das Wort vielleicht einmal) Fabulierlust erfreut und der gleichzeitig die Durchsicht auf die erzählte Welt vielleicht unnötig erschwert. CHRISTOPH BARTMANN
Gerhard Jäger
ALL DIE NACHT ÜBER UNS Allein auf einem Wachturm bewacht ein namenloser Soldat zwölf Stunden lang eine Grenze – und all die Erinnerungen, die auftauchen und ihn nicht mehr loslassen. Fesselnd, poetisch und bildgewaltig erzählt Gerhard Jäger von Liebe und Schmerz, von Verlust und Verantwortung und von Flucht als menschlicher Grunderfahrung. 240 S., gebunden, ISBN 978-3-7117-2064-1, Ð 22,-
www.picus.at
Picus
1
Buy local! Eine Aktion der ARGE Österreichische Privatverlage und unabhängiger Wiener Buchhandlungen Inserat Falter.Jäger.indd 1
04.10.18 15:10
18
F A L T E R 4 1 / 1 8 L i t e r a t u r
Der Maulwurf mit den Nixenaugen Karin Duve hat einen farbenfrohen Zeit- und Charakterroman über Annette von Droste-Hülshoff geschrieben
Die Annette von 1817 ist bei der ganzen Ver-
wandtschaft als schwierig verschrien, als eine, die zu oft und zu grell lacht, die nicht Konversation macht, wie es sich gehört, sondern allzu ernsthaft und ungeniert spricht und widerspricht, auch den Herren. Karen Duve schätzt klare Worte: „Annette von Droste-Hülshoff war eine Nervensäge.“ Dass sie Verse schreibt, ginge ja noch
an, dass sie aber meint, mit den dichtenden Freunden ihres nur um wenig älteren Onkels August von Haxthausen konkurrieren zu können, findet man allenthalben peinlich. Dabei ist die Zwanzigjährige ein hässliches Entlein, aus dem kein Schwan zu werden verspricht, und überdies kurzsichtig wie ein Maulwurf. Doch nach und nach übt sie auf die jungen Männer ihrer Umgebung eine auch für sie selbst erstaunliche Wirkung aus, man bewundert ihren Geist, ihren Witz, ihr Klavierspiel und ihren Gesang und lobt ihre Haare und „Nixenaugen“. Ganz an den Beginn stellt Duve eine Szene, die der Chronologie nach erst später kommt: die Annäherung zwischen Annette und dem wirklich hässlichen, bitterarmen Studenten Heinrich Straube, der ein Protegé Augusts ist und nicht nur bei diesem als poetisches Genie gilt. Mit einem aufgenötigten Kuss im Treibhaus hält Straube den Bund fürs Leben für besiegelt und auch sie (Annettes Sicht der Dinge wird nachgeliefert) ist sich ihrer Liebe sicher, wenngleich sie die damit einhergehenden körperlichen Sensationen gewöhnungsbedürftig findet.
fremd; in den „Szenen aus Hülshoff “ lässt sie ihren Bruder sagen: „Nenn’ sie Hexe und Kokette, / Aber nur nicht kleine Nette!“ Wer so zwischen Hybris und Demut schwankt, tut sich schwer mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Karen Duve, zuletzt mit einem Pamphletroman („Macht“) hervorgetreten, hat nicht nur eine formidable Charakterstudie, sondern auch ein farbenfrohes Milieu- und Zeitporträt gezeichnet. Ihr Blick auf die Marotten des westfälischen Adels wie der krawall- und trunksüchtigen Göttinger Studentenschaft vermittelt so etwas wie großzügige Ironie, mit der sie auch die Prominenz, die Brüder Grimm, Hoffmann von Fallersleben, Brentano oder Heine, nicht verschont. Dass sie in der deutschen Romantik ganz und gar zu Hause ist, zeigt sich am politischen Diskurs, aber auch am prächtigen Alltagskolorit und vielen Realien. Duves sehr heutige Erzählstimme verleugnet
Begonnen hat alles mit einem Affront: Einen
„Geruch wie von einem nassen Hund“ hat sie, laut und vorlaut wie stets, dem Gast in seinem alten Flausrock coram publico bescheinigt. Zwei Jahre später ist es Straubes Freund und Kommilitone August Freiherr von Arnswaldt, der „schöne Arnswaldt“, der die beiden auseinanderbringt. Seine moralische Entrüstung entspringt verschmähter Liebe – oder gekränkter Eitelkeit. Diese psychologischen Finessen zeichnet Duve in wiederholtem Perspektivwechsel meisterlich nach, wenn der Intrigant „am Wort“ ist, vibriert der Text vor verhaltenem Hohn. Geradezu schmerzhaft spürbar wird Annettes Eingeklemmtsein zwischen den katholischen Zielvorgaben der unerbittlichen Mutter und der milden Großmutter. Selbstironie war ihr nicht
Karen Duve: Fräulein Nettes kurzer Sommer. Roman. Galiani Berlin, 581 S., € 25,70
dabei nicht die Distanz zum Berichteten: „Drehen wir die Uhren auf das Jahr 1817. Es dürfte sich dabei um Taschenuhren handeln. Die Armbanduhr war zwar bereits erfunden, konnte sich aber erst im 20. Jahrhundert durchsetzen.“ In den Dialogen aber stören die Anachronismen („mein Nettchen schafft das“) denn doch. Und die zahlreichen Kutschfahrten auf verschlammten Wegen, die nicht enden wollenden studentischen und familiären Dispute über die Fragen der Zeit hätten eine kräftige Kürzung vertragen. Dennoch ist dieses Buch einer Bestsellerautorin eine mehr als artige Verbeugung vor der überlebensgroßen Gestalt der Anna Freiin von Droste zu Hülshoff, die sich einst schwor, „nie auf den Effekt zu arbeiten“: „Ich mag und will jetzt nicht berühmt werden, aber nach hundert Jahren möcht ich gelesen werden, und vielleicht gelingt’s mir, da es im Grunde so leicht ist, wie Kolumbus Kunststück mit dem Ei.“ DANIEL A STRIGL
Illustr ation: georg feierfeil
E
inen Roman, so hat man früher nicht nur die Gattung genannt, sondern auch das, wovon diese handelt: die Liebesgeschichte. Mindestens einen Roman hat auch eine deutsche Dichterin erlebt, die als Inbild des ältlichen Fräuleins gilt, obwohl sie leidenschaftlich glühende Verse geschrieben hat: Annette von Droste-Hülshoff (1797–1848). Über die Tiefe ihrer späten Freundschaft mit dem 17 Jahre jüngeren Schriftsteller Levin Schücking wird in der Droste-Gemeinde trefflich gestritten. Nicht wenige brennende Gedichte des ewigen Freifräuleins sind an Frauen adressiert. Und als die Dichterin jung war, gab es ein inniges Verhältnis zu einem Mann, dem Bürgerlichen Heinrich Straube, das im Sommer 1820 auf ebenso skandalöse wie mysteriöse Weise in die Brüche ging. Die beiden sahen einander nie wieder, und die Droste blieb zeitlebens ledig. Nun hat Karen Duve den Roman über Annettes (ersten) Roman geschrieben. „Fräulein Nettes kurzer Sommer“ ist, wie das Vorwort verrät, eng an die vorhandenen Quellen angelehnt. Auf dem Fundament gesicherter Tatsachen blüht die poetische Spekulation, auch über das, was damals auf Schloss Bökerhof nahe Paderborn geschah: Es war ein kurzer Sommer, doch es ist ein langer Roman. Duve breitet zunächst die fein verzweigten Stammbaum-Äste der Geschlechter Droste-Hülshoff und Haxthausen (die mütterliche Linie) vor uns aus. Sodann widmet sie sich der Vorgeschichte der von der Droste-Forschung so genannten „Jugendkatastrophe“.
L i t e r a t u r F A L T E R 4 1 / 1 8
19
Freitodbegleitung mit Grünem Veltliner Wie schreibt man einen vergnüglichen Roman zum Thema Sterbebegleitung? Daniel Wisser weiß, wie’s geht
W
er „Königin der Berge“ nach zugleich launiger und trauriger, auf jeden Fall aber kurzweiliger Lektüre weglegt, der fühlt sich nachgerade genötigt, sich die Fragen, die der Roman aufwirft, selbst zu stellen: Lebe ich mein Leben so, dass ich später gerne drauf zurückblicke? Was wäre, wenn mich eine tödliche Krankheit aus dem Alltag risse? Würde ich mich gegen die Widerstände meiner Mitmenschen durchsetzen und Suizid begehen? Am Hauptschauplatz des Romans, einem Wiener Pflegeheim, lernen wir den sterbenskranken Herrn Turin kennen, der auf sein Recht pocht, seinem elendigen Leben als Multiple-Sklerose-Patient ein Ende zu setzen. Er will irgendwie in die Schweiz gelangen, um dort die legale Freitodbegleitung in Anspruch zu nehmen. Doch so einfach ist das nicht. Angehörige und Pflegerinnen wollen davon nichts wissen, preisen stattdessen das Leben und versuchen sogar, Zugriff auf das Tablet des Patienten zu erhalten, um dessen Kontakte zu kontrollieren. Wirkt Turins Wunsch zunächst verstörend, so kann man ihn mit fortschreitender Lektüre immer besser nachvollziehen. Die bedrückende Stimmung im Pflegeheim – eine Frau Ditscheiner brüllt regelmäßig „Traaaaaamp“, auf den sie bei der US-Wahl gehofft hat – und das Mitleid, das seine Frau Irene, die Oberschwester oder der Pater dem Protagonisten angedeihen lassen, wirken zusehends unglaubwürdiger; es sind so dahingesagte Phrasen. Als wäre der Roman vor Drucklegung durch die Hände der Zensur gegangen, sind Wörter wie „Freitod“ oder „Selbstmord“ geschwärzt. Daniel Wisser, 1971 in Klagenfurt geboren,
Illustration: © Nicolas Mahler
nimmt die Tabus ins Visier, die in einer sich als liberal verstehenden Gesellschaft in Zusammenhang mit Sterbehilfe noch immer wirkmächtig sind. Neben der sichtbaren Streichung ganzer Sätze weist „Königin
»
Wisser vermeidet den moralischen Zeigefinger und begegnet der polemischen Energie der politischen Korrektheit mit Ironie
der Berge“ noch eine Reihe kühner ästhetischer und literarischer Kunstgriffe auf. Neben gefinkeltem Perspektivenwechsel zählt dazu etwa die Gestaltung der direkten Rede als dramatischer Text, bei dem die Figuren aus ihrer Rolle heraustreten, um ihre Sicht über den Patienten Turin dem Publikum kundzutun. Wissers Sprache ist so treffsicher wie experimentierfreudig und unterhaltsam. Für Komik sorgen auch die inneren Dialoge des Patienten mit seinem längst verstorbenen Kater Dukakis, in denen sich die beiden über Geld, Whiskey und Frauen unterhalten. Wenn Turin, der seinen Namen nicht wie die italienische Stadt, sondern auf der ersten Silbe betont haben will, an die Brüste der Pflegerinnen greift, gibt es von Dukakis Punkte dafür. So findet die #MeToo-Debatte Eingang in die
Daniel Wisser: Königin der Berge. Roman. Jung und Jung, 400 S., € 24,–
Handlung: Der Patient habe Schwestern belästigt. „Ich bitte Sie, das ist in der Pflege doch wirklich nichts Besonderes“, weiß Psychologin Katharina Payer, genannt Pregnerin, die im Laufe der Turin’schen Leidensgeschichte immer wichtiger wird und diesen sogar zu ihrer privaten Geburtstagsfeier einlädt. Als Autor vermeidet es Wisser, der auch Mitglied des Ersten Wiener Heimorgelorchesters ist, den moralischen Zeigefinger zu erheben und begegnet den polemischen Energien der politischen Korrektheit stattdessen mit Ironie. Mit seinem Protagonisten hat er hierfür eine nachgerade ideale Figur geschaffen: ein grantelndes österreichisches Original, skeptisch und launisch, schrullig und liebenswert. In seinem Rollstuhl fährt Turin täglich in die Cafeteria, wo er sich dem Alkoholverbot widersetzt und regelmäßig seinen Veltliner trinkt, den er sich im Tauschhandel mit dem Zivildiener besorgt. „Was könnte ihm Besseres passieren, als am Veltliner zugrunde zu gehen?“ Er sei ein freier Mensch und zahle fürs Heim. Weiters macht sich Turin
Sorgen um die Zukunft seiner Frau. Die Gespräche mit ihr werden immer dünner. Irene sucht Trost in ihrer Karriere. Mit knapp 50 in einem „unbrauchbaren Zu-
stand“, hält der Patient mit seinen Macken die Pflegerinnen auf Trab. So muss die Zimmertür immer einen Spalt offen bleiben, damit er das Brummen auf Station vier mithören kann – den „Urton“ für den Todkranken, der seinerzeit als EDV-Spezialist beschäftigt war und dem Rapid- und Rolling-Stones-Fans ebenso suspekt sind wie „Jihadisten, Veganer und Social-Bots“. Über die Jahre, die er nun schon im Heim verbracht und in denen er sich kein Blatt vor den Mund genommen hat, ist Turin allerdings milder geworden in seinen Urteilen. Ob er es noch aus eigenen Kräften in die Schweiz schaffen wird? Daniel Wisser hat mit dem MultipleSklerose-Roman „Königin der Berge“ – der Titel steht metaphorisch für die tödliche Krankheit – ein richtiges Herbst-Buch geschrieben. Das Pflegeheim, das hier zum Mikrokosmos der Vergänglichkeit wird, hat er offenbar gründlich erforscht. Wie nebenbei erfahren wir Einzelheiten über neurologische Erkrankungen und über die Menschen, die von ihnen betroffen sind. Zugleich taucht man tief ein in die Arbeitssphäre des Pflegepersonals. Da gibt es die Oberschwester Margit, die mit Turin auf Kriegsfuß steht und diesem androht, „einen suprapubischen Katheder“ zu setzen, was „das Aus für die allerletzte Funktion von Turins Penis“ bedeutet. Zum Glück haben Turin und sein Penis nur selten mit Margit zu tun. Der überwiegende Teil der Pflegerinnen rekrutiert sich aus Migrantinnen. Wie zum Beispiel Nata. Die war Deutschlehrerin in Belgrad und hat in Österreich nur einen Job im Pflegebereich bekommen. Und während sie abends an Turins Bett wartet, bis dieser über seinem Whiskey eingeschlafen ist, rezitiert sie Mörike-Gedichte. SEBASTIAN GILLI
Zwei Meister der Zuspitzung in einem Buch Nicolas Mahler illustriert Konrad Paul Liessmann – geistreiche Unterhaltung für Freunde, Feinde und solche, die es noch werden wollen.
112 Seiten. Gebunden Durchgängig 2-farbig illustriert www.zsolnay.at
Mahler-Liessmann_Falter-216x95_lay.indd 1
02.10.18 16:40
20
F A LT E R 41/ 18
LITER ATUR
Und herzerfreulich wedeln die Blätter Weitverzweigt und doch überfrachtet: Julian Schuttings neuer Lyrikband „Unter Palmen“ verliert sich im eigenen Gewucher inmal unter Palmen zu flanieren, ohne E sich dabei der Hitze aussetzen zu müssen, hätte man gerade im vergangenen Som-
mer sicherlich als ein angenehmes Vergnügen bezeichnet – nach dem Motto: lockeres und erholsames Reisen direkt von Balkonien aus. Denn um in jene fernen Gefilde zu gelangen, braucht es nicht einmal einen Flug, sondern einfach poetische Vorstellungskraft. Julian Schuttings neue Lyrik hüpft geschwind von Kalifornien nach Kuba, überhaupt quer durch die Literaturund Kulturgeschichte. Was den Band „Unter Palmen“ zusammenhält,
sind eben allein die großwüchsigen Pflanzen, deren kontinuierliche Präsenz durch sämtliche Epochen einem nun erst richtig vor Augen geführt wird. Mit dem Langgedicht „EINMAL NOCH“ geht der 1937 in Amstetten geborene Autor weit zurück in die Antike, erinnert an die Erlösungsfantasie des Orest. Dieser sieht die Eumeniden „durch eine Palmenallee zu einer Menschenbucht lustwandeln“, wo sie sich von ihrer Schuld reinigen. Jahrhunderte ziehen danach vorüber, in denen sich das Motiv verwandelt. Mitunter ergibt sich eine erotische Komponente, wenn man – assoziierend – etwa an die Blätter der Tabakpflanze denkt. Denn verarbeitet wird sie in einer Fabrik, worin Georges Bizets bekannteste Bühnenfigur arbeitet, die verführerische
be aus der poetischen Zuckerbäckerei: „Palmen / bilden herzerfrischende Palmbaumgruppen, / und ach wie herzerfreulich zu betrachten, / wie ihre Blätter im Luftstrom sich wiegen: / ein Abenteuer, bereits im Erwachen, / ihr vogelflügeliges Meeresbranden; / ach ihre Kronen aus fedrigen Zweigen, / die im Verebben wie Wellen sich werfen“. Sollte das ironisch gemeint sein, dürfte man das ganze Buch nicht ernst nehmen. Dem ist nicht der Fall. Denn Schutting will uns „durch eine Palmenlandschaft / ziehen sehen, durch eine so biblische, als gingen hingegangen Wahrgebliebenem / nachhangende Gespenster uns ähnlicher Gestalt durch wirklich Wahres wie durch bloß Gedachtes“. Der Autor lotet den Musil’schen Möglichkeitssinn aus: zwischen Dichtung und eben Wahrheit, wobei er Letztere zu finden hofft.
Femme fatale Carmen. Wenige später geht es dann etwas sakraler zu. Die Rede ist vom „Palmwedelthron“ des umstrittenen Papstes Pius XII. – eine Täuschung, „wenn doch damalige Photographien bezeugen, / daß hinter seinem Thron an langen Stangen / zu Fächern gefügte weiße Straußenfedern aufgeragt haben“. Was dem Leser geboten wird, ist „weitver-
zweigt“ im ästhetischen Sinne. Denn Schuttings gedanklich immer weiter ausgreifende Gedichte sind dem Wachstum eines Baumes nachempfunden. Dessen Krone aus Zweigen wird dichter und dichter. Blätter und Ranken wuchern wie die Wörter: chaotisch sprießend. Das mag, um eine der häufig altmodischen Verwendungen des Poeten zu gebrauchen, mitunter durchaus „erquick(t)“ sein. Allerdings sind die seitenweise ohne Absätze verfassten Suaden von Überkomplexität und Übercodierung gezeichnet. In seinem letzten Band „Der Schwan“ waren Schutting noch berührende Miniaturen mit existenzieller Schwingkraft gelungen, die vom in Gebirgshöhen aufsteigenden Liebesschmerz bis hin zur Ergründung utopischer Sphären reichten. Nun wirken die Sätze schwerlastig, beladen mit zu vielen Bildern und Anspielungen. Besonders fällt aber die kitschige Ornamentik ins Auge. Nur eine Kostpro-
Julian Schutting: Unter Palmen. Gedichte. Jung und Jung, 80 S., € 20,–
Manchmal gilt die ästhetische Binsenweisheit eben doch: Weniger ist mehr. Etwas mehr Klarheit und Reduktion hätte diesem mit allerlei Dekor behafteten Band, in dem man überdies noch mit Arnold Schönbergs Schwiegertochter durch Palm Springs spazieren geht oder auf dem rauen Meer Heinrich, dem Seefahrer, begegnet, sicherlich gut getan. Vielleicht folgt ja im nächsten Werk nach den zum Himmel ragenden Palmen wieder der Versuch einer Erdung. Erfreulich wäre es allemal. BJÖRN HAYER
Die Zimmerlinde beißt auf Granit In ihrem starken Debütroman „Alles was glänzt“ beutet Marie Gamillscheg die sterbende heimische Montanwirtschaft aus nd wieder einmal ist die Presse schuld. U Denn „seit der Journalist hier war, sind viele in die Stadt gezogen“; das Schauberg-
werk ist aufgelassen, der Tourismus versiegt. Dabei hat er nur veröffentlicht, was ohnehin offensichtlich war: Es rumort in der Kleinstadt am Fuße eines Erzbergs, der jahrhundertelang planlos ausgehöhlt wurde wie der Cerro Rico über Potosí. Der Berg steht nur noch aus Gefälligkeit da, rein statisch betrachtet sollte er die Gemeinde schon längst unter sich begraben haben. „Wer durch den Ort geht, der weiß: Hier passiert etwas.“ Die Einwohner verdrängen das Offensichtliche, nur die Jugendliche Teresa beachtet das allmähliche Rutschen des Hanges, den Riss, der sich über den Häusern auftut. Enkelfit ist die einsame Gebirgsstadt wahr-
lich nicht. Das Durchschnittsalter liegt bei 56,8 Jahren, der nächste Ort ist 19 Kilometer entfernt (der Bus fährt einmal um 6.18 und einmal um 16.18 Uhr dorthin), die nächste Stadt 122 Kilometer entfernt. Jemand hat die Katze der Wirtin totgefahren, der letzte Stammgast, der pensionierte Kumpel Wenisch, verfällt schneller als das Schaubergwerk. Seine einzige Tochter ist schon lange in die Stadt gezogen, aber er hofft immer noch. „Das ist das Schöne an der Familie und am Sport: die Bedingungslosigkeit. Nicht zu hinterfragen, warum man zum ortseigenen Volleyballverein
grund, in dessen Sedimenten die Bergleute hoch über den Tälern graben. Oder Novalis, der ja eher Bergbaubeamter denn Schwärmer war. In „Alles was glänzt“ gräbt niemand mehr tiefer, um zu den Urgründen von Geist und Natur zu gelangen, dem Bergbau ist alle Romantik ausgetrieben, die Minen sind taub, die Stollen blind. Rückbau statt Bergbau. Die europäische Montanwirtschaft samt ihrem pseudo-urbanen Plattenbau ist nur noch literarisch auszubeuten, alles andere soll gesundschrumpfen.
hält, obwohl es tausende andere und bessere gibt.“ Die Schwestern Teresa und Esther planen ihre Zukunft, ebenfalls weit weg von hier. Dann verunglückt Esthers Freund Martin, einer der letzten verbliebenen jungen Männer, als es sein Auto aus einer Kehre trägt. „In der Stadt wäre das nichts, aber hier, bei uns, das trifft uns direkt ins Herz“, wird der Bürgermeister sagen. Kurz darauf taucht – als scheinbar vitaler Widergänger Martins – der übermotivierte Landesbeamte Merih auf. „Alles was glänzt“ ist nicht der circa hundertunderste Antiheimatroman, sondern ein vielschichtiger, klug konstruierter Text – das überzeugende Debüt der aus Graz stammenden und in Berlin lebenden Marie Gamillscheg. Der klischeefreie Roman besticht durch subtile Korrespondenzen – der Figuren, der Handlung, des Schauplatzes, der Erzähltechnik. Wo die Schichten des Romans aneinanderstoßen, tun sich narrative Leerstellen auf wie die Löcher im Berg. Der Riss klafft metaphorisch wie real, im Hang wie in der Dorfgemeinschaft. Perspektiven verschieben sich wie Gesteinsschichten.
Merih ist zuständig für die „zukunftsorientier-
Nichts daran wirkt konstruiert oder aufdring-
lich, so wenig, wie die Zitate den Roman überfrachten. Und Gamillscheg zitiert so einiges: Studien über Symmetrie und sexuelle Attraktion, Roland Barthes’ „Fragmente einer Sprache der Liebe“, Erzählungen über das Urmeer und den aufgefalteten Meeres-
Marie Gamillscheg: Alles was glänzt. Roman. Luchterhand, 224 S., € 18,50
te Wohnraumplanung“ durch „gefestigte Infrastruktur“. Es sind lediglich Euphemismen für verlassene Landstriche, so wie der Slogan „Zusammenwachsen!“ eigentlich bedeutet, dass die Leute ihre Einfamilienhäuser aufgeben müssen. „Merih, Regionalmanager“, sagt er, „und Sie sind?“ Doch die Abgehängten riechen den Braten und lassen die Zimmerlinde auf Granit beißen. Nur Herr Wenisch muss ins Altersheim. Stoisch sieht er dabei zu, wie Arbeiter seine Möbel hinaustragen und seine Habe in Müllsäcke stopfen. „Sie misten sich aus, Herr Wenisch“, sagt einer zu ihm. „Ab jetzt jeder für sich“, denkt die Wirtin Susa am Ende in ihrem Espresso. Von dieser Erz-Erzählung geht ein dunkler Glanz aus – so, als wäre doch noch Silber im Berg. DOMINIK A MEINDL
L i t e r a t u r F A L T E R 4 1 / 1 8
21
Der Spion, der aus der Wehrmacht kam In seinem Debütroman „Edelweiß“ erzählt Günter Wels vom Kriegsende in Oberösterreich und Salzburg
H
inter dem Künstlernamen Günter Wels steckt Günter Kaindlstorfer, der als Kritiker, Moderator sowie Programmleiter der Messe „Buch Wien“ zu den wichtigen Literaturvermittlern im Land zählt. In Wels ist er aufgewachsen und vermutlich hat er den Namen gewählt, weil in den Jugendjahren das mit dem Lesen und dem Schreiben begonnen hat. Als Journalist ist Kaindlstorfer fleißig, der Autor Wels war noch nicht sehr produktiv. Vor acht Jahren ist der Erzählband „Maitage“ erschienen, seine bis dato einzige Buchpublikation. Die meisten Texte drehten sich um das Aufwachsen in den späten 70ern und frühen 80ern. Zwar konnte er der häufig literarisch beackerten Zeit mit Geschichten, die etwa das juvenile Gefühlschaos im Zuge der ersten Annäherungen ans andere Geschlecht im Partykeller beschrieben, thematisch nichts Neues mehr abgewinnen, aber es gelang ihm dies mit einer umso einnehmenderen Genauigkeit und großem Einfühlungsvermögen. Daneben fanden sich in dem Buch auch historische Stoffe, und die Titelerzählung „Maitage“, die sich mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Frühjahr 1945 befasst, kann rückblickend als Vorarbeit zum Debütroman betrachtet werden, denn „Edelweiß“ ist ebenfalls in dieser Zeit und räumlich zu weiten Teilen in Oberösterreich und in Salzburg angesiedelt.
»
Im Krieg wie auch im späteren Leben verhält „Edelweiß“ sich nicht nur heldenhaft
Als Rahmen dient dem Roman ein in der Ge-
„Edelweiß“ lautet der Tarnname eines öster-
reichischen Wehrmacht-Deserteurs, der sich den Alliierten als Spion zur Verfügung stellt. Das Kriegsende naht bereits, es kann sich nur mehr um einige Wochen, allenfalls ein paar Monate handeln. Der junge Mann soll auskundschaften, was es mit der sagenumwobenen Alpenfestung Hitlers auf sich hat. Die Geschichte basiert auf historischen Fakten. Im Februar 1945 sprangen drei österreichische Agenten im Auftrag des briti-
schen Geheimdiensts in deutschen Uniformen im Grenzgebiet zwischen Bayern und dem Salzburger Land ab, um nach Hinweisen auf die Alpenfestung zu suchen. Alle drei wurden gefasst und überlebten das Kriegsende in Haft. In der Ausgestaltung erlaubt sich Wels kleine wie auch größere Freiheiten. So sind bei ihm nicht alle drei Wehrmacht-Deserteure überzeugte Nazi-Gegner. Einer von ihnen war vor seiner Fahnenflucht sogar ein überzeugter Führer-Getreuer. Er ist es dann auch, der seinen beiden Gefährten ein Ei legt und sie bei der Gestapo verpfeift. „Edelweiß“ hat Glück: Zuerst kommt er bei einer Bäuerin und später bei Widerstandsgruppen unter, wobei ihm immer wieder gefälschte Papiere helfen. Das Kriegsende erlebt Carl Maurer in Freiheit.
Günter Wels: Edelweiß. Roman. Czernin, 400 S., € 25,–
genwart angesiedelter Handlungsstrang. Christine Maurer bangt nach einem Sturz Carls um ihren schon sehr betagten Vater. In dessen Wohnung stößt sie auf Aufzeichnungen über die Ereignisse aus dem Jahr 1945 und erfährt darin sehr viel Neues über Carl, der ihr gegenüber zeit Lebens nur sehr verhalten Emotionen gezeigt hat. Ein blinder Fleck bleibt dennoch: Was geschah nach Kriegsende mit dem Mann, der ihren Vater verraten hat? „Edelweiß“ ist ein lesenswertes und wichtiges Buch, weil es auf ein etwas unterbelichtetes Kapitel des Zweiten Weltkriegs fokussiert. Denn wer übergelaufen war und dem einstigen Feind dabei half, den Krieg zu beenden, hängte das nach 1945 zunächst nicht an die große Glocke. Es stand zu befürchten, nicht als Held gefeiert, sondern als Verräter gebrandmarkt zu werden. Zwei Bücher namhafter österreichischer Autoren über den Zweiten Weltkrieg sind heuer bereits erschienen: „Drachenwand“ von Arno Geiger, das ebenfalls gegen Kriegsende spielt, und Erich Hackls „Am Seil“. Geiger ging erfolgreich einen riskan-
ten Weg und fühlte sich auf der Grundlage breiter Recherchen als Nachgeborener in das damalige Leben abseits der Front ein. Hackl wählte in seiner Heldengeschichte eines Mannes, der einer Jüdin und ihre Tochter Unterschlupf bot, den rein dokumentarischen Zugang. Wels geht einen Mittelweg. „Edelweiß“ zeich-
net detailliert und anschaulich die Lage im Frühjahr 1945 nach – die bittere Not, die ständigen Flugzeugangriffe durch die Alliierten, die etwa halb Attnang-Puchheim in Schutt und Asche legen. Im Anhang findet sich ein Literaturverzeichnis mit nicht weniger als 50 Büchern zu Themen wie dem Nationalsozialismus in Salzburg, Wels oder Linz, Spionage im Zweiten Weltkrieg oder über antifaschistischen Widerstand im Salzkammergut. Der Autor hat redlich recherchiert und weiß genau, worüber er schreibt. Literarisch bedient er sich eines ganz einfachen Stils, wohl um bei der Schilderung der Kriegshandlungen nur ja nicht des Reißerischen verdächtigt zu werden. Das schlägt dem Roman, der dadurch etwas blutleer anmutet, aber nicht nur zum Vorteil an. Seinem Protagonisten verleiht der Autor auch ambivalente Züge, denn im Krieg wie auch im späteren Leben verhält „Edelweiß“ sich nicht nur heldenhaft. So richtig plastisch wird dieser Carl dennoch nicht, und Tochter Christine sowie deren nach rechts abdriftender Sohn bleiben überhaupt etwas verschwommen und schemenhaft. Dass die literarische Umsetzung womöglich nicht auf ganzer Linie geglückt ist, dürfte der Autor geahnt haben. Carl Maurer lässt er über seine Kriegsaufzeichnungen sagen: „Naja, man bekommt eine zusammenhängende … Geschichte serviert, alles passt mit allem zusammen … ein Handlungsstrang geht in den anderen über … Aber so war es nicht, verstehst du? Es war … komplizierter.“ SEBASTIAN FASTHUBER
Neue Bücher bei Diogenes »Ich habe dich geliebt. Ich habe dich gehasst. Ich weiß nicht, wer du bist.« Ein psychologischer Thriller und eine Liebesgeschichte in einem – ein brillanter neuer Dennis Lehane.
Erich Hackl Am Seil Eine Heldengeschichte
Zivilcourage in Zeiten der Unmenschlichkeit, damals wie heute – eine Erinnerung. Eine Überlebensgeschichte nach einer wahren Begebenheit.
Diogenes
528 Seiten, Leinen, € (A) 25.70
falter_lehane_hackl.indd 1
128 Seiten, Leinen, € (A) 20.60
Diogenes 04.10.18 10:06
F A L T E R 4 1 / 1 8 L i t e r a t u r
22
Tausend Seiten und kein bisschen leise Größenwahn auf höchstem Niveau: Philip Weiss’ Roman „Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen“
Ü
ber sechs Jahre lang hat der junge Autor Phillip Weiss an dem geschrieben, was man als dessen Debütroman bezeichnen könnte. Man kann die fünf Bände, die zusammen „Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen“ bilden, aber auch als Romanzyklus begreifen. Alle fünf Teile sind jedenfalls als Werke fiktiver Autoren deklariert: die aus Tagebucheinträgen redigierte „Enzyklopädien eines Ichs“ der Pariser Industriellentochter Paulette Blanchard; der Reiseroman „Terrain vague“ des androgynen Fotokünstlers Jona Jonas; die „Cahiers“ der Klimaforscherin und Misanthropin Chantal Blanchard; die transkribierten Diktierprotokolle „Akios Aufzeichnungen“ des neunjährigen Japaners Akio Itō und der Manga „Die glückseligen Inseln“ der Showtänzerin Abra Aoki. Sie alle bilden einen gemeinsamen Erzählkosmos, zu dem jeder Band einen eigenständigen Ausschnitt liefert, und finden sich als schön gestaltete Bände in einem Kartonschuber. Bei aller Unterschiedlichkeit weisen die einzelnen Werke technische und thematische Ähnlichkeiten auf. Stets hat man es mit Ich-Erzählern zu tun, die den Leser tief in die eigenen Gedanken, Wünsche und Gefühle blicken lassen, und alle von ihnen haben einen Japanbezug, der das Gravitationszentrum der unterschiedlichen Weltentwürfe bildet. Eine weitere Konstante ist die technische Entwicklung, die schon auf den ersten Seiten von Paulette Blanchards Selbsterkundungen thematisiert wird. Dort lesen wir einen Brief der Autorin an ihren unbekannten Verleger, in dem sie erklärt, wie sie ihre von 1870 bis 1874 reichenden Tagebücher mit einer Malling-Hansen-Schreibkugel, der Vorläuferin der modernen Schreibmaschine, zu einer chronologischen Erzählung in Form von zwölf Alphabeten verdichtet. Von Anfang an also wird der Leser dazu ein-
geladen, Fährten zu verfolgen und Bezüge herzustellen. Nietzsche, dessen „letzter Mensch“ aus „Also sprach Zarathustra“ in Weiss’ Romantitel anklingt und als eine von hunderten geistesgeschichtlichen Referenzen durch die Erzählungen geistert, war glücklicher Besitzer einer Malling-HansenSchreibkugel. In Paulettes Erzählung findet sich auf dichtem Raum die Faszination für das Maschinenzeitalter, die Grausamkeit der technisierten Kriegsführung und das emanzipatorische Potenzial der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zwischen der erzwungenen Häuslichkeit einer jungen Frau aus gutem Haus, den Wirren des Französisch-Preußischen Krieges von 1870, Glanz und Elend der Pariser Kommune von 1871, der Wiener
Über 1,5 Mio. Bücher, DVDs & CDs mit gutem Gewissen bestellen.
Weltausstellung von 1873 und Paulettes Heirat nach Japan liegen rund 300 Seiten. Zugleich stellt Weiss hier das Zerbrechen alter Ordnungen in einer Sprache dar, die der gefühlsgetränkten Innerlichkeit des 19. Jahrhunderts perfekt angeglichen ist. Dabei bilden die „Enzyklopädien eines Ichs“ erst die Grundierung für die folgenden Erzählungen. Besonders gelungen sind die beiden Bände „Terrain vague“ und „Cahiers. Siebentes Heft“, welche die sonderbare Liebe zwischen dem 30-jährigen Fotokünstler Jona Jonas und der deutlich älteren Klimaforscherin Chantal Blanchard erzählen. Jona begibt sich im Frühjahr 2011 auf die Suche nach seiner irgendwo in Japan verschwundenen Geliebten. In Rückblenden erzählt er von ihrer seltsamen Verbindung, von der Lust, die den jungen Tatmenschen und die spöttische Geistesarbeiterin sowohl zusammenspannt als auch auseinandertreibt. Jona, der sich als Fotograf von zerstörten Or-
ten inspirieren lässt, reist nach der Nuklearkatastrophe vom 11. März 2011 nach Fukushima. Von seiner Chantal fehlt jede Spur. Der Erzählton erinnert an Paul Austers „Stadt aus Glas“. In deren monströsen Notizheft erfahren wir den Grund für Chantals Verschwinden. Sie reist nach Japan, um der Spur eines hominiden Schädels zu folgen, den ihre Verwandte Paulette Blanchard seinerzeit womöglich gefunden hat. Den Schädel selbst, imaginärer Adressat ihrer Aufzeichnungen, kennt Chantal nur von einer vergilbten Skizze. Auf ihrer Recherchereise durch europäische und japanische Archive verstrickt sie sich in gelehrte Abhandlungen zur Evolution und Erdgeschichte, die von einem beißenden Antihumanismus à la Michel Houellebecq getragen sind. Chantal ist gewissermaßen die weibliche Entsprechung zu den an Weltschmerz leidenden Misanthropen des großen französischen Autors. Lakonische Einzeiler, Exkurse zur Geschichte der Naturwissenschaften, wirre Zeichnungen wechseln einander ab. Das alles ist nicht nur stilistisch, sondern auch typografisch und grafisch großartig gelöst. Chantals Annahme, dass der Mensch nur ein hoffnungsloser Unfall der Evolution sei, und ihre obsessive Liebe zu Jona lassen sich nicht zusammenfügen. Zwischen Passagen wie „Woraus besteht der menschliche Körper? Zu 99 Prozent aus Luft und Wasser, Kohle und Kreide. Ein paar Tröpfchen Chlor, Phosphor, Schwefel. Gesamtkosten: 3 Euro“ und „Ich wollte verstehen, warum dieses System, das ich bin, mit Schock und Auflösung reagierte auf dieses Ereignis der Liebe“ entsteht das Psychogramm einer Figur, die in Hinblick auf Tiefgang und Schrägheit ihresgleichen sucht.
»
Philipp Weiss’ Roman korrespondiert mit Werken von Borges, Cortázar oder Okopenko ohne epigonal zu sein
Auch die letzten beiden Bände fügen sich in den Erzählkosmos. „Akios Aufzeichnungen“ ist das Tontranskript eines verängstigten, aber mutigen Neunjährigen, der bei dem Fallout in Fukushima von seinen Eltern getrennt wird. Akio bringt sich, seine stumme kleine Schwester Keiko und sein Haustier mit Bestimmtheit in Sicherheit. Während seiner einsamen Stunden im Evakuierungscamp spricht er in ein Diktiergerät, um die eigene Angst zu bewältigen. Auch dieses kindliche Erzählen ist, wie so vieles in Philipp Weiss’ „Die Menschen sitzen am Weltenrand und lachen“, ein Modell für das literarische Schreiben. Wie Akio steht auch die Showtänzerin Abra Aoki mit Jona Jonas’ Japanreise in Verbindung. Neben ihrem Beruf verfasst und zeichnet die versehrte junge Frau, die als Folge eines Verkehrsunfalls eine Arm- und Beinprothese trägt, Mangas. „Die glückseligen Inseln“, die man genau wie einen japanischen Comic von rechts nach links lesen und umblättern muss, bilden den Abschluss von Weiss’ gigantischem Projekt. Darin erzählt Abra in surrealen Bildern von transhumanistischen Fantasien und dem Schmerz in einer übertechnisierten Gegenwart. Ein geläufiges Verdikt der Literaturkritik ge-
Philipp Weiss: Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen. Roman. Suhrkamp, 1000 S., 5 Bde., € 49,90
genüber dermaßen ambitionierten Erstlingsromanen ist, dass der Autor im krampfhaften Versuch, sein gesamtes Wissen unterzubringen, den Roman überfrachte. Bei Phi lipp Weiss läuft diese Kritik ins Leere, denn der 36-jährige Autor hat eine Form gefunden, um alles, was er weiß, und alles, was er für diesen komplexen Romanzyklus recherchieren musste, als notwendig, als zwingend erscheinen zu lassen. Sein Unterfangen korrespondiert mit einigen der größten Romanexperimente der vergangenen 60 Jahre. Er bricht das serielle Erzählen auf, wie Julio Cortázar in „Ra yuela. Himmel und Hölle“, lotetet die formalen Möglichkeiten der Erzählung aus wie Andreas Okopenko in seinem „Lexikon Roman“, erschafft zusammenhängende, aber stilistisch höchst eigenständige Weltperspektiven wie David Mitchell in seinem „Wolkenatlas“ und legt mit Japan seinen fünf Erzählungen ein Gravitationszentrum zugrunde, wie es Roberto Bolaño in seinem Opus Magnum „2666“ mit Santa Teresa getan hat. Und das Spiel mit fiktiven, apokryphen und realen Bezügen ist deutlich an Jorge Luis Borges geschult. Aber Philipp Weiss ist mitnichten ein Epigone. Er ist ein Autor, der einen komplett ausgereiften Debütroman vorlegt, der eine eigene künstlerische Vision hat und dem es gleichzeitig gelingt, die Möglichkeiten des Romans zu erweitern. FLORIAN BAR AN YI
L i t e r a t u r F A L T E R 4 1 / 1 8
23
Schlüssel rein, Schloss zu, Rübe ab Grimms Märchen sind beliebt, brutal und rätselhaft. Franz Josef Czernin versucht sie zu knacken
M
ärchen? Kein deutschsprachiger Autor, der sich an diesem fantastischen, „volkstümlichen“ und vorgeblich ursprünglichen Genre nicht versucht hätte. Goethe betitelte seine Kunstmärchen schlicht „Das Märchen“, Novalis meinte, in den „Traumbildern ohne Zusammenhang“ spreche „die Natur selbst“. Märchen dienten linker Gesellschaftskritik, den Rechten lieferten sie „Archetypen“. Galt den einen der Grimm’sche Hausschatz als Ausbund schwarzer Pädagogik, hielten die anderen mit dem Slogan „Kinder brauchen Märchen!“ dagegen. Vor einigen Jahren wurde fantasievolles Märchenerzählen zum immateriellen Kulturerbe erklärt, doch bis heute gelten die zwischen 1805 und 1856 gesammelten und vielfach bearbeiteten Kinder- und Hausmärchen von Jacob und Wilhelm Grimm als Inbegriff des Genres. Vor allem die vielen, weitgehend unbekannten Märchen hat der Lyriker und Essayist Franz Josef Czernin in einem aufwendigen Projekt einer Neufassung unterzogen. Er selbst spricht von „Verwandlungen“ und erhebt keinen Anspruch auf Wiedererkennbarkeit der Ursprungstexte, die paraphrasiert, abgestoßen oder gänzlich aufgelöst werden. Ein Hinweis auf die Methode findet sich im parallel entstandenen Logbuch des Unternehmens „Das andere Schloss“: „In den Grimm’schen Märchen ist an fast jeder Stelle das Gefühl für Klang, Rhythmus, aber auch für Konnotationen und für die sich dabei einstellenden Hintergründe wirksam.“ Eine Verwandlung à la Czernin geht so. Bei
Übersetzt von Christine Ammann und Glaudia Seele-Nyima 288 Seiten, geb. | € 22,95 D/sFr 31,80/€ 23,60 A | ISBN 978-3-407-86537-3 erhältlich Auch als
den Grimms hebt etwa das Märchen „Der goldene Schlüssel“ bekannt traditionell an: „Zur Winterszeit, als einmal ein tiefer Schnee lag, musste ein armer Junge hinausgehen.“ Er findet einen goldenen Schlüssel und später in der gefrorenen Erde ein Kästchen mit dem dazu passenden Schloss. Bereits nach wenigen Zeilen endet das Mär-
chen damit, dass der Schlüssel umgedreht wird und „wunderbare Sachen“ in Aussicht gestellt werden. Was man als prä-postmoderne Verarschung des Lesers verstehen kann, bezeichnen Philologen als Vexiermärchen. Nicht zufällig platzierten die Grimms „Der goldene Schlüssel“ symbolträchtig am Ende ihre Sammlung, bei Czernin wird damit titelgebend der Anfang gemacht: „Da ist ein Schlüssel und der dreht sich, und sogleich ist der Schlüssel selbst das Schloss, ja, sowohl der Palast, mit seinen Zimmern, Gängen und Kammern, als auch das planvoll geschmiedete Loch, in das der Schlüssel nun passt.“ Franz Josef Czernin: Der goldene Schlüssel und andere Verwandlungen. Matthes & Seitz, 225 S., € 24,70
Franz Josef Czernin: Das andere Schloss. Zu Märchen Grimms, Verwandlungen und anderen Dingen. Matthes & Seitz, 318 S., € 26,80
Der sprachliche Wirbel reißt rasant Wortfolgen
mit sich, assoziative Ketten wie SchlüsselSchloss-Loch lösen alle narrativen Bezüge auf. Das Ganze ist mit „Der alte Witz“ überschreiben und der Leser greift ein wenig verwirrt zum 300-seitigen Band „Das andere Schloss“, der ein umfangreiches Register enthält, allerdings keinen konventionellen Kommentar bereitstellt, sondern in einem erfrischend pedantischen Close Reading etwa die Frage nach der Zeitenfolgen in der Geschichte stellt und diese so beantwortet: Mit dem Öffnen des Kästchens werde nicht nur das Geheimnis des Schatzes, sondern auch des Textes gelüftet und auf eine Zukunft verwiesen, die freilich „jenseits des Märchens“ läge. Das Aufschließen des Kästchens aber wäre die Bedingung dafür, „dass diese Zukunft stattfinden kann“. Wem derartige Spekulationen zu sperrig sind, der wird durch Mikroessays entlohnt, in denen sich der Autor zur Literatur im Allgemeinen äußert; zu Fragen von Fiktion und Realismus, zu eigenen Leseerfahrungen oder über das sich im Lauf der Zeit verändernde Urteil über Autoren wie Hölderlin (der keine Märchen schreiben konnte) oder den märchenhaften „anderen Zustand“ bei Robert Musil.
Und dann taucht abermals „Der goldene Schlüssel“ auf. Von Franz Kafka stammt der Aphorismus: „Manches Buch wirkt wie ein Schlüssel zu fremden Sälen des eigenen Schlosses.“ Czernin beginnt über das Homonym „Schloss“ nachzudenken – über die Sperrvorrichtung und das Gebäude – und merkt dazu an: „Was gäbe ich darum zu wissen, ob Kafka in den Sälen auch das andere Wort hören wollte oder musste.“ Ganze Bibliotheken befassen sich mit der Ent-
schlüsselung von Kafkas Romanfragment „Das Schloss“. Bekanntlich kommt der Protagonist, K., dort nie hinein. Die Idee, dass der Roman selbst zugleich Schloss und Schlüssel sei, klingt frappierend einleuchtend und dunkel zugleich. Ob eine damit ein Universalschlüssel für Czernins Verständnis von Grimms Märchen in die Hand gegeben ist, sei dahingestellt. Einmal fragt sich dieser, ob es ein Zauberwort gebe, mit dem all die abgeschlagenen Gliedmaßen und Köpfe ihren grausam misshandelten Besitzern zurückerstattet werden könnten. Für die Rührseligkeiten des raunenden „Es war einmal“ ist ohnedies kein Platz. Dafür sind Märchen wie „Die Hochzeit der Frau Füchsin“ zu pornografisch, dafür ist „Der Zaunkönig“ schon im Urtext zu poetisch. Der Frage nach der gerechten Aufteilung des häuslichen Erbes im Märchen „Die drei Brüder“ fällt Czernin geradezu rabiat ins Wort: „Der alte Vater, das pracht- und prunkvolle Haus – das ist schon der erste Schwachoder gar Unsinn.“ Bleibt nur noch zu fragen, was es mit dem vierseitigen Satzmäander auf sich hat, in den sich der Verlust von allem und jedem in Czernins Neudichtung von „Hans im Glück“ auflöst. Doch auch darauf findet sich eine Antwort: „Rätsel können gelöst werden, etliche Märchen kaum, jedenfalls nicht mehr als einmal.“ Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lesen Sie noch heute. ERICH K LEIN
Jeder Mensch hat spirituelle Ressourcen Warum �inden manche Menschen Halt im Glauben und andere stößt er ab? Und welchen Ein�luss haben Meditation, Gebet oder die Suche nach Er�üllung in der Natur? Der �ranzösische Neuropsychiater, Resilienz- und Bindungs�orscher zeigt, wo im Gehirn spirituelles Bewusstsein statt�indet und wie es uns verändert. Sein Buch ist eine Inspiration sowohl �ür Gläubige als auch �ür Zwei�ler.
Leseprobe au� www.beltz.de
24
F A L T E R 4 1 / 1 8 L i t e r a t u r
„Ziemlich bekloppte Truppe, oder?“ In „Mythos“ schwingt sich der Schauspieler und Schriftsteller Stephen Fry nicht gerade zum Olymp auf, der sein Thema ist
zahllosen Variationen gibt: die Erlöser-Geschichten über Menschen, die sich für andere opfern; die Faust-Geschichten über Menschen, der ihre Seele verkaufen; die Western-Geschichten über Fremde, die an einen Ort kommen und ihn verändert zurücklassen; und schließlich die großen RacheGeschichten. Wenn aber nach einer wirklich schmackhaften Ursuppenbasis für grandiose Geschichten all dieser Typen gesucht wird, erweist sich die Welt der griechischen Mythologie als nahezu unerschöpflich. Magisch angezogen hat diese auch den britischen Schriftsteller, Schauspieler und Humoristen Stephen Fry, Jahrgang 1957, den man sich am besten als eine Art Reinkarnation von Oscar Wilde vorstellt. Oxbridge-sozialisiert, eloquent, geistreich und seit Studientagen dick befreundet mit illustren Gestalten wie Emma Thompson, „Mr. Bean“ Rowan Atkinson und „Dr. House“ Hugh Laurie, gehört der charismatische und exzentrische Mr. Fry zur Crème de la Crème der britischen Komiker/Intellektuellen.
Mit Film-, TV- und Bühnenrollen, Theaterstücken, gefeierten Kolumnen, einigen schrägen Roman-Bestsellern sowie einer Autobiografie in mehreren Bänden blickt er auf eine glanzvolle Karriere zurück, Drogen und
Depressionen inklusive. Mit anderen Worten: Der Mann kennt das ganze Auf und Ab der menschlichen Existenz. Nun hat sich Fry, der seit Jugendtagen altphilologisch interessiert ist und seinen Homer und Ovid ausführlich gelesen hat, mit seinem neuen Buch „Mythos“ eine Nacherzählung der Mythen des antiken Griechenlands vorgenommen – und stolpert dabei über seine eigenen Beine. Das liegt wohl vor allem daran, dass sich der Vielbegabte für dieses Mal nicht recht entscheiden kann, in welcher Rolle er sein Lesepublikum ansprechen will. Im Auge hat er jene, „denen das Personal und die Geschichten der griechischen Mythologie fremd sind“ und versichert diesen auch sogleich, dass es „absolut nicht Akademisches oder Intellektuelles in der griechischen Mythologie“ gebe, im Gegenteil, diese „macht süchtig, ist unterhaltsam, zugänglich und erstaunlich menschlich“. Ein Gemeinplatz, der nicht recht überzeugen will. Weit besser ist Fry die Nacherzählung von der
Entstehung der Welt, der Geburt der Götter und des Kampfs der Titanen geglückt. Auch die Etablierung des olympischen Götterkreises rund um Zeus, die Entstehung der menschlichen Zivilisation und deren Interaktion mit der Welt der Unsterblichen liest sich über weite Strecken anregend. Allerdings hat Fry eine fragwürdige Entscheidung getroffen, die man sonst nur aus an-
biedernden Kinder- und Jugend-Versionen der griechischen Göttersagen kennt: Weil sein Publikum alle Schwellenangst ablegen soll, lässt er die mythischen Helden wie juveniles Soap-Opera-Personal sprechen. Wenn also etwa die berühmte Geschichte vom
Stephen Fry: Mythos. Was uns die Götter heute sagen. Mit 34 Abbildungen. Deutsch von Matthias Frings. Aufbau, 448 S., € 24,70
frühreifen Götterboten Hermes erzählt wird, der noch im Säuglingsalter Apollon einen Teil von dessen Herde stiehlt und sich beim ersten Aufeinandertreffen mit Apollon wortreich herausredet und vorstellt, klingt das bei Fry so: „Schlag ein, Pol! Freut mich, dich kennenzulernen. Hermes, letzte Neuerwerbung im göttlichen Dienstplan. Du müsstest mein Halbbruder sein, was? Mutter Maia hier hat mir den Familienstammbaum erklärt. Ziemlich bekloppte Truppe, oder?“ Frys Versuch, die griechische Mythologie ausgerechnet durch sprachliche Trivialisierung als universal und ewig gültig zu präsentieren, mag gut gemeint sein, wirkt aber verkrampft. Im Ergebnis beschädigt er auf diese Weise leider sein kenntnisreich und ambitioniert zusammengestelltes Remake stets aufs Neue, während er umgekehrt viel Interessantes und Wissenswertes in Fußnoten versteckt. Dass man das Buch trotzdem nicht ungern zu Ende liest, liegt an Frys Begabung fürs Geschichtenerzählen. Mit „Mythos“ ist er auf unterhaltsame Weise gescheitert. JULIA KOSPACH
Illustr ation: georg feierfeil
ine der bekannteren Theorien der Narrationsforschung besagt, dass es grosE so modo nur vier Typen von Geschichten in
LITER ATUR
F A LT E R 41/ 18
25
Götter jenseits von Gut und Böse In seinem Roman „Anansi Boys“ recycelt Neil Gaiman Mythen und schubst die Realität ein bisschen rum
D
er Engländer Neil Gaiman ist ein immens produktiver und vielseitiger Autor von Graphic Novels, Fantasy-Romanen und Kinderbüchern. Spätestens seit der TV-Serie „American Gods“ ist er auch bei uns berühmt. Im Gegensatz zu vielen Fantasy-Autoren ist seine Sprache nicht bedeutungsvoll-raunend, sondern einfach und klar, im Ton wechselnd zwischen lyrischen und selbstironischen Passagen. Gaiman vermischt gern die Genres und erzählt alte Mythen neu oder weiter – so auch in „Anansi Boys“. Der Roman beginnt mit dem Tod des aus „American Gods“ bekannten Mr. Nancy. Im Gegensatz zu diesem schillernden Gott lebt dessen Sohn Charlie als durchschnittlicher, farblos-langweiliger Buchhalter ganz „ungöttlich“ in London. Nur widerwillig reist er nach Florida zum Begräbnis seines Vaters, von dem er sich nie geliebt fühlte, der ihm immer peinlich war. Dort erfährt er von den uralten Nachbarinnen seines Vaters (vier wunderbar geschilderten Hexen), von der Existenz eines Bruders, und die Handlung nimmt Fahrt auf.
»
Trickster sind Götter, die ohne alle Moral ihren Emotionen und Triebwünschen folgen
Bruder Spider bringt Charlies Leben völlig
durcheinander. Er verführt dessen Verlobte, und der arme Tölpel wird sogar verhaftet – allerdings von einer ausnehmend netten Polizistin. Dann aber entdeckt Charlie überrascht an sich unvermutete Kräfte, die ihm helfen, zum Helden zu reifen, sich selbst, seine Verlobte und auch den Bruder zu retten. Dabei kommen die beiden Brüder einander natürlich auch näher – und jede weitere Information wäre schon ein Spoiler. Geboten werden uns neben der rasanten Handlung noch mehrere Liebesgeschichten, zwei starke Frauenfiguren, ein rachsüchtiges Gespenst, eine liebevolle Aussöhnung und, als Zugabe, eine leicht hingetupfte Erzählung von der Entstehung der Welt und des Erzählens: Denn Anansi ist auch der Gott der Geschichten!
Neil Gaiman: Anansi Boys. Roman. Deutsch von Karsten Singelmann. Eichborn, 416 S., € 14,40
Zum mythologischen Hintergrund ist zu sagen, dass Anansi ein westafrikanischer „Trickster“ ist, den die Sklaven auch nach Amerika brachten. Trickster sind Götter jenseits von Gut oder Böse. Sie handeln konsequent nach dem Lustprinzip und folgen völlig amoralisch ihren Emotionen und Triebwünschen. Der große Mythenforscher Joseph Campbell beschrieb den Trickster als „Über-Schamanen“ wie folgt: „ein Narr, grausamer und geiler Betrüger, die Unordnung in Person – dennoch auch Kulturbringer“. Paradebeispiel dafür ist der Rebell im griechischen Pantheon: Prometheus. Die Figur des Tricksters lebt weiter in den Legenden als Kobold, im Theater als Hanswurst und Pulcinell – und im Christentum als Teufel. Oft erscheint er in Tiergestalt, als Kojote, Hase, Rabe oder Fuchs. Anansi aber ist ein Spinnengott – und laut Gaiman sind ja auch Geschichten wie Spinnen. Im afrikanischen Trickster-Mythos gehören zu Beginn der Welt alle Geschichten dem grausamen Tigergott. Dessen Geschichten sind voller Blut und Gewalt. Anansi aber überlistet Tiger und stiehlt ihm die Geschichten – und seine Spinnengeschichten leben vom Witz, vom subversiven Lachen, von der List der Schwachen gegen die mächtigen Raubtiere und Autoritäten. Wie alle Trickstergötter hat auch Anansi überhaupt nichts von einem gütigen oder strengen Gottvater. Aus psychoanalytischer Perspektive entspricht er eher einem strahlend gierig-neugierigen und polymorph-perversen Kind. In Interviews hat Gaiman die Funktion von Geschichten durch deren Macht zu verzaubern erklärt: „Die Welt will nicht entzaubert werden.“ Wir brauchen die Geschichten zum Überleben, brauchen neben dem Logos auch den „Mythos, der die Welt so lange genährt hat“ (Claude Lévi-Strauss).
In „Anansi Boys“ skizziert Gaiman leichthändig seine Kosmologie und Poetik. Jeder Mensch solle sein Idiom, seine individuelle Melodie singen, erst dadurch werde er als Individuum lebendig und könne vielleicht sogar seine Welt in Ordnung bringen: „You sing the song, you fix things.“ Und so lässt sich der Roman auch als ein mythisches Self-Empowerment des Underdogs Charlie lesen. Seinem Autor zufolge ist „Anansi Boys“ auch
ein Roman darüber, „wie man Familie überleben kann“, also eine kreative Option zur Bewältigung familiärer und ödipaler Probleme: Wie löse ich mich aus der ambivalenten Beziehung zum übermächtigen Vater? Wie glückt mir der Abschied? Wie ertrage ich die Eifersucht gegenüber dem vom Schicksal bevorzugten Bruder? Wie entscheide ich mich zwischen zwei geliebten Frauen? Diese großen Fragen verhandelt Gaiman in seinem überaus lesbaren Roman im Plauderton und man kann das Buch auch ohne Kenntnis des mythologischen „Überbaus“ genießen. Gaimans Sound ist nicht leicht zu übertragen und Karsten Singelmanns Übersetzung deutlich getragener, ja behäbiger als das federnd-leichtfüßige Original. „Life is a rock, but the radio rolled me“, lautet auf Deutsch: „Das Leben gehört zu den härtesten, aber die Zeit heilt alle Wunden.“ Na ja. „Anansi Boys“ Roman ist auch als Einstieg für all jene zu empfehlen, die Fantasy nur als billigen Eskapismus verachten. Besonders geeignet aber ist er für all jene jungen Männer, die immer schon lässig und cool sein wollten und davon träumten, zu singen, zu tanzen und Frauen zu verzaubern – obwohl ihre Realität leider ganz anders aussieht. Die Empfehlung des Autors lautet: „to push reality around a little“. R AINER GROSS
Ein meisterhaft groteskes Kammerspiel über ein sich zermürbendes Ehepaar Ihre Fachbuchhandlung für Literatur, Kinderbuch, Sprachen und Schule
1010 Wien Schwarzenbergstr. 5 www.oebv.net
»Der Roman entwickelt sich zur skurrilen Psycho-Komödie. Bernhard Strobels gelungener Debütroman bietet subtilste Alltagsbeobachtung an der Abbruchkante zum Wahn.« (Wolfgang Schneider, Deutschlandfunk Büchermarkt) »Mit dem kühlen Blick eines Chirurgen gelingt es Strobel, auch noch die kleinste Wucherung im Gewebe einer Beziehung zu erfassen. Sein Roman knüpft an diese zwischenmenschlichen Psychothriller nahtlos an.« (Ulrich Rüdenauer, Süddeutsche Zeitung)
Roman 188 Seiten gebunden € 20.-
LITERATURVERLAG DROSCHL www.droschl.com
Buy local! Eine Aktion der ARGE Österreichische Privatverlage und unabhängiger Wiener Buchhandlungen
26
F A L T E R 4 1 / 1 8 L i t e r a t u r
„Sex and the City“ meets „American Psycho“ „Mein Jahr der Ruhe und Entspannung“ bestätigt Ottessa Moshfeghs Ruf als eine der spannendsten Autorinnen der USA aszinierend amoralische Frauenfiguren F sind die Spezialität der US-Amerikanerin Ottessa Moshfegh, 1981 in Boston
geboren mit kroatisch-iranischen Wurzeln. In „Eileen“ (2015), einem Psychothriller, der Alfred Hitchcock gefallen hätte, arbeitet eine 24-Jährige in einem Jugendgefängnis und ist nicht minder gestört als die minderjährigen Straftäter, die hier einsitzen. Sie ist brutal und sensibel, egozentrisch und genau in der Beobachtung anderer, monströs und doch zutiefst sympathisch, weil sie mit einer tristen Umgebung hadert, die jungen, intelligenten Frauen keine Perspektiven bietet. In ihrem jüngsten Roman „Mein Jahr der Ruhe und Entspannung“ dreht die Autorin die Schraube weiter. Diesmal steht keine soziale Außenseiterin aus der Provinz im Zentrum, sondern eine vermeintliche Gewinnern: Die Erzählerin ist 27, sieht aus wie ein Model, hat an einer Eliteuniversität studiert, jobbt in einer angesagten Kunstgalerie und muss sich um Geld keine Sorgen machen. Sie hat genug von ihren Eltern geerbt, um sich
an Apartment an Manhattans Upper East Side kaufen zu können und bloß als Hobby arbeiten zu gehen. Trotzdem ist sie unzufrieden und möchte sich eine Auszeit gönnen. Sie glaubt tatsächlich daran, dass sie nach einem ein Jahr währenden „Winter-
schlaf “ als neuer Mensch erwachen würde, der den Tod der Eltern, der sie emotional völlig kalt gelassen hatte, ebenso verarbeitet hätte wie die gestörte On-off-Beziehung mit dem zur Vergewaltigung neigenden und auch ansonsten phänomenal widerwärtigen Trevor.
ckend zynischen Romans, der das Leben in New York vor 9/11 nachzeichnet und dabei wie ein aberwitziger Mix aus „Sex and the City“-Oberflächlichkeit und „American Psycho“-Sadismus wirkt. Während Bret Easton Ellis die Gewaltund Drogenexzesse eines Wallstreet-Yuppies übersteigerte, stellt Moshfegh eine Frau ins Zentrum, die ihrem Dasein als perfektes Deko-Objekt entkommen möchte: „Mein Äußeres machte mich zur Gefangenen in einer Welt, in der Aussehen mehr zählte als alles andere.“ Während sich der überdrehte, gefühlskalte Oberschichten-Snob Patrick Bateman aus „American Psycho“ gern Trash-Talkshows reinzieht, schaut Mosh feghs Figur andauernd kitschige Hollywood-Filme, Whoopie Goldberg ist ihr Idol. Anstatt andere zu killen, versucht sie, sich selbst ruhigzustellen.
Wellness der anderen Sorte, Aussteigen ein-
mal anders: Die junge Frau gaukelt einer Psychiaterin Schlafstörungen vor und bekommt sofort Probepackungen von Psychopharmaka verschrieben, die noch nicht am Markt sind. Sie wirft sich die ärgsten Hämmer ein und stellt als Schlafwandlerin Sachen an, von denen sie nach dem Erwachen naturgemäß überrascht ist: Sie kauft online Unterwäsche von Victoria’s Secret, flirtet via Chat mit unbekannten Männern oder bestellt Unmengen an Essen. Sonderlich zu irritieren scheint sie das aber nicht. Hin und wieder schaut ihre beste Freundin Reva vorbei, die allerdings zu sehr mit sich und ihrer Bulimie beschäftigt ist, um die Probleme der Ich-Erzählerin überhaupt mitzubekommen: „Sie war Sklavin von Äußerlichkeiten und Statussymbolen, was in Manhattan natürlich nichts Ungewöhnliches war.“ Die Treffen mit der durchgeknallten, extrem skrupellosen Ärztin Dr. Tuttle, die EsoGebrabbel liebt und stets aus Neue vergisst, dass die Eltern ihrer Patientin gestört sind, gehören zu den Highlights des beeindru-
Ottessa Moshfegh: Mein Jahr der Ruhe und Entspannung. Roman. Deutsch von Anke Caroline Burger. Liebeskind, 320 S., € 22,70
Moshfeghs brutal-witziger Roman zeigt den amerikanischen Albtraum aus weiblicher Sicht und endet konsequenterweise mit den Anschlägen vom 11. September 2001. Es ist ein großer literarischer Wurf, was nicht zuletzt daran liegt, dass gängige Erwartungshaltungen unterlaufen werden und sich die Autorin nicht in eine Schublade stecken lässt. Am Ende bestehen ihre renitenten Frauen in einer Gesellschaft, in der eigentlich kein Platz für sie vorgesehen ist. K ARIN CERN Y
Curkcuuuuuurikieeeeecurururucuriii! Elizabeth McKenzies tragikomischer Roman „Im Kern eine Liebesgeschichte“ ist gut in Sexszenen und Eichhörnchenphonetik in und wieder zieht man sich ganz gern H einen „großen amerikanischen Familienroman“ rein, wie sie auf Klappentexten
ohne Umschweife angepriesen werden, weil amerikanische Autorinnen und Autoren oft so gekonnt vorführen, wie man’s macht. Die walzen noch unverzagt eine Story nach allen Regeln der Kunst aus und halten sich nicht mit Zweifeln auf, ob die darin detailreich geschilderten alltäglichen Probleme, amourösen Verstrickungen und psychologischen Verwerfungen irgendwen interessieren. Müssen sie ja auch nicht, wenn sie ihr Handwerk verstehen. Dass es mehr Handwerk als Magie ist, spürt
man beim Lesen gelegentlich, aber es kümmert einen wenig, so lange es gut geschrieben und leidlich unterhaltsam ist. Wenn das Buch allerdings an der 500-Seiten-Marke schrammt, muss schon noch mehr dazukommen. Da reicht eine mit verqueren Affären garnierte problematische Mutter-Tochter- oder Vater-Sohn-Beziehung nicht mehr aus. Da braucht es zusätzlich etwas vertiefende Recherche in einem Fachbereich (in diesem Fall: Medizintechnik), ein Grundthema von erweiterter gesellschaftlicher Bedeutung (Kriegstraumata). Was auch nie schaden kann: gelegentliches Abgleiten ins Phantastische. Sprechende Eichhörnchen zum Beispiel. Elizabeth McKenzie hat all das drauf. Was man nicht zuletzt auch daran merkt,
dass die soeben erschienene deutsche Übersetzung ihres dritten Romans mit einem guten Dutzend ziemlich überflüssiger Abbildungen versehen ist – eine drucktechnische Extravaganz, die durchzusetzen man als Autorin sicher schon ein wenig Standing benötigt. So prangt zum Beispiel das Bild eines übriggebliebenen Burritos mitten im Text, wenn in der Zeile darüber von einem übriggebliebenen Burrito die Rede ist. Oder ein Bild von einem Ölgemälde, auf dem der norwegische Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe Thorstein Veblen zu sehen ist, nach dem die Heldin des Geschehens, Veblen Amundsen-Hovda, benannt ist. Zu dem Zeitpunkt hat man den Mann zwar längst gegoogelt und das Bild in besserer Qualität auf Wikipedia betrachtet, aber vielleicht gibt es Leser, die so dieser Mühe enthoben werden. Wenn gegen Ende des Romans, der im kalifornischen Palo Alto spielt, die Geschichte des Wiener Medizingerätebauers Erwin Perzy erzählt wird, der als Erfinder der Schneekugel berühmt wurde, freut man sich dann aber doch über eines der sonderbaren Bilder, die wohl das humorvolle und skurrile Element des Buches hervorheben sollen – für alle, die es nicht von selber erkennen. Immerhin hat es Jonathan Franzen „extrem lustig“ gefunden. Es ist sogar noch mehr als lustig, tragisch-komisch nämlich, und das grenzt tatsächlich schon an hohe Kunst.
Zwei nicht gerade unkomplizierte Menschen aus belasteten familiären Konstellationen, Veblen und Paul, steuern auf eine Heirat zu, der etwas schlappe Spannungsbogen des Romans besteht darin, dass man bis knapp vor Schluss nicht weiß, ob sie’s wirklich wagen. Mit Weisheiten wie „Vielleicht ist die Ehe ja eine kontinuierliche Übung im Loslassen“ wird man jedenfalls nicht bei der Stange gehalten, mit dem durchgehenden Motiv des immer wiederkehrenden rätselhaften Eichhörnchens hingegen schon: In einer der besten Szenen des Romans erhält man höchst unerwartete und überraschende Einblicke in das Leben von Sciurus griseus, dem Westlichen Grauhörnchen. Unbedingt erwähnenswer t auch eine Sexsze-
Elizabeth McKenzie: Im Kern eine Liebesgeschichte. Roman. Deutsch von Stefanie Jacobs. DuMont 480 S., € 24,70
ne, in der die Beteiligten mit Käsesorten assoziiert werden. Das hat man so in der Tat noch nirgends gelesen. Einen Autounfall mit „Rrrums, bums, rums, rums“ zu schildern, ist auch irgendwie dreist, und diese Dreistigkeit macht Spaß. Außerdem lernt man interessante Wörter wie myoklonisch oder seropurulent kennen. Es ist keine verschwendete Lebenszeit, sich dieser Liebesgeschichte zu widmen, aber wie Weltliteratur mit dem nur einmaligen Auftritt eines Eichhörnchens bewerkstelligt wird, liest man besser bei Vladimir Nabokovs „Pnin“ nach. CHRISTINA DAN Y
L i t e r a t u r F A L T E R 4 1 / 1 8
27
Das patscherte Leben eines Superstars Der Ire John Connolly hat einen berührenden Roman über den Weiberhelden Stan Laurel geschrieben
A
ls Stan Laurel im Mai 1946 mit der russischen Sängerin Ida Kitaeva Raphael durchbrennt, um sich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion zu vermählen, handelt es sich – wie die Reporter entzückt vermerkten – um die dritte Aktion dieser Art, die vierte Braut und die siebente Heirat. Vormalige Gattinnen hatte er nach der Scheidung ein zweites Mal, andere in verschiedenen Zeremonien mehrmals geheiratet. Und auch der Bigamie hatte man den Komiker bereits beschuldigt. Doch die Eheleute Ida und Stan Laurel überraschten alle – und blieben zusammen. Bis dass der Tod sie schied, indem er Arthur Stanley Jefferson, wie Laurel mit bürgerlichem Namen hieß, 1965 aus dem Leben holte. Ausgangspunkt für die durchgängig im Präsens erzählte Handlung von „Stan“ ist jenes Hotel in Santa Monica, in dem Laurel seine letzten Lebensjahre mit Ida gemeinsam verbrachte. Hier sitzt der Komiker, emotional verwaist nach dem Tod seines Partners Oliver Hardy (Spitzname: „Babe“), und hängt seinen Erinnerungen nach: „Im Oceana Apartment Hotel beobachtet er von seinem Fenster aus die Origami-Silhouetten der Segelboote auf dem Wasser. Er hatte selbst einmal ein Boot: sechsundvierzig Fuß, fünfunddreißig Knoten, Mahagoni auf Zeder, eine Schönheit. Er hatte ein Boot, und einen großen Wagen, und einen Fahrer. Er hatte einen Sohn. Er hatte Babe. Alles vorbei.“
»
Babe sieht ihn nicht gern in diesem Zustand. Babe hat bereits eine Trinkerin am Hals
Connollys Stil ist knapp und repetitiv. Adjek-
Wie sein Kollege Chaplin, so erfahren wir
aus dem solide recherchierten Roman des Iren John Connolly, hatte auch Laurel einen Sohn, der wenige Tage nach der Geburt starb und den Vater erschüttert zurückließ. An diesem nie verwundenen Schmerz sei auch, so suggeriert der Roman, die Ehe mit der Mutter des Buben, Laurels zweiter Ehefrau Lois Neilson, zerbrochen. Belegt ist jedenfalls, dass Laurel diese jahrelang mit der französischen Schauspielerin Alyce Ardell betrogen hat – auch während der
zweiten, problematischen Schwangerschaft. Erst als sich Laurel und Lois 1933 endgültig getrennt und 1935 die Scheidungspapiere unterzeichnet hatten, setzte Laurel reumütig alle Hebel in Bewegung, um Lois zurückzuerobern. Doch die hatte die Nase voll und klagte auf Unterhalt. Der Scheidungsprozess, an dem sich die Yellow Press damals weidete, verschafft Connolly heute Gelegenheit, seiner Leidenschaft zum Listenschreiben zu frönen. Denn das Ehepaar Laurel war nicht das einzige, das sich in diesem Jahr trennte: „Eleanor Boardman lässt sich von King Vidor scheiden. Janet Gaynor lässt sich von Lydell Peck scheiden. Maurice Chevalier lässt sich von Yvonne Vallée scheiden. Lola Lane lässt sich von Lew Ayers scheiden. Marian Nixon lässt sich von Edward Hillman junior scheiden“, zählt Connolly auf. Und er resümiert: „Und das ist noch nicht einmal die Hälfte von allen. Scheidungsanwälte haben in Hollywood 1933 Hochkonjunktur.“
John Connolly: Stan. Roman. Deutsch von Gottfried Röckelein. Rowohlt, 528 S., € 24,70
tive mag er nicht. Die klangvollen Namen all der Hollywoodstars, die rings um Laurel und Hardy glänzen, sind ihm Schmuck genug. Im Original trägt der Roman übrigens den schlichten Titel „He“ und verwendet das Personalpronomen „er“ ausschließlich für den Protagonisten. Auch deswegen hallen die Namen der anderen, vor allem derjenige seines Partners und Lebensmenschen „Babe“ alias Oliver Hardy, als ständiges Echo durch die Sätze: „Er weiß, dass sich Babe Sorgen um ihn macht. Babe sieht ihn nicht gern in diesem Zustand. Babe hat bereits eine Trinkerin am Hals und kann keinen zweiten Alkoholiker gebrauchen; dennoch kümmert sich Babe wie eh und je um ihn. Babe war in den Tagen für ihn da, als die Scheidung durchkam, und Babe war für ihn da, als Teddy starb.“ In dieser kurzen Passage deuten sich außerdem zwei weitere Tragödien im Leben
Stan Laurels an: 1933 starb sein Bruder Edward „Teddy“ Jefferson, ironischerweise an einer Überdosis Lachgas, das ihm der Zahnarzt zur Betäubung verabreicht hatte. In dieser Zeit begann Laurel auch zu trinken, und zwar mehr, als ihm guttat, wenn Connolly hier die richtigen Schlüsse gezogen hat. Auch im Leben von „Babe“ spielte Alkohol eine zerstörerische Rolle. Von 1921 bis 1940 war Oliver Hardy in zweiter Ehe mit der Stummfilmdarstellerin Myrtle Reeves verheiratet, die jahrelang zwischen Entzugsklinik und gemeinsamem Haushalt pendelte. Gelegentlich wünscht man sich Fotografien all
der Stars, deren Namen in dem Roman aufpoppen. Charlie Chaplin kennt man, Harold Lloyd, Buster Keaton, aber was ist mit all den Nebendarstellerinnen und gescheiterten Stummfilmstars, den Weggefährten, Produzenten und verloren gegangenen Geliebten? Wer ungeduldig ist, googelt – und findet in den meisten Fällen ein paar alte Filmstills oder Porträtfotos im Netz. Geduldigere können auf das Biopic „Stan & Ollie“ warten, in dem Steve Coogan und John C. Reilly das alternde Komikerduo spielen. Anfang 2019 soll es in die Kinos kommen. Nach der Lektüre von Connollys „Stan“ fühlt man sich Laurel und Hardy jedenfalls so nah, als hätte man all ihre Entscheidungen – und die vielen Fehlentscheidungen – mitgetragen. Connollys Sprache ist zwar nicht eben überschwänglich, aber vielleicht wirkt die Wärme, die der Autor seinen Helden entgegenbringt, gerade deshalb so aufrichtig: „Nachdem ich dieses Buch fertiggeschrieben hatte, liebte ich Stan Laurel und Oliver Hary mehr denn je, mit all ihren Makeln, in all ihrem Menschsein, und meine Bewunderung für ihre Kunst war nur noch größer geworden“, schreibt Connolly im Nachwort. So ähnlich dürfte es den meisten Lesern nach 527 Seiten auch gehen. MAYA MCK ECHNEAY
ANNA JELLER BUCHHANDLUNG
Margaretenstraße 35, 1040 Wien Tel.: (..43) 1 586 13 53 Fax.: (..43) 1 586 67 47
empfiehlt: www.loecker-verlag.at
Gillespie_Falterinserat18.indd 1
02.10.18 17:56
28
F A L T E R 4 1 / 1 8 k i n d e r b ü c h e r
Leuchtend bunte Bilderbücher für graue Herb Die Bilderbuchsaison wartet mit bezaubernden Werken auf, in denen mit altbekannten Protagonisten – widerspenstigen Mädchen, weisen Wölfen und freundlichen Walen – neue Geschichten erzählt werden. Aber auch alte Berge und alte Männer erwachen zum Leben ...
in Häuschen im Wald kann Spaß machen, wenn die Sonne scheint, E man Freunde mithat oder zumindest
einen unternehmungsfreudigen Vater. Aber die Ich-Erzählerin macht hier Fe rien nur mit ihrer Mutter, die den gan zen Tag schreibt. Außerdem regnet es. Der Kleinen bleibt nichts anderes üb rig, als Marsmännchen zu töten, oder? Aber selbst das will ihre Mutter ihr verbieten. Da haut sie kurzerhand mit ihrem Minicomputer nach draußen ab und erlebt ein kleines Wunder – je nes der Natur, denn das elektronische Gadget landet im Wasser und macht damit den Weg frei für echtes Erle ben. Das erste auf Deutsch übersetz te Bilderbuch der Italienerin Beatrice Alemagna überzeugt nicht nur inhalt lich, sondern auch optisch. Mit Bunt stift, Wachsmalkreide und Collagen technik erschafft sie eine düstere Welt, in der zunächst nur der knallorange Regenmantel des Mädchens leuchtet. Bis ihre Fantasie erwacht und sie den Zauber der Natur entdeckt, mit Rie senschnecken, einem Meer von Pil zen und einer unterirdische Welt vol ler winziger Wesen. Berückend! K i r st i n B r e i te n fe l l n e r
Beatrice Alemagna: Ein großer Tag, an dem fast nichts passierte. Beltz & Gelberg, 76 S., € 15,40 (ab 5)
is ist nicht weiß, sondern blau. In der Welt, in der die Inuit-Kinder E Cuno und Aia wohnen, dominiert die
Kind möchte wissen, wie es in J edes anderen Wohnungen aussieht. Ein
Haus mit sieben Stockwerken und sieben verschiedenen Wohnungstü ren bietet der Fantasie zahlreiche An haltspunkte. Hinter der ersten woh nen bestimmt Diebe, die Pharaonen schätze horten, hinter der zweiten ein Jäger mit zahmem Tiger und so weiter – bis zur eigenen, langweiligen, braven Wohnung unter dem Dach. Auch die israelische Bilderbuchkünstlerin Ein at Tsarfati ist auf dem deutschsprachi gen Buchmarkt eine Neuentdeckung. Sie entwirft in diesem inspirierenden Buch sieben Tableaus von Wohnstilen, vom Vampirkabinett über den Wohn zimmerzirkus bis zu einem Großraum aquarium und einer Jazzmusikspelun ke. Überbordend und überraschend bis zur letzten Etage! K B
Einat Tsarfati: Wie sieht es aus in unserm Haus? Annette Betz, 44 S., € 15,40 (ab 4)
se Farbe, denn blau ist neben Eis und Himmel auch der heimliche Protago nist der Geschichte: ein Wal, von dem ihr Vater erzählt und den Cuno unbe dingt finden möchte, obwohl sein Va ter ihn seit seiner Kindheit nicht mehr gesehen hat. Mit seinem Kajak haut Cuno einfach ab. Zu seinem Leidwe sen folgt ihm seine kleine Schwester Aia. Zum Schluss findet nicht nur der Wal die Kinder, sondern auch die Ge schwister finden auf neue Weise zuein ander. Auch der Brite Daniel Frost gibt mit dieser Übersetzung sein deutsch sprachiges Debüt. Ein Bilderbuch für die Allerkleinsten, das auch die ästhe tischen Ansprüche der Großen zu be friedigen vermag. K B
Daniel Frost: Die Kinder und der Wal. Kleine Gestalten, 32 S., € 15,40 (ab 3)
K i n d e r b ü c h e r F A L T E R 4 1 / 1 8
29
sttage, an denen fast nichts passiert
Gijs van der Hammen, Hanneke Siemensma (Illustrationen): Kleiner weiser Wolf. Bohem, 40 S., € 17,50 (ab 3) Mac Barnett, Jon Klassen (Illustrationen): Der Wolf, die Ente und die Maus. NordSüd, 40 S., € 15,50 (ab 5)
Francesca Sanna: Geh weg, Herr Berg! Atlantis, 32 S., € 15,40 (ab 4) Martin Widmark, Emilia Dziubak (Illustrationen): Als Larson das Glück wiederfand. arsEdition, 40 S., € 15,50 (ab 5)
ölfe gehören zu den Stars och ein Zugang zum Wolf mit anche Bilderbücher kommen inder sind jung, und Berge sind zahlreicher Bilderbücher. so altmodisch daher, dass es alt. Trotzdem ist noch niemand W N dem Zeug zum Klassiker vom M K fast wehtut. Im Falle der romantiauf die Idee gekommen, einen Berg Umso erstaunlicher, dass es immer Künstlerpaar Gijs van der Hammen noch neue, ungewöhnliche Wolfsgeschichten gibt. Diese hier spielt weitestgehend im Magen eines Wolfes, wo eine Maus und eine Ente zusammenfinden und es sich gutgehen lassen. Und zwar im Wortsinn. Als die Maus dort unfreiwillig landet, findet sie die Ente vor, die im Bett liegt, ihrer neuen Mitbewohnerin aber gleich ein Frühstück zubereitet. Die Welt da draußen fehlt den beiden bald kein bisschen mehr. Und drinnen müssen sie auch keine Angst mehr davor haben, vom Wolf verschlungen zu werden. Als sie ihre neue WG zu feiern beginnen, mit großem Rabatz, wird dem Wolf schlecht. Er beginnt zu stöhnen, was den Jäger aufmerksam macht … Eine tiefsinnige Geschichte mit Klassikerpotenzial und herrlichen Bildern in gedeckten, erdigen Farben. Und mit einer Botschaft ohne Moralisieren. K B
und Hanneke Siemensma: Der kleine Wolf liest gerne dicke Bücher, weswegen er der weise Wolf genannt wird. Auf die Fragen der Tiere kann er aber keine Antwort geben, denn er muss sich weiterbilden. Bis eines Tages ein Bote des Königs erscheint, den der Wolf wieder gesund machen soll. Er begibt sich auf den langen, beschwerlichen Weg und bemerkt dabei zunächst gar nicht, dass er von den Tieren, die er abgewiesen hat, begleitet und unterstützt wird. Auch auf den Bildern wirkt er klein, verloren in weiten Landschaften, auf Bergen und im Regen. Im Palast angekommen, erfüllt er seine Aufgabe bei König Löwe mit Bravour – und wird daraufhin gebeten, als Leibarzt zu bleiben. Aber er hat inzwischen verstanden, dass Freunde genauso wichtig sind wie Bücher. Oder sogar noch wichtiger. Bezaubernd. K B
schen, herzerwärmenden Geschichte des Schweden Martin Widmark und der gnadenlos schönen Bildkunst der Polin Emilia Dziubak ist es ein süßer Schmerz. Der alte Larson hat mit dem Leben abgeschlossen und existiert nur noch in der Erinnerung. Düstere Farben, wehende Vorhänge, geisterhafte Familienmitglieder und wurzeldurchdrungene Kellerlabyrinthe illustrieren seine Weltabgewandtheit. Da klingelt der Nachbarsjunge und übergibt dem unwirschen Alten einen Blumentopf zum Aufpassen während der Ferien. Und über Nacht geschieht etwas Magisches: Die Pflanze erweckt den Misanthropen zu neuem Leben, er öffnet die Vorhänge, putzt die Fenster und lässt so viel Licht herein, dass auch die Katze zurückkehrt. Am Ende lässt er sich von seinen Nachbarn sogar zu einem Glas Wein einladen. K B
HOSTS: DANIELA STRIGL, KLAUS KASTBERGER GÄSTE: GILBERT PRILASNIG, CLEMENS SETZ, SARAH WIPAUER ASSISTENTIN: DIE MIRI MUSIK: JULIAN WERL PRODUKTION: LITERATURHAUS GRAZ UND DAS PLANETENPARTY PRINZIP
Die Literatur-Show
25.10. 22 Uhr
zum Helden zu machen, so wie in diesem schlicht und flächig bebilderten Buch. Der Berg ist ein Herr, das Kind ein Mädchen. Der Berg ist spitz, vielleicht ein Vulkan, vielleicht in Japan. Das Mädchen ist ein Sturschädel, das nicht aufhört, den Berg aufzufordern, aus dem Weg zu gehen. Francesca Sannas prämiertes Bilderbuch „Die Flucht“ (2017) handelte vom Fortgehen, hier geht es ums Festsitzen. Der Berg kann nicht weg, deshalb versucht er Lily loszuwerden, lässt es regnen, bringt Sturm und Schnee. Vergeblich. Da setzt er sie sich kurzerhand auf den Kopf, äh: Gipfel. Eine liebenswert unrealistische Geschichte, denkt man, bis man die Widmung liest: „Für meine Schwestern, die mir gezeigt haben, wie man Berge versetzt.“ „Herr Berg“ bleibt hier an seinem Platz. Aber Lily geht am Schluss auf Reisen. K B
F A L T E R 4 1 / 1 8 k i n d e r b ü c h e r
30
Zippelzefix! Weißt du jetzt auch nix?
Dan, der Dachs, und der tierliebe Landstreicher
Mit Zippel treffen wir eine Art Pumuckl in Gespenstergestalt
A.L. Kennedy mutet Kindern viel Böses und Boshaftes zu
in Gespensterbuch? Die Siebenjährige, die beim Rezensieren E helfen will, schüttelt den Kopf. Kann
ollten mehr Literaten Kinderbücher verfassen, um sich von der S harten Schinderei des Romanschrei-
man nicht lesen, kann man ja nicht schlafen. Ja warte mal, wenn du das Gespenst kennenlernst, wirst du dich nicht mehr fürchten! Also: Paul will den Schlüssel im Schloss umdrehen, da tönt es: „Aua! Auauau. Zippelzefix, was ist denn das?“ Paul erschrickt. „Ist da wer?“ „Neinnein. Hier ist niemand. Keiner da.“ So geht das los mit den beiden. Es sei ein Schlossgespenst, sagt es später fürnehm, schließlich wohnt es ja im alten Türschloss. „Zippel kann dich hören, hat ja gute Öhren!“, singt es, wenn Paul es wieder mal sucht. Gleich hat man da die Pumuckl-Stimme im Ohr. Nur dass der Geheimnisträger diesmal nicht ein Schreinermeister, sondern ein Volksschüler ist, der Zippel ganz gut folgen kann, wenn der klagt: „Awachsana sind böse!“
Zippel legt sein Ohr an Pauls Bauch: „Hallo? Wanderine? Hallo? Bist du da drin?“ Paul hat jetzt außerdem eine Mission: zu verhindern, dass Mama das alte Schloss gegen ein modernes austauscht. Er muss eine neue Wohnstatt für Zippel finden. Umgekehrt lässt das Gespenst sich nicht lumpen, wenn es gegen Tim und Tom geht, die Paul in der Schule martern. Rache ist süß! Nebenbei erzählt Rühle noch die Sache mit Pauls Papa, der auf einmal keine Arbeit mehr hat. Ein realistisches Kinderleben eben, nur mit einem kleinen Gespenst als Beistand. Wer würde das ablehnen? Fazit: Siebenjährige können das Buch abends lesen und dann gutgelaunt einschlafen. Inzwischen heißt es bei jedem unzuordenbaren Geräusch in der Wohnung: „Zippel?“ Gerlinde Pölsler
Eingefallen ist die Geschichte Alex Rüh-
le, Kulturredakteur der Süddeutschen Zeitung, als eines Abends beim Aufsperren der Schlüssel wieder mal klemmte. Dass Axel Scheffler, der beliebte Grüffelo-Zeichner, als Illustrator zusagte, kam als Glücksfall dazu: Mit nur wenigen Pinselstrichen erweckt er das Gespenst mit seinen kurzen Ärmchen zum Leben. Dem Paul ist Zippel sehr willkommen, weil der jede Menge Wirbel reinbringt. Der kleine Geist will zwar immer alles richtig machen, kennt sich aber halt nicht aus mit den komischen Menschensachen. Zum Beispiel dem Wasserfall im Klo. Und wo verschwindet die Mandarine hin, wenn Paul sie in den Mund steckt?
★
Slowa
tla Le t i ★ U ke
★
n ★ Tü Port r k e u ga l ★ i★V ietnam
Argent in Georgien ★ ien Ira ★
20
d lan a st ★ Kub ea
pien ★ Dänemark hio Ät rland ★ Kongo ★ K ★ E I or ★ n
neue Länder
nd e eg ★ kr ★ Lit a in auen ★ Norw an e★ iw Ungarn ★ Ta
3 18 14:2
06/04/20
.indd
naklejka
Alex Rühle, Axel Scheffler (Illustrationen): Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst. dtv, 144 S., € 13,40 (ab 6)
Die Welt entdecken mit einem einzigartigen Landkartenbuch!
1
Moritz Verlag
A.L. Kennedy, Gemma Correll (Illustrationen) : Onkel Stan und Dan und das fast ganz ungeplante Abenteuer. Orell Füssli, 190 S., € 15,40 (ab 9)
Die Maus war immer schon zuerst dort
Jetzt mit 20 neuen Ländern
★
bens abzulenken? Solche wie A.L. Kennedy auf jeden Fall. Sie lässt in „Onkel Stan und Dan und das fast ganz ungeplante Abenteuer“, ihrem ersten Buch, das sich nicht primär an Erwachsene richtet, ihrer Fantasie freien Lauf und genießt das offenkundig. Der Plot ist schnell erzählt: Dachs Dan wird eingefangen und soll Hunden zum Fraß vorgeworfen werden. Als Bösewichte fungieren zwei alte Schwestern, auf deren Farm neben Dan auch besorgte Lamas, mit denen die Damen das große Geschäft witterten, ihr baldiges Ende befürchten. Da es mit Socken aus Lamawolle nicht geklappt hat, sollen die Tiere zu Pastete werden. Die Rettung könnte der tierliebe Landstreicher Stan bringen. Die Handlung ist im Grunde jedoch nebensächlich. „Onkel Stan und Dan“ entpuppt sich, auch in der gelungenen deutschen Fassung von Kennedys langjährigem Übersetzer Ingo Herzke, als Fest der Sprache und der Fabulierlust. Auffällig ist, dass die
Autorin ihrer jungen Leserschaft eine Menge Böses und Boshaftes zumutet. Sowohl der schwarze Humor als auch so manche Grausamkeiten in der Geschichte heben sich angenehm vom faden „Du bist okay so, wie du bist“Tenor vieler heutiger Kinderbücher ab. S e ba s t i a n Fa s t h u b e r
»Kaum hat man hineingeblickt, fängt die große Reise an.« Rotraut Susanne Berner Geb., 152 Seiten / € 35,- [A] /ISBN 978 3 89565 370 4
Torben Kuhlmann schickt Mäuse auf eine Entdeckungsfahrt ass eine Abschlussarbeit zum D internationalen Bestseller wird, kommt bei nichtenglischsprachigen
Kinderbüchern selten vor. Dem Norddeutschen Torben Kuhlmann gelang dieses Kunststück 2014 mit „Lindbergh. Die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus“. 2016 legte er mit „Armstrong – Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond“ nach. Nun liegt Band drei der Serie vor, die auf der Idee beruht, dass die Mäuse immer schon zuerst da waren: in der Luft, auf dem Mond – und auch unter dem Wasser. Dort sucht der junge Mäuserich Pete zusammen mit der Maus, die als Erste den Mond betrat und nun ein alter Professor ist, nach einem versunkenen Schatz. Und entdeckt, dass eine weitere Erfindung, die den Menschen zugeschrieben wird, eigentlich von einer Maus stammt: die Glühbirne. Auf der Textebene sind Kuhlmanns Bücher eher gediegen als originell, mit ausreichend Spannung unterfüttert, nicht mehr und nicht weniger, aber jedes Mal lernt man etwas über eine naturwissenschaftliche Entdeckung oder Errungenschaft. Die Sensation besteht in ihrer stupenden
Bildkraft, getragen von einer klassischen Handwerkskunst, voller liebevoller und witziger Details, mit immer wieder überraschenden Perspektiven, etwa wenn die Taucherglocke von einem Krebs attackiert oder wenn das Unterseeboot von einem Fischschwarm umschwärmt wird. Große Klasse! K ir stin Breitenfellner
Torben Kuhlmann: Edison. Das Rätsel des verschollenen Mauseschatzes. NordSüd, 112 S., € 22,70 (ab 5)
j u g e n d b ü c h e r F A L T E R 4 1 / 1 8
Die Jugend ist die Zeit der harten Landungen
Giftige Wesen sind nicht böse, sie schützen sich
Jugendbuch: Zwei 16-Jährige prallen aufeinander
Jugendbuch: Eine Zwölfjährige verliert ihre Freundin
enn die Frau in dem grauen Mantel sich in den nächsW ten zwanzig Sekunden umdreht und
uzy Swanson ist sich sicher, man ertrinkt nicht einfach so. Vor alS lem nicht ihre Freundin Franny.
eine Brille trägt, werde ich ihm heute begegnen.“ Der 16-jährige Simon veranstaltet ständig solche Lotterien, doch der ersehnte Hauptgewinn will und will nicht auftauchen: Paulus, der Meerestaucher, mit dem Simon nicht mehr als eine Zugfahrt verbracht hat. Paulus, dessen zufällige Berührung Simon Schauer durch den Körper gejagt hat. Der Farbe in Simons Leben bringen soll, denn um ihn herum ist alles grau. Antonia wiederum, ebenfalls 16, stößt ihre gesamte Umgebung vor den Kopf. Mit ihrem Freund, den sie eigentlich mag, vor allem aber mit ihren Eltern kennt sie keine Gnade. „Mir ist klar, dass ich sie damit zum Weinen bringe“, sagt Antonia über den von ihr abgeblockten Annäherungsversuch der Mutter. „Wie auf Knopfdruck. (…) Ungerührt starre ich auf meinen Bildschirm, während sie sich die Tränen von den Wangen wischt.“ Die Katastrophe, die Antonias Familie erlebt bzw. überlebt hat, tritt erst nach und nach zutage. Elisabeth Steinkellner, 37, erzählt abwechselnd aus der Sicht Antonias und Simons. Als Simon auf der Suche nach Paulus komplett planlos in der fremden Stadt herumstiefelt, kippt ihm Antonia quasi in die Arme: Sie meint, in Simon ihren so schmerzlich vermissten Bruder zu erkennen. Glaubwürdig schildert Steinkellner das
Drama der Notwendigkeit, sich von der Kindheit zu verabschieden. Wenn Altvertrautes einfach aufhört zu existieren, Neues aber noch nicht greifbar ist. Wenn die Sehnsucht brennt:
nach großen Gefühlen, nach Bedeutung, nach Sex. Die ersten Gehversuche auf diesem Gebiet schildert die Autorin ebenso unverblümt wie beiläufig. Sie katapultiert ihre bedürftigen Helden in lichte Höhen, spart aber auch die Härte des Zurückgewiesen-Werdens nicht aus: die Trostlosigkeit, wenn der eine nach der ersten Nacht nie mehr weg will, der andere ihn aber eilig aus der Wohnung bugsiert. Steinkellner erzählt von Glück und Versöhnung, von Ernüchterung und Endgültigkeit. Es ist ein schönes und hartes Buch, ein Buch wie das Leben. Die Niederösterreicherin hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten, für dieses Werk den Kinder- und Jugendbuchpreis „Luchs“ des Monats September, vergeben von Radio Bremen und der Zeit. G e r l i n de P ö lsle r
Franny war doch immer so eine gute Schwimmerin. Als diese mit zwölf Jahren im Urlaub in Maryland ertrinkt, hatte ihr Herz 412 Millionen Mal geschlagen, bevor es von einer Sekunde auf die andere für immer aufgehört hat. Suzy mag es, Berechnungen aufzustellen. Und sie ist überzeugt, es „passiert nicht alles so zufällig, wie die Menschen glauben“. Die US-Amerikanerin Ali Benjamin hat mit „Die Wahrheit über Dinge, die einfach passieren“ ein besonderes Buch über die Trauer einer Zwölfjährigen geschrieben. In Rückblenden rollt sie Suzys und Frannys Freundschaft auf, die zum Schluss nicht ganz einfach war. Benjamin erzählt also nicht nur eine Geschichte über den Verlust, den der Tod mit sich bringt, sondern auch über den Verlust, der mit der Pubertät einhergeht.
31
net sie ihre Forschungsergebnisse auf und informiert sich über Quallenexperten und -expertinnen, mit denen sie Kontakt aufnehmen will. Naturwissenschaften treffen auf Philosophie, wenn Suzy über das Universum, das Leben und die Beschaffenheit der Dinge nachdenkt. Über Quallen etwa heißt es an einer Stelle: „Giftige Wesen sind nicht böse. Gift bietet ihnen Schutz. Je giftiger das Tier ist, desto mehr verdient es, dass wir ihm verzeihen. Denn es hat unsere Vergebung am meisten nötig.“ Zum Schluss kann auch Suzy dem Leben ein bisschen vergeben. Benjamin ist es gelungen, eine traurige Coming-of-Age-Geschichte ganz ohne Pathos und mit einer gewissen Leichtigkeit und einer Portion Humor zu erzählen. Das ist sehr bewegend. S A R A S C H A U S B eR G E R
Die Freundschaft der beiden Mädchen ist
Elisabeth Steinkellner: Dieser wilde Ozean, den wir Leben nennen. Beltz & Gelberg, 236 S., € 14,40 (ab 14)
Inserat Falter/Krug_Layout 1 07.10.13 10:28 Seite 1
nicht mehr dieselbe, als Franny anfängt, sich für Makeup und Burschen zu interessieren, während Suzy sich über die Sterilität von Urin, die Weite des Universums, Fledermäuse und Glühwürmer Gedanken macht. Es geht um die Schwelle zum Erwachsenwerden, die auch ohne Todesfall schon schwierig genug ist. Vor allem Suzys naturwissenschaftliches Interesse und ihr Forschungsdrang machen das Buch so besonders. Bei einem Schulausflug ins Aquarium liest sie, dass das Gift der Irukandji-Qualle zu den gefährlichsten der Welt gehört. Von da an versucht sie zu beweisen, dass Franny an einem Quallenstich gestorben ist. Akribisch zeich-
Ali Benjamin: Die Wahrheit über Dinge, die einfach passieren. Hanser, 240 S., € 17,50 (ab 12)
„Der neue Roman der Wienerund Autorin arbeitet sich–an Goldeggs Skurril, poetisch originell heikler NS-Historie ab. ‚Schwedenreiter‘ ist Prosa mit hohem ein herausragendes Debüt! Realitätsbezug.“ (Wolfgang Paterno, PROFIL) „Es ist eine Schande, erst eine Schriftstellerin kommen Parabelhaft und mitdass feinem Humor porträtiert muss, um sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die (nicht nur) Dietmar Krugnoch eineimmer Familie, die sich aufoffene ihrerWunde. in Goldegg schwären wie eine Hanna die Leser spüren, wie nahe uns dieser Suche nachSukare mehrlässt Freiheit zunehmend auflöst. Krieg noch immer ist.“ (Andrea Heinz, Der Beiläufig und subtil wird erzählt, wie sich Standard)
Ignoranz, Unverständnis und Sprachlosigkeit „Es ist ein starkes Buch, ein wichtiges Buch, ein mutiges Buch.“ (Herbert Först, Buchmagazin) breitmachen. Dass dies durchaus komisch sein kann, ist die Lektion dieses wunderbaren „Ein verdienstvoller Versuch, an eine wenig beachtete OpferDebüt-Romans, ein ebenso überraschendes gruppe zuder erinnern!“ (Susanne Alge, BUCHKULTUR) wie fulminantes Ende findet. 172 320Seiten, Seiten,geb., geb.,��20,– 22,–(E-Book: � 15,99) ISBN978-3-7013-1261-0 978-3-7013-1210-8 ISBN
Inserat_Falter_216x95_Sukare.indd 1
OTTO MÜLLER VERLAG OTTO MÜLLER VERLAG www.omvs.at www.facebook.com/otto.mueller.verlag
11.09.18 11:36
32
F A L T E R 4 1 / 1 8 S a c h b u c h
Risiko kann man nicht vermeiden, Philosophie: In Zeiten zunehmender Verunsicherung und Sehnsucht nach Sicherheit lohnt es sich, über das Risiko
E
s gibt kein Leben ohne Risiko. In Zeiten wachsender Verunsicherungen, geprägt von Terror, Migration und Klimaerwärmung, steht den Menschen der Sinn aber eher nach Sicherheit. Und Sicherheit hat einen Preis: die Freiheit. Schon deswegen macht es Sinn, sich mit einem vernachlässigten Thema zu beschäftigen, zu dem es zwei Neuerscheinungen gibt: Anne Dufourmantelles „Lob des Risikos“ und Nassim Nicholas Talebs „Das Risiko und sein Preis. Skin in the Game“. Die französische Philosophin und Psychoanalytikerin und der libanesische Finanzmathematiker und Professor für Risk Engineering an der New York University wissen dabei, wovon sie schreiben, denn beide haben selbst Risiken auf sich genommen. Dufourmantelle, geboren 1964, eilte am 21. Juli 2017 – sechs Jahre nach dem Erscheinen der französischen Originalausgabe ihres flammenden Aufrufs zur mehr Risikobereitschaft – zwei Kindern am Strand der Cote d’Azur zur Hilfe und erlitt dabei einen Herzstillstand, an dessen Folgen sie starb. Die Kinder wurden von Rettungsschwimmern geborgen und überlebten. Taleb begann seine Berufslaufbahn als Trader und Hedge-Fund-Manager und hatte dort naturgemäß mit Risiken zu tun, die seiner Meinung nach aber falsch verstanden und analysiert wurden – weswegen er begann, sich mit dem Thema auch theoretisch auseinanderzusetzen. Die Gegenwart steht im Zeichen des Risikos:
„Wahrscheinlichkeitsrechnungen, Umfragen, Crash-Szenarien, Evaluierung psychischer Belastbarkeit, Prävention gegen Naturkatastrophen, Krisenzellen – keine Facette des politischen oder ethischen Diskurses entgeht diesem Prozess. Das Vorsorgeprinzip ist zur Norm geworden.“ Anne Dufourmantelles „Lob des Risikos“ beginnt mit einer Diagnose des Sicherheitswahns, in den eine überzogene Risikoabwägung münden kann. Was bedeutet es für eine Zivilisation, wenn sie das Risiko nur noch als heldenhaften Akt, puren Unsinn oder abweichendes Verhalten denken kann, fragt die Philosophin, die ihre Dissertation über Kierkegaard, Nietzsche, Levinas und Jan Patocka schrieb und sich dann der Praxis zuwandte, der Psychoanalyse, daneben als Verlegerin arbeitete und rund 20 Bücher veröffentlichte, u.a. zusammen mit Jacques Derrida oder Antonio Negri, über Themen wie Gastfreundschaft, mütterliche Gewalt bzw. Wildheit, Frauen und Opfer, Träume oder die Macht der Sanftheit. „Lob des Risikos“ ist ihr erstes Werk, das ins Deutsche übersetzt wurde, was vermutlich ihrem tragischen Tod geschuldet ist, der ihren Reflexionen auf eine grausame Weise Glaubwürdigkeit verlieh. Unheimlich wird die Lektüre, wenn Dufourmantelle gleich zu Beginn das Risiko als eine „Sterbensverweigerung“ zu fassen versucht, worunter sie den Tod zu Lebzeiten durch Verzicht, Depression und Aufopferung versteht. Diesem setzt sie das Risiko als „positives Trauma“ entgegen, als Gegensatz zur Neurose, die keinen Platz für
das Unbekannte lässt und damit keine Luft zum Atmen. Sowie den Ungehorsam, der auf den Zwang pfeift, „weil man alles, sogar das Leben, zu verlieren bereit ist“. Risiko definiert Dufourmantelle als ein Verlangen, das uns selbst nicht bewusst ist, eine Liebe, deren Gesicht uns verborgen bleibt, ein „reines Ereignis“. Es setzt die Fähigkeit voraus, sich Traurigkeit, Angst und Enttäuschung auszusetzen, und den Mut, frei zu sein. Im Grunde bedeutet jede Entscheidung ein Risiko. Deswegen stellt Dufourmantelle ihrem Buch ein Zitat von Kierkegaard voran: „Der Moment der Entscheidung ist eine Verrücktheit.“ Freiheit versteht Dufourmantelle dabei aber
nicht als absolute Unabhängigkeit, im Gegenteil, sie versucht die „angeborene Abhängigkeit“ des Menschen vom anderen zu denken und geht dabei von der mütterlichen Liebe und „Gastfreundschaft“ aus. Diese existenzielle Unsicherheit gelte es anzunehmen. Die Notwendigkeit, sich zu versichern, daran erinnert Dufourmantelle nachdrücklich, sei proportional zur Logik der Selbstevaluierung und „Testbarkeit“ von Menschen und Dingen gewachsen, einer Kommerzialisierung des Lebens. Sie spalte das Subjekt in ein triebgesteuertes Wesen, das vor sich selbst versichert werden müsse, und ein Vernunftwesen, das nie vernünftig genug sein könne und dennoch andere damit betraue, aus dem Risiko Kapital zu schlagen und sie vor ihrer eigenen Unbedachtsamkeit zu schützen. Dufourmantelle umkreist ihr Thema behutsam. „Freiwillige Knechtschaft und Ungehorsam“, „Das Risiko der Leidenschaft“, „Das Verlassen der Familie“, „Ein Geheimnis wahren“, „Sich mit seinen Ängsten anfreunden“, „Die Traurigkeit riskieren“, „Über das Zeitverlieren“, „Das Risiko des Sprechens“ oder „Das Risiko der Unterwelt (Eurydike)“ lauten die so disparaten wie aussagekräftigen Titel ihrer kurzen Kapitel. Ihr aphoristischer Zugang, bestehend aus vermischten Reflexionen, Lesenotizen, Gesellschaftskritik und berührenden Lebensgeschichten aus Dufourmantelles psychoanalytischer Praxis, macht dieses tiefsinnige und kluge Buch leicht lesbar. Auf starke Thesen verzichtet die Autorin weitgehend, aber in Summe stellen ihre vermischten Betrachtungen eine Hommage an ihren Beruf, die Psychoanalyse, das Risiko der Begegnung, der Interpretation einer fremden Wirklichkeit und des Neuanfangs in einer scheinbar festgefahrenen Lebenssituation dar – auf die Kraft des Gesprächs und damit der Sprache. Nassim Nicholas Taleb pflegt einen entgegen-
gesetzten Zugang. Er packt sein Thema bei der Wurzel und führt es zu einem Nullpunkt zurück, der Frage des Überlebens, die er als Richterin der Geschichte und über Wahr und Falsch begreift. Sein Hauptbegriff „Skin in the Game“ – so der Originaltitel des Buches, der in der deutschsprachigen Ausgabe als Untertitel firmiert – bedeutet die Bereitschaft, sich der Realität auszusetzen, und zwar im wörtlichen Sinne: indem man seine Haut riskiert.
K i rst i n B re i tenfellner
Anne Dufourmantelle: Lob des Risikos. Ein Plädoyer für das Ungewisse. Aufbau, 315 S., € 20,60
Nassim Nicholas Taleb: Das Risiko und sein Preis. Skin in the Game. Penguin, 381 S., € 26,80
»
Merkwürdig in der Tat, dass womöglich keine Epoche je „sicherer“ war als unsere und wir dennoch alle unter einer wachsenden, unermesslichen Angst vor jedem potenziellen Ereignis leiden A nne D uf o ur m antelle
S a c h b u c h F A L T E R 4 1 / 1 8
33
man muss es umarmen! nachzudenken Diesen Einsatz vermisst Taleb bei zahlreichen Menschen, was ihn besonders schmerzt, wenn es sich dabei um Entscheidungsträger handelt. Denn ohne die Bereitschaft, einen Preis für sein Handeln zu bezahlen, so seine These, wird man die Welt nie verstehen, sondern bleibt der Versuchung ausgeliefert, an falschen Prämissen festzuhalten. Als Beispiele dienen ihm Manager, die Boni einstreifen, auch wenn sie ein Unternehmen in den Ruin getrieben haben, Banken, die sich nach Fehlkalkulationen vom Steuerzahler „retten“ lassen, aber auch Interventionisten, die Kriege in anderen Ländern anzetteln, um Diktatoren zu stürzen, und, wenn sie nur Chaos gesät haben, es in einem anderen Land noch einmal probieren. Aber auch Wissenschaftler, der „Intellektuelle also Idiot“ (sic!), Bürokraten und Journalisten bekommen ihr Fett ab, ganz zu schweigen von Charity-Events als zeitgenössische Form des Ablasshandels. Seine Ironie, sein Sarkasmus, sein Furor, seine Nonchalance und seine Unduldsamkeit bilden einen starken Kontrast zu den abwägenden, oft dunkel-poetischen Betrachtungen Dufourmantelles. Taleb kommt stets zum Punkt, wobei Kernsätze typografisch hervorgehoben werden. „Der Fluch der Modernität besteht darin, dass es immer mehr Menschen gibt, die besser erklären können als verstehen“, lautet eine dieser Sentenzen. „Ausschlaggebend ist nicht, was eine Person hat oder nicht hat; ausschlaggebend ist, was sie Angst hat zu verlieren“ eine andere. Aber auch Verhaltensregeln bekommt man von Taleb geliefert: „Lassen Sie sich nicht von Personen beraten, die davon leben, Ratschläge zu geben, es sei denn, sie haften für die Folgen.“ Seine Leidenschaft gilt dem Auffinden von intuitiven Überzeugungen, die Humbug sind. Wer die Bereitschaft aufbringt, sich auf seine Radikalität einzulassen, wird mit Thesen überrascht, die oft wider den Stachel eingefahrener Überzeugungen löcken. Etwa jener der „Minderheitenregel“, die besagt, dass Geschmack und moralische Werte nicht auf Konsens beruhen, sondern der Mehrheit von Intoleranten von Minderheiten aufgezwungen werden. Oder Talebs Skepsis gegenüber dem Universalismus und deswegen auch der Globalisierung. Auch Moral kann für ihn nicht schrankenlos sein, denn der Mensch ist ein Gruppenwesen. Daraus resultiert Talebs Vorliebe für Föderationen. Ohne Risikobereitschaft gibt es für Taleb keine Moral. Mut sieht er dabei als die höchste Tugend an und zugleich die einzige, die man nicht vortäuschen kann – definiert als die Bereitschaft, sein Leben zu riskieren. 1960 in eine griechisch-orthodoxe Familie von
Ärzten, Wissenschaftlern und Politikern geboren, weist der Finanzmathematiker eine profunde Kenntnis der Kultur des Vorderen Orients bis zurück in die Antike auf, er spricht und liest zahlreiche Sprachen: neben Libanesisch-Arabisch, Französisch und Englisch auch Latein, Griechisch, Hebräisch I L L U S T R A T I O N : g e or g f e i e r f e il
Fortsetzung nächste Seite
34
F A L T E R 4 1 / 1 8 S a c h b u c h
»
Fortsetzung von Seite 33
und Aramäisch. In der Antike, betont er, wurden Gesellschaften von Menschen gelenkt, die Risiken trugen, und nicht von solchen, die diese abgaben. Zu seinen Lieblingsautoren gehören römische Philosophen wie Cicero oder Seneca. Leben ist für ihn gleichbedeutend mit Opfer- und Risikobereitschaft. Denn die Verlagerung von Risiken habe die Macht, Systeme zu zerstören. „Skin in the Game“, fasst er an einer Stelle zusammen, „hält die menschliche Hybris im Zaum“. „Das Risiko und sein Preis“ bildet den Abschluss seines fünfbändigen Projekts namens „Incerto“ zu den Themen Glück, Ungewissheit, Wahrscheinlichkeit, Opazität, menschliches Irren, Risiko und Entscheidungsfindung. Es kann aber gleichzeitig auch als Einführung in sein Denken gelesen werden, da Taleb darin immer wieder Themen aus seinen Bestsellern „Schwarzer Schwan“ (dt. 2008) und „Anti-Fragilität“ (2013) aufgreift. Was sie tun sollten, um die „Welt zu retten“,
wird Taleb manchmal von jungen Leuten gefragt, und er rät ihnen, Risiko auf sich zu nehmen: ihre Tugend nicht zur Schau zu
Freiheit ist mit Risiken verbunden – das bedeutet, dass man seine Haut aufs Spiel setzt. Freiheit ist nie frei Nassim Nich o l as T a l e b
mit Ereignissen, die von den meisten Risikoforschern ignoriert werden, weil sie höchst unwahrscheinlich und selten sind. Wenn sie aber doch eintreten, haben sie extreme Konsequenzen, die von den Menschen allerdings, so Taleb, im Nachhinein mit einfachen und verständlichen Erklärungen verharmlost werden. Voraussehen kann man sie nicht, da sie höchst unerwartet eintreten. Man kann ihnen nur mit der Entwicklung von Robustheit und Stabilität begegnen, die Gegenstand seiner Reflexionen zur „Anti-Fragilität“ waren. Im Angesicht eines Ruins – ob von Privatper-
sonen, Firmen oder unserer Lebenswelt durch eine Öko-Katastrophe – sind schließlich keine Kosten-Nutzen-Analysen mehr möglich. „Rationalität ist die Vermeidung eines systemischen Ruins“, lautet sein Fazit, denn zu den klassischen Tugenden gehört neben Mut auch Besonnenheit. Eines seiner Beispiel dafür klingt wie eine Hommage an Anne Dufourmanelle, die Taleb wohl kaum gekannt haben dürfte: „Ich kann Mut beweisen, indem ich eine Gruppe Kinder vor dem Ertrinken rette und dabei mein eigenes Leben aufs Spiel setze, und gleichzeitig wäre es ein Akt der Besonnenheit.“ F
stellen und sich selbstständig zu machen. Risikobereitschaft endet für ihn bei der Möglichkeit eines Ruins. Als Experte für Extremereignisse wie Tail-Risiken (die Risiken extremer Verluste) war Taleb übrigens einer von wenigen, die die Finanzkrise von 2008 vorausgesagt hatten. Auch in seinem Buch „Schwarzer Schwan“ (orig. 2007) beschäftigte er sich
Räuberbanden in den Horten der Hochkultur? Kulturtheorie: Alessandro Baricco verortet in „Die Barbaren“ einen Kulturverfall, lehnt diesen aber trotzdem nicht ab
sehmoderator, Drehbuchautor – diagnostiziert in seinem neuen, als Artikelserie bereits 2006 in der Tageszeitung La Repubblica erschienenen Buch einen dramatischen kulturellen Wandel.
Baricco versucht zu fassen, was viele in einem klassischen geistigen Umfeld aufgewachsene Menschen als Apokalypse begreifen: dass die Orte der Kultur von „Räuberbanden“ überrannt werden und danach nicht mehr viel von der einstigen bildungsbürgerlichen Herrlichkeit übrigbleibt. Zunächst beschreibt Baricco einige der kulturellen Felder, auf denen die „Barbaren“ – also die anderen, die Fremden – gewütet und die sie geplündert haben: Wein, Fußball und natürlich die Buchbranche. Der Mikrokosmos des Weins scheint gut geeignet zu sein, diesen Wandel zu illustrieren: Über einen langen Zeitraum hinweg hatte sich vor allem in Frankreich und Italien eine önologische Könner- und Kennerschaft herausgebildet. Der Reichtum, die Tiefe und Komplexität des Weins führten zu einer Verfeinerung des Geschmacks und des Beschreibungsinstrumentariums. Dann kamen die Amerikaner und warfen ihre, so Baricco, „Hollywood-Weine“ auf den Markt. Bildung und Tradition spielten fortan keine Rolle mehr. Es ging stattdessen um Verflachung und Massentauglichkeit, und die Bewertung eines Weins wurde in Form von Schulnoten vorgenommen. Einen Verlust der Seele nennt Baricco diese Entwicklung. Die Symptome, an denen die Barbaren sichtbar werden: „intensive Kommerzialisierung, moderne Sprache, Anpas-
sung ans amerikanische Vorbild, Entscheidung für Spektakularität, technologische Neuerung, Kampf zwischen der alten und der neuen Macht“. Das intellektuelle Zentrum des Umbruchs macht er bei Google aus, jener Suchmaschine, die unsere seit der Romantik erlernte Form der Aneignung von Wissen, Kunst und Welt radikal umkehrt. Google sei das Feldlager, die Hauptstadt der Barbaren, hier komme man dem Prinzip der neuen Ordnung nahe: Bei Google gehe es um Verlinkung, um eine Sprache, die von den meisten Menschen verstanden werde. Wichtig sei das, was am häufigsten erwähnt werde und am weiträumigsten vernetzt sei. Wahrheit werde gegen eine Kommunikationsquote eingetauscht. Wissen, so die Parole der Barbarei, muss in Bewegung sein, man soll leicht zwischen den Orten hin und her surfen können. Wo einmal Vertiefung, Anstrengung, Vervollkommnung als Ideal vorgegeben waren, stehen nun Sequenzen und Verkettungen. Vielleicht, so räumt Baricco ein, bewahre gerade dieses oberflächliche Surfen und die stetige Bewegung vor Absolutheit und Ideologie. Ein tiefes Misstrauen gegenüber all dem, was tief verwurzelt ist und sich deshalb dem Mythos annähere, finde in der neuen Weltwahrnehmung ihren Ausdruck. Das Verblüffende an Bariccos Standpunkt im
Vergleich mit anderen kulturkritisch aufgeladenen Gegenwartsbeobachtungen, die der Buchmarkt aufgrund der verstärkten Unsicherheitsgefühle in gesellschaftlichen Umbruchszeiten derzeit geballt hervorbringt, besteht darin, dass er diese Mutation gar nicht ablehnt oder fürchtet, sondern als et-
was für kulturelle Evolution Charakteristisches betrachtet. Baricco möchte auf der Seite des Fortschritts stehen. Umkehren ließe sich die Entwicklung ohnehin nicht, meint der Turiner, der heuer seinen 60. Geburtstag gefeiert hat. Umso wichtiger sei es, die zukünftigen Wahrnehmungs- und Umgangsformen mitzugestalten. Noch scheint es also denkbar, liebgewonnene Überbleibsel der alten in die neue Kultur hinüberzuretten. „Jeder von uns ist dort, wo alle sind, am einzigen Ort, den es gibt, mitten im Strom der Mutation, wo wir das, was wir kennen, Kultur nennen, und das, was noch keinen Namen hat, Barbarei. Im Unterschied zu anderen denke ich, dass es ein wunderbarer Ort ist.“ Man kann sich fragen, ob es wirklich ein wun-
Alessandro Baricco: Die Barbaren. Über die Mutation der Kultur. Hoffmann und Campe, 224 S., € 20,60
derbarer Ort ist. Und ob der Wandel formbar ist angesichts der Konzerne, die ihn betreiben. Die Pointe von Bariccos Buch ist deshalb durchaus überraschend: Nach der trüben Diagnose der verschiedenen Felder, auf denen die Barbaren toben, hätte man kaum eine so affirmative Haltung erwartet. Ist das Pragmatismus? Die Einsicht, dass der Lauf der Dinge sich nicht aufhalten lässt? Oder wirklich die Erkenntnis, dass ein Kulturwandel immer die Anmutung einer zerstörerischen Unkultur hat, letztlich aber nur etwas Neues darstellt, einen Aufbruch? Die Zwischenzeit als glücklicher, höchst dynamischer Zustand: Jedenfalls ist Bariccos auf den Spuren Walter Benjamins wandelnde Gegenwartsanalyse nicht ohne Widersprüche und Reibungspunkte. Darin aber höchst inspirierend. U l rich R üd e n au e r
Illustr ation: Georg Feierfeil
er mediale Tausendsassa Alessandro Baricco – er ist Romanautor, EssayD ist, Musikkritiker, Literaturerklärer, Fern-
S a c h b u c h F A L T E R 4 1 / 1 8
35
Die Hunde der Dreistigkeit Wirtschaft: Shoshana Zuboff rechnet mit Big Other ab, dem neoabsolutistischen Regime von Google & Co
D
ieses Buch ist ein Hammer. Nicht nur, weil es mehr als 700 mit nicht eben riesigen Lettern bedruckte Seiten umfasst und satte 1,2 Kilogramm wiegt. Nicht nur, weil die deutsche Fassung ungewöhnlicherweise vor der englischen erscheint (der Verlag war schneller in der Produktion). Nein, dieses Buch ist ein Hammer, weil es unser Zeitalter auf einen Begriff bringt: Wir leben im Überwachungskapitalismus. Hier wird dieser Begriff in so vielen Facetten ausgeleuchtet wie in keinem anderen mir bekannten Werk zum Thema. Shoshana Zuboff, eine emeritierte Ökonomieprofessorin, war an der Harvard Business School eine der ersten ordentlichen Professorinnen. Zuboff sprach als Erste von „Dark Google“ und brachte das Internet in Zusammenhang mit einem neoabsolutistischen Regime. Auch den Begriff Überwachungskapitalismus (Surveillance Capitalism) hat Zuboff geprägt. Der Überwachungskapitalismus durchdringt alle Lebensbereiche und stülpt sie um. Er fegt alle Beziehungen in einer Weise hinweg, wie es Marx und Engels im „Kommunistischen Manifest“ für den Kapitalismus beschrieben haben. Nur, dass kein Gespenst umgeht, das gegen diese Umwälzung aufsteht.
»
Der Terror von Big Brother wirkt harmlos, verglichen mit dem Regime von Big Other, sagt Shoshana Zuboff
„Digitalisiert euch!“, lautet vielmehr der
Schlachtruf der Konformisten aller politischen Lager, und wer vor den totalitären Aspekten der Digitalisierung warnte, wurde gern ins Lager der Rückschrittler gestellt und als Reaktionär und Maschinenstürmer angeprangert. Zuboff ist diesbezüglich nicht zimperlich. Dass die Herschaft der Digitalkonzerne eine Form totalitärer Herrschaft darstellt oder sie zumindest herbeiführen will, darüber besteht für die Autorin kein Zweifel. Statt in der Dystopie des Big Brother leben wir in jener des Big Other, sagt sie. Was ist das, Big Other? Zuboff: „Ich verstehe darunter die wahrnehmungsfähige, rechnergestützte und vernetzte Mario-
Shoshana Zuboff: Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Campus, 727 S., € 30,80
nette, die das menschliche Verhalten rendert, überwacht, berechnet und modifiziert.“ „Rendert“ wäre mit „vorgibt“ besser übersetzt. Aber man versteht die saftige Diagnose. Das Regime der digitalen Konzerne läuft hinaus auf eine neue „kollektive Ordnung auf Basis totaler Gewissheit, auf die Enteignung kritischer Menschenrechte, die am besten als Putsch von oben zu verstehen ist – als Sturz der Volkssouveränität“. Wie konnte es so weit kommen? Zuboffs Buch
schlägt einen großen Bogen von den Bedingungen der Digitalisierung zu deren Wirkungen. Die Bedingungen schuf die zweite Moderne. Das ist jener Zustand, in dem der Einzelne nicht mehr von Fabrik und Familie geprägt wird wie in der ersten Moderne, sondern von einer durch und durch individualisierten Gesellschaft mit starkem Selbstwertgefühl und starkem Bedürfnis nach Selbstbestimmung; ihr entspricht die frühe Apple-Phase und der Beginn von Social Media. Genau diese Bedürfnisse werden allerdings im neoliberalen Regime frustriert, sagt Zuboff. Auf der Suche nach Ausweg und Hilfe flohen wir ins Internet, wo wir in die Hände von Leuten fielen, die man im Amerika des späten 19. Jahrhunderts Räuberbarone nannte und deren Konzerne man zerschlug. Diese digitalen Raubritter haben, unbesorgt um Gesetz und moralische Grenzen, Rechte und intime Schranken überschritten und sind so weit in unser Leben eingedrungen, dass sie nicht nur mit unseren intimsten Regungen Geschäfte machen, dass sie nicht nur voraussagen, was wir tun und denken werden, sondern dass sie auch daran gehen, es uns vorzuschreiben. Der Gedanke, uns zu beherrschen, folgt dabei nur dem kommerziellen Imperativ, den Gewinn zu maximieren. Willkommen in der dritten Moderne! Zuboff beschreibt eine neue Conditio humana, in der wir begeistert dabei mitarbeiten, unsere eigene Würde aufzugeben. Der
neue, sanfte Totalitarismus operiert nicht durch Zwang, sondern durch die Verführung technischer Machbarkeit. Es ist ein Totalitarismus der Instrumentalisierung. Er heißt so, weil er unser Verhalten modifiziert. Zuboff zeigt, wie der Behaviorismus ihres Harvard-Kollegen Bernhard F. Skinner, also die Utopie der kompletten Verhaltenssteuerung des Menschen, mit der neoklassischen Idee des Homo oeconomicus zusammenfällt, der angeblich alles rational entscheidet. Die beiden vereinen sich im Algorithmus, der das Verhalten des Menschen rational vorausberechnet und ökonomisch perfekt ausbeutet. Wir sind nicht das Produkt, sagt Zuboff, wir
sind der Kadaver des Produkts, wir sind das, was übrig ist, nachdem man uns ausgeweidet hat. Wir sind nicht das Produkt, wir sind Rohstoff, den man erntet. Wir sind wie Getreide auf dem Feld. Was derart poetisch klingt und sparsam und schön durch Gedichte von W.H. Auden kontrastriert wird, zeichnet Zuboff faktenreich und in originellen Befunden nach. Was Google an Werbekunden verkauft, sind „Derivate von Verhaltensüberschuss“. Apples i-Tunes war ein Big Hack, Google Maps und Google Glass waren „losgelassene Hunde der Dreistigkeit“ und so weiter. Das alles ist materialreich zusammengefasst und glänzend analysiert. Müssen wir die Hoffnung aufgeben? Nein, wie die Autorin müssen wir uns über den Missbrauch der besseren Möglichkeiten der Digitalisierung empören. Zuboff zitiert den Aufklärer Thomas Paine, der sagte, die Lust einer Generation, Sklaven zu sein, mindere nicht das Recht einer kommenden Generation auf Freiheit. Dieses Buch macht Lust, am Ende hinzuschreiben: Im Übrigen bin ich der Meinung, die Big Five müssen zerschlagen werden. Aber das ist nicht die Lösung, sagt Zuboff. Wir müssen das Prinzip verstehen, um ihm zu widerstehen. Ar min thurnher
»Eine fesselnde Biografie« Times Tania Munz
Der Tanz der Bienen Karl von Frisch und die Entdeckung der Bienensprache 360 Seiten | Hardcover | Euro 27,–
Buy local! Eine Aktion der ARGE Österreichische Privatverlage und unabhängiger Wiener Buchhandlungen
36
F A L T E R 4 1 / 1 8 S a c h b u c h
Geschichten aus der neuen Warenwelt Warenwelt: Luc Boltanski und Arnaud Esquerre analysieren die neue Warenwelt und damit den Kapitalismus
Da die beiden Denker, die sich hier zusammen-
getan haben, Franzosen sind, präsentieren sie vornehmlich Phänomene aus Frankreich, aber im Wissen, dass sie nur Exempel einer globalen Transformation sind. Die industrielle Fertigung – Stahlwerke, Autoindustrie, Eisenbahnbau – ging in Frankreich seit den 1970er-Jahren stark zurück, wodurch die Beschäftigungszahlen in der Industrie um 40 Prozent schrumpften. Zugleich stieg das auf, was man gemeinhin die „immaterielle“ Arbeit nennt. Sie kann ebenfalls mit Stoffumwandlung verbunden sein, aber ihr Schwerpunkt verschiebt sich auf die Produktion von Bedeutung, von Geschichten, die verkauft werden.
Wenn in den Industrieruinen Kunst- und Kulturzentren oder trendige Quartiere errichtet werden, wenn die Geschichte einer Region vermarktet wird (Motto: Authentizität, Lebensstil) oder Stadtviertel wie Saint-Germain-des-Prés, Prenzlauer Berg oder Chelsea, wenn der Weinbau mit Bedeutung aufgeladen wird (Motto: Lebensart), wenn eine Marke mit Lifestyleattributen versehen wird (von Nike über Prada bis zu Apple), wenn ganze Städte „rebranded“ werden (Bilbao: von der Hafenstadt zum Kunstmekka) – dann entstehen nicht nur neue Branchen, sondern es vollzieht sich eine veritable sozioökonomische Transformation. Trendscouts schwirren herum, Marketingleute versehen Waren mit Geschichten, eine Designer-, Kunst- und Kuratorenindustrie entsteht. Man kauft sich zusammen, was einem schein-
bar fehlt: „Den ,Alten‘ fehlt, dass sie nicht ,jünger sind‘, den ,Hässlichen‘, dass sie nicht ,schön‘ sind, den ,Hinterwäldlern‘, dass sie nicht ,berühmt‘ sind, den ,Armen‘, dass sie nicht reich sind, den ,Otto Normalverbrauchern‘, dass sie nicht ,schick‘ sind usw.“ Man erwirbt Dinge also nicht mehr, um ein Bedürfnis im engen Sinne zu stillen, etwa, indem man eine Kaffeemaschine kauft, weil man Kaffee trinken will, sondern man kauft primär die Ware als Zeichen. Dass die verchromte italienische Kaffeemaschine im Vintage-Schick darüber hinaus auch noch Kaffee kochen kann, kommt gewissermaßen nur als Zugabe dazu. All das ist natürlich nicht wirklich neu, es wurde vielfach schon analysiert, manche Urtexte, die als erste diese Spuren aufnahmen, sind schon rund 50 Jahre alt. Man denke an Roland Barthes’ „Die Sprache der Mode“ (1967) oder Jean Baudrillards legendäres Bändchen „Das System der Dinge“ (1968). Im Vergleich damit zeichnet Boltanskis und Esquerres Analyse die Systematik aus, mit der sie die Warenstrukturen unter die Lupe nehmen. Außerdem zeigen
»
Die Kreativen, die als Geschichten produzenten im Zentrum der Bereicherungs ökonomie stehen, werden als Pre kariat mit Peanuts abgefertigt, wäh rend die Super reichen die Profite lukrieren
Luc Boltanski, Arnaud Esquerre: Bereicherung. Eine Kritik der Ware. Suhrkamp, 730 S., € 49,40
sie, wie diese Strukturen ineinander übergehen können und sich bei diesem Übergang bereichern. Da ist einmal die Standardform, das standardi-
sierte industrielle Massenprodukt, das zunächst primär seiner Nützlichkeit wegen gekauft wird (wenngleich auch hier der Bedeutungskonsum nicht ganz übersehen werden darf – man denke an die automatischen Eierkocher der 1970er-Jahre, die als nützlich angepriesen wurden, aber gekauft wurden, weil man so etwas besitzen musste, wenn man als „modern“ gelten wollte). Standardprodukte haben die Eigenschaft, an Wert zu verlieren und zu Abfall werden, es sei denn, es gelingt, sie zum authentischen Vintageteil zu erklären, wenn sie dafür alt genug sind, wie etwa ein OldtimerAuto. Dann gibt es die Trendform, das, was man haben muss, die Sammlerform und die Anlageform. Verlassene Bauernhäuser etwa waren vor 40 Jahren Ruinen, die keiner wollte, dann wurden sie Trend, und heute sind sie schon Geldanlagen. Jede Verschiebung macht irgendjemanden reicher, und meist sind es die Reichen, die reicher werden. Man kann, so die Autoren, diese neue Ökonomie nicht verstehen, wenn man das Wachstum der Ungleichheiten und die Entstehung einer neuen Klasse nicht wahrnimmt. Sie sind die Konsumenten jener Waren, die astronomische Preise erzielen, weil man ihnen einen Wert zuschreibt, den sie nie hätten, wären sie nicht mit Geschichten angereichert. Die Kreativen, die als Geschichtenproduzenten im Zentrum der Bereicherungsökonomie stehen, werden als Prekariat mit Peanuts abgefertigt, während die Superreichen die Profite lukrieren. Denn diese Superklasse ist nicht nur Konsument dieser Güter, weil sie reich ist, sie wird auch reich, indem sie sich diese Güter aneignet. „Im Zentrum dieses verschwommenen Etwas steht die Luxusindustrie.“ R o ber t M i s i k
Illustr ation: georg feierfeil
W
ir umgeben uns mit Gegenständen, die uns in praktischer Hinsicht nützlich sein sollen, aber zugleich sollen sie etwas zum Ausdruck bringen: unseren persönlichen Stil, wie wir gerne wahrgenommen werden würden, eine Lebensart, die die Güter repräsentieren. Attribute der Waren sollen gewissermaßen auf uns übergehen, davon lebt Mode genauso wie Antiquitätenhandel oder Tourismus. „Bereicherungsökonomie“ nennen Luc Boltanski und Arnaud Esquerre diese neue Form des Kapitalismus. „Enrichissement. Une critique de la marchandise“ lautet der französische Originaltitel, dessen deutsche Übersetzung „Bereicherung. Eine Kritik der Ware“ ebenfalls funktioniert, denn der Begriff „Bereicherung“ enthält zahlreiche Subtexte. Waren werden am Markt generell mit dem Ziel gehandelt, dass sich der Verkäufer bereichert. Aber die Waren, die die Autoren analysieren, sind zugleich selbst „bereichert“, sie sind angereichert, etwa mit Kultur und mit Bedeutung. Darüber hinaus können sich die Käufer durch den Kauf bereichern, etwa, weil sie ihr gesellschaftliches Prestige erhöhen, wenn sie sich mit Gütern umgeben, die auch einen Status zum Ausdruck bringen.
S a c h b u c h F A L T E R 4 1 / 1 8
37
Warum Billiges billig ist Wenn die Dinge und wer dabei draufzahlt zu sprechen beginnen Warenwelt: Raj Patel und Jason W. Moore betrachten die schöne neue Wirtschaftswelt und ihre Verlierer
Warenwelt: Susannah Walker erzählt über die Dinge, die wir zurücklassen, und darüber, was diese über uns erzählen
atur, Geld, Arbeit, Fürsorge, Nahrung, Energie und schließN lich das Leben selbst: Wie konn-
ie soll man dieses Buch beschreiben? Vielleicht als allW tagsarchäologische Studie. Oder als
te es passieren, dass diese „Dinge“ in Hinsicht auf die große Mehrheit der Menschen und Tiere entwertet wurden? Dass von unserer Zivilisation langfristig vor allem radioaktive Abfälle, Plastik und Hühnerknochen übrigbleiben werden? Dass arm gemachte Menschen „nichts zählen“, dass auf sie keine Rücksicht genommen wird? Das sei das Ergebnis von Ausbeutung
über Jahrhunderte, schreiben der ehemalige Weltbank- und UN-Ökonom Raj Patel und der Historiker und Soziologe Jason W. Moore. In ihrem Buch „Entwertung“ werfen die beiden einen Blick zurück, u.a. zu den frühen Banken und zu Christoph Columbus. Sie dokumentieren ein zerstörerisches Wirtschaftssystem (ja, den Kapitalismus), das schon vor langem entstanden ist und das ihrer Meinung nach für die meisten Menschen eine Spirale nach unten darstellte und darstellt. Diese Spirale dreht sich in den letzten Jahrzehnten immer schneller. Nicht zuletzt wegen des Klimawandels bzw. der Erderwärmung, zu der die aktuelle industrialisierte Landwirtschaft wesentlich beiträgt. Raj und Moore sparen nicht mit oft schockierenden Zahlen: „Zwischen 1961 und 2010, also in knapp einem halben Jahrhundert, ist die Zahl der Tiere, die weltweit geschlachtet wurden, von etwa acht Milliarden auf 64 Milliarden hochgeschnellt, und diese Zahl wird sich bis zum Jahr 2050 (…) auf 120 Milliarden nahezu verdoppeln.“ Man kann sich vorstellen, wie diese Tiere ihr kurzes Leben verbringen müssen. Es stellt sich auch die Frage, wo so viel Futter herkommen soll, ohne Feldern Konkurrenz zu machen, auf denen Nahrungsmittel für Menschen wachsen. Wie bekannt ist, wird vor allem Sojafutter ja jetzt schon in den Gebieten der geschlägerten Regenwälder angebaut. Dazu kommt, dass sich viele Menschen gesundes Essen nicht leisten können, wenn sie keine Verwandten am Land haben. Zwischen 1990 und 2015 sind die Preise für verarbeitete Lebensmittel weit weniger stark gestiegen als die Preise für frisches Obst und Gemüse. Gleichzeitig sind seit 1990 in den OECD-Ländern die Löhne der Arbeiter relativ stabil geblieben. Menschen, die in Ländern mit niedrigem Einkommen leben, müssten mindestens die Hälfte ihres monatlichen Lohns für ein paar wenige gesunde Produkte ausgeben, meinen die Autoren. Kein Wunder, dass Arme oft fettleibig sind. Wie genau billige Nahrung mit billiger Arbeit und billigem Leben
zusammenhängt, wird klar an einem Beispiel aus den USA, das Patel und Moore vorstellen: der Produktion von Chicken Wings oder McNuggets. Billige Arbeitskräfte (meist Emigranten aus Mexiko oder den mittelamerikanischen Staaten) verarbeiten Unmengen von billigen Hühnchen zu billigen Hühnerflügelgerichten. Aus Hühnern, die natürlich nur gezüchtet wurden, um geschlachtet zu werden. Da ist es egal, ob sie Schmerzen haben, und auch, dass sie wegen ihrer übergroßen Brust kaum laufen können. Sie selbst sind billiges, entwertetes Leben. Egal sind den Besitzern der Fabriken aber auch Beschwerden der Arbeiter. Patel und Moore greifen Konzepte an, die die Dimensionen Macht, Herrschaft und Zwang außer Acht lassen und so tun, als wäre die Krise allein auf individuelle Konsumentscheidungen zurückzuführen. Menschen in ärmeren Ländern würden nicht freiwillig einen geringeren ökologischen Fußabdruck aufweisen bzw. Arme in den Industriestaaten einen höheren, sondern weil sie oft dazu gezwungen wären: „Wenn Sie im Zuge der Gentrifizierung aus Ihrem angestammten Viertel verdrängt wurden und nun eine Stunde länger zu Ihrer Arbeitsstelle unterwegs sind, dann hat Ihr ökologischer Fußabdruck nichts mehr mit einer Lifestyle-Entscheidung zu tun. Sie sind in Ihrer Wahl dann ungefähr so frei wie die englischen Bauern, die (vor allem im 17. Jh.) von ihrem Land vertrieben wurden und zwischen Lohnarbeit und Hungertod wählen durften.“ Arme leben also nicht freiwillig „klimafreundlich“ oder „klimafeindlich“. „Entwertung“ ist ein politisches Buch,
das mit Mitteln der Umwelt- und Wirtschaftsgeschichte die aktuelle krisenhafte Situation erklärt. Einen einfachen Ausweg zeigen Patel und Moore nicht, dafür weisen sie auf die weltweit zahlreichen Initiativen hin, die bereits an einem Systemwandel arbeiten. Etwa die internationale Bauernbewegung La Via Campesina. Diese und andere Initiativen sind sich des Netzes des Lebens, in das sie eingebunden sind, bewusst und versuchen, mit Rücksicht auf dieses zu arbeiten. K a r i n C h l a dek
Jason W. Moore, Raj Patel: Entwertung. Eine Geschichte der Welt in sieben billigen Dingen. Rowohlt, 347 S., € 24,70
raffiniertes, von hinten aufgerolltes Porträt einer brüchigen Mutter-Tochter-Beziehung. Man könnte es aber auch psychologische Fallgeschichte, Familienchronik oder anthropologische Theorie der Dinge nennen, in die zudem noch eine gehörige Portion Designgeschichte hineingemischt ist. Am ehesten ist das Buch eine Mischung aus all diesem. Solche Bücher finden in einem Buchmarkt, der äußersten Wert auf klare Etiketten legt, in der Regel nur schwer einen Verlag. Denn der Buchhandel sträubt sich gegen Bücher, von denen er nicht weiß, in welches Regal er sie einordnen soll. Wenn solche schwer schubladisierbaren Hybridwerke trotzdem erscheinen, haben die Leserinnen und Leser an ihnen besondere Freude, denn das bedeutet zumeist, dass sie besonders gut sind. So auch hier. Das außergewöhnliche und kluge Buch,
um das es geht, trägt den Titel „Was bleibt. Über die Dinge, die wir zurücklassen“. Geschrieben hat es die britische Designhistorikerin, Kuratorin und Literaturwissenschaftlerin Susannah Walker, die im Hauptberuf Designbücher publiziert und als Beraterin für TV-Sendungen zu Kunst, Architektur und Lifestyle tätig ist. Hier beschäftigt sie etwas ganz anderes – allerdings so, dass auch hier ihre Expertise einfließen kann: Susannah Walker schreibt über den Tod ihrer Mutter und darüber, was die Dinge in deren Haus in Worcester über die Mutter, sie selbst und die Familiengeschichte erzählen. Es ist eine Situation, die uns allen nach dem Tod naher Verwandter bevorsteht: Hinterlassenes aussortieren, Ordnen, Aufheben und Wegschmeißen, Bilanz ziehen – im Wort- wie im übertragenen Sinn. In Walkers Fall ist es ein besonders dorniger Weg, denn ihre Mutter war eine schwierige, unglückliche Person. Ihr Lebensweg ist von Verlust, Einsamkeit und Alkoholismus gezeichnet und mündete im Alter in ein an Messietum heranreichendes Horten von Dingen. Die Mutter hinterließ Walker ein Haus, dessen Anblick tiefe Scham mit Ratlosigkeit und Überforderung hervorrief. Dazu kommt, dass Walker nach der Scheidung ihrer Eltern ab acht beim Vater aufwuchs. Zeitlebens blieb die Beziehung zu ihrer ehemals so eleganten, klugen Mutter mehr als kompliziert. Mit fast schon manischer Energie macht sich Walker daran, aus den verdreckten und von Mief, Zigarettenrauch und Feuchtigkeit zerstörten Gegenständen im Haus ihrer
verstorbenen Mutter zu lesen – wie eine Archäologin in einer Fundstätte. Wonach genau sucht sie? Letztlich wohl danach, dass sie ihrer distanzierten Mutter doch viel bedeutet haben könnte. Stattdessen fördert sie eine sie betreffende Notiz in mütterlicher Handschrift zutage: „Geburt der zweiten Tochter. Schlief nur wenig. Ein unerträgliches Kind.“ Walker, das ungeliebte, energiegelade-
ne Kind einer schattenhaften Mutter, wendet alle Kraft auf, um zu rekonstruieren, wo das traurige, enttäuschungsbereite Wesen ihrer Mutter seine Wurzeln hatte, und fördert aus deren Hinterlassenschaften eine zwiespältige Geschichte zutage, in der Snobismus und Trennung, Kindstod und Verschweigen, Verlust und Einsamkeit sich schon seit Generationen erbarmungslos weitervererben. Gleichzeitig geht es aber natürlich auch um die vielen seltsamen Gesichter der Trauer – und um das Tabu, dass in der Trauer von Hinterbliebenen eine riesige Portion Erleichterung, Entlastung und sogar Freude enthalten sein kann. Als Erinnerungsbuch befasst sich „Was bleibt“ auch mit der zutiefst menschlichen Strategie, Besitztümer aller Art als Bollwerk gegen Kränkung, Schmerz und Verlust anzuhäufen, und kommt dabei notgedrungen zu der universellen Frage, ob und in welcher Weise die Dinge, die wir besitzen, für uns sprechen, uns ausmachen oder sogar die Überhand über unser Leben gewinnen können. Wie sie diese Einsichten aus Alltagsgegenständen und Erinnerungsstücken gewinnt, wie sie dabei in die Geistes- und Kunstgeschichte und in die Psychologie mäandert und wie sie all das Kapitel für Kapitel in ein Buch verwandelt, ist ebenso faszinierend wie die grandiose Aufrichtigkeit, mit der sie ihre eigene Rolle und ihre eigenen Sehnsüchte analysiert. Am Ende weiß sie, dass sie nie ein geliebtes Kind war, aber mit ihrer Mutter wohl eines gemeinsam hatte: eine ausgeprägte Fähigkeit, Dinge mit Leben und Bedeutung zu erfüllen. Vielleicht, weil sich Dinge im Endeffekt als verlässlicher erweisen können als Beziehungen. J u l i a K o sp a c h
Susannah Walker: Was bleibt. Über die Dinge, die wir zurücklassen. Kein & Aber, 480 S., € 25,70
38
F A L T E R 4 1 / 1 8 S a c h b u c h
Ist die Kultur also wirklich schon tot? Kulturtheorie: Hannelore Schlaffer und Alexander Grau verabschieden Intellektuelle und Hochkultur
D
ie Essayreihe des Verlages zu Klampen hat zwei Neuzugänge, die mit ihren Thesen verwundern. Dabei handelt es sich um die zugespitzte Kulturgeschichte des Intellektuellen der Germanistin Hannelore Schlaffer und um ein Plädoyer für den Kulturpessimismus des Journalisten Alexander Grau. Beide Bände sind von einem erschütternd verengten Konservativismus geprägt, der beide Male eine verklärende Idealisierung des Abgelebten schon auf den ersten Seiten in Szene setzt. Bei Schlaffer liest man, der Intellektuelle, dessen „Grabrede“ sie verfassen möchte, existiere nicht mehr: „Wo auf der Straße der Mann mit der Zeitung unter dem Arm fehlt, gibt es keinen Intellektuellen mehr.“ Grau macht gleich im ersten Satz seines an Setzungen nicht armen Bändchens klar: „Der Kulturpessimismus ist tot.“ Um diese Behauptungen zu plausibilisieren, bedarf es mehr oder weniger gefinkelter methodischer Twists.
Alexander Grau: Kulturpessimismus. Ein Plädoyer. Zu Klampen, 160 S., € 16,50
Schlaffer beschreibt zwar in ihrem Vorwort die
Hannelore Schlaffer, selbst Intellektuelle mit
15 eigenständigen Buchpublikationen, begreift den Intellektuellen als ästhetisches und strukturelles Phänomen. Folgerichtig versteht sie die Inkarnation der „freischwebenden Intelligenz“ – ein Schlagwort, das Schlaffer dem Soziologen Karl Mannheim entlehnt – als über ihr provokatives und Regeln überschreitendes Verhalten definiert und nicht, wie man annehmen möchte, durch Bildung oder Profession. Sie sieht den Intellektuellen, wie schon der Untertitel ihrer „Erfolgsgeschichte“ lautet, als „Rüpel und Rebell“. Dass das eine moralische und das andere eine politische Vokabel ist, lässt auf die Verbindung der beiden Dimensionen hoffen. Diese Hoffnung wird von Schlaffer aber systematisch unterlaufen. Ihr Fokus liegt deutlich auf der gesellschaftlichen Transgression, der Provokation, der Rüpelhaftigkeit. Sie beginnt ihre Genealogie des Intellektuellen mit Diderots „Rameaus Neffe“, einer ungehobelten und höchst er-
folgreichen Romanfigur, die lebensnah nach Jean Jacques Rousseau modelliert wurde. Schlaffer gibt sich alle Mühe, Rousseaus Erfolg durch dessen unkonventionelles Auftreten im Frankreich der Aufklärung zu deuten und ihn damit in die Tradition des Zynikers Diogenes zu stellen. Freilich nannte das ausgehende 18. Jahrhundert seine Intellektuellen noch „philosophes“. Deren Translation in den deutschen Sprachraum zeichnet Schlaffer anhand von Goethes Übersetzung von „Rameaus Neffe“ nach. Der Dichterfürst gefiel sich in seiner Sturm-und-Drang-Phase wohl selbst als Enfant terrible, wie Schlaffer kundig ausführt. Goethe reiht sich bei ihr genauso in die Ahnengalerie der Intellektuellen ein wie die nonkonformistischen deutschen Studenten der Romantik, die französischen Bohemiens und der britische Ur-Dandy George Brummell.
Hannelore Schlaffer: Rüpel und Rebell. Die Erfolgsgeschichte des Intellektuellen. Zu Klampen, 192 S., € 20,60
Entstehung des Intellektuellen im Wortsinn aus der Affäre Dreyfuss 1898 und der von Émile Zola angestoßenen Empörung, die als „Manifeste des intellectuels“ in die Geschichte einging. In den Analysen spielt das späte 19. Jahrhundert genauso wie fast das gesamte 20. Jahrhundert keine Rolle mehr. Diese methodische Leerstelle, die die Figur des „public intellectual“ unter den Tisch fallen lässt, gesellt sich zu einer noch gewichtigeren Ellipse. Frauen erscheinen bei Schlaffer nie als Intellektuelle, sondern lediglich als deren struktureller Gegenpart in Form von Salondamen, Mätressen und Schauspielerinnen. Das mag tatsächlich emanzipatorisch gemeint sein, Schlaffer beschreibt die Ausweitung weiblicher Handlungsspielräume aber immer in Bezug auf deren moralische Bewertung durch (bürgerliche) Männer und unter Subtraktion ihrer geistigen – also im Wortsinn intellektuellen – Leistungen. Diese verquere Deutung gipfelt in der – aus den Tagebüchern der gehässigen
Brüder Goncourt extrapolierten – Behauptung, die Emanzipation verdanke ihren Erfolg der „Abneigung des Mannes gegen die Verantwortung für die Familie“. Alexander Grau, der 2017 die Streitschrift „Hypermoral. Die neue Lust an der Em-
pörung“ vorlegte, versteigt sich in seiner Rehabilitierung des Kulturpessimismus in ähnlich revisionistische Thesen. Er definiert Kultur, anders als der kulturwissenschaftliche Mainstream, als ein Setting von zwar veränderlichen, aber doch immer ausschließenden und Normen institutionalisierenden Handlungen und Codes. Ein solch enges und exklusives Kulturverständnis begegnete dem Rezensenten das letzte Mal in José Antonio Maravalls Standardwerk „Die Kultur des Barock“ (1975). Graus Ansicht ist aber noch weitaus radikaler: Durch den Verlust einer verbindlichen kulturellen Norm einerseits und die hedonistischen und pluralistischen Auswüchse des modernen Massenwohlstandes andererseits seien wir in die Phase der Postkultur eingetreten. Dabei ergeht sich Grau in lehrbuchhaften Zirkelschlüssen. Aus seiner Setzung, Kultur sei stets normierend und exklusiv, folgert er: „Aufgrund der spezifischen Verfasstheit von Kultur ist es ein Irrglaube anzunehmen, Kultur sei mit einer zivilisierten, humanen, sozialen Wohlstandsgesellschaft vereinbar.“ Der ganze Traktat ist durchwirkt von beißendem Ressentiment. Woher die Kränkungen rühren, die unsere hedonistische und plurale Gesellschaft dem streitbaren Philosophen derart zugefügt hat, dass er uns implizit qua Kulturverlust zu, nun ja, Barbaren stilisieren muss, wird nicht recht plastisch. Am Ende bleibt, was zu beweisen war, der Kulturpessimismus als „letzte Möglichkeit, die Würde des Menschen zu wahren“. In unserer Nachkultur wäre der Kulturpessimismus aber auch nichts anderes als rückwärtsgewandte Trauerarbeit. F l o ria n B ara n y i
ACHT RADTOUREN AUF DEM NEUEN FERNRADWEG EUROVELO.
Julia Köstenberger
Grenzenlos Radeln Die schönsten Touren zwischen Österreich und Tschechien.
Von Aigen-Schlägl, über Weitra, Gmünd, Znojmo, Laa an der Thaya und Breclav bis Hohenau. 352 Seiten, € 29,90
W: faltershop.at T: 01/536 60-928 E: service@falter.at L: in Ihrer Buchhandlung
FA LT E R V E R L A G
S a c h b u c h F A L T E R 4 1 / 1 8
39
Ist die Geschichte eine Lehrmeisterin? Philosophie: Rudolf Burger legt zur Unzeit einen überarbeiteten geschichtsphilosophischen Essay vor
A
m 17. Juli 2003 hielt Tony Blair eine Rede vor dem US-Kongress. Dabei fiel ein bemerkenswerter Satz: „Niemals gab es eine Zeit, in der die Geschichte so wenig Lehren für die Gegenwart bot wie heute.“ Rudolf Burger würde dem wohl zustimmen. Seine These lautet, dass sich aus der Geschichte gar nichts lernen lässt. Burgers Frage „Wozu Geschichte?“ ist nicht neu – sie wurde schon von Friedrich Schiller in dessen Antrittsvorlesung 1789 als Geschichtsprofessor in Jena gestellt –, und Burgers gleichnamiges Buch ist es ebenfalls nicht. Es handelt sich um die sacht überarbeitete Neuauflage eines 15 Jahre alten Essays. Beim Lesen kann man mit Erstaunen feststellen, dass Burgers Überlegungen wissenschaftlich noch immer anschlussfähig sind, während sich die Welt rundherum gehörig verändert hat.
foto: privat
Rudolf Burger erarbeitete sich in den 1990er-
Jahren seinen Ruf als Enfant terrible unter den politischen Kommentatoren des Landes. Damals fiel der Philosophieprofessor und spätere Rektor der Universität für angewandte Kunst durch seine unbändige Lust auf, den öffentlichen Diskurs gründlich gegen den Strich zu bürsten. Österreichs Außenpolitiker, allen voran Alois Mock, nannte er im Profil wegen ihrer wohlwollenden Haltung zu den Unabhängigkeitsbestrebungen Sloweniens und Kroatiens „kriegsgeile Kiebitze“. Die Institutionen des Staates, besonders der ORF mit seinem „Scharfmacherbubi“ Paul Schulmeister, seien von historisch bedingten antiserbischen Ressentiments getrieben. Im Jahr 2000 bezeichnete Burger die Demonstrationen gegen Schwarz-Blau als „antifaschistischen Karneval“, Kritikern wie Hans Rauscher richtete er aus: „Moralische Empörung ist jene Strategie, die selbst einem Idioten Würde verleiht.“ Es überrascht also nicht, wenn der notorische Krawallmacher Rudolf Burger einen
Zur Person Rudolf Burger wurde 1938 in Wien geboren, promovierte 1965 am Institut für angewandter Physik der TU Wien und habilitierte sich 1979 für Wissenschaftssoziologie. Seit 1987 Professor an der Universität für angewandte Kunst, 1995–1999 deren Direktor, emeritierte er 2007
geschichtstheoretischen Essay mit dem Postulat beginnen lässt, man könne aus dem Holocaust keine Lehren für die Gegenwart ziehen. Burger deswegen unter jene konservativen bis stramm rechten Protagonisten des deutschen Historikerstreits einzureihen, die wie Ernst Nolte über eine „Vergangenheit, die nicht vergehen will“, klagten, wäre aber voreilig. Zwar stellte Burger schon zuvor der Metapher Michael Stürmers vom „steinernen Gast aus der Vergangenheit“ seine eigene vom „mumifizierenden Gedenken“ an den Holocaust zur Seite. Doch Burgers Kritik ist so unpolitisch, wie Geschichte eben sein kann – jedenfalls ist sie nicht dadurch motiviert, einem erstarkenden Nationalismus mit historischen Argumenten das Wort zu reden. Joachim Gaucks Befund, es könne keine deutsche Identität ohne Auschwitz geben, würde Burger wohl nicht widersprechen, denn: „Jede Gemeinschaft definiert sich über eine Geschichte, die eine moralische Verpflichtung auferlegt.“ Bloß ist diese Art historischer Identität in Burgers Augen auf Sand gebaut. „Wozu Geschichte?“ ist der Versuch, Ciceros Bild von der Geschichte als Lehrmeisterin für das Leben als Phantasma zu entlarven. Dazu macht sich Burger auf einen Parforce-
Rudolf Burger: Wozu Geschichte? Eine Warnung zur rechten Zeit. Molden, 160 S., € 20,–
ritt durch die Geschichte der Geschichtswissenschaft, der an profunder philosophischer Kenntnis und Gelehrsamkeit kaum zu überbieten ist. Leicht verdaulich ist das nicht. In irrwitzigem Tempo springt Burger von Hegel und Marx zu Nietzsche, Karl Löwith, Theodor W. Adorno und wieder zurück. Bei Giambattista Vico verweilt Burger länger – den Überlegungen dieses neuzeitlichen Vaters der Geschichtsphilosophie widmet er ein ganzes Kapitel. Rudolf Burgers Überlegungen kreisen um das zentrale Axiom, dass „die Geschichte“ als Summe vergangenen Geschehens grundsätzlich unzugänglich ist. Geschich-
te, das ist für Burger eine grobe Verallgemeinerung, unter der alle denkbaren Vorstellungen über Vergangenheit zusammengefasst werden sollen. Ein Ding der Unmöglichkeit, „denn selbst die unmittelbare, sinnliche Gegenwart, die doch unbestreitbar da ist in ihrer prallen Faktizität, wird von jedem Menschen perspektivisch anders erlebt – und deshalb streiten sie. Und da sollten sie sich je einig werden über die Vergangenheit, die noch dazu voller Löcher ist?“ Darum, so Burger, tauge die Geschichte nicht als Lehrerin. „Die Geschichte rechtfertigt, was immer man will. Sie lehrt schlechterdings nichts, denn es gibt nichts, was sich mit ihr nicht belegen ließe.“ In dieser Schlussfolgerung Burgers liegt eine große Gefahr. In Zeiten, da Revisionismus, Relativierung und
Geschichtsleugnung in Europa fröhliche Urstände feiern, wird philosophisch fundierter Nihilismus – und sei er noch so gelehrt – zum moralischen Defätismus. Was vor 15 Jahren als intellektuelle Spielerei durchgehen mochte, ist heute blanke Provokation. Dass die Geschichte unterschiedliche Perspektiven zulässt, heißt schließlich noch lange nicht, dass jede dieser Sichtweisen gleichermaßen nützlich oder dem Zusammenhalt freier Gesellschaften zuträglich ist. Insofern wirkt der Essay des Philosophen, der im Dezember seinen 80. Geburtstag feiert, wie aus der Zeit gefallen, ist ein ungemein gelehrtes, aber kein kluges Buch. Burgers Text ist keineswegs, wie im Untertitel behauptet, eine „Warnung zur rechten Zeit“, sondern kommt gerade zur Unzeit. Soll man das also (wieder) lesen? Schon. Die intellektuelle Qualität von Burgers Essay macht ihn jedenfalls als Reibebaum lesenswert. Aber muss man auch Burgers Schlüssen folgen, während zur selben Zeit Nazis wieder auf deutschen Straßen marschieren? Bestimmt nicht – dafür steht zu viel auf dem Spiel. Thomas Wal ach
Buchtipp von:
David Fuchs erzählt die Geschichte einer Wiederbegegnung im Angesicht des Abschieds und zeigt, dass die großen Gefühle in den kleinen Gesten stecken: zärtlich, mitunter zum Schmunzeln – und lange nachhallend. »ein berührendes, ungewöhnliches Buch« ORF
216 Seiten, fest gebunden mit Schutzumschlag EUR 19.90, ISBN 978-3-7099-3433-3
Buy local! Eine Aktion der ARGE Österreichische Privatverlage und unabhängiger Wiener Buchhandlungen inserat_fuchs.indd 1
25.09.18 14:00
40
F A L T E R 4 1 / 1 8 S a c h b u c h
Der Experte als Star und Sündenbock Medienkultur: Caspar Hirschi seziert messerscharf die Rollen- und Loyalitätskonflikte von Experten
»
Der Kritiker ist verstummt, der Experte hingegen omnipräsent
Für Hirschi bedeutet das Gericht die ent-
Dieser Loyalitätskonflikt ist für Hirschi kei-
ne italienische Besonderheit. Was passiert, wenn ein Experte „dickköpfig“ ist, demonstriert er im ersten Kapitel am Fall des Neuropsychopharmakologen David Nutt. Seit Oktober 2008 saß er der Beratungskommission der britischen Regierung zu Drogenmissbrauch vor. Er klassifizierte Rauschmittel hinsichtlich ihrer Schädlichkeit für den Körper. Alkohol und Tabak reihte er ganz nach vorne, Cannabis, LSD und Ecstasy nach hinten. Dies trug ihm den Vorwurf der Verharmlosung von Drogen ein –
und jenen des Vertrauensbruchs. Man könne nicht gleichzeitig für und gegen die Regierung arbeiten. Im Herbst 2009 musste Nutt zurücktreten. Hirschi geht es in seinen Analysen nicht um Schuldzuweisungen, sondern um die Handlungslogiken der beteiligten Akteure. Und die liegen nun einmal prinzipiell quer zueinander. Journalisten wollen Schlagzeilen, Forscher sehen sich nur der wissenschaftlichen Erkenntnis verpflichtet – und Politiker legitimieren das eigene Tun gerne mit Gutachten, wollen aber bitte das letzte Wort für sich haben. Diese latent stets vorhandenen Rollenkonflikte des Experten zeigen sich dann in aller Schärfe, wenn es knallt. Das Buch heißt daher auch folgerichtig: „Skandalexperten, Expertenskandale“. Der Untertitel lautet „Zur Geschichte eines Gegenwartsproblems“, denn der Anspruch des Schweizer Historikers Hirschi ist es, den Aufstieg des Experten ins Zentrum der politischen Macht nachzuzeichnen und zu hinterfragen. Die zentralen Kapitel des Buches liefern freilich keine Weltgeschichte des Experten, sondern vier Fallstudien aus der französischen Rechtsgeschichte.
Caspar Hirschi: Skandalexperten, Expertenskandale. Zur Geschichte eines Gegenwartsproblems. Matthes & Seitz, 246 S., € 28,80
scheidende Bühne für die Herausbildung des modernen Experten seit dem Ende des 17. Jahrhunderts. Keine Sorge, das ist spannender zu lesen, als es klingt. Denn auch hier geht es wieder um Skandale, nicht zuletzt um die beiden wohl berühmtesten Prozesse des 18. und des 19. Jahrhunderts, den Fall Jean Calas und die Dreyfus-Affäre. In den Augen der Nachwelt erzählen diese Prozesse in erster Linie von den Heldentaten Voltaires und Émile Zolas, die unschuldig Angeklagte rehabilitierten und kraft ihrer spitzen Feder Fanatismus und Unvernunft in die Schranken wiesen, Voltaire mit seinen Breitseiten gegen die katholische Kirche, Zola gegen das antisemitische Lager der Dritten Republik („J’accuse!“).
In beiden Gerichtsverfahren – und daran erinnert Hirschi – spielten aber Gutachter eine zentrale Rolle, und zwar Mediziner: Hatte der Sohn von Jean Calas sich erhängt oder war er stranguliert worden? Und Handschriftenkundler: War Dreyfus der Verfasser einer verräterischen Notiz? Und damit ein Spion? Voltaire und Zola gewannen die öffentli-
che Debatte, weil sie Meister der PR waren und Experten für ihre eigenen Kampagnen punktgenau einzusetzen wussten. Hirschi heroisiert Voltaire und Zola nicht. Aber er bedauert wohl, dass es diesen Typen des scharfzüngigen Intellektuellen in dieser Form heute nicht mehr gibt. Der Kritiker ist verstummt, der Experte hingegen omnipräsent. Er sitzt in allen Gremien und hat das Ohr der Medien. Sein Aufstieg in die obersten Entscheidungsebenen hat ihn gleichzeitig aber entscheidend geschwächt. Die Abhängigkeit des Experten von der politischen Macht ist so stark geworden, dass er die Rolle des Kritikers nicht mehr einzunehmen vermag. Er genießt das Rampenlicht, wird aber doch nur instrumentalisiert. Gleich ob sie sich loyal verhalten (wie die Seismologen) oder ihren Überzeugungen treu bleiben (wie David Nutt), auf dem Schleudersitz nehmen immer die Experten Platz. Politiker haben einen idealen Mechanismus gefunden, um Verantwortung abzuschieben. Hirschi spricht von der „umfassenden Disziplinierung der wissenschaftlichen Praxis durch die Politik“. Wichtige Debatten finden hinter verschlossenen Türen statt, Kritik verpufft, Experten sind gefangen in einer „Kooperations- und Konsenskultur“, es fehlt an Öffentlichkeit und Transparenz. Dies spielt letztlich dem Populismus in die Hände, mahnt Hirschi. Ausweg? Kritiker und Experte müssen wieder zueinanderfinden. O l i ver H och a del
Illustr ation: georg feierfeil
D
as letzte Kapitel beginnt mit einem doppelten Erdbeben. Einem realen, das am frühen Morgen des 6. April 2009 das Abruzzenstädtchen L’Aquila erschütterte und über 300 Menschenleben forderte. Und einem medialen, in dem dreieinhalb Jahre später sechs Experten und ein Ex-Regierungsbeamter zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt wurden. Wissenschaftler und Medien echauffierten sich weltweit: Niemand könne Erdbeben vorhersagen. Ein Missverständnis, wie Caspar Hirschi klarstellt. Die italienischen Seismologen wurden verurteilt, weil sie die Bewohner von L’Aquila nicht über die (an sich geringen, aber doch, wie sich zeigte, vorhandenen) Risiken aufgeklärt hatten. Sie hatten geschwiegen, als ein Regierungsbeamter eine Woche vor der Katastrophe vor einer Pressekonferenz erklärte, ein verheerendes Beben sei trotz der monatelang andauernden seismischen Aktivität ausgeschlossen. Hirschi interessiert sich für den Loyalitätskonflikt, in dem Experten gefangen sind. Als Klienten sind sie ihren Patronen verpflichtet, also jenen Politikern, die sie berufen haben. Als Experten sind sie aber dem Gemeinwohl verpflichtet. Durch ihr Schweigen ließen sie sich zum Feigenblatt der Beschwichtigungsstrategie der italienischen Zivilschutzbehörde machen, die „Panikmache“ verhindern wollte.
S a c h b u c h F A L T E R 4 1 / 1 8
41
Die Erfindung der Authentizität und der Altstadt Kulturgeschichte: Valentin Groebner folgt den Authentizitätsversprechen des Geschichtstourismus vom Mittelalter bis heute er war der erste Tourist? Gemeinhin wird die Geburt des „moderW nen“ Fremdenverkehrswesens auf die Mit-
te des 19. Jahrhunderts datiert. Für Valentin Groebner geht es aber bereits im Spätmittelalter los. Weil für christliche Pilger eine Wallfahrt ins Heilige Land immer gefährlicher wurde, kamen pfiffige Mönche in Norditalien auf die Idee, in ihren Klöstern die biblischen Stätten einfach nachzubauen. „Sacri Monti“ heißen jene Ensembles von Kapellen, in denen etwa der Besuch der Heiligen Drei Könige und das Heilige Grab bildmächtig nachgestellt werden: zum Anbeten, aber auch zum Anfassen. Der große Andrang der Gläubigen löste einen Kapellenbauboom aus.
»
Die unberührte Idylle von früher, die (...) so viele Reisende so schmerzlich vermissen, hat es nur im Nachhinein gegeben Zentrale Merkmale des Tourismus, das An-
werfen einer Bildermaschine, das Versprechen des Authentischen („echte Nachbildungen“), das bewusste Produzieren von „unvergesslichen“ Erinnerungen, das „persönliche“ Eintauchen in Geschichte – all diese Elemente findet Groebner schon an der Schwelle zur Neuzeit. Tourismus als Gegenstand kulturwissenschaftlicher Analyse hat derzeit Konjunktur. Marco d’Eramos „Die Welt im Selfie“ (2018) etwa zeigt eindrücklich die verheerenden Folgen des Massentourismus. Groebner interessiert sich in „Retroland“ für etwas anderes, für „Geschichtstourismus und die Sehnsucht nach dem Authentischen“, so der Untertitel. Groebner ist Mediävist und läuft zu großer Form auf, wenn er die Mittelalterbegeisterung des 19. Jahrhunderts erklärt, etwa am Beispiel Luzerns. Der „mittelalterliche Stadtkern“, den wir heute in vielen Städten bewundern dürfen, ist in aller Regel eine Konstruktion des 19. Jahrhunderts – und das ist nun keinesfalls metaphorisch gemeint. Einerseits konnte es den Luzerner Bürgern nicht schnell genug gehen, Stadtmauern und -türme abzureißen und rabiat enge Gässchen zu verbreitern, um der Stadt ein modernes Antlitz zu verpassen.
Valentin Groebner: Retroland. Geschichtstourismus und die Sehnsucht nach dem Authentischen. S. Fischer, 219 S., € 20,60
Selbst die heute so berühmte Kapellbrücke wurde verkürzt. Anderseits erwachte aber ein historisches Gespür für die eigene Geschichte und damit das Gefühl eines unwiederbringlichen Verlusts, gerade auch im Zusammenhang mit dem beginnenden Tourismus am Vierwaldstätter See. Denn die immer zahlreicher werdenden Besucher verlangten nach „Authentischem“. Groebner konstatiert ein scheinbares Para-
dox: „Je schneller Luzern sich modernisierte, desto historischer wurde seine Altstadt.“ Das 19. Jahrhundert erfindet sich sein eigenes, zauberhaftes Mittelalter – Stichwort: Neuschwanstein –, und das prägt unser eigenes Bild bis heute. Die berühmten Dämonenskulpturen, die die Außenfassade von Notre-Dame in Paris zieren, stammen aus den 1840er-Jahren – inspiriert von Victor Hugos „Der Glöckner von Notre-Dame“. Nicht alles ist neu an diesem Buch. „Retroland“ ist auch nicht frei von Wiederholungen, wohl auch, weil einige der Kapitel schon zuvor als eigenständige Aufsätze publiziert worden sind. Und auch wenn Groebner grob chronologisch vorgeht, von den Sacri Monti bis zu den weißen Sandstränden im Reisekatalog von heute, kreist seine Argumentation doch immer um dieselben Themen: Geschichte als Performance und pittoresker Erlebnispark, als persönliche Aneignung historischen Materials, das sich als unendlich formbar erweist, als ewiges Versprechen auf authentisches Erleben, das sich bei näherem Hinsehen als durch und durch konstruiert erweist. Seine Beispiele sind eher zufällig gewählt, wie Groebner freimütig zugibt. Sie entstammen seinen persönlichen Vorlieben und Lektüren, seinem Wohnort (er ist Professor in Luzern) und seinen bevorzugten Reisezielen. „Retroland“ glänzt eher durch die Fülle an witzigen Details, gut erzählte kleine Geschichten und pointierte Formulierungen als durch eine systematische Analyse. „Die unberührte Idylle von früher, die (...) so viele Reisende so schmerzlich vermis-
sen, hat es nur im Nachhinein gegeben.“ Groebners Begriff des Geschichtstourismus bleibt letztlich schwammig. Viele seiner Beispiele haben eher mit der Konstruktion nationaler Identitäten zu tun als mit selfiesüchtigen Touristen, die sich gezielt auf die Suche nach künftigen Erinnerungen machen. Groebner zeigt, wie die „Erfindung von Traditionen“ den Schweizern und anderen Nationen zur kollektiven Selbstvergewisserung dient, die stets neu mit Leben zu füllen ist. Zu diesen Ursprungsgeschichten zählt das aufwendige Nachstellen „historischer“ Schlachten am „Originalschauplatz“, auch wenn man etwa über die Schlacht von Morgarten von 1315 praktisch nichts Gesichertes weiß. Auch streift der Autor nicht nur durch die Jahrhunderte, sondern auch durch die Gegenwart, kraxelt die Alpen hoch und runter, wandelt an Mittelmeerküsten entlang und genießt die Traumstrände Sri Lankas. Er zeigt, dass der Tourismus überall Sehnsuchtsorte und -landschaften produziert (das „Paradies“), immer wieder mit dem Authentischen lockt, das nun endgültig am Verschwinden sei. Aber fällt alles dies unter „Geschichtstourismus“? Oder ist das nicht einfach nur Tourismus? Sei’s drum. Das intellektuelle Lesevergnügen wird durch die mangelnde Begriffsschärfe kaum beeinträchtigt. Groebner schreibt unterhaltsam, anschaulich und auch persönlich. Zwar stellt sich mitunter ein ironischer Unterton angesichts der absurd anmutenden Verheißungen der Tourismusindustrie wie von selbst ein, Groebner macht sich aber bewusst nicht lustig über die Endlosschleife vermeintlich authentischer Inszenierungen. Jeglicher Überlegenheitsdünkel sei fehl am Platz, mahnt er. Nur wenn man all die Geschichtsklitterungen und -erfindungen ernst nimmt, werden die Sehnsüchte des Touristen sichtbar, so trivial die auch sein mögen. Wir leben alle in Banalistan. O l i ver H o c ha d e l
Buchhandlung empfiehlt: Maria Walcher · Edith A. Weinlich: Ein Erbe für alle Gebunden, € (D/A / I) 36,– ISBN 978-3-85256-767-9 Erstverkaufstag: 30. Oktober EKAZENT Hietzing G14 1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 22 tel. 01/8776102, fax 01/8776125 - 20 ekazent@buchhandlung-bestseller.at Motorbox im Ekazent Hietzing G14, UG 1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 22 tel. 01/8776125, fax 01/8776125 - 20 motorbox@buchhandlung-bestseller.at
LEBENDIGE TRADITION IN ÖSTERREICH Warum ist der Walzer ein Wiener? Was ist das Geheimnis des Blaudruckers? Wo wird das älteste Erntedankfest gefeiert? Wie viele Masken braucht die Imster Fasnacht? Welche Ernterechte verlost Galtür?
WIEN · BOZEN WWW.FOLIOVERLAG.COM
Mo – Fr 9 – 18 Uhr, Sa 9 – 17 Uhr
Buy local! Eine Aktion der ARGE Österreichische Privatverlage und unabhängiger Wiener Buchhandlungen Falter_Erbe für alle_216x95 blau.indd 1
17.09.18 12:11
42 â&#x20AC;&#x192;
F A L T E R â&#x20AC;&#x160; 4 1 / 1 8 â&#x20AC;&#x192;â&#x20AC;&#x201A; S a c h b u c h
â&#x20AC;&#x17E;Sie kĂśnnen einfach machen, was Sie wollenâ&#x20AC;&#x153; Literaturbetrieb: Andreas Thalmayr alias Hans-Magnus Enzensberger gibt Schreibtipps fĂźr angehende Autoren s existieren inzwischen unzählige E Schreibschulen und nicht zuletzt eine FĂźlle von BĂźchern fĂźr angehende Schrift-
steller. Manche konzentrieren sich mehr aufs Handwerk, andere auf Ratschläge zu Agenten- oder Verlagssuche. Zu â&#x20AC;&#x17E;Schreiben fĂźr ewige Anfängerâ&#x20AC;&#x153; werden in der nächsten Zeit in Buchhandlungen mit Gewissheit einige Interessierte greifen, allein wegen des schmalen Umfangs und des Preises. Sie seien dreifach vorgewarnt: a) ist dieses Buch eine charmante Mogelpackung, b) werden angehende Literaturnobelpreisträger so manches von dem, was drinsteht, lieber nicht wissen wollen, c) macht jedoch gerade das die LektĂźre, die in zwei, drei Stunden erledigt ist, zu einer lohnenden. Ein weiteres Argument fĂźr das Buch ist, dass es von einem mit allen Wassern des Literaturbetriebs gewaschenen Profi geschrieben wurde. Andreas Thalmayr, nie gehĂśrt? Von ihm
stammt immerhin ein geheimer Klassiker der deutschen Literatur wie der Germanistik. Mit â&#x20AC;&#x17E;Das Wasserzeichen der Poesie oder Die Kunst und das VergnĂźgen, Gedichte zu lesenâ&#x20AC;&#x153; verĂśffentlichte er 1985 einen groĂ&#x;artigen Lyrik-VerfĂźhrer. 2004 folgte als Nachschrift dazu der Band â&#x20AC;&#x17E;Lyrik nervt! Ein Erste-Hilfe-Buch fĂźr alle, die meinen, dass sie nichts mit Gedichten anfangen kĂśnnenâ&#x20AC;&#x153;. Tatsächlich ist der Name
Thalmayr ein Pseudonym, dahinter verbirgt sich mit Hans-Magnus Enzensberger eine der groĂ&#x;en deutschen AutorenpersĂśnlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Enzensberger blickt mittlerweile Ăźber eine mehr als 60 Jahre umspannende Karriere als Autor, Redakteur, Herausgeber, Ă&#x153;bersetzer und Verleger zurĂźck und hat in allen Genres mitgemischt, Romane, Gedichtbände, Essays, Dramen, HĂśrspiele, Kinder- und JugendbĂźcher und noch manches mehr geschrieben. Dass er als â&#x20AC;&#x17E;ewiger Anfängerâ&#x20AC;&#x153; im Alter von fast 89 Jahren keinen systematischen Leitfaden mehr verfasst hat, liegt auf der Hand. Das BĂźchlein ist im Plauderton verfasst und besteht aus Briefen an einen jungen Kollegen, der ihn um Rat gefragt hat. Als Bonustracks kommen noch kurze Texte von Christoph Martin Wieland, Mario Vargas Llosa und Danilo KiĹĄ dazu. FĂźr wichtig erachtet er zunächst, sich als Autor nicht allein auf die Prosa zu konzentrieren. â&#x20AC;&#x17E;Mut zum Unerheblichenâ&#x20AC;&#x153; wĂźnscht er seinem jungen Kollegen. Damit meint er in erster Linie Lyrik. Wie man schreiben soll, verrät er nicht. Schreiben lässt sich nur durch beständiges Lesen und Schreiben erlernen, heiĂ&#x;t es einmal sinngemäĂ&#x;, die diversen Literaturinstitute betrachtet Thalmayr mit Skepsis. Da es sich bei seinem Adressaten um einen Autor handelt, der bereits ein Buch verĂśffentlicht hat, geht es vor allem darum, wie es sich als Autor
Âť
Schreiben lässt sich nur durch beständiges Lesen und Schreiben erlernen
Andreas Thalmayr: Schreiben fĂźr ewige Anfänger. Ein kurzer Lehrgang. Hanser, 112 S., â&#x201A;Ź 16,50
ßberleben lässt. Viele Ausfßhrungen drehen sich ums Geld, um Urheberrechte und den Fiskus etwa. Thalmayr fßhrt aus, dass das Buch allein den Autor nur in den seltensten Fällen ernähren wird, so viel es ihm auch bedeuten mag. Lesungen kÜnnen mitunter hßbsche Honorare einbringen. Vorträge und Diskussionen solle man nicht liegen lassen. Wem das nicht liege, der mßsse sich rar machen und versuchen, seine Texte mÜglichst teuer zu verkaufen. Was aber, wenn sich eine Durststrecke ergibt?
Dann ist es fĂźr den freien Schriftsteller womĂśglich nur ein schwacher Trost, irgendwann einen von den hunderten jährlich vergebenen Literaturpreisen zu bekommen. Dann hilft nur noch positives Denken: â&#x20AC;&#x17E;Niemand kann Sie entlassen oder mit sechzig in die Rente schicken. Seien Sie froh, dass der Staat Sie, abgesehen von den FinanzbehĂśrden, in Ruhe lässt. (â&#x20AC;Ś) Sie kĂśnnen einfach machen, was Sie wollen. Beneidenswert!â&#x20AC;&#x153; Einiges von dem, was Thalmayr mit Lässigkeit und Elan ausfĂźhrt, wird der Leser nicht zum ersten Mal hĂśren. Viele Fragen lässt der schmale Band auch unbeantwortet. En passant ergibt sich beim Lesen am Ende aber doch ein Bild davon, wie der Literaturbetrieb funktioniert: welche Chancen sie haben und vor allem mit welchen Schwierigkeiten sie rechnen sollten. S e b ast i an F asth u b e r
Der kampfbereite Mensch und die hÜheren Sphären Sport: Ernst Peter Fischer legt eine Geschichte des Sports voller krauser Theorien vor und scheitert fundamental rnst Peter Fischer braucht bis SeiE te 79, um sein historisches Verständnis des Sports zu formulieren.
â&#x20AC;&#x17E;Klar und unbestritten ist auf jeden Fall, dass das Zusammentreffen und Kräftemessen von Athleten in Olympia nicht nur aus der kampfbereiten Natur des Menschen zu erklären ist, sondern sich einem Ursprung aus hĂśheren Sphären verdankt.â&#x20AC;&#x153; Der Wissenschaftshistoriker wollte eine Geschichte des Sports verfassen, herausgekommen ist ein Sammelsurium von Anekdoten, Gemeinplätzen und Geschichten aus dem Leben des Autors. Dazu kommen hier noch eine Prise Anthropologie, da ein paar LĂśffel Biologie.
Die BĂźcherhexen aus der
Fischer kann alles erklären. Er lĂśst sogar das Rätsel des Wembley-Tores, hat er doch das WM-Finale 1966 zwischen England und Deutschland im Wirtshaus verfolgt. Die Jäger und Sammler kannte er zwar nicht persĂśnlich, aber er weiĂ&#x; um die Sehnsucht des kĂźrzlich sesshaft gewordenen Menschen nach Sport, weil diesem das Werfen und Laufen so sehr fehlte. So geht es im argumentativen Nahkampf dahin, vom â&#x20AC;&#x17E;Sportâ&#x20AC;&#x153; der frĂźhen Steinzeit bis zu den Olympischen Spielen des 21. Jahrhunderts. Die Faszination Olympias? Klare Sache: Kein anderes Ereignis konnte es â&#x20AC;&#x17E;an Dramatik mit dem Sterben eines Athleten aufnehmenâ&#x20AC;&#x153;. Fischer weiĂ&#x;,
was die Zuseher vor 2500 Jahren dachten und fĂźhlten, wenn sie die Kämpfer beim manchmal tĂśdlichen Pankration, einer Verbindung von Ring- und Boxkampf, beobachteten. Aber die â&#x20AC;&#x17E;kampfbereite Naturâ&#x20AC;&#x153; des Menschen ist, so der â&#x20AC;&#x17E;Anthropologeâ&#x20AC;&#x153; Fischer, fĂźr Signale aus â&#x20AC;&#x17E;hĂśheren Sphärenâ&#x20AC;&#x153; empfänglich. Der Mitorganisator von Hitlers Sommerspielen 1936 in Berlin, Carl Diem, und dessen â&#x20AC;&#x17E;Weltgeschichte des Sportsâ&#x20AC;&#x153; (1960) gelten Fischer als Referenz fĂźr die griechische Sportgeschichte. Die Verwicklung Diems in das NS-Regime spricht Fischer nicht einmal an.
Frei von historisch-kritischem Zwang
sich Fischer quer durch die
pflĂźckt Jahrhunderte und Disziplinen her aus, was er gerade findet. NaturphiMo â&#x20AC;&#x201C; Fr: 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.00
Mo â&#x20AC;&#x201C; Fr: 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.00 Sa: 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 12.30 Sa: 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 12.30
â&#x20AC;&#x201C; 18.00 empfehlen! MoSa:â&#x20AC;&#x201C; Fr:9.009.00â&#x20AC;&#x201C; 12.30 Monur â&#x20AC;&#x201C; Fr:BĂźcher, 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.00 Nicht sondern Sa: 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 12.30 auch unsere monatlichen Lesungen:
Die nächste findet am 20.10. statt.
www.buecherstube.biz | GymnasiumstraĂ&#x;e 58, 1190 Wien
losophie vermanscht er mit Genetik und unterstellt einen quasi-kausalen Plan und Ablauf der Geschichte, indem er aktuelle Phänomene mit dem Verweis auf alte bis uralte Abläufe â&#x20AC;&#x17E;erklärtâ&#x20AC;&#x153;. Die Methode seiner Erkenntnisse oder ein theoretischer Ă&#x153;berbau sind nicht zu erkennen. Er bramarbasiert Ăźber die Evolution und schildert, wie der Mensch Gott sein Leben aus der Hand nahm. Einfach so. Das olympische Motto â&#x20AC;&#x17E;Schneller, hĂśher, stärkerâ&#x20AC;&#x153; steckt laut Fischer â&#x20AC;&#x17E;tief
in der Natur des Menschenâ&#x20AC;&#x153;. Und die Evolution hat ihren GeschĂśpfen diesen â&#x20AC;&#x17E;Willen zum Fortschreiten und dieses Verlangen nach Mehr eingeschriebenâ&#x20AC;&#x153;. Kann es sein, dass da wer die Evolution nicht kapiert hat? Stellenweise wird es richtig bĂśse. Fischer zitiert den Anthropologen Gilberto Freyre als Beleg, dass im FuĂ&#x;ball wie in der Politik â&#x20AC;&#x17E;Schmiegsamkeit das Kennzeichen des brasilianischen Mulattenâ&#x20AC;&#x153; sei. Freyres Buch â&#x20AC;&#x17E;Herrenhaus und SklavenhĂźtteâ&#x20AC;&#x153; von 1933 argumentierte Ăźbrigens, die Sklaverei sei im â&#x20AC;&#x17E;groĂ&#x;artigen Projektâ&#x20AC;&#x153; der Portugiesen notwendig fĂźr die Zivilisierung Brasiliens gewesen. Quellenkritik? Keine. Fischer schrieb insgesamt an die 70 BĂźcher, davon allein fĂźnf im Jahr 2017. Mit diesem strapaziert er die Geduld des Lesers Ăźber alle MaĂ&#x;en â&#x20AC;&#x201C; und fordert seine Kampfbereitschaft heraus. J o H A N N S K O C E K
Ernst Peter Fischer: Erster sein. Die Natur des Menschen und die Kultur des Sports. Edition Zeitblende, 352 S., â&#x201A;Ź 40,â&#x20AC;&#x201C;
S a c h b u c h F A L T E R 4 1 / 1 8
43
Die Äpfel und Birnen der Anerkennung Philosophie: Axel Honneth liefert ein eher akademisches Close Reading zum Anerkennungsbegriff
Ausgangspunkt und Leitlinie der Studie ist die These, dass die Konzepte der Anerkennung in Frankreich, Großbritannien, und Deutschland von Beginn an unterschiedlich akzentuiert sind und das auch bis ins 20. Jahrhundert so bleibt
Ausgangspunkt und Leitlinie der Studie ist
die These, dass die Konzepte der Anerkennung aus sozialhistorischen Gründen in den drei Ländern von Beginn an unterschiedlich akzentuiert sind und das auch bis ins 20. Jahrhundert so bleibt. In der französischen Ideengeschichte war „Anerkennung“ etwa von Anfang an stark negativ besetzt. Bereits beim Herzog La Rochefoucauld (1613–1680), der den Moralisten zugerechnet wird, fände sich jene „negative Anthropologie“ vorgebildet, die sich ein Jahrhundert später beim Genfer Kollegen Rousseau in der Unterscheidung zwischen „amour de soi“ und „amour propre“ manifestiert. Übersetzt bedeutet beides so viel wie „Selbstliebe“, allerdings schließt nur Letzteres das Bedürfnis mit ein, die eigenen Verdienste mögen von den anderen anerkannt und bestätigt werden. La Rochefoucauld und in der Folge Rousseau gehen davon aus, dass der Mensch aus Eitelkeit und Geltungsdrang prinzipiell besser dastehen möchte, als er ist. Den sozialgeschichtlichen Hintergrund dafür bildet, so Honneth, das Erodieren der feudalen Ständeordnung, was im zentralistischen Frankreich des 17. Jahrhunderts zu einem Wettstreit um die Gunst des königlichen Hofes führte, an dem sich nun „nicht mehr nur die Mitglieder der weitgehend machtlos gewordenen Aristokratie (beteiligten), sondern auch die der aufsteigenden Bourgeoisie“.
Kant mit seinem Kategorischen Imperativ für eine transzendentale Wende, indem er die Anerkennung des anderen zur Voraussetzung für die Selbstbestimmung des Subjekts als intelligibles Wesen macht. Fichte wiederum sieht die wechselseitige Anerkennung über einen Sprechakt („Aufforderung“) gestiftet und nimmt auf diese Weise die Diskursethik des 20. Jahrhunderts (Karl-Otto Apel, Habermas) vorweg. Und Hegel schließlich sorgt durch eine Historisierung und Institutionalisierung des
K L AUS NÜCHTERN
»Commander an Logbuch: Wir stoßen vor in die unendlichen Weiten des Alters!« Wie geht man (um nicht zu sagen: Mann) damit um, dass das Arbeitsleben endet, man sich aber viel zu jung fühlt, um zum alten Eisen zu gehören?
Das Angewiesensein auf die Bestätigung
durch andere aber entfacht bei den Anerkennungsdenkern der französischen Linie, zu denen Honneth auch noch Sartre, Althusser und Judith Butler zählt, die Furcht vor einer drohenden Selbstentfremdung. Denn wenn ich mich, um vor den Augen der anderen zu bestehen, entsprechend verhalte und inszeniere, werde ich eines Tages selbst nicht mehr wissen, wer ich „wirklich“ bin. Diese Sichtweise ist der schottischen Aufklärung – Honneth ruft David Hume und Adam Smith als Kronzeugen auf – voll-
Im deutschen Idealismus sorgt Immanuel
Anerkennungsbegriffs dafür, dass das abstrakte Subjekt auch Fleisch auf die abstrakten Knochen gepackt bekommt. So weit, so gut. Wenn Honneth nach diesem Vergleich von Äpfeln mit Birnen abschließend über eine mögliche Synthese nachdenkt und zu dem Schluss kommt, dass Hegel besser etwas mehr Hume in seinen Tank getan hätte, ist das zwar nachvollziehbar, man beginnt sich aber auch die Frage zu stellen, was das mit den Anerkennungsdebatten der Gegenwart zu tun hat. Abgesehen davon wäre es selbst aus einer rein ideengeschichtlichen Perspektive interessant gewesen, zu erfahren, welche Wege die Höhenkammdiskurse der Philosophie genommen haben, bis sie bewohntes Gebiet erreicht und sich institutionell verfestigt haben, ins Bewusstsein der Gesellschaft vorgedrungen sind. Das Buch beruht auf Honneths Vorlesungen von 2017 an der University of Cambridge. Das merkt man ihm auch an. All die Rückblicke und Rekapitulationen, Vorausschauen und Vorhabensbekundungen mögen im Hörsaal hilfreich sein, in gedruckter Form entfaltet der Schotter der Selbstreflexion, den der Denkfluss mit sich schiebt, eher bremsende Wirkung bei der Lektüre dieses philosophiehistorischen Close Reading, das man dennoch mit Gewinn liest.
groothuis.de
»
kommen fremd, der Begriff der „sympathy“ im Gegensatz zu dem der „amour propre“ ausschließlich positiv besetzt. Im Gegensatz zu Rousseau stellt für Hume der als unparteiische Instanz internalisierte Beobachter keine Gefahr, sondern die Voraussetzung allen moralischen Handels dar: „Anerkennung heißt hier (…), einem anderen Subjekt den normativen Status einzuräumen, uns durch Billigung oder Tadel über die moralische Angemessenheit unserer eigenen Verhaltensweisen zu belehren“. Honneth deutet diese Haltung – nicht zuletzt bei dem als Freier-Markt-Apologeten missverstandenen Adam Smith! – als Widerstand gegen eine durch den Kapitalismus beförderte besitzegoistische Überformung der Gesellschaft.
Axel Honneth: Anerkennung. Eine europäische Ideengeschichte. Suhrkamp, 238 S., € 25,60
Das neue Buch des langjährigen SPIEGEL-Redakteurs und Bestsellerautors Dieter Bednarz ist ein Aufruf an alle Leserinnen und Leser in der Lebensmitte: Wer zu jung ist, um alt zu sein, ist auf jeden Fall nicht zu alt, um neu anzufangen! Erhältlich in jeder Buchhandlung! www.edition-koerber.de
Foto: Claudia Höhne
N
iemand wird bestreiten, dass die Frage der Anerkennung ein aktuelles und relevantes Thema ist. Sobald man aber näher zu bestimmen sucht, was damit überhaupt gemeint sein soll, wird man schnell erkennen, wie vielschichtig und facettenreich dieser Begriff ist. Der vielstrapazierte Begriff der „Wertschätzung“ etwa beschränkt sich ja nicht auf die Zuerkennung eines Status im juridischen Sinne, sondern meldet Anspruch darauf an, als besonders wert- oder verdienstvolles Individuum wahrgenommen zu werden. Der deutsche Sozialphilosoph Axel Honneth ist der Anerkennungsauskenner schlechthin. Mit „Kampf um Anerkennung“ habilitierte er sich 1990 bei Jürgen Habermas, und das Thema hat ihn seitdem nicht mehr losgelassen. Nun legt er ein Buch mit dem schlichten Titel „Anerkennung“ vor. Im Untertitel ist es als „Eine europäische Ideengeschichte“ ausgewiesen, wobei der Kontinent auf Frankreich, Großbritannien und Deutschland zusammenschrumpft, was Honneth damit begründet, dass die relevanten politisch-philosophischen Diskurse fast alle in den jeweiligen Sprachen erschienen seien.
ISBN 978-3-89684-265-7 272 Seiten Gebunden mit Schutzumschlag € 19,– (D) | € 19,60 (A) SFr. 27,50
44
F A L T E R 4 1 / 1 8 S a c h b u c h
Man kann nur Ökologie: Drei Bücher werben für
W
»
Ein emotionaler Naturbezug ist für jegliche wirksame Naturpolitik, die Anhänger mobilisieren muss, unentbehrlich J en s S o en t g en
as manchen heute der Wolf ist, das war einst der Wal: Er galt als Inbegriff des Bösen schlechthin, als gefährliches Monster, das den Tod verdient. „Moby-Dick“ erzählt vom Hass Kapitäns Ahab auf einen weißen Pottwal. Außer seinem schlechten Image hatte der Wal noch das Pech, eine Art schwimmendes Rohstofflager zu sein: Nicht nur zu Kerzen und Seifen kann man ihn verwerten, sondern auch Nitroglyzerin aus ihm kochen: für Sprengstoff. Die Ausrottung der Wale schien bereits besiegelt. Doch dann kamen die Meeresforscher und spielten den Menschen Walgesänge vor. Wir konnten hören, wie die Wale richtige musikalische Einheiten, Strophen und Choräle durch das Meer schicken. Das war ihre Rettung. Der Wal mutierte zum „freundlichen Riesen“, die Macht der Pro-WalfangNationen schwand. Ohne diese Wendung wären die Wale längst ausgerottet. Ihre Gesänge eröffneten den Menschen einen emotionalen Naturbezug, der für jegliche wirksame Naturpolitik, die Anhänger mobilisieren muss, unentbehrlich sei, schreibt Jens Soentgen. Es ist eine der zentralen Aussagen in seinem schmalen, aber dichten Buch „Ökologie der Angst“. Nicht nur hier gibt es einen Berührungspunkt zwischen diesem und zwei anderen interessanten Neuerscheinungen auf dem Gebiet der Ökologie: mit „Das Ende der Natur“ von Susanne Dohrn, dass nun in einer erweiterten Taschenbuchausgabe vorliegt, und Birgit Schneiders „Klimabilder“. Die drei legen den Fokus sehr unterschiedlich: Jens Soentgen, Leiter des Wissenschaftszentrums Umwelt in Augsburg, charakterisiert das Anthropozän, in dem der Mensch „das herrschende Tier auf diesem Planeten“ ist, als Zeitalter der Angst (vornehmlich der Tiere vor den Menschen). Die deutsche Historikerin und Journalistin Susanne Dohrn beschreibt das Verschwinden der Arten im Wald und vor der Tür. Birgit Schneider wiederum, Professorin für Medienökologie an der Universität Potsdam, schaut sich detailliert an, wie über den sogenannten Klimawandel geredet wird, welche Bilder wir uns von ihm machen und warum das nicht egal ist.
Alle drei lassen keine Zweifel an der Dringlichkeit ihrer Botschaften. Alle warnen aber auch vor einer Endzeit- und Eh-schonwurscht-Stimmung: Nein, die Zukunft lässt sich noch gestalten. Doch damit Menschen ökologisch klug handeln, brauchen sie eine innere Motivation: Noch so vernünftige Argumente holen uns nicht hinterm Ofen hervor. Nur wenn der Mensch eine Beziehung zu den anderen Lebewesen und zur gesamten Natur aufbaut, bewegt sich etwas. Aber wie geht, wie entsteht das? „Die Landschaften meiner Kindheit waren voller Leben“, zitiert Susanne Dohrn in „Das Ende der Natur“ aus einem ihrer vielen Gespräche, in diesem Fall mit Michael Succow, Landschaftsökologe und Träger des Alternativen Nobelpreises. Vom Fenster seines Kinderzimmers beobachtete er Großtrappen bei der Balz, tausende Finkenvögel, im Teich auf dem Feld tummelten sich Wasserläufer und Kammmolche. „Ich meinte damals, das bliebe immer so“,
S a c h b u c h F A L T E R 4 1 / 1 8
45
schützen, was man auch versteht und liebt einen neuen Naturbezug und warnen vor Endzeitstimmung. Die Zukunft lässt sich immer noch gestalten! sagt Succow. Kommt er heute in die Gegend, ist der Gesang der Gartenammer verstummt, der Teich ausgetrocknet. Auch in der Autorin ist die Sehnsucht nach den Blumen und Insekten, die sie als Kind als selbstverständlich hingenommen hatte, erwacht. Sie legt eine kleine Wiese an: „Sie soll so aussehen wie früher“, schreibt sie, als rosa Kuckucks-Lichtnelken blühten, lila Wiesenschaumkraut, blaue Rundblättrige Glockenblumen. „Ich will den Tisch decken für Hummeln und Bienen, für Falter und Fliegen.“ Nun kann man ein paar Quadratmeter Wiese natürlich als kleines Ding abtun, das im Großen nichts ändert. Aber: Von der ersten Packung „regionaltypischem Saatgut“ nimmt Dohrn die Leser mit, Monat für Monat erfährt man, was wächst und wer welches Tier anlockt.
Jens Soentgen: Ökologie der Angst. Matthes & Seitz, 160 S., € 14,40
Es macht Spaß, von den „ausgebufften“ Über-
lebensstrategien mancher Lebewesen zu lesen. Nebenbei lernt man viel über die Ursachen der zunehmenden Leere in den Landschaften. Dohrn stellt klar: Ihr Buch ist „ein J’accuse gegen die intensive Landwirtschaft“ und gegen „eine Politik, die es fördert, dass tonnenweise Raps, Getreide und Mais in Biogasanlagen und Autotanks landen“. Auf hoffnungsvolle Kapitel wie „Dornröschen unter der Erde“ folgen solche, in denen Klartext geredet wird: „Teuflische Wirkstoffe“ oder „Die Natur wird zur Latrine“. Dohrns Angriffspunkt ist nicht der einzelne (kleine) Bauer, es sind die Agrarkonzerne und jene Funktionäre und Politiker, die in Wahrheit nicht im Sinne (des Großteils) der Landwirte agieren. Vielmehr ließen sie ihnen nur eine Wahl: „Wachse oder weiche!“ Je länger man Susanne Dohrn auf ihre Wiese begleitet, desto mehr wird man unversehens ebenfalls zur Anwältin von Laubfröschen und Regenwürmern. Damit gelingt der Autorin genau das, was Soentgen empfiehlt: Sie schafft „emotionalen Naturbezug“. Die Autorin selbst weiß inzwischen, dass
ng Lesaum
stag Dien r 2018 obe t k O 23. 9:00 um 1
tiempo nuevo genussbuchhandlung Taborstraße 17A, 1020 Wien Mo bis Fr 10–19 Uhr; Sa 10–18 Uhr /// www.tiempo.at
Susanne Dohrn: Das Ende der Natur. Die Landwirtschaft und das stille Sterben vor unserer Haustür. Herder, 272 S., € 12,40
Birgit Schneider: Klimabilder. Eine Genealogie globaler Bildpolitiken von Klima und Klimawandel. Matthes & Seitz, 462 S., € 32,90
sie den Aurorafalter gekillt hat, als sie früher das Wiesenschaumkraut mähte: „Man kann nur schützen, was man kennt.“ Über das Schützen und das Kennenlernen zerbricht sich auch Jens Soentgen den Kopf. Jagd, Verfolgung, Ausrottung hätten die Tiere die Angst vor dem Menschen gelehrt. Zu den bewährten Feuerwaffen kommt heute das Abholzen und Abfackeln ganzer Wälder, um etwa Sojaplantagen für die Massentierhaltung anzulegen. Wildtiere hätten daher gelernt: Der Mensch ist der „Universalfeind“, vor ihm muss man flüchten. Dabei sei das kein Naturgesetz: „Anders als
wir meinen, ist es nämlich nicht selbstverständlich, dass Tiere panische Angst vor uns haben und davonrasen, -fliegen oder -kriechen, sobald sie uns auch nur von fern sehen.“ Als im Zeitalter der Entdecker die Europäer zahlreiche Inseln ansteuerten, hätten deren Tiere kaum Scheu vor den Menschen gezeigt. Auch Charles Darwin und „Brehms Thierleben“ hätten über die Zutraulichkeit wilder Tiere berichtet. Der Rückzug der Tiere vor dem „Raubtier“ Mensch führe zu noch mehr Entfremdung, doch es sei „möglich und dringend geboten, zumindest lokal und punktuell Schritte der Versöhnung zu tun“. Zwei Möglichkeiten führt Soentgen dazu aus: Erstens sollten die hermeneutischen Naturwissenschaften uns helfen, die (Wild-)Tiere besser zu verstehen – siehe Wale. Zweitens gelte es, mehr Räume zu schaffen, in denen Tiere den Menschen nicht als Gefahr wahrnehmen. Wo der Mensch „nur noch ein einfaches Mitglied der natürlichen Gemeinschaft ist“ und „die Souveränität der Natur“ akzeptiert. Daraus kann nach Soentgen ein innerer Naturbezug entstehen, und aus abstrakten, rationalen Zielen werden im besten Fall emotionale Ziele: Wer Walgesänge bewundert, will, dass die Wale leben. Was es braucht, damit Wissen zu konstruktivem Handeln führt, das ist auch Birgit
Schneiders zentrales Thema. Wer die Botschaft von Grafiken wie dem Hockey Stick, der den Gang des Klimas für die letzten 1000 Jahre rekonstruiert, verstanden habe, der werde auch handeln und die notwendigen Entscheidungen treffen. „Dies zumindest ist die Hoffnung innerhalb eines rationalen Verständnisses aufgeklärter Wissenskommunikation“, schreibt die Medientheoretikerin und liefert den Zweifel gleich mit. Schneider hat eine beeindruckende Kollektion an Darstellungen des Klimas und dessen Veränderung zusammengetragen, beginnend mit den beinahe 200 Jahre alten Isolinien-Karten des Forschungsreisenden Alexander von Humboldt. Ausführlich analysiert sie, was der Begriff „Klimawandel“ suggeriert, und zeigt, wie die Klimawandel-Leugner arbeiten. Sie erklärt, wie das Bild des „Blauen Planeten“ („our home planet“) der NASA zur Ikone eines neuen Umweltbewusstseins wurde. Dem gegenüber stellt sie die Bilder des erhitzten Planeten in brennendem Rot und diskutiert, was diese „burning worlds“ in den Betrachtern auslösen. Studien würden nahelegen, dass solch bedrohliche Bilder zwar Aufmerksamkeit erregen, „dann jedoch keine Handlungen nach sich ziehen“: Die Geschichte von der Apokalypse lässt uns bloß ohnmächtig zurück. Am Ende des Buchs überlegt Schneider, was
das alles nun für Wissenschaft, Kunst und Medien bedeutet. Eines aber will sie nicht: maßgeschneiderte PR-Strategien für eine Stopp-Klimawandel-Kampagne ersinnen. Das sei schon auch wichtig, ihr gehe es aber um die „Praxis der Kritik und des kritischen Denkens“. Um das Ruder herumzureißen, brauche es ganz neue Sichtweisen, schreibt sie. Und zitiert einen Albert Einstein zugeschriebenen Satz: „Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“ GERLINDE PÖLSLER
Ein Welttheater der schriftstellerischen Einbildungskraft »und wieder entschlüpft mir diese Schriftstellerin in jede ihr gerade beliebige Rolle, wechselt von hierorts nach daorts, nach Laune und Lust, und nach der Wahrheit längst kräht keiner mehr. Nur eines steht außer Streit: Innsbruck bleibt unerreichbar ...« In Gabriele Petriceks neuem Buch ist die Grenze zwischen Suche und Verfolgung hauchdünn, durchlässig, um die Möglichkeiten literarischen Erzählens im ständigen Wechsel der Ich-Perspektiven spielerisch auszuloten. Die Autorin lässt sich von Fabulierlust leiten, auf Ab- und Umwege bringen, sich in Variationen und Möglichkeiten verwickeln, und verführt uns ihr überall hin zu folgen: auf eine Reise, quer durch die Möglichkeiten schriftstellerischer Einbildungskraft.
www.sonderzahl.at
Gabriele Petricek Die Unerreichbarkeit von Innsbruck 240 S., € 19,90 ISBN 978 3 85449 492 8
Buy local! Eine Aktion der ARGE Österreichische Privatverlage und unabhängiger Wiener Buchhandlungen
46
F A L T E R 4 1 / 1 8 S a c h b u c h
Streicheln wir bald pelzige Roboter?
Eine Lanze für die Ingenieurskunst brechen
Soziologie: Elisabeth von Thadden untersucht, was Berührungen in unserer Gesellschaft bedeuten
Architektur: Roma Agrawal begeistert sich für die Leistung der Bauingenieure, ein Buch nicht nur für Mädchen
chon allein unser Wortschatz zeigt die hohe Relevanz des Tastsinns. S Etwas ist „in Reichweite“, „zum Grei-
orandi, Morandi, Morandi! Nachdem am 14. August dieses M Jahres das Polcevera-Viadukt in Ge-
fen nah“, „unantastbar“. Man hält sich etwas „vom Leibe“, wird „handgreiflich“ oder „übergriffig“. Wenn uns etwas „unter die Haut geht“, zeigt das, dass auch Gefühle etwas mit der Berührung bzw. Verletzung unserer Körperoberfläche zu tun haben, zumindest symbolisch. Erstaunlicherweise ist der Tastsinn vergleichsweise wenig erforscht. Dabei hielt schon Aristoteles fest, dass er der einzige Sinn sei, ohne den der Mensch nicht überleben könne. Ohne Berührung anderer gehen wir zugrunde. Wir brauchen sie, um uns unserer Existenz sicher zu sein. Die Biochemie einer Hautberührung lässt sich durch nichts virtuell stimulieren, gleichzeitig ist das Handy stets griffbereit und inzwischen für viele zu einer Art Sinnesorgan geworden. Ist unser Leben im Zeitalter der Digitali-
sierung, der Welt der glatten Oberflächen bald ganz entkörperlicht?, fragt sich Elisabeth von Thadden, Redakteurin der Zeit, in ihrem Buch „Die berührungslose Gesellschaft“. Sie untersucht das Thema von allen Seiten, befragt Psychiater, Neurologen, Islamexperten, Sexualwissenschaftler, eine Soziologin, eine Dermatologin, eine Immobilienwirtschaftsexpertin und eine Heilpraktikerin. Es geht um unverletzliche Freiheiten, Freiwilligkeit und (sexuelle) Selbstbestimmung, Offenheit, Abstumpfung und um Einsamkeit, jene Befindlichkeit, für oder vielmehr gegen die die britische Premierministerin Theresa May Anfang des Jahres eine eigene Ministerin eingesetzt hat. Fest steht nämlich: Der Umgang mit Nähe und Distanz ist in jeder Kultur anders. Während in Puerto Rico Einheimische während eines einstündigen Gesprächs in einem Lokal etwa 180 Berührungen austauschen, sind es in Frankreich bereits in einer halben Stunde 110 Berührungen – und in den USA in der gleichen Zeit nur zwei. By the way: Angeblich gibt’s mehr Trinkgeld, wenn die Bedienung den Gast leicht beiläufig streift. Wenn von Thadden beschreibt, was Berührungen können, wem sie schaden und wie sie in Haptikforschung, Robotik und politischer Philosophie behan-
Über 1,5 Mio. Bücher, DVDs & CDs mit gutem Gewissen bestellen.
delt werden, bleibt sie im Stil kühl und sachlich. Unermüdlich sammelt sie Fakten und durchforstet Quellen wie etwa Gesetzestexte. Letztlich ist aber schwer erkennbar, worauf sie hinauswill, welche Schlüsse sie zieht, wofür sie plädiert. Sie ertastet jeden Winkel, der auch nur
annähernd irgendwas mit ihrem Thema zu tun hat. Im Kapitel zu Politik und Recht konzentriert sie sich stark auf die Zeit der Aufklärung („Nichts kann gedacht werden, was nicht zuvor gespürt worden ist“), in der Kunst auf die Empfindsamkeit: Goethes Herzschmerz, Diderots Innigkeitsutopie und Mozarts „Hochzeit des Figaro“ werden als Gründungsdokumente moderner Körperverhältnisse definiert. So wird zwar der epochale Wandel am Schauplatz Körper im Rückblick begreifbar, die Bezüge zu aktuellen Debatten rund um die Kölner Silvesternacht und #MeToo werden allerdings nur angedeutet. Von Thadden widmet sich auch der räumlichen Dichte: Single-Wohnung statt Generationenverband, Flüchtlingslager und Wohnprojekte. Was macht die Großstadt mit uns? Werden wir immer älter, aber sind uns aber trotz aller Egozentrik unserer Existenz nicht bewusst, weil wir nichts und niemanden mehr spüren? Streicheln wir bald pelzige Roboter, weil uns der Körperkontakt im Alter fehlt? Gehen wir bald nicht mehr zum Arzt, sondern zur SchmerzenEvaluierungs-App und nebenbei auf Kuschelpartys? Nur andere Menschen oder Lebewesen versichern uns im körperlichen Kontakt, dass wir nicht alleine auf dieser Welt sind – das ist dann doch so etwas wie ein Ergebnis oder vielmehr eine Warnung, die von Thadden aus ihren Gesprächen mit Experten herauskitzelt. J u liane F isc h er
Elisabeth von Thadden: Die berührungslose Gesellschaft. C.H. Beck, 206 S., € 17,50
nua katastrophal einstürzte und zahlreiche Autos in die Tiefe riss, wusste sofort jeder den Namen seines Ingenieurs – und das nicht nur, weil die Brücke umgangssprachlich nach ihm benannt war. In den Kommentarspalten wurde diskutiert, ob es eine gute Idee gewesen war, Stahlseile in Beton einzuhüllen, und ob die anderen Brücken, die Riccardo Morandi rund um die Welt errichtet hatte, wohl auch bald einstürzen würden. Es ist die Crux der Ingenieure, dass man
meistens über sie redet, wenn mal wieder was passiert ist. Wenn es darum geht, wer schuld daran war. Fehlkalkulation! Nachlässigkeit! Gefängnis! Dabei wird nur allzu gerne übersehen, dass Ingenieure in praktisch allen Fällen alles richtig kalkulieren und dabei die wagemutigsten Konstruktionen ermöglichen, vom erdbebensicheren Wolkenkratzer in Taipei bis zur Kuppel aus Spannbeton. Konstruktionen, für die dann oft der Architekt das Lob einheimst. Eine Ehrenrettung der Ingenieure unternimmt „Die geheime Welt der Bauwerke“, ein kurzweiliges Buch der in Mumbai geborenen Britin Roma Agrawal, selbst Ingenieurin. In mehreren Kapiteln, die nach den Grundelementen des Bauens benannt sind (Ziegel, Beton, Stahl, Wasser), führt sie durch die Welt des Konstruierens. Sachliche Erklärungen (warum fällt ein Bogen aus Ziegelsteinen nicht zusammen?) wechseln sich ab mit anekdotischen Berichten ihrer Besuche im Pantheon in Rom mit seiner fast 2000 Jahre alten und immer noch tadellos funktionierenden Betonkuppel und der Kathedrale von Mexiko-Stadt, deren Südseite sich auf dem weichen Untergrund um mehrere Meter abgesenkt hatte und die mit raffinierten Maßnahmen wieder geradegerichtet wurde. Das liest sich in seiner manchmal unpas-
send naiv anmutenden Erklär-Emsigkeit oft etwas zu „Sendung mit der Maus“-artig („Einen Lehmziegel backt man ganz ähnlich wie einen Kuchen“), aber man muss die Leute
eben abholen, wo sie stehen, und sie stehen fast immer skeptisch vor dem Bauzaun und vermuten unerklärlich Kompliziertes, ermüdend Mathematisches dahinter. Sobald eine Gleichung mit Buchstaben auftaucht, werden sie nervös. Nicht unklug also, dass Agrawal ihre klaren, verständlichen Erläuterungen mit unverdünnter Begeisterung und populärwissenschaftlichen Analogien auflockert. Für etwas mehr toughen Ingenieursstolz wäre hier noch Platz gewesen, denn ganz so einfach lässt sich so ein Brückentragwerk schließlich nicht planen und aufstellen – und Roma Agrawal hat (neben Westeuropas zweithöchstem Wolkenkratzer) selbst Brücken geplant. Kurz, aber charmant wird der Ursprung dieses Enthusiasmus erzählt (die Autorin spielte als Kind gerne mit Lego), das Autobiografische bleibt jedoch gegenüber dem Erklären der Technik, das mit hilfreichen Skizzen ergänzt wird, immer im Hintergrund. Eine gute Wahl, und umso erstaunlicher, als die 35-Jährige Aktivistin der Vereinigung Women in Engineering ist. Der Feminismus wird hier sozusagen als unsichtbares Tragwerk integriert, wie Stahl im Stahlbeton. Vielleicht ist das größte Plus dieses Buchs außer der ansteckenden Begeisterung über Fundamente, Gewölbe und Bohrpfähle die Selbstverständlichkeit, mit der Agrawal ihr Wissen und ihr Können als weiblicher Ingenieur vermittelt, ohne die Powerfrau-Keule schwingen zu müssen. Wenn durch die Lektüre mehr Mädchen die Realisierung eines Lebenstraums als Ingenieurin anstreben, wäre das ein Gewinn. Besser als Morandi können sie es bestimmt. MAIK NOVOTN Y
Roma Agrawal: Die geheime Welt der Bauwerke. Hanser, 352 S., € 24,70
S a c h b u c h F A L T E R 4 1 / 1 8
47
Vom Gedächtnis- zum Integrationstheater? Integration: Max Czollek plädiert in einer Streitschrift für die Anerkennung einer „radikalen Vielfalt“
I
n Israel wird am Holocaust-Gedenktag der Opfer ebenso wie der Widerstandskämpfer gedacht. Er ist auf das Datum des Aufstands im Warschauer Ghetto von 1943 gelegt. Die beiden deutschen Holocaust-Gedenktage, am 27. Jänner und 9. November, erinnern an die Befreiung von Auschwitz 1945 beziehungsweise die Reichspogromnacht 1938. Für Max Czollek ist dieser Unterschied ein gutes Beispiel für Deutschlands Umgang mit seinen Juden, den er anprangert. Das „Gedächtnistheater“ der Deutschen, also
die deutsche Erinnerungskultur nach 1945, sieht die Juden als Opfer und lässt ihnen wenig Spielraum, die eigene Rolle zu definieren. Schoah, Antisemitismus und Israel sind die vorgegebenen Themen. Für Heldentum, Widerstand oder Rache sei kein Platz, moniert Czollek. Am überzeugendsten sind jene Kapitel, in denen Czollek, Jahrgang 1987, Politikwissenschaftler und Lyriker in Berlin, beschreibt, welche alternativen deutsch-jüdischen Narrative es gibt oder geben sollte. Czollek ist Mitherausgeber der Zeitschrift Jalta – Positionen zur jüdischen Gegenwart und nimmt gleich seinen eigenen Gedichtzyklus „A.H.A.S.V.E.R“ (2016) über den „ewigen Juden“ als Beispiel. Lesenswert auch sein historischer Abriss der jüdischen Migration nach dem Zweiten Weltkrieg: Rund 90 Prozent der
Max Czollek: Desintegriert euch! Hanser, 208 S., € 18,50
jüdischen Bevölkerung in Deutschland haben heute sowjetische Wurzeln. Vergleiche zwischen dem Umgang mit Flüchtlingen durch die erstarkende Rechte und dem Holocaust sind hochsensibles Terrain. Czollek gelingt es, die Kontinuitäten zu zeigen. Parallel zum „Gedächtnistheater“ ortet er ein „Integrationstheater“ in Deutschland. Das Problem am Konzept der Integration sieht er darin, dass es eine Art sei, sich „Gesellschaft als einen Ort mit Zentrum vorzustellen“. An diese „Leitkultur“ müssen sich lediglich die als fremd Titulierten anpassen. Aber: „Ab wann gilt man nicht mehr als Integrationsverweigerer, sondern als frustrierter Deutscher?“ Czolleks Gegenvorschlag: die Gesellschaft als „Ort der radikalen Vielfalt“ anzuerkennen. Er analysiert, warum der Heimatbegriff auch bei Linken problematisch ist und der Patriotismus anlässlich der Fußball-WM 2006 nicht so harmlos war, wie er aussah. Wie Czollek das alles schreibt, in einer Mischung aus Soziologendeutsch und flapsigen Kommentaren, ist gewöhnungsbedürftig. Seine dazwischengestreuten Schmähs und Wortspiele zielen sichtlich darauf ab, zu verstören. Die Wut des Ich-Erzählers, der mal mehr, mal weniger in Erscheinung tritt, bleibt spürbar und gibt dem Buch Tempo – aber erzeugt auch Schwächen: So überzeugend die Argumentation, so halbgar sind
leider teilweise die Beweise. Die überspitzten Schlussfolgerungen schaden Czolleks Plädoyer mehr, als sie nutzen. So nimmt er etwa den vom deutschen Bundestag 2015 einberufenen „Expertenkreis Antisemitismus“ als Beispiel. In diesem saß kein einziger Jude, weil man, so zitiert Czollek eine Sprecherin, diesen „nicht nach Religionszugehörigkeit, sondern nach fachwissenschaftlicher Expertise“ besetze. Czollek unterstellt dem Innenministerium die Einstellung, dass Juden und Jüdinnen beim Thema Antisemitismus nicht unparteiisch sein könnten. „Man will die Juden nur, wenn sie einem auch nützen.“ Es gibt mehrere solcher Stellen, bei denen man
beim Lesen die Stirn runzelt und sich fragt, ob es nicht auch eine differenziertere Interpretation getan hätte. Ähnlich verhält es sich mit dem anfangs genannten Unterschied zwischen dem deutschen und dem israelischen Holocaust-Gedenktag. Anders als Czollek schreibt, ist der israelische Yom Hashoah nicht auf das Datum des Warschauer Ghettoaufstands im Jahr 1943 gelegt. Dieser fand nämlich zum jüdischen Feiertag Pessach statt, weshalb der Gedenktag im neugegründeten Staat Israel nach hinten verschoben wurde, um mit dem Feiertag nicht zu kollidieren. Aber in der Wut vergisst man eben manchmal auf Details. Anna Goldenberg
Die Falter-Buchbeilage erhalten Sie gratis in folgenden Buchhandlungen Wien: | 1 | A. Punkt, Fischerstiege 1–7 | Aichinger Bernhard, Weihburgg. 16 | ChickLit, Kleeblattg. 7 | Facultas im NIG, Universitätsstr. 7 | Freytag & Berndt, Wallnerstr. 9 | Frick, Graben 27 | Herder, Wollzeile 33 | Kuppitsch, Schotteng. 4 | Leo & Co., Lichtensteg 1 | Leporello, Singerstr. 7 | Morawa, Wollzeile 11 | ÖBV, Schwarzenbergstr. 5 | ÖGB Fachbuchhandlung, Rathausstr. 21 | Schaden, Sonnenfelsg. 4 | Tyrolia, Stephanspl. 5 | 2 | Im Stuwerviertel, Stuwerstr. 42 | Lhotzkys Literaturbuffet, Taborstr. 28 | facultas.mbs an der WU, Welthandelspl. 1/D2/1 | tiempo nuevo, Taborstr. 17a | 3 | Laaber, Landstraßer Hauptstr. 33 | Thalia, Landstraßer Hauptstr. 2a/2b | 4 | Jeller, Margaretenstr. 35 | INTU.books, Wiedner Hauptstr. 13 | 6 | Thalia, Mariahilfer Str. 99 | 7 | Audiamo, Kaiserstr. 70/2 | Hintermayer, Neubaug. 27 | Posch, Lerchenfelder Str. 91 | Walther König, Museumspl. 2 | 8 | Bernhard Riedl, Alser Str. 39 | Eckart, Josefstädter Str. 34 | Lerchenfeld, Lerchenfelder Str. 50 | 9 | Buch-Aktuell, Spitalg. 31 | Facultas am Campus, Altes AKH, Alser Str. 4 | Hartliebs Bücher, Porzellang. 36 | Löwenherz, Bergg. 8 | Orlando, Liechtensteinstr. 17 | Yellow, Garnisong. 7 | 10 | Facultas, Favoritenstr. 115 | 12 | Frick, Schönbrunner Str. 261 | 13 | Bestseller, Hietzinger Hauptstr. 22 | 15 | Buchcafé Melange, Reindorfg. 42 | Buchkontor, Kriemhildpl. 1 | Thalia Bahnhof City Wien West, Europapl. 1 | 17 | Book Point 17, Kalvarienbergg. 30 | 18 | Hartliebs Bücher, Währinger Str. 122 | 19 | Baumann, Gymnasiumstr. 58 | Fritsch
Georg, Döblinger Hauptstr. 61 | Stöger, Obkircherg. 43 | Thalia Q19, Kreilpl. 1 | 20 | Hartleben, Othmarg. 25 | 21 | Bücher Am Spitz, Am Spitz 1 | Kongregation der Schulbrüder, Anton-Böck-G. 20 | 22 | Freudensprung, Wagramer Str. 126 | Morawa V.I.C., Wagramer Str. 5 | Seeseiten, Janis-Joplin-Promenade 6 | Thalia, Donauzentrum, Wagramer Str. 94 | 23 | Lesezeit – Liesing, Breitenfurter Str. 358 | In Mauer, Gesslg. 8A | Frick EKZ Riverside, Breitenfurter Str. 372 | Niederösterreich: Korneuburg, Stockerauer Str. 31, 2100 Korneuburg | Am Hauptplatz, Hauptpl. 15, 2320 Schwechat | Morawa, SCS, Top G 299, 2334 Vösendorf | Kral, Elisabethstr. 7, 2340 Mödling | Valthe, Wiener G. 3, 2380 Perchtoldsdorf | Riegler, Kircheng. 26, 2460 Bruck an der Leitha | BücherSchütze, Pfarrg. 8, 2500 Baden | Papeterie Rehor, Theodor-Körner-Pl. 6, 2630 Ternitz | Hikade, Herzog-Leopold-Str., 2700 Wiener Neustadt | Thalia, Hauptpl. 6, 2700 Wr. Neustadt | Mitterbauer, Wiener Str. 10, 3002 Purkersdorf | Sydy’s, Wiener Str. 19, 3100 St. Pölten | Thalia, Kremserg. 12, 3100 St. Pölten | Reischl, Hauptpl. 12, 3250 Wieselburg | Schmidl, Obere Landstr. 5, 3500 Krems/Donau | Murth, Wiener Str. 1, 3550 Langenlois | Rosenkranz, Els 127, 3613 Els | Kargl, Hauptpl. 13–15, 3830 Waidhofen/Thaya | Janetschek, Schulg. 5, 3860 Heidenreichstein | Spazierer, Budweiser Str. 3a, 3940 Schrems | Stark Buch, Bahnhofstr. 5, 3950 Gmünd | Oberösterreich: Fürstelberger, Landstr. 49, 4013 Linz | Alex, Hauptpl. 17,
4020 Linz | Buch plus, Südtiroler Str. 18, 4020 Linz | In der Freien Waldorfschule, Waltherstr. 17, 4020 Linz | Neugebauer, Landstr. 1, 4020 Linz | Thalia, Landstr. 41, 4020 Linz | Buchhandlung Auhof, Altenbergerstr. 40, 4045 Linz-Auhof | Wolfsgruber, Pfarrg. 18, 4240 Freistadt | Wurzinger, Hauptpl. 7, 4240 Freistadt | Ennsthaler, Stadtpl. 26, 4400 Steyr | Hartlauer, Stadtpl. 6, 4400 Steyr | Michael Lenk, Vogelweiderpl. 8, 4600 Wels | SKRIBO GmbH, Stadtpl. 34, 4600 Wels | Thalia, Schmidtg. 27, 4600 Wels | Schachinger, Untere Stadtpl. 20, 4780 Schärding | Kochlibri, Theaterg. 16, 4810 Gmunden | Thalia, Pfarrg. 11, 4820 Bad Ischl | Michael Neudorfer, Hinterstadt 21, 4840 Vöcklabruck | Schachtner, Stadtpl. 28, 4840 Vöcklabruck | Bücherwurm, Bahnhofstr.20, 4910 Ried | Thalia, Wohlmeyrg. 4, 4910 Ried/Innkreis | Salzburg: Bücher-Stierle, Kaig. 1, 5010 Salzburg | Motzko, Elisabethstr. 24, 5017 Salzburg | Facultas NAWI-Shop, Hellbrunner Str. 34, 5020 Salzburg | Höllrigl, SigmundHaffnerg. 10, 5020 Salzburg | Morawa SCA, Alpenstr. 107, 5020 Salzburg | Rupertusbuchhandlung, Dreifaltigkeitsg. 12, 5020 Salzburg | Thalia, Europastr. 1, 5020 Salzburg | Der Buchladen, Stadtpl. 15-17, 5230 Mattighofen | Engelhart Brandstötter, Marktpl. 15, 5310 Mondsee | Tirol: Haymon, Sparkassenpl. 4, 6020 Innsbruck | Studia, Innrain 52f, 6020 Innsbruck | Wagner’sche, Museumstr. 4, 6020 Innsbruck | Tyrolia, Maria-Theresien-Str. 15, 6020 Innsbruck | Tyrolia Max Media,
Maximilianstr. 9, 6020 Innsbruck | Riepenhausen, Langer Graben 1, 6060 Hall in Tirol | Riepenhausen, Andreas-Hofer-Str. 10, 6130 Schwaz | Steinbauer, EKZ Cyta, Cytastraße 1, 6167 Völs | Zangerl, Salzburger Str. 12, 6300 Wörgl | Lippott, Unterer Stadtpl. 25, 6330 Kufstein | Tyrolia, Rathausst. 1, 6460 Imst | Jöchler, Malserstr. 16, 6500 Landeck | Tyrolia, Roseng. 3-5, 9900 Lienz | Vorarlberg: Ananas, Marktpl. 10, 6850 Dornbirn | Brunner, Marktstr. 33, 6850 Dornbirn | Brunner, Rathausstr. 2, 6900 Bregenz | Ländlebuch, Strabonstr. 2a, 6900 Bregenz | Brunner, Konsumstr. 36, 6973 Höchst | Burgenland: s’Lesekistl, Obere Hauptstr. 2, 7122 Gols | Buchwelten, Hauptstr. 8, 7350 Oberpullendorf | Pokorny, Schulg. 9, 7400 Oberwart | Wagner, Grazer Str. 22, 7551 Stegersbach | Steiermark: Bücherstube, Prokopig. 16, 8010 Graz | ÖH Unibuchladen, Zinzendorfg. 25, 8010 Graz | Moser Ulrich, Am Eisernen Tor 1, 8010 Graz | büchersegler, Lendkai 31, 8020 Graz | Leykam, Lazarettgürtel 55, 8025 Graz | Plautz, Sparkassenpl. 2, 8200 Gleisdorf | Buchner, Hauptstr. 13, 8280 Fürstenfeld | Leykam, Hauptpl. 2, 8330 Feldbach | Leykam, Mitterg. 18, 8600 Bruck/Muhr | Mayr, Kurort 50, 8623 Aflenz | Kerbiser, Wiener Str. 17, 8680 Mürzzuschlag | Morawa, Burgg. 100, 8750 Judenburg | Hinterschweiger, Anna Neumannstr. 43, 8850 Murau | Buch + Boot, Altausse 11, 8992 Altaussee | Kärnten: Heyn Johannes, Kramergasse 2, 9020 Klagenfurt | Besold, Hauptplatz 14, 9300 St. Veit/Glan
F A L T E R 4 1 / 1 8 S a c h b u c h
A
utismus, das ist doch die Krankheit, wo die Empathie fehlt – oder? Zwei Werke zeigen die fragwürdige Geschichte der Diagnose – und dass Autisten ganz anders ticken könnten, als wir bisher geglaubt haben. Das in der Nazizeit erstmals beschriebene Asperger-Syndrom ist die bis heute gängige Diagnose für jene Form des Autismus, bei der Kommunikation und soziale Interaktion gestört sind, die Intelligenz aber unbeeinträchtigt bleibt und oft in einzelnen Bereichen hoch ausgeprägt ist. Wer aber war Hans Asperger? Dieser Frage geht die Historikerin Edith Sheffer nach. Während die Einstufung der von ihm beschriebenen leichten Form des Autismus als Krankheit heute umstritten ist, war sie zu Zeiten, als der Wiener Arzt Karriere machte, ein Todesurteil. An „Schwachsinn“ oder „Missbildungen aller Art“ leidende Kinder sollten frühzeitig erkannt und gemeldet werden. Um nicht den Genpool der „Volksgemeinschaft“ zu bedrohen, wurden sie in sogenannten „Kinderfachabteilungen“ getötet. Deren Realität schildert die Autorin noch grausamer als weithin bekannt: „In den Euthanasiezentren erhielten Ärzte und Krankenschwestern Gehaltsboni und Zusatzleistungen für jedes getötete Kind.“ Edith Sheffer, Historikerin am Europe Center der Stanford University, hat sich in ihrem letzten Buch an der Entstehungsgeschichte des Eisernen Vorhangs abgearbeitet („Burned Bridge: How East and West Germans Made the Iron Curtain“, 2012). Mit „Aspergers Kinder“ rollt sie einen Kriminalfall auf. Hans Asperger (1906–1980) leitete die heilpädagogische Abteilung der Wiener Universitäts-Kinderklinik. Wie eng der später vollständig rehabilitierte Kinderarzt mit den Todeskliniken zusammenarbeitete, ist erst seit kurzer Zeit bekannt. Mittlerweile ist belegt, dass der aufstrebende Arzt direkt an die berüchtigte Jugendfürsorgeanstalt am Spiegelgrund überwies – in vollem Wissen, was seinen Schützlingen dort blühte. Sheffers Anklageschrift ist zugleich die Geschichte einer Diagnose und die eines Medizinbetriebs, in dem Ärzte groß werden konnten, deren Wirken den Hippokratischen Eid verhöhnte. Das von Anhängern Aspergers gezeichnete Bild eines Nazigegners und Beschützers regimekritischer Ärzte bröckelt hier rasch und weicht dem eines eher unscheinbaren, wenig beseelten Karrieristen ohne moralische Bedenken. Hans Asperger war keiner der unmittelbaren Vollstrecker, er war einer, der als Mitläufer überlebte und damit zum Arbeitsvorbereiter der Tötungsmaschinerie wurde. Die Ergebnisse ihrer akribischen Recherche stellt die Autorin äußerst detailreich dar. Gerade durch die Präzision entsteht Spannung – und Grauen. Sheffer lässt die Diagnose „Asperger“ als ein schauriges Gespenst aus einer menschenverachtenden Zeit erscheinen. Möglicherweise irrten Asperger und Kollegen nicht nur moralisch, sondern auch fachlich. Denn was wir über Autismus zu wissen glauben, ist zum großen Teil falsch. Das behauptet zumindest Henry Markram. Nach den Erkenntnissen des Hirnforschers ist unser bisheriges Verständnis der Krankheit das Negativ des tatsächlichen Bildes: Autisten empfinden nicht zu wenig, sondern zu viel. Wie er zu dieser Behauptung kam, verfolgt der Reporter Lorenz Wagner. „Sie können sich nicht in andere hineinversetzen. Sie interessieren sich kaum für andere“ – das hatte der 1962 in Südafrika
Autisten haben nicht zu wenige Gefühle Autismus: Hans Asperger und Henry Makram: Die gegensätzlichen Pole der Autismusforschung erhalten Monografien
geborene Markram in seinem Studium der Medizin und Neurophysiologie über Autisten gelernt, geglaubt und am israelischen Weizmann-Institut gelehrt. Bis sein Sohn Kai deutliche Autismus-Symptome zeigte. Die bekannten Modelle halfen aber nicht: weder um als Fachmann Kais Verhalten zu erklären noch um als Vater seinen Sohn zu fördern. So nahm Markram die Sache selbst in die Hand – in großem Stil. Lorenz Wagner begleitet seine Jagd nach dem
Phantom Autismus. Nachdem er sich schon als Chefreporter der Financial Times Deutschland einen Namen gemacht hatte, ist er heute beim SZ-Magazin für Reportage und Porträts zuständig. Sein dort erschienenes Porträt von Henry und Kai Markram zählt zu den erfolgreichsten Artikeln, die das Magazin je publizierte. Nun ist seine Geschichte zweier Leben und eines Lebenswerks im Buchformat erschienen. Er erzählt, wie hoch Henry Makram pokerte, um im Forschungsgeld-Dschungel die Gelder aufzustellen, bis er schließlich zum Vater des Human Brain Project wurde, eines der größten Forschungsprojekte, das die EU jemals gefördert hat. Er interviewt Makram und seine zweite Frau Kamilla, die mit ihm gemeinsam forscht. Sogar die sperrigen Laborversuche kann er plastisch nachvollziehbar machen. Hautnah schildert er etwa, wie eine von Markrams Mitarbeiterinnen an dem Tag, an dem sie ihren Job aufgeben wollte, es doch noch einmal probierte. Nach zwei Jahren fruchtloser Arbeit an jenen Gehirnzellen, die für die Hemmungen der autistischen Ratten verantwortlich gemacht wurden, gibt sie sich eine letzte Chance – und untersucht aus keinem vernünftigen Grund deren Gegenspieler, verstärkende Zellen. „Sie stand da, alleine in ihrem Labor, und stach die Pipette hinein (…) und konnte kaum glauben, was sie durch ihr Mikroskop sah. Diese Verstärkerzellen empfanden die Reize doppelt so stark, sie redeten mehr miteinander, sie schnatterten richtig.“ Die verstärkenden Zellen autistischer Ratten sendeten ein Signalfeuerwerk, doppelt so schnell wie die Zellen normaler Ratten. Damit war der Durchbruch geschafft und alles ganz anders als gedacht: nämlich genau umgekehrt. Am vorläufigen Ende der Forschungen der Mar-
Edith Sheffer: Aspergers Kinder. Campus, 340 S., € 30,80
Lorenz Wagner: Der Junge, der zu viel fühlte. Europa, 216 S., € 19,50
krams steht die „Intense World Theory of Autism“: Nicht weil ihnen etwas fehlt, sind Autisten gezwungen, Reize zu reduzieren, sich zurückzuziehen und die Welt durch Rituale zu ordnen, sondern weil von allem zu viel da ist. Diese Erkenntnis führt zu einem gänzlich anderen Umgang mit der Krankheit: Autisten müssen keinesfalls angeregt werden, wie man bisher meinte, sondern man muss sie vor zu viel Anregung schützen. Noch ist die Theorie Gegenstand von Debatten. Und doch gelten die Arbeiten der Markrams vielen als das Beste, das die Autismusforschung heute zu bieten hat. Nicht zuletzt können sie auch sehr gut erklären, warum wir in unserer heute oft reizüberfluteten Welt wesentlich häufiger Autismus-Diagnosen begegnen als noch vor 50 Jahren. Am Ende dieser fulminanten Reportage hat man sowohl eine außergewöhnliche Familiengeschichte mitverfolgt als auch die hartnäckige, mühselige, aber höchst lebendige Jagd nach echtem Wissen. Und man nimmt eine zutiefst menschliche Erkenntnis mit: wie viel es für Betroffene bedeutet, ihre Krankheit zu verstehen – auch wenn sie niemand heilen kann. A n d r eas K r e m la
Illustr ation: georg feierfeil
48
S a c h b u c h F A L T E R 4 1 / 1 8
Frauenpower in der Physik Biografie: Vor 50 Jahren starb die bedeutendste österreichische Kernphysikerin
D
ie Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert war eine der für die Menschheit folgenreichsten Phasen der Wissenschaftsgeschichte. Mit der Entdeckung der Radioaktivität durch Marie und Pierre Curie, der Quantenhypothese von Max Plank, den beiden Relativitätstheorien Albert Einsteins, Niels Bohrs Atommodell von 1913 sowie der Freilegung von Feinstrukturen der Materie wurden innert kurzer Zeit Türen aufgestoßen, von denen man kaum ahnen konnte, dass es sie gibt. Aufgrund der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse waren die Protagonisten jener Zeit mehrheitlich Männer. Es gab aber auch Frauen, die sich trotz widriger Umstände behaupteten und wesentlich zum Erkenntnisgewinn beitrugen. Die berühmteste jener Zeit war die 1867 in Warschau geborene Marie Curie. Da sie in Polen nicht studieren durfte, zog sie nach Paris und schloss dort 1893 als Beste in Physik und ein Jahr danach als Zweitbeste in Mathematik ab. 1903 erhielt sie für ihre Beiträge zur Strahlungsforschung den Nobelpreis für Physik, 1911 denjenigen für Chemie. Nicht minder kreativ war die elf Jahre jüngere Lise Meitner, Tochter des jüdischen Rechtsanwalts Philipp Meitner aus Mährisch-Weißkirchen. Der progressive Freigeist betrieb in der Wiener Leopoldstadt eine Kanzlei als Hof- und Gerichtsadvokat und zählte Bildung und Kultur zu den höchsten Gütern. Meitners Mutter hatte zwischen 1876 und 1891 acht Kinder zur Welt gebracht, zuerst ein Mädchen, dann immer abwechselnd Jungen und Mädchen. Die Dritte dieser Reihe war Lise. Am 7. November 1878 geboren, interessierte sich Lise Meitner wie Marie Curie bereits als Mädchen für die Naturwissenschaften und Mathematik. Und weil auch ihr der gewünschte Bildungsweg verwehrt war, absolvierte sie ab Herbst 1889 die sogenannte „Bürgerschule“ am Czerninplatz, legte auf Wunsch des Vaters ein Lehrerdiplom für Französisch ab und erarbeitete sich dann die Matura im Selbststudium. Mehr als 50 Jahre später schrieb sie noch
immer mit Wehmut: „Wenn man an meine Jugendzeit zurückdenkt, so stellt man mit einem gewissen Erstaunen fest, wie viele Probleme es damals im Leben bürgerlicher junger Mädchen gab, die heute fast unvorstellbar erscheinen.“ Dank ihrer Beharrlichkeit konnte Lise
Meitner wie Curie alle Hindernisse überwinden. Mit 23 Jahren durfte sie sich im Herbst 1901 an der Universität Wien einschreiben, nur wenige Jahre nachdem Frauen in Österreich an Unis überhaupt zugelassen worden waren. Sie belegte die Fächer Physik, Mathematik und Philosophie und kam von 1902 bis 1905 in den Genuss von Ludwig Boltzmanns berühmten Vorlesungen. Noch Jahre danach schwärmte sie von dessen Kampf für die Anerkennung der Realität von Atomen und schilderte ihn als „voll Herzensgüte und Glaube an Ideale und Ehrfurcht gegenüber den Wundern der Naturgesetzlichkeit“. In ihrer Dissertation am Chemisch-Physikalischen Institut bewies Meitner, dass James Maxwells Formel für die Elektrizitätsleitung in inhomogenen Körpern ebenso für die Wärmeleitfähigkeit gilt. Das Rigorosum Ende 1905 bestand sie mit Auszeichnung, ganz sicher war sie sich über ihre Zukunft dennoch nicht. Erst als sie vom neuen Gebiet der Radioaktivität hörte, öffnete sich ihr der Weg, eine eigenständige Wissenschaftlerin zu werden. Sie begann zu publizieren und bewarb sich in Gießen wie wohl auch in Paris bei Marie Curie. Die Absagen bestärkten sie, ihre Ausbildung bei Max Plank in Berlin fortzusetzen, was sie später als Glück bezeichnete. Den berühmten Professor hatte sie in Wien kennenglernt, als dieser Nach-
David Rennert, Tanja Traxler: Lise Meitner. Pionierin des Atomzeitalters. Residenz, 220 S., € 24,–
folger von Boltzmann werden sollte, was er letztendlich ablehnte. 1907 reiste sie nach Berlin und wurde an der Friedrich-Wilhelms-Universität freundschaftlich aufgenommen. In der Hauptstadt des Deutschen Reichs
ernannte sie Planck eigenmächtig zu seiner Assistentin, was Frauen zu der Zeit in Preußen noch verwehrt war. Zudem traf sie auf den fast gleichaltrigen Chemiker Otto Hahn, der ebenfalls brennend am Phänomen der Radioaktivität interessiert war. Diese Jahre mit Hahn bezeichnete sie als die unbeschwertesten ihrer Karriere: „Die Radioaktivität und Atomphysik waren damals in einer unglaublich raschen Fortentwicklung; fast jeder Monat brachte ein wunderbares, überraschendes, neues Ergebnis. Wir waren jung, vergnügt und sorglos.“ Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 hatte die Idylle ein Ende, zumal Meitner aus einer jüdischen Familie stammte. Die Universität entzog ihr die Lehrbefugnis, und nach der Annexion Österreichs floh sie am 13. Juni 1938 mit nur zwei Handkoffern Gepäck über die Niederlande nach Stockholm, wo man sie am Nobel-Institut aufnahm. Sie hatte dort kein Labor mehr, als Diskussionspartner jedoch ihren Neffen Otto Robert Frisch. Mit Hahn blieb sie per Briefverkehr in engem Kontakt. Die Ergebnisse der Teams in Schweden und Berlin zur Kernspaltung und den dabei freiwerdenden Energiemengen elektrisierten Naturwissenschaftler weltweit. Dennoch wurde der Nobelpreis 1945 Otto Hahn allein zugesprochen. Die letzten acht Jahre ihres Lebens verbrachte Lise Meitner in Cambridge. Sie war nie an einer Biografie über sich selbst interessiert. Nun jährt sich am 27. Oktober ihr Todestag zum 50. Mal, was bereits einige Würdigungen zur Folge hatte. Auch David Rennert, Wissenschaftsredakteur beim Standard, und die Physikerin Tanja Traxler haben ihren Lebensund Erkenntnisweg neu nachgezeichnet. Ihr Buch beschreibt Meitners Lebensweg als außergewöhnliche Frau erfreulich klar, einfühlsam und für Laien bestens verständlich. A n dr é B e h r
7.–11. November Messe Wien & an rund 30 Locations in ganz Wien
Alberto Manguel rekapituliert 500 Jahre utopisches Denken er Schriftsteller, Übersetzer D und passionierte Leser Alberto Manguel, einst Vorleser des greisen
Jorge Luis Borges und Autor von in alle Weltsprachen übersetzten Bestsellern über das Lesen und die wahrhaft magischen Orte dieser Erde, die Bibliotheken, deutet gleich zu Beginn an, welches Schicksal Abenteurer ereilen kann. Noch mehr als um diese geht es ihm aber um die vielen Freibeuter der Vernunft, die dem Traum von einer gerechten Gesellschaft in den letzten fünf Jahrhunderten in kühnen Schriften nachgespürt haben. In seinem Buch „Sehnsucht Utopie“ versammelt Manguel 20 Porträts sowohl von Autoren als auch ihren Büchern. Mit seiner Auswahl rührt Manguel tief am Sehnsuchtsdenken des Menschen, für die seit Platons Idee von Atlantis die Literatur in Variationen einen Ort umkreist, den die einen Paradies, die anderen Eldorado nannten. Von Morus arbeitet sich Manguel zu Klassikern wie Rabelais, Francis Bacon oder Cyrano de Bergerac vor, erzählt aber auch einnehmend von weniger bekannten Visionären wie Vasco de Quiroga, Bartolomeo del Bene oder Tommaso Campanella. Manguels Stil und seine Gelehrsamkeit sind nie aufdringlich, sondern regen eher zu weiteren Lektüren an. Wunderbar ergänzt wird diese Reise durch die Jahrhunderte durch die zahlreichen Illustrationen und Abbildungen, die die Visionen der utopischen Denker erfahrbar machen. Für ein haptisches Erlebnis sorgen der Halbleineneinband, das dicke, hochwertige Papier, ein Lesebändchen, kurz: die schöne Ausstattung dieses wahrhaft prächtigen Bandes. B er n d S c h u c h ter
Alberto Manguel: Sehnsucht Utopie. Eine Reise durch fünf Jahrhunderte. Folio, 104 S., € 32,–
2018 Mi 7.11.
ACHT L ANGE N HER DER B0 –Ü2C4.0 0 h
Mit: Thomas Brezina, Arne Dahl, Heinz Fischer, Milena Michiko Flašar, Erich Hackl, Kate Morton, Richard Powers, Judith Schalansky, Margit Schreiner Richard Sennett und hunderten AutorInnen mehr!
buchwien.at
49
19.3
IEN MESSE W D HALLE
BUCH W I EN 18
50
F A L T E R 4 1 / 1 8 S a c h b u c h
Das Menschliche im Tier und das Tierische Biologie: Peter Iwaniewicz und Helmut Höge schreiben über Tiere und über Menschen, die sich mit diesen
T
wurde. Abgesehen davon geht es aber vor allem um Tiere und ihre Fähigkeiten sowie um den menschlichen Blick auf ihre tierische Umgebung – ganz besonders im Spiegel der Medienberichterstattung und der Leserbriefschreibkunst.
ierbetrachtungen haben Konjunktur. Monografien und Erfahrungsberichte von Annäherungen zwischen Mensch und Tier erscheinen in großem Stil. Vor allem Vögel zwitschern allerorten von Buchumschlägen, und sogar auf Büchern, wo keine Tiere drinnen sind, sind vorne Tiere drauf. Statt „Sex sells“ ist man fast versucht zu kalauern: „Animals sell“. Peter Iwaniewicz und Helmut Höge haben es allerdings absolut nicht notwendig, auf diesen tierischen Zug aufzuspringen, denn sie sind schon seit Jahrzehnten stabil damit unterwegs.
Schön wird Iwaniewicz’ Buch nicht nur durch
Ob sie einander nun persönlich kennen oder
nicht, spielt keine Rolle, denn es steht fest, dass es sich bei diesen beiden Biologen – der eine früh, der andere spät berufen – um Brüder im Geiste handelt. So bekennt Helmut Höge im Nachwort seines neuen Buchs „Die lustige Tierwelt und ihre ernste Erforschung“, dass das Lustige in seinem Titel daher komme, dass „vor allem die Tiere (zusammen mit den Pflanzen) mir noch so etwas wie Lebensfreude vermitteln“. Zeitlebens als tröstlich hat auch Peter Iwaniewicz die Beschäftigung mit Tieren empfunden. Als junger Mensch, schreibt er, sei ihm der Umstand, dass „man durch die Beobachtung von Wölfen, Hausschweinen oder Graugänsen etwas über sich und seine erratischen Mitmenschen erfahren könnte“, erschienen wie „ein helles Licht am Ende des Tunnels der Pubertät“. Falter-Leserinnen und -Leser kennen Peter Iwaniewicz. Der Wiener Biologe, Wissenschaftsjournalist und Kulturökologe ist ihnen seit mehr als 20 Jahren als Autor der Tierkolumne des Blattes vertraut. In seinem neuen Buch, das den etwas beliebigen Titel „Menschen, Tiere und andere Dramen“ trägt, erzählt er unter anderem beschwingt, wie er einst mit einem Beleidigte-Leberwurst-Brief das Herz des Herausgebers eroberte und zum Kolumnisten
Helmut Höge: Die lustige Tierwelt und ihre ernste Erforschung. Westend, 160 S., € 16,50
Peter Iwaniewicz: Menschen, Tiere und andere Dramen. Warum wir Lämmer lieben und Asseln hassen. Kremayr & Scheriau. 186 S., € 22,–
das zusammengetragene Faktenwissen: Denn wer will etwa nicht erfahren, dass ohne die „Dienstleistungen von Fliegen und Käfern“, die emsig Kuhdung wegräumen und verarbeiten, täglich allein in Österreich 24.000 Quadratmeter Wiese mehr zugeschissen bleiben würden? Oder dass der Wombat aufgrund seiner Darmbeschaffenheit würfelförmige Losungen absetzt („die Quadratur des Würstchens“)? Doch natürlich beschränkt sich Iwaniewicz nicht aufs Fäkalische: Es geht bei ihm genauso um den Giftgehalt von Wespe versus Honigbiene, um die fälschlich Fruchtfliege genannte Essigfliege, die eines der Lieblingsforschungsobjekte der Genetik ist, oder um die äußerst bedenkenswerte Frage, was passiert, wenn ein Insekt im Flug mit einem Regentropfen kollidiert. All das ist wunderbar, äußerst launig und stilistisch mit großer Eleganz dargestellt. Wirklich witzig aber wird es, wenn Iwaniewicz sich als Kommentator der Tierbetrachtungen anderer betätigt. Die medial hochgejazzten Dauerbrenner Kuh- und Haiattacke bekommen da genauso ihr Fett ab wie etwa der berühmte Tierlexikon-Verfasser Alfred Brehm, der als eingefleischter Vertreter Vorrangstellung des Menschen vor der übrigen Natur keine Gnade vor Iwaniewicz’ Augen findet. Wenn Brehm etwa das Nashorn als wenig alpintauglich geißelt („auf den Bergen springt es auch nicht mit der Leichtigkeit der Gämse herum“), reizt das Iwaniewicz zu ätzendem Spott: „Mangelnde Gebirgstüchtigkeit ist natürlich ein raffinierter Vorwurf für ein hauptsächlich in flachen Savannenlandschaften vorkommendes Tier.“
Wo der Mensch über Tiere schreibt oder seinesgleichen mit Tier- und Naturmetaphern zu beschreiben sucht, da verrät er zugleich seine ideologische Haltung. Deshalb geht es bei Iwaniewicz immer gleichermaßen ums Menschliche im Tier wie ums Tierische im Menschen. Gerade weil Tiere so vielfältige Emotionen in uns auslösen. Und sicher auch, weil sich manche tierische Handlungen auf so erheiternde Weise mit den unseren vergleichen lassen. Die Nähe zum Menschlichen drängt sich etwa auf, wenn Helmut Höge in seinem neuen Buch „Die lustige Tierwelt und ihre ernste Erforschung“ von einer Berauschungstechnik junger Delfine berichtet. Die Meeressäuger wurden schon mehrmals dabei gefilmt, wie sie einen Kugelfisch „wie einen Joint“ herumgehen ließen, um sich mit dessen ausgestoßenem Gift zuzudröhnen. „Wird da nun das Tier (...) hemmungslos vermenschlicht oder der Mensch vertierlicht?“, fragt Höge. Man weiß es nicht. Eines steht aber fest, wie der deutsche Wissenschaftsjournalist, Biologe und langjährige Tierpfleger schreibt: Innerhalb der Zoologie ist die Sparte der Verhaltensforschung mitsamt ihrem zentralen Vehikel, der Feldforschung, zugunsten von genetisch und molekular forschender Wissenschaft deutlich ins Hintertreffen geraten. Gerade deswegen bricht Höge eine Lanze fürs ebenso lohnende wie mühsame Geschäft der Tierbeobachtung. Sein Buch, das anders als das von Iwaniewicz alphabetisch mit Kapitelüberschriften von A wie Ameise bis Z wie Zitteraale aufgebaut ist, stellt ein Plädoyer für die Kunst der geduldigen, ausdauernden Tierbetrachtung abseits der Labore dar. Nach Höges Überzeugung ist es vor allem diese, die uns das Wesen von Tieren näherbringt. Sein Buch ist eine Hommage an all jene, die sich dieser Übung mit Leidenschaft unterziehen. Sehr, sehr schön. J u lia K ospa c h
S a c h b u c h F A L T E R 4 1 / 1 8
51
Hermelin mit Dame und ein lasziver Johannes Biografie: Volker Reinhardt zeigt den Ausnahmekünstler Leonardo da Vinci (1452–1519) in einem neuen Licht amilien wie die Borgia, Päpste wie Pius F II., Reformer wie Calvin und Luther, Philosophen wie Machiavelli und Künstler
wie Michelangelo: Volker Reinhardt veröffentlichte seit 2002 fast jedes Jahr einen gewichtigen Band über die Renaissance. Die Kapitel über die obersten Kirchenfürsten dieser Zeit bilden einen Höhepunkt in seinem letzten Buch „Pontifex. Die Geschichte der Päpste“ (2017). Nun, zum 500. Todestag, ist Leonardo da Vinci an der Reihe. Dass Reinhardt sich jetzt erst dem rätselhaftesten, von Mythen und immer neuen Deutungen umrankten Künstler der Renaissance annähert und ihn in ein geradezu provokativ neues Licht stellt, lässt die bisherigen Werke fast wie Vorbereitungen zum fesselnden Porträt des tief in die kulturelle und politische Umwelt verstrickten großen Außenseiters wirken. Mit allem, was zum guten Ton seiner Zeit ge-
hörte, lag Leonardo im Widerstreit, Humanisten und Dichtern misstraute er, sah in ihnen die Vertreter einer leeren Bildungshuberei. Aufgrund seiner unehelichen Geburt war ihm keine höhere Bildung zuteil geworden – daraus resultiert, wenn man so will, ein Minderwertigkeitskomplex, der sein Leben bestimmte. Die hoch angesehenen Alchemisten verachtete er. Sein größtes Anliegen war die rationale Erfassung der Kräfte der Natur. Wie er es mit der Religion hielt, blieb den Zeitgenossen verborgen. Die Homosexualität spielte im Vergleich zu den gesellschaftlichen Konflikten eine eher untergeordnete Rolle. Mehr Anstoß erregte er sein Leben lang dadurch, wie er mit seinen Auftraggebern umsprang, selbst wenn es sich um Cosimo da Medici in Florenz oder Lodovico il Moro in Mailand handelte. Oft vollendete er die bestellten Werke nicht, veränderte großzügig die Sujets, verwendete andere als die, wie zu dieser Zeit üblich, vertraglich vereinbarten Farben. Oder er führte den Auftrag gar nicht aus, wie das Porträt der Eleono-
ra d’Este, der berühmtesten Kunstsammlerin Italiens. So wurde nach und nach aus dem jungen Wilden ein schwieriger Alter. Seinem letzten Dienstherrn, dem französischen König Franz I., genügte die bloße Anwesenheit der schon zu Lebzeiten legendär gewordenen Künstlerpersönlichkeit an seinem Hof, die allein dafür großzügig bezahlt wurde. Giorgio Vasari, der Chronist der Renaissance und selbst ein mittelmäßiger, aber umso fleißigerer Maler, zeichnet das Bild Leonardos als verschlamptes Genie. Der aber hatte ganz anderes im Sinn als der gefällige Dekorateur und Geschichtenerzähler Vasari.
»
Leonardo sah die Überlegenheit der Malerei darin begründet, dass sie dem Menschen durch das Auge eine Faktizität und Authentizität suggeriert, deren Wirkung er sich kaum entziehen kann. Worte konnten da nicht mithalten
Was man nicht malen könne, könne man nicht
verstehen, lautete sein Credo. Die Malerei sah er deswegen nicht als Handwerk an, sondern als Philosophie und Welterkenntnis, die weit über der konventionell als erste der Künste angesehenen Dichtung stand. Danach kam für Leonardo die Musik – für den Hof verbesserte und entwarf er Instrumente. Dahinter rangierte die Bildhauerei, bei der man sich beschmutzte – ein gezielter Seitenhieb auf seinen größten Konkurrenten Michelangelo. Und ganz am Schluss rangierte die Poeterei … Wenn der Maler zum „Auge der Welt“ mutiert – so lautet Untertitel dieser Biografie –, wird die Bemühung um klassische Schönheit eitel. Das vollendete Werk tritt hinter das für sich sprechende Detail zurück, und „non finito“ bedeutet keinen Makel mehr: ein Grund dafür, dass viele von Leonardos ohnehin nicht sehr zahlreichen Gemälden unvollendet blieben, er sie nicht veräußerte. Am liebsten hätte er wohl ein Leben lang an ihnen weitergearbeitet – erst beim späten Cézanne begegnet man dieser Haltung wieder. Natur sieht Leonardo als ein Kontinuum vom Stein bis zum Menschen. Deswegen ist der landschaftliche Hintergrund oft wichtiger als die Figuren und ihre Geschichten, selbst in einem eleganten Porträt wie dem der Favoritin des Mailänder Herr-
Volk er R e i n hardt
Volker Reinhardt: Leonardo da Vinci. Das Auge der Welt. Biographie. C.H. Beck, 383 S., € 28,80
Der slowenische Karst und die Goriška brda/Collio Die Innerschweiz
Gailtal Großformat, 304 Seiten, durchgehend vierfärbig, gebunden, Lesebändchen, EUR 30,00 ISBN: 978-3-99029-235-8
Flandern Böhmen Sizilien Der dänische Süden Südoststeiermark
Danke für die schriftstellerische Umsetzung der ORF-Reihe.
Wıeser X
T h o mas L e i t n e r
Epirus: Der griechische Norden
Die toskanische Maremma Galicien
Aus den Tagebüchern, die die Hauptquelle Reinhardts bilden, spricht eine materialistische Sicht der Welt. Auch aus Leonardos religiösen Gemälden kann keine christliche Erbauung abgeleitet werden: Das „Abendmahl“ erwähnt höchst beiläufig die Einsetzung des Sakraments, im Zentrum steht Verrat, das Rätselraten um den Verräter, die Enttäuschung des Opfers. In „Anna Selbdritt“, das im Wiener Kunsthistorischen Museum zu bewundern ist, gelingt es den zwei Frauen nur mühsam, den ungebärdigen Jesusknaben davon abzuhalten, dem Lamm den Hals zu brechen. Eine Darstellung des Johannes ist so rätselhaft lasziv, dass ihn eine frömmelnde Favoritin Ludwigs XIV. über 100 Jahre später nur durch Retuschen in einen Bacchus verwandelt ertragen kann. Ein Glück für Leonardo, dass er in einem Milieu lebte, in dem Inquisition und kirchliche Kontrolle nicht so ausgeprägt waren wie im darauf folgenden katholischen Zeitalter des Barock. Reinhardt widmet sich natürlich auch anderen Facetten des „Universalgenies“ und den wechselnden Gründen für seine Verehrung, zunächst als Malerfürst, dann als Gründer der Naturwissenschaften, als faustischer Alchemist und Erfinder. Dass der Ausnahmekünstler mit seiner Zeit unversöhnt bleibt, macht er auch daran fest, dass Leonardo die der Natur abgetrotzten Geheimnisse hinter dem Lächeln der „Mona Lisa“ versteckt und so im Verborgenen hält.
Istrien
Siebenbürgen
Lausitz
schers steht ein emblematisches Tier so im Vordergrund, dass es eigentlich „Hermelin mit Dame“ heißen sollte statt umgekehrt. Natur ist ewig, vergänglich ist der Mensch, ja das Menschengeschlecht. Das steht im Widerspruch zum Christentum. Bei Skizzen von zerstörerischen Windund Wellenspielen kann man sich des Verdachts nicht erwehren, dass ein Ende des Humanen nicht ohne klammheimliche Freude antizipiert wird.
www.marcellinos.de
Großformat, 388 Seiten, durchgehend vierfärbig, gebunden, Lesebändchen, EUR 30,00 ISBN 978-3-99029-250-1
A-9020 Klagenfurt/Celovec 8.-Mai-Straße 12 Tel. +43 (0)463 37036 Fax +43 (0)463 37635 office@wieser-verlag.com
Buy local! Eine Aktion der ARGE Österreichische Privatverlage und unabhängiger Wiener Buchhandlungen Inserat Falter Geschmack NEU.indd 1
27.09.18 16:04
52
F A L T E R 4 1 / 1 8 S a c h b u c h
„Was ich gesucht habe? Gerechtigkeit!“ Südosteuropa: Kapka Kassabova erzählt berührende Geschichten aus einer unbekannten Grenzregion
K
apka Kassabova, 1973 in Sofia geboren, lebt als Journalistin und Autorin in Schottland. Sie schreibt für The Sunday Times und den Guardian, veröffentlichte mehrere Gedichtbände sowie ein Buch über ihre Kindheit in Bulgarien. „Die letzte Grenze. Am Rand Europas, in der Mitte der Welt“, ihre im englischsprachigen Raum bereits vielfach ausgezeichnete Reisebeschreibung des südosteuropäischen Länderdreiecks Bulgarien-Griechenland-Türkei, ist soeben auf Deutsch erschienen.
Falter: Was hat Sie zurück an die Südgrenze Bulgariens gezogen? Kapka Kassabova: Es ging mir weniger um eine Reise nach Bulgarien als vielmehr um das Grenzgebiet zwischen der Türkei, Bulgarien und Griechenland. Diese Grenze ist Ort großer Ungerechtigkeiten, in Zeiten des Kalten Krieges genauso wie heute mit den Flüchtlingen aus dem Nahen Osten. Was ich gesucht habe? Gerechtigkeit!
Sehen Sie das als die Aufgabe von Literatur an? Kassabova: Ich bin hinter dem Eisernen Vorhang aufgewachsen und weiß, was Ungerechtigkeit ist. Meine Reise war der Versuch, etwas zurechtzurücken, indem ich die Geschichte dieser Grenze erzähle. An diesem Ort sind im Lauf der Geschichte Hunderttausende in alle möglichen Richtungen gezogen, und es gibt keinerlei Denkmäler für all diese Displaced Persons. Das klingt jetzt ziemlich abstrakt. Kassabova: Natürlich ist dieser Ort auch eine Metapher, aber mein schriftstellerischer Instinkt sagte mir sehr rasch, dass ich auf wertvolles Erzählmaterial gestoßen war. Meine Hauptaufgabe bestand darin, den Menschen zuzuhören. Das Unternehmen fühlte sich wie ein Akt des Exorzismus an. Diese Gegend ist unheimlich, voller Geister, nichts ist zur Ruhe gekom-
men. Bei William Faulkner heißt es einmal: „Die Vergangenheit ist noch nicht tot, sie ist nicht einmal Vergangenheit.“ Sie meinen die Flucht von hunderttausenden Türken vor der Zwangsbulgarisierung in den späten 1980er-Jahren? Kassabova: Das war eine der großen Ungerechtigkeiten, von denen in England absolut niemand etwas gehört hat. Diese Geschichte wurde bis heute weder in Bulgarien noch in der Türkei wirklich beschrieben. Heute werden Millionen von Menschen aus dem Nahen Osten vertrieben – das hat mich fast noch mehr schockiert, weil es in Friedenszeiten passiert! Was haben Sie über die Pomaken, die sogenannten „BulgaroMohammedaner“, erfahren? Kassabova: Ich verbrachte einige Zeit mit Schmugglern. Mich interessierte,
Kapka Kassabova reiste zurück in ihre alte Heimat und sammelte Geschichten
wie Unterdrückung funktioniert, wie Menschen überleben und wieder Frieden herstellen. Das sind wichtige Momente einer Psychologie der Grenze. Für die Pomaken ist die Grenze selbst der Lebensinhalt. Sobald du Teil dieser Grenze bist, kannst du nicht mehr unschuldig sein, es gibt keine klaren Kategorien mehr, alles ist voller Ambivalenz. Ich kam mir vor wie in einem Labyrinth. Gibt es eine familiäre Beziehung zu dieser Gegend? Kassabova: Nein, es war auch für mich selbst ein gänzlich unbekanntes Territorium.
apka Kassabova beginnt die BeK schreibung ihrer Reise in das Ein sorgfältiger Dreiländereck Bulgarien-Griechenland-Türkei unprätentiös und ambitioniert zugleich. „Ich wollte wissen, was dort vor sich ging, 25 Jahre nachdem ich fortgegangen war.“ Ihr Buch ist ein sorgfältiger Bericht über die elende Alltagsnormalität eines Dutzends Menschen am Rande Europas. „Bleiben Sie eine Woche, und Sie werden nicht mehr fortkommen“, sagte eine alte Frau des „Dorfes im Tal“, in dem sich Kassabova einmietet. Sie trifft auf Arbeitslose, Schmuggler und Jäger, ein alter Grenzsoldat erzählt von den fehlgeschlagenen Versuchen, in die Türkei zu fliehen. An die 4000 Menschen nahmen dieses Wagnis auf sich, einige hundert wurden erschossen und umstandslosen verscharrt. Der Alte, von dem es heißt, er habe da-
Bericht über den Alltag am Rande Europas
Kapka Kassabova: Die letzte Grenze. Am Rand Europas, in der Mitte der Welt. Zsolnay, 383 S., € 26,80
Sie wuchsen in Sofia auf, waren bei der Emigration 16 oder 17 – war das kein Verlust der Heimat? Kassabova: Ich bin mit meinen Eltern unmittelbar nach dem Fall der Berliner Mauer emigriert – mein Vater, ein Computerwissenschaftler und Artificial-Intelligence-Forscher, bekam einen Job an einer Universität in Neuseeland. Ein Verlust war das nicht. Ich wollte weg. Ihr Buch beginnt mit einer kindlichen Liebesgeschichte am Schwarzen Meer, ganz am Ende erklären Sie die ekstatische „Liebe zu dieser Erde“. Welchen Anteil haben Dichterin und Journalistin beim Schreiben? Kassabova: Ich verstehe mich nicht als Journalistin, sondern als Schriftstellerin. Wie ich etwas schreibe, das kann ich nicht sagen. Ich analysiere es auch nicht, aber irgendwie findet die Poesie Eingang in mein Schreiben. Diese Gegend ist sehr alt, archaisch und reich an Mythen. Alles rührt dort von den Thrakern her, deren Geschichten und Legenden ich streife. Im Zentrum stehen aber lebendige Menschen. Das größte Paradox der Region besteht darin, dass es sich – obwohl immer unglaubliche Gewalt vorherrschte – um eine der schönsten Landschaften Europas handelt. Besteht da nicht die Gefahr von Exotismus und Romantisierung? Etwa der balkanischen Hirten ... Kassabova: Die Verantwortung, nicht zu romantisieren, war mir immer klar und die Brutalität der Geschichten, die ich hörte, hat mich davon ohnedies abgehalten. Der Balkan war seit der Antike eine Hirtengesellschaft. Das war einer seiner Reichtümer. Wichtige Elemente der Kultur – die Folklore oder die berühmten Chorgesänge der „Voix Bulgares“ etwa – stammen aus den Bergen. Mit dem Eisernen Vorhang wurde der Raum zerschnitten. Ich wollte beschreiben, was sich über
mals selbst getötet, schenkt der Journalistin zum Abschied eine Handvoll Zwetschken. Nicht weniger stark ist die Geschichte der „schönen Russin“, die Kassabova vor nächtlich herumstreifenden Frauen warnt, die ihre Wäsche verhexen könnten. Der von den bulgarischen Kommunisten staatlich organisierte Antikenschmuggel in den 1980er-Jahren ist die bizarrste Story des Buches. Die Goldschätze einer damals entdeckten thrakischen Nekropole wurden von der Akademie der Wissenschaften geplündert – Parteibonzen finanzierten damit ihr Luxusleben, Drehscheibe dafür war Wien. Omnipräsent in den Rhodopen ist der
heute weitgehend vergessene „Bevölkerungstransfer“ des Jahres 1989. „Es ist verlockend, eine Parallele zwischen
die Zeiten und die Grenzen hinweg davon erhalten hat. Welche unter den eigentümlichen, teils sehr robusten, aber auch skurrilen Personen ist Ihre Lieblingsfigur? Kassabova: Keine der öffentlichen Szenen, die ich erlebte – nicht einmal der orthodoxe Priester, den ich tanzen sah (lacht). Mich hat das Privatleben der Menschen am meisten verblüfft. Es hat mich nicht nur berührt, ich würde sogar sagen, die Begegnung mit einigen hat mich selbst zu einem besseren Menschen gemacht. Das waren Leute, die in materieller Hinsicht absolut nichts besitzen, aber Dinge tun, die sie lieben. Eine einfache, alte Bäuerin, deren Ehemann gestorben ist, die Kinder und Verwandten sind weg – aber sie widmet sich ihrem Garten mit absoluter Hingabe. Oder ein Rom in der Türkei, der das byzantinische Bergkloster St. Nikolas bewacht, weil der Staat sich darum nicht kümmert. Er ist seit 30 Jahren dort, hat absolut nichts, aber er liebt diesen Platz einfach. Solche Menschen inspirieren mich! Winston Churchill soll einmal gesagt haben, es gebe zwei natürliche Beschäftigungen des Menschen, Kriege führen und Gartenarbeit. Passt das auch zu Ihrer Grenze? Kassabova: Da halte ich es lieber mit dem Gärtnern. War es nicht Voltaire, der seinen Candide sagen ließ, dass wir uns um unseren eignen Garten kümmern sollen? Ich habe von diesen Menschen am Ostbalkan gelernt und wollte davon erzählen – in der Hoffnung, dass der Leser dasselbe tut. Um mit Ihrem Buch in das Rhodopen-Gebirge an der Grenze zu Griechenland zu fahren? Kassabova: Ich habe gehört, dass das schon einige gemacht haben. Die Straßen dort sind allerdings ziemlich schlecht. Intervie w: Erich K lein
der Vertreibung der bulgarischen Türken und dem Inferno zu ziehen, das bald darauf in der Nachbarschaft, in Bosnien, serbische Nationalisten anrichteten“, schreibt Kassabova. Und sie erinnert an einen weiteren Schandfleck in Bulgariens Geschichte: Zwar weigerte sich das Land im Zweiten Weltkrieg standhaft, seine jüdischen Bürger an die Nazis auszuliefern, aber um die Juden in den damals angrenzenden, bulgarisch besetzen Gebiete kümmerte sich niemand. Sie fielen dem Holocaust zum Opfer. Kassabova versteht es meisterhaft, Kulturgeschichte ohne Betulichkeit zu schildern: Die bulgarische Tabakindustrie, die Herstellung von Rosenöl oder die Brücken aus osmanischer Zeit kommen dabei ebenso zu ihrem Recht wie die größte Bauchtanzshow des Balkans. Erich K lein
S a c h b u c h F A L T E R 4 1 / 1 8
53
Ein Gemeindebau für die höheren Chargen Geschichte: Yuri Slezkine erzählt die Sowjetgeschichte der Privilegierten und Machthaber anhand eines Gebäudes
E
in riesiger grauer Kasten schräg gegenüber dem Kreml am rechten Ufer der Moskwa mit vielen Gedenktafeln an der Fassade. Der spätkonstruktivistische Wohnblock, der im Volksmund „Haus an der Uferstraße“ heißt, gehört neben den Stalintürmen zu den wichtigsten Landmarks der einstigen Welthauptstadt des Kommunismus. Heute würde man ihn als Erinnerungsort bezeichnen. Das für führende Parteimitglieder und hohe Regierungsbeamte zwischen 1928 und 1932 errichtete Gebäude hieß offiziell „Haus der Regierung“ und galt als Symbol des ersten Fünfjahresplanes: Die Sowjets nahmen damit den Sozialismus in Angriff, allerdings wurde auf sumpfigem Boden gebaut. Der in Berkley, Kalifornien, lehrende Russ-
landhistoriker Yuri Slezkine beschreibt es in seiner monumentalen Studie als eine „Saga der russischen Revolution“ in drei Strängen. Im ersten Teil wird die Vorgeschichte der künftigen „revolutionären“ Hausbewohner mehr als ausführlich in die Tradition messianischen Denkens vom Exodus der Juden über Jesus bis zu Karl Marx gestellt. Slezkine versteht die russischen Altbolschewiken vom Ende des 19. Jahrhunderts, soeben noch Gymnasiasten und Seminaristen, als Mitglieder eine Art Sekte, die – kaum an der Macht – zur Priesterkaste namens KP mutiert. Vorerst läuft Nikolai Bucharin – Lenin wird ihn als „Liebling der Partei“ bezeichnen – noch durch Moskaus Straßen zur Schule und protestiert als illegaler Sozialdemokrat gegen die Ungerechtigkeiten des russischen Kapitalismus. Die Sektierer des Kommunismus werden in Gefängnis, Verbannung oder Exil die Zeit ihrer Prüfung absolvieren – auf dass der Tag der Revolution komme. Michail Kolzow, Sohn eines jüdischen Flickschusters aus Kiew, besingt etwa voller Ekstase den Niedergang des Hauses Romanow und den Anbruch der neuen Zeit. Der junge Dichter Wladimir Majakowski umwirbt eine spätere Be-
wohnerin des Regierungs-Hauses mit Versen wie: „Kommt! / wir übermalen den Montag, den Dienstag / mit Blut zu Feiertagen!“ Die politische Religion verspricht, blutig zu werden. „Dies ist ein historisches Werk. Jede Ähnlichkeit mit Charakteren aus Romanen und Erzählungen, seien sie nun tot oder lebendig, wäre rein zufällig.“ Anders als das ironisch abgründige Motto des Buches, das die frühe Sowjetgeschichte in unzähligen biografischen Details neu aufrollt, behauptet, spielen Literatur, Autoren wie literarische Figuren, eine wichtige Rolle in Yuri Slezkines Gesellschaftspanorama der oberen 1000 des Sowjetkommunismus. Majakowski diente der Revolution und besang Lenin, Isaak Babel mythologisierte den Bürgerkrieg, gab en passant auch Unsägliches von sich: „Schlimmer als schlechter Geschmack ist Konterrevolution.“ Eine Ästhetik mit bisweilen tödlichen Folgen. Der verquere Stalinist Andrej Platonow ließ den Protagonisten einer Erzählung am Regierungshaus selbst mitarbeiten: „,Was wird hier gebaut?‘, fragte er einen Passanten. ,Ein ewiges Haus aus Eisen, Beton, Stahl und hellem Glas!‘, antwortete der. Makar beschloss, auf der Baustelle vorzusprechen, er wollte dort arbeiten und essen.“ Yuri Slezkine sieht auch die Schriftsteller, wiewohl künftige Opfer des Stalinismus, in der Verantwortung.
munisten, beziehen das Haus. Zu den Privilegierten gehören der Stoßarbeiter Aleksej Stachanow, Parteigrößen wie Jakow Swerdlow oder Karl Radek und Larissa Reisner, die „schönste Frau der russischen Revolution“. Der genannte Michail Kolzow ist mittlerweile zum sowjetischen Multifunktionär in Sachen Kulturarbeit avanciert und bezieht Wohnung 143 des Regierungshauses. Dessen 350 Wohnungen sind verhältnismäßig groß bis luxuriös; überdies verfügt der Moskauer Gemeindebau für höhere Chargen über ein eigenes Postamt, Wäscherei, Theater und Kino. Auch für Dienstpersonal ist ausreichend Platz vorhanden. „Die Linke erwartete das unmittelbar bevorstehende Ende des häuslichen Lebens; die Rechte freute sich darauf, die Häuser der Sowjets in ein richtiges Zuhause umzuwandeln.“ Eigentlich war das Haus eine Übergangslösung:
Im Jahr 1927 und auf Seite 400 fängt mit dem
Baubeginn des Regierungshauses der spannendste Teil des Buches an. Regierungschef Rykow ernennt den aus Odessa stammenden und damals in Italien lebenden Boris Iofan zum Chefplaner. Der sumpfige Untergrund birgt schier unüberwindliche Schwierigkeiten bei der Errichtung des Fundaments, das Budget muss mehrfach erhöht werden. 1931 ist es dennoch so weit – hunderte Offizielle, von Lenins Sekretärin, Stalins Verwandten und diversen Volkskommissaren bis zu hochrangigen Militärs, Künstlern und ausländischen Kom-
Yuri Slezkine: Das Haus der Regierung. Eine Saga der Russischen Revolution. Hanser, 1337 S., € 50,40
von überkommenen bürgerlichen zu proletarischen Lebensformen; aber auch in geschichtsphilosophisch höchst düsterem Sinn. Während Stalins „Großem Terror“ werden 800 Bewohner „gesäubert“, sie landen im Gefängnis oder im Gulag; 344 werden erschossen. Am 2. Februar 1940 wird auch Michail Kolzow, soeben noch Starberichterstatter aus dem Spanischen Bürgerkrieg und „Journalist Nr. 1“ der Prawda, hingerichtet. Die einstige Residenz der Nomenklatura hat sich in eine Totenburg verwandelt. Im Volksmund wir sie als „Haus der zweimal Aufgehängten“ bezeichnet – zuerst wurden die Helden der Revolution hingerichtet, dann bekamen sie Gedenktafeln. Am Ende von Yuri Slezkines imposantem Essay steht eine ausführliche Interpretation der Bücher von Juri Trifonow. Trifonow, einst selbst Bewohner des Hauses an der Uferstraße, beschrieb dessen Katastrophengeschichte am Beispiel seines Bolschewiken-Vaters in mehreren Romanen sehr viel kürzer und – horribile dictu – eleganter. E ri c h K l ei n
FA K T EN STAT T FA K E E I NE K A M PFAN SAG E AN DIE P O L ITIK DER UN WAH RH EIT EN .
Florian Klenk und Konrad Pesendorfer
Zahlen, bitte!
Was Sie schon immer über Österreich wissen wollten 120 Seiten, € 24,90
W: faltershop.at T: 01/536 60-928 E: service@falter.at L: in Ihrer Buchhandlung
FA LT E R V E R L A G
54
SACHBUCH
F A LT E R 41/ 18
Die Welt wird nicht überall schlechter Einige Herbst-Kochbücher bieten durchaus Anlass zur gegenteiligen Annahme: dass die Welt besser wird
D
ieser Herbst bringt erstens geschichtenerzählende Kochbücher. Zweitens sterben die Grundsatzwerke nicht aus. Drittens erkunden nicht nur Reiseführer die Welt, sondern auch Kochbücher. Viertens häufen sich heuer die Dessertbücher. Wenn die Welt bitter schmeckt, muss man sie versüßen. Ein verblüffendes Geschichtenbuch legt die als Fernsehköchin und Filmcatererin bekannt gewordene Sarah Wiener vor. Ihr Gerichte, die die Welt veränderten verblüfft weniger der Idee wegen, Geschichte anhand von Rezepten nachzuerzählen, sondern durch die eigene Stimme, die Wiener beim Erzählen entwickelt und die sich deutlich abhebt von der nicht immer glaubhaften Spontaneität ihrer TV-Serien. Hier erzählt sie Geschichte zwar anekdotisch, aber amüsant und keineswegs oberflächlich, sozusagen im geistreichen Plauderton. Das liest man gern, und auch die Rezepte kann man brauchen, zumal sie wirklich historisch sind. Das erste stammt aus Cäsars Zeit, von Apicius, dann geht’s recht flott ins 19. Jahrhundert und in die jüngere Gegenwart, etwa zu den Pancakes der schwarzen Bürgerrechtlerin Rosa Parks, zur Hühnersuppe von Sherpa Tensing und Edmund Hillary, den Mount-Everest-Erstbesteigern, zum Kuchen der deutschen Fußballweltmeisterinnen oder zum Hauptgang nach Barack Obamas zweiter Angelobung. Gut gemacht, Sarah! Ein erprobter Geschichtenerzähler ist Lojze
Wieser, der nach dem ersten Band nun den zweiten von Der Geschmack Europas vorlegt. Der Kärntner Slowene, Buchverleger im Hauptberuf, Erzähler und Poet der Neigung nach, begibt sich diesmal mit seinem TVTeam nach Istrien, Epirus, Flandern, Böhmen, in den dänischen Süden und nach Fünen, nach Sizilien und in die Südoststeiermark. Band eins wurde heuer in China mit dem Gourmands International Award in der Kategorie des weltbesten TV-Film-Begleitbuchs ausgezeichnet. Seine schönen Europa-Bücher sind vor allem lakonisch-poetische Tagebücher einer programmatischen kulturell-kulinarischen Reise, deren nächste Etappe man gespannt erwartet. Den Kontrast zu den anekdotischen bilden die grundsätzlichen Kochbücher. Yotam Ottolenghi ist sozusagen eine Bank. Der in London kochende Israeli hat das Publikum schon mit einem halben Dutzend Kochbüchern überzeugt, die den Geschmack der Zeit treffen. Sein neuestes trägt den Titel Simple und folgt dem Prinzip, nicht mehr als zehn Zutaten pro Rezept zu verwenden.
Sonja Stötzel: New York Food Trends. Gräfe und Unzer, 240 S., € 30,90
Teubner: Kuchen und Torten. Gräfe und Unzer, 312 S., € 43,20
Man kann ihm nicht nur bei OttolenghiFollowern reißenden Erfolg voraussagen. Allein fünf Zucchini-Rezepte bringen Erlösung in vom Überfluss dieses Gemüses geplagte Küchen. Das genaue Gegenteil legt Dr. Stuart Farrimond mit seinem Buch Kochen in Perfektion im gleichen Verlag vor. Farrimonds Schicksal erweckt Anteilnahme. Der ausgebildete Mediziner musste wegen eines bösartigen Gehirntumors operiert werden und war gezwungen, anschließend seinen Beruf aufzugeben, da sich eine Epilepsie entwickelte. Er wandte sich dem wissenschaftlichen Publizieren zu. Sein Buch erklärt in anschaulicher Wort- und Bildsprache, was beim Kochen passiert, und gibt Antworten auf alle Fragen, die man sich in der Küche stellt: wann salzen, scharf anbraten, Gemüse schälen oder schrubben und so weiter. Nichts bleibt unbeantwortet, die fotografische und grafische Aufbereitung ist aufwändig und doch sensationell klar. Anthony Sarpongs Anthony’s kommt da nicht ganz mit, obwohl sich der ghanaisch-deutsche, mit einem Michelin-Stern geschmückte Koch bemüht, seine Rezepte in gut illustrierten Step-by-Step-Anweisungen aufzubereiten. Die Fotos machen den Prozess nachvollziehbar, und es gibt auch nützliche Hinweise, zum Beispiel zum Testen der Qualität von Olivenöl. Schöne Salattipps und neben Verblasenerem (frittiertes Eigelb mit Selleriecreme, in die Eischale eingefüllt) auch Machbares wie Flammkuchen oder Tajine. Zu den monumentalen Kochbüchern zählen auch jene von Lisl Wagner-Bacher. Die hochdekorierte Köchin aus der Wa-chau legt mit Meine österreichische Küche ein unprätentiöses Werk und eine Art Testament vor. Es finden sich Klassiker aus ihrer Zeit im Mauterner Landhaus Bacher wie ihr Kaviar-Ei und ihr gebeizter Saibling mit Erdäpfelblini, der Zander mit Erdäpfel-Krautfleckerln oder das Bohnenfleisch mit Ripperl oder das Cantucciniparfait. Alles gut machbar und durch eine Auswahl schnell kochbarer Gerichte sinnvoll ergänzt. Das Süße tritt uns zuerst in Form von Flachen Kuchen entgegen. Obwohl das bewährte
Team um Ilse König, der Soziologin unter den Kochbuchautorinnen, auch ein paar salzige Flachkuchen anbietet, wird jeder Freund von Crostata, Charlotte, Pie oder Quiche hier bestens bedient. Cremig-international liebt es die Engländerin Hannah Miles. In ihren Himmlischen Desserts fin-
Haya Molcho (Neni): Tel Aviv. Brandstätter, 256 S., € 35,–
Ilse König: Alle lieben flache Kuchen. Brandstätter, 208 S., € 29,–
Sarah Wiener: Gerichte, die die Welt veränderten. edition a, 288 S., € 24,90
det man üppige Trifles, sich aufplusternde Windgebäcktorten und cremige Schokoladen-Pistazien-Marquisen, Mousses, Parfaits und Schichtdesserts. In eine dritte Richtung deuten Bernhard Wiesers und Michael Rathmayers Die Wiener Zuckerbäcker. Sie wählen aus bekannten Wiener Konditoreien die besten Rezepte aus; man kann sozusagen zu Hause nachbacken, was einem die Profis im Geschäft servieren. Zwei kleine Wermutstropfen notiert der Rezensent: Erstens fehlt bei der Konditorei Heiner das Grillageschifferl, und zweitens sind – wohl mit Absicht, da sie (wie auch Heiner) eigene Kochbücher haben – weder Demel noch Sacher vertreten. Trost: Der Sluka ist dabei. Das vierte süße Buch ist so klassisch, dass es nicht einmal einen Autor nennt. Teubners Buch der Kuchen und Torten bietet Grundlagenwissen. Wer eine Teigsorte sucht oder die richtige Art zu glasieren oder Cremes zu produzieren, wird auf dieses Buch nicht verzichten können. Drei „Reisekochbücher“ noch zum Schluss.
Hannah Miles: Himmlische Desserts. Gerstenberg, 144 S., € 20,60 Bernhard Wieser, Michael Rathmayer: Die Wiener Zuckerbäcker. Pichler, 176 S., € 28,– Wolfgang Sievers: La cucina veneziana. Braumüller, 200 S., € 25,–
Lisl WagnerBacher: Meine österreichische Küche. Brandstätter, 272 S., € 35,–
Haya Molcho besucht mit ihren vier Söhnen Tel Aviv, dessen Köche und Restaurants und berichtet von einem kulinarisch wahrlichen Multikulti-Way-of-Life. Die Gerichte sind schlicht und lassen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen, seien es vegetarische Sarma, Weiße-Bohnen-Vorspeise oder der geschmorten Kohl mit Ziegenkäse und Chimichurri. Gar nicht trendig, vielmehr auf Dauer angelegt ist Wolfgang Sievers’ La Cucina veneziana. Mit offensichtlich auf intimer Kenntnis der Sache beruhendem Hintergrundwissen erzählt uns Sievers alles, was wir über Venedigs Küche wissen müssen. Allein das Rezept der handgerührten Stockfischcreme ist den Kauf des Buchs wert. Ein Klassiker. Wer wie der Autor die fetten Pancakes in ukrainischen New Yorker Frühstücklokalen gewohnt ist und doch genug New Yorker ist, um zu wissen, dass sich nirgends die Dinge schneller ändern als dort, wird Sonja Stötzels New York Food Trends mit Vergnügen lesen. Pancakes macht man heutzutage mit Ricotta und Honigbutter. Wichtig: Vergessen Sie nicht die knusprigen Blütenpollen! Stötzel erschließt uns auch wenig bekannte Viertel wie Brooklyns Greenpoint mit seinen handwerklichen Bäckereien. Wer hätte so etwas noch vor wenigen Jahrzehnten, in der Ära von Gummibrot und Plastikkäse, für möglich gehalten? Es wird nicht alles schlechter auf der Welt. AR MIN THURNHER
Yotam Ottolenghi: Simple. Das Kochbuch. DK, 320 S., € 28,80–
Dr. Stuart Farrimond: Kochen in Perfektion. DK, 256 S., € 25,70
Lojze Wieser: Der Geschmack Europas II. Wieser, 300 S., € 30,–
300 WITZE IN STREIFEN
DER SCHN EEM A N N , D ER D EM SCH M E L ZE N SE I T 30 JA H R E E I N SCH N I PP C HEN S CHL ÄGT.
NEU
Tex Rubinowitz
Wilbur
Die aufregend fremde Welt eines Schneemanns Seit 30 Jahren befindet sich regel mäßig an den unterschiedlichsten Stellen im FALTER ein Comicstrip mit einem Schneemann, der sich weigert zu schmelzen, einer Ente namens Manfred und dem kleinen rotznäsigen Tobias. Das Buch versammelt 300 durch gehend farbige Comicstrips aus drei Dekaden und behandelt alle Themen menschlichen Daseins und Versagens. 96 Seiten, € 19,90
W: faltershop.at T: 01/536 60-928 E: service@falter.at L: in Ihrer Buchhandlung
FA LT E R V E R L A G DIE BESTEN SEITEN ÖSTERREICHS
MO. 12.11.2018 WIEN, BURGTHEATER