FA LTER
Nr. 42b/24

Nr. 42b/24
77 Bücher auf 48 Seiten

ILLUSTRATION: GEORG FEIERFEIL
Belletristik: Gastland Italien +++ Peter Henisch: Il mio vaggio italiano +++ Fe te Wälzer +++ Schlanke Short Stories +++ Kinderbücher von Michael Hammerschmid, Peter Stamm, Sa š a Stani šić und vielen anderen +++ Sachbuch: Israel und der Nahostkonflikt +++ USA vor den Wahlen +++ Yuval Harari +++ Identitätspolitik +++ „Unlearn CO2“ +++ Wien und die Moderne +++ Gillian Andersons „Want“



















AUTORIN


25,50
Judith W. Taschler Nur nachts ist es hell
Elisabeth, das jüngste der vier Brugger-Kinder, arbeitet im Ersten Weltkrieg als Lazarettschwester und studiert danach Medizin. Sie heiratet den Sohn einer Wiener Ärztefamilie, der verletzt von der Front zurückgekehrt ist. Gemeinsam führen sie eine Praxis in Wien.
eBook: € 16,99

Matt Haig
Die Unmöglichkeit des Lebens
25,50
Als Grace, eine pensionierte Mathematiklehrerin, von einer fast vergessenen Freundin ein heruntergekommenes Häuschen auf einer Mittelmeerinsel erbt, siegt ihre Neugier. Ohne Rückfugticket, Reiseführer oder einen Plan fiegt sie nach Ibiza.
eBook: € 19,99 | Digitales Hörbuch: € 17,95




27,50
Arno Geiger Reise nach Laredo
Karl hat sich in ein abgelegenes Kloster in Spanien zurückgezogen. Er ist krank und wartet auf sein Ende. Doch dann begegnet er dem elfjährigen Geronimo, und gemeinsam beschließen sie, davonzureiten, nachts, auf Pferd und Maulesel.
eBook: € 19,99 | Digitales Hörbuch: € 19,95

29,50
Yuval Noah Harari NEXUS
Das neue Buch des Bestseller-Autors zeigt, wie Informationsnetzwerke unsere Welt geformt haben und nun bedrohen. Es untersucht, wie Gesellschaften und politische Systeme Informationen nutzen, um ihre Ziele zu erreichen – sowohl positiv als auch negativ.
eBook: € 26,99 | Digitales Hörbuch: € 19,95




23,50
Alex Beer Die weiße Stunde
Wien 1923: In einer politisch angespannten Stadt, in der die Hakenkreuzler auf dem Vormarsch sind, wird die bekannte Gesellschaftsdame Marita Hochmeister brutal ermordet in ihrem Schlafzimmer aufgefunden.
eBook: € 16,99 | Digitales Hörbuch: € 21,95




23,50
Philipp Blom Hofnung – Über ein kluges Verhältnis zur Welt
Wir haben uns angewöhnt, mit dem Schlimmsten zu rechnen, und mussten oft genug erleben, dass es noch schlimmer kam. Gibt es wirklich keinen vernünftigen Grund mehr, zu hofen?
eBook: € 16,99

DKlaus Nüchtern ist für die schöne Literatur zuständig
er Hang zum fetten Roman hält unvermindert an. Neben zwei Schwarten mit 1000 und drei mit rund 700 Seiten finden sich in dieser Beilage aber auch einige äußerst schlanke Formate. Was bekanntlich nicht zwingend etwas über die Qualität aussagt. Die Frage „Does Size Matter?“ bleibt wieder mal offen.
GASTLAND ITALIEN
Il mio vaggio in Italia: Peter Henisch bespricht das Opus magnum von Dolores Prato und durchstrei! sein literarisches Italien 4–5
„Wie ein wilder Go “ von Gianfranco Calligarich 6
Giulia Caminito „Das große A“ 7 „Kassandra in Mogadischu“ von Igiaba Scego 7 Natalia Ginzburg über „Das imaginäre Leben“ 8 „Kalte Füße“ von Francesca Melandri 8
ZWISCHENGANG I
Sofia Andruchowytsch beendet ihre Triologie „AmadokaEpos“ mit der „Geschichte von Sofia“ 10 „Theodoros“ von Mircea C ă rt ă rescu 11
Maria Stepanova mag es schlank: „Der Absprung“ 12 „Die große Versuchung“ von Mario Vargas Llosa 12
AUS HEIMISCHEM ANBAU
Max Oravin „Toni & Toni“ 14 „Der beste Tag seit langem“ von Jana Volkmann 14
Judith W. Taschler „Nur nachts ist es hell“ 15 365 Texte für 365 Tage von Monika Helfer 16
EBENFALLS IN DEUTSCHER SPRACHE 1042 Seiten! „Projektoren“ von Clemens Meyer 18 Anatol Regnier erinnert sich an seine Jugend 18 Diskursgewi er: „Odenwald“ von Thomas Meinecke 19 Tine Melzer macht „Do Re Mi Fa So“ 19
ZWISCHENGANG II
„Der Eremit des Friedens“ von Juhani Aho 19 Elif Shafak reist durch die Zeiten: „Am Himmel die Flüsse“ 20
IN ENGLISH, PLEASE
Téa Obreht „Morgenlicht“ 21 „Verlorene Sterne“ von Tommy Orange 22 Richard Powers mag’s ozeanisch: „Das große Spiel“ 23 „Ours. Die Stadt“ von Phillip B. Williams 24 Kurzgeschichten und kurze Texte von Margaret Atwood und Lydia Davis 25

Gerlinde Pölsler betreut das Sachbuch und das Kinderbuch
Komas Köck Andra Rotaru
Ulrike Haidacher
Knaß Jessica Lind Cordula
Clemens Setz
Bilderbücher
Heuer beziehungslastig und jedenfalls unterhaltsam 26 Kinderbücher von Sa š a Stani š i ć , Peter Stamm, Marta Palazzesi 28 Jugendbücher
Über Queerness und Fleißigseinmüssen 29
WELTGESCHEHEN
Reiter
Gerald Heidegger
eresia Töglhofer
Christoph Dolgan
Florian Klenk
Daniela Strigl Barbara Zeman
urz nach dem Jahrestag des 7. Oktober schauen wir, wie es Juden und Palästinensern geht; kurz vor den US-Wahlen lesen wir eine böse Geschichte der Staaten. Weiters: Wie lässt sich CO2 verlernen? Und: Sinnsuche, Selbstoptimierung und sexuelle Fantasien von Frauen, au ereitet von Gillian Anderson. Junges Literaturhaus
Eine Geschichte der Palästinenser von der Gründung Israels bis zum 7. Oktober 30 Natan Sznaider über „Die jüdische Wunde“ 31 Warum führt der Mensch Krieg? 32 Navid Kermanis „Reise durch Ostafrika“ 33 „Die Welt der Gegenwart“: Geopolitik in Karten 33 „Black as F***“, eine böse Geschichte der USA 34 Der Wert der Wokeness (samt kritischen Anmerkungen) 35 Timothy Snyder über die bedrohte Freiheit 36 Yuval Hararis „Nexus“ über Informationsnetzwerke 36
GESCHICHTE, GEIST, GESELLSCHAFT Nachkriegsphilosophie: „Geister der Gegenwart“ 37 Als „Brave New World“-Autor Aldous Huxley vor 100 Jahren Europa bereiste 37 Wir müssen „CO2 verlernen“. Aber wie? 38 „Salze der Erde“, Kolonialismus und Klima 39 Be ina Balàka über das Zähmen und Ausbeuten der Natur 39 Als Wien die moderne Welt erfand 40 Die Geschichte der arabischen Welt 40 Europas 1. großer Volksaufstand: 500 Jahre Bauernkrieg 41
PSYCHOLOGIE, KULTUR, LEBEN „Götzendiener“: Graphic Novel von Joann Sfar 42 Wofür? Eine Sinnfindungsreise 42 Vom verdrängten Nazi-Erbe 43 Gillian Andersons Sammlung „Want“ 44 Über Selbstoptimierung und Todesangst 45 „Colorful“: Das Vermächtnis der Stilikone Iris Apfel 45 Armin Thurnhers kritische Kochbuchauslese 46

Günther Eisenhuber Alberto Grandi Vea Kaiser
Erste LesebühneGrazer
Ein Abend fürFriederike Mayröcker Grundbücher
Oravin
Erich Klein Vladimir Vertlib Olga Flor
Christine Scheucher Ljuba Arnautović Marco Balzano
Daniela Seel Miljenko Jergović
Rossmann
Gertrude Grossegger
AlfredKolleritschPreis manuskriptePräsentation
Ransmayr
Ein Abend fürHelena Adler
Lederwasch
Tomic
Schorsch Feierfeil ist Illustrator, Grafiker und Animationsfilmemacher. Seit vielen Jahren zeichnet er regelmäßig für den Falter. Zudem gestaltet er Albumcovers und animiert Musikvideos. Einen Überblick seines künstlerischen Schaffens und die Möglichkeit einen Kunstdruck zu erwerben, bietet seine Homepage: www.schorschfeierfeil.com Falter 42b/24 Herausgebe r: Armin Thurnher Medieninhaber : Falter Zeitschri! en Gesellscha ! m.b.H., 1011 Wien, Marc-Aurel-Str. 9, T: 01/536 60-0, F: 01/536 60-912, E: wienzeit@falter.at Redaktion: Klaus Nüchtern, Gerlinde Pölsler Herstellung: Falter Verlagsgesellscha ! m.b.H.; Layout: Barbara Blaha; Korrektur: Helmut Gutbrunner, Rainer Sigl; Geschä ! sführung: Siegmar Schlager; Leitung Sales: Ramona Metzler Druck: Passauer Neue Presse Druck GmbH, 94036 Passau DVR: 047 69 86. Alle Rechte, auch die der Übernahme von Beiträgen nach § 44 Abs. 1 und 2 Urheberrechtsgesetz, vorbehalten. Die O ff enlegung gemäß § 25 MG ist unter www.falter.at/o ff enlegung/falter ständig abru ar Bücher-Herbst ist eine entgeltliche Einschaltung aufgrund einer Subvention durch das Bundesministerium für Kunst, Kultur,
Günter Eichberger
Zweites Halbjahr 2024


Erstmals liegt das Opus magnum von Dolores Prato, „Da unten auf der Piazza ist niemand“, in seiner vollständigen Fassung auf Deutsch vor
I
n ihrem Gutachten zu Dolores Pratos im Jahr 1978 bei Einaudi in Turin eingelangtem Manuskript schrieb die damals für den Verlag lektorierende Autorin Natalia Ginzburg Folgendes: „Das Buch ist sehr schön. Es war 1250 Seiten lang. Ich habe es gekürzt. Jetzt sind es etwa 300.“
Man kann es sich gut vorstellen: Hier Natalia Ginzburg, die beim Schreiben und Überarbeiten ihrer eigenen Texte streng darauf bedacht war, nichts Überflüssiges stehen zu lassen; und da, vor ihr auf dem Schreibtisch, dieses ausufernde Opus einer Frau, die sich ihre eigene Kindheit erzählen, erklären, die Verborgenes und Verlorenes aufspüren und wiederfinden will, anscheinend ohne den geringsten Gedanken an so etwas wie Schreibökonomie.
LEKTÜRE: PETER HENISCH hat sie nicht mehr erlebt. Jetzt liegt diese auch auf Deutsch vor, sorgfältig übersetzt von Anna Leube und ergänzt um ein Nachwort der deutschen Schri stellerin und Übersetzerin Esther Kinsky. Prato erzählt darin die Geschichte eines Kindes, dessen Bewusstsein unter einem Tisch erwacht. Die Geschichte eines Kindes, das sich danach sehnt, aufgehoben, in den Arm genommen, überhaupt wahrgenommen zu werden. Eine Sehnsucht, die der Protagonistin ihr Leben lang bleiben wird. Auf der Suche nach der verlorenen und daher immer aufs Neue herau eschworenen Kindheit. Ein unerwünschtes (überflüssiges) Kind, das von der Mutter, die bereits vier andere Kinder hat, bei entfernten Verwandten deponiert worden ist. In Treia, einer kleinen Stadt in den Marken. Der „Onkel“, offenbar ein geistlicher Herr, die „Tante“, seine Schwester. Das Haus, in dem sie wohnen, eine Casa del Beneficio, strahlt Kälte aus.
„Ein bisschen kürzen und straffen wird dem Text guttun.“ Natalia Ginzburg war eine ehrenwerte Frau, aber mit diesem Urteil und ihren Eingriffen in den Text hat sie sich geirrt. Selbstverständlich hatte es Gespräche mit Frau Prato gegeben, etliche Sitzungen, in denen diese jedoch, aus Respekt vor der berühmten Kollegin, nicht zureichend protestiert haben dür e. Dann war das Werk immerhin zwischen zwei Buchdeckeln erschienen, 1980, als Taschenbuch, aber Dolores Prato war nicht glücklich damit und hinterlegte das vollständige Manuskript in einer renommierten Bibliothek in Florenz.
1983 ist Prato mit 91 Jahren gestorben. Die Publikation der vollständigen Fassung von „Unten auf der Piazza ist niemand“ (1997)
Dennoch versucht die Autorin Jahrzehnte später, jedes Detail dieses Hauses zu evozieren. Das Muster der Fliesen, auf denen das kleine Mädchen sitzt, die hart gewordenen Brotkrumen, die unter den Tisch gefallen sind, die Unterseite der Tischplatte, die Tischbeine, die Fransen des Tischtuchs. Und jedes Detail des Ortes, der dieses Haus umgibt. Das ist der Ort, zu dem sie gehört, ob sie will oder nicht, der Ort, der sie geprägt hat.
Die akribische Beschreibung von Haus und Ort – vielleicht ein Versuch, Halt zu finden. Als ob die Erwachsene einen Anker
Italo Svevo: „Zenos Gewissen“ • Der Protagonist Zeno Cosini will sich das Rauchen abgewöhnen und sucht deshalb einen Analytiker auf. Als der Roman entstand, war die Psychoanalyse noch relativ neu, Svevo, durchaus von ihr inspiriert, geht ironisch mit ihr um. Er überlässt dem Arzt, dessen Behandlung er sich mittendrin entzogen hat und der Zenos Aufzeichnungen nun „als Rache“ publizieren will, das Vorwort und behauptet seinerseits, manches bloß erfunden zu haben, um den Analytiker zu täuschen. Sehr schön auch ein paar Freud’sche Fehlleistungen des Helden, der in manchen Szenen ein wenig an manche von Chaplin verkörperte Figuren erinnert.
Curzio Malaparte: „Die Haut“ • 1943, nach der Landung der Alliierten. Ein bitterarmes Neapel, in dem sich die ragazzi darum reißen, den Ami-Soldaten die Schuhe zu putzen und alte Frauen Kinder zum Sex anbieten – „two dollars the boys, three dollars the girls“. Malaparte ist zweifellos ein Zyniker, vielleicht aber auch ein verkappter Moralist. Wie soll man sich gleichzeitig besiegt und befreit fühlen? Und wie kann man trotz allem überleben? Ein grauenha es Buch, ein großartiges Buch, ein großartig grauenhaftes. O missverstanden, aber letzten Endes ein Buch gegen den Krieg.
Italo Calvino: „Der Baron auf den Bäumen“ • Die Familie, aus der der kleine Held ausbricht, ist eine sehr feine Familie. Und das Schneckengericht, französisch angerichtet, gilt als besondere Gourmandise. Nicht für Cosimo.
Peter Henisch wurde 1943 in Wien geboren. Er studierte Geschichte, Germanistik und Philosophie und war Mitbegründer der Zeitschri Wespennest Er verfasste zahlreiche Romane, Theaterstücke und Hörspiele, zuletzt erschien sein Roman „Nichts als Himmel“ (2023). Seit vielen Jahren verbringt Henisch einen Teil des Jahres in San Quirico d’Orcia in der Toskana
auswürfe in die Vergangenheit, um sich am Tau oder an der Kette, an der dieser Anker hängt, in die Kindheit zurück zu ziehen. Das ambivalente Gefühl dieser Kindheit gegenüber. Einer Kindheit gegenüber, die sie nicht loswird. Sie hängt an der Kittelfalte der alten Tante, die sich kaum nach ihr umdreht, nie zu ihr herabneigt. Sie nennt sie versuchsweise Mama, aber das will die Tante nicht hören. „Man hat mich nicht ausgebrütet“, schreibt Dolores Prato. Das Fehlen der mütterlichen Wärme sei die Ursache von allem.
Niemand habe sie hochgehoben, auf den Schoß genommen, sie richtig angesehen. Das ist ein Gefühl, das ihr geblieben ist, der Basso continuo ihrer Lebensmelodie. Weit holt sie mit ihrer Geschichte aus, auf den fast tausend Seiten, die der Text nun umfasst; es vergehen – auch wenn nicht chronologisch erzählt wird – Jahrzehnte, aber unablässig kreist die Erinnerung um dieses Zentrum, diese leere Stelle, an der die Liebe fehlt. Die Basisliebe, die ein Leben in Schwung bringt.
Wenn Erwachsene das kleine Mädchen fragen, wie es heißt, antwortet es mit „nein“. Sie ist nun einmal da, sagt die Tante zum Onkel – aber anscheinend will sie gar nicht da sein. Sie isst nichts. Sie magert ab. Sie hat kaum mehr Gewicht. Ein Schatten von einem Kind. Wenn der Hund mit dem Schweif wedelt, fällt sie hin. Was tun? Die Tante will sie nach Loreto gebracht und in der Basilika auf die Stufe vor den Altar der Madonna gelegt haben, wo sie nach vielen
Fortsetzung nächste Seite
Er steht von der der Tafel auf, läu in den Garten und steigt auf einen Baum. Komm herunter!, ru sein Vater, immerhin ein Baron, aber der Sohn folgt nicht. Wenn dir das Sitzen da oben zu dumm wird, sagt der Vater, wirst du’s dir schon anders überlegen. Werde ich nicht, sagt Cosimo. Sein jüngerer Bruder bewundert ihn. Was für ein schönes Buch aus antiautoritär bewegten Zeiten!
Natalia Ginzburg: „Die Stimmen des Abends“ • Das Buch spielt in Turin und Umgebung. Oder nicht? „In dieser Erzählung“, schreibt die Autorin, „sind Orte und Personen erfunden ... Es tut mir leid, dies zu sagen, denn ich habe sie geliebt, als wären sie wirklich.“ Die Ginzburg schreibt einfache, elementare Sätze und lapidare Dialoge. „Natalia sagt keine Wörter, sie benennt Dinge.“ So Italo Calvino, der ihre Texte mit den Bildern des Malers Rousseau vergleicht. Eine Erzählung über das Schweigen und Verschweigen, über die Liebe zwischen Menschen, die nicht zusammenkommen.
Antonio Tabucchi: „Erklärt Pereira“ • Lissabon im August 1938. Pereira, Redakteur einer erst vor kurzem gegründeten Zeitung namens Lisboa, ist ganz allein in der Redaktion, der Herausgeber auf Urlaub. Pereira soll die Kulturseite zusammenstellen. Alles Mögliche geht ihm durch den Kopf, aber vor allem denkt er an den Tod. Er engagiert einen jungen Mann als Mitarbeiter, der Nachrufe auf noch lebende Autoren auf Halde schreiben soll. So beinah surreal lässt sich dieser Text an. Aber bald wird klar, dass
Malapartes
Roman ,Die Haut‘ ist ein grauenha es Buch, ein großartiges Buch, ein großartig grauenha es
er vor dem Hintergrund faschistischen Terrors des Salazar-Regimes spielt. Ein philosophisches Buch, ein Buch voll Ironie und Melancholie, das im Finale fast zum Politkrimi wird.
Giulia Caminito: „Das Wasser des Sees ist niemals süß“ • Der Lago di Bracciano. Ein See, nicht weit entfernt von Rom, an dem es einmal schön war. Heute sieht es dort anders aus: Allerlei Unrat auf dem Grund des Sees, verbaute Ufer. Hier bezieht das Mädchen Gaia mit ihrer Familie eine Sozialwohnung. Die verhärmte Mutter hat nur einen Wunsch: Gaia soll nicht so enden wie sie, aus ihr soll etwas werden. Bildung soll helfen, die Klassenschranken zu überschreiten. Aber die Verhältnisse, die sind nicht so. Mit Wut und Mut (und manchmal auch Anmut) geschrieben.
Paola Mastrocola: „E se covano i lupi“ („Wenn die Wölfe brüten“) • Wunderbar: die Geschichte eines Wolfs, der eine Ente liebt. Die Ente brütet die Eier aus, Produkt ihrer etwas ungewöhnlichen Beziehung. Der Wolf aber, ein Philosoph, der sich Gedanken über Gerechtigkeit macht, beschließt, seine Geliebte beim Brüten abzulösen und ihr den freien Flug hinaus in die Welt zu ermöglichen. Von da an laufen die Geschichten parallel: hier der brütende Wolf, dort die fliegende Ente. Die Gans beginnt eine journalistische, stark feministisch orientierte Karriere. Bislang leider nicht ins Deutsche übersetzt.
PETER HENISCH
Fortsetzung von Seite 5
Tagen zum ersten Mal „Hunger“ sagt. Die Muttergottes habe sie geheilt. Aber vielleicht hat sie eher der Doktor geheilt, Doktor Guerra, der der Tante geraten hat, dem Kind einen Löffel Eigelb mit Marsala vor die Nase zu halten. Was die Tante auch tut, mit Engelsgeduld. Das süße Angebot wird angenommen. Ist da nicht doch eine Spur von Zuwendung?
Trotzdem wird die Kleine noch lange nicht fest auf zwei Beinen stehen. Von einem Ungleichgewicht in ihrem Leben wird sie später, wenn sie groß ist, schreiben. Manchmal könnte sie immer noch auf der Stelle umfallen. Aber sie hat einen entscheidenden Beistand, den Heiligen Geist. Und der ist zweifellos eine Stütze. Sie lebt (überlebt) ja in einem geistlichen Haus. Der Onkel, dessen schüchterne Liebe sie erst später begreifen wird, hat ihr ein Medaillon umgehängt. Darauf ist der Geist als Taube mit ausgebreiteten Flügeln zu sehen. Umgeben von Strahlen und der Inschri „Veni Sancte Spiritus“ – etwas, was vielleicht nachhaltig wirkt. Noch aber ist sie ein Kind, das übersehen wird. Als junges Mädchen in einem katholischen Internat wird es ihr kaum besser gehen. Doch dann, als erwachsene Frau, will sie sich selbst wahrnehmen. Als Lehrerin in Privatschulen in Mailand und Rom, als Betreuerin eines psychisch kranken, jungen Mädchens, und – ja, schlussendlich auch – als Autorin.
„Ein riesiger Korb voller Leute, Ängste, Wunderdinge von Worten, die sich bewegten – das war die Stadt; ich schaute hierhin, ich schaute dahin, manchmal flüchtete ich,
manchmal war ich entzückt und wusste nicht, dass ich unglücklich war ... Alles, was sich bewegte und in der Lu ertönte, war vielleicht das Leben. Zu jener Zeit hatten die wenigen Wörter, denen ich begegnete, alle ein Gesicht, doch das Leben hatte keins.“
„Dolores Pratos Sprache“, schreibt Übersetzerin Anna Leube, „ist in der italienischen Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts einzigartig.“ Diese Autorin erfindet keine Neologismen, sie treibt keine Wortspiele. Sie ist eher Spracharchäologin, die im Akt des Schreibens Material aus tieferen Schichten freilegt, das bis dahin verschüttet war – im eigenen so wie im kollektiven Bewusstsein. Sie geht der Sprache nach, in der sich die sozialen Unterschiede widerspiegeln.
„Letztlich bestand der Unterschied zwischen den Gesellscha sschichten darin, ob man einen Spitznamen hatte oder nicht. Wir hatten keinen. Die Armen immer. Der wahre Name der Unterschicht, ob arm oder begütert, war der Spitzname: die Essenz des Individuums, das sich den Menschen enthüllt hatte, die dieses Individuum leben sahen.“
„Alle regten sich auf über das Elend. Die einen sagten per la miseria oder auch managgia la miseria, andere porca miseria. Sie schimp en auf das Elend, um es noch übler zu beleidigen, blieb manchmal das porca, doch statt des miseria benutzten sie ein anderes Wort, das auch mit M anfing, und das war dann ein echter Fluch.“ (Kursivierungen P.H.)

Roman. Aus dem Italienischen von Anna Leube. Mit einem Nachwort von Esther Kinsky. Hanser, 976 S., € 39,10
In den volkstümlichen Worten spielt das gesprochene Wort die größte Rolle. „Der Ton“, schreibt die Prato, „war der Verstärker der Bedeutung. Er verlieh den Wörtern die ganze Verachtung, zu der ein Mensch fähig ist; du bist ein Ekel, marsch! Ich hatte das Wort nie benutzt; doch ein paar Mal äußerte ich es in den Monaten der deutschen Besatzung.“
Dolores Prato ist fast 70, als sie an ihrem Hauptwerk zu arbeiten beginnt. Schreibend verleiht sie den aufsteigenden Erinnerungen eine neue Bedeutung. Der Schweif des Hundes hat sie umgeworfen, ja, aber das sieht sie nun nicht als Niederlage, sondern als Erkenntnis. Der Name des Hundes, Sile, erweist sich als der Name eines Flusses. Eines Flusses, der ihr zum Sinnbild wird. Überraschend ist, dass der Onkel seinem Hund den Namen dieses Flusses gegeben hat. Eines Flusses weit weg von Treia, im Norden. Das begrei die Protagonistin allerdings erst gegen Ende des Buches, als sie bereits 70 ist. Unversehens erwacht da eine etwas überraschende Liebe zu ihrem Onkel, an den sie sich anfangs nur als kalten, abweisenden Menschen erinnert hat. Eine Art nachgelieferte Liebe und ein Interesse an seiner Herkun , über die er wenig oder nur vage gesprochen hat. Einer Herkun , die sie sich nun zu vergegenwärtigen versucht. Die Poebene, „Land ohne Vertikalen, Land und Vegetation, die sich, kaum tauchen sie auf, schon im Wasser spiegeln“. Und der Fluss Sile, der nicht ins Meer mündet, sondern in vielen, sich durchs Deltaland verzweigenden Armen leise verschwindet. F
Mit dem Roman „Wie ein wilder Go “ bricht Gianfranco Calligarich zu einer kolonialen Expedition auf – mit zu leichtem Gepäck
Auf der Suche nach aktuellen Versionen von Dantes „Inferno“ bringen Schristeller gern den Topos Afrika ins Spiel. Joseph Conrads „Herz der Finsternis“ gilt als Maß aller Dinge, verbindet dessen aufwühlende Prosa doch kolonialen Albtraum mit psychischem Ausnahmezustand. In dieser Tradition ist auch Gianfranco Calligarichs Roman „Wie ein wilder Gott“ zu sehen, der ein reales Ereignis aufgrei : die Expedition des Afrikaforschers Vittorio Bottego (1860–1897) in das Ende des 19. Jahrhunderts noch kaum erforschte Abessinien.
Im deutschsprachigen Raum wurde Calligarich durch eine literarische Kuriosität bekannt: „Der letzte Sommer in der Stadt“, eine zauberha melancholische Liebesgeschichte im Rom der 1960er-Jahre, war im Erscheinungsjahr 1973 ein Bestseller, verschwand aber bald wieder in der Versenkungen. 2022 veröffentlichte der Zsolnay Verlag die deutsche Übersetzung und verhalf dem heute 77-Jährigen zu einem späten Comeback. An die wunderbare Leichtigkeit seines Frühwerks vermag der Autor allerdings nicht anzuschließen.
Calligarich grei ein verdrängtes Kapitel der italienischen Geschichte auf. Auf der Suche nach kolonialen Gebieten sandte das Königreich Italien Truppen nach Eritrea und Abessinien (Äthiopien). Beide Vorstöße endeten mit einem Desaster. Sowohl
in der Schlacht bei Dogali (1887) als auch in jener von Adua (1896) bezogen die Italiener Prügel, eine schwere Kränkung des Nationalgefühls.
Genau in diesen gefährlichen Jahren unternahm Bottego Expeditionen, um den Lauf von Flüssen zu vermessen. Während die erste Reise mit einem gefeierten Triumph endete, starb der Abenteurer 1897 bei einem Überfall von Indigenen. „Wie der französische Dichter Arthur Rimbaud verfiel Bottego dem dunklen Herz Afrikas“, notierte der bekannte Journalist Indro Montanelli 1957. Selbst aus Eritrea gebürtig, rekonstruiert Calligarich Bottegos Biografie – teilnahmsloser und sprachlich schütterer als Joseph Conrad. Das liegt auch an dem erzählökonomisch fragwürdigen Kunstgriff, die Handlung aus der Sicht eines Zeitgenossen erzählen zu lassen. Der pensionierte Präsident der Geographischen Gesellscha lernt Bottego Anfang der 1890er-Jahre kennen und lässt dessen Leben anhand von Tagebüchern Revue passieren, räsoniert wiederholt über Alter und Gedächtnis. Der Kniff hat allerdings den Nachteil, dass das Herz nicht in der Finsternis, sondern am Schreibtisch einer römischen Villa schlägt. Recht trocken werden die Strapazen referiert: Hunger, Hitze, Fieber und die Überfälle lokaler Stämme erschweren das Weiterkommen. Dazu kommt die beständige

Gianfranco
Calligarich: Wie ein wilder Go . Aus dem Italienischen von Karin Krieger. Paul Zsolnay Verlag, 206 S., € 24,70
Angst vor dem äthiopischen Kaiser, der Italien den Krieg erklärt hat. Realistischer wirken jene Szenen, in denen der Afrikaforscher wegen der Finanzierung seiner Expedition bei Politikern vorstellig wird oder die Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern und Gegnern kolonialer Expansion. König Umberto I. schmäht die Gegner überhaupt als primitive Affen.
Francesca Melandri ist mit ihrem Roman „Alle außer mir“ (2018) eine informative Lektion über Italiens von Kriegsverbrechen und Rassismus geprägte Kolonialzeit geglückt. Auch „Wie ein wilder Gott“ erinnert an Strafexpeditionen und Folter. Der au lärerische Impuls geht freilich verloren, wenn der Autor auf klischeeha e Formulierungen zurückgrei . So versinkt eine Einheimische „in ihrer schwarzen Wildheit“ und ist „auf afrikanische Weise“ entschlossen. Der bürokratische Tonfall wird dem Protagonisten nicht gerecht. Bottego wird zwar als ehrgeiziger Militär vorgestellt, der „nichts und niemanden je würde lieben können, außer sein Entdeckerleben“. Das Porträt dringt aber selten in das Innenleben dieses Fanatikers vor, der in der Wildnis die bürgerliche Herkun abstrei . Die Altersmilde des Erzählers speckt die Etappe des kolonialistischen Ironman zum Verdauungsspaziergang ab.
MATTHIAS DUSINI
In „Kalte Füße“ gelingt es Francesca Melandri, Faschismus und Ukraine-Krieg, Privates und Politisches zusammenzudenken
Wer die Alpini kennt, die Gebirgsjäger des italienischen Heeres mit der Prunkfeder am Hut, der kann in etwa nachvollziehen, warum sie im Zweiten Weltkrieg von den sowjetischen Truppen als Hühner beschimp wurden. Eine Zeit lang retteten sich die Hühner vor einem Gegenschlag, indem sie die feindliche Seite mit schaurigem, täuschend echtem Wolfsgeheul auf Abstand hielten.
So hat es der Alpini-Offizier und Journalist Franco Melandri seinen Töchtern erzählt, und dass bei solchen Kindergeschichten die Kriegsgräuel außen vor blieben, liegt auf der Hand. Familienlegenden dieser Art ließen den Vater als mutigen Davongekommenen erscheinen, als listigen Odysseus. Als „anständigen Faschisten“. Wobei die Sache mit dem Faschismus gänzlich aus dem Fokus geraten war.
Mit ihrem Roman „Alle, außer mir“ (2018) wurde Francesca Melandri international bekannt. Auch in diesem weit ausholenden Familienepos ging es um die Macht kollektiver Mythen, um die italienische Kolonialgeschichte – und um einen Vater, der keine Auskun mehr geben kann, als ein äthiopischer Flüchtling behauptet, zur Familie zu gehören. Ihr jüngstes Buch „Kalte Füße“ dagegen ist kein Roman, sondern ein Gattungsgrenzgänger aus Memoir, Zeit-Kommentar und erinnerungspolitischem Essay.
„Jirro
Kalte Füße haben, ganz unmetaphorisch, die italienischen Soldaten, die beim sogenannten „Rückzug aus Russland“ in der Schneewüste starben oder mit abgefrorenen Gliedmaßen im Lazarett landeten. Die Füße des Sohnes sind es auch, die Franco Melandris Mutter nach dessen Rückkehr zuerst ansieht: Hat er noch alle Zehen? Erst dann fällt sie in Ohnmacht.
Kalte Füße zu bekommen, ist aber auch die Metapher der Stunde, wenn es um das Verhältnis des Westens zur Ukraine geht. Wer glaubt, dass der Krieg au ört, weil man nicht weiter hinschaut, verhalte sich mindestens verantwortungslos, so die Autorin. Für sie ist diese gegenwärtige Verdrängung eng gekoppelt an viel ältere Formen der Auslöschung und des Nicht-Wissen-Wollens. Sie reichen von der jahrhundertealten, in Putins Russland fortgesetzten Unterdrückung ukrainischer Kultur und Sprache bis zur Weigerung eines beachtlichen Teils der Linken, den russisch-sowjetischen Kolonialismus als solchen wahrzunehmen. Als ob nicht auch Burjaten, Jakuten oder Ewenen bedroht waren und sind; nicht zuletzt, weil sie im Ukrainekrieg an vorderster Front verheizt werden.
Eine Anrede an den Vater zieht sich dabei als beharrliches Mantra durch das gesamte Buch: „dein Russlandfeldzug, der größtenteils ein Ukrainefeldzug war“. Denn

die italienische Invasion der Jahre 1941 bis 1943 spielt sich vor allem am Donbass, in Charkiw, Sumy oder Isjum ab. Im privaten Sprachgebrauch, so Melandri, schlägt auch das Unbewusste einer Gesellscha Wurzeln; im Familienwortschatz wiederholt sich die Nichtexistenz der Ukraine. Verschwiegen wurden aber nicht nur die ertragreichen Plünderungen dieses Feldzugs: „Dass wir selbst die Verbündeten der Nazis gewesen waren, daran wollte man lieber nicht mehr rühren.“
Neben dem verdrängten Faschismus geht es Melandri aber genauso um die Frage, ob der friedliche, reiche, mehr oder weniger unbehelligte Westen überhaupt verstehen kann, was Krieg ist. „No justice, no peace“ lautet ihre wütende Antwort an diejenigen, die nur „peace“ fordern und damit Putin, direkt oder indirekt, entgegenkämen. Das Gegenteil von Krieg ist Rechtsstaatlichkeit, hält Melandri fest, und ihr Plädoyer ist so leidenscha lich wie unbequem. Vor allem aber ist „Kalte Füße“ eine eindrucksvolle literarische Spurensuche nach den kleinen und großen Mythen, aus denen Überzeugungen entstehen. Ein Brief an den Vater, der die ganze Bandbreite gemischter Gefühle wiedergibt und damit etwas schafft, was meistens nur Behauptung bleibt: Privates und Politisches zusammenzudenken. JUTTA PERSON
Die römische Schri stellerin Igiaba Scego begibt sich mit „Kassandra in Mogadischu“ auf die Spuren ihrer somalischen Familie
Auf dem Buchumschlag sind drei schwarze Frauen in bunten, festlichen Kleidern zu sehen. Die mittlere hält ein Kind im Arm, die Frauen links und rechts von ihr legen ihr, wie zur Unterstützung, die Hand auf Schulter und Oberschenkel. In dem neuen Buch der römischen Schri stellerin mit somalischen Wurzeln, Igiaba Scego, geht es um den Kampf um solch innige Verbindungen zwischen Menschen. Gleich zu Beginn schreibt sie über ihre Familie, die „wie alle somalischen Familien der Diaspora, über fünf Kontinente zerstreut“ sei. „Zerrissen vom Krieg, der uns getroffen hat, von den Katastrophen, von einer alten Diktatur, von Tod und Liebe. Und jede Trennung zerstört uns. Versprengt uns. Vernichtet uns.“
„Kassandra in Mogadischu“ ist als Roman ausgewiesen, trägt abern klar autobiografische Züge. Die Namen hat Scego nicht verändert ihr eigener ist auch jener der Erzählerin. Diese schreibt einen Brief an ihre Nichte Soraya Omar Scego, die, wie man bald erfährt, die junge Waris Dirie in dem Film „Die Wüstenblume“ gespielt hat. Dirie, ein aus Somalia stammendes Model, erregte mit ihrer Autobiografie Ende der 1990er-Jahre weltweit Aufsehen und setzt sich seither gegen die Genitalverstümmelung von Frauen ein. Drei Jahrzehnte zuvor war Scegos Vater, Ali Omar Scego, unter an-
derem Bürgermeister von Mogadischu. Die Eltern mussten fliehen, als 1969 der Diktator Siad Barre an die Macht kam. Ihre Kinder dur en sie nicht mitnehmen. In Rom, wo sie sich eine neue Existenz au auten, wurde ihre jüngste Tochter, Igiaba, geboren.
Scegos Brief an ihre Nichte ist der Versuch, die Geschichte einer Familie, die über Kontinente verstreut ist, erzählend festzuhalten. Archive und Fotoalben wurden in den vielen Kriegen zerstört. Was bleibt, sind mündliche Überlieferungen und der persönliche Austausch mit jenen, die noch am Leben sind; was aber alles andere als einfach ist. Soraya etwa, die in Quebec lebt, spricht kaum Somali, aber auch kein Italienisch, kann sich mit ihrer Großmutter nur schwer verständigen.
Im Zentrum stehen Scegos Mutter und die Gespräche mit ihr; darüber, wie sie als Nomadin in Somalia aufwuchs, schon dort Gewalt erlebte, wie sie als El ährige in die Stadt kam und beschnitten wurde und ihr Leben lang unter der Verstümmelung litt. Als Erwachsene wurde sie die Frau eines Politikers und First Lady von Mogadischu. Immer wieder kehrt Scego in die Silvesternacht des Jahres 1990 zurück. Während sie als 16-Jährige auf eine Party ihrer römischen Schulklasse geht, bricht in Somalia der Bürgerkrieg aus. Ihre Mutter ist nicht da, denn sie hat die italienische Hauptstadt
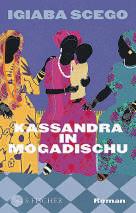
kurz davor verlassen und ist nach Mogadischu gereist. Niemand kann in Erfahrung bringen, wie es ihr geht und ob sie noch lebt. Nach dem Sturz des Diktators Barres versinkt Somalia im Bürgerkrieg.
Das Buch kreist um den Begriff des „Jirro“, das somalische Wort für Krankheit. Doch es bedeutet noch viel mehr, wie Scego erläutert: „Es benennt unsere Verletzungen, unseren Schmerz, unseren posttraumatischen, kriegsbedingten Stress. Jirro ist unser gebrochenes Herz. Unser Leben auf der Kippe zwischen Hölle und Gegenwart.“
Die Autorin folgt nicht strikt der Chronologie der Ereignisse. Sie erzählt von den Kriegen und den vielen Toten. Sie liebt ihre Stadt, Rom, und sehnt sich nach einem Mogadischu, das es nicht gibt. Sie thematisiert den Kolonialismus der Italiener und Briten in Somalia, besucht mit ihren Neffen ein römisches Museum, das sich nun mit der geraubten Kunst auseinandersetzen will, und berichtet vom Rassismus, den ihre Familie o zu spüren bekam.
Scego findet eine Sprache für die Zerrissenheit der Diaspora, für Krieg und Vertreibung, an einem wenig bekannten Schauplatz afrikanischer Geschichte. Mit „Kassandra in Mogadischu“ trägt sie dazu bei, dass Somalia wieder mehr ist als der „gescheiterter Staat“ am Horn von Afrika. STEFANIE PANZENBÖCK
Das Roman-Debüt „Das große A“ von Giulia Caminito arbeitet sich an der italienischen Kolonialgeschichte ab
Italien war unter den Kolonialmächten ein kleiner Spätling. Umso aggressiver verhielt sich in den 30erJahren des vergangenen Jahrhunderts das italienische Militär, das von Eritrea aus Äthiopien annektierte. Mussolini und die Seinen träumten von einem großitalienischen Reich.
Als Giulia Caminito sich des im kollektiven Bewusstsein nur schwach verankerten Themas annahm, war sie in ihren Zwanzigern und hatte noch kein Buch veröffentlicht. Zu Hilfe kam ihr bei der Arbeit die Tatsache, dass ein Teil ihrer Familie im damals sogenannten Abessinien gelebt hatte. Die zahllosen Geschichten und Geschichtchen, die sie in ihrem Erstlingsroman – zwei weitere sind bereits ins Deutsche übersetzt – erzählt, hat sie von ihrer Großmutter gehört, die sie eigens interviewte. Ein Anlass, ein Hoch auf die Großmütter auszurufen:
Schon Gabriel García Márquez hatte seine „Hundert Jahre Einsamkeit“ aus den o mals fantastischen Geschichten seiner Oma gezogen. „Das große A“ braucht den Vergleich mit dem berühmten kolumbianischen Roman nicht zu scheuen, auch wenn der Anteil des Phantastischen hier doch etwas geringer ist.
Um aus den Großmuttergeschichten einen Roman zu machen, braucht es schri stellerische Disziplin. Über diese verfügt die studierte Enkelin. Zugleich bewahrt sie den erzählerischen Schwung, die Fabulierfreude, die aus den alten kolonialen Zeiten herstammen mag: Wenn nicht von der Großmutter, dann vielleicht von deren Mann, über den es im Buch heißt, seine Geschichten seien mit „nie gesehenen kostbaren Bildern angereichert“, sodass sie am Ende „besser als jedes Buch“ wirken würden.
Die Oma ist im Roman ein junges Mädchen, das die Kriegszeit in der Nähe von Mailand durchsteht und später nach Afrika geschickt wird, wohin ihre Mutter Adele geflüchtet ist – geflüchtet nicht vor den Faschisten, sondern vor der Enge der Ehe mit ihrem aus Sizilien stammenden Mann.
Diese Mu er ist nicht gerade das, was man treusorgend nennt, aber die Bande zu ihr sind stark, und so baut sich Giada mit ihrer Hilfe in Abessinien eine Existenz auf, zuerst in Assab, dann in Asmara, zuletzt in Addis Abeba: lauter A, größere und kleinere. Caminito zündet in ihrem Roman mithilfe der Familienüberlieferung, aber noch mehr mithilfe der eigenen Imaginationskra ein regelrechtes Feuerwerk aus Detailbeschreibungen, Situationen, Geschichten, atmosphärischen Eindrücken. Über Afrika und die Afrikaner, zuletzt auch über ihre Aufstände gegen den äthiopischen
Negus und die Kolonialherren erfahren wir wenig; umso mehr über die Italiener und Engländer, die in Abessinien koloniale Enklaven bildeten.
Zu einem einzigen Afrikaner entwickelt Giada eine etwas engere Beziehung, sie bringt ihm im Café der Mutter, wo die beiden jungen Leute kellnern, Lesen und Schreiben bei. Ansonsten aber: italienische Clubs, italienischer Kaffee (wenn auch salzig), italienischer Ehemann (wenn auch mit spanischem Nachnamen), italienische Firma, italienische Zeitschri en, italienische Mode. Dazu ab und zu ein griechischer Freund, eine französische Freundin.
Mehr oder weniger träge geht die Kolonialzeit zu Ende, und das Finale des Romans spielt in Italien, wo das Wirtscha swunder bereits am Abebben ist. In Rom, wo die Olympischen Spiele von 1960 gerade vorbei sind, wird nach wie vor fleißig gebaut, die Hauptstadt wächst rapide.
Caminito hat mit ihrem Erstling einen weitgehend blinden Fleck auf der literarischen Landkarte sichtbar gemacht, den Fleck des Kolonialismus; so wie Antonio Pennacchi in „Canale Mussolini“ einige Jahre zuvor ein anderes stiefmütterlich behandeltes historisches Thema sichtbar gemacht hatte: die Trockenlegung der Pontinischen Sümpfe.
Beide Bücher werfen ein etwas anderes Licht auf den Mussolini-Faschismus, als dies die auf den Heroismus der Resistenza fixierten Erzählungen der Jahrzehnte nach dem Krieg getan haben. Mussolini hatte in der Bevölkerung einen breiten Rückhalt, ohne den manch eine Kra anstrengung des Regimes nicht möglich gewesen wäre.
Caminito erzählt sprudelnd und o kursorisch kreisend, setzt bewusst Wiederholungen ein, neigt zu Aufzählungen, manchmal etwas selbstverliebt gegenüber den eigenen Einfällen und der Sprache mit den überraschenden Bildern. Der Kritiker lässt sich gern von der Großzügigkeit des Erzählens anstecken und sieht ein, dass gewisse Nachlässigkeiten unvermeidlich sind, wenn in der Leere der Wüste oder der Kargheit von Kriegszeiten nach paradiesischer Fülle gestrebt wird.
LEOPOLD FEDERMAIR

Der Band „Das imaginäre Leben“ gibt Gelegenheit, Natalia Ginzburg beim Nachdenken zuzusehen
Es ist eigentlich egal, ob man die 18 Texte von Natalia Ginzburg (1916–1991), die der – neu aufgelegte – Band „Das imaginäre Leben“ versammelt, Kurzprosa, Skizzen, Feuilletons oder Selbstbefragungen nennt. Sie sind irgendwo dazwischen angesiedelt und bis auf eine Ausnahme nur wenige, dichte Seiten lang.
Viel wesentlicher ist es, über den Ton zu sprechen, in dem die große italienische Autorin, Essayistin und Parlamentarierin sie gehalten hat. Dieser Ton ist völlig unverstellt und so einfach wie die klaren Züge einer von erfahrener Meisterhand geschnitzten Holzmaske: alles Wesent-
Es ist einer der großen Verdienste von Natalia Ginzburg, aufzuzeigen, dass manche Widersprüche nicht aufgelöst werden können
liche vorhanden, kein Firlefanz, große Expressivität.
Natalia Ginzburg befragt sich in diesen Texten selbst, erforscht ihre Gefühle und Motive, Sehnsüchte und Fantasien, ihre Beziehungen zu Menschen und Orten, unternimmt Vergleiche zwischen unterschiedlichen Lebensaltern. Sie tut das ruhig und in gemessenem Tempo.
Das Spektrum ihrer Themen ist breit und man könnte auch sagen: disparat. Es geht um ihre Kindheit, um die tiefe Verbundenheit mit der Stadt Rom, ums Reisen, für das man äußerst unbegabt sein könne, und um den Sommer, den man wie sie zutiefst hassen kann; es geht ums Judentum, um die Sexualität und immer wieder um die Familie und das Generationengefüge.
Darüber hinaus macht sich die Autorin Gedanken über die „doppelte Natur“ der Intellektuellen, denen zwar die Privilegien von Bildung und reichem Wortschatz zur Verfügung stünden, die sich aber umgekehrt gerade deswegen selten in die Lage von Menschen versetzen könnten, die nicht über diese Mittel verfügen.
Ginzburg gelangt zu der Einsicht, dass politisches Denken und Handeln immer bedeutet, eine Absicht zu verfolgen, und sie fragt sich, wie es kommt, dass sie sich als Jüdin allen Juden verbunden fühlt, obwohl sie nicht glaubt, „dass es Au eilungen nach Blut gibt“ („Die Juden“). In wenigen Strichen
zeichnet sie die „Verzweiflung der Adoleszenz“ nach („Sommer“) und staunt über unsere Zeit, „in der wir den Kindern weitschweifige Erklärungen über jeden Aspekt des Universums zu geben pflegen“ („Die Kindheit und der Tod“).
Manche ihrer Überlegungen besitzen eine geradezu unheimliche Aktualität – etwa jene, ob man sich auf die Seite des Staates Israel stellen soll: „Die Menschen und die Völker machen sehr rasche und schreckliche Veränderungen durch. Die einzige Wahl, die wir haben, ist, auf der Seite jener zu sein, die zu Unrecht sterben oder leiden.“ Andere Einträge wiederum sind ganz der Zeit ihrer Entstehung verha et („Die Frauen“) und wirken aus heutiger Sicht fast rührend vergangen.
Wie um deutlich zu machen, dass sie Erfahrungen mit anderen teilt oder es sich um kollektives Erleben handelt, sind einige von Ginzburgs Stücken in der ersten Person Plural verfasst; etwa wenn sie der Frage nachgeht, wie sich der Gehalt, den der Begriff „Freiheit“ in ihrer Jugendzeit hatte, mit dem Älterwerden verändert hat: „Schon lange haben wir angefangen zu denken, dass Freiheit vielleicht eines der dunkelsten, schwierigsten, kompliziertesten Wörter ist, die es auf der Welt gibt.“
Es ist dies ein typischer Ginzburg-Satz. Er bietet keine Lösung an, scheut aber nicht davor zurück, sich – um es neudeutsch auszudrücken –„ergebnisoffen“ über alle Facetten des Problems Gedanken zu machen. Es ist einer der großen Verdienste dieser Autorin, deutlich zu machen, dass manche Widersprüche nicht aufgelöst werden können, sondern im Vagen und Ungewissen bleiben. Ein wunderbares Beispiel dafür ist „Einige Gedanken über die Könige“. Darin erzählt Ginzburg, wie sie als Kind im Geheimen eine glühende Monarchistin gewesen war und sich auch in ihrem Erwachsenenleben nie ganz von dieser Begeisterung befreien konnte. Denn „im Halbschatten unserer Seele gedeiht eine Flora und eine Fauna, die keinerlei Beziehung zu unseren im Lauf der Zeit gerei en Überzeugungen, zum Denken und zur Vernun hat.“
JULIA KOSPACH





Biometrische Brillengläser von Rodenstock unterstützen
Augen und Gehirn optimal


























Das menschliche Sehsystem besteht aus zwei Teilsystemen, dem zentralen und dem peripheren Sehen, die beide mit dem Gehirn zusammenarbeiten. An einem Tag bewegen sich unsere Augen bis zu 250.000 Mal und wechseln dabei ständig zwischen den beiden Teilsystemen.
Der Mensch nutzt das periphere Sehen, um sich zu orientieren und um Bewegungen in seiner Umgebung wahrzunehmen. Wenn das Gehirn einen Punkt von Interesse erkennt, geht es ins zentrale Sehen über, um detailliertere visuelle Informationen aufzunehmen. Nur wenn beide Systeme im Einklang zusammenarbeiten, ist das Sehen übergangslos und dynamisch.
Wir sehen nicht nur mit den Augen
Wie und was wir sehen, hängt also nicht nur von der Sehkraft der eigenen Augen ab, sondern ist vielmehr die Grundlage für unser Gehirn, um das Wahrgenommene zu verstehen. Nur eine Brille mit biometrischen Gläsern berücksichtigt das Sehen als großes Ganzes und versorgt das Gehirn so mit bestmöglichen Informationen. Als Basis dient dazu eine individuelle Vermessung der Augen, die Rodenstock mit Hilfe modernster Technologie durchführt und damit die präzisesten biometrischen Brillengläser auf dem Markt anbietet.

Der Weg zur passgenauen Brille







Jedes Auge ist einzigartig. Und doch wird diese Einzigartigkeit bei der Anfertigung von Standardbrillengläsern nicht berücksichtigt. Für ein biometrisch exaktes Brillenglas, das bestmöglich an das individuelle Auge angepasst wird, ermittelt Rodenstock als einziger Glashersteller ein biometrisches Augenprofil für das individuelle Auge, das exakt zu den Augen eines Brillenträgers passt. Dafür bestimmt Rodenstock mit dem DNEye® Scanner die individuellen Parameter eines jeden Auges mit mehreren tausend Messpunkten. Diese umfangreichen Daten fließen dann direkt in die Herstellung von biometrischen Brillengläsern ein.
Das Ergebnis: Der Brillenträger erhält ein präzises und auf sein Auge exakt angepasstes Brillenglas, das ihm schärfste Sicht in allen Distanzen und bei allen Lichtverhältnissen bietet und das Gehirn für ein übergangsloses und dynamisches Seherlebnis unterstützt.
Weitere Informationen unter www.rodenstock.at/bigvision Eine Schweizer Befragung belegt die großen Vorteile der biometrischen Brillengläser:
88 % der Teilnehmer empfanden einen höheren
Sehkomfort im Vergleich zu ihrer alten Brille 1
92 % sahen schärfer als vorher 2
1 DNEye® Kundenbefragung (2018), Zürich.
84 % sahen kontrastreicher als vorher 1
87 % erlebten eine kürzere Eingewöhnungszeit 2 .
80 % hatten eine bessere Sicht in der Dämmerung 1
2 Muschielok, A. (2017). Personalisierte Gleitsichtgläser nach Kundenwunsch – Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie. Präsentation auf dem opti-Forum, München.
Im letzten Teil ihres „Amadoka-Epos“ erzählt Sofia Andruchowytsch die Tragödie der Ukraine bis in die Gegenwart
Längste Zeit gab es die Ukraine nicht. Sie war Bestandteil des Zarenreiches und später der UdSSR. Selbst nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Imperiums 1991 dauerte es ein gutes Jahrzehnt, bis ukrainische Literatur auch im Westen wahrgenommen wurde. Erst mit den beiden Revolutionen 2004 und 2014 und vor allem Russlands Angriffskrieg änderte sich die Rezeption.
Sofia Andruchowytsch, Tochter des Schri stellers Juri Andruchowytsch und 1982 in Iwano-Frankiwsk geboren, ist mit bislang acht Büchern die bekannteste Vertreterin der jüngeren Generation. Ihr Hauptwerk, „Das Amadoka-Epos“, ist ein 1400 Seiten langer Parforceritt durch die blutige ukrainische Geschichte im 20. Jahrhundert.
In der „Geschichte von Romana“, dem ersten Teil der Trilogie, übergibt ein Unbekannter einen Koffer mit Briefen und Fotoalben einem Kyjiwer Archiv. Dessen Mitarbeiterin Romana sichtet den Bestand kursorisch – und behauptet, nach einer Internetrecherche in einem 2014 während des Kriegs im Donbass schwer entstellten Soldaten ihren Mann Bohdan wiederzuerkennen. Der Kriegsversehrte selbst hat das Gedächtnis verloren. Um ihm zu helfen, seine alte Identität wieder zu erlangen, erzählt ihm Romana sein bisheriges Leben und einiges mehr.
Schauplatz des zweiten Bandes ist das galizische Butschatsch, wo Bohdan seine Kindheit bei Großmutter Uljana verbrachte. Im Zentrum der „Geschichte von Uljana“ steht deren Liebesaff äre mit Pinkas, dem Sohn des Schächters, vor dem Hintergrund des beginnenden Holocaust. Sofia Andruchowytsch grei damit erstmals ein in der Westukraine lange Zeit tabuisiertes Thema auf. Hier fällt auch erstmals der Name „Amadoka“, ein riesiger, vom antiken Historiker Herodot erstmals genannter mythologischer See, der sich auf diesem Gebiet befunden haben soll.
«Pflichtlektüre.
Timothy Snyder ist einer der wichtigsten Denker unserer Zeit.»
Thomas Piketty
Der unermüdlich gegen Putin wie gegen Trump kämpfende Historiker legt nun ein brillantes
Buch vor, das erklärt, was Freiheit bedeutet, wie sie oft missverstanden wird und warum sie unsere einzige Chance ist zu überleben.
„Die Geschichte von Sofia“, Abschluss der Trilogie, beginnt intim: „Dieses Haus ist die Verlängerung meines Körpers.“ Eine Frau leuchtet sich nachts durchs Zimmer, in dem sich Bohdan gerade in Albträumen wälzt und die Autorin keine Scheu vor schwülstigem Pathos zeigt: „In den Vertiefungen seiner Narben haben sich wie nach einer Gletscherschmelze ganze Seen gebildet. ,Bald werden alle Gletscher schmelzen. Und was ist dann?‘, sage ich leise. ,Werden wir beide diesen schrecklichen Augenblick erleben? Ich will das Ende der Welt gemeinsam mit dir erleben. Ich will in deiner Umarmung sterben, hörst du? […] Als ich deinen überraschten Blick sah, fuhr ein heißer Strahl des Erkennens in meinen Bauch.‘“
Anhand der Bilder aus einem alten Fotoalbum entfaltet sich eine höchst verschlungene Geschichte mit der bereits aus dem zweiten Band bekannten Großmutter Uljana. Unter anderem geht es um deren Begräbnis und die zahlreichen Kirchen von Butschatsch mit ihren kulturell bedeutenden Heiligenstatuen, Objekten eines ominösen, fehlgeschlagenen Kunstraubs. Archivarin Romana erzählt Bohdan vom Bildhauer Georg Pinsel, oder genauer gesagt: Andruchowytsch referiert die überbordende Geschichte des in den letzten Jahren auch im Westen bekannt gewordenen Künstlers aus dem 18. Jahrhundert, der schließlich überhaupt ins Zentrum des Romans rückt.
„Ich habe dir die Geschichte von Pinsels Heiligem Onufrij ja schon erzählt“, hebt Romana immer wieder an, verrät auch, was die expressiven Bildstöcke mit den Legenden von Baal Schem Tov zu tun haben. Der legendäre Wunderrabbi wirkte in derselben Gegend, und die Erzählerin konstatiert fragend: „Beide waren eng mit ihrer Religion verbunden, jeder mit seiner eigenen. Beide brachten Gott den Menschen näher, und die Menschen näher zu Gott. Ob einer von ihnen wohl bereit gewesen wäre, eine Ähnlichkeit zwischen sich und dem anderen zuzugeben?“







Sofia
Andruchowytsch:
Die Geschichte von Sofia. Das Amadoka-Epos 3. Aus dem Ukrainischen von Alexander Kratochvil und Maria Weissenböck. Residenz, 688 S., € 35,–
«Ein großartiger Reporter –neugierig, offen und schwer zu ermüden.»
Frankfurter Allgemeine Zeitung
«Mehrstimmigkeit ist das Elixier von Kermanis Ruhm:
Seine Begegnungen von Zeiten und Welten verteidigen in Zeiten zunehmender Abschottung, dass die Welt mehr ist als alles, was der Fall ist.»
Marie Luise Knott, Deutschlandfunk
Und dann gibt es da noch einen Dritten im Bunde der lokalen Heiligenverehrung –den kosakischen Laientheologen und Philosophen Hryhorij Skovoroda, der einen Schüler schon auch einmal als „Schweinskopf“ titulierte und mit einem Spruch zum Klassiker wurde: „Die Welt hat mich gejagt, aber nicht gefangen.“ Ob es sich bei dieser Erzählung schon um Bohdans Erinnerung handelt, wird nicht ganz klar, allerdings ist von einem 2000 Grad heißen Geschoss die Rede, das seinen Unterstand traf. Noch einmal interveniert die Erzählerin: „In den Adern dieser drei Männer fließt kein Blut, sondern Feuer.“
Das Blut gefriert im Hauptteil des Romans, wenn es um eine der großen ukrainischen Tragödien des 20. Jahrhundert geht – die Vernichtung der ukrainischen Intelligenzija Mitte der 1930er-Jahre. Hatten die Sowjets anfänglich unter der Losung „Einwurzelung“ die Ukrainisierung des Landes gefördert, so wurden in Stalins Großem Terror tausende Schri steller, Künstler und Wissenscha ler als „Nationalisten“ ermordet.
Als Leitfigur dieses Erzählstrangs dient der Autorin die historisch verbürgte und höchst undurchsichtige Figur des Schri stellers Wiktor Petrow, der als sowjetischer Agent zum „Kollaborateur“ der Nazis wurde und die Verbrechen des Sowjetregimes anprangerte. Seine Briefe sind an die Titelheldin Sofia Zerow adressiert.
Am Ende wird sich Bohdan erinnern und ein Gespräch mit seinem Vater beginnen, mit dem er sich überworfen hatte, als er zu Beginn der Trilogie den erwähnten Koffer aushändigte. Das schon vor Putins „großem Krieg“ begonnene und mittlerweile in zahlreiche Sprachen übersetzte Opus magnum wird ob der Vielzahl an Figuren gelegentlich unüberschaubar. Dessen Lektüre ist eine Herausforderung – aber einfacher ist die tragische Geschichte des Landes mit all seinen Abgründen nicht zu haben.
ERICH KLEIN







Seinen surreal-schwülstigen Spla er-Wälzer „Theodoros“ hat sich Mircea C ărt ărescu von den Erzengeln diktieren lassen
Der junge Mann will hoch hinaus. Von früh auf treibt Tudor ein Ehrgeiz an, den Größenwahn zu nennen eine Untertreibung wäre. Sein Vater ist zwar nur ein Mützenmacher im Dienst eines walachischen Bojaren gewesen, die griechische Mutter vertreibt ein Mittel gegen Spulwürmer, den Sohn dagegen drängt es, Herrscher über Himmel und Erde, ja, der „blaue Kaiser des Seienden“ zu werden. Und der junge Barbar hat zweifellos das Zeug dazu. Einen kampfeslustigeren Mann hat man jedenfalls zwischen Walachei und Äthiopien noch nicht gesehen.
Äthiopien? Ja, der junge Tudor wird dort als Theodoros II. oder äthiopisch Téwodros im Jahre 1855 zum Kaiser gekrönt werden. Das geht eine Weile gut, ehe er es sich mit Königin Victoria verscherzt und mit jener Pistole entleibt, die ihm in besseren Tagen die Königin geschenkt hatte.
Das alles ist natürlich frei erfunden, wenn auch nicht von Mircea Cărtărescu selbst. Der rumänische Staatsmann und Dichter Ion Ghica habe bereits im Jahre 1883 die Geschichte vom jungen Tudor und seiner Odyssee nach Äthiopien in die Welt gesetzt, erläutert der Autor. Nach ersten Untaten in der Heimat sei der einstige Bojarenknecht als Seeräuber durch die Ägäis geirrt, habe dann tatsächlich das afrikanische Kaiserreich unterworfen, um aber schließlich an den Briten und seinem eigenen Wahnsinn zugrunde zu gehen.
C ă rt ă rescu hat den pseudohistorischen Stoff zu einer, wie er schreibt, „kontrafaktualen, fiktionalen, mythischen und archetypischen“ Geschichte weiter ausgesponnen. Bukarest, die Walachei, die griechischen Inseln und das ferne Äthiopien, sie bilden dann aber doch nur die Rampe für ein manichäisches Endspiel zwischen Himmel und Hölle. Ausgetragen wird es freilich erst am 4. Februar 2041, wenn am Tage des Jüngsten Gerichts final über die Taten und Untaten des walachischen Wüstlings entschieden wird.
Cărtărescus „Theodoros“ ist eine literarische Wunderkammer. Es fragt sich bloß, was es für Leser außer Staunen noch zu tun gibt
Das klingt alles ziemlich verrückt. Aber was sonst hätte man vom Großmeister des psychedelischen Surrealismus erwartet? Dass ihm die Mittel zur detailgenauen Ausgestaltung solcher Fabelwelten fehlten, lässt sich nicht behaupten, im Gegenteil: Cărtărescu kann erfinderisch erzählen wie sonst kaum jemand. Es stellt sich bloß die Frage, was es bei dieser literarischen Wunderkammer außer Staunen für Leser noch zu tun gibt.
Ein anderer Autor hä e aus dem Sto ff vielleicht eine halbwegs realistische Abenteuergeschichte gemacht, etwa diese: Wir befinden uns im 19. Jahrhundert; das britische Empire regiert die Welt; Queen Victoria wird auf die Talente des aufstrebenden Irren mit der Weltherrscher-Allüre aufmerksam, manipuliert ihn zunächst in ihrem Sinne … –und so fort.
sche Äthiopien verbracht wurde. Für den Zugriff auf die Bundeslade, den MacGuffin des Romans, ist Theodoros notfalls bereit, die ganze Welt in Brand zu stecken. Blut fließt in Strömen, und Cărtărescu wird niemals müde, noch eine weitere Gräueltat farbig auszumalen. Spannung kommt dabei keinen Moment lang auf. Bei maximaler Ausstattung fehlt dem Roman der Motor einer großen Erzählung. Stattdessen zerfällt er in lauter Mosaiksteine.

Aber Cărtărescu steht der Sinn weniger nach Handlung als nach Vision. Seine Welt ist ein Tableau, ein Wimmelbild aus Gewaltakten. Albrecht Altdorfers Gemälde „Die Alexanderschlacht“ (1528–29) habe ihn ästhetisch beeinflusst, sagt Cărtărescu, ebenso wie die byzantinische Kunst in rumänischen Kirchen. Man könnte auch von Manierismus sprechen, einer barocken Kunsttendenz, die Opulenz entschieden über Ökonomie stellt. In „Theodoros“ macht sich eben dieser Stilwille geltend. Wenn sich irgendwo die Chance zu mehr Schwulst und Üppigkeit au ut, wird sie beherzt ergriffen.
Im Grunde ist „Theodoros“ wohl ein Fantasy-Roman, und zwar einer, der sowohl aus ganz alten Quellen schöp wie auch an die Neo-Archaik heutiger TV-Formate à la „Game of Thrones“ andockt. Was den jungen Wüstling umtreibt, ist nämlich eine „Quest“, also die umweg- und aufgabenreiche Erledigung eines Suchau rags, mit der Weltherrscha als letzter Prämie. Nicht nach dem Gral wird hier gesucht, sondern nach der Bundeslade, die einst der Sage zufolge von Menelik, Sohn des Königs Salomo und der Königin von Saba, ins heimi-
„Wenn du dich mit drei blutverschmierten Fingern bekreuzigst, dir mit dem Blut die Stirn beschmierst“, so der Beginn des allerersten Satzes. Bald werden wir erfahren, dass Theodoros nicht mehr lange zu leben hat. Von wem? Es handelt sich um Wesen, die den König der Könige mit „du“ ansprechen, die wissen, was geschah und geschehen hätte können, die den Schrecken der Meere vor einer tödlichen Kugel bewahren, indem sie ihren Lauf beeinflussen (ein erzählerisches Kabinettstück des Romans). Menschen sind es nicht, auch keine Götter, sondern Sendboten zwischen Himmel und Erde.
Der Text, den wir lesen, trägt – abgesehen von Theodoros’ Briefen an seine Mutter – die Handschri der sieben Erzengel, er ist gewissermaßen deren Kollektivroman. Auf wessen Konto, fragt man sich, geht dann die altherrenha e Erotik, die den Roman durchwirkt, etwa im nimmermüden Beschwören von „Titten“ und „Zitzen“ (sogar Jesu Brustwarzen werden nicht vergessen)? Sind das auch die Engel, ist es vielleicht doch ihr Autor oder hat der tapfere Übersetzer Ernest Wichner selbst diese Vokabeln gewählt? Und warum können die Engel gar nicht au ören mit der Schilderung von Foltern und Todesarten der exquisitesten Art? Faszinierter von Grauen und Gräueln hat sich lange kein Roman mehr gezeigt. Das macht „Theodoros“ bei aller Fabulierkunst über weite Strecken zu einer ziemlich quälenden Lektüre.
CHRISTOPH BARTMANN
Die russische Lyrikerin Maria Stepanova vollführt in „Der Absprung“ einen fuliminanten Trapezakt selbstreflexiver Prosa
Eigentlich sollte es für die russische, in B. lebende Schri stellerin M. eine normale Fahrt zu einer Lesung in F. werden. Als der Anschlusszug beim Umsteigen gecancelt wird und sich das Taxi, das die Autorin zum vereinbarten Leseort bringen sollte, als das falsche erweist, beginnt die eigentliche Reise.
Maria Stepanova, 1972 in Moskau geboren und heute in Berlin lebend, avancierte mit dem Roman „Nach dem Gedächtnis“ (2018) und bislang drei ebenfalls bei Suhrkamp erschienenen Gedichtbänden zur bekanntesten russischen Autorin der mittleren Generation. In ihrem aktuellen Kurzroman „Der Absprung“ inszeniert die Lyrikerin ein Spiegelspiel der besonderen Art. Statt modischer Autofiktion stellt sie über die handelsübliche Nabelschau hinausgehende große Fragen und vergisst dabei weder ihr Interesse an der Umgebung noch schwungvolles Erzählen. Im Original heißt das soeben auch in Moskau erschienene Buch „Fokus“.
Am Anfang steht der Überfall Russlands auf die Ukraine: „Im Sommer 2023 wuchs das Gras weiter, als wäre nichts geschehen: es wuchs, als ginge es gar nicht anders, wie um ein weiteres Mal zu zeigen, dass es an seiner Absicht festhielt, aus der Erde zu sprießen, ganz egal, wie viel auf deren Oberfläche gemordet wurde.“
In dergleichen lakonisch-apokalyptischer Gestimmtheit bricht M. frühmorgens zum Bahnhof auf, wo sie von einem Obdachlosen angeherrscht wird: „Kauf mir etwas zum Essen!“ Schuldbewusst tut sie das, beim zweiten Schnorrer verfliegt alle Empathie, ihr Kaffee bleibt stehen. Ein Schauer an Gedankensplittern zu Wokeness, Klimakatastrophe und zum Literaturbetrieb (Buchpräsentationen als „Brautschau“) treibt durch die Erzählung.
Selten wurde das Verhalten von Zugreisenden mit sämtlichen Spielarten des Einander-Ignorierens besser beschrieben. Ohnedies ist M. mit ihren Gedanken beschä igt. Über den Krieg, wie es dazu kam, wie das Klima in Russland peu à peu verpestet wurde, bis der Leviathan seine Fratze zeigte. Über ihre Landsleute und deren Hilflosigkeit angesichts des Kriegsputinismus heißt es harsch: „Sie sind vertiert.“ Und da ist M.s Unbehagen, noch immer in der Sprache der Mörder zu denken. Sollte sie überhaupt au ören zu schreiben?
Die Selbstbefragung in quasi essayistischer Form führt nahtlos in die Erzählung zurück: M. verlässt genervt den Zug, das Avocadosandwich reist allein im Gepäcknetz weiter. Bei einem Türken kommt sie endlich zu ihrem Kaffee, vergisst aber das Ladekabel ihres Handys. Die Verbindung zur Welt reißt ab: „Sie gehörte nicht mehr

Maria Stepanova: Der Absprung. Roman. Aus dem Russischen von Olga Radetzkaja. Suhrkamp, 141 S., € 23,70
dazu, existierte nicht mehr – niemand wusste, wo sie steckte und was mit ihr los war, niemand konnte sie herbeizitieren und zur Ordnung rufen.“
Bei der Weiterfahrt im Regionalzug fällt ihr, nicht zum ersten Mal, ein Mann mit Zopf auf, von dem sie sich nach einigen slapstickartigen Wendungen zum gemeinsamen Besuch eines Escape Room einladen lässt. Selten wurde bei Betonung der Abwesenheit aller Erotik derart prickelnd über die Begegnung zweier Fremder geschrieben! Der Höhepunkt der Erzählung ereignet sich im Zirkus, dem sich die auf Abwegen befindliche M. für eine Abend lang anschließt – Partizipation an einer Zauberschau inklusive. Stepanova meistert das literarische eher abgedroschene Terrain Zirkus auf souveräne Weise. Der Blick hinter die Manege ist auch einer hinter die Fassade der Erzählung, deren Ende offen bleibt wie in Michelangelo Antonionis „Blow Up“. Über weite Strecken liest sich „Der Absprung“ wie die Beschreibung einer Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs, am Ende erweist sich die Verfasserin als Enkelin von Ka a. Und: Die Lyrikerin Maria Stepanova schafft, wenn schon nicht den Absprung, so doch den Genrewechsel zur Prosa. Was bekanntlich nicht jedem Dichter gelungen ist.
ERICH KLEIN
Auch mit seinem angeblich letzten Roman „Die große Versuchung“ gelingt es Mario Vargas Llosa, die Leser zu verwirren
Der Forschungs- und Lebensbericht eines die längste Zeit nur mäßig erfolgreichen Musikwissenscha lers ist Gegenstand des neuen Buches von Mario Vargas Llosa. Das Interesse des Protagonisten gilt volkstümlichem Gesang und Tanz, er gilt als Kapazität für den Vals peruano, der im 19. Jahrhundert aus Europa übernommen und von Indigenen, städtischem Proletariat und später auch der weißen Mittelklasse gepflegt wurde.
Die klassenüberschreitende Leidenscha für dieses Genre verbindet sich für Tono Azpilcueta mit der Hoffnung auf nationale Einheit. Trotz vielversprechendem Studienabschluss hält er sich mit prekären Jobs über Wasser, gibt Musikstunden, schreibt knappe Konzertkritiken in marginalen Magazinen. Die Begeisterung, die er seinen Lesern vermitteln möchte, steigert sich zur Leidenscha , als er einen völlig unbekannten Sänger hört. Allerdings nur ein einziges Mal, denn das junge Genie verschwindet.
Als er von dessen frühem Tod erfährt, beschließt Tono, eine Biografie dieses Lalo Molfino zu verfassen. Er bereist den Norden Perus und besucht das Kaff, in dem Molfino als Findelkind unter Patronage eines Priesters aufgewachsen ist. Das Manuskript über das kurze Leben eines so genialen wie unleidlichen Einzelgängers wird nach vielen Ablehnungen von einem ambitionier-
ten, unerfahrenen Verleger angenommen und zu einem überraschenden Erfolg: Es befriedigt das Harmonieverlangen der zerrissenen, vom Terror der Guerillaorganisation Sendero luminoso überschatteten Gesellscha der 1980er-Jahre.
Tonos Selbstbewusstsein blüht auf, endlich eröffnet sich ihm eine akademische Laufbahn. Doch statt sich mit Neuauflagen des nachgefragten Buches zufrieden zu geben, überspannt er den Bogen und fügt Exkurse über peruanisches Kulturerbe wie den Stierkampf oder das kaum übersetzbare Lebensgefühl huachafería ein. Sie sollen nicht nur eine neue nationale Identität begründen, sondern den ganzen Kontinent, ja letztendlich die Welt vereinen. Das aber ist endgültig zu viel des Guten. Die Buchhändler verlieren die Geduld mit dem angeschwollenen Kompendium, der Verleger verliert sein Vermögen, Tono den Verstand. Und auch der Leser ist verwirrt. Denn nun meldet sich die Stimme des Autors, der versichert, die Reise in den Norden Perus gerne unternommen zu haben. Ist man bei den seltsamen Heilsversprechungen aus Kitsch und Kommerz mit den Visionen eines vom Irrsinn Bedrohten konfrontiert, oder meint Vargas Llosa die Lobpreisungen der Populärkultur ernst? Die Akteure der geschilderten Musikszene sind jedenfalls real (wie sich auf Youtube überprüfen lässt).

Mario Vargas Llosa: Die große Versuchung. Roman. Aus dem Spanischen von Thomas Brovot. Suhrkamp, 304 S., € 26,80
Vargas Llosa liebt es zu verwirren, und das gelingt ihm seit den genialen Frühwerken wie „Das grüne Zimmer“ (1965) immer wieder. Auch in der „Großen Versuchung“, von dem der 88-Jährige behauptet, es wäre sein letztes literarisches Werk, frönt er wohl diesem Vergnügen. Andererseits sind seine politischen Äußerungen o nichts weniger als das Versprechen der Geburt Perus aus dem Geiste der Volksmusik. In den letzten Jahren unterstützte er gar Brasiliens rechtsextremen Präsidenten Bolsonaro.
Um die Verdienste eines virtuosen Autors nicht zu schmälern, dessen Meisterscha in der Personenzeichnung und dem Gefühl für Natur und Lokalkolorit in der Übersetzung von Thomas Brovot spürbar wird, sei der Vergleich mit einem der ganz Großen gewagt; schließlich kommt der Literaturnobelpreisträger von 2010 ja „von Cervantes her“. Das betont er zwar nicht explizit, aber unverkennbar sind seine Desorientierungstechniken, die er früh entwickelt und selbst so genannt hat, mit dem desengagno des spanischen Renaissancedichters verwandt. Auch manche Einzelmotive scheinen dessen Opus magnum entnommen: Die Ratten, die Tono bei Rückschlägen quälen, kann man durchaus als Analogie zu Don Quixotes vergeblichem Kampf gegen Windmühlenflügel sehen.
THOMAS LEITNER


Das Postkartenbuch mit hochwertigem Wickelei nband beinhaltet 15 Postkarten mit den schönsten Illus trationen aus Klaus Nüchterns Buch „Famose Vögel“ gezeichnet von Silvia Ungersböck.
! 15,90
Klaus Nüchtern
Der Autor würdigt die besten Seiten eines jeden Vogels. Ein amüsantes Kompendium für alle, die einen Buntspecht von einem Blumentopf unterscheiden können wollen. Mit beeindruckenden Illustrationen von Silvia Ungersböck.
224 Seiten, ! 24,90
„Toni & Toni“, Ying und Yang: In seinem Romandebüt setzt Max Oravin zugleich auf Meditation und Ekstase
Nichts sollte ihre Einheit auflösen, nichts diese unglaubliche Ekstase zweier Liebender beenden, bis sich in einer wilden Partynacht das Unglück ereignet: Tonis Partnerin, die passend zur Nähe der beiden denselben Namen wie der Icherzähler trägt, bricht zusammen und gerät in eine depressive Abwärtsspirale. Während sie sich in der schützenden Wohnung verbarrikadiert, zwischen Netflix-Serien und Selbstverletzungsepisoden dahinvegetiert, sucht ihr Ge-
Der Körper wird zum Buch, in dem die Narben einer schwierigen Kindheit wie Buchstaben anmuten
fährte Trost im Erlernen der japanischen Sprache. Dabei hatte das Paar vor der unerwarteten Zäsur noch Großes vor, nämlich eine gemeinsame Tanzpremiere.
Für diese rasante Choreografie aus Liebe und Verzweiflung hat Max Oravin mit seinem Debütroman, der es auf die Longlist zum Deutschen Buchpreis Debütroman geschafft hat, eine anspruchsvolle Form gefunden.
Der auch als Musiker tätige Schri steller legt nicht bloß einen Roman, sondern eine Sprachpartitur vor, wobei selbst dieser Begriff unscharf anmutet, suggeriert er doch eine im Notentext fixierte Ordnung. Eine solche etabliert der Autor zwar schon, allerdings um sie sogleich auch wieder aufzulösen.
Immer wieder fragt sich der zwischen Gegenwart und Erinnerungsbildern schwankende Icherzähler, wie er „den Wortstrom verlassen, einen Ausgang schlagen kann“. Und „müsste nicht, hinter den Worten, das reine Land sprachlos sein?“
Er strebt nach der weißen statt der beschriebenen Seite, benutzt häufig Verben des Entfernens wie „radieren“ und „löschen“. Auf strukturierende Elemente wird weitestgehend verzichtet.
Ohne Absatz fließt der Text über hundert Seiten hinweg wie ein ungehalten mäandernder Fluss mit unvorhersehbaren Stromschnellen und Katarakten. Beim Lesen gerät man permanent ins Stocken, einerseits weil ständig asiatische Schri zeichen aufpoppen, andererseits weil jeder Satz mit Einschüben durchsetzt ist.
Es geht also darum, sich freizuschreiben, bestenfalls hinein in ein neues Leben. Nur wie soll es aussehen, gerade angesichts der Gegensätzlichkeit der beiden Protagonisten?
Toni träumt von der Ruhe, wie sie Zen und Shentong versprechen, derweil seine Partnerin das völlige Chaos im Kopf zu erleiden scheint. Neigt sie zum Pessimismus, steht er für den bejahenden Part; setzt er auf die Ratio, gibt sie sich ganz der Emotion hin. Offensichtlich verhalten sich beide komplementär zueinander, stehen dadurch aber ebenso für ein Weltbild, das diese Kontraste vereint beziehungsweise in Bewegung hält, das Absolute durch das Durchlässige ersetzt.
Dies trifft insbesondere auf den menschlichen Körper zu, der in „Toni & Toni“ immer wieder thematisiert wird. Gerade im Tanz scheint er seine Grenzen zu überwinden, das Wagnis der Verschmelzung einzugehen. Dynamisch ist auch seine Inszenierung im Text: Mal wird er lesbar wie ein Buch, in dem die Narben etwa einer schwierigen Kindheit wie Buchstaben anmuten, mal tritt er als Zeichen reiner Vitalität in Erscheinung. So oder so dient er der Selbstvergewisserung. Toni betrachtet ihn o von außen, notiert und deutet die Resultate der Selbstverletzungen seiner Gefährtin mit geradezu forscherischer Akribie.
Allerdings beschränken sich die Beobachtungen nicht auf die äußere Physis. Immer wieder zeigt sich der 1984 in Graz geborene und heute in Wien lebende Autor in seinem Erstling offen für spirituelle Einflüsse – etwa wenn Toni immer tiefer in den fernöstlichen Buddhismus eintaucht. Dadurch bekommt der Text etwas Schwebendes. Die Gegensätze von Enge und Weite, Lu und Erde, Kontemplation und Aktion lassen sich letztlich nur schwer fassen, die ausdrucksstarken Sprachbilder und der elanvolle Flow der Worte ist dazu angetan, eine klar konturierte Wahrnehmung zu verwischen. Oravin geht aufs Ganze, will die Leser mit seiner Überwältigungsästhetik mitreißen, was ihm auch gelingt, denn tatsächlich gerät man bei der Lektüre immer wieder in einen zügellosen Rausch.
BJÖRN HAYER

„Der beste Tag seit langem“ führt bei Jana Volkmann zu einem Generalstreik von Legehennen und Fiakerpferden
Der Roman fängt geradezu klassisch an: „Cordelia sah das Pferd zuerst. Es stand an die Außenwand eines Gasthauses gelehnt, als hätte es gesoffen, und schaute leer in die von einer Unzahl Sternen perforierte Nacht.“ Wir befinden uns in der Mitte Wiens und des Sommers, ein Abenteuer bahnt sich an, doch was als individuelle Entdeckungsreise in die Gefilde tierischer Nachbarscha beginnt, endet als offene Revolte gegen die menschengemachte Ordnung der Dinge.
Noch ahnt das niemand. Das Pferd, eine buchstäblich abgehal erte Rappstute, folgt der Icherzählerin und ihrer Nichte Cordelia quer durch die Stadt bis zu deren Haus und Garten am Rand, einem etwas desolaten Anwesen in bester Lage. Die Erschöpfung des Tieres sowie seine deutlichen Gebrauchsspuren legen die Vermutung nahe, es könnte sich um einen entlaufenen Fiakergaul handeln.
Die beiden Frauen taufen die neue Mitbewohnerin Isidora und fühlen sich überfordert, haben sie doch keine Ahnung von Pferdehaltung. Alle einschlägigen Bücher „taten in Kapitel 1 ihr Möglichstes, um gewöhnliche Menschen wie uns davon abzuhalten“.
Doch vergeblich: „Wenn ich improvisieren musste, lief ich zur Hochform auf. […] Ich war dafür zuständig, dass uns niemals der Mut verließ, den es brauchte, um schlechte Ideen in die Tat umzusetzen. Und Cordelia setzte die schlechten Ideen in die Tat um.“
Die Lage erinnert an die Villa Kunterbunt und Pippi Langstrumpf, die ihr Pferd auf der Veranda hält, weil es in der Küche nur im Weg wäre. Isidoras Anwesenheit im Garten soll geheim gehalten werden, vor allem vor den einschüchternd tüchtigen Nachbarinnen, den Kargls, einem „Konglomerat aus Anwältinnen, drei Generationen mindestens“.
Doch dann entscheidet die Autorin sich offenkundig gegen das leicht skurrile Kinderbuchsetting und entwir ein unbehagliches, verstörend gegenwärtiges Zukun sszenario, wie sie das ähnlich schon in ihrem Debüt „Auwald“ (2020) getan hat. Bald wird klar, dass Isidoras Arbeitsverweigerung kein Einzelfall ist: Überall quittieren Tiere den Dienst, Hennen flüchten aus Legebatterien, Laborhunde verstecken sich im Wald, Schweine stürmen durch die Simmeringer Hauptstraße. Sie finden Unterstützung durch immer mehr Menschen, die gesetzwidrig Käfigtüren öffnen und den Generalstreik der Nutztiere propagieren, bis eines Tages Blut fließt. Während ihre Nichte sich den Aktivisten anschließt, bleibt die Erzählerin bei aller Sympathie skeptisch.
Nicht zufällig verweist ihr Name –Maja Stirner – auf den Philosophen Max Stirner, der 1845 mit „Der Einzige und sein Eigentum“ die Urschri eines Anarchismus der Individuen vorlegte. Maja, unkonventionell, aber träge, von einer tiefen Angst bestimmt, seit Jahrzehnten festgebannt in ihr Haus, als Interview-Lektorin auch beruflich eine Eigenbrötlerin – sie lässt sich von ihren tierischen Bekanntscha en und Cordelias Wagemut aus der Reserve locken, ohne wirklich mitzutun.
Nebenbei erzählt der Roman eine Familiengeschichte der Lücken und Ausfälle. Auch die Halbwaise Cordelia ist ihrer Tante zugelaufen wie eine Katze oder wie nun die Stute: „Für uns würde sie immer das sich selbst klauende Pferd bleiben: eine Davonstehlerin.“ Es ist eine weibliche Verschwörung, die der Welt der Nützlichkeit und Vernutzung den Kampf ansagt, aber Männer mischen mit, allen voran Micha „Gorbi“ Gorbach, der wackere Tierarzt, der auf den Spuren von Hugh Lo ings Doktor Dolittle wandelt.
Aber anders als im Kinderbuchklassiker der Tierrechte versteht hier bis fast zum Schluss keiner die Sprache der Kreatur, und zwischen Tier und Tierfreundin bleibt stets ein Quantum Fremdheit, das im Biss seinen sinnfälligen Ausdruck findet. Der titelgebende „beste Tag seit langem“ ist gleichwohl einer der chaotischen Harmonie zwischen allen Beteiligten, vom Findelhund, einem angstgebeutelten Beagle, bis zur gar nicht so z’wideren Kargl-Nachbarin.
Auch wer in Fiakerpferden nicht den Inbegriff entfremdeter Arbeit sieht, kann von diesem Buch etwas lernen. Volkmanns betont distanzierte Erzählhaltung äußert sich in Humor und milder Ironie, ihre Sätze sind präzis und eröffnen doch einen Raum für das Anschauliche und Unerprobte, passagenweise riskieren sie höchste poetische Konzentration. Das rätselha e Wiesenbild im Prolog bereitet Majas finalen Au ruch in ein verheißungsvolles Niemandsland vor: ein Zug am Abstellgleis als Arche Noah. Jana Volkmann hat zum Glück einen Roman geschrieben und kein Manifest.
DANIELA STRIGL

Jana Volkmann: Der beste Tag seit langem. Roman. Residenz, 250 S., € 26,–
Judith W. Taschler führt
Erneut ein historischer Roman der in Linz geborenen, heute in Innsbruck lebenden Autorin Judith W. Taschler. „Nur nachts ist es hell“ breitet die Erinnerungen einer pensionierten Ärztin, Jahrgang 1895, aus, die in den 1970er-Jahren ihrer Enkelin aus ihrem Leben erzählt. Wieder ist es ein Buch mit einer Ansammlung üppiger Schicksale, prallvoll mit Aff ären, Dramen und Tragödien, mit einer breit gefächerten Familiengeschichte zwischen Oberösterreich und Wien, mit Atemlosigkeit entlang der österreichischen Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts erzählt, die ja nicht wenige Katastrophen und Zäsuren bot.
Ein dezidierter Frauenroman, der exemplarisch von den Schwierigkeiten weiblicher Emanzipation handelt, vom Erwachen der Sexualität, von den Barrieren, die sich dem Berufswunsch entgegenstellen, von Glück und Unglück in der Ehe. Geschickt und effektvoll mäandert die fiktive Autobiografie der Elisabeth Tichy, geborene Brugger, zwischen Schauplätzen, Zeiten und Personen und befördert mit der Schilderung der Irrungen und Wirrungen bei der Leserscha Spannung und Anteilnahme.
Auch als politisches Buch will der Roman verstanden sein. Viele Seiten lang beschä igt sich die Icherzählerin mit ihrer Arbeit als Geburtshelferin, bei der sie in einen der großen politischen Konflikte des vergangenen Jahrhunderts hineingezogen wird. Die For-

derung nach Straffreiheit für den Schwangerscha sabbruch wird in den 1920erJahren von den konservativen Krä en abgeschmettert.
In der Auseinandersetzung um den § 144 ergrei die Ärztin eindeutig Partei. Schwangere Frauen wenden sich an sie, weil sie von ihrem sozialen Engagement und ihrer politischen Haltung wissen, sie aber blockt ab, weil sie nicht die Schließung ihrer Ordination riskieren will. Schließlich zeigt sie sich bereit, amateurha en „Engelmacherinnen“ zur Seite zu stehen, und instruiert sie, mit welchen Werkzeugen, Medikamenten und hygienischen Vorkehrungen sie arbeiten sollen, um das Leben ihrer Kundinnen nicht in Gefahr zu bringen.
In der Zeit des Austrofaschismus landet sie für einige Tage im Gefängnis. So quasi nebenbei werden die Fortschritte in der Medizin referiert, auch in Hinblick auf Verhütungstechniken – von den „Frommsern“, als welche Kondome seinerzeit bezeichnet wurden, bis zur Antibabypille.
Nicht zufällig ist Elisabeths Mentor in der Schule der Geschichtslehrer, der sie mit seinem Faible für Politik fasziniert und mit dem sie später eine heiße Liebesaff äre beginnen wird. Die Icherzählerin selbst versteht sich ebenfalls als Historikerin, was in zahlreichen sozial- und kulturgeschichtlichen Exkursen zu Buche schlägt. „Nur nachts ist es hell“ ist quasi ein Se-
quel von Taschlers Erfolgsroman „Über Carl reden wir morgen“ (2022); die Geschichte der Familie Brugger, die im Mühlviertel tatsächlich eine Mühle betreibt, und wo Elisabeth ihre ersten Jahre verbringt, wird weitergeschrieben.
Während die Protagonistin in ihrer Jugend nach Wien ausbricht und nach dem Ersten Weltkrieg in eine honorige, konservative Wiener Ärztefamilie einheiratet, bleibt sie trotz der räumlichen Distanz mit ihren drei Brüdern eng verbunden. Die Schicksale rund um die Mühlviertler Hofmühle sind wahrlich nicht arm an Turbulenzen. Vor allem die Lebensgeschichten der Zwillingsbrüder bieten ein reichlich verworrenes, jedenfalls aber großes Drama. Zu den Ingredienzen des auf Spannung getrimmten Romans zählt das Chaos in der Liebe, so auch hier: Die beiden haben Sex mit der gleichen Frau. Nur, wer ist der Vater der Kinder? Als während des Nationalsozialismus eine jüdische Familie in der Hofmühle Unterschlupf findet, werden das Versteckspiel und der Identitätstausch unerträglich und die Zwillingsgeschichte nimmt eine tragische Wendung, die sich offensichtlich der Schreibstrategie des immer wieder leicht übersteuerten Romans verdankt: Nur ja nicht langweilen! Einer breiten Leserscha wird das vermutlich gefallen, dem Absatz des Buches dienlich sein.
ALFRED PFOSER











































































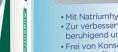








































































„Wie die Welt weiterging“ von Monika Helfer versammelt „Geschichten für jeden Tag“ – und zwar für ein ganzes Jahr lang
Dreihundertfünfundsechzig Tage hat das Jahr. 365 kurze Texte enthält Monika Helfers neues Buch „Wie die Welt weiterging“, macht 768 Seiten. Ein wahrer Ziegel für die Vorarlberger Autorin, die dieser Tage ihren 77. Geburtstag begeht und ansonsten bekannt ist für ihre schmalen, verdichteten Werke.
Fast drängt sich der Gedanke auf, Helfer könnte eine Wette mit sich selbst abgeschlossen haben, ob sich dieses Projekt tatsächlich ein Jahr lang durchhalten lässt. Der Band hat jedenfalls etwas von einer Versuchsanordnung, vielleicht auch einem dichterischen Tagebuch, das vollgefüllt ist mit Einfällen, Gedanken, Skizzen, Notizen, Mini-Storys, Feuilletons, Kurzmärchen und -geschichten.
Auch thematisch ist so ziemlich alles enthalten, was einem im Laufe eines Jahres an Ideen, Erinnerungen und Beobachtungen unterkommen mag. Manches ist autobiografisch, anderes reine Fiktion, wieder anderes mischt Alltagsereignisse mit Assoziativem. Zahllose Figuren treten auf. Es gibt sehr viele Dialoge.
Der Vorschlag für die Lektüre lautet, nur eine oder einige wenige Geschichten auf einmal zu lesen. Andernfalls läu man Gefahr, sich zu
verheddern, und das Gefühl, dass aus diesem Sammelsurium auch dann kein rechtes Ganzes werden will, wenn man ihm eine Jahresstruktur unterlegt, verdichtet sich zunehmend.
Es stimmt: Monika Helfer ist eine Meisterin der kurzen Form. Besonders eindrucksvoll hat sie das in ihren autobiografischen Kurzromanen „Die Bagage“, „Vati“ und „Löwenherz“ unter Beweis gestellt, in denen sie ihrer Großmutter, ihrem Vater und ihrem Bruder hinreißende Porträts widmet. Wie dort ist Helfers Sprache auch hier einfach und eindringlich, von ruhiger, poetischer Genauigkeit.
Noch den aufwühlendsten Ereignissen – Tod, Entwurzelung, Krankheit, Unfall, Ungerechtigkeit, Liebesleid –geht sie in beinah dokumentarischer Kürze auf den Grund. Es gibt zahlreiche Storys, deren Ausgangspunkte zufällige Zusammentreffen mit Frem-
den sind – in Zügen, auf Bahnhöfen, beim Spazierengehen. Darüber hinaus finden sich auch märchenha e Geschichten und solche, deren Personal und Setting an La Fontaine’sche Fabeln erinnern.
Ein wiederkehrendes Motiv ist der Tod: „Seit geraumer Zeit geht der Tod neben mir her, er überholt mich nicht, schleicht nicht hinter mir, ist einfach an meiner Seite, manchmal versucht er, die Hand nach mir auszustrecken, das erlaube ich nicht“, heißt es etwa in Geschichte 93 mit dem Titel „Im Sarg“.
Und natürlich geht es um die Liebe, um die seltsamen Beziehungskonstellationen, in die sich Menschen mitunter hineinmanövrieren. „Wollen Sie mir das wirklich erzählen, wissend, dass ich darüber eine Geschichte schreiben werde?“, fragt etwa die Icherzählerin von Helfers Tag-16-Geschichte „Erbärmliche Rache“. Was darauf folgt, dokumentiert den hohen Preis, den eine der Armut entkommene Ehefrau für eine materiell komfortable Existenz zu bezahlen hat.
vielen Worten so wenig zu sagen hat“, heißt es einmal über einen schlechten Liebesbriefschreiber. Ein anderer Text beginnt mit den Worten: „Als ich ein Kind war und geschichtensüchtig ...“ Auch das Schreiben selbst wird immer wieder zum Thema. Auf die Fragen einer 17-Jährigen, wie man es erlernt, antwortet die Icherzählerin von Tag Nummer 324 „Sag: Es regnet“ fast schon sentenzenha : „Viel lesen, die richtigen Sachen. Hemingway für das Dialogschreiben, Beckett für die Knappheit, Ka a fürs Geheimnis. Präzision ist in meinen Augen das Wichtigste. Lass alles Unnötige weg.“ Das klingt nach Werkstatt und Handwerk; und Einladung zum Werkstattbesuch ist vielleicht auch die beste Zusammenfassung, die den 365 so verschiedenen Texten doch noch gerecht wird.
JULIA KOSPACH
Noch den aufwühlendsten Ereignissen geht Monika Helfer in beinah dokumentarischer Kürze auf den Grund
Natürlich sind da auch einzelne Sätze, die sich einem beim Lesen nachhaltig einprägen: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich für einen Mann entscheidet, der mit so

Monika Helfer: Wie die Welt weiterging. Geschichten f ü r jeden Tag. Hanser, 768 S., € 32,90


Fritsch
Verlag






Verlag


Elke Laznia Fischgrätentage Müry Salzmann Verlag








In seinem Wälzer „Die Projektoren“ dreht Clemens Meyer die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts durch den Fleischwolf
Noch halbwegs am Anfang des 1041 Seiten hohen Textgebirges, das Clemens Meyer in „Die Projektoren“ aufschichtet, heißt es: „Der Roman, wie ihn die Moderne versteht, ist ein Monolith, ein Chaos aus Stimmen.“ Das kann man durchaus so sagen. Dennoch stimmt der Satz, mit dem sich Meyers Roman so salopp wie offensichtlich selbst meint, zunächst ein wenig misstrauisch.
So wartet „Die Projektoren“ mit einer erschlagenden Fülle von Handlungssträngen, Orten, Protagonisten, Zeitebenen und Erzählstilen auf. Es geht um Titos Partisanen, um Nazis und Neonazis. Es geht um Faschismus, Sozialismus, Kapitalismus, um die Jugoslawienkriege der 1990er, um einen China-Imbiss in Sachsen, um ein Massaker an den amerikanischen Ureinwohnern, um den wilden Westen und den wilden Osten. Der Titel lässt erahnen, dass auch das Kino eine wichtige Rolle spielt. Vor allem geht es um Karl May und um seine Helden, die auf der Leinwand von Lex Barker und Pierre Brice verkörpert wurden.
Vom serbischen Novi Sad geht es nach Belgrad, dann in die USA und schließlich ins heutige Syrien. Von Leipzig geht es nach Dortmund und wieder zurück nach Leipzig, wo in einer Nervenheilanstalt ein Mann behandelt wird, der die Wände seiner Zelle beharrlich mit unverständlichem Zeug vollkritzelt und sich daher den Namen „der Fragmentarist“ eingehandelt hat.
Vor allem diese Figur wir anfangs die Frage auf, ob der Autor es sich nicht doch ein wenig zu einfach macht, indem er sich unter dem Deckmantel des „Romans, wie ihn die Moderne versteht“, umstandslos die Lizenz zum planlosen, grafomanisch-größenwahnsinnigen Draufloslabern erteilt. Denn zur Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts lässt sich ja so einiges herbeiassoziieren. Schließlich hängt ja alles mit allem zusammen – irgendwie.
Doch Meyer weiß sehr genau, was er tut, sein Wahnsinn hat Methode. Er legt
Meyer hält keine Sonntagspredigt zur Weltverbesserung und Demokratieverteidigung, sondern zelebriert konsequent die Eigengesetzlichkeit der Literatur
es bewusst darauf an, seinen Lesern auf die Nerven zu gehen, durch unbeirrbar vor sich hinmäandernde Figurenprosa, in der das Geschehen lange keine rechte Kontur annehmen will. Das gilt passagenweise sogar für den Bewusstseinsstrom des „Cowboys“, eine der Hauptfiguren des Romans, ein Gestaltwandler, Schlachtenbummler und Zeitreisender, der gegen die Nazis kämpfte, in Titos Jugoslawien in Ungnade fiel, sich als Film-Double von Lex Barker und als Groschenromanschri steller versuchte. Bisweilen schwer zu ertragen sind auch die beiden „Dottores“, die unbeirrbar kalauernd den Fragmentaristen in der Leipziger Klinik überwachen.
Doch genau in jenen Momenten, in denen man das Buch am liebsten in die tiefste Schlucht des kroatischen Velebitgebirges schleudern will, lenkt der Autor plötzlich ein. Er ändert Stil und Erzähltempo und verwebt all die lose heraushängenden Fäden zu einer formbewussten, stimmigen, unwiderstehlich sogha en Erzählung.

Clemens Meyer: Die Projektoren. Roman. S. Fischer, 1041 S., € 37,10
Zu regelrecht sensationeller Form läu Meyer auf jenen knapp 30 Seiten auf, die gebündelt unter der Kapitelüberschri „Wunder über Wunder“ selbst zu einem der Wunder der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gehören. Als Protagonistin taucht hier die historisch verbürgte „chronofotografische Flinte“ auf, die um 1900 erfunden wurde, um bewegte Objekte abzulichten. Bei Meyer materialisiert sich dieser eigentümliche Fotoapparat, der tatsächlich aussah wie eine Art Gewehr, auf mirakulöse Weise in den Schützengräben des letzten Jahrhunderts. Die Folgen sind fatal. „Bilder waren mit einem Mal gefährlicher als Waffen“, heißt es, „zumindest genauso gefährlich.“
Zu den prägnantesten Nebenfiguren gehört ein junger Neonazi namens Franko, der vor der Wende vaterlos in Westdeutschland aufwuchs. In der Wohnung seiner Hippie-Mutter findet er eines Tages ein altes schwarzes Messbuch im Taschenfor-
mat, den sogenannten Schott, den vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil jeder fromme Katholik besaß (dass Karl Mays Roman „Der Schut“ unmittelbar vor dem „Schott“ Erwähnung findet, gehört zu Meyers komplexem etymologischem Humorprogramm).
Als aus den vergilbten heiligen Seiten dann auch noch ein Ustascha-Ausweis herauspurzelt, ist die selbstermächtigende Herkun sgeschichte schnell fabriziert. Der Vater, so denkt sich Franko, muss in seiner Jugend ein kroatischer erzkatholischer Faschist gewesen sein. Diesem Vorbild gilt es nachzueifern. Franko macht sich auf, um im blutig zerfallenden Jugoslawien mit ein paar Gleichgesinnten auf der Seite der Kroaten zu kämpfen.
Meyer stößt hier in das Herz rechtsidentitärer Vergangenheitsprojektionen vor. An anderer Stelle geht es um die brennenden Flüchtlingsheime im frisch wiedervereinigten Deutschland. Irgendwo findet sich eine unmissverständliche Anspielung auf Putins Überfall auf die Ukraine. Überhaupt gibt es hier unendlich viele Versehrte, Tote und Menschheitsverbrechen. Der so gerne als naiv verschrieene Humanismus Karl Mays, der sich immer wieder zwischen das blutige Geschehen drängt, müsste eigentlich obszön wirken.
Doch genau das ist hier nicht der Fall. Das liegt daran, dass Meyer trotz der offenkundig politischen Schwerpunktsetzung keine Sonntagspredigt zur Weltverbesserung und Demokratieverteidigung hält, sondern konsequent die Eigengesetzlichkeit der Literatur zelebriert. Dazwischen darf dann doch noch deutlich genug und maximal unpathetisch die frohe Botscha der May’schen „Edelmenschen“ durchschimmern. Die Silberplatte, die man Lex Barker nach einer Kriegsverletzung in den Schädel operiert hat, muss bisweilen ganz ähnlich durch sein blondes Haar gefunkelt haben. Wer dieses Buch liest, findet den Schatz im Silbersee.
MARIANNA LIEDER
Der Schri steller und Gitarrist Anatol Regnier erinnert sich an seine Jugend in den 1950ern, an seine Eltern und deren Freunde
M
it dem 16. Geburtstag des Autors enden dessen Erinnerungen an den Taugenichts, der er als Spross einer prominenten Künstlerfamilie war. Im kurzen Nachwort erklärt Anatol Regnier: „Romane schreiben liegt mir nicht, das ,Autofiktionale‘ widerstrebt mir, aber in der Vergangenheit zu wühlen, in Archiven zu hocken, Zusammenhänge zu entdecken und Menschen zu schildern, wie sie wirklich sind, ist für mich das Paradies.“
Im Jänner 1945 geboren und auf den Namen Donald Maria Anatol Charles Nikolaus Hippolyt Rafael Waldemar Antonio Regnier getau , blickt der Autor zurück auf Begebenheiten und Gestalten aus seiner Kindheit und Jugend. Den Großeltern, Tilly und Frank Wedekind, hat er jeweils ein Buch gewidmet, mit „Wir Nachgeborenen“ eines über Kinder berühmter Eltern verfasst. Sein Hauptwerk „Jeder schreibt für sich allein“, eine Studie über die Schri steller im Nationalsozialismus, erschien 2020 und wurde von Dominik Graf als Dokumentarfilm fürs Kino adaptiert.
In den „Erinnerungen eines Taugenichts“ lässt Regnier mithilfe kurzer biografischer Beobachtungen und Anekdoten eine Jugend im Schwabing der 1950er wiederaufleben. Sympathisch daran ist, dass er keinen Unterschied zwischen großen Namen und gänzlich Unbekannten macht und so
die Gefahr des bloßen Name-droppings gekonnt umgeht. Seine eigenen Eltern nehmen dabei naturgemäß eine Sonderstellung ein – die „feurige Mutter“, Pamela Wedekind, und der „elegante Vater“, Charles Regnier, beide Schauspieler.
Doch wie wenig kennt man seine Eltern, vor allem, bevor sie Eltern wurden! Und gerade in dieser Generation stellt sich die Frage: Wie sind sie durch den Krieg gekommen? Und wie ihre Freunde, die man später ja auch selbst kennenlernte? Gustaf Gründgens? Der Regisseur Alfred Weidenmann? Der Schri steller Waldemar Bonsels?
Bonsels, der Vater der „Biene Maja“, war Nachbar der Regniers in Ambach am Starnberger See. In seinem Nachlass fanden sich 70 Briefe von Pamela Wedekind, die von einem Vertrauensverhältnis zu dem Autor zeugen. Dass er sich den Nazis andiente und als Antisemit erwies, hinderte Wedekind nicht, ihren Sohn auch nach ihm zu benennen. Es sind die Widersprüchlichkeiten der menschlichen Natur, denen sich Regnier in seinen Büchern widmet. „Mein Vater hat viele Freunde“, schreibt er. „So gut wie alle sind homosexuell.“ Und über Kai Molvig, dessen ältesten Freund: „Mein Vater brachte ihn mit in die Ehe, die Mutter hat ihn quasi als Mitgi übernommen.“ Onkel Kai machte sich als Übersetzer bei Rowohlt einen Namen; andere Freunde, wie der Sän-

Anatol Regnier: Erinnerungen eines Taugenichts. btb, 314 S., € 24,70
ger Peter Schütte oder der Geschä sführer des Schauspielhauses Hamburg, Gerhard Hirsch, nahmen sich das Leben.
Parallel dazu erzählt Regnier von seiner ersten großen Liebe, der Liebe zur, wie man damals sagte, „Zupfgeige“. Seine großen Vorbilder sind Andrés Segovia und John Williams, bei dem er Gitarre studiert. Doch je länger er später als Musiker au rat, desto weiter entfernte er sich von deren Meisterscha . Schon der Werner, ein Bruder eines Schulfreundes, unterbricht ihn beim Spiel einmal brüsk: „Du kannst das ja gar nicht! Gib nicht an und übe, mehr kann ich dir nicht sagen.“ So weit Werner Herzog.
Das musikalische Talent liegt in der Familie, auch Mutter Pamela gibt Liederabende, singt Frank Wedekind, altfranzösische Volkslieder, Brecht/Weill. Vielleicht nicht mit der gleichen Resonanz wie Lotte Lenya, der sie bei einem Gastspiel in München wiederbegegnet. „Ich sehe sie noch vor der Bühne stehen, auf der die Lenya gerade ihr Programm beendet hatte“, bemerkt Regnier, „die Lenya oben, die Mutter unten, symptomatisch für das Verhältnis zwischen Emigranten und Hiergebliebenen, wie ich es Dutzende Male beobachtet habe.“
Ein irritierender Missklang in diesem sonst so stimmigen, gleichermaßen heiteren wie nachdenklichen Buch.
MICHAEL OMASTA
In „Odenwald“ verschlägt es Thomas Meinecke nach Amorbach, wo die Assoziationsblitze aus den Theoriewolken zucken
Amorbach sei der einzige Ort auf diesem fragwürdigen Planeten, in dem er sich im Grunde noch zuhause fühle, schrieb Theodor Wiesengrund Adorno im Januar 1968 an Annemarie Trabold, die ebendort ein Schreibwarengeschä führte. Mit Mutter und Tante hatte der Knabe Teddie immer wieder das winzige Städtchen im bayerischen Odenwald besucht.
In dem Band „Ohne Leitbild“ beschwört Adorno diese Jahre noch einmal herauf, ein Stück melancholischer Erinnerungsprosa, das bereits in der Kindheit Motive seines späteren Denkens ausmachen will: radikale Kritik der falschen Verhältnisse; die Kunst als Gegenpol zur beschädigten Welt und dabei besonders das Werk Richard Wagners, mit dem er in Amorbach zum ersten Mal in Berührung gekommen sein will, wo ein Bühnenbildner der Bayreuther Festspiele in seinem Atelier regelmäßig Besuch von Sängerinnen und Sängern empfing.
Mit seinem neuen Roman kehrt Thomas Meinecke, über den sich die Experten nicht einig werden, ob er nun zu den Pop-Literaten zählt oder eher doch nicht, in den Odenwald zurück; schon „Tomboy“ von 1998 hatte dort seinen Schauplatz. Nun aber speziell Amorbach, wo eine der Figuren, die wohl nicht zufällig den gleichen Vornamen wie der Autor trägt, in Emichs Hotel absteigt, das, als es noch die Wiesen-
grunds beherbergte, Hotel Post hieß. Um ihn herum versammelt sich ein Ensemble von Figuren, die teilweise schon in früheren Romanen Meineckes unterwegs waren, zu einer lockeren Gesellscha , in der Forschungen sehr unterschiedlicher Art präsentiert, diskutiert und weitergesponnen werden: Psychoanalyse, Mediävistik, Neuere Geschichte, Musikwissenscha – Gendertheorie nicht zu vergessen.
Beim Lesen verirrt man sich recht bald in einen wuchernden Wald aus Geschichten und Theorien. Da geht es erst einmal um die Ortsgeschichte Amorbachs, die ein wenig kompliziert verlaufen ist, wie man das von der deutschen Kleinstaaterei so kennt.
Amorbach kam 1803 zum frisch gegründeten, aber nur kurzlebigen Fürstentum Leiningen, das in jüngerer Zeit Aufmerksamkeit fand, als sich Prinzessin Gabriele von Leiningen 1998 von ihrem Ehemann trennte, zum Islam konvertierte und Karim Aga Khan IV heiratete – überschattet von einem spektakulären Scheidungsprozess.
Auch ihr gönnt Meinecke mehrere Auftritte, zitiert mit bisweilen gnadenloser Ausführlichkeit die einschlägigen Quellen, gerne auch auf Englisch; vergisst natürlich auch nicht Viktor zu Leiningen-Westerburg-Altleiningen, der als Mitbegründer des „Mainzer Adelsvereins“ zwischen 1844 und 1849 die Auswanderung von vielen tausend

Thomas Meinecke: Odenwald. Roman. Suhrkamp, 440 S., € 26,80
Deutschen nach Texas organisierte. Da trifft es sich gut, dass Meinecke schon im Herbst 2023 Teile des Romans am Texas Language Center vorstellen konnte: Auch davon erzählt der Roman.
Der erzählerischen Imagination hat Meinecke schon immer misstraut und stattdessen Versatzstücke aus unterschiedlichsten Diskursen aneinander montiert. Bringt man gehörig Zeit und Geduld für die Lektüre auf, wird ein Netzwerk von Bezügen erkennbar, das auch noch Adornos Amorbach-Essay mit einschließt und als philosophischer Text genauso gelesen werden kann wie als ein Stück Literatur.
Ähnlich verfährt Meinecke, wenn er theoretische Texte als literarisches Material verwendet, aus ihrem ursprünglichen Kontext löst und den Krä en der Assoziation aussetzt. Von der binären Ordnung der Geschlechter bleibt auch hier nicht viel übrig, was damit zusammenpasst, dass auch Meineckes fluide Texte die strikte Unterscheidung von Literatur und Theorie sabotieren. Sie stehen für sich, gigantische Denk- und Erzählmaschinen, reich bestückt mit Schnittstellen, die auf Imaginationen, Geschichten und Archive aller Künste und Wissenscha en zugreifen, ein diskursives Ökosystem, so dunkel und undurchdringlich wie der Odenwald.
TOBIAS HEYL
Seinen Roman „Der Eremit des Friedens“ von 1916 hat Juhani Aho in den österreichischen Bergen angesiedelt
Von Juhani Aho, einem 1861 in Finnland geborenen Autor, nimmt man in der Habsburgermonarchie nicht allzu o Notiz. Mehrere Zeitungen drucken aber immer wieder kurze Beiträge des „Dichters“ ab und loben seinen Stil. 1905 veröffentlicht zum Beispiel die Agramer Zeitung einen Text des Schri stellers – immerhin auf den ersten beiden Seiten. Damals beherrscht freilich der blutige Verlauf der ersten Revolution im russischen Zarenreich, zu dem auch Ahos Heimat gehört, die Schlagzeilen der internationalen Presse. Mag der später als Anwärter auf den Nobelpreis gehandelte Finne im Habsburgerreich auch kein großer Starautor gewesen sein, eignete sich diese für ihn aber sehr wohl als Schauplatz jener Erzählung, die er 1916 unter dem Titel „Eremit des Friedens“ publizierte. Die nunmehr vorliegende, rund 150 Seiten umfassende deutsche Übersetzung beinhaltet auch jene Passagen, die in der finnischen Erstauflage der Zensur zum Opfer fielen. Damals duldeten die Behörden Klagen über die „Sinnlosigkeit“ eines „brutalen“, „verderblichen“, ja „absurden“ Krieges ebenso wenig wie den Protest gegen ein System, in dem alle ungefragt und unterschiedslos „in den Schlund des Todes“ getrieben würden.
Dem „Eremiten des Friedens“, einem „Tolstoi des Gebirges“, begegnet der Icherzähler in der Abgeschiedenheit der Berge, irgendwo in Österreich. Zuvor aber macht der urlaubende Alpinist noch die Bekanntscha einer Gruppe von Studenten, die alle aus verschiedenen Ländern stammen und sich in naivem Optimismus über eine friedvolle Zukun und eine vernun basierte Koexistenz ihrer „Völker“ verbreitern.
Trotz des A entats von Sarajevo glauben die jungen Männer nicht an einen Krieg. Zu „zivilisiert“ sei man längst, zu sehr seien die einzelnen Staaten schon aufgrund wirtscha licher Interessen miteinander verbunden und zu vernetzt schließlich die ganze Welt: Angesichts moderner Kommunikationstechnologie und weitläufiger Verkehrswege würden sich Grenzen fast schon erübrigen. Der Urlauber ist skeptisch. Aber auch die Bewohner des Bergdorfs, das ihm als Ausgangs-
punkt für seine Wanderungen dient, pflichten der sorglosen Jugend bei. Überzeugungsarbeit leistet dann auch der ominöse Einsiedler. Er ist, so skizziert ihn Aho, ein Tiefgläubiger der besonderen Art. Er setzt den Botscha en der national zersplitterten Amtskirche mit Priestern, die stets die Kanonen der jeweiligen Armeen segnen, das Geheimnis gelebten Glaubens entgegen. Und dieses Geheimnis offenbart sich in entwaffnender Einfachheit: Der Glaube vermag Berge zu versetzen! In dem Schilderwald, den der Eremit errichtet hat, ist unter anderem zu lesen: „Der Weltfrieden wird nicht Wirklichkeit, wenn niemand an ihn glaubt. Seine Verwirklichung beginnt sofort, wenn jemand an ihn glaubt.“
Wir wissen, wie es gekommen ist. 1916, als er den Roman verfasst, weiß das auch Aho. Aber er will glauben, dass es besser wird. Was bleibt ihm, dem notorischen Skeptiker, inmitten des großen Blutbads auch anderes übrig? Der Eremit verliert die Hoffnung erst recht nicht und berichtet – der Krieg dauert bereits viele Monate – freudvoll von Weihnachten an der Front und von Soldaten, die aufhörten aufeinander zu schießen. Weitere Verbrüderungen, von denen Aho noch nichts ahnt, werden folgen. Sie sind das Wetterleuchten eines ideologischen Konflikts, der im Zuge der beiden Russischen Revolutionen von 1917 weite Teile Europas in „Bloodlands“ verwandeln wird.
1921 würdigt eine österreichische Zeitung das Lebenswerk des im August jenes Jahres verstorbenen Autors. Sein Buch „Der Friedenseremit“ sei allerdings von „mehr grübelnder und diskutierender Art“ gewesen, heißt es. Über den Frieden nachzudenken, ist nicht zuletzt ein Prozess des Abwägens. Aho hat sich darauf eingelassen.
VERENA MORITZ

Juhani Aho: Der Eremit des Friedens. Roman. Aus dem Finnischen von Gabriele Schrey-Vasara. Braumüller, 159 S., € 22,–
Tine Melzer erzählt in „Do Re Mi Fa So“ die Geschichte eines Wewltverlustes auf höchst amüsante Weise
Zu seinem vierzigsten Geburtstag fallen Gäste ins Haus des berühmten Opernsängers Sebastian Saum ein. Doch der gefeierte Bariton wäre lieber alleine geblieben: „Überraschungspartys sollten verboten werden.“ Um Mitternacht stiehlt er sich fort und beschließt, nachdem er ein Schaumbad genommen hat, auch gleich in der Badewanne zu übernachten. Es plagen ihn große Zweifel: „Solide Berufe, die gänzlich ohne drohende Sinnfragen ausgeübt wer-
»Splitterfasernackt sitzt der Opernsänger in der Badewanne und „dreht sich im Kleiderkarussell“
den können, genießen meinen uneingeschränkten Neid. Ich als Sänger muss mich ständig fragen, wem ich wirklich nutze.“
Zu wessen Zweck und Nutzen der hochsensible Künstler für gut zwei Wochen in seinem selbstgewählten Badezimmerexil verbringt, ist Gegenstand des knapp 200 Seiten starken Künstlerromans „Do Re Mi Fa So“. Die in Zürich lebende Tine Melzer, Jahrgang 1978, hat mit ihrem Debüt „Alpha Bravo Charlie“ (2023) den Franz-Tumler-Literaturpreis gewonnen.
Ihr Folgeroman ist das Gegenteil eines Pageturners und versteht es dennoch gekonnt, die Leser auf das entschleunigte Erzähltempo und seine Sentenzen einzustimmen: „Freiwilligkeit ist das Gegenteil von Geborenwerden“ oder „Alleinsein ist eine gute Übung gegen die Einsamkeit“.
Die Partygäste fragen dann nicht mehr nach dem Gastgeber, und auch in den nächsten Tagen geht der Opernstar offenbar niemandem ab. Auch Melissa, die „große Liebe“, mit der er einst über ein gemeinsames Kind nachgedacht hat, meldet sich nur sporadisch. Sie hält Kontakt mit seinem Mitbewohner Franz und ist sich si-
cher, dass es Saum gut geht in seiner Wanne und in dem in einem Weiler gelegenen Haus, das er von der Mutter geerbt hat.
Der wortkarge Franz wiederum versorgt den Sänger aufopferungsvoll mit Essen und Getränken, die auf dem geschlossenen Klodeckel serviert werden, ist aber bald genervt „von der Freiheit, die ich mir nehme, nicht am Leben der Bekleideten teilzunehmen“.
Saums Versuch, „mit mir selbst auszukommen“, hat nämlich nicht nur den Rückzug aus der Gesellscha und ins Badezimmer, sondern auch den Verzicht auf jegliche Kleidung zur Folge, die ihm dafür als Assoziationsvorlage für seine aufsteigenden Erinnerungen dienen: an die Kniestrümpfe der Kindheit, den Firmungsanzug, den Blaumann beim Handwerken …
Der Opernsänger, gewohnt mit jeder Rolle in ein anderes Kostüm zu schlüpfen, dreht sich nun „splitterfasernackt“ im „Kleiderkarussell“, was freilich nicht ganz ungefährlich scheint, denn Saum gerät – „niemand soll mir erzählen, dass Kleider nicht unheimlich sind“ – im Strudel seiner Assoziationen dem Wahn ziemlich nahe: „Ich versuche mich an alle Menschen zu erinnern, denen ich jemals begegnet bin, mit Vor- und Nachnamen.“
Der Roman, dessen Titel „Do Re Mi Fa So“ auf das „Alphabet des Sängers, der ich bin“ verweist, ist so kunstvoll wie klar gestaltet. Hier sitzt jedes Wort. Und in den Reflexionen des Ich-Erzählers, der mitunter auch ziemlich geschwätzig ist, pendelt die Autorin mit Humor und Sinn für Ironie zwischen den Möglichkeiten bzw. der Diskrepanz eines Lebens zwischen Opernhochkultur und dem einfachen Leben auf dem Lande.
SEBASTIAN
GILLI

Tine Melzer: Do Re Mi Fa So. Roman. Jung und Jung, 192 S., € 22,–
Über 1.5 Mio. Bücher, DVDs & CDs mit gutem Gewissen
Der Roman „Am Himmel die Flüsse“ von Elif Shafak spannt einen epischen Bogen vom Altertum bis in die Gegenwart
I
n einem Wassertropfen steckt bekanntlich ein ganzes Universum. Bei Elif Shafak steckt in einem Wassertropfen ein ganzer Roman. Wasser, heißt es da, „erinnert sich“. Es ist „die seltsamste Chemikalie, das größte Rätsel“. In einer Art Prolog wird ein Regentropfen, der im 7. Jahrhundert vor Christus auf die Stirn des babylonischen Herrschers Assurbanipal fällt, zum Zeugen einer schrecklichen Tat: Der König, so gebildet wie blutrünstig, lässt seinen alten Lehrer bei lebendigem Leib verbrennen. Assurbanipal steht in seiner Bibliothek aus Tontafeln. Von hier stammen die Keilschri -Fragmente, die Jahrtausende überdauerten und die das Gilgamesch-Epos bewahrt haben.
Diesen Fundstücken gilt die Leidenscha der Romanfigur Arthur Smyth, die auf einem realen historischen Vorbild beruht: dem Entzifferer der Keilschri George Smith, der sein ganzes Leben dem Gilgamesch Epos und der Entzifferung der Keilschri widmete.
Als Arthur im Jahr 1840 am Ufer der Themse im Schlamm und in entsetzlicher Armut geboren wird, landet eine Schneeflocke auf seiner Zunge. Es ist eben der Wassertropfen, der in Babylon auf die Stirn des Tyrannen fiel. Vielleicht ist Arthur wegen dieser Berührung mit einem außerordentlich präzisen Gedächtnis ausgestattet, weil Wasser Erinnerungen in homöopathischer Dosis enthält.
Die Anordnung des Wassermoleküls war auch Inspiration für die Struktur des Romans. So wie ein Sauerstoffatom von zwei Wasserstoffatomen umrahmt wird, so fügt Shafak ihre Handlungen zusammen. Die Arthur-Geschichte steht als O in der Mitte. Die Passagen über seine Kindheit in den Elendsquartieren Londons lesen sich wie ein Roman von Charles Dickens, dem Shafak sogar einen eigenen Au ritt ermöglicht. Flankiert wird dieser Erzählstrang von den beiden H-Teilen. Das ist zunächst einmal die Geschichte des Jesiden-Mädchens
Narin, das im Jahr 2014 am Tigris getau werden soll, deshalb mit der Großmutter aus der Türkei in den Irak au richt und dort in ein Massaker des „Islamischen Staates“ gerät. Diese dramatische Reise hat auch mit einem Staudammbau im südlichen Anatolien zu tun, der dazu geführt hat, dass Ausgrabungsstätten und uralte Kulturgüter in den Fluten des Tigris versunken sind.
Im anderen H-Teil geht es um die Hydrologin Zaleekhah, die 2018 in einem Bootshaus auf der Themse lebt. Ihre Depressionen verdankt sie einem Kindheitstrauma: Sie verlor ihre Eltern bei einem Hochwasser des Tigris und wuchs danach bei einem schwerreichen Onkel in London auf. Wasser will sie deshalb erforschen, weil sie darin ihr eigenes Schicksal gespiegelt sieht: „Wasser ist durch und durch Immigrant, es ist gefangen im Übergang und kann sich nirgends für immer niederlassen.“
Elif Shafak lebt mit ihrer Familie in England und schreibt auf Englisch, doch ihr Thema bleibt die türkische Vergangenheit und Gegenwart. Ihr Roman „Der Bastard von Istanbul“, der sich mit dem Völkermord an den Armeniern auseinandersetzt, trug ihr eine Anklage wegen „Beleidigung des Türkentums“ ein.
Ihr jüngstes Buch, „Am Himmel die Flüsse“, verhandelt am Beispiel von Narin die jahrhundertelange Unterdrückung und Verfolgung der Jesiden. Die Angehörigen dieser uralten, nur mündlich tradierten Religion galten als Ungläubige, als „Teufelsanbeter“.
Darüber hinaus beschreibt Shafak, wie Kunstgegenstände aus der mesopotamischen Zeit in alle Welt verhökert wurden. Sie skandalisiert den Bau des international höchst umstrittenen Ilisu-Staudamms, für den 80.000 Menschen – darunter viele Jesiden – umgesiedelt werden mussten. In diesem Fall ist das Wasser nicht nur Symbol, sondern die ganz handfeste Ursache von Heimatlosigkeit. Dass am Ende auch noch

Elif Shafak: Am Him mel die Flüsse. Aus dem Englischen von Michaela Grabinger. Hanser, 592 S., € 28,–

»Literatur auf dieser Stufe ist Vollendung, ist Magie. Lesen Sie dieses Meisterwerk.«
LE MONDE

»Einer der größten literarischen Abenteurer der Gegenwartsliteratur.«
EL PA Í S
»Că rt ă rescu schreibt sich mit Theodoros mitten unter die größten Dichter.«
NZZ

illegaler Organhandel thematisiert wird, ist dann fast ein bisschen zu viel für diesen überquellenden Roman.
Miteinander verbunden sind die verschiedenen Orte und Zeiten zunächst nur durch den Wassertropfen auf seinem ewigen Kreislauf durch die Atmosphäre. Mal stammt er aus einem verunreinigten Brunnen und bringt die Cholera nach London; mal taucht er als Träne auf der Wange der Hydrologin auf; dann befindet er sich in der Flasche mit Tigriswasser, mit dem Narin getau werden soll. Erst ganz am Ende führt Shafak die drei Handlungsstränge mit einer überraschenden Volte dann tatsächlich zusammen, nachdem auch die Hydrologin Zaleekhah in humanistischer Mission zum Tigris au richt.
Alles fließt, das Strömen von Themse und Tigris wird zur Metapher für das Erzählen selbst, das wie das Wasser alles in sich aufzunehmen vermag. Gelegentlich spürt man den Druck, unter dem die Autorin stand, auch noch diese und jene Fakten unterzubringen. Das staut gelegentlich den Erzählfluss, zumal die Informationen über das Gilgamesch-Epos nicht unbedingt dem Wissensstand von 1870 entsprechen. Shafak ist eine epische Erzählerin, detailreich und lebensnah. Wunderbar sind die archaischen Mythen, die Narins Großmutter immer wieder erzählt. Die Uhrzeit, heißt es da, sei verzerrt und trügerisch. Anders ist es mit der „Zeit in den Geschichten“. Sie weiß um „die Brüchigkeit des Friedens, die Tücke der Lebensumstände, die nächtlich lauernden Gefahren, aber sie würdigt auch die kleinen liebenswürdigen Gesten. Deshalb leben Minderheiten nie in der Uhrzeit. Sie leben in der Geschichtenzeit.“ Genau aus diesem Grund ist Elif Shafak eine Erzählerin, für die Zeitgeschichte nicht linear abläu , sondern in all ihren Episoden ineinanderfließt. Alles hat mit allem zu tun, quer durch die Zeiten, vom Altertum bis in die unmittelbare Gegenwart.
JÖRG MAGENAU



Seiten. Gebunden mit Lesebändchen. Auch als E-Book Foto: © Leonhard Hilzensauer. zsolnay.at
672

In ihrer urbanen Dystopie „Morgenlicht“ hält Téa Obreht immer auch ein Fenster der Hoff nung in die Zukun off en
Der titelgebende Wolkenkratzer Morgenlicht in Téa Obrehts neuem Roman ist ziemlich heruntergekommen. Gebaut wurde er vor „über hundert Jahren“, als Vorzeigeprojekt des noblen Stadtteils mit dem martialischen Namen Battle Hill. Nun versinkt das Hochhaus im gelockerten Untergrund, die Aufzüge und die Stromversorgung fallen immer wieder aus.
In dem maroden Gebäude in Island City, das an ein von Überflutungen, Hitze und Versorgungsengpässen geplagtes Manhattan denken lässt, leben neben Ortsansässigen und Flüchtlingen die el ährige Icherzählerin Silvia, ihre Mutter und ihre Tante Ena. Sie sind Teil eines Wiederansiedlungsprogramms. Die verantwortlichen Regierenden belässt die 1985 in Belgrad geborene und 1997 in die USA emigrierte Autorin freilich im Dunkeln – wie so vieles in ihrer Dystopie.
In dieser san chaotischen und von trügerischen Hoffnungen genährten Welt von morgen gibt es aber immerhin ein „Landesbüro für Nachwelt“, das sich um die Organisation des Wiederau aus nach einem offenbar verheerenden Krieg kümmern soll. Außerdem existiert eine Schule, ein Radio spendet Trost und Rat und die Müllentsorgung funktioniert so leidlich. Silvias Mutter träumt gar von der Übernahme eines Cafés in näherer Zukun . In diesem eher dauerimprovisierten als apokalyptischen ClimateFiction-Szenario geht also nicht alles unter, sondern alles irgendwie weiter.
Das einsame Mädchen Silvia rekapituliert, wie man aus einer knapp gehaltenen erzählerischen Klammer erfährt,16 Jahre später die Ereignisse von damals. Das Verhältnis zu ihrer Mutter, die einen Sommer auch als Hufauskratzerin gearbeitet hat, erscheint in diesem Rückblick zunächst als unterkühlt und distanziert, während die als Hausmeisterin arbeitende Tante den Teenager mit ihrer Fabulierkunst in den Bann zieht. Ena erzählt nämlich von einem durch Zeit und Raum wandernden Berggeist, der
In Obrehts eher dauerimprovisiertem als apokalyptischem Climate-FictionSzenario geht also nicht alles unter, sondern alles irgendwie weiter
schon in der sogenannten Alten Heimat sein Unwesen getrieben habe und auch im Hier und Jetzt noch über unglaubliche magische Krä e verfügen soll: Die drei riesigen Hunde, erschaffen wie „aus Ruß und Stahlwolle“, die von einer mysteriösen, im Penthouse wohnenden Malerin nach Einbruch der Dunkelheit ausgeführt werden, seien nur nachts Hunde. Tagsüber aber verwandelten sie sich in Menschen.
Aussicht gestellt wird. Auch Silvias Mutter bekommt die Spätfolgen des ökologischen Desasters zu spüren, als während eines Tauchgangs in den Ruinen eines Hotels plötzlich eine Wand einstürzt und das Schicksal der Taucherin an einem seidenen Faden hängt.

Téa Obreht: Im Morgenlicht. Roman. Aus dem Amerikanischen von Bernhard Robben. Rowohlt Berlin, 352 S., € 28,80
Bevor die Protagonistin Näheres zu diesen möglicherweise als Anspielung auf slawische Mythologien am Balkan konzipierten Geistererscheinungen in Erfahrung bringen kann, verstirbt Ena auf bizarre Weise beim Zubinden ihrer Schuhe. Silvia, die von ihrer danach als Hausmeisterin-Ersatz und später als Wracktaucherin schu enden Mutter zur Geheimniskrämerei über ihre Herkun und die Kenntnis ihrer Muttersprache namens Unser angehalten wird, ist in ihrer unbändigen Neugier auf sich allein gestellt und beginnt mit ihren detektivischen Nachforschungen zu der einzelgängerisch im Dachgeschoß hausenden Bezi Duras. Dabei vertraut sie auf den Schutzzauber angeblich magischer Objekte und läu Gefahr, nicht mehr zwischen verbindlichen Wahrnehmungen und wirksamen Einbildungen unterscheiden zu können.
Die Frage nach der Wirklichkeit des Fiktionalen stellt sich auch in einem Handlungsstrang, der von biografischen Aneignungen und der Suche nach einem verlorenen Manuskript handelt. Später begegnet Silvia, das bislang einzige Kind im Hochhaus, der fast gleichaltrigen Mila. Diese wird zu einer Verbündeten, deren furchtlose Verwegenheit in Kontrast zur Vorsicht Silvias steht. Bezi Duras aber entpuppt sich – eine weitere der zahlreichen Wendungen in diesem täuschungsfreudigen Roman –als durchaus diesseitig engagierte Erscheinung. Sie arbeitet an desillusionierenden Recherchen über jene in weiten Teilen unbewohnbare und vergi ete Insel, die von der Regierung als neuer Siedlungsraum in
In der Folge wendet sich Obreht, die sich in ihrem letzten Roman „Herzland“ um eine Neudeutung des Western-Genres aus osteuropäisch-postkolonialer Sicht bemüht hatte, nochmals intensiv dem konfliktreichen Verhältnis von Mutter und Tochter zu, das vor dem Hintergrund eines mutmaßlichen Kriegsverbrechens nochmals an Brisanz gewinnt. Es gelingen ihr hier einige überzeugende Passagen über gelingendes und scheiterndes Einander-Verstehen. Darüber hinaus relativiert sie auch die Tendenz des eigenen Romans zur Wiederverzauberung der nachmodernen Welt, wenn sie etwa der Mutter als Reaktion auf den Aberglauben ihrer Tochter in den Mund legt, diese solle sich gefälligst von dem „volkstümlichen Quatsch“ befreien.
In Bezug auf das o ff enbar im Rahmen von nicht näher definierten „Säuberungen“ verübte Kriegsverbrechen bleibt eine genaue politische Verortung aus. Diese Abstraktion von politischer Gewalt und kriegerischem Horror kann man dem Roman angesichts der realen Kriege und der flexiblen Faschismen, die sich an vielen Orten der Welt manifestieren, durchaus zum Vorwurf machen. Die Last einer ins Unbestimmbare gerückten Geschichte liegt nicht so schwer auf den Schultern wie eine konkrete Erinnerung. Trotz aller Traumata ist es der Protagonistin daher auch möglich, sich selbst ins Zukun soffene zu entwerfen, kann Obreht am Schluss noch einmal den narrativen Köder der „Was wäre, wenn“-Fiktionen auswerfen: „Die Vergangenheit ist ungeheuerlich. Nur bedeutet sie weniger und weniger. Also kommen wir ohne sie zurecht. Und das ist gut so.“
THOMAS EDLINGER
In seinen zwei Romanen arbeitet Tommy Orange die Leidensgeschichte der Native Americans ohne Pathos auf
Er gilt als die kra volle neue Stimme der nordamerikanischen Ureinwohner: Tommy Orange, Jahrgang 1982, ein Native American vom Stamm der Cheyenne und Arapaho. In seinen beiden Romanen „Dort, dort“ und „Verlorene Sterne“ rückt er ein gerne verdrängtes Thema neu ins Bewusstsein – den Vernichtungskrieg, den die europäischen Einwanderer gegen die Ureinwohner führten.
Beide Romane beginnen mit einem sarkastischen Schnelldurchgang durch die Leidensgeschichte der American Indians in ihrem vergeblichen Kampf gegen die Kolonisatoren – von der Vertreibung aus ihren angestammten Territorien über die Massaker an den rebellischen Stämmen der Prärie-Indianer bis zur erzwungenen Assimilation, die die Ureinwohner vor das Dilemma stellten, entweder in der überlegenen Zivilisation auf- oder unterzugehen.
„Dieser Krieg hat länger angehalten, als es die USA heute gibt. Dreihundertdreizehn Jahre. Und nach all dem Töten und Vertreiben und Versprengen und Wieder-Zusammentreiben von Indianern, um sie in Reservate zu sperren, und nachdem die Bison-Population von rund dreißig Millionen auf ein paar Hundert Wildtiere zusammengeschossen war, schließlich bedeutete ,jeder tote Bison einen Indianer weniger‘, kam ein neuer politischer Slogan für das Indianerproblem auf: ,Den Indianer töten, um den Menschen
zu retten‘. Als die Indianerkriege langsam abkühlten, als Landraub und Selbstverwaltung der Stämme zu bloßer Bürokratie wurden, steckte man die Indianerkinder in Internate, wo man ihnen beibrachte, was alles am Indianer-Sein falsch war. Damit aus ihm ein Nicht-Indianer im Sinne dieser Schulen wurde, tötete man den Indianer, um den Menschen zu retten.“
Das Augenmerk des Autors gilt vor allem jener Generation von Urban Indians, die in den letzten 50 Jahren das elende Dasein in den Indianerreservaten aufgaben, um in den Städten Arbeit und ein besseres Leben zu suchen. Konkret erzählt Tommy Orange von der schwierigen Existenz einer Handvoll städtischer Indianer und deren Familien in seiner Heimatstadt Oakland, Kalifornien. Sie sind gezwungen, ihr Dasein auf und in dem Land zu fristen, das ihnen weggenommen wurde, und sie kämpfen nicht nur gegen Armut und Arbeitslosigkeit. Fast alle Romanfiguren sind und waren eine Zeit lang suchtkrank, abhängig von Nikotin, Alkohol oder anderen Drogen. Die Familien sind zerstückelt, die Männer hauen irgendwann ab und überlassen es den Frauen, sich und die Kinder durchzubringen und so etwas wie ein Familienleben zu improvisieren. In beiden Romanen spielt der Teenager Orvil Red Feather eine Protagonistenrolle, neben den beiden taffen Halbschwestern Opal Bear Shield und Jacquie Red Feather,









»Kein Indianer von damals, als die Weißen uns das erste Mal so genannt haben, würde uns heute noch als Indianer erkennen. So hätten sie sich selber überhaupt nicht genannt
die als Erzieherinnen des Schulabbrechers fungieren.
Beide Romane thematisieren die Zerstörung des historischen Gedächtnisses der Native Americans und deren Versuche, dieses wieder zu restituieren, die verlorenen Stammessprachen, Zeremonien, Tänze und Gesänge wiederzubeleben; allerdings immer in dem Bewusstsein, selbst gar keine „echten“ Indianer mehr zu sein. Sie veranstalten sogenannte „Powwows“, Traditions- und Brauchtumstreffen, auf denen viel getrommelt und getanzt wird, und wissen doch, dass sie sich bloß für ein Folklore-Event verkleidet haben: „Kein Indianer von damals, als die Weißen uns das erste Mal so genannt haben, würde uns heute noch als Indianer erkennen. So hätten sie sich selber überhaupt nicht genannt. Sie hatten ja ihre eigenen Sprachen und Namen für alles. Genau wie sie ja auch in Afrika alle ihre verschiedenen Länder mit eigener Geschichte haben und doch alle Afrikaner sind.“
















Tommy Orange: Verlorene Sterne. Roman. Aus dem Amerikanischen von Hannes Meyer. Hanser Berlin, 304 S., € 26,80

Bereits mit seinem vor sechs Jahren erschienenen preisgekrönten Debütroman „Dort, dort“ hatte Tommy Orange international Eindruck gemacht. Er erzählte darin vom Aufstand der Urban Indians Kaliforniens gegen ihre Entrechtung und Entterritorialisierung, der 1969 in der historischen Besetzung der ehemaligen Gefängnisinsel Alcatraz gipfelt, an der der Autor etliche seiner Figuren teilnehmen lässt. Im Finale des Romans treffen sich alle bei einem Powwow in Oakland, bei dem es zu einer Schießerei mit vielen Toten und Verletzten kommt. Dabei wird der Teenager Orvil Red Feather angeschossen und schwer verwundet. In „Verlorene Sterne“, seinem neuen Roman, erzählt Orange mehr über Orvils Herkun und darüber, wie es mit dem Jungen nach dem Powwow-Anschlag weiterging. Erzählt wird im Wesentlichen Orvils Suchtgeschichte, die den vorhersehbaren Verlauf nimmt. Es beginnt damit, dass dem Jungen, der einen Steckschuss abbekommen hat, gegen die Schmerzen viel zu starke Morphiumtabletten verschrieben werden. Bald erhöht er eigenmächtig die Dosis: „Ihm kam der Gedanke, dass er süchtig wurde. Das Wort war ihm nicht fremd. Diesen Vorwurf hatte er schon in Bezug auf Videospiele und sein Handy und Bildschirme im Allgemeinen gehört. Und er wusste, dass er von Süchtigen abstammte. In seinem Fall war ihm schon vor seiner Geburt die Sucht eingestochen worden. Von seiner Mom mit Nadel und Heroin.“ Ein Schulkamerad gewöhnt ihn an Tabletten, die sein Vater zuhause in einem Privatlabor herstellt. Um seine Sucht zu bedienen, wird Orvil selbst zum Dealer. Am Ende stehen eine Überdosis und ein qualvoller Entzug.
Der Gefahr des Elendskitschs, zu dem eine solche Geschichte leicht verkommen könnte, entgeht Tommy Orange durch den abgebrüht-coolen Erzählton, den er anschlägt. Schon sein Rückblick auf die Leidensgeschichte der indianischen Völker vermied alle Weheleid- und Klage-Rhetorik, sondern behandelte die historische Katastrophe mit bissigem Ingrimm. Lässiger ist dieser pathos-gefährdete Stoff noch nie erzählt worden.
SIGRID LÖFFLER
US-Autor Richard Powers grei mit „Das große Spiel“ ein brisantes Thema auf, verliert sich aber in den Weiten der Ozeane
Geboren am 1. Jänner 1970 eine Sekunde nach Mitternacht, wird Todd Keane von seinen Eltern in jungen Jahren „Nummer eins“ genannt. Was das Einzelkind schon etwas unter Druck setzt. Es hält ihm freilich stand, wird Computer-Wizard und mit seiner Schöpfung Playground, einem digitalen Spielplatz in der Art von Facebook und „Second Life“, zum Milliardär. Todd Keanes Widerpart ist Rafi Young. Von seinem Vater darauf gedrillt, frisst sich der schwarze Junge aus armen Verhältnissen schon als Schüler durch ganze Bibliotheken. Für einige Jahre verbindet ihn und Todd eine intensive Freundscha , obwohl die beiden in Hinblick auf ihren Hintergrund und ihre Neigungen verschiedener kaum sein könnten.
Was sie eint, ist ihre Intelligenz, Neugier und schnelle Auffassungsgabe. Während ihres Studiums bestreiten die beiden regelrechte Marathons in Schach und Go. Danach trennen sich ihre Wege. Auch wegen Ina Aroita: Die junge Frau findet einen Draht zum verschlossenen Rafi und wird seine große Liebe.
Jahrzehnte später lebt das Paar mit seinen Adoptivkindern auf Makatea, einer zu Französisch-Polynesien gehörende Koralleninsel im Südpazifik. Rafi ist Lehrer, Ina macht aus angeschwemmtem Plastik Kunst. Die Insel zählt nicht einmal hundert Bewohner. In den 1960ern wurde hier auf Teufel komm raus Phosphat abgebaut, inzwischen hat sich das Ökosystem halbwegs erholt.
Da kommt eine neue Bedrohung auf. Amerikanische Investoren wollen in der Gegend ein Pionierprojekt des sogenannten „Seasteading“ durchführen, also dauerha en Lebensraum auf dem Meer schaffen. Geplant sind „schwimmende Burgen der Selbstverwirklichung“ für eine entsprechend reiche Klientel.
Finanziell würden die Makateer davon profitieren. Aber womöglich wäre es gleichzeitig das Todesurteil für ihren Lebensraum. Das Zünglein an der Waage bei der Abstimmung unter den Inselbewohnern könnte Evie Beaulieu sein, die ihr Leben der Erforschung des Ozeans verschrieben hat.
US-Autor Richard Powers legt alle paar Jahre einen Wälzer vor, in dem er nach akribischer Recherche seine aktuellen Interessen verarbeitet. Nicht umsonst gilt der Mittsechziger als „the brain“ der zeitgenössischen Literatur. In vorangegangenen Romanen hat er sich mit den Erkenntnissen der Gehirnforschung („Das Echo der Erinnerung“) oder der Gentechnik („Das größere Glück“) beschä igt. Seine Bücher lesen sich wie intellektuell anregende Einführungen in verschiedene Wissensgebiete.
Zuletzt hat sich der studierte Physiker, der in jungen Jahren als Programmierer gearbeitet hat, unter dem Eindruck des Klimawandels verstärkt der Natur zugewandt. In „Die Wurzeln des Lebens“ ging es um das aus dem Gleichgewicht geratene Verhältnis zwischen Mensch und Natur – und um die Kra von Bäumen.
Mit „Das große Spiel“ setzt Powers diese Thematik auf dem offenen Meer fort, ohne das Genre der Dystopie zu bemühen, wenngleich das Bedrohungsszenario eines ständig steigenden Meeresspiegels nicht ausge-
Nach der Gehirnforschung und Gentechnik hat sich Richard „the brain“ Powers der Natur zugewandt und widmet seinen jüngsten Roman dem Ökosystem der Ozeane
blendet wird. Aber anstatt nur schwarz in schwarz zu malen, betreibt der Roman einigen Aufwand, um die Schönheit der Unterwasserwelt zur Geltung zu bringen: Die Beschreibungen dessen, was Evie Beaulieu auf ihren Tauchgängen zu sehen bekommt, sind so farbenfroh wie eine Naturdoku in Ultra HD-Auflösung. Wobei sich Powers nicht damit bescheidet, Staunen hervorzurufen, sondern schon auch eine Botscha hat: Das Leben unter Wasser könnte uns etwas über Koexistenz erzählen und lehren – auch auf der Erde.
Dabei ist dem US-Autor der moralische Zeigefinger fremd. Powers drückt einem seine Meinung nicht aufs Auge, er überlässt es den Leserinnen und Lesern, ihre Schlüsse zu ziehen.
Bevor es zu technisch oder abstrakt wird, nimmt er verlässlich die Abzweigung Richtung Plot. So geht das über 500 Seiten hin und her. Der vielfach ausgezeichnete Powers zählt unbestritten zu den großen Romanciers unserer Zeit. Doch diesmal sinkt die Begeisterung mit Fortdauer der Lektüre. Die häufigen Zeit-, Orts- und Perspektivwechsel sorgen dafür, dass man immer wieder neu ansetzen muss und bisweilen Angst bekommt, unter eine Welle aus Text gedrückt zu werden. So erzählt Todd, der im Alter von 50 Jahren an Demenz erkrankt, seine Geschichte mit Rafi und vom Aufstieg seines Unternehmens einem „Du“, das
schwer auszumachen ist. Oder spricht hier schon eine KI?
Erschwerend kommt hinzu, dass die Figuren für einen so komplexen Roman recht eindimensional geraten sind. Literaturnerd Rafi wird nie grei ar. Technikvisionär Todd entwickelt sich mit wachsendem Reichtum immer mehr zum versponnenen Konzernchef, wie man das aus dem wirklichen Leben ja von Twitter kennt, das jetzt X heißt.
Leider gesteht Powers dem SuperhirnDuo mit Empathiemangel viel mehr Raum zu als Taucherin Evie Beaulieu. Diese hat damit zu kämpfen, dass sie als Erforscherin der Ozeane in eine Männerdomäne eindringt. Sie muss für ihre große Leidenscha auch immer wieder ihren Ehegatten und die zwei kleinen Kinder über längere Zeit zuhause zurücklassen.
Evie regt sich darüber auf, dass die meisten Menschen, wenn sie „Meer“ sagen, nur die Küstenregionen meinen. Sie hingegen interessiert sich für das fast unermesslich große Ganze. So ähnlich dür e das Selbstverständnis von Powers als Autor aussehen. Er würde am liebsten die ganze Welt zu fassen kriegen.
„Das große Spiel“ erforscht den Ozean, erzählt von Freundscha und behandelt obendrein das Thema künstliche Intelligenz. Leider ergibt das Ganze weniger als die Summe der einzelnen Teile. SEBASTIAN FASTHUBER


In seinem Debütroman „Ours. Die Stadt“ erteilt sich Phillip B. Williams jede Lizenz, schwarze Geschichte magisch umzudichten
Ursprünglich war es eine Kurzgeschichte, die der junge Phillip B. Williams bei einem Literaturwettbewerb eingereicht hatte. Sie belegte dort nur den dritten Platz, denn die Jurorin fand, da stecke eigentlich etwas Größeres drin. Der Autor hat sie beim Wort und sich zehn Jahre Zeit genommen, um den Roman „Ours. Die Stadt“ zu schreiben. Der 1986 in Chicago geborene Afroamerikaner ist zunächst als Lyriker hervorgetreten, sein Debütroman aber wurde in den USA mit großer Spannung erwartet, nicht zuletzt von TV-Talk-Queen Oprah Winfrey. Kein Wunder, sind doch die mächtigsten Figuren weiblich oder genderfluid, während die kühn geschichtsklitternde Prämisse schwarze Kollektivtraumata mit Balsam bestreicht.
Der Roman beginnt mit einer mitreißend beschriebenen Szene in der Gegenwart: Ein schwarzer Teenager wird von der Polizei angeschossen, ein klarer Fall von Racial Profiling, erhebt sich aber scheinbar unversehrt vom Boden. Dann springt die Handlung ins 19. Jahrhundert zurück, wo sie sich fast durchgehend abspielen wird.
Um 1830 ist eine Zauberin namens Saint, also Heilige, auf den Plantagen von Missouri eingefallen, hat die Besitzer getötet und die Versklavten befreit. Mit Geldscheinen wedelnd konnte sie einen weißen Banker überzeugen, die geltenden Rassentrennungsgesetze zu ignorieren und ihr Immobilien und Land zu verkaufen. Um die neue Stadt, die ausschließlich von ihr, ihrer Crew und den Befreiten bewohnt wird und somit „uns gehört“ – daher der Name Ours –, hat sie einen magischen Schutzwall aus Steinen errichtet.
Als die Haupterzählung einsetzt, ist der Alltag in Ours voll im Gange, allerdings geht der Traum von der heilen schwarzen Welt nicht auf. Denn Saint hat ihre mannigfaltigen übersinnlichen Krä e nicht ganz unter Kontrolle. Die Zeit scheint hier langsamer zu vergehen als draußen, sodass der Bürgerkrieg und die Abschaffung der Skla-
verei beinahe an Ours vorübergehen. Eine von einem Geist besessene Frau stirbt, obwohl Saint geholt wird, um sie zu retten, und auch mit ihrem Zauber zum Behufe der Geburtenkontrolle geht etwas schief. Während Saint bei den Einwohnern zusehends an Glaubwürdigkeit und Beliebtheit verliert, finden auf unergründlichen Wegen vereinzelte Zugereiste doch ihren Weg in die Stadt, darunter Frances, eine mal männliche, mal weibliche Person, die „aus Wasser geboren“ ist und sich so wie auch Saint nicht so genau erinnern kann, wie sie hier gelandet ist.
Außerdem folgt der Roman den Schicksalen eines guten Dutzends weiterer Ouhmey – so die an ihre afrikanischen Wurzeln gemahnende Selbstbezeichnung der lokalen Bevölkerung.
Überhaupt liebt der Autor das Spiel mit sprechenden Namen: Justice heißt einer, Joy eine andere, und die Frau, der Saint möglicherweise ihre magischen Krä e verdankt, nennt sich Essence. Da sich die meisten Ouhmey nach der Befreiung nicht an ihre ursprünglichen Namen erinnern können, dürfen sie sich welche aussuchen. Eine Frau, der die Liebe abgeht, hat sich für Miss Love entschieden, ein Mann, der seine verstorbene Frau vermisst, für Miss (!) Wife. Lustigerweise heiraten die beiden und Miss Love wird zu Mrs. Wife. Wirklich grei are Charaktere werden daraus allerdings keine, denn was in diesen vorgeht, hängt jeweils stark von den gerade statthabenden magischen Machenscha en ab, die keiner nachvollziehbaren Logik folgen.
Colson Whitehead hat in seinem Roman „Underground Railroad“ (2016) die Fiktion durchgespielt, das legendäre Netzwerk freigekommener Sklaven wäre tatsächlich eine echte Eisenbahnlinie gewesen. Auch sein um 17 Jahre jüngerer Landsmann Phillip B. Williams entwir eine Alternativwelt, die er mit zahlreichen Referenzen an afrikanische und afroamerikanische Mythen ausstattet, in der er nach Gutdünken schal-


S., € 28,80
ten und walten kann. Man kann „Ours“ dem Genre des magischen Realismus zurechnen – mit he iger Betonung auf „magisch“. Ein Mysterium jagt das andere, jedes Kapitel wir mehrere neue Fragen auf. Dass auf die meisten keine befriedigende Antwort folgen wird, ahnt man, vom starken Einstieg gepackt, erst spät; und immerhin klärt sich auf, was der Jugendliche im 21. Jahrhundert soll.
Bei allem Hokuspokus sind wir hier nicht bei Harry Potter, und Phillip B. Williams mag zwar einen Prosawälzer geschrieben haben, ist in erster Linie aber immer noch Poet. Das Erzählen ist weder seine Stärke noch scheint er großes Interesse daran zu haben. Lieber malt er, durchaus gekonnt, mit dickem Pinsel farbenfrohe Bilder des Infernos, die die Stadt Ours und deren Bewohner regelmäßig erleben.
Alles wabert traumartig. „Bunte Stoffe flossen über Boden und Wände“, nimmt ein ungebetener Gast in einer kurzen Episode seine Umgebung wahr. „Vorhänge verbargen den Rest Sonnenlicht, das der nahende Abend noch übrig ließ, und Dutzende brennende Kerzen verwandelten den Stoff in ein wogendes Meer.“ Wie es der Mann wieder aus Ours herausschafft, erfahren wir nie, nur dies: „Als er sprach, troff Kauderwelsch von seiner Zunge.“ Umso trivialer nehmen sich im Vergleich zu solch elaboriertem Schwulst manche der Dialoge aus. Angesichts solcher stilistischen Sprünge plagt sich die Übersetzerin sichtlich damit, einen Ton durchzuhalten, der glaubha der Sprache des 19. Jahrhunderts entspricht. Im Zweifelsfall entscheidet sie sich dankenswerterweise für ein flüssig lesbares Deutsch. Ein weiteres Hindernis auf diesem stellenweise faszinierenden, insgesamt aber vor allem anstrengenden Literatur-Parcours wäre auch fatal. Fast scheint es, als läge auch um den Roman ein Kreis von Zaubersteinen, der Eindringlinge abhält.
MARTIN PESL
Nein, der Krebs ist noch nicht besiegt, aber die Wissenschaft ist ihm auf der Spur!
Von der historischen Entwicklung der Krebsbehandlung, von Hippokrates über Virchow bis zu den beeindruckenden Fortschritten in der Forschung. Wie Hormone, Gene und das Immunsystem den Krebs beeinfussen, wie moderne Chirurgie, die Entdeckung der Erblichkeit von Krebs und bahnbrechende Entwicklungen in der Immuntherapie die Behandlung revolutionierten.


»›Dem Krebs auf der Spur‹ ist nicht nur ein für medizinische Profs und Laien lehrreicher Beitrag zu einem wichtigen Thema unserer Zeit, sondern auch ein medizinischer, historischer, soziologischer und wissenschaftlicher Kriminalroman.«


– Univ.-Prof. Dr. Markus Müller | Rektor der Medizinischen Universität Wien
Wie man seit vergangener Woche weiß, hat Margaret Atwood, 84, den Literaturnobelpreis wieder nicht gewonnen. Vielleicht hat sie sich darüber hinweggetröstet, indem sie gemeinsam mit ein paar alten Freundinnen den ein oder anderen Gin Tonic verräumt und über die Entscheidung abgelästert hat. So würde man es sich jedenfalls gerne vorstellen, und vergleichbare Szene finden sich auch in den 15 Storys, die in Atwoods jüngstem Buch „Hier kommen wir nicht lebend raus“ versammelt sind. Als Myrna Chrissys Wohnung betritt, ist Leonie schon da, ein Glas Gin Tonic in der Hand, große, orange Plastikohrringe, keine Perücke nach der zweiten Chemo. Die drei gehören irgendeinem Komitee an, das auf Spenden von Erben mit schlechtem Gewissen hofft, und Myra findet: „Menschen mit Geld sollten ö er sterben.“ Worauf Leonie einwendet: „Hör auf, ständig dieses S-Wort zu sagen […]. Ich finde, das triggert.“ Es wird ausführlich gestorben bei Atwood. In der letzten Geschichte, deren Titel, „Old Babes in the Wood“, auch jener der englischen Originalausgabe ist, sind nur noch Nell und deren um vieles jüngere Schwester am Leben. Nells Mann Tig ist nicht mehr (das S-Wort wird auch von ihr immer wieder ausgespart), was Nell das Herz gebrochen hat, bloß, dass man das in ihrer Familie nicht sagt, sondern stattdessen nach Keksen fragt. „,Gibt’s noch Kekse?‘, bringt sie heraus. ,Nein‘, sagt Lizzie. ,Aber Schokolade. […]‘ Sie weiß, dass Nells Herz gebrochen ist; ihr muss man nichts erzählen.“
Atwoods „Geschichten“ sind ein ziemlich wilder Mix. Unter ihnen findet sich etwa auch ein Monolog der grausam ermordeten spätantiken Philosophin und Mathematikerin Hypatia von Alexandria („Tod durch Muschelschalen“), eine düstere post-pandemische eugenische Dystopie („Freizone“) à la „Der Report der Magd“ oder ein „Interview mit einem Toten“, das Atwood selbst mit niemand Geringerem als George Orwell führt.
Formal konventioneller, aber um nichts weniger schräg und darüber hinaus sehr, sehr komisch sind „Meine böse Mutter“ und „Schlechte Zähne“. Besagte Mutter fusioniert schwarze Magie mit schwarzer Pädagogik, um ihre Tochter unter anderem vor dem sicheren Unfalltod im Auto ihres Freundes oder vor deren Sportlehrerin zu schützen, mit der die dominante Mama einen schon Jahrhunderte währenden Showdown unter Hexen austrägt. Und die schlechten Zähne gehören einem gewissen Newman Small, von dem Csilla unbeirrbar behauptet, ihre Freundin Lynne hätte in den späten 1960ern eine Aff äre mit diesem gehabt, was diese so vehement wie folgenlos bestreitet.
Die Unverblümtheit, mit der die beiden älteren, Scones schnabulierenden Damen ihr Liebesleben von seinerzeit Revue passieren lassen, wird in der deutschen Ausgabe übrigens nicht ganz originalgetreu abgebildet, wenn Monika Baark „to be hung like a donkey“ etwas gar betulich mit „was in der Hosen haben“ übersetzt.
Die Storys von Lydia Davis und Margaret Atwood handeln vom Alter. Im Vergleich zu deren Scharfsinn und Witz sehen sehr viel Jüngere freilich ziemlich alt aus


Lydia Davis: Unsere Fremden. Stories. Aus dem Amerikanischen von Jan Wilm. Droschl, 312 S., € 26,–
Die Gemeinsamkeiten zwischen Margaret Atwood und deren US-amerikanischer Kollegin Lydia Davis, 77, sind nicht zu übersehen. Beide haben soeben Storys herausgebracht, in denen sie sich ausgesprochen unzimperlich mit dem Altwerden und den damit einhergehenden Verlusten auseinandersetzen; beide verfügen über eine unglaubliche Beobachtungsgabe, Beschreibungsakribie und einen ziemlich trockenen Witz; beide warten mit grandiosen Freundinnengesprächen auf; und bei beiden spielen Tiere eine große, tote Tiere in Tie ühltruhen eine besondere Rolle. Bei Atwood ist es eine Katze zwischen Würsten und Erbsen, bei Davis ein Wiesel neben einer Flasche Wodka.
Und nun zu den Unterschieden. Atwood kann Kurzgeschichte, aber in Sachen Kürze spielt Davis, die 2013 mit dem internationalen Man Booker Prize ausgezeichnet wurde, in ihrer eigenen Liga. Der offizielle Witz geht so: Davis’ Bücher kann man während einer roten Ampelphase lesen. Der MetaJoke dazu: Eine Grünphase tut’s auch. Denn die „Geschichten“ in „Unsere Fremden“, dem bereits sechsten Erzählungsband, der im Grazer Droschl Verlag erschienen ist, sind o nur wenige Zeilen lang. Wo Atwood mit ihren sieben unsentimentalen, aber berührenden Storys über Nell und Tig ihrem Band ein starkes thematisches und narratives Rückgrat eingesetzt hat, da verzichtet Davis auf dergleichen und setzt aufs serielle Prinzip – etwa mit ihrer „Claim to Fame“-Reihe (in der Übersetzung: „Berühmtheitsgrund“, naja), die Promi-Ansprüche anmeldet, weil: „Der Schwiegervater der Tochter der Tante meiner Halbschwester war Ezra Pound.“ Sehr vergnüglich auch die „Ehemomente der Verärgerung“, wo sich der Eintrag „Gemurmel“ wie folgt liest: „[Murmel, Murmel.]“ / „Ich kann dich nicht hören.“ / „Willst du mich hören?“ / „Nein.“
Es ist nur ein Beleg dafür, wie die auch als Übersetzerin tätige Lydia Davis Störungen in der Kommunikation als Inspirationsquelle nutzt und Fehlleistungen wie Verschreiben, Versprechen und Verhören zum Ausgangspunkt ihrer verbalen Vignetten macht – zum Frust und Verdruss des Übersetzers, der am Original nur scheitern kann, wenn ein Pilot und eine Vogelfreundin aufgrund der akustischen Ähnlichkeit der Phrase „So what?“ („Na und?“) und „Saw Whet“ (Sägekauz) aufs Komischste aneinander vorbeireden.

Margaret Atwood: Hier kommen wir nicht lebend raus. Storys. Deutsch von Monika Baark. Berlin Verlag, 304 S., € 26,80
Davis’ überbordende, nach allen Seiten offene Neugier ist ansteckend und kommt in dem Text „Jemand fragt mich nach Flechten“ aufs Schönste zum Ausdruck: „Nachdem die Person gesagt hatte, dass er vermute, ich könnte mich für Flechten interessieren, habe ich mich natürlich sofort für Flechten interessiert […], obwohl ich eigentlich kein flechteninteressierter Mensch gewesen war, bis zu dem Zeitpunkt, als er dies gesagt hatte.“ Es versteht sich wohl von selbst, dass sich der Rezensent nach Lektüre dieser Geschichte sofort das Buch „Die Flechten Mitteleuropas“ bestellt hat. KLAUS NÜCHTERN
Das Teilen und der Neid, die Einsamkeit und die Sehnsucht, im Mi!elpunkt zu stehen, die Scham, ausgeschlossen zu werden, der Wert der Vielfalt und der Freundscha : Der Bilderbuchherbst kommt beziehungslastig, aber auf jeden Fall unterhaltsam daher!
REZENSIONEN:
KIRSTIN BREITENFELLNER
Wer teilt schon gerne? Jedenfalls nicht die kleine Sally. Als sie erfährt, dass ihr Freund Nico zu Besuch kommt, fängt sie an, ihre Sachen im großen Kasten zu verstecken. Zunächst scheint es ja keine schlechte Idee von Mama gewesen zu sein. Aber nach dem Stofftier-Eichhörnchen muss unbedingt auch die Parkgarage weg und das Spiel mit den Fischen – und dann sogar Sachen, die eigentlich zu groß für den Schrank sind, wie die Matratze, die Badewanne, das Klo und der Kühlschrank. Schließlich muss sogar Mama selbst daran glauben. Als Nico endlich da ist, wird auch er ins Versteck bugsiert, denn es könnte ja sein, dass Eva auch kommt und mit Nico spielen will! Und mit Eva will Sally auch nicht teilen!
Unterstützt wird diese Geschichte über das Dilemma des Neides von den frechfröhlichen Zeichnungen von Charlotte Ramel mit abstrusen Größenverhältnissen zwischen Menschen und Dingen. Ja, manchmal muss man ein Phänomen ins Groteske steigern, um seinen Kern sichtbar zu machen. Das gelingt Autorin Klara Persson hier ganz formidabel und sogar ohne erhobenen Zeigefinger.

Klara Persson, Charlo ! e Ramel (Illustr.): Meins! Hanser, 32 S., € 15,50 (ab 3)
Das Leben ist ungerecht. Nur weil sie schon länger auf der Welt sind, dürfen die Erwachsenen so viele Dinge alleine entscheiden. Ob sie Handschuhe anziehen, wo sie schlafen wollen und wie viele Kinder in ihrem Haushalt leben sollen. Wenn sie nur eins haben, heißt das dann Einzelkind. Das ist nicht schlimm, denn ein Einzelkind ist ja nicht alleine, aber manchmal fühlt es sich schon einsam, zum Beispiel im Urlaub. Corinna Pourian versucht in diesem poetisch-schönen Bilderbuch erst gar nicht, Einzelkinder zu trösten, sondern lädt sie stattdessen zu einem permanenten Perspektivwechsel ein. Außerdem bleibt im Leben ja nichts so, wie es ist. Und irgendwann kann das „Alleinekind“ selbst entscheiden, wie es leben möchte. „Dann bekommt es vielleicht selbst zwei oder vier Kinder. Oder kein oder drei.“

Weil ihr Freund Nico nicht damit spielen darf, verräumt Sally sogar Badewanne und Klo

W er Sport macht, muss aufpassen, sich nicht zu verletzen. Aber wenn man in der Pause im Schulhof um den Tischtennistisch jagt und hinfällt, sodass das Knie blutet wie verrückt, kommt man vielleicht drauf, dass Wunden auch ihre Vorteile haben. Der kleine Icherzähler genießt die „schönste Wunde“, weil er plötzlich im Mittelpunkt steht. Alle versammeln sich um ihn. Mama muss von der Arbeit kommen und ihn abholen. Alle Wunden heilen irgendwann. Zuerst bildet sich eine formidable Kruste über der Wunde. Als diese im Schwimmunterricht abgeht und im Becken schwimmt, scheint das die traurigste Sache der Welt. Aber zum Glück bleibt ja eine Narbe! Ein frech-fröhliches Trostbuch, das dazu angetan ist, anscheinend unumstößliche Wertungen noch einmal zu überdenken.

Emma AdBåge: Die schönste Wunde. 28 S., € 14,40 (ab 4)

Bailey, Natalia Shaloshvili (Illustr.): Drei kleine Handschuhe. cbj, 40 S., ! 15,50 (ab 4)
Kinder sind gerne gewillt, Gegenständen eine Seele und einen Willen zuzusprechen. Deswegen werden sie sich nicht über ein Buch wundern, in dem drei Handschuhe die Protagonisten abgeben. Wenn drei zusammenkommen, wird meistens einer ausgeschlossen. Im Fall der Handschuhe ist es der gestreifte, den die gepunkteten nicht dabeihaben wollen.
„Streifi“ fristet ein trauriges Dasein in der Manteltasche der kleinen Besitzerin, bis ein „Pünktchen“ verloren geht. Nun freunden sich die verbliebenen Ungleichen notgedrungen an. Aber dann taucht ein verloren geglaubter zweiter „Streifi“ auf. Zum Schluss entscheidet das kleine Mädchen, von nun an immer verschiedene Handschuhe zu tragen –und setzt damit einen Trend. Mit ihren liebenswerten Bildern gelingt es der ukrainischen Illustratorin Natalia Shaloshvili, dieser etwas überdeutlich pädagogischen Parabel so viel Charme einzuhauchen, dass sie das Zeug zu einem Bilderbuchklassiker hat.

Gideon Sterer, Charles Santoso (Illustr.): Kommt alle her, ich lese euch vor! Baumhaus, 40 S., ! 15,50 (ab 4)
Wie jeden Abend liest Mama ihrem Sohn etwas vor. Und der wünscht sich natürlich etwas Gruseliges. Monster schlafen bekanntlich nicht. Weil sie niemand ins Bett bringt? „Lässt du die Fragerei denn nie?“, seufzt Mama. Aber der Junge springt aus dem Bett und zieht seine Mutter in die Nacht hinaus, um die Monster zu suchen und ihnen seinerseits eine Gutenachtgeschichte vorzulesen.
Diese sympathische und eigenwillige Story von Gideon Sterer lebt von den gewinnenden Illustrationen des gebürtigen Indonesiers Charles Santoso, die an Maurice Sendaks Klassiker „Wo die wilden Kerle wohnen“ erinnern.
Die Vampire, Skelette, Drachen, Geister, Riesen, Hexen, Mumien etc. lassen sich hier auch wirklich herbeirufen. „Lesende Wesen und Räume zum Träumen – das gehört zusammen“, raunt der Vorleser ihnen zu. Und bringt die „Monsterchen“ damit gekonnt zum Einschlafen. Der Vorteil: Vor schlafenden Ungeheuern fürchtet sich wirklich niemand!

Hassan, Sonja Stangl (Illustr.): Sorgenfalter.
Edition 5Haus, 40 S., ! 18,– (ab 5)
Der Ursprung dieses originellen Bilderbuchs liegt in einem Song: „Sorgenfalter“ der Berliner Band MIA. Er ist hinten im Buch auch abgedruckt. Magda Hassan, Autorin, Buchhändlerin und Mitgründerin des Wiener Verlags Edition 5Haus, nahm den Song zum Anlass, dem Sorgenfalter ein Bilderbuchleben einzuhauchen. Unter dem Namen Mia Kirsch verfasste Hassan übrigens die Texte der ASAGAN-Reihe des Verlags, die mit bis zu 500 Jahre alten Drucken arbeitet und daraus zeitgemäße Kinderbücher zaubert. Die Story geht so: Ein Mädchen folgt einem angewehten Blatt in einen „Blätterwald“ aus gestapeltem Papier. Dort trifft es den Sorgenfalter, der kein Schmetterling ist, sondern ein Papiermännchen. Er erklärt ihr, wie man Sorgen verkleinert: indem man die Blätter zu Schmetterlingen faltet und davonfliegen lässt. Zum Schluss gibt es tatsächlich eine Anleitung für einen Origami-Falter – und ein orangefarbenes Papierquadrat liegt auch bei. Also an die Arbeit!
Wieso? Weshalb? Warum? … Zivilcourage, Demokratie und Mitbestimmung wichtig sind
Schon Kinder kennen Kon ikte, kommen mit Krieg und Vertreibung in Kontakt und suchen nach Orientierung in einer Welt, die durch widerstreitende Meinungen, verschiedene Kulturen, Religionen, Denk- und Lebensweisen geprägt ist. Wie beantworte ich Kinderfragen dazu auf Augenhöhe? Wie gelingt gutes Miteinander?
Ein neues Kindersachbuch der Reihe „Wieso? Weshalb? Warum?“ versucht ausgehend von alltäglichen Situationen in der Familie, Kita und Schule dafür zu sensibilisieren, was Demokratie und Mitbestimmung bedeuten, warum Grund- und Kinderrechte wichtig sind und wie friedliches Miteinander gelingen kann. Und da Empathie zudem Verständnis für das Erlebte und die Gefühle aller (Kinder) voraussetzt, werden im Buch auch Themen wie Krieg, Flucht und Vertreibung oder das Leben in einer neuen Heimat behandelt.
www.ravensburger.de
Patrizia Mennen, Markus Humbach, Wieso? Weshalb? Warum?, Bd. 44: Wie leben wir miteinander? Spiralbindung, 16 Seiten, ab 4 Jahren | ISBN 978-3-473-60064-9, € 15,50

Dautremer: Eine wunderbare Sache. Insel, 56 S., ! 24,70 (5 bis 99)
Für die französische Presse gehört Rébecca Dautremer mit ihrem umfangreichen Werk zu den größten Illustratorinnen der Gegenwart. Auf Deutsch gibt es von ihr erst fünf Bücher – aber mit „Eine wunderbare Sache“ bereits das vierte über den flauschigen weißen Hasen namens Jacominus Gainsburg.
Darin geht es um den Wert der Freundscha zwischen Jacominus und dem Stier Polikarp. Gemeinsam suchen sie nach einer verlorenen Erinnerung, die sie nicht und nicht finden können. Dafür entdecken sie zahlreiche andere Highlights ihrer Freundscha : den Apfelkuchen von Oma Beatrice, den Witz vom Soldaten ohne Gewehr etc. pp. Bis Jacominus sich endlich doch erinnert … Mit altmeisterlicher Illustrationskunst und tief philosophischen Geschichten gehören Dautremers Werke zu den sogenannten All-ageBilderbüchern, denen man im Laufe des Lebens immer mehr abgewinnen wird, sprich: die nicht veralten. Was kann man Besseres über Bücher sagen?
Bezahlte Anzeige

O ! o von Irgendwas hat zwar ein Schloss, aber …
Der Glamour von Ottos Leben hält nur einer sehr kurzen Betrachtung stand. Ja, Otto von Irgendwas, der so heißt, „weil seine Familie mal irgendwas gewesen war“, gehört ein Schloss. Er hat einen Koch und einen Vorkoster, er braucht bloß „Frau Lämm ...“ sagen und schon steht Frau Lämmle da und fragt, was er will. Aber Otto ist sehr alleine. Von seiner Familie ist bloß der Ballsaal voller Gemälde von all den Urururottos vor ihm übrig. Wo seine Eltern sind, weiß Otto nicht.
Jeder Tag ist gleich. Der Hauslehrer bringt ihm nichts bei, weil er selbst fast nichts kann und meint, Mathe sei etwas für Erbsenzähler und Geschichte zu weit weg. Sport sei zu anstrengend, Musik zu laut und Malen zu schmutzig. Andere Kinder kennt Otto nicht. Bis er Ina und ihre Baumhausbande trifft.
Der Schweizer Peter Stamm schreibt vorwiegend Romane für Erwachsene. Hier hat er mit feinem Humor eine Geschichte geschrieben, die viel vom echten Leben hat: Ottos Eltern bleiben verschwunden, so wie sich auch im echten Leben man-
ches nie auflöst. Die anderen Kinder und ihr Chaos sind am Anfang ein bisschen viel für Otto. Gleichzeitig kann er dem Baumhausleben etwas abgewinnen und auch den geheimen Gängen und der Zeitmaschine, die er mit seinen Freunden findet. Am Ende steht er an einem Neubeginn – und findet es plötzlich gar nicht mehr so übel, dass er nicht genau weiß, was als Nächstes kommt.
GERLINDE PÖLSLER

Peter Stamm: O ! o von Irgendwas. Atlantis, 144 S., € 16,50 (ab 8)
Wer traut sich, mit Sa š a Stani šić s rasanten Taxis zu reisen?
B ist du schon mal in einem Auto gefahren, in dem jemand per Hand den Blinker blinken macht? Wo eine sehr kleine, sehr krä ige Frau mit einem Hammer auf ein heißes Hufeisen haut – und jedes Mal, wenn dieser das Hufeisen trifft, fliegen die Funken? Falls du sie demnächst mal triffst, kannst du gleich losstiefeln, weil Gundula sicher „ein Käffchen“ will. Du brauchst dann nur hinten die Motorhaube öffnen, in dem sehr kleinen Dorf darunter, bei der Mühle am Fluss, gibt’s ein Café. Hauptsächlich schreibt Sa ša Stani š i ć , Träger des Deutschen Buchpreises, ja Erwachsenenromane. Nebenbei erfinden sein Sohn und er Abend für Abend abgefahrene Geschichten rund um Taxis. „Hey, hey, hey, Taxi!“, Teil 1, wurde für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2022 nominiert. Für Band 2 hat Sohn Nikolai selbst drei Geschichten verfasst, er geht ja schon in die dritte Klasse. Auch das neue Buch strotzt wieder vor Übermut und schrägen Dialogen. „,Ich will mal mit der Königin unter vier Augen sprechen.‘ ,Hey!‘, ru die Königin, weil sie ja nur ein
Auge hat. ,Sagt man so‘, sage ich.“ – Drache Sören will unbedingt seinen kleptomanischen Freund Fieberthermometer zurück, obwohl der ihm zuerst seine Zange gestohlen hat und damit dann einen Zahn aus dem Mund! Aber ihn den Rieseneichhörnchen überlassen? Ungebärdig umkreisen Katja Spitzers Zeichnungen die Geschichten und fügen ihnen noch eigene hinzu. Einsteigen. Losfahren. Abheben! GP

NEUERSCHEINUNG
Der neue Krimi von Kabarettist Joesi Prokopetz!




Ein Mädchen wird tagsüber zum Falken, ein Junge nachts zum Panther: Grusel aus Italien
Amparo hat eine seltsame Lichtallergie, deshalb kann sie tagsüber das Haus nicht verlassen. Erzählt zumindest ihr Großvater herum. Damit kann man vielleicht Erwachsene täuschen, aber doch keine Kinder! Amparos einstige Freundinnen jedenfalls halten sie jetzt für eine eingebildete Ziege. Aber wem könnte sie ihr Geheimnis auch anvertrauen – dass sie sich mit jedem Tagesanbruch in einen Falken verwandelt?
Sollte sie nicht die Einzige ihrer Art sein? Amparo ist außer sich über das, was sie auf dem Jahrmarkt, im Zelt des Zauberers, beobachtet hat: Ein Junge verwandelte sich vor den Augen des Publikums in einen Panther. Das Publikum glaubte wohl an einen großen Zaubertrick, „dass der Junge durch eine Falltür oder hinter einem Spiegel verschwunden war. Doch sie, Amparo, kannte die Wahrheit: Der Junge und der Panther waren eins. So wie sie und der Falke eins waren. Aber da war noch mehr.“ Als sie den Panther sah, erwachten wirre Bilder in ihr: „Feuer, Hitze, der Geruch von verbranntem Holz.“ Was verbindet die beiden? Woher kom-
men sie – wer sind sie eigentlich? Wie sich herausstellen wird, wissen beide nichts über ihre Eltern.
Italien ist heuer Ehrengast der Frankfurter Buchmesse, und mit „Feder und Kralle“ liegt erstmals ein Buch von Marta Palazzesi auf Deutsch vor, die in ihrem Heimatland 2019 bereits die höchste Auszeichnung für italienische Jugendliteratur, den Premio Strega Ragazzi, erhielt. Mit „Feder und Kralle“ ist ihr ein spannender Kinderroman in schaurigem Ambiente gelungen. So farbig wie düster lässt sie das Valencia des Jahres 1914 erstehen, mit Schaustellerinnen, Handwerkern und Kartenspielrunden in nächtlichen Gassen.
Die Suche der Kinder Amparo und Tomás – so heißt der Pantherjunge – erschwert der Umstand, dass sie nie gleichzeitig Menschengestalt haben. Den Vermittler spielt der etwas sehr altklug daherkommende Pepe. Er hil , dass jahrzehntelang gehütete Lebensgeheimnisse entworren werden.
Das Besondere am Buch: Zwischen den Kapiteln tun sich 60 opu-
lente, doppelseitige Zeichnungen von Ambra Garlaschelli auf, die die düstere Atmosphäre unterstreichen. Die Geschichte hält die Spannung bis zur letzten Seite: In einem verlassenen Dorf kommt es zum Showdown, aus dem eine der Figuren nicht lebend herauskommt – und es ist keine von den Bösewichten. Amparo trifft am Ende eine überraschende Entscheidung, und selbst wenn wir glauben, dass es aus ist, ist es nicht aus … GP

Ein Jugendroman über Schwulsein zwischen den Welten
W
enn das erste Wort eines Jugendromans „Schwulsein“ lautet, ist damit ein Thema vorgegeben, das zeitgemäß unter dem Begriff „Queerness“ subsumiert wird und um das man in diesem Genre derzeit nicht herumkommt.
Ungewöhnlich machen das Buch mit dem Titel „Nur dieser eine Augenblick“ von Abdi Nazemian, USamerikanischer Autor mit persischen Wurzeln, die Lokalisierung der Handlung zwischen Kalifornien und Teheran sowie der zeitliche Rückgriff bis in die 1930er-Jahre.
Seinen drei Hauptfiguren Moud, Saeed und Bobby sind abwechselnd Kapitel gewidmet, in denen sie als Icherzähler au reten. Da es sich bei ihnen um Sohn, Vater und Großvater handelt, trifft man sie trotzdem in einigen davon gemeinsam an.
Das erste Kapitel erzählt der 17-jährige Moud, und sein einleitender Satz lautet: „Schwulsein im Internet ist anstrengend.“ Wir schreiben das Jahr 2019, und Moud hat soeben seine Timeline gelöscht, aus der seine sexuelle Orientierung – Moud nennt sie „wahres Selbst“ – ablesbar ist. Das liegt nicht daran, dass sein Vater Mouds Schwulsein wie auch seinen Freund Shane schlicht ignoriert, sondern hängt mit einer Reise zusammen. Da sein Großvater nicht mehr lange zu leben hat, macht Moud sich mit seinem Vater in den Iran auf – zum ersten Mal in seinem Leben.
„Aber sie töten queere Menschen“, regt sich Shane auf, als er davon erfährt. Beide kennen die Fotos der Teenager, die für ihre Homosexualität gehängt wurden. Moud hält Shane entgegen, dass die US-amerikanische Gesellscha sich „um Öl aus Ländern mit grauenha en Menschenrechtsverletzungen“ drehe. „Du hast meine Werte nie geteilt“, kontert Shane. Während der ganzen Reise wird der Beziehungssegen schief hängen bleiben.
Manchmal hat man das Gefühl, dass das Bashing der USA im Vergleich zu jenem der ungleich restriktiveren Gesellscha des Iran ein wenig überzogen ist. Glücklicherweise bleibt Abdi Nazemian in seinem spannenden Roman aber nicht auf der politisch korrekten Oberfläche hängen, sondern taucht tief in das Innenleben seiner Protagonisten, ihre Beziehungen und Schicksale hinab. Dabei gelingt es ihm, ein differenziertes Bild des Lebens im Iran zu zeichnen. Auch dort gibt es unterschiedliche Meinungen, jede Menge Menschlichkeit, ja es werden sogar (illegale) queere Partys gefeiert. Über die Jugendgeschichte von Mouds Vater Saeed, angesiedelt im Jahr 1978 in Teheran, lernt man einiges über die persische Alltagskul-
tur sowie über die verunglückte Revolution gegen Schah Mohammad Reza Pahlavi, die zum noch autoritäreren Regime der Mullahs geführt hat.
Großvater Bobby entpuppt sich im Laufe der Handlung als in Los Angeles aufgewachsener Sohn einer Amerikanerin und eines Persers, dem sich im Jahr 1939 die Chance zu einer Hollywood-Karriere eröffnet. Aufgrund seiner Vorliebe für Männer – personifiziert in seinem Freund Vicente – gerät er in gehörige Schwierigkeiten. Denn das Studio-
Diese Gedichte f ür Jugendliche machen süchtig
Michael Hammerschmid, geboren 1972 in Salzburg, kann man getrost als einen hochdekorierten Autor von Gedichten für Kinder bezeichnen. Für seinen Band „wer als erster“ erhielt er 2022 den Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Wien und 2023 den Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis, für „stopptanzstill!“ den Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2024.
Schwulsein im Internet ist anstrengend
MOUD IN „NUR DIESER EINE AUGENBLICK“
system von Metro-Goldwyn-Mayer gewährt seinen „Protegés“ kein unabhängiges Leben mehr. Als der amerikanische Staat Vicentes Vater, der unverschuldet arbeitslos geworden ist, nach Mexiko zurückschickt, macht sich Bobby auf die Suche nach seinem Vater im Iran.
Dass Abdi Nazemian auch als Produzent und Drehbuchautor arbeitet, merkt man dem Roman an. Die Dialoge sind lebendig und glaubwürdig, wenn auch manchmal ein wenig pathetisch psychologisierend, so wie es die Hollywood-Industrie liebt, und bisweilen sieht man die dazugehörigen Filmbilder schon vor sich.
Jedenfalls steckt so viel pralles, komplexes, kompliziertes Leben in dem Buch über „nur einen Augenblick“, dass man dessen bisweilen gereckten Zeigefinger gerne übersieht.
KIRSTIN BREITENFELLNER

Entsprechend hoch hängen die Erwartungen für seinen neuen Band „was keiner kapiert“ mit Gedichten, die sich erstmals ausschließlich an Jugendliche wenden. Und man kann sagen, dass diese von den Texten noch übertroffen werden. Dabei scheint es viel schwerer, für Dreizehnjährige zu schreiben als für Vierbis Zehnjährige. Oder trügt dieser Eindruck, weil Erwachsene der Unsicherheit und der Melancholie von Pubertierenden doch näher sind als der Unbeschwertheit und Neugier von Kindern?
Hammerschmid jedenfalls gelingt das Kunststück, an sich selbst und der Welt verzweifelnde Heranwachsende (und Erwachsene, die solche geblieben sind) mit seinen zarten, tiefgründigen Versen wenn nicht aufzumuntern, so doch zu umschmeicheln.
Dabei geht er mutig auf die Lebenswelt der Jugend ein, die von einem anscheinend unlyrischen Instrument beherrscht wird: dem Handy. „singlesong“ heißt das erste Gedicht, und der Titel bezieht sich nicht auf einen Beziehungsstatus, sondern auf einen Tag ohne Handy.
„mein handy ist ein / bienenstock für heute / lass ihn sein“. Aber das lyrische Ich will auch sonst niemanden sehen: „heute ist ein langer / tag an dem ich niemand / sehen mag / ich bleibt heut allein / allein / alleinallein / allein“, trällert es weiter.
Ein anderes Gedicht singt dem mobilen Endgerät hingegen ein Loblied und beginnt mit den Zeilen: „heute bin ich nur / im handy heute / bin ich gar nicht / da heute bin ich bildlich / heute bin ich / virtuell heute / bin ich ohne mich / im internet / doch super- / schnell“. Ja, das Handy kann einen auch von sich selbst befreien!
Die Texte sind schmal und nie mehr als eine Seite lang. Flankiert werden sie von heiter-ironischen Illustrationen der Niederösterreicherin Barbara Hoffmann, Jahrgang 1985, die für ihr letztes Bilderbuch „Alles, was gesagt werden muss“ gleich zweifach ausgezeichnet wurde.
Die durchgängig in Blitzblau gehaltenen, bisweilen ins Abstrakte dri enden Bilder verschmelzen mit den elegant gesetzten Texten in verschiedenen Schri en und Schri größen zu einem Gesamtkunstwerk, in
„jemand der nichts zu werden verspricht“ ist ein Gedicht übertitelt, das sich mit dem Druck auseinandersetzt, jetzt schon zu wissen, was man später einmal werden will. Es beginnt schon einmal großartig: „ICH WEISS NICHT / WAS ICH WERDEN SOLL / TOLL JEMAND MIT GELD / JEMAND MIT GLÜCK / JEMAND MIT COOL / JEMAND VERRÜCKT / JEMAND VIELLEICHT / DEMS JETZT SCHON / REICHT“
In ihm ist auch die titelgebende Zeile enthalten: „JEMAND DER LERNT / WIE MAN VERLERNT / DER NUR STUDIERT / WAS KEINER KAPIERT“. Der übermütige Text endet mit den Worten: „JETZT WEISS ICH / WAS ICH WERDEN SOLL // VOLL!!!“
Das Adjektiv, das heutigen Jugendlichen o als Füllwort dient, das o andeutet, dass man nicht weiß, wie man etwas nennen soll, gewinnt hier einen doppelten Boden – und bedeutet sowohl die Kapitulation vor der Lebensaufgabe Selbstfindung als auch – wortwörtlich – deren Erfüllung.
Auch die Menschheitskonstante Krieg, die Jugendliche derzeit aus allen Medien anspringt, wird hier nicht ausgespart. „der krieg fetzt / in mich / der bildschirm / zerfetzt / ich bin nach / außen unverletzt“, beginnt ein Gedicht.
Und natürlich darf hier der Schulalltag mit seinem Fleißigseinmüssen und Faulseinwollen nicht fehlen. „ich soll latein / ich soll sitzen“ hebt das Gedicht mit dem Titel „beschissen“ an – und endet mit einem zehnmaligen emphatischen Nein.
Hammerschmid liebt Zeilensprünge, er setzt behutsam Neologismen. Sein Rhythmus lässt manchmal an Rap denken, und zwischen den Worten und Sätzen lassen sich so viele Zwischentöne vernehmen, dass man wünscht, dass diese Lyrik nie au ört. Oder mit einem neuen Band fortgesetzt wird. KB

Michael Hammerschmid: was keiner kapiert. Illustr. von Barbara Ho ff mann. Jungbrunnen, 104 S., € 15,– (ab 13) dessen ins Fröhliche tendierenden Blues man gerne eintaucht.
Der palästinensische Schri steller Raja Shehadeh zieht eine große Linie von der Gründung Israels bis zum 7. Oktober
REZENSION: TESSA SZYSZKOWITZ
Z um Jahrestag des 7. Oktober sind in den deutschsprachigen Verlagshäusern einige Bücher von israelischen Autorinnen und Autoren erschienen – siehe etwa Lee Yarons „Israel, 7. Oktober“ oder das von Gisela Dachs herausgegebene „7. Oktober. Stimmen aus Israel“ (rezensiert im Falter 40). Wenig ist aber über den Krieg und seine Folgen für Palästinenserinnen und Palästinenser publiziert worden. Eine Ausnahme ist der Essayband des palästinensischen Schri stellers Raja Shehadeh. Der 73-jährige Autor und Rechtsanwalt aus Ramallah gehört zu den feinen Denkern des Nahen Ostens und zählt seit Jahren zum Kreis der Autorinnen und Autoren der New York Review of Books Raja Shehadeh hat sein ganzes Leben mit der Nakbah verbracht. Nakbah – Katastrophe auf Arabisch. So nennen die Palästinenser, was ihnen bei der Gründung Israels widerfahren ist. Nach 1948 stellten die Palästinenser erstaunt fest, dass das junge Israel auf dem Boden Palästinas wirklich entstand. Zu ihrer Überraschung tat niemand etwas dagegen. 700.000 palästinensische Araber verloren ihre Heimat. Manche, wie die Familie von Raja Shehadeh, flohen aus der Küstenstadt Jaffa ins Hügelland des Westjordanlandes. Es stand unter der Kontrolle Jordaniens. „Der Verlust ihres Landes im Jahr 1948 war ein Schock für die Palästinenser und führte zu jahrzehntelanger Verzweiflung“, schreibt Raja Shehadeh.
Und dann passierte es 1967 wieder. Israel wurde von den arabischen Nachbarn angegriffen, drehte den Kriegsverlauf um und besetzte im sogenannten Sechstagekrieg das Westjordanland und den Gazastreifen. „Wir konnten uns nicht vorstellen, dass Israel mit der Ansiedlung von 750.000 Siedlern in unserer Mitte im Westjordanland und in Ostjerusalem durchkommen würde.“ Doch so ist es geschehen. Seit Jahrzehnten breiten sich die israelischen Siedlungen aus.
In seinem Essay „Permission to Narrate“ hatte der palästinensische Gelehrte Edward Said schon 1984 festgestellt, dass sich daran nichts änderte, obwohl die Palästinenser durch das internationale Recht unterstützt wurden. Die Besetzung der Westbank gilt bis heute als illegal. Raja Shehadeh gesteht sich bitter ein: „Trotz all unserer Versuche, über die Situation zu schreiben, scheinen wir Palästinenser nichts an der Art und Weise geändert zu haben, wie diese Ereignisse von den Israelis und der Außenwelt wahrgenommen werden.“
Der palästinensische Schri steller Raja Shehadeh erzählt, wie seine Großmutter

ihm abends von Ramallah aus immer wieder die Lichter von Jaffa zeigte, der verlorenen Stadt am Meer. Der kleine Enkel, der ehrfürchtig den Erzählungen der Erwachsenen gelauscht hatte, wuchs zu einem jungen Mann heran. 1967 fuhr er nach Jaffa, denn nachdem Israel das Westjordanland erobert hatte, waren Ramallah und Jaffa wieder im gleichen Land: Israel. Was Shehadeh aber zu seiner Überraschung feststellte: Die Lichter, die seine Großmutter für die von Jaffa gehalten hatte, waren in Wirklichkeit jene von Tel Aviv. Jaffa lag verlassen im Dunkeln. Tel Aviv aber war die Metropole eines neuen Staates, eine Stadt unter Strom. Heute ist die alte palästinensische Stadt eine Art trendiger Vorbezirk von Tel Aviv geworden. Palästinensische und jüdische Israelis leben hier mehr oder weniger freiwillig zusammen.
Was den Israelis gelang, misslang den Palästinensern. Ein eigener Staat blieb Wunschtraum. Die palästinensische Führung verabsäumte es, dem stärker werdenden Israel etwas entgegenzusetzen. Dazu kam, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu auf Umwegen die Hamas-Regierung im Gazastreifen stärkte, um die von Jassir Arafats Fatah dominierte Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland zu schwächen. Ab 2018 erlaubte Netanjahu dem Emirat Katar, monatlich 15 Millionen Dollar in bar an die Hamas im Gazastreifen abzuliefern. „Die Hamas nutzte einen Teil dieser Gelder“, vermerkt Raja Shehadeh, „um für den gegenwärtigen Krieg mit Israel zu trainieren.“
Im zweiten Essay des Bandes befasst sich der Autor mit dem Krieg im Gazastreifen. Den Angriff der Hamas am 7. Oktober kritisiert Shehadeh: „Während eine besetzte Bevölkerung nach dem Völkerrecht zwar das Recht hat, Widerstand zu leisten, hat sie nicht das Recht, Kriegs-

Raja Shehadeh:
Was befürchtet Israel von Palästina? Westend, 112 S., € 15,50
verbrechen zu begehen.“ Die Antwort Israels auf das Massaker und die Geiselnahme von etwa 250 Menschen ist ein Krieg, dessen Ausmaß alles Bisherige bei weitem übersteigt. Über 40.000 Tote, 80.000 Verwundete, 80 Prozent der 2,3 Millionen Palästinenser in Gaza intern vertrieben, 90 Prozent der Kinder unter fünf Jahren leiden an akuter Ernährungsarmut. 70 Prozent der zivilen Einrichtungen und der Infrastruktur sind zerstört. „Dieser Krieg ist bei weitem der verheerendste, den Israel jemals geführt hat.“ Shehadeh kommt zu dem Schluss, dass Israel nicht nur die Hamas vernichten will. „Aufgrund des grausamen Verhaltens der Hamas wurde das gesamte palästinensische Volk verurteilt und hat in den Augen vieler Israelis sein Existenzrecht verloren.“
Der Autor beschreibt nicht nur die Auswirkungen des 7. Oktober und des Krieges auf die Zivilbevölkerung von Gaza –auch im Westjordanland und in Ostjerusalem hat die Gewalt zugenommen. „Laut Ha’aretz besteht das neue Protokoll für die Festnahme von gesuchten Personen darin, das Haus einzukreisen, den Verdächtigen aufzufordern, das Gebäude zu verlassen und – falls er nicht herauskommt – eine Panzerabwehrrakete auf das Gebäude zu schießen.“
Der Eskalation von Gewalt versucht Shehadeh gegen Ende des Essays eine kleine Hoffnung entgegenzusetzen: die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofes, alles zu unterlassen, was genozidalen Handlungen gleichkommen könnte. Der palästinensische Intellektuelle hofft, dass „dieser Triumph des Völkerrechts“ langfristige Folgen für Israels Kontrolle über die Palästinenser haben könnte.
An einem anderen Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag war Shehadeh selbst beteiligt: „Im Juli 2004 urteilte das Gericht, dass die Trennmauer
im Westjordanland gegen das Völkerrecht verstößt und abgebaut werden muss.“ Die Mauer steht bis heute. Doch Shehadeh hofft darauf, dass sich Israel auf Dauer den Urteilen der internationalen Gerichtsbarkeit nicht entziehen wird können.
Er warnt auch davor, die Palästinensische Autonomiebehörde wieder beleben zu wollen. „Die PA ist ein Geschöpf des gescheiterten Osloer Abkommens mit vielen eingebauten Beschränkungen.“ Es sei kontraproduktiv, zu dieser Form der Selbstverwaltung zurückzukehren, „die das Gedeihen der Siedlungen ermöglichte“. Bei der palästinensischen Bevölkerung würde eine solche Vertretung in freien Wahlen kaum erfolgreich sein können. Er plädiert für die Abhaltung von Wahlen nach einer Reorganisation der PLO, der Palästinensischen Befreiungsorganisation, damit ein Gremium gewählt werden kann, „das alle palästinensischen politischen Gruppierungen vertritt“.
Shehadeh vergisst nicht, die Frage zu beantworten, die er im Titel gestellt hat: „Was befürchtet Israel von Palästina?“ Die resignierte Antwort: „Die Existenz Palästinas selbst.“ Er konstatiert, dass die messianistische Rechte in Israel und die zersplitterte politische Führung der Palästinenser eine Lösung des Konflikts extrem erschweren. Unter Einbindung der USA, der UNO und des Globalen Südens aber könnte der Druck auf die Streitparteien erhöht werden, um ein Abkommen zu erreichen.
Zum Schluss kommt er, wie so o , auf seinen Vater Aziz zurück. Der moderate Politiker und Rechtsanwalt hatte schon 1967 vorgeschlagen, einen Staat Palästina neben Israel zu gründen. Man schenkte ihm kein Gehör. 1985 wurde er ermordet. Heute aber, hofft sein Sohn Raja, „gibt es einen Konsens, dass es nur dann Frieden in der Region geben wird, wenn ein palästinensischer Staat gegründet wird“.
Natan Sznaider, in Deutschland geborener israelischer Soziologe, begibt sich mit einem anderen Nathan auf eine Zeitreise durch die jüdische Existenz in Israel und der Diaspora. Nathan der Weise steht, seit Gotthold Ephraim Lessing die fiktive Figur 1779 geschaffen hat, für Au lärung und Toleranz. Der Versuch der aufgeklärten Juden, in Europa akzeptiert zu werden, bedeutet aber dann im 19. Jahrhundert vor allem eines: „Die Idee der Au lärung heißt nicht mehr jüdische Selbstbestimmung, sondern von der nichtjüdischen Umwelt toleriert oder geduldet zu werden“, schreibt Sznaider. „Die Au lärung war die Geburtsstunde des ,unsichtbaren‘ Juden.“ Er untermauert das mit Karl Marx’ Schri „Zur Judenfrage“ aus dem Jahr 1843 über die politische Emanzipation der Juden und warum sie scheitern musste. Marx schreibt: „Die gesellscha liche Emanzipation des Juden ist die Emanzipation der Gesellscha vom Judentum.“
Diese Aussage wurde nicht nur von den Feinden der Juden gerne zitiert. Für jene Juden, die sich im Sozialismus wiederfanden, war es ein Versprechen, als Menschen gleichberechtigt in einer aufgeklärten, demokratischen Gesellscha leben zu können. Mit dem Holocaust endete diese Illusion. Doch es gibt, so absurd das 1945 schien, natürlich doch ein Leben nach dem Tod der

Natan Sznaider:
Die jüdische Wunde. Hanser, 272 S., € 26,80
deutsch-jüdischen Beziehungen. Das deutsche Theater wird 1945 wieder mit Lessings „Nathan der Weise“ eröffnet. „Es ist das passende Ideendrama für das zerstörte Berlin im Herbst 1945: philosophische Toleranz und ein Jude, der sich für sie hingibt“, schreibt Sznaider. 1958 bekommt die in Deutschland geborene Philosophin Hannah Arendt, die vor den Nazis nach New York geflohen war, vom Hamburger Senat den Lessingpreis verliehen – in der Hoffnung, „die deutsch-jüdische Tradition könne die Barbarei überwinden“.
Gustav Gründgens, die Manns, Mascha Kaléko – Sznaider führt uns sehr detailliert durch die deutsch-jüdische Debatte nach 1945 und die Frage, wie ein Zusammenleben möglich sein kann. Der Soziologe zieht dann eine Linie bis heute und zur Debatte um das Wimmelbild von Taring Padi auf der documenta 15 vor zwei Jahren. Das Bild wird schnell wieder abgebaut, die Darstellung eines an einen orthodoxen Juden erinnernden Mannes mit SS-Runen im Hut stößt ab, erschreckt und empört viele. „Je häufiger beteuert wird, dass es für Antisemitismus im öffentlichen Raum in Deutschland keinen Platz gibt, desto stärker wird man sich der Anwesenheit des Antisemitismus im öffentlichen Raum bewusst.“
Von der Kolonialismusdiskussion, die rund um die documenta entbrennt, ist es nur noch ein kleiner Schritt nach Israel. „Israel stammt aus Europa, liegt aber nicht in Europa. Israel kann daher als eine weiße europäische Formation betrachtet werden, die in kolonialistischer Weise den arabischen Raum eroberte“, schreibt Sznaider.
Schon am Anfang dieser in jeder Hinsicht atemberaubenden Studie über die jüdische Existenz in Diaspora und Israel hat er konstatiert: „Die israelische Souveränität verändert den jüdischen Blick. Juden sind nicht mehr Fremde und Marginalisierte, sondern verfügen als souveräne Subjekte über Macht.“ Der Vertrag zwischen dem modernen Staat und seinen Bürgerinnen und Bürgern lautete, dass Israel für die Sicherheit garantierte. Der 7. Oktober aber habe alles verändert. Der Vertrag wurde gebrochen, die Zivilbevölkerung hilflos der Hassorgie der Hamas ausgesetzt.
„Es ist der zionistische Fehlschluss, der annahm, dass Israel ein Staat wie jeder andere sein könne, wo das Jüdische unsichtbar wird“, schreibt Sznaider. Er lässt aber offen, wohin diese Erkenntnis führt. Sein Alter Ego Nathan geht zurück ins Haus und macht die Tür hinter sich zu.
TESSA SZYSZKOWITZ
Der Historiker Richard Overy fragt, warum die Menschheit immer wieder Krieg führt – und wie das au ören könnte
Der Brite Richard Overy ist ein Großer seines Fachs. Schon früh erklärte der Historiker als Spezialist für den DeutschSowjetischen Krieg „Die Wurzeln des Sieges“ der Alliierten mit deren wirtscha licher Überlegenheit über Nazi-Deutschland. Es folgten monumentale Studien über Stalins und Hitlers Diktaturen: Europa als Schlachtfeld des Zweiten Weltkrieges stand im Zentrum von „Der Bombenkrieg“, „Weltenbrand“ beschrieb die globale Kriegsgeschichte zwischen 1931 und 1945.
Die Bücher entstanden zu einer Zeit, als noch das „Ende der Geschichte“ beschworen wurde – trotz zahlreicher Stellvertreterkriege seit 1945 hatten die Großmächte keinen Krieg mehr geführt, der Kalte Krieg schien zu Ende. Dass ein möglicher ewiger Friede zur ewigen Friedhofsruhe würde, wie Immanuel Kant gescherzt hatte, war ohnedies nicht zu befürchten. Richard Overys neues Buch „Warum Krieg?“ ist eine Art Resümee seiner historischen Aufarbeitung der Katastrophengeschichte des 20. Jahrhunderts samt Ausblick auf viel größere Fragen.
Obwohl es im vergangenen Jahrhundert kein einziges Jahr gab, in dem nicht Krieg geführt wurde, befasse sich die Geschichtswissenscha selten mit der Frage, warum Menschen Kriege führen. Deren Beantwortung überlasse sie anderen Wissenscha en wie Biologie, Psychologie oder Anthropolo-
gie. Und: „Die Frage nach den Ursprüngen des Krieges wurde teilweise selbst zu einem regelrechten akademischen Schlachtfeld.“ Symptomatisch dafür sei der auf Initiative des Völkerbundes entstandene Briefwechsel „Warum Krieg?“ zwischen Albert Einstein und Sigmund Freud aus dem Jahr 1932. Die Antwort des Begründers der Psychoanalyse – Gewaltanwendung sei ein Merkmal des gesamten Tierreichs, die Menschheit eingeschlossen, der menschliche Kampf- und Zerstörungstrieb sei einfach nicht zu bremsen – machte den Physiker ratlos.
Im ersten Teil des Buchs begibt sich Richard Overy „dilettierend“, wie er selbst sagt, aber um Sachlichkeit bemüht zu den Naturwissenscha en, die über mehr „Evidenz“ als die Historie verfügten. Beginnend mit dem „gefährlichsten Teil unseres Erbes“, der Biologie. In den 1930er-Jahren propagierte der britische Anatom Sir Arthur Keith kruden Sozialdarwinismus: Die Idee, Krieg sei unter biologischen Gesichtspunkten nützlich, weil die Gemeinscha en auf diese Weise die Schwachen ausmerzen und die Starken fördern könnten, stößt nach 1945 weitgehend auf Ablehnung. Über Konrad Lorenz’ Konzept vom „sogenannten Bösen“, das in der evolutionären Vergangenheit wurzle, führe das Geschwätz diverser Evolutionsbiologen herauf bis in die Gegenwart.

Overy spielt sich nicht als Zensor auf, im Fall der Psychologie geht er den Verästelungen von „Friedenspsychologie“ bis zur Evolutionspsychologie und der Erforschung von Langzeitfolgen der Kriege nach. Am Beispiel französischer Katholiken und protestantischer Hugenotten, von Hutus und Tutsis und der Vernichtung von Juden und Slawen im NS-Staat exemplifiziert er die Entwicklung des rabiaten Freund-Feind-Schemas, wie vom Nazi-Juristen Carl Schmitt entworfen. Auch die Ökologen beteiligten sich an der Erforschung von Kriegsursachen –sei es durch Beschreibung von Dürreperioden oder besonders harter Winter, die etwa in der tausendjährigen Geschichte Chinas Kriege nachweislich begünstigten.
In den Kapiteln über Ressourcen, Macht, Sicherheit und Religion findet sich Overy auf seinem ureigenen Terrain: bei Kriegen um Ressourcen im alten Sintascha im Uralgebiet, bei den Kriegen zwischen Karthago und Rom, gegen die amerikanischen Ureinwohner, in Nazi-Deutschland und in Putins Russland. Die Kreuzzüge stehen am Ende für den Ursprung der modernen Dschihadisten. „Krieg hat in der Menschheit eine lange Geschichte – und leider auch eine Zukun “, heißt es zuletzt. Die Aussicht auf Frieden sei gering, aber man könne zumindest Muster erkennen.
ERICH KLEIN

RETTET DIE BÖDEN
Gernot Stöglehner
Innovative Lösungsansätze zeigen, wie Bodenschutz trotz wachsender Inanspruchnahme für Bauland und Infrastruktur gelingen kann. 216 Seiten, € 24,90
Navid Kermani hat den Osten Afrikas bereist und berichtet schonungslos über o verdrängte Probleme
Das Kind der Bettlerin rollt einen Geldschein sorgfältig ein und steckt ihn in die Dose, holt ihn wieder heraus und rollt ihn auf. Der Autor beobachtet das Kind, wie es in sein Spiel vertie ist, seine Blicke treffen sich mit jenen der Mutter. Vielleicht denken sie für einen kurzen Moment dasselbe, „denken bang, was für eine Zukun dieses Kind wohl haben mag, wenn nicht zu betteln, zu schu en, früh zu sterben wie all die anderen Kinder auf den Straßen, und sind froh, daß es sich im Spiel vergißt“, schreibt Kermani (der Autor verwendet die alte Rechtschreibung, Anm.).
Weiter im Süden Madagaskars spielen die Kinder nicht mehr, dort haben die Vereinten Nationen im Herbst 2021 die erste klimabedingte Hungersnot ausgerufen. Dort sind die Augen der Kinder matt, ihre Bäuche aufgebläht, schildert Kermani, der im Jahr darauf dort ankommt: „Es ist die Erzählung, die seltsamerweise immer ähnlich klingt, wenn ein Kind vor Hunger stirbt, nämlich ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe: Es liegt nicht, sondern sitzt aufrecht auf dem Boden, die Hände um die Knie. Dann sinkt plötzlich der dicke Bauch nach unten, wirklich so, daß man es von der Seite sieht, und das Kind kippt auf einen Schlag um.“ Schonungslos und eindrücklich berichtet Navid Kermani von seiner Reise durch Ostafrika. Der Schristeller, Orientalist und Intellektuelle ist für die Zeit vom Süden Madagaskars bis in die Nuba-Berge im Sudan gereist. Jetzt sind seine Reportagen als Buch erschienen. Kermani, der kürzlich den Thomas-Mann-Preis erhielt, zieht den Leser mit seiner Erzählung in den Bann. Beinahe glaubt man, man wäre selbst dabei gewesen, hätte sogar den Rhythmus der Musik gehört, die bei all der Not immer wieder mitschwingt. So trifft Kermani etwa den Jazzmusiker Mulatu Astatke in Addis Abeba, der erklärt, wie Musik die Völker Äthiopiens verbindet: „Mein Jazz hat keine Ethnie, mein Jazz ist ganz Äthiopien.“
Auf seiner Reise begegnet Kermani Menschen, die in extremer Armut leben, Frauen, die im Krieg vergewaltigt wurden, er spricht mit Kriegern in den Nuba-Bergen. Dort sieht er vor dem Haus eines Arztes auch das blonde Kind eines europäischen Mitarbeiters, wie es mit „tiefschwarzen Kindern“ in einer Sandmulde spielt. Doch die Kinder sind nur scheinbar alle gleich: „Sicher, wenn das blonde Kind erkrankte, stünden ihm andere Behandlungsmöglichkeiten offen, seine Speisen werden nahrha er sein, bestimmt hat es ein Bett, und seine Zukun ist viel offener, allein dank des europäischen Passes ...“
Manchmal bleibe Kermani bei seinen Recherchen zu sehr an der Oberfläche, kritisiert die Süddeutsche. Warum etwa gelingt es in Mosambik nicht, mit ein paar hundert islamistischen Terroristen fertig zu werden? Kermani geht dieser Frage nicht wirklich auf den Grund. Er spricht mit einem Geschä smann und einem Imam, doch die wissen es auch nicht.
Im Verlauf der Reportagen zeigt sich jedoch, dass es bei der Suche nach den Ursachen o keine klaren Antworten gibt – Kolonialismus und Klimawandel, Kriege, korrupte Eliten und Konzerne spielen alle eine Rollen. Auch die Hilfsleistungen sind o Teil des Problems. Und vielfach will man sich die Fragen gar nicht stellen. Kermani berichtet, wie schwer es ist, Sender für afrikanische Themen zu begeistern. Meist komme der Globale Süden
„Die Welt der Gegenwart“ macht die Faszination von Geopolitik durch 130 Landkarten erlebbar
Wenn in der internationalen Politik wieder einmal irgendwo die Karten neu gemischt werden, sollte man dabei besser nicht an Spiel-, sondern eher an Landkarten denken. Schließlich geht es dabei meist um Geopolitik. Der einst mit Nazi-Gedankengut assoziierte Begriff wird heute nicht mehr zur Rechtfertigung expansionistischer Projekte, sondern zur Beschreibung der Zusammenhänge von Geografie und Politik verwendet. Er erlebt seit den 1980er-Jahren eine Renaissance. 1990 erfand der französische Politikwissenscha ler Jean-Christophe Victor für das französische Fernsehen ein „geopolitisches Magazin“, das seit 1992 unter dem Namen „Mit offenen Karten“ im deutsch-französischen Sender Arte läu
Seit 2017 wird die Sendung von der französischen Politikwissenschalerin Émilie Aubry präsentiert. Mit ihrem Kollegen Frank Tétart hat sie nun das Buch „Die Welt der Gegenwart“ herausgegeben. „Ein geopolitischer Atlas“ lautet der Untertitel.
Juli. Landkarten erklären die tiefe Spaltung des Landes am Orinoco. Ein Sechstel der Bevölkerung ist vor dem Elend ins Ausland geflohen. Was dieser Aderlass im weltweiten Maßstab bedeutet, führt eine weitere Karte drastisch vor Augen. Sie zeigt die Ströme von geflüchteten und asylsuchenden Menschen rund um den Globus. Zwei Drittel der 35 Millionen aus ihren Herkun sländern geflohenen Menschen stammten im Jahr 2022 aus Syrien, der Ukraine, Afghanistan – und Venezuela.
In Madagaskar herrschte Hunger, und bei uns bekam es kaum jemand mit
NAVID KERMANI
nur vor, wenn deutsche Touristen auszufliegen seien. Und genau darin liegt der Verdienst der Reportagen: Auch wenn man sich manchmal mehr Tiefgang bei politischen und geschichtlichen Hintergründen gewünscht hätte – Kermani macht Ostafrika mit seinen Krisen und Katastrophen für die Leser sichtbar.
Seine Tochter warf dem Autor auf der letzten Reise vor, ein bisschen ungerecht zu sein, Afrika sei so viel mehr als Krieg, Klimakrise und Kolonialismus! Allein die Schönheit der Landscha , die netten Menschen. „Aber es war nicht meine Aufgabe, die Schönheit zu beschreiben oder auch nur die Normalität, sage ich: Der ganze Anlaß der Reise war schließlich, daß in Madagaskar Hunger herrschte, und bei uns bekam es kaum jemand mit.“
DONJA NOORMOFIDI

Navid Kermani: In die andere Richtung jetzt. Eine Reise durch Ostafrika.
C.H. Beck, 272 S., € 26,80
Die Aha-E ff ekte, für die das geopolitische Magazin seit 32 Jahren verlässlich am frühen Samstagabend sorgt, sind in Buchform freilich nicht auf die gleiche, bequeme Weise herstellbar. Wer etwa die Entwicklung der Abhängigkeit Europas von russischem Erdgas verstehen möchte, muss sich trotz reicher Bebilderung so manche Information, die einem das Fernsehen als bewegtes Bild direkt an die Couch serviert hätte, eben selbst aus den Texten zusammenklamüsern.
Die Mühe lohnt sich. Beim dazu notwendigen Umblättern offenbart sich nämlich der riesige Vorteil, den das Buch gegenüber der Fernsehsendung hat: Querverbindungen zwischen den unterschiedlichsten Schauplätzen und Krisenherden werden beim Hin- und Herblättern zwischen den 28 „Destinationen“ von Aubrys und Tétarts Welt der Gegenwart unmittelbar deutlich. Wesentlich besser als mit der Fernbedienung in der Hand lässt es sich in diesem ungewöhnlichen Atlas lesend und blätternd zwischen den einzelnen, o auf unerwartete Weise zusammenhängenden Kapiteln hin und her switchen.
Das zeigt etwa die neunte Destination, die Ölraffinerie Punto Fijo, mit der ein längeres Kapitel über Venezuela beginnt. Das Land verfügt zwar über 18 Prozent der weltweiten Ölreserven, ist seit 2018 aber von den USA mit einem Ölembargo belegt. Sorgte gerade noch der schwelende Konflikt mit dem Nachbarstaat Guyana für internationale Besorgnis, ist es heute die gewaltsame Unterdrückung der Proteste nach den gestohlenen Wahlen vom vergangenen
Als blutroter Faden ziehen sich die Folgen der Geopolitik, wie sie derzeit Russland im alten, imperialistischen Sinn betreibt, durch das Buch. So auch in Destination Nummer 24, der malischen Wüsten- und UnescoWeltkulturerbestadt Timbuktu. Dort wurden die Islamisten, die die Kulturdenkmäler teilweise zerstörten, ab 2013 von der französischen Armee in Schach gehalten – bis sich Frankreich aus Mali wie auch aus dem benachbarten Burkina Faso zurückziehen musste. „Dies ist ein wichtiger Wendepunkt in einer Region, in die neue ausländische Krä e vordringen wie zum Beispiel die von Russland gesteuerte Wagner-Miliz, die der malischen Militärregierung nahesteht“, so Aubry und Tétart über die russische Geopolitik an unerwartetem Schauplatz.
„Die Welt der Gegenwart“ enthält auch einen Ausblick in die Welt von morgen, für den die Autoren den Blick vor allem in Richtung der aufstrebenden Weltmächte China und Indien richten. Oder nach Kanada, das zum Ausgangspunkt einer kurzen Reise zu den weltweit am stärksten vom Klimawandel betroffenen Regionen der Erde wird.
Auch wenn man sich da und dort noch mehr Tiefenschärfe wünschen würde: Émilie Aubry und Frank Tétart gelingt mit 130 Landkarten auf gut 200 Seiten eine globale Standortbestimmung, die einen in dieser Form einzigartigen Überblick über die politischen und geografischen Zusammenhänge unserer „Welt der Gegenwart“ vermittelt. An Prägnanz und Aha-Erlebnissen steht der Atlas der vertrauten Fernsehsendung um nichts nach.
GEORG RENÖCKL

Émilie Aubry, Frank Tétart: Die Welt der Gegenwart. Ein geopolitischer Atlas.
C.H. Beck, 224 S., € 29,90

Michael Harriot hat eine zornige, lustige, schnoddrige und böse Geschichte des schwarzen Amerika geschrieben
Würde man aus Vergangenheit und Gegenwart Amerikas ein fühlendes Wesen erschaffen wollen“, eines, das die dunklen Wahrheiten, die Geschichte, die Identität der Vereinigten Staaten verkörpert, ätzt Michael Harriot, „es wäre wie Donald Trump.“ Es würde alle hassen, die nicht weiß sind. Es würde sich für ein einzigartiges mental stabiles Genie halten.
„Donald Trump ist Amerika.“
„Er lügt … genau wie Amerika lügt.“ Die Geschichte der Nation, ihrer Bedeutsamkeit, dass sie ein Leuchtturm des Guten sei, all das ist „das Hirngespinst einer kollektiven weißen Fantasie. Amerika ist ein Hochstapler.“
„Der Typ war total verrückt. Er war weder reich noch klug noch besonders begabt … und heiratete irgendwann eine portugiesische Adelige“ – in diesem Sound geht die Geschichte los. Gemeint ist Christoph Kolumbus, der Seefahrer, der sich ein wenig irrte und dadurch „Amerika“ entdeckte, was mehrfach falsch war. Erstens war es schon entdeckt, zweitens betrat er erst auf seiner vierten Reise „amerikanisches“ Festland (und das auch nur bei Honduras).
Michael Harriot, Journalist, Reporter, Kommentator, TV-Pundit, Polemiker und Autor mit einem Hang zum Comedyha en hat die Geschichte Amerikas geschrieben –und in gewissem Sinne neu geschrieben. Als Geschichte von weißer Vorherrscha und

Michael Harriot: Black as F***. Die wahre Geschichte der USA. HarperCollins. 558 S., € 26,80
weißen Superioritätsgefühlen, als Geschichte einer Nation, die nicht nur von Gewalt vergi et ist, sondern auch von Genozid, Ausrottung, Sadismus, Habgier und vom Hang, sich das alles in geschönten, doppelt „weißgewaschenen“ Tönen zu erzählen. Zugleich ist es eine Gegengeschichte des schwarzen Amerika, die von Leid, aber auch von Widerstand, Mut, Selbstbehauptung und Überlebensgeschick handelt.
Vieles, was Harriot berichtet, ist für die meisten Leserinnen und Leser wohl nicht ganz neu. Die Ausrottung der indigenen Bevölkerung, die Versklavung von Millionen Schwarzen, aus Afrika hergebracht, die rassistische Brutalität bis in unsere Tage: All das ist vielfach beschrieben. Genauso wie die heldenha en Kämpfe der Bürgerrechtsbewegungen, von Rosa Parks über Martin Luther King bis Malcolm X oder Stokely Carmichael und der Black-Panther-Party. Oder die große Geschichte schwarzen Geisteslebens, mit Giganten wie William E. B. Du Bois, der schon um 1900 Weltruhm erlangt hatte und etwa Max Weber ein paar spannende Ecken des Landes zeigte.
Das Buch liest sich packend und ist dennoch ein Fall für sich und von einer Eigentümlichkeit, die es erschwert, zu sagen, was es eigentlich ist: ein populärwissenscha liches Geschichtsbuch, befeuert von Jahrhunderten schwarzer Verwundungen? Ja, das auch. Zugleich auch ein Buch, als wäre es extra
für Teens und Twentysomethings geschrieben, im schnoddrigen und o auch scherzha en Ton des Influencer-Sounds. Und ein bisschen ist es „Critical Whiteness Theory“, nur ohne Theorie.
Das Buch ist gut, aber seltsam. Es beginnt schon damit, dass der Autor immer wieder private Storys einflicht, dass ein – realer oder fiktiver? – Onkel als Erzähler in die Geschichte springt, dass es zwischendurch Exkurse zu allen möglichen Abschweifungen gibt, Fragebögen, um das Gelernte lustig abzuprüfen, und sogar Kochrezepte, die aber auch ihre kulturhistorische Bedeutung haben.
„Geschichte wird von den Siegern geschrieben, aber von Rebellen gemacht“, formuliert Harriot. Und noch die Überschreibungen der Geschichte werden von der dominanten Kultur verfasst. Heute wird die Sklaverei eben als eine „Verirrung der Zeit“ erzählt, der Geschichtslauf als Abfolge humanitärer Reformen, bei denen weiße Humanisten und gewaltlose schwarze Pazifisten langsam, mühsam, aber zum gemeinsamen Vorteil die Welt besser gemacht hätten. Harriot nennt das „die Schulbuchversion des Bürgerrechtskampfes, wie sie in unserem kollektiven, weißgewaschenen Gedächtnis existiert“.
Was ist das gefährlichste Lebewesen, dem ein Schwarzer begegnen kann, fragt Harriot? „Ein Amerikaner.“
Noch die freundliche, humanistische Fantasiegeschichte wiederholt auf ihre Weise die Entrechtung, wenn etwa das vorherrscht, was Harriot das „Weiße kämp en für das Ende der Sklaverei“-Narrativ nennt. Noch in dieser Befreiungsgeschichte verlieren die Opfer ihre Identität, denn die Sklaven, die verschleppt wurden, waren nicht nur „Sklaven“, sondern „Ärzte, Priester, Kinder, Ehefrauen und Krieger“, also Menschen mit einer Identität, die bis heute ausgelöscht ist, wenn man sie auf ihr Sklaven-Sein reduziert.
Harriot beschreibt eindrücklich, wie diese Geschichte der Brutalität Gemüter und Mentalitäten prägt. Die Ideologie der „White Supremacy“ ist nicht nur von Überlegenheitsgefühlen vergi et, sondern mindestens so sehr von Angst: Der Schwarze wird als unberechenbares Raubtier imaginiert. Der Autor erklärt das so: Wer sich geknechtete, entrechtete, ihrer Identität beraubte Arbeiter einer anderen Ethnie in großer Zahl ins Land holt, den Familien ihre Kinder, den Menschen ihr Leben stiehlt, macht bald die Erfahrung: Die sind gefährlich. Die werden nämlich jede Gelegenheit zum Aufstand wahrnehmen. Aber die Träger der weißen Vorherrscha hätten sich natürlich nicht gesagt: „Oh, wir haben Mist gebaut“, sondern fantasierten sich den Schwarzen dann zur Bestie zurecht. Als Stereotype lebten diese Trugbilder dann noch Jahrhunderte fort. Die Schwarzen wiederum wollen laut Harriot von den Weißen am liebsten in Ruhe gelassen werden, doch die Unrechtserfahrungen und das Wissen um dauernde Bedrohtheit, um Willkür und Ausgeliefertsein schreibt sich in die „Seelen der Schwarzen“ ein (so der Titel von Du Bois’ legendärem Buch). Immer am Sprung, immer aufmerksam. Jeder Schwarze werde „Experte“ für die Weißen, weil er Bedrohungen schnell erkennen müsse. James Baldwin, der große schwarze Erzähler und Essayist, hat einmal über die scheinbare schwarze „Fröhlichkeit“ geschrieben, den immer lustigen Schwarzen, der stets ein Grinsen im Gesicht hat. Was in den Stereotypenschatz der Weißen einging (Schwarze sind o lustig, immer zu Späßchen aufgelegt …), sei aber zunächst einfach eine Überlebensstrategie. Der Schwarze weiß, ihm schlägt leicht Aggressivität entgegen, er wird – Stichwort: weiße Angst – auch leicht als Bedrohung wahrgenommen. Also lächle, dann lächelt die Welt vielleicht zurück. Eine Strategie, so Baldwin, die leider meist nicht funktioniert.
Spannend ist Harriots „wahre Geschichte der USA“ besonders da, wo sie die unbekannteren Episoden erzählt: Wie versklavte Landarbeiter ihre eigenen Gemeinscha en gründeten, damit Ruhe von ihren Besitzern hatten und daraus Freiheitsbewegungen entstanden; wie brutal die „Gegenrevolution“ nach dem Bürgerkrieg wütete, um den Befreiten ihre Rechte wieder zu nehmen; wie die Gesetzlosigkeit herrschte und die Lynchkultur („der Boden glitschig vor Blut“). Es war der Kampf der Schwarzen, so Harriot, der „das kriminelle Unternehmen namens Amerika“ veränderte. „Das Rechtsstaatsprinzip existiert wegen uns.“ Es wurde erkämp , von zornigen Predigern, brillanten Journalistinnen und Kämpfern, die der Gewalt mit Gegengewalt begegneten. Harriot: „Vielleicht liegt der erste Schritt zur Befreiung in der Loslösung von dem Gedanken, dass Freiheit etwas ist, was weiße Menschen jemandem gewähren können. Ich wollt’s nur mal gesagt haben.“
ROBERT MISIK
Würde man aus Vergangenheit und Gegenwart Amerikas ein fühlendes Wesen erschaff en wollen, es wäre wie Donald Trump
MICHAEL HARRIOT
Im Kulturkrieg um die „Wokeness“ bringt Karsten Schubert eine Menge guter Argumente vor – und auch ein paar fragwürdige
Die „Identitätspolitik“ hat heute einen schlechten Ruf, man möchte beinahe meinen, sie kommt nur mehr als Injurie vor. „Woke“ ist zu einem regelrechten Schimpfwort geworden, und nicht nur Konservative reagieren hysterisch, wenn benachteiligte Bevölkerungsgruppen Forderungen stellen. Auch Weltverbesserer mit „universalistischem“ Anspruch beklagen, mit der Identitätspolitik würde ein Tribalismus einziehen, also eine Art neues Stammesdenken; gemäßigte Linke sehen die Freiheit und den vernün igen Diskurs bedroht, wenn nicht mehr zählt, ob ein Argument plausibel ist, sondern allein, wer es vorbringt. Identitätspolitik führt, so die Klage, zu Spaltungen und einem Gegeneinander, wo eigentlich Bündnisse angesagt wären. Etwas wohlwollendere Einwände lauten, dass die Identitätspolitik benachteiligter Gruppen viel zu leicht in Übertreibungen eskaliert, sodass Theorien, die Richtiges zur Sprache bringen, ins Konfrontative oder Verrückte ausarten.
Schon der Titel von Karsten Schuberts „Lob der Identitätspolitik“ ist angesichts dieses verbreiteten Raunens eine kalkulierte Irritation. Der Berliner Theoretiker schreibt aber nicht mit pamphletistischer Verve, sondern im ruhigen Ton der politischen Philosophie. Er versucht mit durchdachten Begründungen gegen die Kritiker der Identitätspolitik zu argumentieren – und bisweilen gegen die überspannten Wirrköpfe unter deren Anhängern.
Über weite Strecken gelingt Schubert das auf plausible Weise. Identitätspolitik sei, aus seiner Sicht, die „politische Praxis marginalisierter Gruppen, die sich in Bezug auf eine kollektive Identität gegen ihre Benachteiligung durch Strukturen, Kulturen und Normen der Mehrheitsgesellscha wehren“. Sei das der Feminismus, der gegen die Benachteiligung von Frauen aufsteht, oder der Antirassismus; seien das Bewegungen gegen Sexismus oder Herabsetzung aufgrund von sexueller Orientierung, Religion, Hautfarbe, seien es postkoloniale Diskriminierungen, was auch immer. Gemeinsam ist all diesen Bewegungen, dass sie Lebenserfahrungen und ein Leiden durch Sozialisation zur Sprache bringen, die zunächst in den dominanten Diskursen gar nicht vorkommen (oder nicht vorkamen).
Schuberts Grundthese: Identitätspolitik reagiert auf „real existierende Diskriminierungsstrukturen“. Daher sei sie nicht „antidemokratisch“, sondern im Gegenteil für „die Demokratisierung der Demokratie nötig“, da die „real existierenden demokratischen Institutionen ihren eigenen Maßstäben nicht gerecht werden“.
Die Gegner von Identitätspolitik mögen da und dort schon richtigerweise auf Übertreibungen von einzelnen Engagierten hinweisen, letztendlich steht ihre Prämisse freilich auf tönernen Füßen: nämlich, dass Diskriminierung kein fundamentales Problem unserer Gesellscha sei, dass die Machtungleichgewichte zwischen jenen, die stets zu
Wort kommen, und jenen, die (vergleichsweise) ungehört bleiben, nicht dramatisch ins Gewicht fallen. Das ist natürlich Unfug. „Weil Diskriminierungen unsere Gesellscha strukturieren, ist Identitätspolitik notwendig.“
Identitätspolitik setzt auch nicht einfach auf vorhandene Identitäten, sondern stellt diese erst her, indem Anliegen benachteiligter Gruppen artikuliert werden –die „Identität“ wird somit verändert. Der Gegensatz zwischen Universalismus und Identitätspolitik sei, so Schubert, eine Fantasie. Man denke an die „universalen“ Werte von Gleichheit und Freiheit. Identitätspolitik ist notwendig, um ihnen erst zum Durchbruch zu verhelfen.
Problematisch wird das für Schubert nur, wenn es Gruppen in einer fixen Identität quasi einkesselt, wenn die analysierte „Vermachtung“ von Institutionen und Diskursen dazu führt, dass das argumentierende Gespräch abgelehnt wird, wenn Identitätspolitik „anti-au lärerisch“ wird. Objektivität gibt es laut ihm nicht, weil jede Position durch die Perspektive und Erfahrung der Protagonisten geprägt sei. Das Streben nach einer „besseren Version von Objektivität“ dürfe deshalb nicht aufgegeben werden. Das Ziel sei Verständigung, nicht Gegeneinander.
So tri ig Schuberts Argumentation ist, so tut er Fragwürdigkeiten dann doch etwas zu sehr als Nebensachen ab. Moralische Beschämung, das Anprangern von Leuten, die manche Dinge auch nur eine Spur anders sehen, sektiererische Rigidität, nervige Überbietungswettbewerbe in radikalen Szenen und alles, was man mit dem Komplex „Cancel Culture“ verbindet – sie alle hätten sich eine weniger beschönigende Beschreibung verdient. Schubert hingegen meint, dies alles sei nötig, um den Widerstand „aktiv ignoranter Subjekte“ zu brechen und weil unsensible Individuen „externe Hilfe“ benötigen würden. Das ist schon absurd, wenn man weiß, wie leicht auch der Gutwillige an den Pranger geraten kann und dass ein sogenanntes „ignorantes Subjekt“ einfach eine Person sein kann, die in einer Frage eine andere Auffassung hat. Auch ist „externe Hilfe“ eine ziemlich euphemistische Beschreibung für die moralische Totalvernichtung, auf die Beschämungsstrategien bisweilen hinauslaufen. Damit lässt sich jeder Unfug rechtfertigen, auch jener, der letztlich zur Diskreditierung der guten Identitätspolitik führt, deren Loblied Schubert singt. ROBERT MISIK

Ungleichheit, Desinformation, Erosion der Demokratie: US-Historiker Timothy Snyder über die bedrohte Freiheit
D er Begriff Freiheit scheint in den letzten Jahrzehnten zu einem Wort für Sonntagsreden verkommen zu sein, wenn nicht zu einer ideologischen Floskel, mit der vor allem Wirtscha slibertäre rücksichtslose Maßnahmen und Ausbeutungsverhältnisse zu rechtfertigen suchen: Hauptsache, kein Staat, keine Regeln, keine Hürden für Güter und Geld, stattdessen geschlossene Grenzen für schutzsuchende Menschen. Der US-amerikanische Historiker und Philosoph Timothy Snyder („Bloodlands“, „Über Tyrannei“) nennt das „negative Freiheit“, eine Freiheit von. Das Gegenteil, die „positive Freiheit“, sei hingegen ganz schön ins Hintertreffen geraten – die Freiheit zu einem menschenwürdigen, selbstbestimmten und sicheren Leben also. Dass Snyder sein Buch während einer Reise in die vom Angriffskrieg Russlands erschütterte Ukraine beginnt, ist kaum verwunderlich: „Hier ist das Thema allerorten grei ar.“
„Über Freiheit“ ist mehr als eine deskriptive und historische Studie. Immer wieder bringt Snyder uns die Realitäten des 21. Jahrhunderts zu Bewusstsein. Die USA dienen ihm als Anschauungsobjekt dafür, was passiert, wenn Oligarchen und Möchtegern-Putschisten den Freiheitsbegriff missbrauchen. „Das Recht dient der Tyrannei“, schreibt er, „wenn es eine winzige Minderheit von Oligarchen begünstigt. Wenn Ame-
rika ein Land der Freien werden soll, muss es das Recht auf seine gigantischen Ungleichheiten bei Vermögen und Einkommen anwenden. Allein die Durchsetzung der bestehenden Gesetze wäre ein guter Anfang.“
Fünf Faktoren führt Snyder für seine wertgebundene Auseinandersetzung mit der Freiheit an: Zunächst geht es um Souveränität oder „die erlernte Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen“ – souverän wird man als Kind, wenn man den anderen nicht als Objekt, sondern empathisch wahrnimmt. Der oder die andere ist eben kein verwaltbarer Körper, sondern ein fühlender Leib.
Als zweite Grundlage nennt er „die Fähigkeit, physikalische Gesetzmäßigkeiten den persönlichen Zwecken anzupassen“ –frei ist in diesem Sinne, wer Entscheidungen fällt, die aufgrund einer eigenen Wertebasis vernün ig, aber nicht unbedingt rational sind. Auch die Mobilität, die einen befähigt, sich durch Raum und Zeit zu bewegen und soziale Bewegungsspielräume zu haben, gehört zur Freiheit.
Punkt vier beinhaltet den Abgleich mit den realen Gegebenheiten der Welt. Wahrha igkeit erst erlaubt es, die Welt zu verändern. Zu guter Letzt würden diese Fähigkeiten ins Leere führen, wenn sie nicht solidarisch geteilt würden – nur durch andere können wir lernen; nur die Freiheit aller ermöglicht die Freiheit des Einzelnen.

Was die Freiheit bedroht, liegt gerade in den letzten Jahren offen zutage. Soziale Medien dienten vornehmlich der Desinformation, sie behinderten wissenscha liches Denken. Dass es einem Teil der Wählerscha schwer gemacht werde, überhaupt an Wahlen teilzunehmen, sowie das Gefängnissystem in den USA seien rassistische Versuche, einen Teil der Bevölkerung aus dem politischen Prozess auszuschließen und ihm damit Freiheit vorzuenthalten. Das Effizienzdenken mache Solidarität unmöglich. Der Leib werde nur als nutzbarer oder nutzloser Körper betrachtet. Und dass reiche Leute ihre Steuern nicht zahlen, führe zur Erosion demokratischer Institutionen.
Was Snyder für die Gegenwart herausarbeitet, ist so luzide wie düster. Und doch endet das Buch hoffnungsvoll – oder zweckoptimistisch. Auf Biegen und Brechen musste da wohl noch eine positive Aussicht hinein: Alles sei menschengemacht, wir könnten unser Schicksal in die Hand nehmen. Angesichts all der Krisen, Kriege und der Klimakatastrophe hätten wir eine letzte Chance, aber doch eine gute. Denn: „Unser Problem ist nicht die Welt, unser Problem sind wir. Und deshalb können wir es lösen. ... Wir können uns gegenseitig anerkennen, eine gute Regierung bilden und unser eigenes Glück machen.“ ULRICH RÜDENAUER
Yuval Noah Harari analysiert, wie Informationsnetzwerke den Lauf der Geschichte und die Zukun der Menschheit prägen
Das destruktive Potenzial des Menschen ist ein verstörendes Phänomen, über das Philosophie, Literatur, Kunst und Wissenscha schon immer gerätselt haben. Warum ist der Homo sapiens bei seinem Tun o weniger weise, als sein lateinischer Gattungsbegriff suggeriert? Wie konnte es geschehen, dass sich die Menschheit nach 100.000 Jahren Entdeckungen, Erfindungen und Eroberungen in eine existenzielle Krise manövriert hat, an den Rand eines ökologischen Zusammenbruchs oder gar eines drohenden Weltkrieges?
Der an der Hebrew University in Jerusalem lehrende Historiker Yuval Noah Harari, 48, wurde mit populärwissenscha lichen Publikationen über die Geschichte der Menschheit wie „Sapiens“ zum Bestsellerautor. In seinem neuesten Werk „Nexus“ versucht er herauszuarbeiten, woher dieser selbstzerstörerische Zug der Menschheit rührt. In den Mittelpunkt stellt er diesmal die Geschichte der Informationsnetzwerke „von der Steinzeit bis zur künstlichen Intelligenz“. Letztere, warnt er eindringlich, „hat das Zeug, nicht nur den Lauf der Geschichte unserer Spezies zu verändern, sondern die Evolution des gesamten Lebens“. Der Begriff „Nexus“ stammt aus dem Lateinischen und meint das Zusammenknüpfen, allgemeiner auch „binden“ oder „verknüpfen“. Harari benennt damit seine
zentrale These, „dass die Menschheit gewaltige Macht erwirbt, indem sie kooperative Netzwerke au aut, dass jedoch die Konstruktionsweise dieser Netze dem unklugen Gebrauch dieser Macht Vorschub leistet“. Als krasse Beispiele dafür führt er den Nationalsozialismus und den Stalinismus an, zwei der verheerendsten Netzwerke, die Menschen je erschaffen haben. Wie stark auf Wahnvorstellungen basierende Netzwerke werden können, fällt uns schwer zu verstehen, weil wir laut Harari einem „Irrtum aufsitzen, wie große Informationswerke – ob wahnha oder nicht – funktionieren“. Wir gehen davon aus, so Harari, „dass große Netzwerke mehr Information verarbeiten können als Einzelpersonen und auf diese Weise Fortschritte auf Gebieten wie Medizin, Physik, Wirtscha und so weiter ermöglichen“. Netzwerke scheinen dadurch nicht nur mächtig, sondern auch weise zu sein. Probleme beim Erwerb oder der Verarbeitung von Information lassen sich beheben, so der Glaube, indem man schlicht mehr Daten sammelt.
Tatsächlich gibt es viele Fälle, in denen mehr Information unser Verständnis der Welt verbessert. Ein Beispiel aus der Medizin, so Harari, ist der dramatische Rückgang der Kindersterblichkeit. Noch im 18. Jahrhundert erreichten selbst in wohlhabenden Familien nur drei von zwölf Kindern das Er-

wachsenenalter. Heute befindet sich auf jedem Handy mehr Information als in der legendären antiken Bibliothek von Alexandria. Aber „trotz – oder gerade wegen dieser Datenmenge – stoßen wir nach wie vor Treibhausgase in die Atmosphäre“, mahnt der Israeli, „zerstören wir Lebensräume und produzieren immer mächtigere Massenvernichtungswaffen – von Atombomben bis zu apokalyptischen Viren“.
Im ersten Teil des Buches schildert Harari die historische Entwicklung von Informationsnetzwerken, von den Mythologien der Antike bis zu Bürokratien moderner Staaten. Dabei nimmt er sich des Problems von falscher Information an und zeigt Unterschiede auf, wie demokratische und totalitäre Systeme Informationsnetzwerke nutzten. Der zweite Teil ist dem Informationsnetzwerk gewidmet, das wir gerade schaffen, inklusive der KI-Systeme, sowie der Rolle von Social-Media-Algorithmen. Zum Schluss arbeitet er heraus, welche Gefahren und Chancen in unterschiedlichsten politischen Systemen auszumachen sind. Man mag dem Buch gewisse formale oder sprachliche Schwerfälligkeiten anlasten. Inhaltlich legt es eine sehr ernstzunehmende Basis für eine enorm wichtige Diskussion darüber, wie wir unsere (technologiegetriebene) Zukunft gestalten wollen. ANDRÉ BEHR
Wolfram Eilenberger erzählt anhand von vier Beispielen über die Au lärung in der Nachkriegsphilosophie
Am Anfang von Wolfram Eilenbergers neuem Buch „Geister der Gegenwart“ steht das Herrenfinale von Ivan Lendl gegen John McEnroe der French Open aus dem Jahr 1984. Nach erzählenden Sachbüchern über vier Philosophen und vier Philosophinnen unter den Titeln „Zeit der Zauberer“ und „Feuer der Freiheit“ legt der Bestsellerautor nun so etwas wie ein gemischtes Doppel vor: einen Parcours durch die Nachkriegsphilosophie anhand von Theodor W. Adorno, Paul Feyerabend, Michel Foucault und Susan Sontag. „Die letzten Jahre der Philosophie und der Beginn einer neuen Au lärung. 1948–1984“ lautet der Untertitel.
Wie in den Vorgängerbüchern verschränkt Eilenberger dabei Leben und Schri en seiner Protagonisten und Protagonistinnen auf gekonnte Weise – und spart auch nicht mit Details aus deren Privat- und Liebesleben. Auf diese Weise erhalten seine Ausführungen zur Frage, was Philosophie nach dem Rückfall in die Barbarei während des Zweiten Weltkriegs noch bedeuten kann, Fleisch und Sa . Sie lassen das Denken der Protagonisten nicht im lu leeren Raum schweben, sondern leiten es – zumindest teilweise – aus ihren Biografien bzw. ihrer Selbstbefragung ab.
Gemeinsam ist Adorno, Feyerabend, Foucault und Sontag, dass sie sich gegen normative, generalisierende Theorien wandten und selbst keine Schulen begründeten, dafür aber einen Zug zum Literarischen bzw. Musischen und zur Lebenskunst zeigten. „Geister der Gegenwart“ nennt Eilenberger die zwischen 1969 und 2004 Verstorbenen, weil sie immer noch „als Gespenster durch unsere Diskursräume wabern“, wie er dem Philosophie Magazin erklärte.
„Wir leben in einer Zeit, die bewusst auf Gesundheit aus ist und dennoch allein an die Realität der Krankheit glaubt“, formulierte etwa Sontag 1978 im Essay „Krankheit als Metapher“, den sie nach ihrer Krebsdiagnose verfasst hatte. Ein Satz, der nichts an Aktualität eingebüßt hat.
Als roter Faden zieht sich Kants legendäre Definition vom „Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“ durch Eilenbergers Buch. Er begrei die Philo-
sophierebellen nicht als Vertreter oder Vorbereiter der Postmoderne, sondern als Au lärer. „Sie wollten den Kern der Moderne retten, nicht überwinden“, sagt er im erwähnten Interview.
Auch hegten alle vier eine gewisse Skepsis gegen gewaltsame Revolutionen, mit denen sie in den Jahren 1967 bis 1969 hautnah in Kontakt kamen. Eilenberger lässt das Gefahrenpotenzial aktivistischer Instrumentalisierung für das Denken spürbar werden, wenn er die Besetzung der neuen Universität in Vincennes im Januar 1969 schildert, bei der sich Michel Foucault trotzdem zu Handgreiflichkeiten hinreißen ließ, oder Adornos Auseinandersetzung mit den revoltierenden Studenten in Frankfurt.
Spannend wird es, wenn er Verbindungen zwischen den Werken darstellt, etwa dass Paul Feyerabends „Against Method“ (dt. „Wider den Methodenzwang“, 1975) nicht nur im Titel auf Susan Sontags „Against Interpretation“ (1964) anspielt – auch wenn sich der Wiener Freigeist Feyerabend auf die Wissenscha stheorie bezieht und die angriffslustige New Yorker Szene-Ikone auf Kunst.
Sontags Essay „Notes on ,Camp‘“ hingegen liest er als Antwort auf Adornos „Minima Moralia“: „Bätsch, es gibt sehr wohl ein richtiges Leben im falschen. Man muss es dafür eben nur so richtig falsch machen wollen!“
Und kann damit in einer Zeit der Massenkultur sogar noch Dandy sein.
Letztlich erweisen sich alle vier als egomanische Snobs, daher kann man Eilenbergers Abschluss der „Trilogie“ auch als eine Entzauberung lesen. Am Anfang seien ihm alle außer Feyerabend unsympathisch gewesen, gesteht er im Interview. Nach der Lektüre dieses Buchs muss man sie nicht mögen, aber man kann ihren unbestechlichen Denkanstrengungen Respekt zollen.
KIRSTIN BREITENFELLNER

Wolfram Eilenberger: Geister der Gegenwart. Die letzten Jahre der Philosophie und der Beginn einer neuen Au lärung. Kle -Co a, 492 S., € 28,80
In „Along the Road“ stellt sich „Brave New World“-Autor Aldous Huxley als pointierter Reiseschri steller vor
Touristen sind im Allgemeinen ein recht trübseliger Haufen“, befindet Aldous Huxley. „Wenn sie eine flüchtige Stunde lang so tun können, als wären sie zu Hause, wirken die meisten Touristen tatsächlich glücklich“, schreibt der Autor (1894–1963), der später durch seine hellsichtige Dystopie „Brave New World“ („Schöne neue Welt“) berühmt werden sollte. Im Kapitel „Warum nicht lieber zu Hause bleiben?“ zieht er über den Massentourismus her, klap-
Ich habe schon bei Beerdigungen fröhlichere Gesichter gesehen als auf dem Markusplatz
ALDOUS HUXLEY
pert aber selbst genauso die Sehenswürdigkeiten ab – am Beifahrersitz eines 10-PS-Citroën. (Wobei: „Ob ein Citroën mit zehn PS wirklich als Auto gelten kann, ist noch die Frage.“ Für ihn spreche vor allem, „dass er fährt“.)
In den nerdigen Beobachtungen, die Huxley „Along the Road“ ersonnen hat, würden „sich Witz und Ernst aufs Schönste verbinden“, urteilte die New York Times 1925.
Erst jetzt, fast 100 Jahre später, hat der Autor und Journalist Willi Winkler das Buch erstmals ins Deutsche übersetzt. Der gebürtige Brite Huxley schreibt darin über seine Reisen durch das Europa der 1920er-Jahre, durch bildha e Landscha en in Holland und Belgien und ganz besonders o durch Italien, wo auch „Brave New World“ entstanden ist. Und er denkt über das Unterwegssein selber nach. Zum Beispiel über „Bücher für die Reise“. Der erschöp e Tourist sei zu längerer Konzentration ohnehin nicht fähig, daher dürfe die Lektüre ruhig der reinen Neugier dienen und „den Geist kitzeln“. Für Huxley hieß das zum Beispiel: wahllos in einem Lexikon zu schmökern; das unterscheidet ihn dann doch von durchschnitt-
lichen Reisenden seiner Zeit. Er liest die Encyclopædia Britannica anstatt den Reiseführer von Baedeker: Dieser preise indifferenziert alles, was alt ist. Statt der „langweiligen, dummen Fakten, die jeder parat hat“, solle man sich lieber auf „Ungewöhnliches und Abseitiges“ konzentrieren, auf die No Names und Fun Facts, das „Abgelegene und Seltsame“ anstatt des „Naheliegenden und Klassischen“.
Seine Umwege geraten ausschweifend. Das Unterwegssein spornt ihn an, über alles Mögliche zu sinnieren – über Neid, Lügen, die Kunstform Theater. Mit seiner Verachtung für Massengeschmack und Kommerzialisierung klingt Huxley streckenweise wie der Philosoph Theodor Adorno. Er kennt sich mit griechischen Säulenordnungen und dem Schicksal italienischer Adelsfamilien aus, schwärmt für den römischen Architekten Leon Battista Alberti und für Pieter Bruegel den Älteren, dessen Werk man doch bitte im Kunsthistorischen Museum Wien bestaunen möge. Allen guten Malern gemein sei übrigens ihr „Gespür für Pobacken“. Gerne wäre Huxley selbst bildender Künstler geworden, seine Sehschwäche machte das unmöglich. Also malte er mit Worten die herbstliche Landscha in Holland und ließ das Pferderennen in Siena als Tableau vivant erscheinen.
„Along the Road“ fand sogar Eingang in die Weltgeschichte, wie man im Nachwort erfährt. Für Huxley war das Fresko im Rathaus von Sansepolcro, das die Auferstehung Christi zeigt, „das beste Bild der Welt“. 1944 war der britische Offizier Anthony Clarke mit der Beschießung von Sansepolcro beau ragt. Doch er hatte als Teenager Huxleys Buch gelesen, erinnerte sich des Bildes – und gab nicht den erwarteten Feuerbefehl.
JULIANE FISCHER
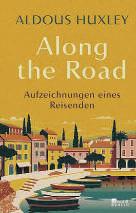
Aldous Huxley: Along the Road. Aufzeichnungen eines Reisenden. Rowohlt, 288 S., € 25,70
Über 1.5 Mio. Bücher, DVDs & CDs mit gutem Gewissen
F esttag for Future“, jubelten Klimaaktivisten, als das deutsche Bundesverfassungsgericht im April 2021 eine historische Entscheidung traf: Um die Freiheitsrechte kün iger Generationen zu schützen, müsse die deutsche Politik die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens umsetzen. Klimaschutz erlangte somit Verfassungsrang.
Danach ging alles weiter seinen gewohnten Gang. Wirtscha , Politik und Medien finden weiterhin andere Dinge wichtiger, Verwaltungsbeamte und Richterinnen entscheiden wie eh und je. Der Grund: „Unser Rechtssystem stammt noch aus einer Zeit mit viel menschenleerer Natur. Das ist bis heute zu spüren“, schreiben die Juristinnen Roda Verheyen und Alexandra Endres. Inzwischen können die Ozeane und die Atmosphäre all den Müll, das CO2 und andere Emissionen nicht mehr aufnehmen. Das Rechtssystem aber halte stur daran fest: Zu schützen seien vor allem das Eigentum und die Wirtscha , heißt es in „Unlearn CO2“. Mit dem Buch knüp der Ullstein-Verlag an sein Erfolgsbuch „Unlearn Patriarchy“ an. Dessen Botscha : Das Patriarchat ist nicht ein „Thema“ unter vielen, sondern allen Lebensbereichen eingeschrieben: Familie, Sprache, Arbeit, Politik. Genauso ist es mit den Treibhausgasen. Was wir morgens anziehen und essen, wie wir uns von A nach B bewegen und nach welchen Regeln unsere (patriarchale) Gesellscha läu : All das basiert darauf, dass wir Öl und Gas verheizen und die Natur ausnutzen. Und all das gilt es nun wieder zu verlernen – durch eine „radikale Kohlendioxid-Kur“.
Dabei müsse das Neue, das es zu erlernen gilt, keinesfalls immer nur mit Verlust und Verzicht zu tun haben, betonen die 17 Autoren, darunter die prominentesten Köpfe der deutschsprachigen Klimadebatte: Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die Juristin Verheyen, die mit ihrer Klimaklage gegen die deutsche Bundesregierung vor dem Höchstgericht Erfolg hatte; Julien Gupta und Manuel Kronenberg vom Klima-Newsletter Treibhauspost. Das Buch will vor allem eines sein: „Kompass für den Weg aus der Frustration“. Mit je rund 20 Seiten sind alle Beiträge kurz und knackig und enthalten nebst einem Problemaufriss auch Lösungsvorschläge. So deklinieren in „Unlearn Recht“ Verheyen und Endres durch, was passieren müsste, damit die legendäre Verfassungsentscheidung auch wirksam wird. Derzeit tue sich zwischen dieser und ganz konkreten Genehmigungsverfahren „ein juristisches Vakuum“ auf.
Der Großteil der Gesetze orientiere sich eben nach der alten Logik: Demnach wird das Recht, eine natürliche Ressource zu nutzen, vor Gericht stärker gewichtet als das Recht der Natur auf Schutz. „Deshalb werden neue Straßen gebaut, bestehende Kohlegruben weiter ausgebaggert und zusätzliche Flüssigerdgas-Terminals genehmigt – obwohl jedes einzelne Vorhaben dazu beiträgt, die Emissionen noch weiter in die Höhe zu treiben, also unser CO2-Budget immer stärker zu überziehen.“
Dabei müsste sich die deutsche Politik nun an jenem (wissenscha lich ermittelten) CO2-Budget orientieren, das Deutschland noch verbrauchen darf, damit die Erderwärmung wie in Paris beschlossen auf unter zwei Grad bleibt. Das Parlament müsste weiters festlegen, wie dieses Budget auf die einzelnen Sektoren und Akteure verteilt werden soll. Projekte wären nur noch dann zu genehmigen, wenn sie die Klimaziele nicht gefährden. In Teilen

Essen und Kleidung, Arbeit und Wirtscha : Egal was wir tun, wir blasen dabei Treibhausgase in die Lu . Wie lässt sich „CO2 verlernen“?
sei das Recht bereits „dabei, CO2 zu verlernen. Doch bis es seine alten, fossil geprägten Grundsätze auch tatsächlich vergessen hat, bleibt noch viel zu tun.“
Der Debatte um den Primat des Wirtscha swachstums und mögliche Alternativen – Stichworte Green Growth oder aber Degrowth – widmet sich Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtscha sforschung. Prinzipiell gelte: Mehr Wachstum heißt mehr Energieverbrauch heißt mehr Ökokrise. Von der Hoffnung, die beiden ließen sich entkoppeln – indem weniger Energie oder CO2-freie Energie verbraucht wird –, habe sie selbst sich verabschieden müssen: Weil es nicht oder nicht schnell genug funktioniere. „Es scheint leider im Wesen der Menschen zu stecken, dass man zwar,
um Kalorien zu sparen, fettreduzierte Chips isst, aber dann statt einer Handvoll gleich die ganze Tüte futtert.“
Also Verzicht und Schrumpfung? Führe nicht gerade zu Jubel. Und von einer echten Kreislaufwirtscha seien wir ebenso weit entfernt. Am Ende plädiert Kemfert für eine „vorsorgeorientierte Postwachstumsökonomie“ mit Elementen aus mehreren Konzepten. Ihre Vision: „Alle Produkte sind recycelbar. Es gibt ein Recht auf Reparatur. […] Umweltschäden und klimaschädliche Emissionen bekommen einen Preis. Die Einnahmen werden als Klimageld pro Kopf an alle Menschen ausgezahlt; das schafft einen sozialen Ausgleich und erleichtert den Übergang.“
Bi erkeit spricht aus dem Beitrag der Politologin Andrea Schöne, die über Ableismus schreibt: Das ist „die Bewertung von Menschen nach ihrer Leistungsfähigkeit [...]. Dabei wird insbesondere die Leistungsfähigkeit von behinderten Menschen infrage gestellt.“ Im Zusammenhang mit der Klimakrise ist das Thema noch kaum bekannt. Die Autorin, selbst kleinwüchsig und gehbehindert, erzählt vom „Schmerz, in Klimadebatten nicht beachtet zu werden“. Ihr Text macht das gut nachvollziehbar. Als Deutschland 2022 das Neun-Euro-Ticket einführte, hätten die Menschen die Züge so gestürmt, dass sie selbst „schon beim Einsteigen fast von nichtbehinderten Fahrgästen direkt wieder aus dem Zug gedrängt worden wäre“.
Generell müssten beeinträchtigte Menschen bei Klimamaßnahmen und Katastrophenplänen einbezogen werden, fordert Schöne. Was sonst passieren kann, zeigte die Flutkatastrophe im deutschen Ahrtal im Jahr 2021. Kurz davor warnte Schöne Behörden und Öffentlichkeit vor den besonderen Gefahren für beeinträchtigte Menschen, wurde aber weitgehend ignoriert. Erst nachdem zwölf Menschen in einer Behinderteneinrichtung nicht rechtzeitig evakuiert worden und ertrunken waren, kam man auf sie zurück. Was genau damals passierte, sei immer noch ungeklärt und werde es mangels Interesses auch bleiben, glaubt sie: „Es trifft mich als behinderten Menschen zutiefst, dass das Leben von Menschen mit Behinderung nichts wert zu sein scheint.“
Das Buch spannt also ein wirklich breites Panorama auf, es schaut aus verschiedensten Perspektiven auf unsere Gesellscha und warum sie nicht und nicht vom CO2 lassen kann. In Einzelfällen werden potenzielle Lösungen etwas zu einseitig angepriesen, etwa wenn Autorin Sara Weber zum Thema Arbeit ausschließlich die Vorteile einer Arbeitszeitverkürzung anpreist, die Frage des drängenden Personalmangels aber ausklammert. Doch auch dieses Kapitel gibt wichtige Denkanstöße.

Ist alles zum Verzweifeln? Manchmal fühlt es sich so an, schreibt Katharina van Bronswijk, die die Psychologists/Psychotherapists for Future mitbegründete. Sie benennt die Emotionen, die die Klimakrise auslösen kann: Abwehr und Angst, Wut, Schuld und Trauer, aber auch das Gefühl, nach Covid, Krieg, Inflation nicht noch eine Krise zu packen. Unter „Unlearn Krisenmüdigkeit“ spricht van Bronswijk von den positiven Gefühlen, die es zu gewinnen gibt. Etwa, wenn man in den eigenen sozialen Gruppen einen Anstoß gibt und gemeinsam aktiv wird. Laut Co-Herausgeber Manuel Kronenberg gehört das sowieso zum Wirkungsvollsten, das man überhaupt tun kann. GERLINDE PÖLSLER
Nahrung, Bevölkerungswachstum, Kriege: Auf den Spuren der drei wichtigsten Elemente durch die Welt und durch die Zeit
Hinter einem Buch mit dem Titel „Salze der Erde“ könnte man ein Lehrbuch der Chemie vermuten. Doch schon der Untertitel „Was drei chemische Elemente mit Kolonialismus, Klima und Welternährung zu tun haben“ gibt Aussicht auf eine spannende Erkenntnisreise durch Geschichte, Ökosysteme und Politik.
Obwohl das Buch tatsächlich nur von den drei chemischen Elementen Phosphor, Stickstoff und Kalium handelt, taucht man von Anfang an in eine großartige Lesereise ein, die uns die komplexen Zusammenhänge zwischen Sto reisläufen, landwirtscha licher Produktion, Bevölkerungswachstum und Kriegen aufzeigt.
Autorin Kerstin Hoppenhaus hat Biologie und Wissenscha sfilm studiert und bei Dokumentarserien für Arte und ARD Regie geführt. Das merkt man auch im Buch an den starken Bildern, die sie beim Lesen erzeugt, der reportageha en Erzählweise und solide recherchierten Fakten, die ein spannendes Lesevergnügen bieten. Der Inhalt erschließt sich auch ohne chemisches Fachwissen und die sparsam eingesetzten Fachbegriffe werden im Glossar erklärt.
Warum spielen gerade diese drei Nährstoffe in der Menschheitsgeschichte eine so große Rolle? Weil alle drei gemeinsam essenzielle Bestandteile für das Pflanzenwachstum sind. Die Ursprünge der Landwirtscha fin-
den sich in Überschwemmungsgebieten, wo Hochwässer regelmäßig neue Nährstoffe mit den Schlammmassen auf die Felder spülen. Sobald man aber in anderen Gebieten Ackerbau betreiben wollte, musste man aktiv die Bodenfruchtbarkeit herstellen. Das gelang durch Brandrodungen oder durch das Ausbringen von organischem Material wie Dung von Tieren und Menschen. Doch die auf diese Weise eingebrachten Nährstoffmengen waren zu wenig, um eine wachsende Bevölkerung zu ernähren.
Hoppenhaus führt durch die Geschichte dieser Entwicklungen; erst im 19. Jahrhundert erkannte die als Wissenscha au ommende Chemie diese drei für die Produktivität entscheidenden Elemente. Damit begann die Jagd nach den wertvollen Stoffen, die vor allem in den Kolonien zu finden waren. Guano – die Exkremente von Seevögeln –, aber auch Phosphor und Kalium aus dem Bergbau wurden und werden ausgebeutet, bis diese Quellen versiegen und zerstörte Landscha en zurückbleiben. Auch in der Kriegstechnik waren die drei Element sehr begehrt, da deren chemische Energie nicht nur für Pflanzen, sondern auch für Sprengstoffe ein wesentlicher Bestandteil sind.
Gerade das Interesse von Staaten an Aufrüstung während des Ersten Weltkriegs trieb die Forschung zur Stickstoffgewinnung voran. Unsere Lu besteht zwar

Kerstin Hoppenhaus: Die Salze der Erde. Hanser, 336 S., € 26,80
zu 78 Prozent aus diesem Element, doch diese chemische Bindung ist überaus stabil und damit für uns nicht so einfach nutzbar. Erst mit dem energieaufwändigen Verfahren, das Fritz Haber erfand und Carl Bosch in der Praxis realisierte, war Stickstoff massenha verfügbar. Brot aus der Lu , hieß die Botscha , wobei in den Kriegsjahren vielmehr Sprengstoff aus der Lu Vorrang hatte. Die Synthese von Ammoniak aus Lu und Wasserstoff war Grundlage für die sogenannte Grüne Revolution in der Landwirtscha , durch die die globale Nahrungsmittelproduktion wesentlich gesteigert wurde.
Die Auswirkungen der weltweiten Stoffströme zeigen, wie kurzsichtig wir fast überall auf der Erde mit diesen drei Rohstoffen umgehen – immer noch. Treffend schreibt Hoppenhaus: „Nichts auf der Erde bleibt da, wo man es hintut. Und nichts ist jemals weg. Sondern nur woanders.“
Im letzten Teil des Buchs wir sie einen Blick auf die Erde als ein selbstregulierendes Gefüge aus Wechselwirkungen und Rückkopplungen. Dabei grei sie die einst als esoterischer Nonsens kritisierte GaiaHypothese von James Lovelock auf und verortet sie als den Beginn der Erdsystemwissenscha en. Ein überaus erkenntnisreiches Buch, das auf atomarem Niveau beginnt und bis zu den planetaren Grenzen hinaufsteigt. PETER IWANIEWICZ
Be ina Balàka geißelt die haarsträubende Willkür unseres Umgangs mit der Natur und ihren Geschöpfen
W ie es kommt, dass das Fußballfeld zur Maßeinheit für Bodenversiegelung und Rodung wurde? Weil man sich so die Flächenausmaße besser vorstellen kann. Und doch bleibt es unvorstellbar, ganz gleich, wie o man die Zahlen schon gehört hat: Pro Tag wird in Österreich eine Fläche von 18 Fußballfeldern versiegelt, im amazonischen Regenwald pro Tag eine Fläche von 4340 Fußballfeldern abgeholzt. Wir fahren Schlitten mit der Natur, ihren Ressourcen und Geschöpfen und verhalten uns dabei so widersprüchlich, wie es nur die Spezies Mensch zusammenbringt: „Das Bedürfnis, Ordnung durch Bodenversiegelung herzustellen, geht einher mit dem komplementären Bedürfnis, der Asphaltwüste der Städte zu entfliehen und in möglichst unberührten Wäldern Lebensenergie aufzutanken“, schreibt Bettina Balàka in ihrem neuen Essayband mit dem grenzgenialen Titel „Vom Zähmen, Ausbeuten und Bestaunen“. Dabei handelt es sich, so der Untertitel, um „eine ungeordnete Kulturgeschichte der Natur“, vor allem aber um eine Bestandsaufnahme des ambivalenten Verhältnisses des Menschen zu dieser Natur.
Be ina Balàka ist eine Autorin mit ausgeprägten Interessen, die sich in den Themen und Motiven ihrer Romane und Essays niederschlagen: Naturwissenscha en und Geschichtsschreibung aus feminis-
tischer Sicht gehören dazu, ebenso TierMensch-Beziehungen oder die Biografien von Forscher:innen. Ihre neuen Essays passen bestens in dieses Spektrum. Sie sind weniger Anklage als das Aufzeigen der abstrusen Willkürherrscha , die die Menschheit sich über die Natur anmaßt, eine Herrscha , die in der von Balàka aufgezeigten Dichtheit deutlich macht, wie blind-gemütlich wir uns in Widersprüchen eingerichtet haben, die uns eigentlich zerreißen müssten: etwa dass wir „ebenso strikt wie willkürlich“ zwischen Haus- und Nutztieren unterscheiden und daraus Regeln für den Umgang mit diesen ableiten. Dass wir eine „verrückte, comicartige Welt“ geschaffen haben, in der Abermillionen „Kühe mit riesigen Eutern“ oder „Puten mit überdimensionierten Brustmuskeln“ leiden, oder dass wir Zootiere mit Psychopharmaka ruhigstellen, um die Illusion von artgerechter Haltung aufrechtzuerhalten.
Sehr eindrucksvoll zeigt Balàka auch auf, wie allgegenwärtig eine Rhetorik ist, die Tierschützer:innen als sentimental und unvernün ig verspottet – „als ob ausgerechnet Tierquälerei ein Zeichen von höherer Intelligenz, ethischer Überlegenheit und zivilisatorischem Fortschritt wäre“. Nicht minder eindrucksvoll sind umgekehrt ihre Erzählungen von Menschen, die sich von ihrer Einsicht in Tierleid und Naturzer-

Be ina Balàka: Vom Zähmen, Ausbeuten und Bestaunen. Haymon, 216 S., € 22,90
störung nachhaltig verändern ließen und gleichsam die Seiten wechselten: etwa der Schri steller Ignaz Franz Castelli (1781–1862), der von einem tierquälerischen Jungen zum Gründer des Wiener Tierschutzvereins wurde, oder Ric O’Barry, Fänger und Tiertrainer der fünf für die TV-Serie „Flipper“ eingesetzten Delfine, der eine radikale Kehrtwendung hin zum Gegner der Haltung von Meeressäugern durchmachte.
Auch viel Interessantes zur Historie der Mensch-Natur-Beziehung sowie zu moderner Forschung ist aus Balàkas Buch zu erfahren. Das reicht von den Veränderungen in der Pferdehaltung, die der Erfolgsroman „Black Beauty“ (1877) bewirkte, über aktuelle Erkenntnisse der Verhaltensbiologie, welche immer genauer nachweisen kann, „wie sehr wir uns in unseren angenehm herablassenden Vorstellungen vom Tier als gefühllosem Automat geirrt haben“, bis hin zu sehr anrührenden Porträts einzelner Tierindividuen. Darunter „Käpt’n Krebsi“, ein Landeinsiedlerkrebs, der 15 Jahre lang Balàkas Haustier war und dem es, obwohl er nicht als höheres Tier gilt, trotzdem gelang, sich seiner Besitzerfamilie in seinen Bedürfnissen „verständlich zu machen“. „Vom Zähmen, Ausbeuten und Bestaunen“ ist ein sehr erhellendes Buch, wie gemacht, um Verhaltensänderungen anzustoßen. JULIA KOSPACH

Von Architektur
zur Volkswirtscha
Richard Cocke weiß, wie Wien die Moderne hervorbrachte
Im Oktober 1956 eröffnete im US-Bundestaat Minnesota die Southdale Mall, 72 Läden unter einem Dach. Das moderne Einkaufszentrum war geboren, vier Jahre später gab es bereits 4500 davon. Da amerikanische Städte meist keinen historischen Stadtkern haben, wollte Victor Gruen (geboren 1903 in Wien) nicht nur einen kommerziellen Raum schaffen, sondern auch einen Ort der Geselligkeit, inklusive kultureller Angebote. Der Architekt der Southdale Mall verschmolz „seinen Wiener Sozialismus mit dem amerikanischen Kapitalismus“ und veränderte nicht nur das Einkaufen, sondern auch die städtische Geografie weltweit, so Richard Cockett in seinem Buch „Stadt der Ideen“.
Der Untertitel „Als Wien die moderne Welt erfand“ mag zugespitzt wirken, der britische Journalist (The Economist), des Lokalpatriotismus unverdächtig, meint es aber ernst. Und nach über 400 Seiten voller Beispiele für Innovationen made in Vienna tut man sich schwer, ihm zu widersprechen.
Das Panorama, das Cockett auff ächert, besteht aus drei Teilen: ein kürzerer Teil zu Wien um 1900, ein zweiter zu Aufstieg und Fall des Roten Wien in der Zwischenkriegszeit sowie ein abschließender Teil zum globalen Wirken von Wiener Migranten bis weit in die Nachkriegszeit hinein.
Das intellektuell fruchtbare Milieu Wiens vor 1934/38 ist schon seit Jahrzehnten ein Topos, und viele der Innovationsleistungen sind im Wesentlichen bekannt. Aber noch niemand hat all dies so umfassend und vor allem so konsistent zusammengefasst wie Cockett.
Cockett, qua Profession ein flotter Schreiber, aber auch ausgebildeter Historiker, liefert weit mehr als eine Aneinanderreihung von Kurzbiografien, die Werdegang und Wirken bedeutender Denker und Erfinder skizzieren. Er verfolgt durchgehend die Frage: Warum in Wien? Aufgrund welcher historischen Konstellationen konnte die Stadt zu einer globalen Ideenschmie-
Die Gesellscha Wiens war [...] erfrischend off en für Gruppen, die bis dahin weitgehend von der kulturellen und geistigen Produktion ausgeschlossen gewesen waren
RICHARD COCKETT

de werden? Dafür liefert er eine Reihe von miteinander vernetzten Antworten. Der intellektuelle Grundstein war das Wien des Fin de Siècle mit seiner umfassenden Idee der Bildung, wesentlich getragen vom assimilierten jüdischen Bürgertum. In den Salons und Kaffeehäusern wurde eine fruchtbare Interdisziplinarität praktiziert: Musik, Literatur und bildende Kunst waren dort genauso Thema wie die neuesten Ideen in Medizin, Biologie, Physik, Recht und Ökonomie. Der Austausch von Ideen funktionierte zwanglos. „Die Gesellscha Wiens gedieh eben, weil sie erfrischend offen für Gruppen war, die bis dahin weitgehend von der kulturellen und geistigen Produktion ausgeschlossen gewesen waren: Frauen, Juden und eine Vielzahl ethnischer Gruppen aus dem vielgestaltigen Habsburgerreich.“
Der Übergang zur Praxis gelang aber erst in der Zwischenkriegszeit, so Cockett. Gestützt auf neueste Erkenntnisse aus der Psychologie und in Wien entstehende Disziplinen wie der Konjunkturforschung und der empirischen Sozialforschung sollte die Gesellscha umgestaltet werden. Sozialer Wohnungsbau, Kleinkindpädagogik, Sexualerziehung und Frauenrechte wurden im Roten Wien propagiert und praktiziert.
Wien war bekanntlich schon seit Ende des 19. Jahrhunderts nicht nur ein Nährboden progressiver Ideen, sondern auch eine Hochburg des Antisemitismus. Der Austrofaschismus und vor allem die Nationalsozialisten ab 1938 verfolgten die liberalen und linken Wiener Köpfe gnadenlos, darunter sehr viele Menschen jüdischer Abstammung. Flucht und Exil oder Ermordung im KZ – dies zieht sich wie ein grausamer Refrain durch die biografischen Abrisse Cocketts. Von den Überlebenden kehrten nach 1945 nur die allerwenigsten zurück, Wien wurde intellektuell steril. Aber – und dies ist wohl der wichtigste Baustein in Cocketts Argumentation –die bahnbrechenden Wiener Ideen waren
längst in der Welt. Ideen, die gerade auch durch die profunden Krisenerfahrungen –Antisemitismus, Krieg, Totalitarismus und Vertreibung – geprägt waren. Auch wenn die Mehrzahl der von Cockett porträtierten Denker und Macher Männer sind, so bemüht er sich doch erfolgreich, den gewichtigen Anteil der Wienerinnen an dieser Melange aus Forschung und praxisbezogener Innovation zu benennen. Margarete Schütte-Lihotzky, die Erfinderin der modernen Einbauküche (erstmals 1924 im Wiener Gemeindebau), Edith Kramer, die „Mutter der Kunsttherapie“, oder die Sozialpsychologin Herta Herzog, die Pionierin der Marktforschung und Erfinderin der „Fokusgruppe“, um nur drei Wienerinnen zu nennen, deren Arbeiten globale Bedeutung erlangten.
Cocke fokussiert insbesondere auf den Einfluss von Wiener Ideen auf Kultur, Wirtscha und Gesellscha in den USA, etwa Hollywood (Fred Zinnemann, Billy Wilder), moderne Managementtheorien (Peter Drucker) und die modernistische Westküstenarchitektur Kaliforniens (Richard Neutra). Was die Wiener auszeichnete, sei die Fähigkeit des Transfers von Ideen und Methoden: etwa von Freuds Psychoanalyse hin zur Erforschung der unbewussten Wünsche des Konsumenten und der Begründung der PR (Edward Bernays), von der mathematischen Spieltheorie (John von Neumann) oder der aus der Biologie stammenden Systemtheorie (Ludwig von Bertalanffy) zum Prognostizieren von wirtscha lichem und politischem Verhalten im Kalten Krieg. Cocketts Paradebeispiel für den langfristigen globalen Impact Wiens ist freilich die Österreichische Schule der Volkswirtscha Die ökonomische Grundsatzdebatte zwischen Planwirtscha (Otto von Neurath) und Liberalismus (Ludwig von Mises und Friedrich Hayek) begann im Roten Wien. Von Mises und Hayek wurden nach 1945 zu den geistigen Vätern des Neoliberalismus.
OLIVER HOCHADEL
Die Historie der Araber von der vorislamischen Zeit bis heute erzählt zugleich eine Menge Globalgeschichte
Wer vom „Orient“ oder der „islamischen Welt“ spricht, der denkt meist entweder an „gewalttätige und enthemmte Verhältnisse“ oder an ein schönes „Morgenland“, schreibt Andreas Kaplony. „Aber ob nun schön oder schrecklich, in jedem Fall gilt ,der Orient‘ als rückständig und dient als Kontrastfolie, um sich eines selbstbestimmten, friedliebenden und kontrollierten – und gleichzeitig fremdbestimmten, getriebenen und unendlich banalen – Lebens in Westeuropa zu versichern.“ Diesen Projektionen will die „Geschichte der arabischen Welt“ mit Wissen kontern.
Zur Zeit ihrer größten Ausdehnung erstreckte sich die arabische Welt von Cordoba bis Buchara, zeitlich finden sich erste Spuren einer vermutlich arabischen Bevölkerung in mesopotamischer Keilschri aus dem dritten vorchristlichen Jahrtausend. Ein weites Feld also. Der Verlag trägt dem Rechnung: Anders als im bisherigen gleichnamigen Standardwerk von Ulrich Haarmann die Arbeit einem Autor anzuvertrauen, stellte Andreas Kaplony als Herausgeber ein 37-köpfiges Team internationaler Experten zusammen, um die fünf Zentralräume der arabischen Welt (Arabische Halbinsel, Syrien-Palästina, Irak, Ägypten und der Maghreb) in ihren fünf geschichtlichen Epochen (vorislamisch, spätantik-muslimische Epoche, Expansionszeit, Vormoderne, Globalisierung) zu beschreiben.
Verständlich, dass vieles gedrängt dargestellt ist. Der Fokus liegt auf der politischen Geschichte; kulturelle Aspekte können o nur gestrei werden, beschränken sich auf wissenschaliche Leistungen und die religiöse Entwicklung.
Dennoch fasziniert das Gesamtwerk in seiner Vielstimmigkeit, aus der einzelne Artikel brillant herausragen: Michael Macdonald befragt in sehr britischer, spielerischer Weise den Begriff „arabisch“. Nimmt die Arabische Halbinsel den Namen von ihren Bewohnern, oder werden vielmehr diese nach der geografischen Herkun benannt?
Ein Glanzstück ist Thomas Bauers Kapitel „Arabische Kultur als Teil der islamischen Kultur“. Er weist nach, dass die These von Stagnation und Dekadenz der arabischen Kultur ab dem zweiten Jahrtausend Produkt einer eurozentristischen Fortschrittsgläubigkeit ist – westliche Voreingenommenheit übersieht bedeutende Entwicklungslinien dieser Zeit. Zur gleichen Zeit gelangte im östlichsten Arabisch sprechenden Raum, im sogenannten Transoxanien – Usbekistan und Turkmenistan – die Kultur zu höchster Blüte. Als sich dort während der folgenden Jahrhunderte
das Persische als Hochsprache durchsetzte, bedeutete das keinen Niedergang der islamisch-arabischen Zivilisation: Eine der Errungenscha en der mittelasiatischen Periode war der enger gewordene Kontakt höfischer und priesterlicher Eliten. Der dadurch ausgelöste Prozess der Verschmelzung weltlich-literarischer und wissenscha lich-religiöser Kultur wirkte nun auf den Westen zurück und führte im Mamlukenreich zu einer regelrechten Bildungsexplosion: Neue Medresen (Schulen) entstanden, sie dienten weit über die theologische Ausbildung hinaus als „wissensfördernde Infrastruktur“. Noch erhaltene Bibliotheksinventare belegen eindrucksvoll die hohe Allgemeinbildung.
Weniger stichhaltig scheinen Bauers (allzu?) positive Ausführungen für die osmanische Zeit. Gerade
500 Jahre deutscher Bauernkrieg: Mehrere Bücher erzählen von Europas erstem großen Volksaufstand
Vor 500 Jahren endete der große deutsche Bauernkrieg. Heuer und im nächsten Jahr wird der Freiheitsbewegung und ihrer blutigen Niederlagen gedacht. Zum Jubiläum erscheinen Bücher, und Ausstellungen, darunter in Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen und Südtirol, sind bereits offen oder öffnen demnächst. Sie versuchen darzustellen, was wo passierte, und loten aus, was die Ursachen für diese bewegten Monate waren, als die alte feudale Ordnung wankte. Es ging vor einem halben Jahrtausend nicht nur um die Rücknahme ausbeuterischer Praktiken, sondern auch um Grundsätzliches: Erstmals wurden universelle Freiheitsrechte gefordert und eine allgemeine Gleichheit der Menschen postuliert. In großen Manifesten wurden kommunistische Utopien nach biblischem Vorbild entworfen: „Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann?“
chen sozialen Gruppen kamen die Rebellen? Wie weit verbündeten sich die Bauern mit dem Bürgertum in den damals au lühenden Städten und den Bergknappen? Welche Ziele verfolgten die Aufstände? Gerd Schwerhoff hat viele Jahre über die Frühe Neuzeit geforscht; sein Buch („Der Bauernkrieg“, C. H. Beck) fügt ereignisgeschichtliche Regionalstudien zum großen Panorama zusammen. Bezeichnenderweise fällt es ihm aber schwer, über die Widersprüchlichkeit der au egehrenden „Haufen“ eine einheitliche Deutung zu spannen.
Ob nun schön oder schrecklich, in jedem Fall gilt ,der Orient‘ als rückständig
ANDREAS KAPLONY
in diesem Punkt erweist es sich als Vorteil, dass sich Beiträge teilweise überschneiden und einander auch widersprechen: In einem späteren Artikel spricht Henning Sievert von der Rückständigkeit des Bildungswesens dieser Periode.
Bis heute geht von der arabischen Welt eine nicht zu leugnende Dynamik aus. Der fün e Teil des Buchs betrachtet die „Arabische Kultur als Teil der Globalkultur“ auch der Gegenwart. Da werden die Staatenbildung auf der Arabischen Halbinsel ebenso analysiert wie Einwanderer-Subkulturen in Europa, Süd- und Nordamerika. Nicht unerwähnt bleiben Phänomene wie der Islamische Staat und der internationale Terrorismus; erklärt werden sie aus ihren Wurzeln in der Kolonialzeit.
THOMAS LEITNER

Andreas Kaplony (Hg.): Geschichte der arabischen Welt.
C.H. Beck, 904 S., € 70,–
Dabei waren Bauernkriege keine deutsche Spezialität. Bauernaufstände gab es vom 14. bis ins 19. Jahrhundert im gesamten Habsburgerreich (wie Wolfgang Maderthaner in seinem kürzlich erschienenen Buch „Zeitenbrüche“ dargestellt hat), auch in Frankreich, England, Russland und Sizilien. Der deutsche Bauernkrieg um 1524/25 war aber der größte Volksaufstand in Europa vor der Französischen Revolution: Hunderttausende Menschen waren involviert.
Seinen Ausgang nahm er in Südwestdeutschland. Dort lösten im Juni 1524 Schikanen kleinere Aufstände aus, die sich schnell zu einem Flächenbrand entwickelten. Zunächst setzten die Bauern bei ihren Aktionen auf Einsicht durch die adeligen Herrscher, stimmten Kompromissen zu, vertrauten den Versprechungen der Verhandler. Aber innerhalb weniger Monate radikalisierten sich beide Seiten und verschär en die Gangart. Die Herrscher, ob evangelisch oder katholisch, mobilisierten Söldnerheere; dem Aufstand folgten spektakuläre Hinrichtungen, brutaler Terror und unbarmherzige Verfolgung. Im Mai 1525 endeten drei Entscheidungsschlachten im Elsaß, in Württemberg und Thüringen in Gemetzeln mit zehntausenden Toten. Der Funke des Au egehrens sprang spät auch nach Österreich über, in Tirol gab es ab Anfang Mai 1525 Widerstand unter dem visionären Bauernführer Michael Gaismair. Ende Mai 1525 fügten Bauern und Bergknappen einem Adelsheer bei Schladming eine schwere Niederlage zu; im ganzen Land Salzburg herrschte Revolution. Die Übersicht zu bewahren, ist nicht leicht: Wo gab es Unruhen und wo überall wurde gekämp ? Aus wel-
Leichter hat es da die flott geschriebene Einführung des Wissenscha sjournalisten Christian Pantle („Der Bauernkrieg“, Propyläen): Sie bietet keine neue Forschung, sondern hat „bloß“ den Anspruch, die vorhandene Literatur zusammenzufassen, das Geschehen auf die großen Ereignisse herunterzubrechen und die wichtigsten handelnden Personen in Porträts der Heerführer, Ideologen und adeligen Gegenspieler vorzustellen. Etwas anders geht es die australische Luther-Biografin Lyndal Roper mit ihrem Buch („Für die Freiheit“, S. Fischer) an, indem sie viele neue Fragen einführt: etwa nach der Rolle der Frauen, die auf den Höfen die Männer ersetzen mussten. Nicht verschlechterte wirtscha liche Umstände hätten die Bauern dazu gebracht, sich zu erheben – vielmehr habe Martin Luthers aufrüttelnde Botscha von der „Freiheit eines Christenmenschen“ in einer Epoche großer Veränderungen revolutionär gewirkt. Der neue Blick auf die Schöpfung und der Glaube an einen göttlichen Au rag, das Christentum in Brüderlichkeit zu leben, veränderte radikal die Mentalitäten: Es war also die Theologie der Bauern, die der angeblichen Gottgegebenheit der feudalen Herrscha ein Ende setzte.
ALFRED PFOSER


Christian Pantle: Der Bauernkrieg. Deutschlands großer Volksaufstand. Propyläen, 335 S., € 22,70
Lyndal Roper: Für die Freiheit. Der Bauernkrieg 1525. S. Fischer, 676 S., € 37,10
In der Graphic Novel „Der Götzendiener“ erzählt Comicstar Joann Sfar autobiografisch vom Zeichnen als Schlüssel zum Leben
Die Lust am Zeichnen, eher: die Gier danach, ist Joann Sfar auch nach einer über dreißigjährigen Karriere und rund 150 Comic-Alben noch nicht vergangen. Sein neues Album trägt den Titel „Der Götzendiener“ und ist – wie auch sein letztes Album „Die Synagoge“ – autobiografisch. Stellte der in Nizza aufgewachsene französische Comic-Star, Jahrgang 1971, in „Die Synagoge“ seine Beziehung zum Judentum, seinen Anwaltsvater und dessen erdrückende männliche Omnipräsenz ins Zentrum der Geschichte, ist in „Der Götzendiener“ Sfars abwesende Mutter der Dreh- und Angelpunkt, von dem aus er erzählt. Seine Mutter starb, als er knapp vier Jahre alt war. Ihr Tod wurde viele Jahre vor ihm verschwiegen. Es hieß, sie sei auf Reisen. Über sie gesprochen wurde nicht.
Bis ins Erwachsenenalter trug Joann Sfar stets ein Foto seiner Mutter bei sich. Für sein neues Album hat er es nachgezeichnet: Eine dunkelhaarige Schönheit ist darauf zu sehen. Ihr Gesicht drückt Missbilligung aus. Für ihren Sohn fühlte es sich an, als würde sie seine Entscheidungen stets infrage stellen; auch und vor allem seine unbändige Mal- und Zeichenbesessenheit und seinen dringlichen Wunsch, sich – buchstäblich – ständig Bilder von der Welt zu erschaffen. Als junger Mann erklärt ihm dazu ein Rabbiner: „Dieses Foto mit der gerunzel-
ten Stirn wird jedes Mal ‚Nein‘ sagen, wenn dich etwas glücklich macht … Genau deshalb sind Fotos auf jüdischen Gräbern verboten. Man soll die Erinnerung an einen Verstorbenen nicht erstarren lassen. Das wäre Götzenanbetung.“
Nur was tun, wenn man wie Joann Sfar einer ist, der das Zeichnen, das Erschaffen von Bildern braucht, um sich die Dinge des Lebens zu erschließen? Während gleichzeitig die eigene Religion lehrt, dass man kein Recht habe, Bilder zu machen, die die Welt darstellen? Vor allem, wenn man selbst von frühester Kindheit an im Zeichnen den Modus gefunden hat, alles unter Kontrolle zu halten? Nicht umsonst sagt ein gezeichnetes Selbstporträt von Sfar an einer Stelle im Comic: „Niemand stirbt ohne meine Erlaubnis.“ Denn in Zeichnungen ist alles möglich, sogar, sich zum Herrn über Leben und Tod zu machen. Zugleich ist das Zeichnen für ihn ein Dialog mit der verstorbenen Mutter, die Malerin war. Um diese und ähnliche Themen kreist „Der Götzendiener“. Sfar, der Philosophie studiert hat und im Gedankengebäude des Judentums erzogen wurde, ist der große Debattierer und Ideendiskutierer unter den Comiczeichnern. Man denke nur an seine vielteilige Erfolgscomicserie „Die Katze des Rabbiners“, in der eine sprechende Katze, die die Tora studiert hat, gern theo-

Joann Sfar:
Die Katze des Rabbiners. Sammelband 5.
Avant-Verlag, 168 S., € 30,90 (erscheint im November)

Joann Sfar: Der Götzendiener. Avant-Verlag, 200 S., € 30,90
logische Streitgespräche von der Art führt, wie sie das Judentum zur Vermittlung seiner Lehren kennt.
Was abstrakt klingt und große Fragen berührt, wird in Sfars Zeichnungen ganz konkret: Da geht es dann um den kleinen Joann, der lieber Actionfiguren zeichnet als hölzerne Gliederpuppen, weil sie „besser gebaut sind“. Da geht es um Zwiegespräche mit seinen Figuren, die ihn buchstäblich aus seinen Zeichnungen heraus anspringen. Es geht um Sex, Verführung und wie man sich gelegentlich ins Zeichnen flüchtet, statt zu leben. Es geht um Lehrer und Vorbilder, ums Draußen-Zeichnen und ums Malen mit den eigenen Kindern, um Erinnerungen und Durchbrüche und ums Finden eines eigenen Stils. Durch das Album geistern auch die Figuren anderer Zeichner, die für Sfar prägend waren.
Am Ende steht das Fazit: „Zeichnen, das ist das Leben.“ Aber wie man nach so langem Ringen endlich an den Punkt findet, an dem man sich das, was man längst als sein Ureigenstes erkannt hat, auch endlich erlaubt, das ist die Essenz dieser lebensprallen, farbenprächtigen Graphic Novel. Und wer Lust auf noch mehr von Joann Sfar hat: Ende November erscheint endlich auch Sammelband Nummer 5 von „Die Katze des Rabbiners“ in deutscher Übersetzung.
JULIA KOSPACH
Die Psychologin Tatjana Schnell und der „Zeit“-Journalist Kilian Trotier erforschen die große Frage nach dem „Wofür?“
Aus 26 Sinnquellen schöp der Mensch. Am Gemeinwohl orientierte Konzepte wie soziales Engagement, Naturverbundenheit oder Moral zählen ebenso dazu wie die eher selbstbezogenen Disziplinen Individualismus, Macht oder Freiheit. Aus der Metaphysik-Abteilung kommen Religiosität und Spiritualität dazu.
Zur Erkenntnis dieser mentalen Kraquellen ist Tatjana Schnell im Laufe der letzten 20 Jahre durch umfangreiche Untersuchungen gelangt. Die Psychologieprofessorin, die auch Religionswissenscha und evangelische Theologie studiert hat, lehrt und forscht an der Universität Innsbruck und an der MF Norwegian School of Theology, Religion and Society. Als Sachbuchautorin ist sie bereits mit „Psychologie des Lebenssinns“ (Springer 2020) in Erscheinung getreten.
Um aus ihrer Forschung eine Fundgrube für alle zu machen, hat sie sich mit dem ZeitRedakteur Kilian Trotier zusammengetan. Er hat das Projekt „ZEIT Sinn – Wofür leben wir?“ mitbegründet und leitet seit kurzem das ZEITmagazin online Vom ursprünglichen Wortsinn ausgehend – „eine Richtung nehmen, eine Fährte suchen“ – betrachten die Autor:innen die Wege der Menschen zu ihrem persönlichen „Wofür?“. Diese beschreiben sie mithilfe altbewährter psychologischer Modelle
etwa zur Selbstwirksamkeit oder zur Entwicklung unserer Lebensaufgaben; und anhand zahlreicher Fallbeispiele.
An Menschen, denen es besser ging, sobald sie ihren Sinn gefunden hatten, lernen wir unter anderem kennen: Maximilian, der nach dem Tod seiner Frau ein Jahr lang mit seinem Sohn im Campingwagen durch Frankreich tourte; Sebil Kekilli, die aus der Enge ihrer fürsorglichen Familie ausbrach, um als Schauspielerin zu reüssieren; Rufus, der einen radikalen Neustart wagte, nachdem sich sein Traumjob als Albtraum erwiesen hatte.
Hohen Stellenwert räumen die Autor:innen dem Sinn auch in Sachen Gesundheit ein. Zahlreiche Studien würden belegen, dass die Suche nach dem Sinn gesünder sei als die Suche nach dem Glück, die in eine „hedonische Tretmühle“ führen könne.
Eine kurze Kulturgeschichte des SinnBegriffs reicht von Aristoteles bis Camus. Lao-tse kommt darin nicht vor. „Der Sinn, der sich aussprechen lässt, ist nicht der ewige Sinn“, hatte der alte Meister vor ca. 2700 Jahren im „Tao-Te-King“, dem wohl ersten Buch über den Sinn, geschrieben. Trotier und Schnell hingegen benennen den Sinn sehr klar – manchmal so klar, dass die Wissensvermittlung zur direktiven Richtungsvermittlung zu werden droht. „In 4 Schritten zu einem sinnerfüllten Leben“

Tatjana Schnell, Kilian Trotier: Sinn finden. Warum es gut ist, das Leben zu hinterfragen. Ullstein, 304 S., € 25,70
verspricht die Website sinnmacher.eu, die die Autorin betreibt.
Zunächst sieht das nach einer sinnvollen Trennung aus: dort Ratgeber-Website; hier leicht zu lesendes Sachbuch, beides auf Basis fundierter Forschungsergebnisse. Doch immer wieder steht hier geschrieben, was man tun müsse, um den eigenen Sinn zu finden. Im letzten Kapitel mutieren die Autor:innen endgültig von neutralen Berichterstattern aus der Welt der Sinnforschung zu Ratgebern, die den richtigen Weg weisen. Als konkrete Schritte empfehlen sie „Gemeinsam losziehen“, „Eins nach dem anderen“ oder die Nutzung der eben entdeckten 26 Sinnquellen. Zumindest ist die Mission, die sie dabei vermitteln, keine alleinig anzustrebende Heilslehre, sondern nur die Methodik zur eigenen Wegfindung.
„Generativität“ führt die Hitparade der Sinnquellen an: „Das meint die Lebenshaltung, etwas von bleibendem Wert tun oder schaffen zu wollen.“ Hierin liegt wohl auch der Sinn eines Sachbuchs: Wissen weiterzugeben, das die Welt ein Stück bereichert. Allzu viel wurde zum Sinn noch nicht geforscht; selten wurde so systematisch und leicht lesbar darüber geschrieben. Insofern lässt sich dieses Buch eindeutig als sinnvoll sehen. Schnell und Trotier gelingt es, ein o benanntes, selten begriffenes Thema handhabbar zu machen. ANDREAS KREMLA
Sebastian Moll verknüp die Biografie
F rankfurt am Main spielt in der deutschen Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts eine besondere Rolle, und das keineswegs nur aufgrund der bekannten Hochhäuser. Vor allem, was den Städtebau betrifft, spiegeln sich hier Schicksal und Geschichte des ganzen Landes. In den 1920er-Jahren waren die Siedlungen des „Neuen Frankfurt“ unter Leitung des Planungsdezernenten Ernst May die Speerspitze der Wohnungsbau-Avantgarde. Für diese Siedlungen entwarf die Wiener Architektin Margarete Schütte-Lihotzky die berühmte „Frankfurter Küche“. Unter den Nazis folgten brave Familiensiedlungen mit Selbstversorgergärten, nach 1945 der energische Wiederau au. Büros für die Handelsmetropole, die Nordweststadt als Beton-Satellit der 1960er-Jahre, die Hausbesetzerszene im Westend, die verspielte Postmoderne der wohlhabenden 1980er-Jahre mit dem Museumsufer am Main als Aushängeschild einer kultivierten Metropole. All dies begleitet von gesellscha lichen Debatten, zuletzt jener um die zwischen Rekonstruktion, Touristen-Puppenstube und Vergangenheitsverklärung angesiedelte Neue Frankfurter Altstadt. Dabei betonte man in Frankfurt immer wieder die Liberalität der großbürgerlich-weltoffenen Stadt, wo 1848 in der Paulskirche die Demokratie erprobt wurde.
Diese verflochtene Historie aus Städtebau und Weltanschauung erzählt auch Sebastian Moll in seinem „Würfelhaus“, verknüp sie jedoch zusätzlich mit der eigenen Familiengeschichte. Das titelgebende Würfelhaus in seiner autobiografischen Familiengeschichte ist jenes in einer Siedlung am Stadtrand, in das die Eltern Anfang der 60er-Jahre zogen und in dem der Autor aufwuchs. Eine moderne Reihenhaussiedlung, im Wohnzimmer Sessel von Charles Eames und Regale von Dieter Rams. Weltoffen und wirtscha lich erfolgreich. Doch das stimmt nicht ganz, denn hinter der Fassade tun sich Brüche auf, die Moll erst nach dem Tod der
seiner Eltern in Frankfurt mit der Architekturgeschichte der Stadt
Eltern langsam erforschen wird: Der Vater zieht sich zunehmend in den Keller zurück, wo er sich mit dem Zweiten Weltkrieg beschä igt und das Foto seiner Elsässer Jugendliebe an der Wand hängt. Vor den Augen von Frau und Sohn beginnt er eine Aff äre mit seiner Assistentin. Die dadurch gedemütigte Mutter fühlt sich als Frankfurter Großstadtkind in der SpeckgürtelSpießigkeit isoliert und wird alkoholkrank.
All dem liegt, wie Moll in schleifenartigen Annäherungen erkundet, das Trauma der Kriegserfahrung zugrunde. Die Eltern, Jahrgang 1927 und 1930, sind zwar gerade noch zu jung, um Mitschuld auf sich zu laden, werden aber von Bombenangriffen und sinnlosem Flakhelfer-Aktionen im Innersten erschüttert. In der jungen Bundesrepublik, die, wie am Beispiel Frankfurt sichtbar, im Rausch des Au aus die Vergangenheit vergessen will, fehlen die Worte, um diese Erschütterung zu artikulieren. Der Soziologe Alexander Mitscherlich, der neben Klaus Theweleits „Männerphantasien“ den theoretische Referenzrahmen des Buchs abgibt, spricht von der „Unfähigkeit zu trauern“.
Biografien deutscher Kriegsgenerationen wie diese wurden o erzählt, doch durch die Parallelmontage der Familiengeschichte mit Stadt und Architektur eröffnet Moll neue Dimensionen, ohne in einfache Symboliken und Gleichsetzungen zu verfallen. Frankfurt als Schauplatz der Aufarbeitung und Verdrängung der Nazi-Zeit erlaubt ihm Deutungsversuche und suggeriert mögliche Antworten, die die inzwischen verstorbenen Eltern ihm nicht mehr geben können.
Dass die Wiederbegegnung mit dem Elternhaus, ebenfalls ein sattsam bekannter Topos der Literatur, hier einmal nicht auf der Achse „Großstadt versus Dorf“ verhandelt wird, sondern die Heimat selbst eine Großstadt ist, ist eine willkommene Abwechslung, dabei erzählt Moll verständlich und konzise die Architekturdebatten der Stadt und der einzelnen historisch aufgeladenen Orte in ihr, während er Spazier-
Der unterdrückte Zorn darüber, nach einer Jugend des Drills und der Erniedrigungen um den Lohn der Weltherrscha betrogen worden zu sein, bricht sich [...] nicht selten in der Familie Bahn
SEBASTIAN MOLL

Sebastian Moll: Das Würfelhaus.
Mein Vater und die Architektur der Verdrängung. Insel, 207 S., € 24,70
gänge in seiner alten Heimat unternimmt. Für ihn, der seit Jahren in New York lebt, wird die Wiederannäherung an Frankfurt und an das Würfelhaus seiner Kindheit und Jugend auch zu einer Beschä igung mit der Frage nach der eigenen deutschen Kollektivschuld, die er durch journalistische Interviews mit jüdischen Emigranten in New York und Therapiesitzungen abzugleichen versucht – typisch New York, aber weitgehend erfolglos, wie er selbst zugibt.
Dieser journalistische Hintergrund des Autors macht sich zwar an manchen Stellen mit etwas zu phrasenha en Routine-Formulierungen bemerkbar („In den 70er und 80er Jahren etablierte sich das East Village dann endgültig als Biotop der Boheme, als Nährboden für die amerikanische Avantgarde“), und die Eltern als Hauptprotagonisten geraten manchmal etwas zu lange aus dem Blickfeld. Doch die ruhige Erzählweise gibt die Erzählstränge nie aus der Hand.
Die schlaglichtha en biografischen Erinnerungen sind eindringlich und manchmal fast unerträglich – etwa wenn der Vater den zwöl ährigen Sohn auffordert, den BH seiner Geliebten zu öffnen, während die Mutter im Türrahmen steht und zuschaut. Ist dieser Sadismus, fragt sich Moll, auch ein Resultat der Erfahrung als adoleszenter Soldat in den letzten Monaten der Nazi-Kriegsmaschine? Vermutlich ja: „Der unterdrückte Zorn darüber, nach einer Jugend des Drills und der Erniedrigungen um den Lohn der Weltherrscha betrogen worden zu sein, bricht sich dann jedoch nicht selten in der Familie Bahn.“ Vieles bleibt jedoch bis zum Schluss offen, und die Frage, wer Vater Heinz wirklich war, bleibt unbeantwortet. „Beinahe alles, was meinen Vater angeht, kommt aus einer Entfernung zu mir und verharrt in ihr. Er bleibt mir unscharf.“ Doch manchmal, wenn die Menschen stumm bleiben, können Architektur und Stadt, in denen Geschichte und Geschichten gespeichert sind, Antworten geben.
MAIK NOVOTNY

Motivation für Führungskräfte, Mitarbeiter und Stakeholder
Was Sie vom Spitzensport lernen können

»Klare Visionen, Ziele und starke Motivation sind der Fahrplan zum Erfolg.«
Theri Hornich
Eishockey-Expertin, Trainerin, Psychologin und Autorin

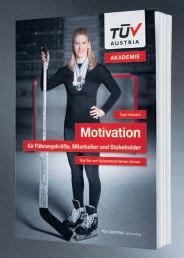
Dr. Jean Milburn ist Sexualtherapeutin. Ihr Witz ist trocken, ihre Sprache, wenn nötig, explizit. Für ihren pubertierenden Sohn Otis ist ihre professionelle Unverblümtheit Problem und Inspiration zugleich.
Die mit „Akte X“ berühmt gewordene amerikanisch-britische Schauspielerin Gillian Anderson verkörpert Dr. Milburn in der Netflix-Serie „Sex Education“ ebenso herzlich wie gnadenlos und immer glaubwürdig. Als Vorbereitung für die Rolle habe sie das Buch „My Secret Garden“ von Nancy Friday gelesen. Dabei sei die Neugier erwacht, was sich seither verändert hat, berichtet Anderson im Vorwort von „Want“.
1973 erschienen, stellte Fridays Sammlung sexueller Fantasien von Frauen einen Tabubruch dar. In Irland wurde das Buch verboten, weltweit avancierte es zu einem Meilenstein der Frauenbewegung. 50 Jahre später ist es ein cleverer Schachzug Andersons und des Bloomsbury Verlags, auf Personalisierung zu setzen: Gillian Andersons Name, ihr Gesicht, ihr Image und Charisma tragen das „Dear Gillian Project“. Dass dies Aufmerksamkeit und Verkaufszahlen steigern soll, kann man bekritteln. Muss man aber nicht. Schließlich gelingt es so, den Stimmen unbekannter Frauen Gehör zu verschaffen.
Fans von Gillian Anderson kommen mit „Want“, das zum New York Times-Bestseller wurde, jedenfalls auf ihre Rechnung. Im Vorwort und in den Einleitungen zu den 13 Kapiteln (mit Titeln wie „hart und bereit“, „angebetet werden“, „kink“ und „sicher und geborgen“) gibt die Schauspielerin wohlkalkuliert und -dosiert Einblicke in ihr Leben. Sie teilt Überlegungen zu Frausein, Sexualität und Gesellscha und erzählt Anekdoten. Etwa, wie sie für ihre Darstellung der als Eiserne Lady bekannten britischen Premierministerin Margaret Thatcher in „The Crown“ nicht nur den Emmy und den Golden Globe erhielt, sondern auch unerwartet erotische Fanfiction. Dass Anderson selbst anonym eine Fantasie für „Want“ beigesteuert hat, lädt eventuell zum Rätseln ein.
Als Kuratorin hat Anderson aus 1000 Seiten Material Briefe zur Veröffentlichung ausgesucht. Anders als 1973 wurden Fantasien mit in der Realität illegalen Handlungen und rassistische Texte aussortiert.
Den Frauen stand ein eigens vom Verlag eingerichtetes Internetportal für das anonyme Hochladen ihrer Texte zur Verfügung. Die Auswahl soll zeigen, wie vielfältig Frauen und ihre Fantasien sind. Am Ende jedes Beitrags finden sich soziobiografische Notizen zu Nationalität, ethnischem Hintergrund, Religion, Jahreseinkommen, sexueller Orientierung, Beziehungsstatus und Kindern. Auch wenn diese Angaben wohl nicht überprü wurden, die Autorinnen sind zweifellos international und divers. Und vermutlich sind unter ihnen viele Guardian-Leserinnen und Fans von Gillian Anderson.
Die Frauen beschreiben Sex im Büro, in der Straßenbahn oder auf einem Piratenschiff. Sex mit der Nachbarin und dem Schwager, mit tentakelbestückten Aliens oder dem eigenen Ich. Ihre Texte sind ebenso voll von Klischees wie von Überraschungen. Sie klingen vertraut, kurios, berührend. Manche Frauen erzählen (mehr oder weniger) erotische Geschichten, manche – und das sind die interessanteren Stellen – auch aus ihrem realen Leben. Einige reflektieren die Herausforderung, ihre Fantasien in Worte zu fassen, zu teilen oder auch sich selbst einzugestehen.
Sexuelle Fantasien: Die Schauspielerin Gillian Anderson hat Frauen eingeladen, ihr „das zu erzählen, was sie sonst verschweigen“
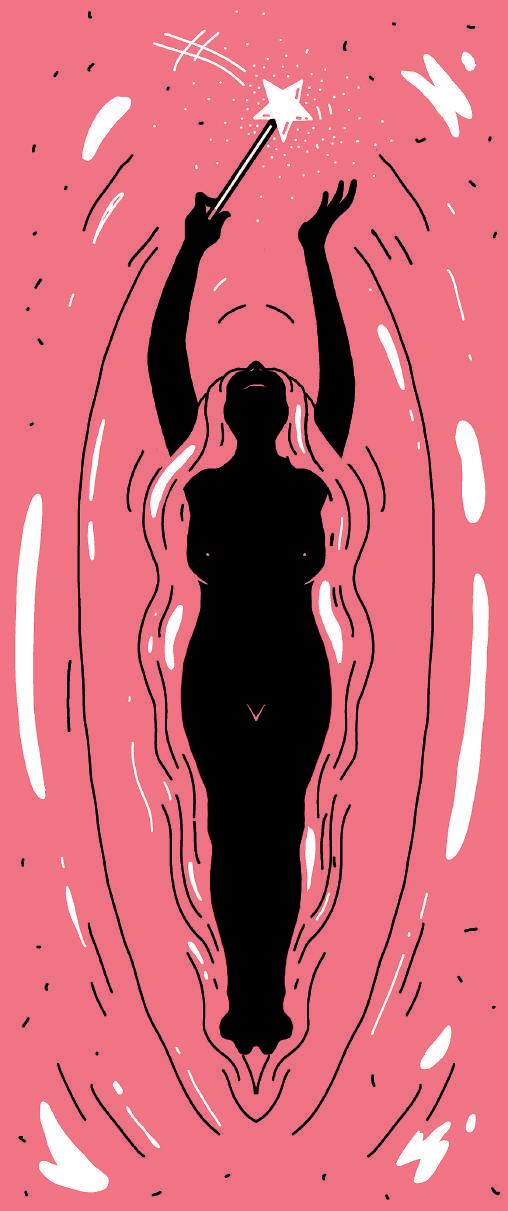

Immer wieder geht es um Scham. Frauen schämen sich für ihr Alter, ihre Brüste, ihre Schwangerscha sstreifen. Weil sie „zu wenig“ sexuelle Erfahrung haben. Weil sie „zu o “ Sex wollen. Manche Texte könnten aus den 1970erJahren stammen, in anderen zeigt die Scham ein neues Gesicht. Dann geht es darum, ob die Fantasie vielleicht zu unoriginell, zu konservativ, „zu hetero“ sei. Einige Frauen stellen die bange Frage, warum sie als Feministinnen von Männern fantasieren, die sie demütigen und missbrauchen. Immer wieder wird Einvernehmlichkeit und Zustimmung beschworen, unabhängig davon, mit wem sich die Autorinnen Sex vorstellen und mit wie vielen. So findet sich etwa mitten in einer Gruppensex-Fantasie der Hinweis: „Sie genießen es ebenfalls, natürlich. Das ist mir wahnsinnig wichtig. Wir alle genießen es, niemand liefert eine Performance ab, niemand täuscht Lustgeräusche vor.“
In sozialen Medien werden Fantasien im Sekundenrhythmus angespült. Die Pornoindustrie ist milliardenschwer. Nach dem Bestseller „Fi y Shades of Grey“ boomt das von Autorinnen wie Colleen Hoover dominierte Spicy-Romance-Genre, also gerne auf Tiktok besprochene Liebesromane mit expliziten Sexszenen, geschrieben von Frauen für die Zielgruppe junger Frauen.
Der Garten ist längst nicht mehr geheim. Aber bunt ist er. „Want“ zeigt, wie vielfältig die Geschichten sind, die Frauen sich ausdenken, um Orgasmen zu erleben, dem Alltag zu entfliehen, sich begehrt und mächtig zu erleben, Trost zu finden, Spaß zu haben oder sich geborgen zu fühlen. Im allerkürzesten Text heißt es: „In meiner Fantasie liebt mich ein Mann für das, was mich ausmacht.“
„In der Welt der Imagination gibt es keinen Orgasm Gap“, spielt Anderson auf die Ergebnisse zahlreicher Studien an, dass Frauen in realen heterosexuellen Beziehungen viel seltener einen Orgasmus erleben als ihre Partner. Außerdem seien in Fantasien – anders als im Beziehungsalltag – keine Kompromisse nötig. Sie sind sichere Räume, in denen Grenzen überschritten werden können.
Dabei bleibt es wichtig, klar zu unterscheiden zwischen lustvollen Vorstellungen und tatsächlichen Wünschen für das echte (Sex-)Leben. Oder, wie eine Frau über ihre Fantasie schreibt: „Vor allem geht es um den Zahnarztstuhl, an dem ich festgeschnallt bin. Ich wüsste nicht, was das bedeutet, außerdem wäre ich superentsetzt, wenn mein Zahnarzt versuchen würde, mich zu ficken.“
Gillian Anderson: Want. Sexuelle Fantasien der Frauen im 21. Jahrhundert. dtv, 384 S., € 25,70
„Want“ ist keine wissenscha liche Studie und kein Ratgeber, nicht Pornografie und nicht Literatur. Gillian Anderson gibt am Beginn jedes Kapitels die charmante Moderatorin. Doch keine Psychologin, Soziologin oder Sexualwissenscha lerin hil , die Texte in einen größeren Kontext einzuordnen. Das Wort gehört den Expertinnen in eigener Sache. Beim Lesen wird das vermutlich o unbewusste Ringen der Frauen um eine eigene Sprache deutlich. Ist die Fantasie tatsächlich ein Land ohne Grenzen? Oder sind Gedanken nur in alten Liedtexten frei? Kann man im Patriarchat nicht-patriarchal geprägt schreiben oder Sex haben? Sexualität ist politisch. Macht und Ohnmacht bleiben auch zwischen den rosa Buchdeckeln gesellscha liche Tatsachen. FELICE GALLÉ
Scharfsinnig und unglaublich lustig: Die Graphic Novel „Das Orakel spricht“ über Selbstoptimierung, Influencer und Todesangst
W as sind sie zu beneiden, die Gürteltiere, Ponys, Seepocken und all die anderen tierischen und pflanzlichen Lebewesen auf diesem Planeten, die im Gegensatz zu uns Menschen nicht wissen, dass ihnen der Tod ins Haus steht! Da kann man als Gürteltier leicht „einfach umherschweifen, chillen“ und „das Leben nehmen, wie es kommt“, während wir mit unserem „bizarr überentwickelten Gehirn“ die abstrusesten Manöver entfesseln müssen, um irgendwie mit „der sicken Erkenntnis“ zurande zu kommen, dass es eines Tages „unvermeidlich, unkontrollierbar, unvorhersehbar“ ans Sterben gehen wird. Indessen wir hadern, prosten einander bestens gelaunte Gürteltiere mit Sektgläsern zu und singen dazu „Living la vida loca“.
So stellt sich die Szenerie textlich und zeichnerisch in Liv Strömquists neuester Graphic Novel „Das Orakel spricht“ dar. Deren Kernthema: wie belämmert wir Menschen die Sinnsuche im Wissen um unsere eigene Sterblichkeit gern anlegen. Verdrängung, religiöser Wahn, Aberglaube, Wellness-, Schönheits- und Spaßkultur sowie Influencertum und Social Media sind die Bereiche, die Strömquist nach Ratschlägen für ein besseres Leben durchforstet hat.
Skurril und widersprüchlich wird es da schnell einmal, und die vielfach preisgekrönte schwedische Zeichnerin, die als
„Sexualaufklärerin, Ideenhistorikerin, Normkritikerin und Kulturvermittlerin“ in Personalunion gilt, beweist einmal mehr scharfen Blick und frechen Zeichenstrich. Dazu ist Strömquist auch in ihrem siebten Buch über die Skurrilitäten der Conditia humana extrem lustig. Bild für Bild komponiert sie herrlich witzige, bunte Duette zwischen Text- und Bildebene, wobei ihre zeichnerischen Ideen mindestens so gut sind wie ihre charakteristischen Figurendarstellungen und ihre Sprechblasentexte.
Strömquist durchmisst Jahrhunderte, lässt Philosophen, Psychologinnen und Soziologen zu Wort kommen, macht in der Antike beim Orakel von Delphi und der Göttin Fortuna genauso Station wie im 14. Jahrhundert bei der Heiligen Katharina von Siena, die überzeugt war, mit Gott einen Deal eingehen zu können. Von Katharinas „mega seltsamem Gottesbild“ wechselt Strömquist locker zur Selfcare-Epidemie des 21. Jahrhunderts und zu unserem Zwang, alles kontrollieren, vorhersehen und uns zur Verfügung halten zu wollen – Welt, Gesundheit, Glück, Schönheit, Liebe. Doch warum flieht uns das, was wir begehren, so leicht?
Guter Rat ist teuer. Womit wir bei der stets wachsenden und an raren Figuren reichen Gruppe der Lebens-, Liebes- und Gesundheitsberater:innen angelangt wären, denen Strömquist besonders viel Raum

gibt. Ob’s der US-Promi-Astrologe Carroll Righter (1900–1988) ist, der Hübschund Glücklichsein als die zwei Hauptanweisungen der Sterne an uns alle propagierte und engster Berater von Nancy und Ronald Reagan war, oder der Manosphere-Youtuber Rollo Tomassi, dessen Ehe-, Sex- und Aufriss-Tipps ihn mehr als ängstlichen Kontrollfreak denn als coolen Auskenner entlarven. Oder die US-Star-Instagrammerin und Psychologin Nicole LePera, die auf SelfHealing spezialisiert ist und den Traumabegriff kurzerhand auch auf Alltagserlebnisse ausgeweitet hat, um die dadurch rapid anschwellende Gruppe der Traumatisierten mit ihren Tipps (Höre auf das Kind in dir!) zu versorgen.
Sie alle kriegen bei Strömquist ordentlich ihr Fett ab, weil sie vorgaukeln, über Patentlösungen für den Umgang mit dem komplexen Chaos von Leben und Sterben zu verfügen. Was also tun? Strömquist hält es mit Humor, Au lärung und sagenha lustigen Darstellungen unserer verzweifelten Suche nach Sinnsti ung. Es ist nicht leicht, im Heute zu leben, weil man vor lauter freier Wahl ständig Stellung beziehen muss. Bei Strömquist klingt das dann etwa so: „Ich bin Halbdäne, glutenintolerant, teils intro- und teil extrovertiert, teils Charaktertyp ‚blau‘, Katzenmensch sowie ‚Sigma Male‘“. Sehr, sehr witzig! JULIA KOSPACH
„Colorful“: Die New Yorker Modematrone und Innenarchitektin Iris Apfel hat ein inspirierendes Vermächtnis hinterlassen
Ü
ber 80 Jahre lange pflegte sie ihren Look, einen Mix aus exzentrischen Vintage-Teilen und Haute Couture, für sich und vielleicht die New Yorker Society-Szene. Im Jahr 2005 kannte dann nahezu die ganze Welt Iris Apfel. Was war passiert? Mehr oder weniger aus einer Verlegenheit hatte ein Modekurator am Metropolitan Museum of Art eine Ausstellung für seine gute Bekannte Apfel organisiert, weil ihm eine andere Schau ausgefallen war. Er besuchte die exzentrische Frau zuhause in ihrer Parc-Avenue-Wohnung und stieß auf ein bemerkenswertes Aufgebot an Koffern, Regalen und Schränken, in denen wie in Konserven Chanel-Blusen, liturgische Gewänder, Federboas, Seidenmäntel, Flohmarktschätze und Tabletts voller Modeschmuck gebunkert waren.
Die weit gereiste Iris hatte gemeinsam mit ihrem Mann Carl im Laufe von mehr als einem halben Jahrhundert wahrscheinlich eine der größten Kleider-, Accessoires- und Modeschmucksammlungen New Yorks zusammengetragen. 2018 schrieb sie in „Stil ist keine Frage des Alters“, ihrem Debüt als Autorin, dass sie in einem früheren Leben wohl einmal Jägerin und Sammlerin gewesen sein musste. Ihre erste Ausstellung war von Erfolg gekrönt, sogar Designer wie Karl Lagerfeld oder Giorgio Armani schauten vorbei.
Ein halbes Jahr vor ihrem Tod begann Apfel mit dem Buch „Colorful“, das sie ihr persönliches Vermächtnis nannte und das 300 private Fotos zeigt. Darin geht es auch um die Suche nach dem Glück. Die schlanke Frau mit dem weißen Kurzhaarschnitt war umtriebig bis zum Schluss, sogar im Rollstuhl und über hundertjährig tauchte sie noch in Fernsehshows auf. Ihren unstillbaren Arbeitswillen begründete sie so: „Wenn ich zur Ruhe komme, werde ich depressiv.“ Sie sagte auch: „Shoppen macht mich glücklich.“ Bei ihr darf das aber nicht als bloßer Konsum verstanden werden: Sie shoppte so, wie Anna Netrebko Töne schmettert, hoch konzentriert und intuitiv.
Die New Yorker nannten Iris Apfel liebevoll Rara Aris, was lateinisch ist und so viel bedeutet wie „seltener Vogel“. Sie liebte Farben und kombinierte alles miteinander. Rund zehn wuchtige Armreifen klapperten an ihren schmächtigen Handgelenken. Eine bunte Brille mit Gläsern so groß wie die Reifen war ihr Signature Piece. Mode trug sie immer mit einer Spur Ironie. Sie war cool, das fiel auch Jüngeren auf. Zu Lebzeiten folgten ihr auf Instagram fast drei Millionen Menschen. Vielleicht auch, weil sie auf alle gängigen Moderegeln pfiff. Predigte doch Minimalistin Coco Chanel, bevor man auf die Straße trete, solle man in den Spiegel schauen und etwas weglassen oder ausziehen – für die französische De-
»Baby, du bist die Einzige hier, die noch ihr eigenes Gesicht hat
CARL APFEL
ZU SEINER FRAU
IRIS APFEL

Iris Apfel: Colorful. Welche Farbe hat das Glück? Prestel, 288 S., € 37,10
signerin war weniger mehr. Iris Apfel feierte das Gegenteil „More is more, and less is a bore“, war ihr Mantra, und sie riet: „Das Leben ist grau und dumpf genug, ziehen Sie sich ruhig bunt an.“
Die späte Mode-Influencerin wurde 102 Jahre alt und starb im März dieses Jahres in ihrem Zweitwohnsitz in Palm Springs. Sie hinterließ dort, ebenso wie in einem Lager und in der Wohnung ihrer Mutter, nahezu Tonnen an „Sachen“. Iris und Carl Apfel waren begütert, hatten sie doch 1950 ein überaus erfolgreiches Textilunternehmen gegründet und Anfang der 90er für eine beträchtliche Summe verkau . Zur erlauchten Kundscha zählten Greta Garbo, der Vatikan und das Weiße Haus. Apfel kannte keine Regeln, Individualität war immer ihr Ding, auch wenn es um das Alter und seine Spuren ging. Schönheitsoperationen lehnte sie ab. Einmal, als das Society-Paar ausging, schaute Carl sich um und meinte: „Baby, du bist die Einzige hier, die noch ihr eigenes Gesicht hat.“ Iris meinte, sie wolle nicht nach einem Eingriff schlimmer aussehen als davor. Sie kenne viele, die nach den OPs nun aussähen wie ein Picasso. Und man habe ihr schon als sehr junge Frau gesagt: Schön sei sie nicht – sie habe aber etwas viel Besseres, nämlich Stil. Und der wird niemals alt. NATHALIE GROSSSCHÄDL
Österreich über alles, wenn es nur will! Denn in der Küche bedeutet Österreich, über den Tellerrand hinauszusehen …
Unsere Küche ist bekanntlich ein politisches Vorbild an Integration und Internationalität im Nationalen; die Wiener Küche die einzige, die nach einer Stadt benannt ist, und die österreichische, selbst wo sie provinziell scheint, immer länderübergreifend. Die große Fanfare wird diesmal für ein Buch geblasen, das erst in diesem Herbst erschien und doch schon in die zweite Auflage gehen musste, weil das Thema derart aufgelegt ist: das Knödelbuch mit dem beziehungsreichen Titel Knödelreich hat bei mir einen ganz dicken Stein im Brett.
Seit Jahren trauere ich dem Wirtshaus Moar Sepp in Andrichsfurt nach, wo es nichts gab als die „Moar-Rein“, einen Sur- oder Schweinsbraten mit Kraut und Knödeln. Aber was für welche! Wer je dort war, wie die Falter-Crew in frühen Jahren, wird sie nie vergessen. Innviertler Knödel wären der Prüfstein für die Qualität dieses Buchs, dachte ich, und als ich es an der betreffenden Seite aufschlug, was sah ich? Gerti Fuchs, die legendäre Köchin des Moar Sepp, breitet ihre Küchengeheimnisse vor uns aus. Großartig, wie der Rest, der sich auf alte Kochbücher bezieht, sie aber dezent modernisiert. Diese Knödel bleiben nicht im Hals stecken!
Ein ebenfalls scheinbar schlichtes Buch kommt aus einem mir bis dato nicht bekannten Wirtshaus, dem Karlsteg im Tiroler Ginzling, dem Talschluss des Zillertals. Vater Josef Moser, ein gelernter Metzger, und die bei Wiener Starköchen in die Schule gegangene Tochter Franziska Moser haben ein einfach-raffiniertes Buch vorgelegt, das mich stellenweise heimatlich anmutet. Den Rehrücken haben auch wir immer mit Rotkraut und Schupfnudeln gemacht, zu Weihnachten. Blättert man um, bekommt man ein feines Rezept für Hirschburger samt eigenen, vintschgerloiden Burgerbrötchen. An Knödel-und Tascherlrezepten mangelt es ebenfalls nicht; Naturbeschreibungen und Folklore nimmt man in Kauf. Österreichische Tapas verspricht Abenteuerlicheres, als es dann bietet; aber sind nicht unsre Snacks, von Schinkenkipferl bis Blunzenradl, von Wurstsalat bis Indianerkrapfen mit Schlag, Abenteuer eigener Art? Die Kärntner Köchin Nini Nagele kochte jahrelang und preisgekrönt am Klagenfurter Benediktinermarkt, und auch sie unterschlägt nicht den Hinweis, dass „unsere“ Küche nicht österreichisch, sondern mitteleuropäisch ist.


Paul Ivić gehört ebenfalls zur nationalen Küchenfolklore; er ist „unser“ vegetarischer Spitzenkoch und legt mit Vegetarisch zum wiederholten Male ein Kochbuch vor, diesmal allerdings sein bestes. Es gibt nicht nur grundlegende Kochtipps zur vegetarischen Küche, Grundrezepte und unerlässliche Anleitungen, er geht auch systematisch die Gemüsearten durch und hat für jedes Grünzeug zahllose Variationen für elegante und schmackha e Rezepte. Allein bei den Salaten und Blattgemüsen freut man sich über sechs, sieben Möglichkeiten, Chicoree zuzubereiten, und so geht es weiter. Man weiß, dass man Salatherzen gut abbraten kann, sie aber mit grüner Gazpacho zu servieren ist eine gute Idee. Der wohlbekannte im Ganzen gebackene Blumenkohl ist mit Salzzitronencreme und Pommes natürlich etwas anderes, die gefüllte Chinakohlroulade oder die Kohlrabilasagne – man könnte so das ganze Buch durchgehen, es ist eine Fundgrube neuer Ideen.
Stevan Paul gehört zu meinen Lieblings-Kochbuch-Autoren. Er ist kein Spitzenkoch, sondern eben Autor, vielleicht sind seine Rezepte deswegen besonders praktikabel. Sein Green Street hat eine asiatische Schlagseite, was bei Streetfood nicht überrascht; allerdings finden sich auch Kässpätzle. Obwohl Paul aus dem Allgäu stammt, sorgen sowohl Käsemischung als auch Teig in den Augen eines Vorarlbergers für einen der seltenen Minuspunkte: Den Teig für Spätzle schlägt man niemals glatt, man vermischt ihn gerade ein wenig; und zur Käsemischung kann man nur sagen, Bergkäse und Gruyère stellen einen Pleonasmus dar. Korrekt wären: Rässkäse, Bergkäs, Sura Käs. Man kann nicht alles wissen. Sonst ist das Buch ganz prima.
Rachel de Thample ist Ernährungs- und Fermentierspezialistin und Autorin mehrerer Kochbücher. Ihr Winterfest hätte ein ganz aktuelles Thema für sich: Wintergemüse selbst anzubauen ist allerdings nicht ihr zentrales Thema, es geht darum, wie wir uns selbst winterfest machen. Essen kann dazu beitragen; die Rezepte wollen auf die Jahreszeit vorbereiten; sie sind schön, auch schön fotografiert, bringen viel Info übers Immunsystem und wie man es mit Nahrungsmitteln stärkt. Grenzt ans Heilende, ohne das Kulinarische zu vernachlässigen. Lust auf Ahorn-Miso-Blumenkohl aus dem Ofen, schwedischen Pizza-Salat oder gebackenen Kürbis mit Kimchi-Butter? Hier wird Ihnen geholfen.



Grabmer, Katharina Seiser u.a.: Knödelreich. Brandstä er, 272 S., !

Josef und Franziska Moser: Karlsteg. Das Gasthaus in den Tiroler Alpen. Brandstä er, 224 S., ! 36,–

Valerie Hammacher, Christine Nini Nagele: Österreichische Tapas. Ars Vivendi, 216

Lea Wilson und ihre Familie habe im walisischen Anglesey eine Meersalzfabrik eingerichtet, die preisgekröntes Salz (als „Halen Môn“ ursprungsgeschützt) für Gourmetrestaurants produziert. Salz ist nicht nur die unerlässliche Würze, wir sollten mehr Salzbewusstein entwickelt. Kein jodiertes Salz, vielmehr andere Arten, von denen Meersalz nur eine ist. Wie raffiniert damit in der Küche umgegangen werden kann, zeigt ihr Buch Meersalz – von Krautsalat mit Parmesan (!) über Jakobsmuscheln-Ceviche bis zum schottischen Karamellbonbon.
Asien ist und bleibt ein Schwerpunkt auf dem Kochbuchmarkt. Zu Recht. In Monica Lees So schmeckt Korea bleiben kaum Wünsche offen. Die in Los Angeles werkende Köchin bringt neben ihrer Spezialität Tofu vor allem überraschende KimchiVarianten und Suppen, naturgemäß auch Eintöpfe. Empfehlung!
Tim Andersons Leben ist Ramen, wie der Koch, Forscher und Autor in Ramen Forever überzeugend darlegt. Was sind überhaupt Ramen? „Sie haben Brühe? Sie haben Nudeln mit einem pH-Wert von unter 7? Dann haben Sie auch Ramen.“ Dass es nicht ganz so einfach ist, beweist er dann mit umfassender Basisinformation und an die 100 schlür aren Rezepten. Emiko Davies ist Foodbloggerin, lebt mittlerweile in der Toskana und bringt mit Gohan ein sehr schönes Buch über japanische Hausmannskost heraus, fast ohne Ramen, aber mit sehr guten Einführungen in japanische Grundzutaten und gut nachkochbaren Rezepten. Das Einfachste zum Schluss: Gennaro und sein Schüler. Gennaro Contaldo ist Liebhabern der einfachen italienischen Küche ein Begriff, seine Cucina Povera ist wirklich nützlich; ebenso sein neues, auf Eintöpfe, langsam zu kochende Pastasaucen und dergleichen konzentriertes Slow Cook Italiano. Zwar kennt man einiges, wie die Linsenpastasauce, aber das tut der Nützlichkeit des Buchs keinen Abbruch. Contaldo war ein Lehrer von Jamie Oliver, der als Kochbuchautor in Simply Jamie das Gegenteil dessen macht, was sein Lehrer lehrt: schnelle Küche für Ungeduldige, mit Minutenangaben und Nährstoffinhalten. Fünf Rezepte, wie man eine Hähnchenbrust zubereitet oder fünf, wie man Gnocchi präsentiert – auch das funktioniert und findet sein Publikum!
ARMIN THURNHER


Wien
1. Innere Stadt
A. Punkt | Fischerstiege 1–7
Aichinger Bernhard | Weihburgasse 16
ChickLit | Kleeblattgasse 7
Facultas im NIG | Universitätsstraße 7
FAKTory |Rathausstraße 21
Freytag & Berndt | Wallnerstraße 9 Frick | Graben 27
Herder | Wollzeile 33
Thalia Kuppitsch | Schottengasse 4
Leo & Co. | Lichtensteg 1
Leporello | Singerstraße 7
Morawa | Wollzeile 11
ÖBV | Schwarzenbergstraße 5
Schaden | Sonnenfelsgasse 4
Tyrolia | Stephansplatz 5
2. Leopoldstadt facultas.mbs an der WU | Welthandelsplatz 1/D2/1 Im Stuwerviertel | Stuwerstraße 42 Lhotzkys Literaturbuffet | Taborstraße 28 tiempo nuevo | Taborstraße 17a
3. Landstraße
Laaber | Landstraßer Hauptstraße 33 Thalia | Landstraßer Hauptstraße 2a/2b
4. Wieden
Jeller | Margaretenstraße 35 INTU.books | Wiedner Hauptstraße 13
5. Margareten
Buchinsel | Margaretenstraße 76
6. Mariahilf
Analog | Otto-Bauer-Gasse 6/1 Thalia | Mariahilfer Straße 99
7. Neubau
Posch | Lerchenfelder Straße 91 Walther König | Museumsplatz 2
8. Josefstadt
Bernhard Riedl | Alser Straße 39 Eckart | Josefstädter Straße 34 Lerchenfeld | Lerchenfelder Straße 50
9. Alsergrund
Buch-Aktuell | Spitalgasse 31
Facultas am Campus | Altes AKH | Alser Straße 4
Hartliebs Bücher | Porzellangasse 36 List | Porzellangsse 36 Löwenherz | Berggasse 8 Oechsli | Berggasse 27 Orlando | Liechtensteinstraße 17 Yellow | Garnisongasse 7
10. Favoriten
Facultas Dombuchhandlung | Favoritenstraße 115
12. Meidling
Frick | Schönbrunner Straße 261
13. Hietzing
Kral | Hietzinger Hauptstraße 22
14. Penzing
Morawa Auhof Center | Albert Schweitzer Gasse 6
15. Rudolfsheim-Fün aus Buchcafé Melange | Reindorfgasse 42 Buchkontor | Kriemhildplatz 1 Thalia Bahnhof CityWien West | Europaplatz 1
16. O akring Margaritella | Ottakringer Straße 109
17. Hernals
Book Point 17 | Kalvarienberggasse 30
18. Währing
Hartliebs Bücher | Währinger Straße 122
19. Döbling
Baumann | Gymnasiumstraße 58 Stöger-Leporello | Obkirchergasse 43 Thalia Q19 | Kreilplatz 1
20. Brigi enau Hartleben | Othmargasse 25
21. Floridsdorf
Bücher Am Spitz | Am Spitz 1
Kongregation der Schulbrüder | Anton-Böck-Gasse 20
22. Donaustadt
Freudensprung | Wagramer Straße 126
Seeseiten | Janis-Joplin-Promenade 6
Thalia | Donauzentrum | Wagramer Straße 94
23. Liesing
Lesezeit – Liesing | Breitenfurter
Straße 358
In Mauer | Gesslgasse 8A
Frick EKZ Riverside | Breitenfurter Straße 372
Niederösterreich
Korneuburg | Hauptplatz 20, 2100 Korneuburg
Am Hauptplatz | Hauptplatz 15, 2320
Schwechat
Morawa | SCS, Galerie 27, 2334 Vösendorf
Kral | Elisabethstraße 7, 2340 Mödling
Valthe | Wiener Gasse 3, 2380 Perchtoldsdorf
Riegler | Kirchengasse 26, 2460 Bruck an der Leitha
Bücher-Schütze | Pfarrgasse 8, 2500 Baden
Papeterie Rehor | Theodor-KörnerPlatz 6, 2630 Ternitz
Hikade | Herzog-Leopold-Straße 23, 2700 Wiener Neustadt
Thalia | Hauptplatz 6, 2700 Wr. Neustadt
Mitterbauer | Wiener Straße 10, 3002 Purkersdorf
Sydy’s | Wiener Straße 19, 3100 St. Pölten
Thalia | Kremser Gasse 12, 3100 St. Pölten
Fragner | Hauptplatz 12, 3250 Wieselburg
Schmidl | Obere Landstraße 5, 3500 Krems/Donau
Murth | Wiener Straße 1, 3550 Langenlois
Rosenkranz | Els 127, 3613 Els
Kargl | Hauptplatz 13–15, 3830 Waidhofen/Thaya
Spazierer | Budweiser Straße 3a, 3940 Schrems
Stark Buch | Bahnhofstr. 5, 3950 Gmünd
Oberösterreich
Fürstelberger | Landstraße 49, 4013 Linz
Alex | Hauptplatz 17, 4020 Linz
Buch plus | Südtiroler Str. 18, 4020 Linz
Bücher & Mehr | Klosterstraße 12, 4020 Linz
In der Freien Waldorfschule | Waltherstraße 17, 4020 Linz
Neugebauer | Landstraße 1, 4020 Linz
Thalia | Landstraße 41, 4020 Linz
Buchhandlung Auhof | Altenbergerstraße 40, 4045 Linz-Auhof
Wolfsgruber | Pfarrgasse 18, 4240 Freistadt
Wurzinger | Hauptplatz 7, 4240 Freistadt
Obereder | Markt 23, 4273 Unterweißenbach
Ennsthaler | Stadtplatz 26, 4400 Steyr Hartlauer | Stadtplatz 6, 4400 Steyr
Michael Lenk | Vogelweiderplatz 8, 4600 Wels
SKRIBO GmbH | Stadtplatz 34, 4600 Wels
Thalia | Schmidtgasse 27, 4600 Wels
Schachinger | Untere Stadtplatz 20, 4780 Schärding
Kochlibri | Theaterg. 16, 4810 Gmunden
Thalia | Pfarrgasse 11, 4820 Bad Ischl
Michael Neudorfer | Hinterstadt 21, 4840 Vöcklabruck
Schachtner | Stadtplatz 28, 4840 Vöcklabruck
Bücherwurm | Bahnhofstraße20, 4910 Ried
Thalia | Wohlmeyrgasse 4, 4910 Ried/Innkreis
Der Buchladen | Stadtplatz 15-17, 5230 Mattighofen
Salzburg
Bücher-Stierle | Kaig. 1, 5010 Salzburg
Motzko | Elisabethstr. 24, 5020 Salzburg
Facultas NAWI-Shop | Hellbrunner Straße 34, 5020 Salzburg
Morawa Höllrigl | Sigmund-Haffnergasse 10, 5020 Salzburg
Morawa SCA | Alpenstraße 107, 5020 Salzburg
Rupertusbuchhandlung | Dreifaltigkeitsgasse 12, 5020 Salzburg
Thalia | Europastraße 1, 5020 Salzburg
Morawa Shoppingcity Seiersberg | Top 2/2/12, 8055 Salzburg
Tirol
Haymon | Sparkassenplatz 4, 6020 Innsbruck
Studia | Innrain 52f, 6020 Innsbruck
Wagner’sche | Museumstraße 4, 6020 Innsbruck
Tyrolia | Maria-Theresien-Straße 15, 6020 Innsbruck
Tyrolia | DEZ Einkaufszentrum, 6020 Innsbruck
Riepenhausen | Langer Graben 1, 6060 Hall in Tirol
Riepenhausen | Andreas-Hofer-Straße 10, 6130 Schwaz
Steinbauer, EKZ Cyta | Cytastraße 1, 6167 Völs
Zangerl | Salzburger Straße 12, 6300 Wörgl Lippott | Unterer Stadtplatz 25, 6330 Kufstein
Tyrolia | Rathausstraße 1, 6460 Imst Tyrolia | Malserstraße 16, 6500 Landeck
Tyrolia | Rosengasse 3-5, 9900 Lienz
Vorarlberg
Ananas | Marktplatz 10, 6850 Dornbirn
Brunner | Marktstraße 33, 6850 Dornbirn Rapunzel | Bahnhofstraße 12, 6850 Dornbirn
Brunner | Rathausstraße 2, 6900 Bregenz Ländlebuch | Strabonstraße 2a, 6900 Bregenz
Brunner | Konsumstraße 36, 6973 Höchst Tyrolia | Josef-Wolf-Platz, 6700 Bludenz
Burgenland s’Lesekistl | Obere Hauptstraße 2, 7122 Gols
Pokorny | Schulgasse 9, 7400 Oberwart Wagner | Grazer Str. 22, 7551 Stegersbach
Steiermark
Bücherstube | Prokopigasse 16, 8010 Graz
ÖH Unibuchladen | Zinzendorfgasse 25, 8010 Graz
Morawa Moser | Am Eisernen Tor 1, 8010 Graz
büchersegler | Lendkai 31, 8020 Graz
Morawa | Lazarettgürtel 55, 8025 Graz
Morawa | Shopping Center Seiersberg, Top 2/2/12, 8055 Seiersberg
Plautz | Sparkassenplatz 2, 8200 Gleisdorf
Morawa | Wiener Straße 2, 8230 Hartberg
Buchner | Hauptstraße 13, 8280 Fürstenfeld
Morawa | Hauptplatz 8, 8330 Feldbach
Morawa | Hauptplatz 6, 8530 Deutschlandsberg
Morawa | Mittergasse 18, 8600 Bruck/ Muhr
Mayr | Kurort 50, 8623 Aflenz
Kerbiser | Wiener Straße 17, 8680 Mürzzuschlag
Morawa | Hauptplatz 14, 8700 Leoben
Morawa | Burggasse 10, 8750 Judenburg
Hinterschweiger | Anna Neumannstraße 43, 8850 Murau
Buch + Boot | Altausse 11, 8992 Altaussee
Kärnten
Heyn Johannes | Kramergasse 2, 9020 Klagenfurt
Morawa Kärntner Buchhandlung | Wiesbadener Straße 5, 9020 Klagenfurt
Besold | Hauptpl. 14, 9300 St. Veit/Glan
Morawa Kärntner Buchhandlung | Bahnhofsplatz 3, 9400 Wolfsberg
Morawa Kärntner Buchhandlung | 8.-Mai-Platz 3, 9500 Villach
Morawa Spittaler Stadtbuchhandlung | Tiroler Straße 12, 9800 Spittal am Millstätter See
Hubert Achleitner
Ewald Arenz
Dominik Barta
Jürgen Bauer
Bettina Baláka
Alex Beer
Clemens Berger
Birgit Birnbacher
Isabel Bogdan
Kirstin Breitenfellner
Josef Brainin
Alina Bronsky
Alex Capus
Didi Drobna
Nava Ebrahimi
Jens Eisel
Marc Elsberg
Mareike Fallwickl
Milena Michiko
Flašar
Franziska Gänsler
Arno Geiger
Daniel Glattauer
Lena Gorelik
Susanne Gregor
Andrea Grill
Sabine Gruber
Ulrike Haidacher
Nino Haratischwili
Petra Hartlieb
Romy Hausmann
Elke Heidenreich
Jakob Hein
Ilse Helbich
Monika Helfer
Judith Hermann
Andreas Hepp
Elias Hirschl
Judith Holofernes
Hauke Hückstädt
Helge-Ulrike Hyams
Elyas Jamalzadeh
Sebastian Janata
Julia Jost
Andreas Jungwirth
Nicola Kabel
Barbara Kadletz
Daniel Kehlmann
Gertraud Klemm
Florian Klenk
Doris Knecht
Gabriele Kögl
Wlada Kolosowa
Ste ffen Kopetzky
Martin Kordic
Jacqueline Kornmüller
Ute Krause
Daniela Krien
Susanne Kristek
Jarka Kubsova
Felix Kucher
Rolf Lappert
Micha Lewinsky
Jessica Lind Raimund Löw
Kristof Magnusson
Lilly Maier
Barbi Marković
Simone Meier
Dominika Meindl
Eva Menasse
Felix Mitterer
Margit Mössmer
Terézia Mora Bernhard Moshammer
Philipp Oehmke
Tanja Paar
Robert Palfrader
Susann Pásztor
Petra Pellini
Jürgen Pettinger
Khuê Phąm
Silvia Pistotnig
Ursula Poznanski
Teresa Präauer
Felicitas Prokopetz
Doron Rabinovici
Julya Rabinowich
Edgar Rai
Tanja Raich
Lena Raubaum
Eva Reisinger
Andreas Schäfer
David Schalko
Elke Schmitter
Gaea Schoeters
Sabine Scholl
Jasmin Schreiber
Claudia Schumacher
Johanna Sebauer
Robert Seethaler
Nicole Seifert
Stefan Slupetzky
Heinrich Steinfest
Dirk Stermann
Judith Taschler
Toxische Pommes
Caroline Wahl
Benedict Wells
Daniel Wisser
Iris Wolff
Die Wiener Buchhändlerin Petra Hartlieb im Gespräch mit Autorinnen und Autoren über das Lesen, das Schreiben und das Leben an sich.
Alle Folgen auf falter.at/buchpodcast und überall dort, wo Sie Podcasts hören.
