FALTER
Nr. 26a/24

Nr. 26a/24
Beackern. Ernähren. Schützen. Forschen.










Klimaschutz und Landwirtschaft. EIN WIDERSPRUCH?


Bauern-Porträts: Maria Vogt +++ Robert Brodnjak +++ Franz Uller +++ Alfred Grand +++ Zukun svisionen: Laborfleisch +++ Neue Gentechnik +++ Pioniere: Naturschützer Michael Succow +++ Pilzexpertin Irmgard Greilhuber +++ Auslandsreporter Bartholomäus Grill +++ Themen: Green Deal +++ Flächenverbrauch +++ Pestizide +++ Agri-PV +++ Tipps: Bücher +++ Dokumentarfilme
LILLY



















































































BEACKERN
4 Porträt: Die Biobäuerin
Maria Vogt
6 Essay: Sind Klimaschutz, Naturschutz und Landwirtscha vereinbar?
10 Die EU-Parlamentarier
Alexander Bernhuber (ÖVP) und Thomas Waitz (Grüne) im Streitgespräch über Pestizide
ERNÄHREN
14 Porträt: Der Nahversorger Robert Brodnjak 16 Ist Laborfleisch der nächste Heilsbringer?
20 Biolandwirtscha gilt als Flächenfresser.
Ein Zahlen-Check
22 Der deutsche Auslandsreporter Bartholomäus Grill hat ein persönliches Buch über den Strukturwandel in der Landwirtscha geschrieben. Ein Besuch
SCHÜTZEN
26 Porträt: Der Humus-Meister Franz Uller
28 Sieben Erfolge des Green Deal
32 Michael Succow ist ein Pionier des Bodenschutzes –und ein starker Kritiker intensiver Landwirtscha
34 Das Zukun smodell Agri-PV
FORSCHEN
36 Porträt: Der Bauer am Forschungshof, Alfred Grant
38 Wissenscha ler bejubeln die Deregulierung Neuer (grüner) Gentechnik, NGOs sind stark dagegen. Wer hat recht?
41 Die Pilzforscherin
Irmgard Greilhuber im Interview über Pilze als Nahrungsmi el der Zukun
44 Tipps: Bücher und Dokumentarfilme zu Landwirtscha
46 Ein Gespräch mit fünf Acker-Tieren









Sind Landwirtscha , Klimaschutz und Naturschutz wirklich Gegensätze? Eine Annährung.






Der Naturschützer Michael Succow hat riesige Flächen in Ostdeutschland für die Natur gesichert.
I ch verstehe nun endlich, wie es sich anfühlt, einen Oscar zu bekommen. Nein, ich bin nicht größenwahnsinnig geworden, sondern übe die Dankesrede. Kein Werk entsteht als Ego-Show, dieses He ist keine Ausnahme. Kaum vorzustellen, wie nackt die Seiten ohne die Porträts von Christopher Mavrič & Illustrationen von Lilly Graschl wären! Wie leer ohne die Texte von Anna Goldenberg, Ingrid Greisenegger, Peter Iwaniewicz, Eva Konzett, Benedikt Narodoslawsky, Gerlinde Pölsler & Martin Staudinger! Vom Layout von Barbara Blaha, Dirk Merbach & Raphael Moser ganz zu schweigen. Sie lesen und bestaunen auf den nächsten 43 Seiten so etwas wie ein Zukun sbild der Landwirtscha . Einer
IMPRESSUM



Bauernvertreter fürchten sich bereits lautstark vor Laborfleisch. Was kann das Produkt?






Kann Neue Gentechnik die Landwirtscha klimafitter machen? NGOs und Forschende streiten.
Landwirtscha , die sich um Natur- und Klimaschutz kümmert – mit teils ungewöhnlichen Mitteln wie AgriPV (S. 34) oder Laborfleisch (S.16). Sie lesen Geschichten von jenen, die versuchen, es anders zu machen oder sich über dieses Andere Gedanken machen (etwa Michael Succow auf S. 32 oder Bartholomäus Grill auf S. 22). Und die Auseinandersetzung kommt natürlich – in guter Falter-Manier – auch nicht zu kurz, etwa wenn es um den Einsatz von Pestiziden (S. 10) oder Gentechnik geht (S. 38) oder um die Frage, ob Bio-Landwirtscha klimafreundlicher ist (S. 20). Viel Vergnügen!
KATHARINA KROPSHOFER

Dieses He ist ein Unikat. Nicht nur, weil es sich ausschließlich Klima- und Umweltthemen widmet, sondern weil es die talentierte Grazer Grafikerin Lilly Graschl (bis auf vier schöne Ausnahmen) durchillustriert hat. Die Handmassage geht auf uns!
FALTER Zeitschri für Kultur und Politik. 47. Jahrgang. Aboservice: T: +43-1-536 60-928, E: service@falter.at, www.falter.at/abo Herausgeber: Armin Thurnher Medieninhaber: Falter Zeitschri en Gesellscha m.b.H., 1011 Wien, Marc-Aurel-Straße 9, T: +43-1-536 60-0, F: +43-1-536 60-912, E: wienzeit@falter.at Chefredakteure: Armin Thurnher, Florian Klenk Redaktion: Katharina Kropshofer, Benedikt Narodoslawsky Herstellung: Falter Verlagsgesellscha m.b.H. GRAFIK: Barbara Blaha, Dirk Merbach KORREKTUR: Helmut Gutbrunner, Daniel Jokesch Geschä sführung: Siegmar Schlager Finanz: Claudia Zeitler Marketing: Barbara Prem Leitung Sales: Ramona Metzler Abwicklung: Franz Kraßnitzer, Oliver Pissnig Vertrieb: PGV, St. Leonharder Straße 10, 5081 Anif Druck: Passauer Neue Presse Druck GmbH Erscheinungsort: Wien, Verlagspostamt 1011 Wien Homepage: www.falter.at. DVR-Nr. 047 69 86. Alle Rechte, auch die der Übernahme von Beiträgen nach § 44 Abs. 1 und 2 Urheberrechtsgesetz,



ZERSIEDELUNG
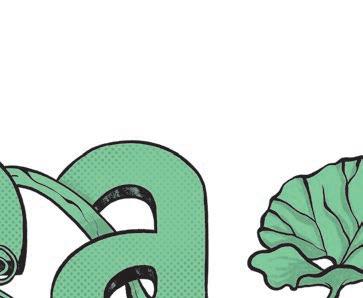


VIA CAMPESINA AUSTRIA
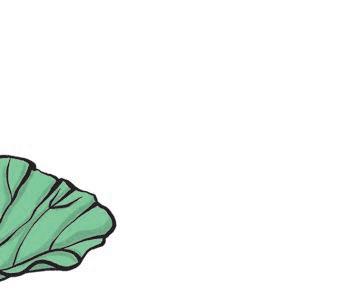
ist die Durchschnittsgröße eines land- oder forstwirtscha lichen Betriebs in Österreich. 154.953 Betriebe gab es 2020, die Tendenz geht aber hin zu weniger und größeren Höfen: Um elf Prozent hat die Anzahl im vergangenen Jahrzehnt abgenommen, die Fläche hingegen um 26 Prozent zugenommen.


ENTWALDUNG
Beinahe so groß wie das Burgenland ist das Gebiet, das in Österreich zwischen 1975 und 2020 zersiedelt worden ist. Das zeigt eine neue Studie, an der Forscher der Universität für Bodenkultur (BOKU) beteiligt waren. Unter Zersiedelung versteht man die Ausbreitung von bebauter, gering besiedelter Fläche in die Landscha – also beispielsweise Einkaufszentren oder Einfamilienhäuser. Somit fehlen immer mehr funktionsfähige Böden wie beispielsweise nachhaltig bewirtscha ete Äcker, die wiederum notwendig sind, um Umweltkatastrophen wie Hochwasser zu vermeiden. Der WWF empfahl in seinem Bodenreport 2023, fixe Siedlungsgrenzen einzuhalten und die Weiternutzung von Leerstand und Brachflächen finanziell zu fördern.
Die politische Vertretung für österreichische Bergbauern fehlte lange – bis sich Anfang 1974 einige engagierte Menschen zusammentaten, um die „Österreichische Berg- und Kleinbäuer_innen Vereinigung“, kurz ÖBV, zu gründen. Der Verein, der 2013 gemeinsam mit anderen Organisationen die länderübergreifende, weltweit aktive Via Campesina au aut, feiert heuer seinen 50. Geburtstag. Er setzt sich für eine sozial gerechte, agrarökologische und auch kleinteilige Landwirtscha ein. Gemeinsam mit Global 2000 und einigen anderen Organisationen erarbeiteten sie einen Zehn-Schritte-Plan für eine Landwirtscha der Zukun – und empfehlen beispielsweise zehn Prozent „Space for Nature“, um dem Biodiversitätsverlust entgegenzuwirken.
Auf jeden Einwohner Österreichs kommen rund 406 Bäume. Vier Millionen Hektar Wald gibt es in Österreich; er bedeckt 48 Prozent der Landesfläche, Tendenz steigend: Laut Waldbericht 2023 des Landwirtscha sministeriums kamen in den vergangenen zehn Jahren sechs Hektar Wald pro Tag hinzu. Eine solche Entwicklung ist in der ganzen EU zu beobachten – und nur auf den ersten Blick eine gute Nachricht. Denn der Grund dafür liegt darin, dass Anbauflächen schlicht verlagert werden. Laut einer Studie des Fachjournals Nature aus dem Jahr 2020 wurden zwischen den Jahren 1990 und 2014 in Brasilien, Argentinien, Indonesien und anderen Staaten 11,3 Millionen Hektar Wald gerodet, um Feldfrüchte für den Export in die EU anzubauen.
Die Aktivistin:
Maria Vogt, Wolkersdorf, Niederösterreich
Unweit der Stadtgrenze im Norden Wiens ist Maria Vogt zuhause. Vor 35 Jahren gründete sie ihren Bio-Betrieb hier im Weinviertel, hält Milchschafe, baut Gemüse, verschiedene Getreidesorten, Wein und ein „bissi Obst“ an, wie sie sagt. Immer mit dem Versuch, die Vielfalt, die möglich ist, weiterzuentwickeln. Um von dem kleinen Hof leben zu können, verkau sie Biolebensmi el direkt ab Hof. Seit drei Jahren führen ihr Sohn und ihr Neffe den Betrieb. Auch, damit Vogt sich noch mehr auf ihre politische Arbeit konzentrieren kann: Bei der Österreichischen Berg- und Kleinbäuerinnen-Bewegung Via Campesina etwa sitzt sie in der internationalen Frauenkommission. „Es geht darum, den ‚Care-Gedanken‘, also unbezahlte Arbeiten, die meist von Frauen geleistet werden, mit Land-
wirtscha zusammenzudenken.“ Vor fünf Jahren hat die Gruppe ein „Bäuerinnen-Manifest“ geschrieben. Und das reicht noch nicht: Sie hält Workshops ab, tri mit dem Bäuerinnen-Kabare „Miststücke“ auf, um die Realität auf den Höfen auf die Bühne zu bringen. Momentan unterstützt sie auch den Widerstand gegen die „Ostumfahrung“ bei Wiener Neustadt, durch die die Fischa-Auen bedroht sind. „Es ist mir wichtig, nicht nur am Acker zu stehen, sondern auch ein politisches Standbein zu haben.“ Die klassische Landwirtscha svertretung agiere zu o gegen die Interessen der Natur – und damit schlussendlich auch gegen die Interessen der Bauern und Bäuerinnen, also gesunde Lebensmi el zu erzeugen. Ihr Mantra: „Wir müssen lernen, uns als Teil der Natur zu verstehen.“ KK



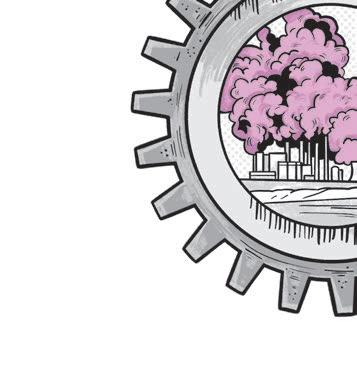
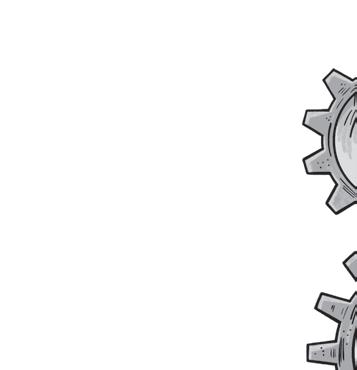

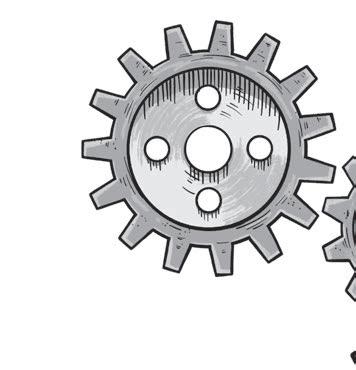
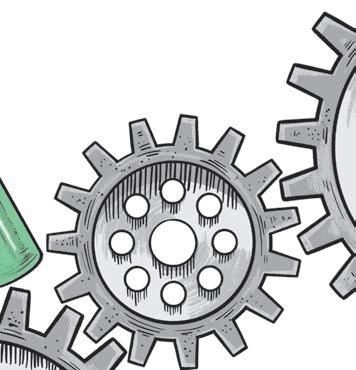





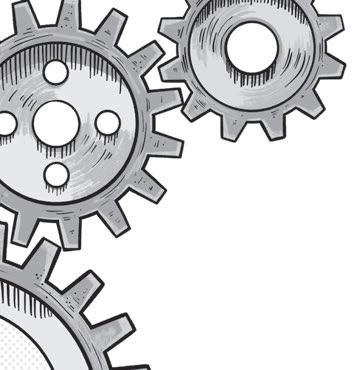
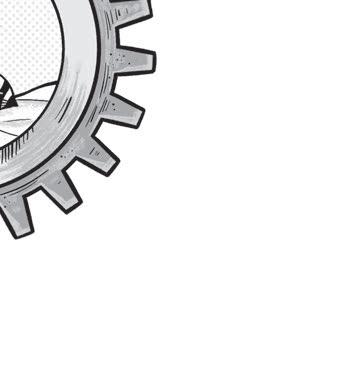
Intensive Landwirtscha , Artensterben und die Klimakrise beeinflussen sich gegenseitig und negativ. Aber sind alle Bauern wirklich Feinde der Natur? Und könnte es nicht anders sein? Eine Erkundung zwischen Zahlen, Protesten und Lösungen
ESSAY: KATHARINA KROPSHOFER
ILLUSTRATION: LILLY GRASCHL

ne leistungsfähiger, unsere Kulturen vielfältiger, unsere Gesellscha en zivilisierter gemacht, sondern ernähren mittlerweile ganze acht Milliarden Menschen. Tendenz steigend.
RReinhold Lopatka hat Angst um seine Bauern. „Ich will nicht, dass unsere Bauern jetzt Schmetterlingszählungen vornehmen müssen. Irgendwann ist einmal Schluss mit der Regulierung.“ Der EU-Spitzenkandidat der ÖVP machte in der letzten Elefantenrunde vor der EU-Wahl Anfang Juni klar (oder implizierte zumindest), wie er sich eine moderne Landwirtscha vorstellt: Weg von der Natur und ihren lästigen Viechern; stattdessen wohl schwere Maschinen, vereinheitlichte Parzellen, maximaler Ertrag. Und absolut keine Zeit, auch noch Schmetterlinge zu zählen. Welch lächerliche Vorstellung, sich den Bauern als interessierten Naturfreund vorzustellen!
Es regiert das Bild des Unterwerfers: Landwirte schaffen es seit der neolithischen Revolution vor 11.000 Jahren, dem Boden so viel Gemüse und Getreide wie möglich zu entlocken, Tiere zu züchten, die schwere Wägen ziehen, Eier, Milch, Fleisch und Wolle für den Menschen abzuwerfen. Und sie haben so nicht nur unsere Gehir-


Nur fehlt etwas Wesentliches in diesem Bild: Weniger naturnahe Flächen bedeuten auch weniger Schmetterlinge, Bienen und andere Insekten. Weniger Insekten heißt weniger Bestäubung. Und weniger Bestäubung führt zu Herausforderungen für die moderne Landwirtscha – und zu höheren Kosten für die einzelnen Landwirte und Konsumenten, die ohnehin schon über Geldsorgen jammern.
Vielleicht ist es ja so: Die Landwirte wollen gar keine Unterwerfer sein. Vor allem, weil man Naturschutz, Landwirtscha und Klimaschutz eben doch zusammendenken kann. Wenn man denn will.
Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass sich Landwirte und Landwirtinnen gegen strengere Umweltauflagen au äumen.
Im Februar dieses Jahres protestierten Hunderte von ihnen während eines Treffens der EU-Landwirtscha sminister in Brüssel gegen die Agrarpolitik der Union. Diese planten strengere Umweltauflagen. Die Bauern setzten Reifen in Brand, schütteten Gülle auf die Straße und richteten Pyrotechnik gegen Polizisten. Im März luden Bauern in Deutschland Mist und Gülle auf einer Brandenburger Bundesstraße ab, weil






Entdecken Sie die Feistritzklamm bei einem Ausflug in die Tierwelt Herberstein. Von den über 5.000 im Gebiet vorkommenden Tier-, Pflanzen und Pilzarten befinden sich allein in der Gruppe der Käfer 10 vom Aussterben bedrohte, 43 starke bedrohte und 40 gefährdete Arten.
Vier Käferarten sind nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union streng geschützt: Als Flaggschiff-Art zählt der Große Eichenbock, der in der Steiermark sein einziges Vorkommen in der Feistritzklamm hat.
Außerdem im Eintritt inkludiert: Tierwelt, Gartenschloss, Haus der Biodiversität & Historische Gartenanlagen.
Täglich geöffnet! Tickets & Gutscheine online erhältlich: www.tierwelt-herberstein.at
die deutsche Regierung die Steuerbefreiung für Diesel in der Forst- und Landwirtscha abschaffen wollte. Ein Lkw-Fahrer starb, als er auf den Stau auffuhr.
Und anders als bei den Aktivisten und Aktivistinnen der Letzten Generation, die Politiker wie der bayrische CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gar mit einer „Klima-RAF“ verglichen, blieben die hasserfüllten Stimmen gegen die Bauernproteste großteils aus.
Der Journalist Rico Grimm des deutschen Community-Mediums Krautreporter, formulierte den Vergleich zwischen Landwirten und Klimaaktivisten auf X zugespitzt so: „Die einen produzieren das leckere Steak, die anderen wollen es wegnehmen.“
Die Proteste verstummten wieder. Wohl nicht nur, weil sich die Bauern gehört fühlten. Sondern weil die Winterruhe vorbei war, das Feld rief. Und weil die deutsche Regierung ihren Forderungen nachgab.
Die Lobby der Landwirte ist stark. Nicht nur in Österreich sitzen allein 13 im Nationalrat (und noch viel mehr halten eine Position in regionalen Landwirtscha skammern), sie beraten sich mit Ministern und
Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung von Seite 7
Abgeordneten und haben ein großes Druckmittel in der Hand: „Wenn wir nicht wollen, dann bleibt ihr hungrig!“ Zumindest trumpfen sie bei Unmut auf, auch wenn sie selbst von Supermärkten und anderen Abnehmern abhängig sind.
Und so setzten sie ihre Druckmittel auch auf EU-Ebene durch: Noch vor der EU-Wahl Anfang Juni lockerte die Kommission die Umweltauflagen für Landwirte. Sie müssen nun etwa nicht mehr einen Mindestanteil an unproduktiven Flächen, also Brachen, erhalten. Stattdessen können sie sich dafür entscheiden, dies im Rahmen eines Anreizsystems zu tun. Umweltorganisationen sahen diese Lockerung als „opportunistischen Versuch“, vor allem von Politikern der Europäischen Volkspartei, noch vor der Wahl Unterstützung zu bekommen. Der konservative EU-Landwirtscha skommissar Janusz Wojciechowski zeigte sich im Interview mit dem EU-Medium euractiv sogar dankbar für die jüngste Protestwelle der Landwirte. Diese habe dazu beigetragen, dass „Probleme mit der GAP“, also der Gemeinsamen Agrarpolitik, gelöst werden. Wie mächtig die Bauern sind, zeigt sich an all den Änderungen in Klimaschutzund Umweltfragen, die allein in den acht Monaten vor der EU-Wahl vorgenommen wurden: Noch im November, also vor den Protesten der Landwirte, hatten die EUMitgliedsstaaten beschlossen, die Rinderzucht weiterhin von den Emissionsvorschri en für die Industrie auszunehmen. Für den Schweine- und Geflügelsektor gab es nur minimale Änderungen. Im Februar zog die Kommission dann einen Gesetzesvorschlag zurück, der vorsah, den Einsatz von Pestiziden – mit all ihren Folgen für die Biodiversität und Bodengesundheit – um 50 Prozent zu reduzieren.
140 regionale und internationale Nichtregierungsorganisationen, darunter Greenpeace, BirdLife und der WWF, kritisieren das in einem offenen Brief stark. Und warnten sogar vor einem ökologischen Kollaps. „Die Beziehung unserer Gesellscha zu der Natur, die sie ernährt, ist grundlegend gestört“, schreiben sie.
Der (vermeintliche) Widerspruch zwischen Landwirtscha , Klima- und Naturschutz zeigte sich auch Mitte Juni: Als Verräterin, Vertreterin urbaner Bobos, unwissende „Umweltaktivistin“, stempelten Landwirte die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler ab, als diese – gegen den Willen der ÖVP und vor allem der ÖVP-geführten Bundesländer – für die Verordnung zur Wiederherstellung der Natur, kurz Renaturierungsgesetz, stimmte.
Dabei könnte es auch genau andersherum sein: Eine Landwirtscha , die Biodiversität fördert, Lebensräume für Vögel, Insekten, und kleine Säugetiere schaff t, Böden so bewirtscha et, dass sie CO2 speichern
men. 26 Prozent der globalen Emissionen stammen aus der Lebensmittelerzeugung, so Zahlen der Ernährungs- und Landwirtscha sorganisation der Vereinten Nationen FAO, ein Großteil davon aus der Viehhaltung. 94 Prozent der Biomasse aller Säugetiere sind Vieh, nur noch sechs Prozent wilde Tiere.
Doch es sind nicht nur Klimaauswirkungen, die fatal sind: 80 Prozent der Ökosysteme in der EU sind in einem schlechten oder unzureichenden Zustand. Seit 1990 sind fast 30 Prozent der Wiesenschmetterlinge verschwunden.
Aber nur blanke Zahlen erzählen natürlich nur die halbe Geschichte. Landwirtscha , Artenverlust und Klimakrise verstärken sich gegenseitig. Dabei könnte es ja auch genau andersherum sein: Eine Landwirtscha , die Biodiversität fördert, Lebensräume für Vögel, Insekten und kleine Säugetiere schafft, Böden so bewirtscha et, dass sie CO2 speichern.
Die Natur ist immerhin für die Lebensmittelerzeugung unverzichtbar. Knapp fünf Milliarden Euro der jährlichen landwirtscha lichen Produktion innerhalb der EU sind unmittelbar auf Bestäuberinsekten zurückzuführen. Auf der Häl e der Flächen, auf denen Obstbäume und andere Pflanzen stehen, die auf Bestäuber angewiesen sind, herrschen keine geeigneten Bedingungen für genau diese Symbiose. Deshalb sind Schmetterlingszählungen, wie sie das Renaturierungsgesetz vorsieht (und welche mit ziemlicher Sicherheit nicht von Landwirten selbst, sondern von ausgewiesenen Experten durchgeführt werden) ja auch so wichtig.

1,86 Billionen Euro würde der Nutzen von Hochwasserschutz, fruchtbaren Böden, der Stärkung von Bestäubungsleistungen und anderen Maßnahmen insgesamt bringen. Wer auf gesunde Ökosysteme setzt, Flächen so bewirtscha et, dass die Natur eine Chance hat, profitiert davon.
Wie sieht es nun also aus, das Bild vom Bauern als Natur- und Klimaschützer –das im Übrigen sehr viele Landwirte und Landwirtinnen bereits anstreben?
Österreichische Biobauern stellten Mitte Mai gestützt von Umweltorganisationen wie Global2000 und Birdlife zehn Punkte vor, wie sich die Aspekte Ernährungssicherheit, Ökologie und ein faires Einkommen für Bäuerinnen und Bauern vereinen ließen. Darunter: mehr Biodiversität, wie es etwa auch das Renaturierungsgesetz vorsieht – etwa zehn Prozent „Space for Nature“, also ungenützte Flächen wie Brachen oder Blühflächen; mehr Vielfalt beim Saatgut, eine Reduktion von Pestiziden und vor allem eine Umverteilung der Förderungen von den Großen zu den Kleinen.
Es ist ja nicht so, dass Steuerzahler kein Geld in die Landwirtscha stecken würden: 55 Milliarden Euro fließen in den Agrarsektor der EU, ein Drittel des gesamten EU-Haushaltes. Aber verteilt wird dieses Geld gerade so: Wer mehr Fläche aufweisen kann, bekommt auch mehr.
Und noch einen Punkt sprechen die Verfasser der Streitschri an: die fortschreitende Digitalisierung der Landwirtscha . Die große Hoffnung, um zum Beispiel Pestizide und Düngemittel zu reduzieren, heißt „Precision Farming“, also Präzisionslandwirtscha . Die Landwirte und Landwirtinnen nützen so Drohnen (wie Sie sie übrigens auch auf unserem Cover sehen), um viel gezielter und somit viel kleinflächiger ungeliebte Tiere oder Pflanzen zu entfernen.

Es gibt aber noch eine weitere, versöhnlichere Zahl: Während das Renaturierungsgesetz bis 2070 etwa 154 Milliarden Euro kosten wird, sind die Nutzen, die damit einhergehen, nämlich wieder intakte(re) Ökosysteme zu haben, viel höher. Das zeigt eine Wirkungsanalyse der EU-Kommission:




Die teils falschen Infos, die zuvor die Runde machten, hatten die Bauern verunsichert: Sie fürchteten, enteignet zu werden, dass Erträge ausbleiben, wenn man die Äcker naturnah bewirtscha et, Flächen zum Teil aus der Nutzung nimmt. Und so kam es, dass die ÖVP als Bauern-Partei, als die sie sich im Moment versteht, die grüne Ministerin gleich zweimal anzeigte: Einmal wegen Amtsmissbrauchs und einmal vor dem Europäischen Gerichtshof wegen Nichtigkeit.




Scheren sich Bauern also wirklich nicht um den Fortbestand der Natur? Wer nur auf blanke Zahlen blickt, könnte dem zustim-

Was dabei hil : Eine Zusammenarbeit zwischen Landwirtscha und Wissenscha , wie es etwa der Landwirt Alfred Grand auf seinem Forschungshof in Niederösterreich macht (siehe S. 36). Er erprobt etwa das System „Market Garden“, also viele verschiedene Gemüsesorten auf kleiner Fläche. Denn aus Sicht der Wissenscha sind die Lösungen so banal wie festgefahren. Um Flächen einzusparen, sie auch der Natur zur Verfügung zu stellen, müssten die Menschen weniger Lebensmittel wegwerfen und weniger Fleisch wie Tierprodukte essen. Keine Neuigkeiten.
Doch die Zahl der Vegetarier und Veganer stagniert vielerorts. Ein erster Schritt, der auch Landwirte versöhnlich stimmen würde: auf Moderation statt Absolutismen setzen. Eine Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung zeigt etwa, dass nur ein Fün el des globalen Rindfleischkonsums durch fleischlose Alternativen ersetzt werden müsste, um die Umwelt maßgeblich zu schützen.


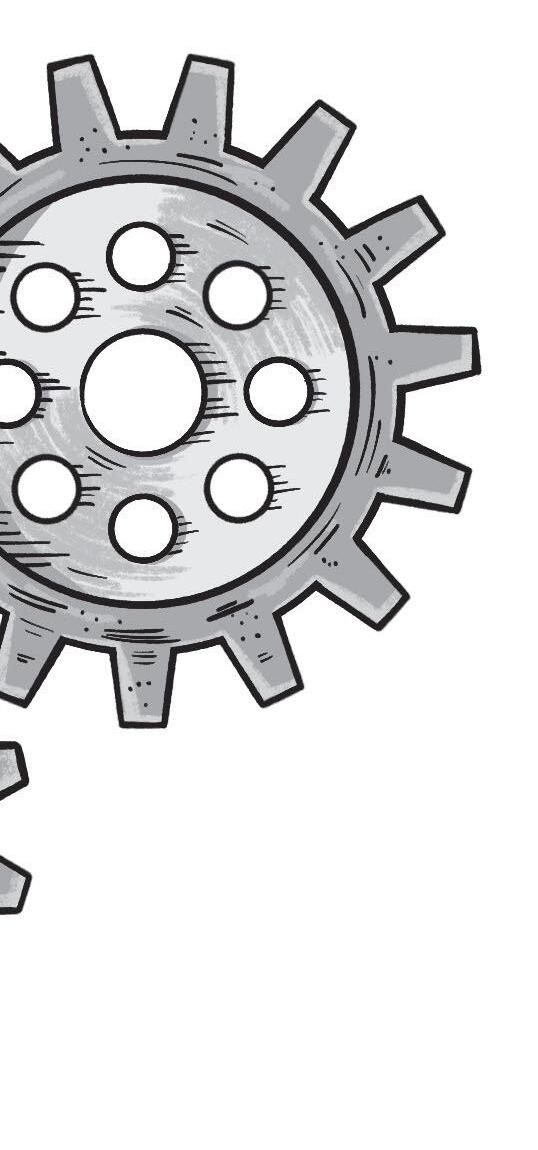
Der Bauer der Zukun ist also wohl einer, der sich modernen Technologien nicht verschließt (dazu zählen auch Ansätze wie Laborfleisch, siehe S. 16), der kleinräumiger denkt und so auch Rücksicht auf die Natur nehmen kann, die ihn und uns alle nährt. Denn was wäre ein Bauer, der sich nicht für die Schmetterlinge interessiert, die über seinen Acker fliegen? F

Nachhaltige s auen al s chlüssel für erfolgreiche n limaschutz
Wenn von zukunftsfitten Gebäuden die Rede ist, dann denkt man insbesondere an klimafreundliche Lebensräume. An Orte zum Arbeiten und zum Wohnen, von denen auch folgende Generationen profitieren.
Diesen Anspruch verfolgt die ARE Austrian Real Estate mit Weitblick und Konsequenz und schafft Perspektiven, indem ihre Projekte möglichst ökologisch und ressourcenschonend errichtet werden.
REVITALISIERTE ALTBAUTEN
Die ARE bringt neue Energie in alte Gebäude. Die Erhaltung und Sanierung ihrer historischen Liegenschaften ermöglicht einen signifikanten Beitrag zum Schutz des Klimas. Neue Bodenversiegelungen werden vermieden und der Bedarf an Baumaterialien wird auf ein Minimum reduziert. Bis 2040 investiert die ARE zusätzlich rund 700 Mio. Euro in die CO 2 -Neutralität ihrer Liegenschaften, z.B. durch den Einbau energieef fi zienter Gebäudetechnik und klimafreundlicher Energiesysteme. So entsteht ein einzigartiger Charme aus historischer Architektur und modernen Nutzungskonzepten, der zudem das Klima schützt.
ÖKOLOGISCHE BAUSTOFFE
Wenn neu gebaut werden muss, dann richtig –umweltfreundlicher, sauberer, besser. Die Vorteile der Holzbauweise liegen auf der Hand: Holz ist erneuerbar, CO 2 -neutral, energieef fizient und auch in Kombination mit anderen Materialien als Holzhybridbau einsetzbar. Der Baustoff Ziegel punktet als langlebiges und recycelbares Baumaterial und bietet eine besonders ef fi ziente Wärmedämmung.
URBAN MINING UND RE-USE
Der ressourcenef fi ziente Rückbau nicht mehr nutzbarer Gebäude und die Wiederverwendung der Abbruchmaterialien für Neubauprojekte wird als Urban Mining bzw. Re-Use bezeichnet. Diese Kreislaufwirtschaft stellt einen ganz wesentlichen Schritt hin zu nachhaltigerem Bauen dar: Ressourcen werden gespart, Deponieabfälle reduziert und gleichzeitig entfällt der Energiebedarf, der bei der Herstellung neuer Baumaterialien entstehen würde.
Nähere Informationen über die ARE Austrian Real Estate GmbH und ihre Projekte finden Sie unter www.are.at

Die Kleine Sperlgasse 5 bietet durch die Revitalisierung Energieef fizienz auf Neubauniveau






Wären die Mittel so gesundheitsschädlich, würden sie in der EU sicher nicht zugelassen



Jahrelang hat die EU gestri en, wie sich der Einsatz von Spritzmi eln reduzieren ließe – am Ende gab es keine Einigung. Hier streiten die EUAbgeordneten Thomas Waitz (Grüne) und Alexander Bernhuber (ÖVP) über Glyphosat und „Gi scheine“, Bienen und unfruchtbare Bauern
INTERVIEW: GERLINDE PÖLSLER
DDer eine sah schon die Wachauer Marille und den Weinviertler Wein bedroht. Alexander Bernhuber, ein ÖVP-Bauernbündler, der im Bezirk Melk Weizen, Mais und Soja anbaut, lehnte die sogenannte „Sustainable Use Regulation“ (SUR) der EU kategorisch ab: Diese sollte den Einsatz und die Risiken von Pflanzenschutzmitteln in der EU halbieren, also jener Stoffe, die Maiswurzelbohrer & Co zu Leibe rücken.
Der andere, Bio-Schaf- und Bienenzüchter in der Südsteiermark, sorgt sich um die Fruchtbarkeit der Böden und Winzer und kämp e für die SUR: Thomas Waitz, CoVorsitzender der Europäischen Grünen. In Brüssel und Straßburg geraten die beiden regelmäßig aneinander. Nachdem die SUR im vergangenen November im EUParlament scheiterte, hat sich deren Chefverhandlerin, die frühere Fernsehköchin Sarah Wiener (Grüne), desillusioniert von der Politik verabschiedet. Ihr Ansprechpartner von der Europäischen Volkspartei, Alexander Bernhuber, bleibt und wird auch in Zukun mit Thomas Waitz streiten. Beide haben zuletzt bei der EU-Wahl am 9. Juni so richtig abgeräumt: Bernhuber erhielt 44.641 Vorzugsstimmen und Waitz sogar 75.018.
Falter: Was fällt Ihnen zu „Spritzmittel“ als Erstes ein?
Alexander Bernhuber: Ein Hilfsmittel. Thomas Waitz: Gesundheits- und Biodiversitätsfragen.
Warum genau das?
Bernhuber: Weil Pflanzenschutzmittel o die letzte Möglichkeit sind, um die Ernten zu sichern.
Waitz: Man muss unterscheiden zwischen nicht toxischen, minder toxischen und sehr toxischen Spritzmitteln. Toxische sind krebserregend, außerdem haben wir das Problem mit dem Verlust der Artenvielfalt und mit Rückständen in Lebensmitteln.
In der EU wurden im Jahr 2020 circa 350.000 Tonnen an Spritzmitteln ausgebracht – ziemlich genau gleich viel wie 2010. Die Menge ist also nicht gesunken. Wie problematisch ist das?
Waitz: Die Mengen allein sagen noch nichts über die Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt aus. Selbst der Biolandbau verwendet Hilfsstoffe wie etwa Kieselerde, die formal Pestizide sind. Man benötigt davon sehr große Mengen, sie sind aber gar nicht oder kaum toxisch. Von hochtoxischen Pestiziden wie den Neonicotinoiden werden da-
gegen nur kleinste Mengen verwendet. Ich will toxische und hochtoxische Pestizide reduzieren.
Sie haben genickt, Herr Bernhuber ... Bernhuber: Weil mir das auch nicht gefällt, dass wir immer von den Mengen sprechen, die tatsächlich wenig aussagen. Und ich möchte ganz klar sagen: Die europäischen Behörden haben alle unsere Pflanzenschutzmittel genehmigt. Zu sagen, die seien plötzlich gi ig, bedeutet, dass wir unseren eigenen Behörden nicht trauen. Nehmen wir Glyphosat: Da haben sich 90 Wissenschaler mehr als 2400 Studien angeschaut, bevor sie das Mittel wieder zugelassen haben. Sonst berufen wir uns immer auf die Wissenscha , aber beim Pflanzenschutz zählt diese auf einmal nicht mehr.
Waitz: Da muss ich widersprechen. Gerade Glyphosat ist eines der allertoxischsten Mittel. Wissenscha lich steht außer Zweifel, dass es einen Zusammenhang zwischen Glyphosat und dem Non-Hodgkin-Lymphom gibt, einem Lymphdrüsenkrebs. Auch viele andere Mittel gefährden nachweislich die Gesundheit, wenn sie in die Ernährung gelangen oder über den Hausstaub aufgenommen werden. Die Landwirte stehen aber unter einem derartigen ökonomischen Druck, dass sie zu solchen Stoffen greifen: Damit ersparen sie es sich, vier oder fünf Mal mechanisch Beikräuter zu regulieren. Bernhuber: Und der Diesel, der da verbraucht würde!
Waitz: Ja, da entstehen Kosten, Traktorstunden, Arbeitszeit. Und das geht sich bei den äußerst knappen Erzeugerpreisen, die manchmal unter den Produktionskosten liegen, einfach nicht aus. Da ist es billiger, einmal drüberzufahren und alles niederzuspritzen.
Sie sagen beide, die Mengen alleine sagen nicht viel aus. Allerdings stehen heute eben mehr Spritzmittel zur Verfügung, die in sehr kleinen Mengen schon hochtoxisch sind. Ist ein gleichbleibender Verbrauch dann nicht doch eine schlechte Nachricht?
Bernhuber: Es kommt auch auf die Kulturen an. Österreich bräuchte morgen nur noch die Häl e an Pflanzenschutz, wenn wir nur mehr Weizen, Mais und Soja anbauen würden. Aber unser Gemüse, das Obst und der Wein sind einfach viel anfälliger für Pilzkrankheiten oder Insekten, etwa Blattläuse, und bedürfen höherer Mengen an Pflanzenschutzmitteln. Und wenn wir den heimischen Pflanzenschutzmittelverbrauch anschauen: Seit zehn Jahren zählt hier das Gas CO2 zu den Pfl anzenschutzmitteln, die in der Lagerhaltung der Abwehr von Schädlingen in geschlossenen Räumen dienen und völlig unproblematisch sind. Fast ein Drittel der Mengen machen schon Kupfer-Schwefel-Mittel aus, und das ist ja gut, weil es bedeutet, dass viel mehr Bauern in den Bio-Werkzeugkoffer greifen, weil diese Mittel genauso wirken. Aber von denen bringt man eben nicht 30 Gramm pro Hektar aus, sondern ein Kilo.
Dass Bio-Spritzmittel genauso wirksam seien, hören Sie sicher gern, Herr Waitz. Waitz: Ja. Aber beim Obst- und Weinbau muss man schon genauer hinschauen! Im Weinbau gibt es viele Sorten, die kaum Pestizide brauchen, die sogenannten Piwis. Diese werden aber in Österreich
Fortsetzung nächste Seite

Etwa ein Fün el aller Krebsfälle hat mit Pestiziden zu tun



ILLUSTRATIONEN: LILLY GRASCHL





Fortsetzung von Seite 11
seit Jahrzehnten massiv bekämp , sie waren jahrelang sogar verboten. Mittlerweile dürfen manche unter bestimmten Bedingungen verkau werden, zum Beispiel der steirische Uhudler, der auch Heckenklescher heißt.
Warum hat man die so bekämp ?
Waitz: Weil man gut eingeführte Sorten wie den südsteirischen Sauvignon wichtiger findet als den Schutz der Artenvielfalt und Gesundheit. Es sind also rein marktwirtschaliche Gründe. Der Preis dafür sind enorme Mengen an Pestiziden, unter denen die Landwirte als Erste leiden. Das ist ein Tabuthema bei mir in der Region, in der Südsteiermark: Viele meiner Kollegen und auch Kolleginnen sind wegen der hohen Pestizidbelastung unfruchtbar.
Bernhuber: Wo ist das belegt?
Waitz: Wie viele Namen willst du haben? Bernhuber: Ich möchte die ärztlichen Atteste sehen. Solche Anschuldigungen müssen ja belegt werden.
Waitz: Aber dass eine hohe Pestizidbelastung massiv gesundheitsschädlich ist, ist doch tausendfach bewiesen, Alex! Und Unfruchtbarkeit ist halt einer der Effekte.
Vermuten diese Winzer das oder haben sie tatsächlich Atteste?
Waitz: Ich könnte mindestens drei Kollegen sofort beim Namen nennen, die diese Analyse haben.
Wir können das aber hier nicht klären …
Waitz: Es ist empirisch belegt, dass Unfruchtbarkeit in Weinbaugebieten viel häufiger vorkommt. In vielen EU-Ländern sind wiederum Parkinson und das Non-Hodgkin-Lymphom als Berufskrankheiten von Landwirten anerkannt. Zum Glück arbeiten die Landwirte heute, sofern sie gut ausgebildet sind, wirklich mit Maske, Schutzanzug und Handschuhen. Früher sind die Weinbauern ohne Maske am Spritztraktor gesessen.
Bernhuber: Ja, die junge Generation ist da sehr gut geschult. Man muss ja heute Kurse und Weiterbildungen besuchen, um den Sachkundenachweis zu bekommen und überhaupt Spritzmittel kaufen zu können. Waitz: Dieser Schein heißt bei uns in der Landwirtscha übrigens Gi schein.
Herr Bernhuber, wenn die Risiken ohnehin so gering sind: Warum gilt dann etwa Parkinson in Frankreich als Berufskrankheit?
Bernhuber: In der Vergangenheit sind viele Mittel mit gutem Gewissen zugelassen worden, weil man den Nutzen gesehen hat. Wir haben damit Ernährungssicherheit geschaffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Weizenerträge bei zwei bis drei Tonnen je Hektar, jetzt stehen wir bei sieben bis acht Tonnen. Und das in höherer Qualität, sprich mit weniger Mykotoxinen, also Schimmelpilzgi en, und Co.
Und heutzutage schaden die Pestizide der Gesundheit nicht mehr?
Bernhuber: Ich glaube, wirklich nur mehr minimal. Wären sie so gesundheitsschädlich, würden sie in der EU sicher nicht zugelassen. Wenn man schaut, wie streng die Zulassungsprüfungen heute für die Hersteller sind, dann kann man nicht sagen, dass die Toxizität steigt.
Waitz: Das sehe ich anders. Etwa ein Fün el aller Krebsfälle hat mit Pestiziden zu tun. In Südtirol wurde sehr gut untersucht, wie
sehr Spielplätze, Krankenhäuser und Parks mit Pestiziden kontaminiert sind. Und zur Zulassung: Noch immer beau ragt die Industrie selbst die Studien, die sie für die Zulassung braucht. Bis vor kurzem konnte sie unliebsame Studien sogar einfach verschwinden lassen, immerhin das geht jetzt nicht mehr: Jetzt müssen sie alle schon vorher in ein Register eintragen.
Sie beide haben im EU-Parlament mehrere Jahre über die Spritzmittel verhandelt, am Ende gab es keine Einigung. Woran lag’s?
Bernhuber: Daran, dass das, was die Kommission auf den Tisch gelegt hat, teilweise wirklich absurd war und extrem viel mehr Bürokratie bedeutet hätte.
Waitz: Aber um den Kommissionsentwurf ging es ja längst nicht mehr! Du hast ja dem fertigen Vorschlag des Parlaments nicht zugestimmt.
Bernhuber: Auch im Entwurf von Sarah Wiener stand immer noch das Ziel, um die Häl e weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Dazu sind Studien zum Schluss gekommen, dass Europa dann weniger Lebensmittel produzieren würde. Wir hätten mehr importieren müssen, die Lebensmittel wären teurer geworden. Wir hätten unsere Versorgungssicherheit geopfert.
Waitz: Da war jetzt vieles dramatisch falsch. Die Versorgungssicherheit Europas war nie und ist in keinster Weise gefährdet. Das sind Fake News von vorn bis hinten. Wir verwenden 60 Prozent unserer Flächen für Viehfutter und verbrauchen hunderttausende Tonnen Getreide für Biosprit. Wir verschwenden mehr als 120 Kilo Lebensmittel pro Nase. Eine Logik, wonach wir Pestizide brauchen, nur damit wir ein bisschen mehr vom Acker wegführen können, blendet alle anderen Schäden völlig aus.
Bernhuber: Nehmen wir mein Lieblingsbeispiel Kartoffeln. Da verbrauchen wir im Anbau Diesel und Pflanzenschutzmittel, wenn wir aber am Ende den Drahtwurm drinnen haben, dürfen wir das Mittel dagegen seit ein paar Jahren nicht mehr verwenden. Und müssen den Großteil der Ernte wegschmeißen.
Waitz: Bei dem Mittel gegen den Drahtwurm handelt es sich um Neonicotinoide, die in der EU nach langem Streit verboten wurden, weil sie derartig gefährlich für die Umwelt und den Menschen sind. Trotzdem kam es auch nach dem Verbot zu zahlreichen Notfallzulassungen für das Mittel, auch in Österreich. Dass es die nun nicht mehr gibt, ist richtig.
Und was sollen die Erdäpfelbauern tun, wenn sie den Drahtwurm drinnen haben?
Waitz: Der kommt mit der Trockenheit, und dagegen helfen Agroforstmethoden (dabei kombiniert man Ackerbau mit Bäumen oder Sträuchern, Anm.). Und er tritt vor allem dann auf, wenn ich auf demselben Feld ein Jahr ums andere Erdäpfel auf Erdäpfel anbaue. Mit Fruchtfolge lässt sich der Drahtwurm also gut in Schach halten. Generell müssen wir intensiv in Forschung und Entwicklung investieren, etwa in Nützlinge und auch in die Technik: Drohnen können zum Beispiel kleine Tonkügelchen mit Raubmilben abwerfen, um Blattläuse zu reduzieren.
Bernhuber: Da bin ich bei dir. Mir tut es ja um ein paar positive Ansätze leid, die wir nicht mehr beschließen konnten, zum Beispiel schnellere Zulassungsverfahren für weniger riskante Pflanzenschutzmittel.
Pestizide oder Pfl anzenschutzmi el?
Der Streit über die Spritzmi el fängt schon bei den unterschiedlichen Bezeichnungen an
Pestizide sind alle Mi el gegen (schädliche) Insekten, Pilzerkrankungen und „Unkräuter“. Auch die Biolandwirtscha verwendet Pestizide, darf allerdings keine chemisch-synthetischen Mi el einsetzen
Die EU-Kommission wollte mit ihrem Green Deal die Verwendung und das Risiko von Pestiziden halbieren. Jahrelang verhandelten Kommission, EU-Parlament und die EU-Länder darüber – am Ende einigten sie sich nicht
Manche sagen, Pestizide dienten dem Klimaschutz: Weil man mit ihnen aus einer Fläche mehr Erträge herausholt als ohne. Bernhuber: Das stimmt. Mit Pfl anzenschutzmitteln lässt sich auf weniger Fläche mehr produzieren, dadurch kann man andere Flächen außer Nutzung stellen, auf denen dann mehr Biodiversität stattfindet. Waitz: So einfach ist das nicht. Die Schäden, die Pestizide an der Artenvielfalt, an der Gewässerökologie und so weiter verursachen, schlagen ja auch auf die Produktivität der Landwirtscha zurück. Und ja, es ist richtig, dass etwa im Bio-Landbau die Ernten um zehn bis 30 Prozent niedriger ausfallen. Das gleichen aber die besseren Inhaltsstoffe der Bio-Produkte großteils wieder aus.
Herr Bernhuber, am 22. November, dem Tag, als die SUR endgültig gescheitert ist, haben Sie angefragt, was die Kommission für die Erhaltung der Bestäuber zu tun gedenkt. Herr Waitz hat darauf geantwortet, das sei „doppelzüngig“ von Ihnen, hätten Sie doch gerade die Pestizidreduktion mit abgewürgt. Wären weniger Pestizide nicht gut für die Bienen?
Bernhuber: Unter anderem, ja, aber wir machen in unserem Umweltprogramm ÖPUL auch schon sehr viel. In Österreich werden mit 210.000 Hektar fast zehn Prozent der Ackerfläche als Biodiversitätsflächen bereitgestellt und helfen damit der Artenvielfalt und den Bienen.
Waitz: Trotzdem werden die Bestäuber weniger!






Alexander Bernhuber, bleibt und wird auch in Zukun mit Thomas Waitz streiten. Beide haben zuletzt bei der EU-Wahl am 9. Juni so richtig abgeräumt: Bernhuber erhielt
44.641
Vorzugsstimmen und Waitz sogar 75.018






Bernhuber: Ja, aber auf den Höfen herrscht extremer Druck. Dann müssen wir auch darüber reden, dass, wenn wir Bauern hier noch mehr tun sollen, das auch abgegolten werden muss. Entweder durch Zahlungen, wenn man Flächen aus der Nutzung nimmt, oder durch höhere Produktpreise.
Wie o haben Spritzmittel-Lobbyisten Sie in den letzten Jahren kontaktiert und wie o haben Sie sich mit ihnen getroffen?
Waitz: Ich habe ein einziges Mal mit BASF gesprochen, dann haben sie es aufgegeben und sind nicht wiedergekommen. Andere Abgeordnete haben sich dafür hergegeben – ich finde, das hast du getan, Alex. Aber ja, jeder wählt die Seite, auf der er steht. Bernhuber: Was heißt hergegeben? Ich habe sowohl Termine mit NGOs als auch mit anderen wahrgenommen. Ich finde es wichtig, alle Seiten anzuhören. Und wenn ich mir die Rückmeldungen aus der Landwirtscha anschaue, dann mache ich keine Politik für irgendwelche Pflanzenschutzfirmen, sondern für unsere Bäuerinnen und Bauern. Waitz: Du tust immer so, als würdest du „die Landwirtscha “ vertreten. Du vertrittst weder die Bio- noch die kleinstrukturierte Landwirtscha . Du vertrittst den niederösterreichischen Ackerbau, that’s it.
Bernhuber: Entschuldigung, aber die Grünen treten nicht einmal bei der Landwirtscha skammerwahl an …
Sind Sie sich bei irgendetwas auch einig?
Waitz: Ja, dass die Landwirte wieder einen fairen Erzeugerpreis bekommen sollen. Und dass es nicht geht, dass wir unseren eigenen Bauern hohe Auflagen geben und gleichzeitig Freihandelsabkommen abschließen, in denen wir diese Bedingungen nicht voraussetzen. Da stehen wir auf derselben Seite.
Stimmt?
Bernhuber: Ja, stimmt. Ist genehmigt. F


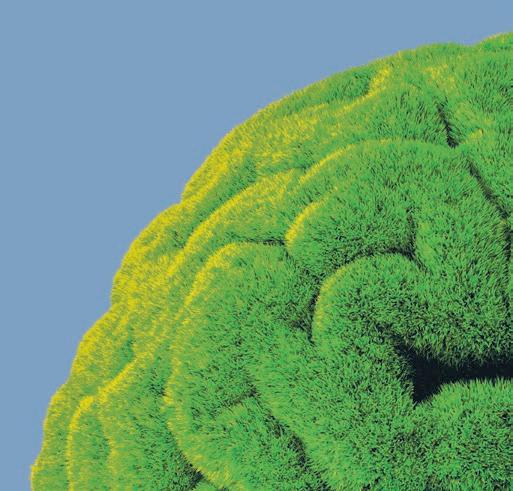


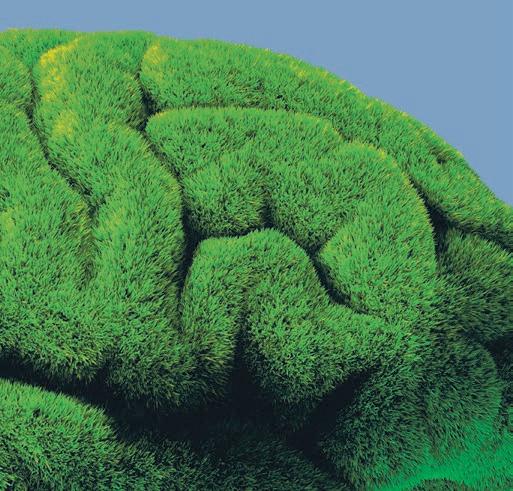










des Fleisches bis 2050 durch mikrobielles Protein zu ersetzen –also Fermentationsprodukte aus Hefen oder Bakterien, die zum Beispiel zu Käse verarbeitet werden können – würde viel bringen: So könnte man die weltweite Entwaldung halbieren.

Schon 2014 haben sich die deutsche HeinrichBöll-Sti ung, die Umweltschutzorganisation Global 2000 und die Tierschutzorganisation Vier Pfoten zusammengetan, um jährlich den österreichischen Fleischatlas herauszugeben. Der zeigt nun: Der weltweite Fleischkonsum hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt. Die Bevölkerung ist gewachsen, Einkommen sind gestiegen und Menschen essen immer mehr tierische Produkte. Experten mahnen seit langem, dass dieser Konsum zumindest halbiert werden muss. Der Fleischatlas begleitet diesen Prozess. Vor allem Junge machen laut einer ihrer repräsentativen Umfragen Hoffnung: Mehr als zwei Drittel der 16bis 29-Jährigen lehnten im Jahr 2021 die heutige Fleischindustrie ab.
Der Nahversorger: Robert Brodnjak, Karmelitermarkt, Wien
PLANETARY HEALTH DIET
Von der berühmten Ernährungspyramide hören viele schon in der Volksschule: Viel Gemüse und Obst, dazwischen Getreide und Milchprodukte, und im oberen Drittel Fleisch oder Süßes. Idealerweise schützen wir so nicht nur die menschliche Gesundheit, sondern auch den Planeten. Das dachten sich Forschende der EAT-LancetKommission. Die gute Nachricht für Fleischliebhaber: Komplett auf Tierisches verzichten müssen wir für die „Planetary Health Diet“ nicht. Der Konsum von Obst und Gemüse, Hülsenfrüchten und Nüssen müsste verdoppelt, der Verzehr von Fleisch und Zucker dagegen halbiert werden. Der Report zeigt auch, dass es machbar ist, bis zum Jahr 2050 etwa zehn Milliarden Menschen auf der Erde gesund zu ernähren, ohne den Planeten zu zerstören.
Er ist Vielfaltsproduzent und Klimaaktivist auf dem Feld. Sein Bio-Gartenbaubetrieb „Krautwerk“ im südlichen Weinviertel war einer der Ersten, die in Österreich die Market-Gardening-Methode umsetzten – er ha e sie in den USA kennengelernt. Diese steht für Gemüselandbau mit hohem Ernteertrag auf kleinster Fläche bei geringster Störung und gezielter Fü erung der sensiblen Bodenorganismen – wodurch auch mehr Kohlenstoff im Boden gebunden bleibt. Schnell fand er einen begeisterten Unterstützer: Heinz Reitbauer vom Restaurant Steirereck. Immerhin bekam er bei Brodnjak 13 verschiedene Erbsen- und 50 Paradeisersorten angeboten. Reitbauer wurde zum Förderer und Abnehmer, wie später auch weitere Stars der Spitzengastronomie. Seit zwölf Jahren


LEBENSMITTELINFLATION
Sie müssen jetzt stark sein: Steigende Temperaturen wirken sich nicht nur auf Wetterlagen aus, sondern beeinflussen auch die Preise unserer Nahrungsmittel. Bis 2035 steigen sie um 3,2 Prozentpunkte, so eine neue Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) und der Europäischen Zentralbank EZB. Was das genau heißt? Orangen, Kaffee, Bier, Kakao – also viele „Luxusprodukte“, die in jenen Regionen angebaut werden, die in Zukun stark von Dürren, Hochwasserevents und somit von Missernten oder sinkenden Erträgen betroffen sind – kosten bald mehr. Schon jetzt ist das bemerkbar: Während ein Liter Orangensa im Dezember 2022 laut dem Preismonitor der Arbeiterkammer noch 1,89 Euro kostete, waren es ein Jahr später schon 2,99 Euro.
betreiben Brodnjak und seine Frau Claudia Detz auch einen Stand am Wiener Karmelitermarkt. Diese Vielfaltsdestination bietet auch revolutionäres Frischgemüse („Snow Food“) an: Radieschen, Salate, Zierkohle, die ohne Heiz-und Beleuchtungsenergie im tiefen Winter klimafreundlich geerntet werden können. Früher war Brodnjak als Koch, dann im EDV-Bereich tätig, als Quereinsteiger verfiel er der Gemüseproduktion, als er nach einem sinnsti enden, familienfreundlichen Job suchte: „Ich wollte nicht Problem, sondern Teil einer Lösung sein.“ Die Idee ist aufgegangen. Seine ursprünglich 3,5 Hektar Pachtland konnte er auf einen Hektar reduzieren: „Wir sind kleiner geworden, dabei aber betriebswirtscha lich gewachsen – also gesundgeschrump .“ IG



EKann Fleisch aus dem Labor das Klima re en und unsere Essgewohnheiten gleich mit? Die Industrie ist euphorisch, die Bauern sind fuchsteufelswild. Und die Wissenscha skeptisch, dass das alles schnell auf den Tellern landen wird
TELLERBESCHAU:
EVA KONZETT


Ein bisschen erinnert Lucys Schicksal an das Matthäusevangelium mit der wundersamen Vermehrung der Gerstenbrote und der Fische. Da passt es auch gut, dass Lucy in Israel ist. Beziehungsweise die Zellen, die von ihr übrig sind und sich weiterentwickeln.
Zu Fleisch. Nicht an Lucys Knochen. Sondern im Labor.
Man kann Lucy bis heute im Internet anschauen, sie ist eine sehr schwarze, sehr stattliche Kuh, Rasse Angus. Aus der lebendigen Lucy waren – sehr grob gesprochen – Eizellen entnommen worden, diese ließ man befruchten, die Rinderembryonen
in der Petrischale ein paar Tage wachsen. Man extrahierte die Stammzellen, die sich in jede Zellenart weiterentwickeln können, und züchtete Muskelzellen daraus. Die so entstandenen Zellklumpen kamen in einen Bioreaktor. „Man“, das ist das israelische Unternehmen Aleph Farms, Haim-Holtzman-Straße 1, Rehovot, ein paar Kilometer von Tel Aviv entfernt. An diese Adresse hatte Lucys Besitzer, ein kalifornischer Farmer, ihre befruchteten Eizellen geschickt. In den großen Brutreaktoren wuchs in Rehovot daraus Fleisch für den menschlichen Verzehr. Tut es immer noch, im Vier-WochenZyklus. Zelluläre Landwirtscha nennt das




Unternehmen das Unterfangen. Das Ziel: die Fleischproduktion vom Tier zu entkoppeln. Schon 1931 schrieb Winston Churchill in seinem Weihnachtsessay: „In 50 Jahren werden wir die Torheit überwunden haben, ein ganzes Hühnchen zu züchten, wenn wir doch eigentlich nur dessen Brust oder Keule verzehren wollen. Stattdessen werden wir die einzelnen Teile in einem geeigneten Medium heranwachsen lassen.“
Ein bisschen länger als 50 Jahre später scheint das Ziel zum Greifen nah.
In-Vitro-Fleisch, Laborfl eisch, Zellfl eisch, Retortenfleisch, die endgültigen Begrifflich-
keiten haben sich noch nicht durchgesetzt, doch das Versprechen ist hoch. Diese Form des Proteins könnte die Essgewohnheiten in der industrialisierten Welt (viel Fleisch) weiterhin bedienen und möglicherweise sogar die sogenannte „Proteinlücke“ schließen, also den steigenden globalen Proteinbedarf durch eine wachsende Weltbevölkerung. Und das ganze klimafreundlich(er) als mit Lebendtieren, weitestgehend ohne Tierqualen und ohne Antibiotikaeinsatz. Ohne Pestizide und Rodung des Regenwalds.
Bereits 2019 prognostizierte das amerikanische Beratungsunternehmen AT Kear-
ney, dass bis 2040 bis zu einem Drittel des heutigen klassischen Fleischmarkts von solchem Kunstfleisch bespielt werden könnte. Doch die „Frankenstein-Frikadelle“ (Süddeutsche Zeitung, 2017) hat mächtige Gegner: die Bauern. Sie fürchten um ihre Existenzgrundlage. Sie fürchten große Lebensmittelkonzerne, die an ihrer statt die Lebensmittelproduktion übernehmen könnten. Es geht auch um das eigene, handwerkliche Erbe, um die Tradition. Schlicht, ums Bauernsein. Laborfleisch stehe „im völligen Widerspruch“ zum „bisherigen Modell
ILLJSTRATION: LILLY GRASCHL Fortsetzung nächste Seite
Fortsetzung von Seite 17
der Lebensmittelproduktion in Österreich und Europa“, urteilte sodann auch der österreichische Landwirtscha sminister Norbert Totschnig im Frühjahr. Rechtspopulisten machen aus der Frage (wie aus allem) einen Kulturkampf. Die postfaschistische Regierung in Italien hat das Laborfleisch bereits verboten.
Kann man Fleisch im Reaktor heranziehen, anstatt es im Stall aufzuziehen? Und ist das Verheißung oder die Vorhölle? Der Falter fasst die wichtigsten Fragen zusammen.
Worum geht es eigentlich? Grelles Rampenlicht fiel an jenem Tag auf das unscheinbare Burger-Patty, das in einer haushaltsüblichen Teflonpfanne vor sich hin brutzelte. Vor mehr als zehn Jahren, am 3. August 2013, stellten Mark Post und sein Forscherteam von der Universität Maastricht das erste aus In-vitro-Fleisch geformte Fleischlaberl in London vor. Sie ließen es öffentlichkeitswirksam live im Fernsehen von Gastrokritikern verkosten. Deren Urteil: trocken, kein Fett. Aber schon irgendwie fleischig. Das Patty hat damals 250.000 Dollar gekostet. Die Aufnahmen schafften es in die Hauptabendprogramme.
Die Geschichte des Laborfleisches geht zurück auf den Niederländer Willem van Eelen. Er wäre als junger Soldat in japanischer Kriegsgefangenscha fast verhungert, studierte später Medizin und lernte bei Hauttransplantationen für Brandopfer, wie man Zellen in der Petrischale wachsen lassen kann. Wenn man Hautzellen so vermehren konnte, warum dann nicht auch
Muskelzellen? Van Eelen reichte 1999 ein erstes Patent für die Herstellung von Invitro-Fleisch ein. Da war er über 70 Jahre alt. Seine Technologie war nicht ausgerei genug, das Gewebe hielt nicht zusammen. Aber sein Engagement blieb nicht folgenlos.
Van Eelen überzeugte die niederländische Regierung, Fördergelder für weitere wissenscha liche Forschung für das Kunstfleisch aufzustellen. Einer der Empfänger: Mark Post und seine Kollegen, die das Patty in die Pfanne brachten. Auch die Nasa hatte sich 2001 für solcherart Alternativen interessiert, um Astronauten im All mit Eiweiß versorgen zu können. Forscher schafften es dann in ersten Versuchen auch, drei Zentimeter lange Goldfischfilets zu züchten, irgendwann auch Truthahnzellen. Doch das Projekt war zu teuer, die Nasa stellte es ein. Seit 2020 erlaubt Singapur Hühnernuggets aus In-vitro-Fleisch für den Massenmarkt. Auf knapp 3000 Quadratmetern sollten sie im Osten der Stadt in einem Bürohaus produziert werden. In den USA dürfen zwei Unternehmen ebenfalls ihre Produkte verkaufen. In Europa hat ein deutsches Unternehmen bereits um Zulassung bei der zuständigen Agentur für Lebensmittelsicherheit EFSA in Amsterdam angefragt. Sie prü , inwiefern die Produkte der sogenannten „Novel-Food-Verordnung“ entsprechen.
Wie wird dieses Laborfleisch hergestellt? Man entnimmt aus lebenden oder geschlachteten Tieren ungefähr eine erbsengroße Menge Muskelgewebe. Die natürlich vorhandenen, adulten Stammzellen werden separiert
Seit 1981 erst schafft es die Wissenscha , Stammzellen zu extrahieren. Als Erstes bei Mäusen, 1998 beim Menschen. Heute reichen zehn solcher Rinderstammzellen, um in zwei Monaten 50.000 Tonnen Fleisch zu züchten, sagt die Industrie
Laborfleisch war bis vor kurzem ein Hotspot für Risikokapital. 2021 investierten Geldgeber weltweit rund eine Milliarde Dollar in die Branche. Seither aber sinken die Zuwendungen
Der teuerste BeefPa y der Welt landete 2013 in London in der Pfanne. Es war das erste Stück Fleisch aus Zellkulturen, das der Öffentlichkeit vorgestellt wurde
www.nachhaltigewerte.at
NACHHALTIG
WERTE SCHAFFEN. MIT SICHERHEIT.
und in einer Nährflüssigkeit, bestehend aus Aminosäuren, Mineralien, Zucker und Vitaminen, gezüchtet. Alternativ können Stammzellen auch aus Eizellen entnommen werden. Außerdem muss ein bisschen Blut von ungeborenen Kälbern hinein, es ist auch für den Au au von Hühnernuggets notwendig. Für das „fötale Kälberserum“ muss eine trächtige Kuh geschlachtet werden. Forscher arbeiten bereits an pflanzlichen Alternativen. Sie sind dringend notwendig, um die Produktion skalieren, also in marktrelevante Größenordnungen bringen zu können.
Überhaupt können Forscher erst seit 40 Jahren Stammzellen aus Säugetieren extrahieren, 1981 schafften sie es bei Mäusen, 1998 beim Menschen. Heute reichen zehn solcher Rinderstammzellen, um in zwei Monaten 50.000 Tonnen Fleisch zu züchten.
Womit die Lebensmitteltechnologen aber weiterhin kämpfen, ist die Textur von Muskelfleisch, das beim Tier zusätzlich von Fett und Bindegewebe durchzogen ist. Nicht ohne Grund haben Mark Post und seine Kollegen in London ein Burger-Patty und kein Steak vorgestellt. Und bis heute sind „Flakes und Faschiertes deutlich einfacher zu erzeugen als große Gewebestücke“. Das sagt Henry Jäger. Der Mann ist Professor und Leiter des Instituts für Lebensmitteltechnologie an der Universität für Bodenkultur in Wien. „Das große Gewebestück muss gleichmäßig mit Nährstoffen versorgt werden“, erklärt er. Derzeit experimentiere man damit, Fleischzellen auf Trägerstrukturen zu züchten, „um größere Geometrien herzustellen“.
Das können etwa Raster aus Weizenproteinen sein, wie sie bei Aleph Farms zum Einsatz kommen. In Geschmack und Aussehen komme man schon ziemlich nahe an das Original heran, allerdings eben einfach nicht bei der Textur, „dem Mundgefühl“, wie Jäger sagt. Das dafür notwendige Fett muss beim Laborfleisch extra erzeugt werden. Dann wird das Fleisch zusammengebaut. Aleph Farms, das Unternehmen hinter Lucy, experimentiert bereits mit 3-D-Druckern, um Knochen und Fettmarmorierung im Steak imitieren zu können. Laborfleisch ist ein hochkomplexes Lebensmittel.




Warum tut man sich das überhaupt an? Die Fleischwirtscha ist je nach Schätzung für rund 15 Prozent des weltweiten Ausstoßes an klimaschädlichen Gasen verantwortlich. Die drei größten Fleischkonzerne der Welt blasen jährlich mehr klimaschädliche Gase in die Lu als die gesamte Republik Frankreich. Etwa 70 Prozent der landwirtscha lich nutzbaren Fläche der Erde sind reserviert für die Viehhaltung und deren Futtermittelproduktion. Dafür roden Bauern weiterhin Regenwald, sie bringen die Wasserhaushalte und Sticksto reisläufe durcheinander. Es geht um ein Geschä in Höhe von einer Billion Dollar weltweit. Die Deutsche Gesellscha für Ernährung hat für Aufsehen gesorgt, als sie im März ihre Ansichten für eine gesundheitsfördernde und umweltschonende Ernährung veröffentlichte –

Als Vorreiter im Bereich Green Banking leben wir seit 2012 mit dem Umweltcenter der Raiffeisenbank Gunskirchen unsere Vision einer grünen Bank. Mit unserem Private Banking gehen wir unseren Weg konsequent weiter und ergänzen unser nachhaltiges Angebot im Bereich Vermögensverwaltung und Veranlagung. Wir veranlagen Ihr Geld mit Mehrwert.


»In 50 Jahren werden wir die Torheit überwunden haben, ein ganzes Hühnchen zu züchten, wenn wir doch eigentlich nur dessen Brust oder Keule verzehren wollen
und nur noch 300 Gramm Fleisch, oder in etwa drei Bratwürste, und ein Ei pro Woche empfahl.
Laborfleisch habe einen um 95 Prozent verringerten ökologischen Fußabdruck, sagt das Good Food Institute, das sich allerdings dem Laborfleisch als Alternative verschrieben hat. Das Institut räumt selbst ein, dass dieser Wert nur erreicht werden kann, wenn die Energie für den Züchtungsprozess aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Die Bioreaktoren, in denen die Fleischzellen schwimmen, brauchen Strom, um zu arbeiten. Eine Studie der Universität Oxford kam 2010 zu ähnlichen Ergebnissen, demnach hat Laborfleisch im Vergleich zu konventionell produziertem Fleisch einen um 35 bis 60 Prozent verringerten Energieverbrauch und erzeugt um bis zu 95 Prozent weniger Ausstoß schädlicher Gase. Doch das sind alles Modelle.
Kritiker werfen ein, dass – rein klimaschutztechnisch – im Vergleich zur konventionellen Rinderzucht das Laborfleisch langfristig eine schlechtere Bilanz aufweisen könnte; vor allem, wenn die Tanks nicht aus Strom von erneuerbaren Quellen gespeist werden. Das von den Rindern ausgestoßene Gas Methan ist zwar unmittelbar klimaschädlicher, verschwindet aber deutlich schneller aus der Atmosphäre als CO2
Warum wehren sich die Bauern? Der Prozess hinter dem Produkt Laborfleisch heißt „Tissue Engineering“ und hat, wie oben beschrieben, tatsächlich wenig mit der traditionellen Aufzucht von Tieren zu tun, wie der Mensch es seit der neolithischen Revolution betreibt. Man könnte einwenden, dass die moderne Massentierhaltung ebenso wenig Ähnlichkeit damit aufweisen kann.
Besonders die österreichischen Bauern betonen indes stets die kleinräumige Bewirtscha ung der Kulturlandscha . Die Landwirtscha skammern versuchen, mit großen Kampagnen gegen das Laborfleisch anzukämpfen. Die Landwirtscha skammer Steiermark lässt Unterschri enlisten in den Bezirksämtern dagegen auflegen, in Kärnten will der Agrarreferent von der ÖVP eine Konsumentenbefragung durchführen, die „Vollversammlung der Landwirtscha skammer Tirol fordert von der Bundesregierung, umgehend auf EU-Ebene und nationaler Ebene sicherzustellen, dass Laborfleisch nicht in den Verkehr gebracht wird“, heißt es von dort. Der Präsident Josef Moosbrugger will das Fleisch nicht. Kurz: Die Bauernvertreter sind sich einig – sie sind dagegen. Was aber, wenn ausgerechnet Laborfleisch den Bauern einen Ausweg bieten könnte, weil es ihnen den Druck nehmen würde, besonders billig zu produzieren? Das zumindest sagt die Österreicherin Patricia Bubner, eine promovierte Biotechnologin, die im Silicon Valley mit dem Startup Orbillion Laborfleisch erzeugt. „In der Zukun , die ich sehe, ersetzt kultiviertes Fleisch Produkte aus industrieller Massentierhaltung, und Bauern können mit ihren traditionell produzierten Produkten höhere Margen mit kleineren Herden erzielen“, erklärte sie im März gegenüber der Kleinen Zeitung
Einen Kritikpunkt der Bauern kann aber auch Bubner nicht wegwischen: nämlich dass hinter der Technologie Risikokapitalgeber und die großen Lebensmittelkonzerne stehen. Von einer „Industrielobby“, die alles aufsaugen werde, spricht Landwirtscha s-
Flakes und Faschiertes sind deutlich einfacher zu erzeugen als große Gewebestücke, die gleichmäßig mit Nährstoff en versorgt werden müssen
HENRY JÄGER, LEBENSMITTEL TECHNOLOGIE, BOKU WIEN
minister Totschnig. Den ersten Burger von Mark Post in London hat einer der Google-Gründer mitfinanziert. Hinter dem israelischen Start-up Aleph Farms mit Lucy steht Cargill, einer der weltweit größten Nahrungsmittelkonzerne mit mehr als 160 Milliarden Euro Jahresumsatz. Der kleinere amerikanische Mitbewerber Tyson hält sich mit Upside Foods in Kalifornien ebenso eine eigene Sparte für Laborfleisch. 2021 haben Risikokapitalgeber eine Rekordsumme von rund einer Milliarde Dollar in die Branche gesteckt – seither aber fallen die Zuwendungen.


Was haben die Konsumenten dagegen? Die Risikokapitalgeber argumentieren mit einer allgemeinen Investitionsmüdigkeit, doch möglicherweise steckt mehr dahinter, nämlich schlichtweg eine Ablehnung der Konsumenten. Henry Jäger von der Boku erklärt das so: „Die Bedürfnisse der Konsumenten sind regionale und ‚natürliche‘ Lebensmittel“. Dem widerspreche Laborfleisch dann doch wesentlich. Allein die
Bezeichnung „Laborfleisch“ rufe völlig falsche Assoziationen hervor.
Abschreiben will der Wissenscha ler das Fleisch aus dem Bioreaktor aber nicht. Es müsse noch mehr geforscht werden und die Produkte müssten noch besser werden, sagt er. Es ist also vielleicht einfach noch zu früh, die Revolution auszurufen. Zumal Pioniere in ähnlichen Bereichen gerade abstürzen: Unternehmen wie Beyond Meat und Impossible Foods, die Fleischersatz aus Pflanzenprotein herstellen und Kooperationen mit globalen Ketten wie McDonald’s eingingen, haben an der Börse deutlich nachgegeben und 80 Prozent ihres Marktwerts verloren.
Die Vorreiter haben zum einen Konkurrenz von anderen Herstellern bekommen, müssen sich aber auch dafür rechtfertigen, eben keine „natürlichen“ Lebensmittel zu produzieren. Die Extrusion, die Schlüsseltechnologie hinter den pflanzlichen Fleischalternativen, kommt aus der Plastikproduktion. Mit ähnlichen Argumenten könnte auch das Laborfleisch dereinst zu kämpfen haben. Die Hühnernuggetsproduktion in Singapur jedenfalls hat man wieder eingestellt.
In Österreich ist der Fleischkonsum seit mehreren Jahren rückläufig, zuletzt lag er statistisch bei rund 88 Kilogramm pro Jahr und Kopf – um knapp sieben Kilogramm unter dem Zehnjahresdurchschnitt.
Und Lucy? Die Kuh aus Kalifornien starb 2022. Ihre Zellen leben seither weiter. Aleph Farms hat Anfang Jänner die Zulassung bekommen, die daraus gezüchteten „Cuts“ in Israel zu verkaufen. F






















Der deutsche Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) will dorthin, wo Österreich schon bald ist: 30 Prozent der landwirtscha lichen Fläche hätte er gern ökologisch bewirtschaftet. Derzeit steht Deutschland bei einem Zehntel, Österreich immerhin schon bei 28 Prozent und damit auf Platz eins in der EU. Doch Özdemir bekommt wie die österreichischen Biobauern nun ö er etwas zu hören, was besonders wehtut: dass die Arbeit der Biobauern für das Klima gar nicht gut sei. Im Gegenteil: Weil sie pro Hektar Fläche am Ende weniger Obst, Gemüse und Getreide vom Acker führen können als ihre konventionell wirtscha enden Kollegen, seien sie sogar besonders gefräßige Bodenverbraucher. Und erst ihre Tiere! Bekommen Biorinder und Ökoschweine doch deutlich mehr Platz als ihre Artgenossen, auf dem sie dann auch noch länger herumstehen und Fleisch anlegen dürfen, bevor es ab ins Schlachthaus geht. Je höher der Bio-Anteil wird, desto stärker fielen seine „kontraproduktiven Effekte“ ins Gewicht, schallt es auch Özdemir von manchen Agrarexperten entgegen.
„Öko macht auch Dreck“ und die Klimabilanz der Biobauern sei ebenfalls „nicht toll“, titelte die durchaus umweltbewusste Berliner Zeitung taz einmal. Weil Bio mehr Platz braucht, so heißt es, gingen Flächen verloren, auf denen stattdessen Wald oder Wildnis wachsen und man Kohlendioxid speichern könnten. Im schlechtesten Fall müssten gar Felder in anderen Teilen der Welt die geringeren Erträge ausgleichen. Ist es also für die Umwelt wurscht, ob die Konsumentinnen und Konsumenten bio oder konventionell in ihre Einkaufswägen legen? Sind die Käufer von Bioerdäpfeln oder -fleisch am Ende gar daran schuld, dass noch mehr Regenwald abgeholzt wird?
Die Studien zu dieser Frage bringen Schlagzeilen mal pro, mal contra Bio hervor. Viel beachtet war etwa ein Gutachten des Wissenscha lichen Beirats für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz, der das deutsche Bundeslandwirtscha sministerium berät. Da der Biolandbau mehr Äcker benötige, „scheint der Konsum von Ökolebensmitteln keine eindeutige ‚Klimamaßnahme‘ zu sein“. Daher sei auch die „pauschale Förderung des Ökolandbaus allein aus Gründen des Klimaschutzes nicht zielführend“, schreibt der Beirat. 2021 erschreckte gar der „Biopapst“ Urs Niggli – er leitete 30 Jahre lang das Schweizer Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) – die eigene Branche mit dem Buch „Alle satt?“. „So wie der Biolandbau heute funktioniert, eignet er sich nicht, um das Problem der globalen Ernährungssicherheit auf nachhaltige Art zu lösen“, schrieb er. Die Erträge seien zu niedrig, auch, weil die Biobauern „bei technologischen Innovationen übervorsichtig“ seien. Dabei sagt Niggli immer noch: Ökologisch bewirtscha ete Böden blieben anders als intensiv genutzte auf Dauer fruchtbar. Überhaupt


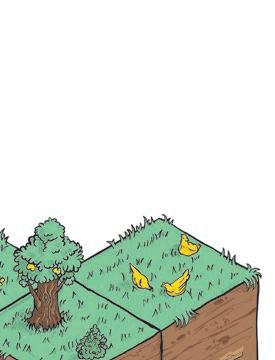

Weil die Öko-Landwirtscha pro Fläche weniger erntet, sei sie schlechter fürs Klima als ihre konventionelle Schwester, heißt es o . Was ist da dran?
BILANZWÄLZEREI: GERLINDE PÖLSLER
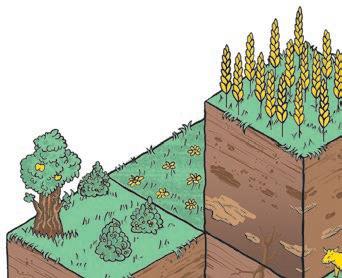



sei Bio insgesamt für die Umwelt unschlagbar. Dennoch: „Die Herausforderung ist, den Boden zu erhalten und genug für zehn Milliarden Menschen zu produzieren“, erklärte er dem Falter: „Nur die Landwirtscha , die beides kann, hat eine Zukun . Und die existiert aus meiner Sicht noch nicht.“ Niggli sucht nun nach Methoden, die gesamte Nahrungsmittelproduktion nachhaltiger zu machen.
Dann kam auch noch der britische Autor und Umweltschützer George Monbiot daher und behauptete in seinem Buch „Regenesis“: „Es gibt kein schädlicheres landwirtscha liches Produkt als Fleisch aus biologischer Weidehaltung.“ Gerade für Rinder kommen auch andere Studien zu ähnlichen Schlüssen: Weil diese mehr Auslauf erhalten und länger brauchen, bis sie genug Fleisch angesetzt haben, entstünden hier pro Kilo viel mehr Emissionen.
Bio als Klima-Buhmann und Luxusvergnügen für Bobos, das aber die Massen nicht sattkriege, ja ihnen gar etwas wegnehme: Diese Argumentation freut konventionelle Agrarvertreter. So ist für Alexander Bernhuber, EU-Abgeordneter der ÖVP, klar, dass Pestizide gut fürs Klima seien: Dank ihnen lasse sich auf weniger Platz mehr ernten, „dadurch kann man andere Flächen außer Nutzung stellen, auf denen dann mehr Biodiversität stattfindet“ (siehe Interview auf Seite 10).
Aber was steht wirklich in all den Studien? Bei genauem Lesen liegen die Ergebnisse am Ende meist gar nicht so weit auseinander.
Einig sind sich etwa fast alle darin, dass die Biolandwirtscha pro Hektar weniger Treibhausgase rausbläst als die konventionellen Kollegen. Das bestätigte auch der Wissenscha liche Beirat des Deutschen Agrarministeriums in seinem Gutachten.
Auch die Biobauern selbst bestreiten außerdem nicht, dass ihre Wirtscha sweise zumindest derzeit weniger Erträge abwir . Weil sie ihre Ernte nicht mit Kunstdünger pushen dürfen. Und auch keine chemischen Pestizide spritzen dürfen, um gefräßigen Insekten oder „Unkraut“ – die Biobranche spricht lieber von „Beikräutern“ – beizukommen.
Laut Urs Niggli, heute Obmann des Forschungsinstituts FiBL Österreich, liegen die Bio-Erträge im Schnitt um ein Fün el niedriger. Thomas Lindenthal vom Zentrum für Globalen Wandel & Nachhaltigkeit an der Boku, seit 20 Jahren am Thema dran, geht von einem Viertel aus. Die meisten Studien rechnen mit ähnlichen Zahlen.
Sogar bei den Treibhausgasen pro Tonne oder pro Produkt, also etwa auf ein Kilo Tomaten heruntergerechnet, liegen meistens keine Welten zwischen den Studien. Laut dem viel zitierten deutschen Ministeriumsgutachten mit seinen kritischen Schlussfolgerungen hat der Ökolandbau „häufig eher etwa gleich hohe oder nur leicht verminderte“ Emissionen, „in einigen Fällen“ seien sie
höher. Selbst hier ist also nicht davon die Rede, dass der CO2-Rucksack pro Produkt immer höher sei.
Am Ende schloss das Gutachten, „die pauschale Förderung des Ökolandbaus allein aus Gründen des Klimaschutzes“ sei „nicht zielführend“. Sie sagte aber auch: Bio soll weiter gefördert werden. Weil es gut für die Artenvielfalt, den Erhalt des Grünlands, den Boden- und den Tierschutz sei.
Nicht so viel anders fallen die Ergebnisse des deutschen Thünen-Instituts aus, das sich über eine Metastudie von 528 Vergleichsstudien wagte: Die Emissionen je Produkt lägen sowohl bei Pflanzen als auch bei der Milch „wahrscheinlich“ in beiden Systemen gleichauf.
Die Thünen-Forscher betonen aber andere Vorteile von Bio: Die Böden seien teils besser gegen Hochwasser und Erosion gerüstet. Das Wasser werde weniger belastet, die Böden seien fruchtbarer. Über den Öko-Feldern fliegen mehr und mehr verschiedene Vögel wie auch Insekten, die Blüten besuchen, und es wachsen sogar fast doppelt so viele verschiedene Pflanzenarten. Über alle Indikatoren hinweg habe die Öko-Sparte bei 58 Prozent der Vergleichspaare die Nase vorn, nur bei 14 Prozent liege sie schlechter.
Christian Vogl, Leiter des Instituts für Ökologischen Landbau an der Wiener Boku, beeindrucken die Zahlenspielereien überhaupt nicht. Erstens fielen in der Biolandwirtscha sämtliche Emissionen weg, die beim Herstellen des besonders energieaufwändigen synthetischen Stickstoffdüngers und der synthetischen Pestizide entstehen – und die die Bauern am Gängelband der Fossilindustrie halten. Das werde o gar nicht mitkalkuliert.
Zweitens greife die Debatte viel zu kurz, weil sie nur einen einzigen Umweltindikator herauspicke. Vogl nennt das „Greenwashing der konventionellen Landwirtscha : Deren Höchsterträge sind nur möglich, weil die Folgekosten auf die gesamte Gesellscha ausgelagert werden: für Umweltschäden, Trinkwasserreinigung oder Krankheiten, die durch synthetische Pestizide entstehen.“
Vogl findet es auch absurd, dass sich immer noch alles ausschließlich um Höchsterträge dreht – und sich gleichzeitig an zwei Stellschrauben nichts bewegt: Dass Berge an Lebensmitteln immer noch im Müll landen. Und dass aufgrund des enormen Fleischkonsums auf rund 60 Prozent der Flächen in der EU Tierfutter wächst. „Es sind auch nicht die Biobauern, die für das Abholzen von Regenwäldern, damit Futtermittel erzeugt werden können, verantwortlich sind“: Biorinder fressen vorwiegend Gras und Heu; und BioAustria-Bauern dürfen nur Kra futter verwenden, das vom eigenen Hof oder von einem europäischen Biobetrieb stammt.
„Wenn wir den Fleischkonsum und die vermeidbaren Lebensmittelabfälle verringern, dann kann der Bioland-
bau sehr wohl die Welt ernähren“, sagt Nachhaltigkeitsforscher Thomas Lindenthal, der für Österreich selbst an zahlreichen Studien zum Thema mitgearbeitet hat.
Und an diesem Punkt treffen sich tatsächlich so gut wie alle Forscher: Ob Urs Niggli, der Weltklimarat IPCC oder der Fachbeirat des Deutschen Landwirtscha sministeriums – sie alle predigen seit Jahren: Macht Fleisch teurer! Hört auf, die Stromerzeugung aus Mais zu subventionieren! Sonst geht sich das mit der Ernährung von zehn Milliarden Menschen nicht aus.
Auch die Deutsche Gesellscha für Ernährung hat ihre Landsleute im März mit dem Rat schockiert, sie sollten nur noch höchstens 300 Gramm Fleisch pro Woche essen, also etwa ein Schnitzel und fünf Scheiben Wurst. Auch ein Ei wöchentlich und höchstens 400 Gramm Milch oder Milchprodukte seien genug. Sie begründete das nicht nur mit der Gesundheit, sondern auch mit den Emissionen, die tierische Lebensmittel verursachen. Übrig bleibt: Esst weniger Fleisch, Milch, Eier –nicht weniger Bio.
Heißt das jetzt, die Biobauern können sich zurücklehnen? Keineswegs,
mahnt eine Studie der TU München: Die Erträge müssten weiter nach oben, „weil hiervon die Wettbewerbsfähigkeit, das Au ommen an Biolebensmitteln sowie die produktbezogenen Umweltwirkungen abhängen.“ Die Forscher schlagen zum Beispiel vor, leistungsfähigere Sorten zu züchten und neue biologische Wirkstoffe gegen Pflanzenkrankheiten zu finden. Das wird schon, meint Boku-Forscher Christian Vogl. Ob Tierhaltung, Pflanzenbau oder Landtechnik: „Biobauern sind sehr innovativ und experimentierfreudig, das haben sie in den letzten 60 Jahren gezeigt.“ F

Die Mission von Wertgarantie für weniger Elektroschrott.
Technische Geräte sind alltägliche Helfer und Begleiter. Haben sie einen Defekt, ist man ganz schön aufgeschmissen. Eine Reparatur ist meist recht kostenintensiv und scheint oftmals in Anbetracht des Zeitwerts eines Geräts wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll. Dreiviertel der Verbraucher entscheiden sich laut der repräsentativen „Reparieren statt Wegwerfen“-Studie des Spezialversicherers Wertgarantie gegen eine Reparatur, ein Drittel davon wegen zu hoher Kosten. Und: Viele wissen gar nicht, wo sie ihre defekten Geräte reparieren lassen können. Lediglich jeder Vierte kennt einen geeigneten Reparaturbetrieb in der Nähe. Das ergab eine weitere aktuelle, repräsentative Befragung von 2.145 Haushalten in Österreich durch Wertgarantie.
Allerdings verlängern Reparaturen die Nutzungsdauer von Geräten und schonen damit Ressourcen und Umwelt. Wenn die Reparaturquote nur um ein Viertel erhöht würde, ließe sich die Gesamtmenge an Elektroschrott pro Jahr um 6.892 Tonnen reduzieren.
Nahegelegenen Reparaturbetrieb über die Wertgarantie-Werkstattsuche finen „Wir gehen stark davon aus, dass die Bekanntheit von Reparaturbetrieben in Wohnortnähe einen signifikanten Einfluss auf die Reparaturbereitschaft hat. Je mehr professionelle Möglichkeiten zur Reparatur vorhanden sind, desto eher lassen Verbraucher ihre defekten Geräte reparieren. Mit unserer Werkstattsuche tragen wir zum Auf finden von geeigneten Reparaturbetrieben bei“, erklärt Wertgarantie-Vorstand Konrad Lehmann.
Unter www.wertgarantie.at/werkstattsuche können Verbraucher schnell einen geeigneten Reparaturbetrieb in ihrer Nähe finden und verschiedene Angebote miteinander vergleichen. Damit will der Spezialversicherer für mehr Reparaturen sorgen und zur Vermeidung von Elektroschrott beitragen. Übrigens: Mit dem Wertgarantie-Komplettschutz können Elektrogeräte je nach Kaufpreis schon ab 3,50 Euro monatlich vor Reparaturkosten geschützt werden.



EEr ist seit langer Zeit wieder einmal hier, auf dem letzten Stück Land, das ihm noch gehört: ein Hektar Mischwald – Buchen, Kiefern, Eschen, Wildkirsch- und Ahornbäume, Fichten – auf einer Anhöhe nahe der Stadt Wasserburg in Oberbayern, nur ein paar hundert Meter vom Inn entfernt. Ein bisschen muss Bartholomäus Grill suchen, bis er den Weg zu der Holzbank findet, die sich im Gebüsch am Waldsaum versteckt. Von dort geht der Blick nach Süden, an klaren Tagen bis zur Alpenkette. Und unten in der Senke liegt der Bauernhof, der nach über 300 Jahren nicht mehr im Besitz seiner Familie ist.
Grill wir einen Blick hinunter, setzt sich, zündet sich eine Zigarette an und beginnt zu erzählen.
Es war einmal: Das ist an dieser Stelle weder ironisch noch romantisierend ge-

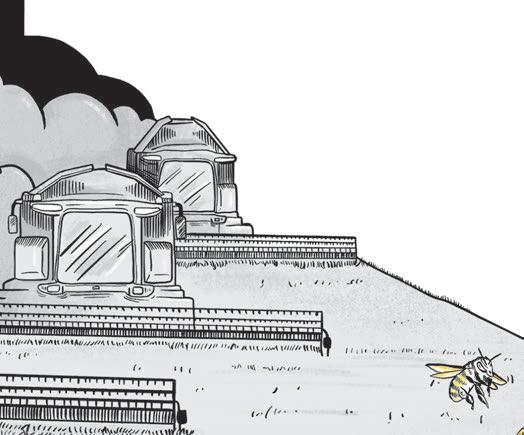



BEGEGNUNG:
MARTIN STAUDINGER
meint, denn Grills Geschichte handelt davon, wie eine kleine Welt kaputtgemacht wurde, in der zwar nicht alles gut, aber vieles besser war – und davon, welche Auswirkungen diese Zerstörung auch auf die große Welt hatte. Sie beginnt hier, wo Grill aufgewachsen ist, sie spielt aber auch in Brüssel und in Afrika, wo er nach langen Jahren als Auslandskorrespondent von angesehenen Medien inzwischen lebt. Sie zeigt, wie alles miteinander zusammenhängt: die Zerstörung der traditionellen Landwirtscha in Europa, die Krisen in vielen Entwicklungsländern und der Klimawandel. Und sie kann zwar nicht mehr wirklich gut ausgehen, aber sie endet immerhin mit ein paar Ideen, wie noch zu retten wäre, was von dieser kleinen Welt übrig geblieben ist. Darüber hat Grill ein Buch mit dem Titel „Bauernsterben“ geschrieben, das auch
ein Plädoyer ist: „Für die Erhaltung einer Wirtscha sform, die am Anfang unserer Nahrungskette steht, Einkommen schafft, soziale Identität sti et und gesamtgesellscha liche Wohlfahrtsfunktionen erfüllt, vom Schutz bedrohter Habitate bis zur Bewahrung des Dorflebens“, heißt es darin. Also: Es war einmal ein Bauernhof im bayerischen Voralpenland: „25 Hektar groß, mit Äckern, Weiden und Wald. Wir hatten 22 Milchkühe, die standen den größten Teil des Jahres auf der Wiese, ein paar Schweindln in recht geräumigen Koben und freilaufende Hendln“, erinnert sich Grill. Höfe wie diesen gab es vor gar nicht so langer Zeit noch viele. Alleine in Westdeutschland zählte die Statistik Ende der 1950er-Jahre fast 1,4 Millionen landwirtscha liche Betriebe. Die meisten davon hat-



Er wuchs als Bauernbub in Bayern auf und lernte als Auslandsreporter die ganze Welt kennen. Jetzt beschreibt Bartholomäus Grill in einem Buch, wie alles miteinander zusammenhängt: die Zerstörung der traditionellen Landwirtscha in Europa, die Krisen in Afrika, die Migration und der Klimawandel





ten eine überschaubare Größe. Sie waren eingebettet in ein Wirtscha s-, Sozial- und Ökosystem, das vor allem kleingewerblich geprägt war: Mühlen, Bäckereien, Schmieden, Fleischhauereien, Wagner, Molkereien – eine Kreislaufökonomie, in der kaum jemand reich wurde und niemand ein leichtes Leben hatte, aber sie war nachhaltig und funktionierte. Und zwar nach einfachen Leitsätzen, die Grill so umreißt: Was du aus den Tieren, Böden und Wäldern herausholst, sollst du in gleichem Maße wieder zurückgeben. Gehe sparsam mit den Ressourcen um. Halte das natürliche Gleichgewicht. Seine Vorfahren bis zu den Eltern herauf hätten das gelebt: „Die Verbundenheit mit dem Boden, mit der Natur, mit der Tierwelt – man hat schon das Bäuerliche in sich drin“, sagt er und meint damit auch sich selbst.
Wenn man Sie so hört, könnte man auf die Idee kommen, dass Sie ein Nostalgiker sind, Grill!
„Klar klingt das nostalgisch“, sagt er: „Auch naiv. Aber eigentlich habe ich einen Zorn auf den Wachstumswahn des agroindustriellen Komplexes, der so mächtig geworden ist wie der militärisch-industrielle Komplex.“
Und das kam so: Nach dem Zweiten Weltkrieg stieß das kleinteilige Agrarsystem Europas an seine Grenzen. Der Kontinent war nicht mehr in der Lage, sich ausreichend mit Nahrung zu versorgen, und musste Lebensmittel importieren.
In dieser Situation startete die Europäische Wirtscha sgemeinscha (EWG), der Vorläufer der EU, ein radikales Programm zur Industrialisierung der Landwirtscha : Europa sollte nie wieder Hunger
leiden. Und das wollten die Technokraten in Brüssel nicht nur durch Kunstdünger, hochgezüchtetes Saatgut und Mechanisierung erreichen – sondern auch durch die Zusammenlegung von Klein- und Mittelzu Großbetrieben. Motto: Wachsen oder weichen.
Anfangs schien das für alle zu passen. Die Produktivität stieg enorm, die Profite zogen mit. Auch auf dem Hof der Grills, obwohl dort sehr zurückhaltend mit dem verlockenden Fortschritt umgegangen wurde. „Beim Kirchgang zum Erntedankfest protzten die Bauern mit ihren fetten Erträgen“, schreibt Grill in seinem Buch: „Sie waren jetzt Produzenten, beglückt von den hohen Garantiepreisen der EWG.“
ILLUSTRATION: LILLY GRASCHL Fortsetzung nächste Seite
Fortsetzung von Seite 23
Nicht nur das: Die „grüne Revolution“ ermöglichte einem gesamten Berufsstand den Weg aus einem kärglichen Hinterwäldlertum in die Moderne mit ihren Annehmlichkeiten. Wasserklosett, Kühlschrank, Farbfernseher, Zentralheizung – all das hatte es auf vielen Bauernhöfen bis in die 1960erJahre nicht gegeben. Jetzt konnte man es sich leisten, mehr noch: sogar einen Pkw. Und das hieß: Der kleine Bartholomäus Grill musste sich nicht mehr dafür genieren, dass ihn sein Vater mit dem Traktor zum Zahnarzt in die Stadt brachte.
Das Modernisieren funktionierte aber fast teuflisch gut. Der Ertragsreichtum der Landwirtscha wuchs sich zur Überproduktion aus, in den Lagern häu en sich Unmengen von Getreide, Zucker, Butter, Fleisch und Milch an, für die es keinen Bedarf gab. Die Technokraten, die diese Entwicklung in guter Absicht eingeleitet hatten, mussten nun das Gegenteil versuchen: Die Erzeugung drosseln – etwa durch eine 1984 eingeführte Milchquote.
Dabei kam auch der Hof, der seit dem Jahr 1720 im Besitz der Familie Grill gewesen war, immer mehr unter Druck. Der Betrieb erzeugte mit seinen zwei Dutzend Kühen mehr Milch, als das ihm zugewiesene Kontingent erlaubte, und musste Strafe zahlen. Derartige „Superabgaben“ trafen zehntausende Landwirtscha en mit wenig Viehbestand. Je größer die Rinderherde, desto höher die Milchquote; je kleiner, desto geringer – und damit auch der Ertrag. Das kostete alleine im ersten Jahr der Milchquote 34.000 Höfen in Deutschland die Existenz. Gleichzeitig stieg die Zahl der Kühe aber immer weiter.
Über die Jahre verstärkte die Landwirtscha spolitik der EWG (die 1993 in der EU aufging) diese Tendenz. Ende der 1980er-Jahre blieb der Familie Grill nach Abzug aller Kosten ein monatliches Nettoeinkommen von umgerechnet 1000 Euro. „Anfang der 1990er-Jahre waren sie auf SozialhilfeNiveau angekommen“, erinnert sich Grill. Die Zahl der Landwirtscha en in Deutschland hatte sich zu diesem Zeitpunkt im Vergleich zu den 1950ern um fast 700.000 auf die Häl e verringert, inzwischen ist sie auf etwas mehr als 200.000 gesunken.
Der jüngste Bruder, der den Hof übernahm, versuchte es in den 1990ern noch mit biologischem Landbau. Als auch das an der Schuldenlast scheiterte, die sich angehäu hatte, verscherbelte er hinter dem Rücken der Geschwister den Hof.
„Jetzt gehört er einem Eventmanager aus München“, sagt Grill, und wie er das sagt, das sagt vieles: „Alles, was ich noch tun konnte, war: den Familienstammbaum im Hausflur abzunehmen. Nach 300 Jahren.“
Ihm selbst ist nur noch das Stück Forst geblieben, auf dem das Aussichtsbankerl steht: „Der Wald meiner Ahnen“, wie er es ganz unironisch nennt. Hier lehnt an einem Baum ein Holzkreuz für einen viel zu früh verstorbenen Bruder; hier hat ihm der Vater beigebracht, wie man Pilze und Pflanzen bestimmt; hier liegen liebgewonnene Haustiere begraben; hier ist er o mit seinen Geschwistern gesessen und hat den Blick und die Ruhe genossen.
Grill schaut noch einmal auf das Anwesen hinunter, das inzwischen zum Reithof geworden ist, und dämp seine Zigarette (die dritte) aus: „Fåhr ma! Es gibt hier in der Gegend noch einiges zu sehen.“
Man darf sich Bartholomäus Grill nicht als verbittert oder gar weinerlich vorstellen.

Zur Person Bartholomäus Grill, geboren 1954 in Oberaudorf am Inn, studierte Philosophie, Soziologie und Kunstgeschichte und arbeitete danach als Kulturjournalist. 1987 wechselte er ins Politikressort der Zeit, ab 1993 als deren Korrespondent nach Afrika. Von 2005 bis 2009 gehörte er zum Afrika-Beraterkreis des damaligen deutschen Bundespräsident Horst Köhler, danach kehrte er nach Südafrika zurück. Derzeit arbeitet er von Kapstadt aus, wo er mit seiner Familie lebt, für den Spiegel. Grill hat mehrere Bücher geschrieben, darunter „Ach, Afrika“, „Um uns die Toten“ und „Wir Herrenmenschen. Unser rassistisches Erbe: Eine Reise in die deutsche Kolonialgeschichte“
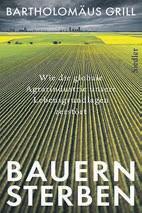
Bartholomäus Grill: Bauernsterben. Wie die globale Agrarindustrie unsere Lebensgrundlagen zerstört. Siedler Verlag, 240 S., € 24,70
Ein bisschen melancholisch, ja. Aber vor allem hat er diesen archetypischen bayerischen Grant, der ohne einen guten Schuss Anarchismus nicht auskommt.
Und man könnte gar nicht falsch genug liegen, wenn man ideologische Schlüsse daraus ziehen würde, dass er heute einen grauen Trachtenjanker trägt: „Tradition ist nicht bloß eine konservative Angelegenheit. Die darf man nicht der CSU und den Rechten überlassen“, findet er. Und meint damit diejenigen, die besonders lauthals die Tradition beschwören, aber gleichzeitig ihre Grundlagen zerstören. Die bei der Sonntagsmesse in der ersten Kirchenbank sitzen, am Mittwoch im Gemeinderat die nächste Grünland-Umwidmung durchwinken und das am Samstag in „Event-Locations“ feiern, die früher einmal Wirtshäuser waren: „Da gibt es jetzt Schrei- und Saufveranstaltungen, die sich ‚Kuhdreckfest‘ nennen“, sagt Grill, und dabei beutelt es ihn zumindest innerlich.
Eigentlich ist er, wie er es selbst nennt, ein „Bankert“, das Produkt eines gschlamperten Verhältnisses. Seine Mutter stammt von einem Bergbauernhof nahe der österreichischen Grenze, auf dem Grill auch seine frühen Kinderjahre verbrachte; der Vater von dem inzwischen verloren gegangenen Hof bei Wasserburg im Voralpenland. Dorthin kommt der kleine Bartl erst, als seine Eltern von ihren Familienoberhäuptern zur Heirat genötigt werden: „Für mich war der Umzug ins Voralpenland eine Art Vertreibung aus dem Paradies“, sagt er heute.
Als der Niedergang des Familienbetriebs offenkundig wird, hat Grill längst in einem ganz anderen Metier Fuß gefasst. Er ist Journalist geworden und nach Hamburg gegangen, wo er 1987 bei der Zeit anheuerte. Die schickte ihn 1993 nach Südafrika, wo er einen großen Teil seines beruflichen Lebens verbrachte, unter anderem auch als Berater des deutschen Bundespräsidenten, derzeit als Autor für den Spiegel. Inzwischen hat er sich mit seiner Familie dauerha in Kapstadt niedergelassen.
Doch selbst in Afrika, tausende Kilometer von Oberbayern entfernt, trifft Grill auf die fatalen Folgen der Landwirtscha spolitik in seiner europäischen Heimat. Zum Beispiel in den Ländern der Sahel-Zone, die in den 1980er-Jahren zu einer Art Entsorgungszone für die Überproduktion Europas wurden: Unmengen von hochsubventioniertem Fleisch kamen billigst auf den Markt und ließen die Preise verfallen. Die einheimischen Viehbauern reagierten darauf, indem sie ihre Rinder nicht mehr verkau en. Das wiederum führte dazu, dass die Herden immer größer wurden und die ohnehin spärlichen Weideflächen der Region überforderten. Was wiederum die Erosion und damit den Klimawandel sowie seine Folgen verstärkt – und damit auch den Migrationsdruck.
Was die globale Agrarindustrie seit Jahrzehnten tut, ist für Grill nichts anderes als ein Krieg gegen Natur und Mensch, er nennt sie in seinem Buch „eine der destruktivsten Krä e, die die Menschheit je entfesselt hat“. Entsprechend martialisch fällt auch sein Vokabular aus. „Schau, da san s’, die Agrar-Waffenhändler“, sagt er auf der Rückfahrt von seinem Wald: Neben der Bundesstraße stellt ein Landmaschinenhändler die neuesten Traktormodelle aus – wuchtige Trümmer, die schon im Stehen einen Eindruck davon vermitteln, wie sie über die Felder walzen werden.
Als eine Art „Gefechtseinsatz“ beschreibt er im Prolog zu „Bauernsterben“ die Erntearbeiten auf einem Feld, die ihn zu seinem Buch inspiriert haben: „Attacke! Die Schneidwerke fressen sich hinein in das Heer der Maisstauden. Vom Ausleger, der aussieht wie ein Geschützrohr, wird der geschredderte Mais auf einen dreiachsigen Seitenkipper namens ,Gigant‘ geschossen. Männer in gelb-grünen Umformen verfolgen das Geschehen vom Feldrain aus …“ Nicht jeder hört so etwas gerne, in Bayern eigentlich: fast niemand. Kürzlich hat Grill in Regensburg aus „Bauernsterben“ gelesen. Er beleidige damit einen ganzen Berufsstand, musste er sich anschließend von einer empörten Kreisbäuerin an den Kopf werfen lassen: Er möge sich gefälligst öffentlich dafür entschuldigen. Der Großteil des Publikums sah das ähnlich. „Für manche sind die Grünen heute das, was früher die Kommunisten waren“, spöttelt Grill. Man kann die Folgen der Agrarindustrialisierung verleugnen und verdrängen: zugrunde verdichtete Ackerböden, nitratverseuchtes Grundwasser, abgetötete Feldraine. Manche Verheerungen sieht man nicht auf den ersten Blick. Dass in Deutschland seit den 1950ern mehr als eine Million Landwirtscha sbetriebe stillgelegt wurden, fällt auch nicht sofort auf: Viele Höfe verfallen unbeachtet, bei anderen wird die Unproduktivität durch eine neue Verwendung behübscht: als schicke Veranstaltungslocations, Ferienquartiere oder Reithöfe.
Aber es gibt Folgen, die unübersehbar sind. Man begegnet ihnen auf der Fahrt mit Grill durch die sozial und wirtscha lich entkernten Dörfer Oberbayerns. Schuster, Schreiner, Schmied – an manchen Häusern hängen noch die alten Schilder, hinter den Fassaden gähnende Leere. Wir suchen ein Wirtshaus, aber alle haben zu, was nicht nur damit zu tun hat, dass Montag ist. Letzte Rettung: Systemgastronomie, es gibt Selchfleisch mit Blaukraut und Erdäpfeln von der Selbstbedienungstheke. Bier wird hier nicht ausgeschenkt, Bayern 2024. Lässt sich die Landwirtscha noch vor der Agrarindustrie retten, Herr Grill? „Da bin ich pessimistisch. Die Machtstrukturen wirken unüberwindlich, der Einfluss der Agrarlobby ist zu stark.“
Aber man muss es versuchen, in „Bauernsterben“ hat Grill einige Möglichkeiten aufgelistet. Zum Beispiel die Umleitung unsinniger EU-Subventionen von der Agrarindustrie zu nachhaltig wirtschaftenden Betrieben. Die Schaffung von Gemeinwohlprämien, mit denen Leistungen für Klima und Umwelt, Artenschutz und Landscha spflege honoriert werden. Die konsequente Bestrafung von Qualzüchterei und die strenge Regulierung von Agrarfabriken. Und eine Digitalisierung, die dabei hil , Bodenbewirtscha ung und Tierhaltung möglichst schonend zu betreiben. Und es sind positive Ansätze zu erkennen. In Deutschland werden inzwischen mehr als 14 Prozent aller Höfe biologisch betrieben, in Österreich sind es sogar 23 Prozent. Erzeugergenossenscha en greifen wieder auf altbewährte Methoden von Ackerbau und Viehzucht zurück. Crowdfarming-Initiativen helfen ökologisch arbeitenden Bauernhöfen, ihre wirtscha lichen Risiken besser in den Griff zu kriegen. Die kleine Welt, in der Bartholomäus Grill aufgewachsen ist, wird es nie wieder geben. Aber es ist möglich, ein bisschen etwas von ihr zurückzuholen. F
Gesprächspartner auf vier Beinen: wer mit Eseln wandert, entschleunigt


Eine kreative uszeit im arte n sterreichs geni eß en, Einheimische und lltagskultur kennenlernen, mit Slow Trips die Region entdecken
In der Oststeiermark, dem Garten Österreichs, gibt die Natur den Ton an. Hier findet man Almwiesen voller Wildkräuter und Orchideen, romantische Blumendörfer sowie sonnige Obst- und Weingärten. Tradition und Nachhaltigkeit werden hier mit Leidenschaft gelebt und bieten eine unvergleichbare Landidylle.
Wer nach ein bisserl mehr Abenteuer im Urlaub strebt: Es geht auch so. Ja, du musst nicht mal weit reisen, um langsam anzukommen: „Slow Trips“ ist eine Idee aus Österreich. Neun Reiseziele in sechs europäischen Ländern haben sich zu einem transnationalen EU-LEADER-Projekt unter oststeirischer Federführung (LEADER-Region Oststeirisches Kernland in Kooperation mit Verein f. Zukunftsinitiative Oststeiermark) zusammengeschlossen: www.slowtrips.at. Die allesamt ländlichen Regionen konzentrieren sich auf nachhaltiges Reisen abseits des konventionellen (Massen-) Tourismus. Was all diese Reiseziele trotz ihres unterschiedlichen Charakters von Land und Leute

NACHHALTIG URLAUBEN
3 Nächte mit Frühstück in einer nachhaltigen Unterkunft, Begrüßungsgetränk, Rad- und Wandertipps ab € 157,–Package jetzt anfragen ▶ www.oststeiermark.com
gemeinsam haben: Nicht der Reiseführer oder die Handy-App in der Hand erläutern staubtrocken Historisches über die Region, sondern Einheimische erzählen ihre Geschichten oder Geschichten ihrer Vorfahren und von Zeitzeugen, hautnah und lebendig. Oft wird man zu verborgenen Schätzen geführt, die ansonsten für Touristen nicht zugänglich sind. Es geht um Alltagskultur und gelebte Traditionen. Und ganz wesentlich, um kulinarische Spezialitäten, denn immerhin sind wir der Garten Österreichs.
Die oststeirischen „Slow Trips“ können von unkonventionell bis hin zu komplett ausgefallen und neuartig sein. Ob du klimafreundliche Mobilitätsangebote nutzt, wie etwa mit einer FahrradDraisine den Gleisen entlang radelst, zu Fuß im Wald oder auf der Alm mit Yoga und Achtsamkeit dich selbst spürst, auf der Schlosskutsche den Tierpark erlebst oder mit dem Fahrrad Lost Places erkundest, in zertifizierten Unterkünften mit dem Green Globe oder dem österreichischen Umweltgütesiegel übernachtest oder auf einem Bauernhof, in einer Almhütte oder auf einem Campingplatz verweilst – die Oststeiermark hält nachhaltige Erlebnisse für jeden Geschmack bereit.
Kulinarisch erwartet dich das Beste aus der Region: Genieße regionale und saisonale Lebensmittel direkt vom Erzeuger in Bauernläden und auf Bauernmärkten oder in Selbstbedienungsläden. Erkunde die Naturparke Almenland und Pöllauer Tal sowie zahlreiche Natur- und Europaschutzgebiete, die dir umweltfreundliche Aktivitäten und besondere Naturerlebnisse vermitteln. Und wer abends nach ein bisserl Unterhaltung sucht: Unsere TaxiTänzer-Bars und Buschenschenken bieten dir genau das Richtige.

Fermentations-Workshop: Regionale Köstlichkeiten selbst gemacht
SLOW TRIPS: LERNE DAS GRUNDHANDWERK DES FERMENTIERENS
Bei einem spannenden und unterhaltsamen Workshop am BIO Kräuterhof Zemanek erlernst du die Kunst der Fermentation mit Milchsäurebakterien. Diese Methode des Haltbarmachens von Gemüse zählt zu den ältesten Methoden der Lebensmittelverarbeitung. Buchung unter www.slowtrips.eu/de/ regionen/oststeiermark



FARN- UND BLÜTENPFLANZEN




stehen in Österreich auf der Roten Liste. Das entspricht mehr als einem Drittel der rund 3500 heimischen Arten. 66 dieser Arten sind bereits ausgestorben, weitere 235 in Österreich vom Aussterben bedroht. Laut Umweltbundesamt ist der Haupttreiber dafür die Zerstörung von Biotopen.

ARCHE NOAH
In den 1980er-Jahren erkannten Bauern und Gärtnerinnen, dass Gemüse-, Obst- und Getreidesorten zunehmend verschwanden und durch nicht nachbaufähige Hybridsorten ersetzt wurden. Um gefährdete Kulturpflanzen zu retten, gründeten sie die niederösterreichische „Samenpflegevereinigung“ und den steirischen Verein „Fructus“. Beide Vereine verschmolzen 1990 zur Arche Noah, die heute mehr als 17.000 Mitglieder und Unterstützer zählt. Der Verein pflegt tausende gefährdete Sorten und setzt sich auch politisch für ihren Erhalt ein. Auf sein Betreiben hin führt Österreichs UNESCO-Kommission das „Wissen um traditionellen Samenbau und Saatgutgewinnung“ als immaterielles Kulturerbe.

Die Europäische Kommission zeichnete das Umweltprogramm „Flora“ im Jahr 2022 als erstes österreichisches Projekt mit dem Naturschutzpreis „Natura 2000 Award“ aus. Flora hil Gemeinden, Organisationen, Landwirtinnen und Landwirten in Naturschutzgebieten mit Expertise und Geld dabei, ökologisch wertvolle Flächen für die Artenvielfalt zu erhalten. Und so Blumenwiesen, Wälder, Auenlandscha en und Moore nachhaltig zu bewirtscha en. Das Projekt wird von Blühendes Österreich getragen, einer gemeinnützigen Organisation aus der Billa-Sti ung, die sich für Naturschutz und Biodiversität einsetzt und unter anderem eng mit der Artenschutzorganisation Birdlife zusammenarbeitet.

ÖPUL

Die größte heimische Umweltförderung für die Landwirtscha heißt ÖPUL. Die Abkürzung steht für „Österreichisches Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtscha “. Bis 2027 sind dafür jährlich 574 Millionen Euro vorgesehen, das Geld fließt etwa in Maßnahmen für den Klimaschutz, die Förderung der Biodiversität, Tierschutz, Naturschutz, aber auch in den Erhalt der Kulturlandscha , des Humus und der gefährdeten Nutztierrassen. Etwa die Häl e des Geldes kommt aus der EU, die andere Häl e stemmen Bund und Bundesländer. In Österreich kann jeder Bauer und jede Bäuerin bei ÖPUL mitmachen – und das tun auch viele.
Meister Humus:
Franz Uller, Feldbach, Steiermark
Das schwere Unwe er vor 16 Jahren hat Franz Uller nicht vergessen. Es schü ete wie aus Kübeln und er musste mitansehen, wie sich sein frisch gesäter Acker in eine braune Suppe verwandelte. Die Sicherung und Förderung von fruchtbarem Boden hat Uller seither ins Zentrum seines Wirkens gestellt. Als damaliger Bürgermeister der südoststeirischen Gemeinde Raabau setzte er 2009 einen Gemeinderatsbeschluss durch, der bei jeder Entscheidung deren Auswirkung auf den Boden mitberücksichtigte. Beim Klimabündnis absolvierte er den Lehrgang als „Kommunaler Bodenbeau ragter“ und arbeitete 2013 für seine Region – das steirische Vulkanland – eine Bodencharta mit aus, in der sich die Vulkanland-Gemeinden und wichtige Institutionen in der Region zum Schutz ihres Bodens bekannten. Mi lerweile leitet der 52-Jährige die Landwirtscha skammer des Bezirks Südoststeiermark, die durch sein Engagement seit 2019 das „Kompetenzzentrum für Acker, Humus und Erosionsschutz“ beherbergt. Diese soll den Humusau au und die Bodenfruchtbarkeit fördern, um die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen und die Ernährung der Bevölkerung sicherzustellen. Ullers neuestes Projekt: die Ausbildung von so genannten Bodenpädagogen, die in Schulen und auf Exkursionen der nächsten Generation den Wert von Böden vermi eln sollen. Selbst baut Uller Mais, Soja und Rotklee an und kommt laut eigenen Angaben durch gelebten Bodenschutz auch als konventioneller Bauer seit 15 Jahren fast ohne synthetischen Dünger aus. BN

Das wichtigste Vorhaben der EUKommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geht seinem Ende zu. Aber was hat das Gesetzespaket für Klima- und Umweltschutz überhaupt gebracht?
Sieben Erfolgsgeschichten
KÜBERBLICK:
KATHARINA KROPSHOFER
ILLUSTRATION:
LILLY GRASCHL Knapp 390 Millionen Wahlberechtigte, 27 Länder, vier Tage an Abstimmungen und ein klarer Sieger. Die EU-Parlamentswahlen sind geschlagen. Die Europäische Volkspartei EVP hat sie für sich entschieden. Und eine Nachricht, nein Sorge, machte danach die Runde: Was wird nun, wo die europäischen Grünen 19 Sitze verloren haben, die rechten Fraktionen zugelegt haben, Ursula von der Leyens zweite Amtszeit mit Stand Mitte Juni nicht fixiert ist, aus ihrem Herzensprojekt: dem Green Deal?
Als Ursula von der Leyen 2019 sich anschickte, neue EU-Kommissionpräsidentin zu werden, hatte sie zwei Probleme: Erstens kannten sie außerhalb Deutschlands nur wenige, zweitens hatte sie keine der Parteien für das Amt vorgesehen gehabt. Sie war die Notlösung, weil Frankreich in Person
des Präsidenten Emmanuel Macron mit dem eigentlich gesetzten Fraktionsführer der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, fremdelte. Von der Leyen vereinte taktisch ziemlich klug Eigennutz mit Zukun svision. Sie konzipierte ein milliardenschweres Investitionsprogramm und nannte das Ganze Green Deal. Damit konnte sie bei den Sozialdemokraten (viel Geld) und bei den Grünen und Liberalen (viel Klimaschutz) für sich werben und strei e gleichzeitig den Vorwurf ab, aus der zukun svergessenen Ecke der Konservativen zu kommen. Es war die Zeit der Fridays for Future auf den Straßen. Es war, als konservative Feuilletonisten die „kulturelle Hegemonie“ der Grünen beklagten. Von der Leyen war Zeitgeist, nannte den Green Deal Europas „Man on the moon“-Moment.
Der Green Deal. Ein ambitionierter Meilenstein in der Geschichte der EU: Nicht nur einigten sich die Abgeordneten darauf, bis 2050 klimaneutral zu sein und die CO2-Emissionen bis 2030 immerhin um 55 Prozent zu reduzieren; sie beschleunigten auch den Ausbau erneuerbarer Energieerzeugung, Neuzulassungen von Verbrennungsmotoren sind ab 2035 verboten. Um 24 Prozent hat die EU ihren CO2Ausstoß im Vergleich zu den 1990erJahren laut Daten der Weltbank übrigens schon reduziert. Statt auf drei Grad Erwärmung bewegt sich die EU im Durchschnitt auf einen Zwei-GradPfad zu, so Analysen des Kontext Instituts (die Details der Erfolge lesen Sie auf diesen Seiten).
Die Frage ist nun, wie es weitergeht: In einer geleakten Version der sogenannten „strategic agenda“ des Gremiums der Staats- und Regierungschefs der EU konnte man schon im April klar sehen, wohin die Reise gehen soll: Die Klimakrise steht im Hintergrund, Sicherheitspolitik hat die Oberhand, so Recherchen von Politico. „Umwelt“ ist ein einziges Mal erwähnt: Als Versprechen, eine „unternehmensfreundliche Umwelt“ zu schaffen. Natur und Biodiversität kommen als Stichwörter gar nicht vor.
Das heißt aber noch lange nicht, dass hier alles verloren ist. Der Klimawissenscha ler Daniel Huppmann, der am IIASA Institut im niederösterreichischen Laxenburg forscht, meint, es habe bereits vor dieser Wahl reichlich Weichenstellungen gegeben – die nicht alle einfach rückgängig gemacht werden können. Jetzt gilt es den Widerstand, den es gerade hautnah zu erleben gibt – Bauernproteste gegen höhere Treibstoffpreise, eine Blockade der Pestizidreduktion und zuletzt das große Au egehren gegen das Renaturierungsgesetz –, so gut wie möglich aufzufangen.
Denn prinzipiell sorgen sich die Europäer weiterhin um Klima und Natur. Das sagt auch Aurélien Saussay, er forscht am Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment an der London School of Economics. „Die Koalition, die sich für den Green Deal ausgesprochen hat, ist immer noch da“, meint er. Schließlich habe die Europäische Volkspartei weiterhin eine Mehrheit, Ursula von der Leyen ist weiterhin im Rennen als neue/alte Kommissionspräsidentin. Und er hat noch mehr gute Nachrichten: Klimaskeptiker nehmen rasant ab, so auch eine Umfrage der OECD unter 40.000 Menschen in allen G20-Ländern. Es ist aber auch nicht das Thema, das den Menschen am meisten Sorgen macht: Die instabile geopolitische Weltlage mit zwei großen Konflikten im Nahen Osten und in der Ukraine, die weiterhin hohen Lebenskosten, auch die großen offenen Fragen über einen Umgang mit der anhaltenden Migration beschä igen die Menschen in ihrem Alltag noch mehr. „Ich bin sehr vorsichtig optimistisch“, sagt Saussay. F


GEHT MIT VOLLDAMPF VORAN.
BIS 2050 SOLL DER GESAMTE ENERGIEHUNGER DES KONTINENTS SO GESTILLT WERDEN
Es ist der große Wurf des Gesetzbündels: das „Fit for 55“-Paket. Und ein sehr konkreter noch dazu: 40 Prozent am gesamten Energieverbrauch der EU sollen bis 2030 aus erneuerbaren Energien stammen. Und bis 2050 soll der Großteil des Energiekonsums aus Sonnen-, Windkra und anderen regenerativen Quellen kommen – immerhin will Europa bis dahin der erste klimaneutrale Kontinent sein. Die einzelnen Mitgliedstaaten müssen vorlegen, wie sie diese Ziele umsetzen wollen, und unter anderem auch sogenannte Beschleunigungszonen ausweisen, wo Genehmigungen etwa für Windparks besonders einfach zu bekommen sind.
An manchen Stellen sorgt das auch für Unmut, sehen viele mit dieser „REDIII-Regelung“ doch den Naturschutz ausgehebelt. Ein weiteres, sehr österreichspezifisches Hindernis: Bei der Übermittlung dieser Nationalen Energie- und Klimapläne kam es im Herbst zu einem Koalitionsstreit: Die grüne Klimaministerin Leonore Gewessler wollte den Entwurf nach Brüssel schicken, Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) zog diesen zurück. Der finale Klimaplan muss nun bis Ende Juni bei der EU-Kommission liegen.



DAS AUTO ALS SYMBOL FÜR DIE ZEITENWENDE: DIE EU WILL DEN VERBRENNUNGSMOTOR AB 2035 VERBIETEN, KONSERVATIVE KLAMMERN
SICH
VEHEMENT
DARAN


Es gehört zu den umstrittensten Themen des Green Deal: Nach langem Ringen einigten sich die EU-Mitgliedstaaten im März 2023 endgültig darauf, die Zulassung neuer Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2035 zu verbieten. Statt Benzin- und Dieselautos sollen Unternehmen und Konsumenten auf E-Autos (und öffentliche Verkehrsmittel) setzen.

Dabei geht es vor allem darum, die CO2-Emissionen des Verkehrssektors zu senken. Dieser bläst weiterhin geraume Mengen an klimaschädlichen Gasen in die Atmosphäre. Die Emissionen neuer Autos sollen bis 2030 um 55 Prozent sinken.
Vor allem konservative Parteien bringen vehement Wünsche zur Aufweichung auf die Agenda: Sie wollen mehr über den Einsatz synthetischer Kra stoffe diskutieren. Die Unternehmen selbst haben aber großteils längst die Weichen in Richtung E-Mobilität gestellt.


Fortsetzung nächste Seite




Fortsetzung von Seite 29
WIE MAN HUNDERTTAUSENDE VERFRÜHTE TODESFÄLLE VERMEIDET.
AB NUN GELTEN STRENGERE GRENZWERTE FÜR SCHADSTOFFE
Rund 400.000 vorzeitige Todesfälle; mehrere Hundert Milliarden Euro an Kosten – das sind die Folgen der Lu verschmutzung in der EU, so ein Sonderbericht des EU-Rechnungshofes. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO ist die Lu verschmutzung sogar das größte umweltbedingte Gesundheitsrisiko auf dem Kontinent, vor allem für Menschen in Städten, die täglich Feinstaub, Stickstoffdioxid und bodennahes Ozon einatmen. Das muss besser gehen, meinen die Parlamentarier, und haben strengere Grenzwerte für diese Schadstoffe bis zum Jahr 2030 vorgesehen. Zehn Mikrogramm pro Kubikmeter statt der bisherigen 25 heißt es nun etwa für Feinstaub, auch das Stickstoffdioxid sollen die EU-Staaten halbieren.




RENATURIERUNGSGESETZ WILL GESCHÄDIGTE ÖKOSYSTEME IN DER EU WIEDERHERSTELLEN: FLÜSSE FREI FLIESSEN LASSEN, MOORE VERNÄSSEN UND MEHR SCHUTZGEBIETE AUSWEISEN
um an dieses Ziel
In Österreich freute das vor allem einen: den Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP). Italien will ihn als Verantwortlichen klagen, nachdem er ein Nachtfahrverbot und Blockabfertigungen für Lkw aus dem südlichen Nachbarland vorgeschlagen hatte. Die Lösungen, um an dieses Ziel zu kommen, gehen Hand in Hand mit weiteren Vorhaben: einem Umstieg von Kra fahrzeugen auf öffentliche Verkehrsmittel, Fahrräder und E-Mobilität.

INDIREKT – DAS TIERWOHL IN DER LANDWIRTSCHAFT STEIGERN WILL. UND WIE IHR DAS ZUMINDEST TEILWEISE GELINGT
Es ist nur indirekt ein Bestandteil des Green Deal: der Tierschutz. Die Förderung einer nachhaltigen Landwirtscha , der Schutz der Biodiversität und auf gewisse Weise auch der landwirtscha lich genutzten Tiere waren trotzdem im Fokus des Gesetzespakets.
Die „Farm to Fork“-Strategie zielt etwa darauf ab, nachhaltige Lebensmittelproduktion und -konsum zu fördern. Teil dieser Strategie ist es, höhere Tierschutzstandards in der Landwirtscha zu fördern und sicherzustellen, dass landwirtscha liche Praktiken umweltfreundlich und ethisch vertretbar sind.
Über den Green Deal hinaus hat die EU aber einige Versuche gestartet, um den Tierschutz zu verbessern: Die Kommission hat etwa einen neuen Vorschlag für eine Tiertransportrichtlinie präsentiert: Die Transportzeiten sollen maximal acht Stunden dauern, Bedingungen währenddessen etwas besser und Kontrollen schärfer werden. Denn jedes Jahr werden 1,6 Milliarden Tiere innerhalb der EU transportiert.
Eigentlich kündigte die EU auch an, Käfighaltung für Legehennen, Schweine und Kaninchen zu verbieten. Doch noch fehlt ein derartiger Gesetzesentwurf. Die Bürgerinitiative „End the Cage Age“ hat die EU-Kommission deshalb im März 2024 vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) angezeigt.
Kaum ein Gesetz ist so umstritten wie das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, kurz: Renaturierungsgesetz, ein Teil der Biodiversitätsstrategie der EU. Nach langem Hin und Her und Abschwächungen auf Druck der Bauernlobby stimmten die Umweltministerinnen und -minister der EUStaaten am 17. Juni schließlich dafür – was eine innenpolitische Krise in Österreich auslöste. Was aber steht im Gesetz, das viele Expertinnen als „wichtigstes Gesetz für die Natur“ bezeichnen?
Die neue Version pocht auf Freiwilligkeit der Grundbesitzer: Bis 2030 sollen auf 30 Prozent und bis 2050 dann auf 90 Prozent der geschädigten Flächen Maßnahmen gesetzt werden, um Lebensräume und Arten wieder in einen guten Erhaltungszustand zu bringen. Immerhin sind 80 Prozent der Lebensräume der EU in einem schlechten Zustand, Moore ausgetrocknet, Flächen versiegelt. Die Häl e der Wildbienenarten ist bedroht, drei von fünf Amphibienpopulationen sind im vergangenen Jahrzehnt geschrump . Nun müssen die einzelnen EU-Staaten das Gesetz regional umsetzen.


DER GRÜNEN INDUSTRIE, ALSO TECHNOLOGIE UND FACHKRÄFTE
Schon im Jänner 2023 stellte die Europäische Kommission den Grünen Industrieplan vor. Das Ziel? Die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu stärken und so zur Klimaneutralität bis 2050 beizutragen. Das große Vorbild ist der Inflation Reduction Act (IRA), den US-Präsident Joe Biden wenige Monate zuvor präsentiert hatte. Mit Blick Richtung Westen, aber auch nach Osten – immerhin ist China Vorreiter bei Solar- und E-Mobilitäts-Technologien – will die EU-Regierung sicherstellen, dass europäische Unternehmen im globalen Wettbewerb um grüne Technologien nicht ins Hintertreffen geraten.
Gezielt fördert sie so grüne Technologien, die Treibhausgasemissionen reduzieren sollen: erneuerbare Energien, Batterien, Wasserstoff, CO2Abscheidung und -Speicherung, aber (zum Ärgernis vieler) auch Kernenergie. Aber auch Qualifikationen und Arbeitsplätze, um entsprechende Fachkrä e zu haben, die diese Technologien auch umsetzen können. Und den besseren Zugang zu Finanzmitteln: Genehmigungen wären dann einfacher, EU-Mittel leichter zugänglich.
WIEDERVERWERTUNG:
WAS DIE EU FÜR DIE KREISLAUFWIRTSCHAFT VORHAT
Die EU-Politiker wollen mit mehreren Beschlüssen die Kreislaufwirtscha in Schwung bringen und die Müllberge schrumpfen lassen. Die Ökodesign-Verordnung verbietet es Händlern kün ig, unverkau e Kleidung und Elektrogeräte zu zerstören. Sie schreibt den Herstellern gleichzeitig vor, dass deren Produkte länger halten sollen, umweltschonender produziert, reparabel und besser recycelbar werden.

Die neue EU-Richtlinie über das Recht auf Reparatur ermöglicht es Konsumenten kün ig, Produkte einfacher und billiger reparieren zu lassen, und verpflichtet die EU-Mitgliedstaaten dazu, Reparaturen zu fördern. Darüber hinaus gehen die EU-Parlamentarier mit neuen Regeln gegen Verpackungsmüll vor. Ab 2030 werden bestimmte Einwegverpackungen aus Kunststoff verboten, darunter auch jene für unverarbeitetes frisches Obst und Gemüse.
Die neuen Regeln verpflichten die Hersteller außerdem, leichtere Verpackungen mit weniger Volumen zu verwenden. Nahezu alle Verpackungen müssen strenge Recycling-Anforderungen erfüllen. Parlament und Rat haben schon dafür gestimmt, die Richtlinie muss nun noch formell bestätigt werden.
ILLUSTRATIONEN: LILLY GRASCHL

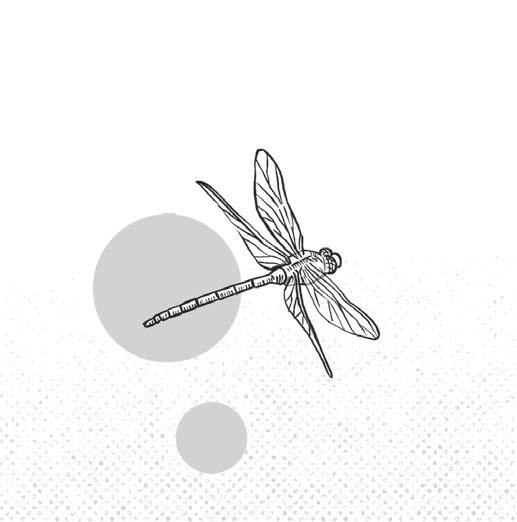





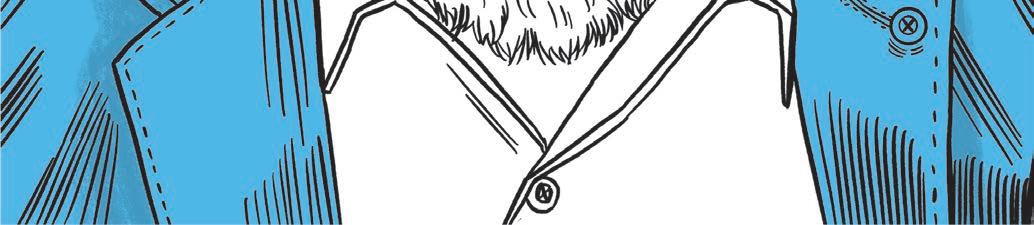


AAm Ende seines Vortrags am Symposion Dürnstein will Michael Succow ein wenig Optimismus versprühen. Deshalb wir er ein Foto von Wasserbüffeln auf die Leinwand. „Das sind meine Lieblingstiere“, sagt Succow. „Sie liefern wunderbare Kothaufen, in denen dann der Wiedehopf Nahrung findet.“ Wasserbüffel sind zugleich putzig und kolossal, können sich nicht nur gut an ihre Umwelt anpassen, sondern prägen sie mit. Etwa im ostdeutschen Biosphärenreservat Schor eide-Chorin. Für Succow gleichen die dort weidenden Wasserbüffel einem Ideal: Tier und Mensch leben im Einklang mit der Natur und erhalten eine wertvolle Kulturlandscha .
Succow, 83 Jahre alt, ist einer der Stargäste des Symposion Dürnstein. Mitte März treffen hier internationale Experten in der Wachau zusammen, um über die Zukun der Ernährung zu sprechen. „Boden – das am stärksten gefährdete Naturgut“ nennt Succow seinen Vortrag. „Hier seht ihr die Vergewaltigung der großen Moorlandscha en“, sagt er und wir weitere Bilder an die Wand: Entwässerungsarbeiten mit Baggern. Tiefe Gräben mit verfaultem Wasser. Ein Traktor auf einem endlosen, ausgeräumten Acker. Eine Maiswüste. Erosion. Ausgetrocknete, tote Böden. Die Bilder dokumentieren den Niedergang der Natur, es sind Fotos aus Succows Heimat.
Succow ist Biologe und Bodenkundler, vor allem aber einer der einflussreichsten Naturschützer Europas, und er zählt zu den Urgesteinen der deutschen Ökologiebewegung. 1997 bekam er den Right Livelihood Award, der auch als alternativer Nobelpreis bekannt ist. Die Auszeichnung würdigt Menschen und Organisationen, die im Umweltschutz oder für die soziale Gerechtigkeit Außerordentliches geleistet haben. Succow erhielt ihn „für sein Engagement zum Schutz natürlicher Ökosysteme und Gebiete von außergewöhnlichem Naturwert für kün ige Generationen.“ Schon früh hat sich der Mann mit dem weißen Vollbart der Rettung der Natur verschrieben.
Succow wuchs in Lüdersdorf im Osten Brandenburgs als Bauernsohn auf. Spricht er von damals, schwingt Nostalgie in seinen Sätzen. Er erzählt, wie er als Kind die Schafe hütete und seine Eltern jeden Sonntag auf die Felder ritten und dabei überlegten, wie ihr Boden fruchtbar bleiben kann. Er spricht von den kleinen Bächlein – „klare, kleine Gewässer mit Eisvogel und der Gebirgsbachstelze“ – aus denen man bedenkenlos trinken konnte, weil „es weder chemische Pflanzenschutzmittel noch Dünger gab“. Er schildert die üppige biologische Vielfalt seiner Heimat, mit all den unzähligen Schmetterlingen, Käfern und Insekten, „die kleinen Feldteiche waren voller Leben“. Wenn er damals mit heute vergleicht, schlägt die Nostalgie ins Dramatische um. Der wunderschöne Klarwassersee, in dem er einst schwimmen lernte und angelte, sei
mittlerweile verschwunden. „Alles, was da an Muscheln und Schnecken so lebte, gibt es nicht mehr.“
Michael Succow sicherte riesige Flächen in Ostdeutschland für die Natur –und wurde damit zur Legende. Nun warnt er vor dem Verlust der Böden durch die intensive Landwirtscha
BEGEGNUNG: BENEDIKT NARODOSLAWSKY
Die jahrzehntelange Verwüstung der ostdeutschen Böden durch die Agrarindustrie begann unter den Kommunisten in der DDR und setzte sich nach der Wende fort, als der Kapitalismus über die Felder fegte. „Wachse oder weiche“ lautet das Mantra, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten EU. „Die subventionierte Unvernun geht weiter“, kritisiert Succow und spielt damit auf die EU-weite Flächenprämie an. Diese begünstigt, dass landwirtscha liche Betriebe sich vergrößern, während kleinbäuerliche Betriebe zunehmend verschwinden.
Geht es nach ihm, sollte die Politik stattdessen den Erhalt der fruchtbaren Böden fördern, die für Natur, Klima und Mensch eine überlebenswichtige Rolle spielen. „Auch die Bildung von trinkfähigem Grundwasser muss die Gesellscha bezahlen“, sagt Succow. Jene Landwirte, die mit ihren gesunden Böden die Bildung von Grundwasser ermöglichen, seien „hoch zu prämieren“.
Mit der Bewirtscha ungvon Flächen hat sich Succow ein Leben lang beschäftigt. Er studierte Biologie an der Universität Greifswald, in den 1960er-Jahren hatte er es zum wissenscha lichen Assistenten gebracht, dann endete seine Uni-Karriere abrupt. 1968 wollte die Tschechoslowakei den Kommunismus zum „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ wandeln, der Prager Frühling begann. „Ich dur e nicht mehr an der Universität sein und bin in die Produktion geschickt worden, weil ich den Einmarsch der Sowjetunion in die Tschechoslowakei nicht akzeptiert habe“, erzählt Succow dem Falter.
Statt auf der Uni zu unterrichten, musste er hinaus, um als Bodenkundler für die DDR neue Flächen zu erschließen. Stück für Stück verschlang die intensive Landwirtscha die heile Welt seiner Kindheit. Succow erzählt von der „Pflanzenproduktion auf riesigen Schlägen“, dem Einsatz von schwerem Gerät auf den Äckern wie den „Raketenschleppern, die in der Ukraine hergestellt worden sind, also Traktoren mit 700 PS“, dazu noch „Flugzeugstaffeln, die den Dünger aus der Lu “ ausbrachten. Succow war mitten drin im Kampf gegen die Natur. Er bezahlte ihn mit einem bleibenden Rückenschaden.
tischen Einheitspartei die DDR. Die Zeichen standen auf Neuanfang. Die Bürgerbewegungen, die Ende der 1980er-Jahre auf die Straße gegangen waren und das Ende der DDR eingeläutet hatten, forderten auch einen stärkeren Umweltschutz ein. Modrow holte als stellvertretenden Umweltminister einen kritischen Geist in die Regierung, zuständig für Ressourcenschutz und Landnutzungsplanung: Succow. Dieser holte sich Unterstützung aus seiner NaturschutzCommunity. „Ich konnte alle von meinen Weggefährten einstellen. Die Ersten kamen schon nach einer Woche“, erzählt er. Succow war der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In wenigen Monaten plante er mit seinem Team einen der größten Naturschutz-Coups in Europa. Schon viele Jahre zuvor hatte er mit seinen Mitstreitern in der Gesellscha für Natur und Umwelt eine Liste wertvoller Landscha en in der DDR ausgearbeitet. Im Fokus lagen jene riesigen Flächen, die die DDR als Staatsjagdgebiete, Grenzsicherungsräume und Truppenübungsplätze nutzte. Succow wollte sie unter Naturschutz stellen. Er nützte das einmalige, schmale Zeitfenster in der deutschen Nachkriegsgeschichte maximal aus. In seiner historisch letzten Sitzung beschloss der Ministerrat der DDR am 12. September 1990 das Nationalparkprogramm. Mit einem Schlag standen kurz vor der deutschen Wiedervereinigung plötzlich 4,5 Prozent der DDRLandesfläche dauerha unter Naturschutz – mit fünf Nationalparks, sechs Biosphärenreservaten und drei Naturparks. Succow schrieb damit Umweltgeschichte – und fügte ihr nach der Wende noch weitere Kapitel hinzu. „Die Unesco hat mich beau ragt, bei den Unesco-Welterben zu helfen“, erzählt Succow, der im wiedervereinigten Deutschland Vizechef des deutschen Naturschutzbundes wurde. Mithilfe von Sponsoren wie dem Sti erverband für die Deutsche Wissenscha und dem WWF begründete er weitere Naturschutzgebiete in vielen Ländern mit, darunter in Georgien, Kirgistan, Russland, Aserbaidschan, Turkmenistan und Äthiopien.
Die jahrzehntelange Verwüstung der ostdeutschen Böden durch die Agrarindustrie begann unter den Kommunisten in der DDR und setzte sich nach der Wende fort, als der Kapitalismus über die Felder fegte
Die Liebe zur Natur konnte ihm all das nicht austreiben. Er lebte sie in der Gesellscha für Natur und Umwelt im Kulturbund der DDR aus. „Das waren so Leute, die nicht in die Partei gingen, aber die kontrolliert wurden durch die Partei“, erzählt Succow. „Wir waren nicht in Opposition, sondern eine Parallelgesellscha , die geduldet wurde.“ So nützte er im Ehrenamt die Freiräume, die ihm das kommunistische System ließ, publizierte mit seinen Kameraden Studien, bildete junge Menschen aus und gab seine Faszination für die Natur weiter. Nachdem ihm mehrfach eine Rückkehr an die Uni verwehrt worden war, wurde er als einer der führenden Bodenkundler Ostdeutschlands im Jahr 1987 schließlich doch noch Professor an der Akademie der Landwirtscha swissenscha en der DDR.
Die große Stunde des Michael Succow schlug drei Jahre später. Die Berliner Mauer war da schon zerbröselt, nun zerbröckelte die DDR. Bis zu den ersten freien Volkskammerwahlen im Jahr 1990 regierte Hans Modrow als letzter Politiker der Sozialis-
Von all den Auszeichnungen, mit denen Succow später überhäu wurde, war der alternative Nobelpreis wohl der wichtigste. Mit dem Preisgeld gründete er die Michael Succow Sti ung, die sich den drei Begriffen „Erhalten – Haushalten – Werthalten“ verschrieben hat. Die Sti ung treibt seither wegweisende Projekte für Natur und Klima voran, „von der Restaurierung von Mooren bis zur Schaffung von Schutzgebieten für bedrohte Tier- und Pflanzenarten“, heißt es aus der Sti ung.
Zu den Projekten zählt auch die Paludikultur, die nasse Hoch- und Niedermoore umweltschonend für die Land- und Forstwirtscha nutzt. Auch mithilfe von Succows Lieblingstieren, den Wasserbüffeln. „Durch den selektiven Fraß und Trittschäden entsteht eine erhöhte Strukturvielfalt der Vegetation und des Bodens, was positive Auswirkungen auf die Biodiversität hat“, heißt es vom Greifswald Moor Centrum, das Wissenscha mit der Praxis verbindet und das von der Universität Greifswald und der Michael Succow Sti ung gemeinsam betrieben wird.
Heuer feiert Succows Sti ung ihr 25-jähriges Jubiläum. Er selbst denkt noch lange nicht ans Au ören. Der Schutz der Natur sei schließlich kein Luxus, sondern die „Grundlage für den Fortbestand der menschlichen Zivilisation“. F
WWer in Österreich ein Fotomotiv für die Energiewende sucht, findet auf dem Sonnenfeld im niederösterreichischen Bruck an der Leitha die ideale Kulisse. Hier drehen sich riesige Photovoltaik-Paneele in die optimale Position zur Sonne, darüber spannen mächtige Masten Stromleitungen übers Feld, ringsum drehen sich Windräder, im Hintergrund leuchtet die helle Kuppel einer Biogasanlage. Hier im Industrieviertel, an der Grenze zum Burgenland, proben Pioniere der Energiewende seit drei Jahrzehnten die Zukun .
Aber auf dem Sonnenfeld geht es um weit mehr als nur um Energie. Hier steht ein österreichisches Leuchtturmprojekt mit Strahlkra , eine sogenannte Agri-PV-Anlage. Zur Inbetriebnahme im November 2022 reisten Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Landwirtscha sminister Norbert Totschnig (ÖVP) an. Gewessler rühmte es als „tolles Vorzeigeprojekt“, Totschnig sah darin einen „zukun sfähigen Weg, der auch andere inspirieren wird“. Seither haben nicht nur Landwirtscha skammer und Wirtscha skammer ihre Vertreter zur Inspiration aufs Sonnenfeld geschickt, sondern es kamen auch Bauern aus Deutschland, Studenten aus China, Politiker aus der Ukraine und der Slowakei.
Die Gründe für das Interesse fasst eine große blaue Tafel am Rand des eingezäunten Sonnenfelds zusammen. „Warum einfach, wenn’s auch dreifach geht?“, steht darauf und nennt die Vorteile: Die Agri-PV-Anlage erzeuge erstens „Sonnenenergie für mehr als 1100 Haushalte“, ermögliche zweitens „Lebensmittelproduktion“ und sorge drittens für eine „Erhöhung der Biodiversität durch Blühstreifen“. Ein Acker für Energie, Ernährung und biologische Vielfalt? In Zeiten der Klima- und Biodiversitätskrise klingt das beinahe zu gut, um wahr zu sein. Funktioniert das auch?
Anfang Mai steht Michael Hannesschläger auf dem Sonnenfeld, zückt unterm wolkenverhangenen Himmel sein Handy und liest in seiner App nach, wie viel Strom die Agri-PV-Anlage gerade produziert: „Sie hat 38 Prozent der Maximalleistung.“ Hannesschläger ist Geschä sführer des Energieparks Bruck an der Leitha, der die
Auf dem Sonnenfeld in Bruck an der Leitha beackern Bauern ihre Felder, ernten zugleich Energie und schützen die biologische Vielfalt. Über ein Zukun smodell namens Agri-PV
ERKUNDUNG: BENEDIKT NARODOSLAWSKY
Agri-PV-Anlage gemeinsam mit dem oberösterreichischen Erneuerbaren-Energie-Unternehmen EWS Consulting betreibt. 3,9 Millionen Euro hat sie gekostet, davon stammen rund 1,6 Millionen aus dem staatlichen Klima- und Energiefonds, der das Sonnenfeld gefördert hat.
„Eine Forschungsanlage ist kein Business Case“, sagt Hannesschläger. „Unser Ziel ist es, dass wir eine schwarze Null zusammenbringen. Das werden wir schaffen.“ Dafür seien auch die hohen Strompreise während der Energiekrise in der jüngsten Vergangenheit verantwortlich. Die Agri-PV-Anlage am Sonnenfeld dient ohnehin weniger der Profitmaximierung, sondern vielmehr dem Erkenntnisgewinn. Die Versuchsanlage habe man so entwickelt, „dass man daraus Business Cases planen und umsetzen kann“, sagt Hannesschläger.
Und noch etwas gelingt mit dem Projekt: Vorurteile abzubauen. Unter Bauern gilt Flächenfraß heute als eines der drängendsten Probleme, durch den Bau von Einkaufszentren, Straßen oder Siedlungen wird fruchtbarer Boden versiegelt und geht für immer verloren. Normale PV-Anlagen versiegeln zwar

keine Flächen, aber Landwirte können Felder, auf denen eine solche Anlage steht, nicht mehr bewirtscha en. „Als wir vor fünf Jahren das erste Mal gesagt haben, wir gehen mit einer PV-Anlage auf einen Acker, haben alle ‚Nein‘ gesagt“, erzählt Hannesschläger über die ablehnende Haltung der Landwirte, die Gesellscha er des Energieparks Bruck an der Leitha sind.
Das Modell einer Agri-PV-Anlage führte bei ihnen schließlich zum Umdenken. „Ich habe das Glück, dass ich mit leiwanden Landwirten zusammenarbeite, die sagen: ‚Wir schauen uns das einmal an‘“, sagt Hannesschläger.
Roland Wi ner ist einer von ihnen. Sein Zugang zu erneuerbarer Energie ist Teil eines größeren Konzepts. Er ist Biobauer aus Überzeugung, schon 1989 stellten seine Eltern den Hof von konventionell auf bio um. „Ausschlaggebend bei uns war, dass die Böden immer karger und vom Humusgehalt her ärmer wurden“, erzählt Wittner. Mais, Dinkel, Klee, Sojabohnen und Mohn wachsen auf seinen Feldern, die Umstellung auf nachhaltige Landwirtscha erfolgte im großen Stil: „Die biologische Wirtscha sweise, die biologische Ernährung, die nachhaltige, regionale Energieproduktion – das ist für uns eine Gesamtheit“, sagt Wittner. Zuhause versorgt seine PV-Anlage das E-Auto mit Strom, das er gerade neben dem Sonnenfeld geparkt hat.
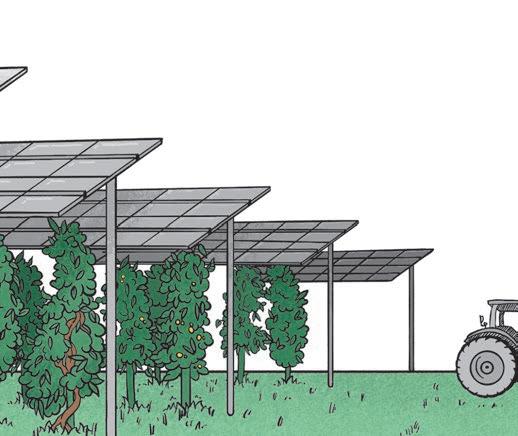


Auf dem 5,5 Hektar großen Sonnenfeld bleiben laut den Projektbetreibern 80 Prozent für die landwirtscha liche Nutzung bestehen, dazu kommen 18 Prozent Blühstreifen zwischen den Feldern, die sich unter den PV-Paneelen befinden und die Biodiversität steigern. Zum Vergleich: Bauern wie Wittner müssen fürs Bio-Gütesiegel auf ihren Äckern zumindest sieben Prozent der Fläche für die Biodiversität reservieren, die Anforderung wird auf dem Sonnenfeld also bei weitem übertroffen.
Lediglich zwei Prozent der Fläche auf dem Sonnenfeld entfallen auf alles andere wie Wege und Pfähle, auf denen die Solarmodule montiert sind. Diese versiegeln keinen Boden, denn die Pfähle wurden in die Erde gerammt, man kann sie nach der Nutzung wieder herausziehen.
Wittner stap in gelben Gummistiefeln vorbei an den Reihen aus Solarmodulen, die wie dunkle Zaunwände die einzelnen Ackerstreifen einhegen. Er lässt seinen Blick über ein Feld mit Winterweizen streifen. „Wo keine Paneele sind, da ist die Pflanzenfarbe viel lichter, fast gelblich, der Bestand ist schütter“, sagt Wittner, „im Gegensatz dazu ist es neben den Paneelen dunkelgrün. Hier wächst der Winterweizen höher und dichter.“
Warum die Feldfrucht neben den Solarmodulen scheinbar besser gedeiht, könnte am Mikroklima liegen, vermutet Wittner. Dort sei das Feld durch die Paneele etwa besser vor Wind geschützt. Neben Wittner bewirtscha en fünf weitere Bauern die Ackerstreifen zwischen den Solarmodulen, im Vorjahr bauten sie Körnerhirse, Kartoffel, Soja, Sonnenblumen und Mais an. Wittner selbst erntete Blaumohn zwischen den Reihen 13 und 14. Verglichen mit einem normalen Feld ohne Agri-PV schätzt er die Ausbeute aus dem ersten Jahr auf zwischen 70 und 90 Prozent, je nach Feldfrucht.
Auf dem Sonnenfeld wird nicht nur Unterschiedliches angebaut, die Reihen an PVModulen stehen auch in verschiedenen Ausrichtungen – von Süd bis Ost-West –, die Ackerstreifen sind unterschiedlich breit, die Bewirtscha ung erfolgt sowohl bio als auch konventionell. „Es ist als Versuchsanlage konzipiert, wo wir viel probieren wollen“, sagt Energiepark-Geschä sführer Hannesschläger.
Wissenscha ler des Instituts für Landtechnik und des Instituts für Pflanzenbau von der Universität für Bodenkultur in Wien können das Sonnenfeld deshalb als riesiges Freilu experiment nützen. Sie erforschen hier, welche Pflanzenkulturen bei Agri-PV-Anlagen am besten gedeihen, welche Bewirtscha ungsform sich am meisten lohnt. Das Feld haben sie in acht For-
schungszonen eingeteilt und mit Sensoren übersät, die beständig Daten erheben – darunter die Bodentemperatur, die Feuchtigkeit, das Pflanzenwachstum. Zwei Jahre läu das große Forschungsprojekt noch, dann werden die ersten Ergebnisse vorliegen.
Lukas Hammer ist heute schon vom Potenzial der Agri-PV-Anlagen überzeugt: „Ich glaube, was den gesamtgesellscha lichen Nutzen, die Effizienz, aber auch die Akzeptanz in der Bevölkerung betrifft, wird das einfach die Zukun sein.“ Der Klimaund Energiesprecher der Grünen hat im Parlament das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) mitverhandelt, das dafür sorgen soll, dass Österreichs Strom bis 2030 komplett aus erneuerbaren Quellen kommt.
Dazu muss Österreich die jährliche grüne Stromerzeugung um 27 Terrawattstunden steigern. Elf von diesen 27 sollen durch Photovoltaikanlagen hereinkommen – und die benötigen viel Platz. „Wir werden nicht nur die Dächer und die bestehenden versiegelten Flächen brauchen, sondern wir werden auch auf die Freifläche gehen müssen“, sagt Hammer.
Der Vorteil von PV-Anlagen auf Freiflächen ist: Sie sind deutlich größer, effizienter und damit auch günstiger. Der Nachteil: O sind es fruchtbare Böden, die sich besonders für diese Freiflächen eignen. Stellt man diese mit PV-Anlagen zu, verliert man wertvolle Felder für die Ernährungssicherheit. Weil Agri-PV-Anlagen diesen Zielkonflikt weitestgehend au eben, wollte Hammer ihnen in den EAG-Verhandlungen eine Vorrangstellung einräumen. „Wir haben uns überlegt: Wie können wir Agri-PV beanreizen?“, erzählt er. Die türkisgrüne Koalition einigte sich darauf, sie stärker zu fördern. „Man bekommt einen Förderabschlag von einem Viertel, wenn man eine Freiflächen-Anlage errichtet“, sagt Hammer, „Der wird aber nicht fällig bei einer Agri-PV-Anlage. Bei der Investitionsförderung gibt es sogar einen Zuschlag von 30 Prozent.“
Auf dem Sonnenfeld beginnt es zu tröpfeln. Je nach Wetterlage ändert die Agri-PVAnlage ihr Gesicht. Stehen die Module horizontal, sehen sie aus wie ein mächtiges T. Je nach Bedarf kann der obere Strich dieses T sich bis zu 70 Grad nach links oder rechts neigen. Die Module sind bifazial, das heißt, sie können sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite Sonnenenergie in Strom verwandeln.

Die Agri-PV-Anlage rattert die Paneele nun automatisch in den Regenmodus, schwenkt also die Module, bis sie steil schräg stehen. So reinigt der Regen die Paneele, zugleich bekommt auch der Blühstreifen unter den PV-Modulen Wasser ab. Im Winter rutscht in dieser Position der Schnee von den Modulen zu Boden. So kann die Anlage ihre Sonnenernte auch in der kalten Jahreszeit steigern.
Die schwenkbaren Module hätten nicht nur Vorteile für die Energieernte, sondern auch für die Bearbeitung der Felder, sagt Verena Bernardi, die unter einem PV-Modul Schutz vor dem Regen gesucht hat. Bernardi arbeitet als Projektentwicklerin für das Unternehmen EWS Consulting, das die Idee zum Sonnenfeld entwickelte und umsetzte. „Bei einer Bodenbearbeitung, wo Steinschlag zu erwarten wäre, kann man die Modultische horizontal stellen. Dann sind die Module ganz weit weg und eine Beschädigung der PV-Paneele kann verhindert werden“, sagt sie.
Kommt der Mähdrescher, schwenkt man die Module zur Seite, damit er bis ganz an den Rand des Ackers fahren kann. Die Einstellung nützt auch, wenn man bei der Feldbearbeitung mit Staubentwicklung rechnen muss. „Der aufgewirbelte Staub würde auf den Modulen liegen bleiben und die Module verschmutzen, wenn sie horizontal stehen würden. Deshalb dreht man sie weg“, sagt Bernardi, „so bleibt der Staub unter den Modulen und setzt sich wieder auf das Feld und nicht auf die Paneele nieder.“ Die Module richten sich automatisch nach der Wetterlage, aber die Betreiber können sie bei der Feldarbeit auch einfach über eine Handy-App steuern.
Das Konzept scheint zu überzeugen. EWS hat bereits mehrere Agri-PV-Projekte in verschiedenen Bundesländern in der Planungs- und Genehmigungsphase, erzählt Bernardi. Allein der Energiepark Bruck an der Leitha möchte zwei weitere Sonnenfelder errichten. Und auch Biobauer Wittner will sich bald eine eigene Agri-PV-Anlage auf sein Feld stellen. Die doppelte Ernte von Erde und Sonne sieht er als zukun sfähiges Konzept für seine Zun an: „Mit der Kombination geht’s sich als Landwirt auf jeden Fall aus.“ F




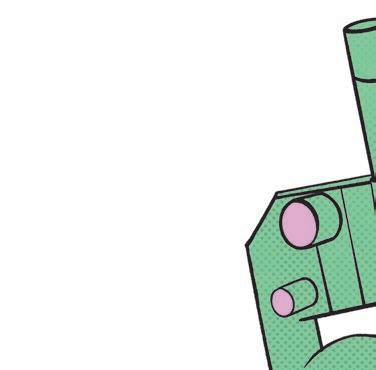




BODENBAKTERIEN
In den Böden leben rund eine Billion Mikroorganismenarten, also Bakterien, Pilze oder Archaeen. Sie wandeln unter anderem Kohlenstoff in Kohlenwasserstoff (CO2) um. Mit dem Ergebnis, dass dort rund viermal so viel CO2 gespeichert ist wie in der Atmosphäre. Steigen die Temperaturen, setzen die Böden mehr CO2 frei. Aber warum? Bislang ging man davon aus, dass die Mikroben schneller arbeiten, wenn es wärmer ist. Doch ein Team rund Andreas Richter von der Universität Wien entdeckte bei der Analyse von Bodenproben aus Island, dass in wärmeren Böden mehr Mikrobenarten aktiv werden. Ihre Ergebnisse könnten dafür sorgen, dass Modelle zum Kohlenstoffkreislauf nun neu berechnet werden.
Der Wurmdompteur:
Alfred Grand, Absdorf, Niederösterreich
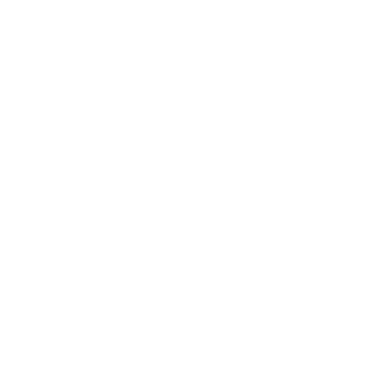

Wasser braucht es, um ein Kilogramm Rindfleisch herzustellen. Bei Hühnerfleisch sind es „nur“ 4325 Liter, Gemüse kommt auf zarte 322 Liter, so die Ernährungs- und Landwirtscha sorganisation der Vereinten Nationen, FAO.


METHANREDUKTION
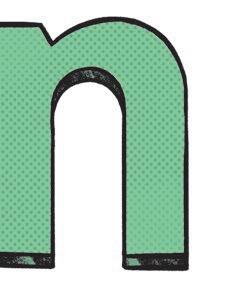
Joseph Poore ist Umweltwissenscha ler an der Universität Oxford. Zusammen mit seinem Kollegen Thomas Nemecek erstellte er 2018 eine große Studie, um die Auswirkungen von Lebensmitteln auf die Umwelt zu beziffern, darunter Emissionen, Land- und Wasserverbrauch. Einiges dür e überraschen: Käse verursacht im Schnitt ungefähr gleich viel Emissionen wie Hühnerfleisch, Bier mehr als Kuhmilch. Es gibt aber auch eine deutliche, weniger überraschende Botscha : Weniger oder keine tierischen Produkte zu essen ist der beste Weg, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Tiere zu essen deckt nur 18 Prozent der Kalorien ab, die wir benötigen, nimmt jedoch 83 Prozent unserer weltweiten Ackerfläche ein.
Alfred Grand ist kein Anfänger, aber durchaus Pionier: Vor mehr als 20 Jahren startete er auf seiner Grand Farm mit Wurmkompostierung. Soll heißen: Er erntet das besondere Talent der Regenwürmer, die organisches Material zerkleinern und dem Boden in Form von Kot als wertvolle, fruchtbare Masse zurückgeben. Ein Grund für ihn, 2006 dann auch auf biologische Landwirtscha umzustellen: „Ich dachte mir, ich bin begeistert von den Würmern, aber streue selbst Mineraldünger – das widerspricht sich“, sagt Grand. Schon immer kombinierte er das Wissen, das er über die Tiere anhäu e, mit Wissenscha , öffnete die Ho ore für Forscher und Forscherinnen oder Studierende und ihre Projekte. Als der Niederösterreicher 2014 dann mit 80 anderen Forschern im Rah-
Methan ist das schlimmere CO 2 Obwohl es kürzer in der Atmosphäre verweilt, hat es eine viel potentere Erwärmungswirkung. Das meiste Methan stammt aus der Landwirtscha – die berühmten Rülpser und Fürze von Rindern. Aber auch Mülldeponien oder Lecks in der Infrastruktur von Erdgas und Öl führen zu Methanemissionen. Die Forschung sucht nach Lösungen: Eine Studie an der University of California, Davis, zeigte etwa, dass Tierfutter mit Zusätzen der Algenart Asparagopsis taxiformis das Methan um bis zu einem Fün el reduziert. Ein anderes Projekt namens Zelp hat „Maulkörbe“ für Kühe entwickelt, die aus dem Methan Kohlendioxid und Wasserdampf machen – ob das für die Tiere bequem ist, sei dahingestellt.
men eines EU-Projekts zusammenkam, wusste er: Sein Hof soll offiziell zum Forschungshof werden. Seither wird versucht, hier große Fragen zu beantworten: Wie bindet man mehr CO2 im Boden? Wie passt man Pflanzen an den Klimawandel an? Oder könnte man Saatgut mit dem Mikrobiom, also den Darmbakterien, von Regenwürmern beizen? Nebenbei hat Grand das System der „Marktgärtnerei“ wiederbelebt. Und baut auf kleinen Flächen (meist unter einem Hektar) eine große Vielfalt an Gemüse und Kräutern an.
Bei ihm selbst sind es 7000 Quadratmeter mit 70 verschiedenen Gemüsekulturen – und 180 Kunden, die sich ihr Gemüsekisterl mit der Ernte dann abholen. KK












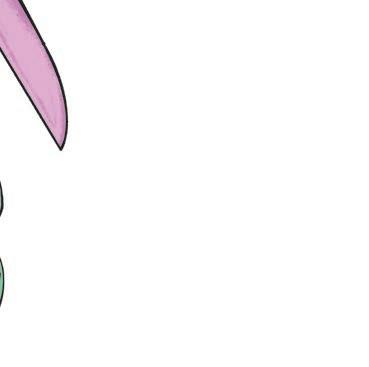


Neue Gentechnik könnte im Kampf gegen den Klimawandel helfen und die Ernährungssicherheit stärken, sagen Forscher. NGOs sehen in ihr weiterhin eine große Gefahr. Wer hat Recht?
BERICHT: KATHARINA KROPSHOFER
ILLUSTRATIONEN: LILLY GRASCHL




AArabidopsis thaliana fühlt sich sichtlich wohl hier. Im lila Licht der Kühlkammer hat das zarte Pflänzchen ihre weißen Blüten gen Leuchtröhre wachsen lassen, die fleischigen Blätter lappen über die kleinen Plastikbehälter. Die Ackerschmalwand ist der Prototyp einer Samenpflanze, evolutionär gesehen komplexer als Moose oder Algen und trotzdem simpel – zumindest, was ihr Genom angeht, die Summe der Gene, die ihr Leben bestimmen. Und weil sie außerdem schnell wächst, macht sie das zum beliebtesten Forschungsobjekt eines jeden Pflanzenforschers.
Hier am Gregor Mendel Institut der Österreichischen Akademie der Wissenscha en ÖAW nützen sie Wissenscha ler unter anderem, um zu verstehen, wie sich die unscheinbare Pflanze über tausende Jahre europaweit ausbreiten konnte, sich dabei genetisch veränderte, manche Subtypen Kälte besser vertragen oder ihre Blütezeit angepasst haben. Und so auch Antworten auf größere Fragen zu finden: Was ist das Geheimnis von Pflanzen, die unter kalten Gletscherdecken wachsen oder mit kleinen Wasserreserven in Wüstengebieten überleben können? Und in welchen Genen steht es geschrieben?
Vor rund zehn Jahren fand auf diesem Forschungsgebiet eine kleine Revolution statt: Statt die Pflanzen wachsen zu lassen, zu kreuzen, auf zufällige Mutationen in den Genen zu hoffen, hatte man plötzlich ein neues Werkzeug in der Hand: die Genschere Crispr-Cas9 (siehe Glossar). Nur ein Gebäude neben dem Gregor Mendel Institut legte die Biochemikerin Emmanuelle Charpentier die Bausteine für diese Technologie, gemeinsam mit Jennifer Doudna bekam sie 2020 dafür einen Nobelpreis verliehen. Kennen Forscher das Genom einer Pflanze, können sie die Genschere nutzen, um Gene gezielt ein- oder auszuschalten und so schnell und kostengünstig herauszufinden, welche Gene für welche Funktion oder Eigenscha zuständig sind. Und die Pflanzen im nächsten Schritt auch dahingehend verändern.
Im Labor ist die Genschere seither zum Alltagswerkzeug geworden. Aber die Geneditierten Pflanzen auch im Freien, unter realen Bedingungen, zu testen, war bisher fast unmöglich, so die Forscher: Zu streng die Richtlinien, zu viele Ressourcen und Geld für einen Antrag. Zumindest in Österreich. Und zu groß die Bedenken der EU, diese Neue Gentechnik anders zu bewerten als veraltete Vorgängermethoden, sie viel-
leicht doch zuzulassen – wie es in den USA oder China etwa bereits gang und gäbe ist. Zumindest bis jetzt.
„Das ist einfach eine ganz künstliche Umgebung“, sagt Ortrun Mittelsten Scheid und fährt mit den Augen ihr Labor ab. 42 Forscherinnenjahre lang verfolgt die Biologin die Diskussion rund um die Gentechnik bereits. Kurz vor ihrer Pensionierung hat sich zum ersten Mal ein politisches Fenster aufgetan: Die EU hatte die Regulierungsprozesse rund um die Neue Gentechnik nochmal überdacht und im Sommer 2023 einen Gesetzesvorschlag vorgelegt. Im Februar dieses Jahres stimmte dann das EUParlament dafür – wenn auch mit einigen Lockerungen, die etwa Biolandwirte besser schützen sollen.
Warten müssen nun die Freunde und Feinde der Technologie: Weil einige Mitgliedstaaten skeptisch blieben, muss mit der Lockerung der strengen Vorschri en bis zur nächsten Legislaturperiode gewartet werden. Die Blockierer? Polen, Kroatien, die Slowakei – und Österreich. Bis auf Claudia Gamon (Neos) stimmten die österreichischen Abgeordneten schon im EU-Parlament dagegen. Denn in Österreich ist Gentechnik in etwa so populär wie Atomkra – also gar nicht.
Und während Forscher schon von neuen Möglichkeiten träumen, wächst auch die Liste der NGOs, die das Ende der spezifischen Risikoprüfung und Kennzeichnungspflicht dieser Methoden fürchten. 340 Organisationen wandten sich schon vergangenes Jahr in einem offenen Brief an die EU-Kommission und forderten, Neue Gentechnik weiterhin klar zu kennzeichnen und zu regulieren. „Für uns wäre es fatal, wenn eine Deregulierung der Gentechnik kommt“, meint etwa Birgit Reisenberger, die bei Global2000 für Landwirtscha zuständig ist. Umweltorganisationen wie diese sorgen sich um negative gesundheitliche, wirtscha liche sowie ökologische Folgen. Wer hat also recht?
Mehr als 600 Einträge listet die EU-Forschungsdatenbank „eusage“, alles wissenscha liche Publikationen zu Pflanzen, deren Eigenscha en mit der Genschere verändert wurden. Die Hoffnung? Einen Beitrag zum großen Dilemma zu leisten, mehr als acht Milliarden Menschen zu ernähren, während wir gleichzeitig auch Flächen für die Natur bereitstellen wollen. Da könnte eine Kartoffel mit besserer Resistenz gegenüber der Kraut- und Knollenfäule helfen; setzt man sie ein, müsste man die Pflanze mit weniger Fungiziden behandeln. Oder Gen-editierter Raps: Da seine reifen Schoten sehr spröde sind, kommt es bei der maschinellen Ernte normalerweise zu großen Verlusten. Mutiert man ein bestimmtes Gen, bleiben die Samen in den Schoten. Und dann noch ein Forschungsprojekt der renommierten US-Forscherin Joanne Chory, das fast zu gut klingt, um wahr zu sein: Sie versucht, Arabidopsis-Arten per Genschere dazu zu bringen, mehr CO2 in ihren Wurzeln zu speichern. Auch der Schweizer Agrarwissenschaler Urs Niggli plädiert dafür, Methoden der Neuen Gentechnik eine Chance zu geben. Vor allem, um die konventionelle Landwirtscha nachhaltiger zu machen. „Das Endprodukt des Genom-Editierens ist nicht mehr unterscheidbar von einer natürlichen Mutation, wie sie in der Natur au ritt oder wie sie auch Biozüchter herbeiführen. Daher sind diese Methoden, wenn sie geprü
sind, für eine nachhaltige Landwirtscha kein Widerspruch mehr“, sagte er vor zwei Jahren im Interview mit dem Falter Bisher galten für alle Lebensmitteln, die mit Methoden dieser Neuen Gentechnik hergestellt wurden, die gleichen, strengen Regeln des EU-Gentechnikrechts. So urteilte der Europäische Gerichtshof auch 2018 – und viele Wissenscha ler verstanden das nicht. Schließlich blieb nichtzielgerichtete Mutagenese, also eine Veränderung der Pflanzen durch chemische Behandlung oder Bestrahlung, weiterhin erlaubt. Obwohl diese Methode Mutationen viel ungezielter herbeiführt. „Ich glaube, das größte Problem ist, dass diese Richtlinie nicht unterscheidet, ob hier fremdes Erbgut eingebracht oder die Pflanze in sich selbst verändert wurde“, sagt auch der damalige Wissenscha sminister Heinz Faßmann bei einem Pressegespräch. Die Bioethikerin Christiane Druml nannte die EU-Entscheidung gegenüber dem Standard damals ein Zeichen der „existierenden Abneigung gegenüber Genetik“ und die Folge eines „romantisch verstandenen Natürlichkeitsbegriffs“.
Denn eigentlich experimentiert der Mensch schon seit 10.000 Jahren mit Pflanzen, verändert ihre Gene – wenn auch nicht in Laboren. Seitdem er sessha ist, suchen Menschen Wildpflanzen mit Mutationen aus, die gewünschte Eigenscha en haben, zum Beispiel mehr Früchte bilden. Im heutigen Mexiko züchtete man etwa vor 8000 Jahren Teosinte-Getreide mit natürlich vorkommenden Mutationen zu den heutigen Maissorten – mit mehr Ertrag und Pilzresistenzen. 1996 bauten Landwirte in den USA erstmals transgene Sojabohnen an, die das Pestizid Glyphosat tolerierten. Als sie noch im gleichen Jahr nach Europa importiert wurden, sorgte das für Kontroversen. Boulevardblätter warnten vor „Frankenstein-Tomaten“. Und auch in Österreich ist das Thema bis heute vorbelastet: 1,2 Millionen Österreicher unterschrieben 1997 das Volksbegehren gegen Gentechnik, es war das zweiterfolgreichste in der Geschichte. Kurz zuvor hatten Aktivisten von Global2000 – unter ihnen die heutige Stadträtin Wiens, Ulli Sima (SPÖ) – einen kleinen Skandal aufgedeckt: Der Nahrungsmittelkonzern Agrana hatte begonnen, gentechnisch veränderte Kartoffeln zu testen – ohne auf die bereits eingereichte Bestätigung aus dem Ministerium zu warten. Darau in schlos-
Fortsetzung nächste Seite
Die Genschere besteht aus zwei Bestandteilen. Der eine ist ein Enzym, das DNA schneidet, der zweite Bestandteil ist eine RNA, die bestimmt, an welcher Stelle die Genschere ihren Schni durchführt. So lässt sich das Erbgut viel einfacher und schneller verändern als bisher
ist eine spontan au retende oder herbeigeführte, dauerha e Veränderung des Erbguts. Sie hat (teils sichtbare) Auswirkungen auf die Merkmale eines Organismus, etwa die Farbe von Blütenblä ern
Gentechnisch veränderte Organismen (GVOs) sind Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen, deren Erbgut durch technologische Methoden verändert wurde
Werden in einem Organismus einzelne Gene verändert oder neu eingeführt, handelt es sich um „klassische“ Gentechnik. Als Neue Gentechnik (NGT) bezeichnet man Methoden wie die Genschere Crispr-Cas9, die diese Änderung viel präziser durchführt – ohne organismusfremde Sequenzen einzuführen
Biologin Ortrun Mi elsten Scheid.
42 Forscherinnenjahre lang verfolgt die Biologin die Diskussion rund um die Gentechnik







Fortsetzung von Seite 39
sen sich immer mehr Entscheidungsträger aus Politik und Wirtscha dem Lager der Anti-Gentechnik-Aktivisten an.
Das Ressentiment gegen Gentechnik hält bis heute. Lebensmittel schmücken sich weiterhin mit dem Label „gentechnikfrei“, vor allem für die biologische Landwirtscha ist es ein großes Verkaufsargument. Auch das aktuelle Regierungsprogramm spricht sich gegen eine Anpassung des aktuellen Gentechnikrechts aus. Global2000 vertritt weiterhin dieselben Standpunkte, ihre ehemalige Geschä sführerin Leonore Gewessler führt heute für die Grünen das Klimaschutzministerium.
Aber auch ein Großteil der Wissenscha ist seither auf demselben Standpunkt geblieben: Es gebe keine wissenscha liche Basis, gegenüber dieser neuen, grünen Gentechnik besonders skeptisch zu sein. Darauf zu verzichten wäre in etwa so, wie wenn die Medizin minimalinvasive Chirurgie ablehnen

Die Global2000-Expertin Brigitte Reisenberger erzählt diese Geschichte etwas anders. Nicht die Wissenscha sei es, die hier ihre Interessen durchgebracht hat. Vielmehr liege eine neue Auslegung im Interesse großer Konzerne wie Bayer oder Syngenta. „Die Pestizid- und Saatgutindustrie möchte diese unliebsame Kennzeichnung loswerden, weil sie beides im Doppelpack verkaufen. Und weil sie Patente auf diese neuen Züchtungen legen wollen“, meint Reisenberger. Weil die EU plant, im Rahmen ihres Green Deals auch Pestizide um 50 Prozent zu reduzieren, würden die Konzerne einen Einbruch ihres Absatzmarktes fürchten und nun nach neuen Geschä sfeldern suchen.
Dazu kommen ökologische Sorgen: Gerade stresstolerante Pflanzen könnten erhebliche Umweltauswirkungen haben, weil sie sich in bisher unzugängliche Lebensräume ausbreiten und natürliche Arten verdrängen könnten, heißt es aus dem Umweltministerium. Dass Neophyten, also eingeschleppte Arten, das bereits tun, wird hier nicht erwähnt.
Umweltorganisationen wie Global2000 begründen ihre Skepsis auch mit enttäuschten Erwartungen: Trotz intensiver Forschung sei es nicht gelungen, genetisch veränderte Nutzpflanzen, die gegen Trockenheit resistent sind und Hitze besser aushalten, zur Marktreife zu bringen. „Da beißt sich doch die Katze in den Schwanz“, meint die Pflanzenforscherin Ortrun Mittelsted Scheid, „wenn man es nicht anbauen und nicht testen kann – wo soll der große Sprung dann herkommen?“

würde, meinen viele. „Vermutungen, Ängste und Ideologien haben wir in diesem Bereich zuhauf. Was wir zu wenig eingebracht haben, ist dieses gesicherte Wissen“, sagt Heinz Faßmann.
Das Beharren der Wissenscha hat Wirkung gezeigt. 2021 veröffentlichte die EU selbst eine Studie und zeigte sich offen gegenüber einer Neubewertung: „Diese Studie bezeugt, dass es ein großes Interesse für Forschung an neuer Gentechnik in der EU gibt, aber die meiste Entwicklung außerhalb passiert“, schreibt die EUKommission darin. Das Urteil des EuGH hätte zu negativen Einflüssen in der Forschung geführt, man fürchte auch, nicht mehr mit Staaten außerhalb der EU mithalten zu können. Auch wenn viele Vorteile, etwa um den Green Deal zu erreichen, bisher nur hypothetisch sind, könne man für viele dieser neuen Methoden keine größeren Gefahren erwarten als für herkömmliche Zuchtverfahren.

Dieser Text erschien im Falter 22/23 und wurde aktualisiert.
Viele Forscher plädieren daher dafür, auf Bewährtes zu setzen: Verfahren, die auf bisherige, konventionell erzeugte Sorten angewendet werden, auch auf Gen-editierte Pflanzen anzuwenden. „Da bin ich mit den Opponenten völlig einig: Ohne ausführliche Prüfung von neuen Zuchtergebnissen wäre ich auch sehr vorsichtig, sie zur Marktreife bringen zu wollen.“
Es ist also kompliziert. Viel spricht dafür, die neuen Züchtungsmethoden über konventionelle zu stellen, vor allem auch, um Abhängigkeiten gegenüber den USA und China, die diese Methoden seit langem anwenden, nicht noch zu verstärken, sich abhängen zu lassen. Aber auch die Vorsicht gegenüber neuen Patenten, die große Konzerne leichter umsetzen können, nicht zu unterschätzen. Und dass die biologische, gentechnikfreie Landwirtscha ihr Alleinstellungsmerkmal nicht einfach so aufgeben will, wundert selbst die Forscher nicht.
Am Ende kritisieren Umweltorganisationen, die vor unbekannten Folgen warnen, und Forscher, die auf eine Neubewertung pochen, auf gewisse Weise dasselbe: die Einseitigkeit der Landwirtscha . Pflanzen, die resistent gegen Herbizide werden, und Landwirte, die sich deshalb auf Unkrautvernichter verlassen, anstatt nach ausgewogenen Methoden zu suchen. „Ich halte Gentechnik nicht für das Allheilmittel, viele Probleme sollten wir wirklich anders angehen“, sagt auch die ÖAW-Forscherin Ortrun Mittelsten Scheid. „Aber auf ein sehr wirksames, gut etabliertes Werkzeug zu verzichten, halte ich nicht für sehr gescheit.“ F
NNatürlich sitzt Irmgard Greilhuber vor Pilzen. Der Bildschirmhintergrund beim Videotelefonat lässt keine Zweifel daran, wo die Leidenscha der 62-Jährigen liegt. Greilhuber, außerordentliche Professorin am Department für Botanik und Biodiversität der Universität Wien, ist gleichzeitig so etwas wie Österreichs Pilz-Erklärerin –und eine der wichtigsten Forscherinnen des Landes in diesem Bereich.
Pilze bilden neben Tieren und Pflanzen ihr eigenes Reich. Man kennt sie mit Hut und Stiel im Wald oder als wucherndes Gewächs an Baumstämmen. Das ist aber nur ein kleiner Teil der enormen Vielfalt. Viele der Pilze sind winzig klein und leisten im Verborgenen wichtige Arbeit für den Stoffkreislauf, etwa im Boden.
Rund 2,5 Millionen Arten gibt es weltweit, 155.000 sind derzeit beschrieben, 17.000 werden in Österreich vermutet –dieselbe Vielfalt wie im zehnmal größeren Deutschland. Denn von Tiefland bis Hochgebirge verfügt Österreich über verschiedene Lebensräume. „Das macht uns auf der kleinen Fläche so bald niemand nach“, sagt Greilhuber.
Und das kommt mit einiger Verantwortung: Fast jeder dritte österreichische Pilz steht auf der roten Liste, ist also gefährdet. Gäbe es keine Pilze mehr, wäre einiges anders, erklärt Greilhuber im Gespräch.
Falter: Warum brauchen wir eigentlich Pilze?
Irmgard Greilhuber: Ohne Pilze würde unser Planet vollkommen anders ausschauen. Es gäbe niemanden mehr, der die Biomasse, die von den Pflanzen aufgebaut wird, remineralisiert, also recycelt. Es gibt zwar Tiere wie den Borkenkäfer oder Engerlinge (die Larven der Blatthornkäfer), die das tote Holz und die abgestorbenen Pflanzenreste zerkleinern und vorverdauen. Aber den Abbau machen die Pilze. Sie sind die einzigen Organismen, die komplexe Stoffe wie Lignin, also die Holzsubstanz, zersetzen können.
Wie gelingt ihnen das?
Greilhuber: Sie scheiden Enzyme, also Proteine, die chemische Reaktionen verursachen, in den Boden aus und nehmen dann die gelösten Nährstoffe, wie beispielsweise Stickstoff, wieder auf und können diese an die Pflanzen weitergeben. Dazu haben sie ihre feinen Hyphen, also Pilzfäden. Die kann man sich wie Spinnweben vorstel-








Die Mykologin Irmgard Greilhuber über Pilze als klimafreundlichen Düngerersatz, Inzucht bei Eierschwammerln und den bedrohten Lebensraum des riesigen Reichs
INTERVIEW: ANNA GOLDENBERG








len, die im Boden verborgen sind. Damit können sie sehr weite Strecken besiedeln und funktionieren somit wie eine Verlängerung der Pflanzenwurzeln – und liefern der Pflanze wichtige Nahrung, vor allem Phosphat, das sie zum Wachsen brauchen. Die meisten Pilze sieht man nicht. Sie verrichten ihre Arbeit im Verborgenen.




Dafür bekommen sie aber bestimmt etwas. Natürlich. Die Natur ist beinhart. Da wird nichts kostenfrei gemacht. Der Pilz erhält bis zu 30 Prozent der Photosyntheseprodukte der Pflanze dafür – also der Zucker, der entsteht, wenn die Pflanze mithilfe von Lichtenergie Kohlenstoffdioxid umwandelt. Die Pflanze wächst dank der Pilze um so viel besser, dass sie davon etwas abgeben kann und trotzdem noch eine positive Bilanz für sie bleibt. Man könnte sich künstliche Düngemittel, wie etwa Phosphatdünger, ersparen, wenn man ganz gezielt Mykorrhiza-Pilze einsetzen würde. Das sind jene Pilze, die mit den Pflanzen in Symbiose leben. Es profitieren also beide davon. Wenn nur einer profitiert, wäre es Parasitismus.
Wenn ich an Pilze denke, assoziiere ich damit ja eher solche schädlichen Gewächse. Greilhuber: Parasiten gibt es natürlich auch. Besonders, weil wir als Menschheit mit unserer globalen Reisetätigkeit und dem globalen Handel die Ökosysteme durcheinanderbringen. Sprich: Wir schleppen sehr viel ein – und exportieren natürlich auch selbst. Die Anzahl dieser sogenannten Neomyceten, also eingeschleppten Pilzarten, hat sich in den vergangenen 20 Jahren verfünffacht. Wir haben jetzt über 350 Arten in Österreich. Viele sind harmlos; einige sorgen aber für massive Schäden in der Land- und Forstwirtscha . Das Eschentriebsterben verursacht beispielsweise das Falsche Weiße Stengelbecherchen, ein Mikropilz, der aus Ostasien stammt. Oder die Ulmenwelke, die entsteht durch Ophiostoma-Schlauchpilze, ebenfalls aus Ostasien. Wenn das Ökosystem im Gleichgewicht ist, haben solche Parasiten keine Chance. Dann gibt es sie da und dort ein bisschen, aber sie können keinen Schaden in diesem Ausmaß anrichten.
Was kann man also tun, wenn man die parasitären Pilze gering halten und die nützlichen fördern will?
Fortsetzung nächste Seite
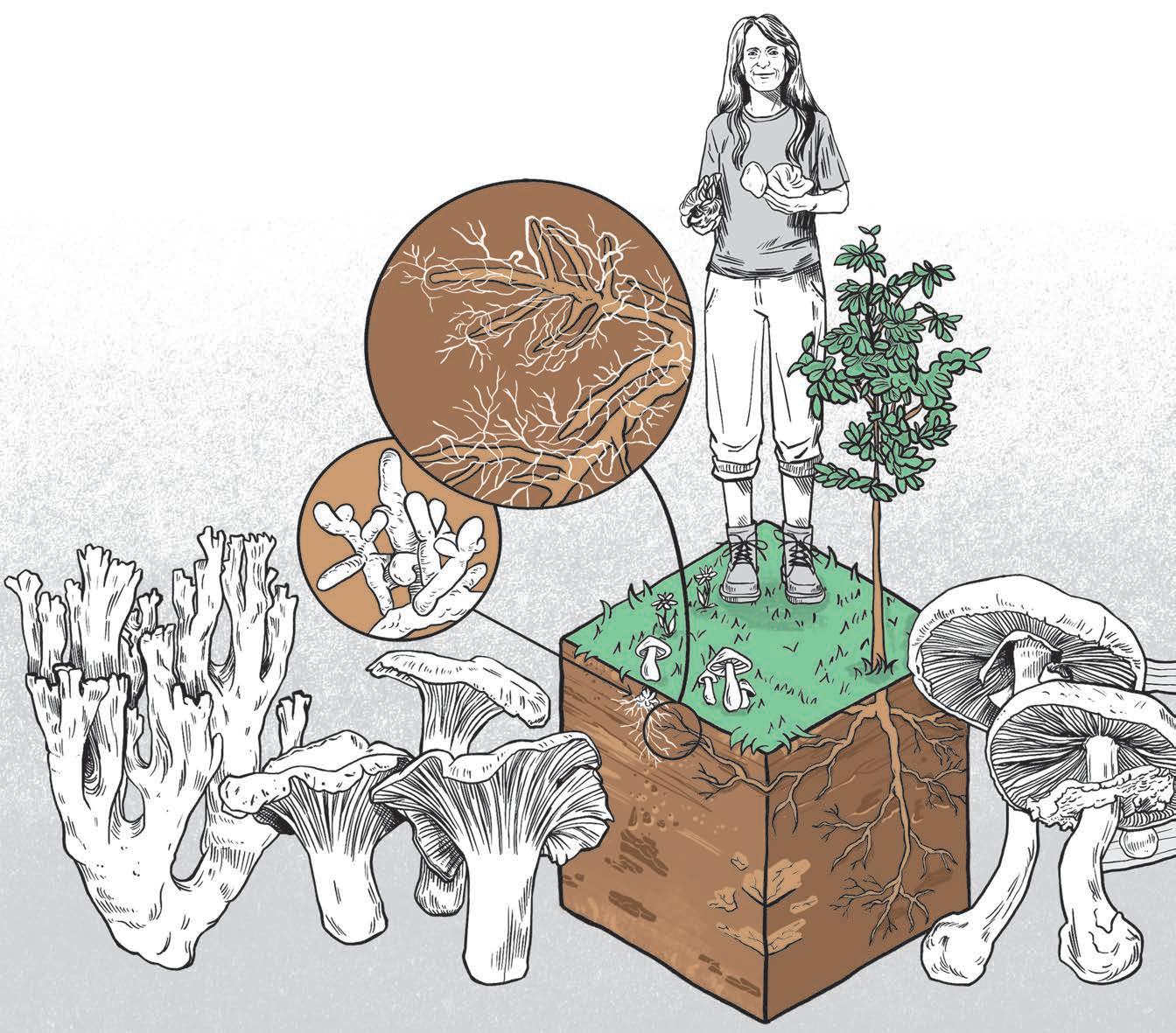
Fortsetzung von Seite 41
Greilhuber: Das Wichtigste ist der Habitatschutz. Da wären wir etwa bei der Bodenversiegelung. Habitate sollten nicht zerstört werden. Und die, die es gibt, sollten möglichst biodiversitätsfreundlich bewirtscha et werden. Das heißt: Mischwald statt Monokultur und einen gewissen Anteil an Totholz für Holzkäfer und Holzpilze liegen lassen. Ich sag immer: Räumt im eigenen Garten einfach nicht alles so zusammen! Habt ein bisschen mehr Mut zum Chaos … Man schafft damit auch den Insekten einen Lebensraum, und das sind wichtige Bestäuber, die die ganze Nahrungskette fördern. Gut, manche wollen das vielleicht nicht, denn dann haben sie auch mehr Gelsen ... Aber schreiben Sie doch, es gibt dann auch mehr Schmetterlinge!
Sollte man, um das Klima zu schützen, Pilze statt Fleisch essen?
Greilhuber: Pilze sind sicher eine Fleischalternative. Ihre Konsistenz ist ähnlich und sie enthalten viel Eiweiß. Außerdem produzieren sie im Vergleich zum Rind viel
weniger CO2. Man muss zudem viel weniger Fläche dafür zerstören. Pilze wachsen auch in Innenräumen und dort lassen sie sich sogar übereinanderstapeln! Ernährungsphysiologisch sind sie wertvoll. Das lässt sich verstärken, etwa indem man sie mit UV bestrahlt – dann enthalten sie noch mehr Vitamin D.
Ich lese, dass wir rund 155.000 Pilzarten kennen, es aber geschätzt 2,5 Millionen Arten gibt. Verzweifelt die Forschung nicht daran?
Greilhuber: Es hat sich schon sehr viel getan. Ich habe mich ja schon als Kind dafür interessiert. Da war ich sicherlich erblich vorbelastet, denn beide meiner Eltern haben Biologie studiert, und so waren wir am Wochenende o in der Natur, rund um die oberösterreichische Seenplatte, wo ich aufgewachsen bin. Die Pflanzen fand ich ein bisschen langweilig: Die waren stabil. Man hat sie sich einmal angesehen und hat sie schon erfasst gehabt. Die Tiere waren mir zu schnell, die sind immer davongeflogen oder davongehüp . Und die Pilze, die fand
Man könnte sich künstliche Düngemittel, wie etwa Phosphatdünger, ersparen, wenn man ganz gezielt Mykorrhiza-Pilze einsetzen würde
ich faszinierend. Denn sie waren nicht immer da, dann kamen sie plötzlich, dann waren sie wieder weg – und niemand hat sich ausgekannt.
Und jetzt kennt man sich besser aus?
Greilhuber: Damals war beispielsweise völlig unbekannt, wie viele Pilze es in Wien gibt. Wenn man Durchschnittsbürger heute fragt, wie viele Arten es gibt, tippen sie auf rund 20. In meiner Dissertation habe ich mich damit beschä igt: Wir kamen auf 1500 Arten – und das ist nach wie vor nicht alles. Dass Pilze in fast jeden Lebensbereich hineinspielen, ist den meisten nicht bewusst. Haben Sie eigentlich selbst neue Pilzarten entdeckt?
Greilhuber: Ich habe es nicht abgezählt, aber um die 20 werden es schon sein. Wir haben ziemlich viel Material in der Schreibtischlade, aber kommen einfach nicht dazu, das aufzuarbeiten.
Warum ist das so aufwändig?

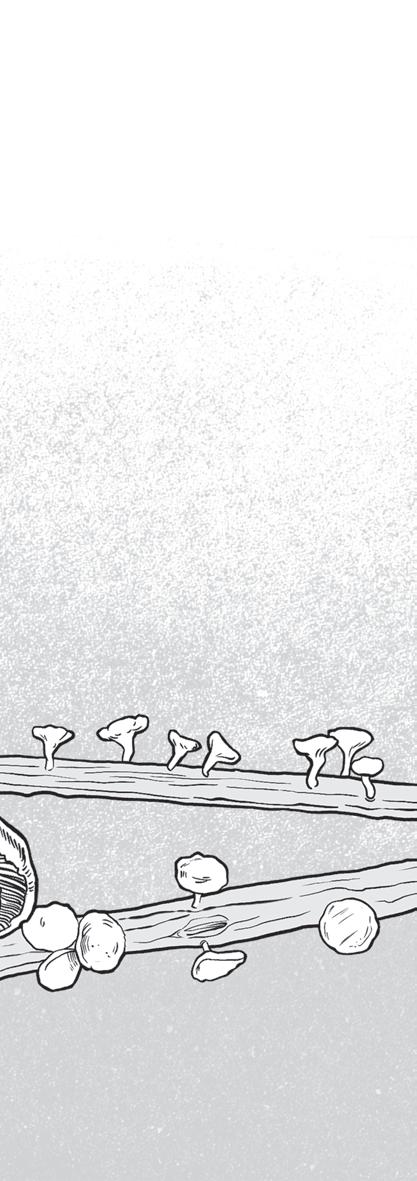
Greilhuber: In einem ersten Schritt muss ich die Pilze kultivieren, also züchten. Dann steht die Sequenzierung der genetischen Information an. Außerdem müssen wir die makroskopischen und die mikroskopischen Merkmale erheben. Und dann kommt die größte Herausforderung: Man muss schauen, ob die Art schon beschrieben wurde. Hab ich irgendwo Literatur übersehen, wo es eventuell schon drinsteht? Wenn man beispielsweise denkt, der neue Pilz könnte zur Gattung der Amanita, also Knollenblätterpilze, gehören, muss ich die ganze Literatur durchackern, inklusive der uralten Literatur, in der noch keine DNA sequenziert wurde.
Als Präsidentin der Österreichischen Mykologischen Gesellscha haben Sie ja auch viel mit Pilzsammlern zu tun, die Ihnen ihre Funde zum Bestimmen bringen. Worauf muss man achten, wenn man verantwortungsvoll sammeln will?
Greilhuber: Ich würde mal sagen, einfach die gesetzlichen Regeln einhalten – also nicht mehr als zwei Kilo pro Person und Tag pflü-

Zur Person
Irmgard Greilhuber, Jahrgang 1962, ist außerordentliche Professorin am Department für Botanik und Biodiversität der Universität Wien, Präsidentin der Österreichischen Mykologischen Gesellscha und im Leitungsteam des Österreichischen Biodiversitätsrats
ILLUSTRATIONEN: LILLY GRASCHL
ren brauchen, um die genetische Vielfalt zu bewahren. Sonst landen sie in der Inzucht. Das zu untersuchen ist allerdings schwierig.
Die Vergi ungszentrale stellt ja auch zu Ihnen durch, wenn es Fragen zu Pilzen gibt. Was wollen die Menschen wissen?

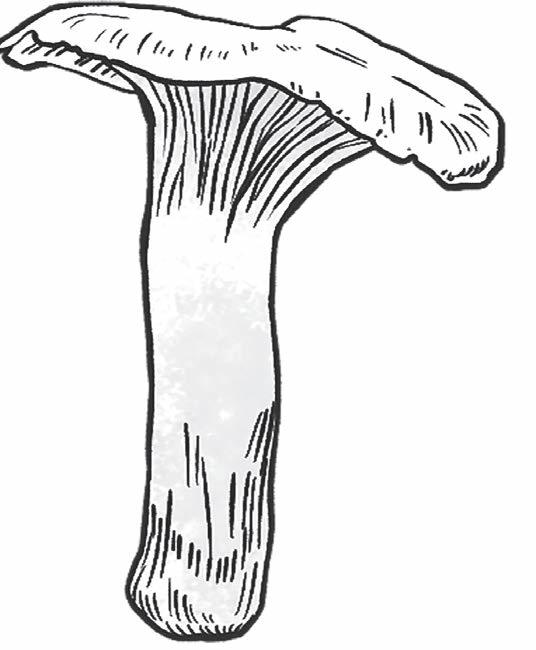


cken. Die beliebten Schwammerl – Steinpilze, Eierschwammerl oder Parasole – sind nicht gefährdet. Die kann man guten Gewissens nehmen. Man sollte aber nicht jedes kleine Pilzbaby ausreißen, sondern dem Pilz ermöglichen, seine Sporen, also Fortpflanzungszellen, auszubilden. Vor allem Eierschwammerl entwickeln ihre Sporen relativ spät. Werden sie alle zu früh gepflückt, nimmt die Population ab. In Großstadtnähe geschieht das schon – auch weil dann immer nur die Sporen von den ungenießbaren Pilzen im Boden landen und sich die Verteilung verschiebt. Im Maurerwald bei Wien ein Eierschwammerl zu finden, ist mittlerweile Glückssache. Das war früher leichter. Dazu kommt, dass die Pilze die Spo-
Greilhuber: O ist den Menschen nicht bewusst, dass es in einer Pilzgruppe auch giftige Arten gibt. Zum Beispiel Champignons – Karbolchampignons sind gi ig. Außerdem bekomme ich sehr viele Anfragen zu Kindern im Vorschulalter. Die sind neugierig und kosten einfach alles. Meistens ist es harmlos, denn die wenigsten Pilze sind so schwer gi ig, dass man gleich etwas machen muss. O haben Leute Beschwerden, weil sie zu alte oder verschimmelte Pilze gegessen haben. Sie schicken mir auch Fotos. Das ist sehr hilfreich, denn dann tue ich mir bei der Diagnosestellung leichter.
Ist es denn bei manchen Pilzen so schwierig zu erkennen, wenn sie schimmeln?
Greilhuber: Nein, das sieht man ganz deutlich. Es ist ein psychologischer Faktor. Man hat sie mühsam im Wald gefunden – und dann sind sie vielleicht nicht mehr gut und stinken. Dann muss man diesen Jagdtrieb überwinden und die Härte zu sich selbst au ringen, sie einfach wegzuschmeißen. F

WANDERN MIT KINDERN K. Bliem | P. Hiess
30 Touren rund um Wien für Familien- Wandertage mit Kindern von 4 bis 14 Jahren.
256 Seiten, € 29,90
Die Falter-Klimajournalistinnen Katharina Kropshofer und Gerlinde Pölsler stellen Ihnen zwölf Bücher und vier Dokumentarfilme

Tanja Busse: Fleischkonsum. 33 Fragen – 33 Antworten. Piper, 128 S., € 10,30
Die deutsche Journalistin Tanja Busse hat schon über das Artensterben, „Die Wegwerfkuh“ und umkämp e Böden Bücher geschrieben. In „Fleischkonsum“ beantwortet sie Fragen wie „Wie viel Fleisch dürfen wir essen, ohne dem Planeten zu schaden?“ Dabei berücksichtigt sie sowohl Ökologie und Tierwohl als auch die Bedingungen, unter denen Bauern arbeiten müssen. Klare und dennoch keineswegs verkürzte Antworten.

Florian Klenk: Bauer und Bobo. Wie aus Wut Freundscha wurde. Piper, 160 S., € 12,40
„Steigen Sie von ihrem Bobo-Ross und kommen Sie zu einem Praktikum“, forderte Bergbauer Christian Bachler in einem Wutvideo Falter-Chefredakteur Florian Klenk auf. Der tat das und erfuhr dabei viel über Banken und das Bauernleben. Als der Hof vor dem Ruin stand, fanden die beiden in zwei Tagen 12.829 Spender, der Hof war gerettet. In „Bauer und Bobo“ erzählt Klenk faktenreich, Kurt Langbein brachte die Story ins Kino.

Urs Niggli: Alle sa ? Ernährung sichern für 10 Milliarden Menschen. Residenz, 160 S., € 19,–Mehr als 30 Jahre hat
Urs Niggli zum Biolandbau geforscht. In „Alle satt?“ sucht er nach Wegen, eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Ihn treibt die Frage um, wie sich neben dem Biolandbau die gesamte Landwirtscha ökologisieren lässt. Als unverzichtbar sieht er Wiederkäuer, weil nur sie für den Menschen nicht verwertbares Gras in Proteine umwandeln können. Für die Biobranche, aus der Niggli kommt, setzt es Lob und Kritik.

Martin Grassberger: Das leise Sterben. Warum wir eine landwirtscha liche Revolution brauchen, um eine gesunde Zukun zu haben. Residenz, 336 S., € 25,–
Es war das Wissenscha sbuch des Jahres 2020 (Kategorie Naturwissenscha ): Der Arzt und Biologe Martin Grassberger beschreibt darin, was die industrielle Landwirtscha mit chronischen Erkrankungen zu tun hat. So schade die Chemie in den Ackerböden, auf denen unser Essen wächst, unserem Darm. Der Autor skizziert auch eine mögliche Agrarwende.

Eine Bohne re et die Welt. Warum die Billigfleisch-Ära zu Ende geht und was Soja damit zu tun hat. EcoWing, 184 S., € 24,–
Matthias Krön war Manager in der Milchwirtscha und gründete dann den Verein Donau Soja, der den Anbau der kleinen Proteinbombe in Europa fördert. In ihr sieht Krön riesiges Potenzial. Aber nicht, wenn sie aus dem Regenwald kommt, um den Globus gekarrt wird und in Futtertrögen landet. Sondern wenn sie regional und gentechnikfrei wächst und Menschen statt Tiere ernährt.

Bastian Kaiser: Bin im Wald! Mit einem Forstexperten durchs grüne Dickicht. Hirzel, 300 S., € 25,70
Der Rektor einer Hochschule für Forstwirtscha erforscht seit Jahrzehnten den Wald in Deutschland und anderswo. Auf die vielen Konfliktfelder blickt Bastian Kaiser differenziert: So kritisiert er, dass viel Holz vergeudet werde, plädiert aber auch für das moderate Nutzen heimischer Wälder und gegen Importe aus Regionen, in denen der Wald für die Menschen existenziell viel wichtiger ist als in Europa. Lehrreich und persönlich.

Timo Küntzle: Landverstand. Was wir über unser Essen wirklich wissen sollten. Kremayr & Scheriau, 336 S., € 24,–
Das Ende der Intensivlandwirtscha wäre Selbstmord; wir brauchen Pestizide, Gentechnik und Stickstoffdünger, so Timo Küntzle, Bauernsohn und studierter Agrarwissenscha ler. Die Konsumenten würden der Landwirtscha „einen Mühlstein“ an widersprüchlichen Wünschen umhängen. Man kann in vielem zu anderen Schlüssen kommen, Debattenanstöße liefert der Autor jedenfalls.

Leo Steinbichler: Wir fü ern die falschen Kühe. Der betrogene Konsument – Wege aus dem System. Ueberreuter, 268 S., € 26,–
In seinen „Stallvideos“ gibt der oberösterreichische Landwirt Leo Steinbichler gern den „Agrarrebellen“: Bevor er aus dem Bauernbund flog, saß er für die ÖVP im Bundesrat und später fürs Team Stronach im Nationalrat. In seinem Buch kriegen alle ihr Fett ab: die Agrarpolitik und Raiffeisen, ÖVP und SPÖ, die AMA und scheinheilige Konsumenten. Mit Einblicken zu Bezirksjägertagen und Bauernbundsitzungen.

24,70
Kühe rülpsen und furzen das Treibhausgas Methan aus und sind daher gefährliche Klimakiller, heißt es. Doch dieses Narrativ lenke bloß von der Öl- und Gasindustrie ab, sagt Florian Schwinn. Und überhaupt: Die Kuh gehöre wieder raus aus dem Stall auf die Wiese, die dadurch eine Weide wird. Das helfe dem Humusau au und also dem Klima. Außerdem ist jede Kuhflade ein Eldorado für die Artenvielfalt: Ein Plädoyer für eine andere Tierhaltung.

Astrid Drapela: Ich wollt, ich hä ein Huhn. Goldegg, 256 S., € 24,–Hühner im eigenen Garten zu halten wird immer beliebter. Auch Astrid Drapela lebt in Niederösterreich mit rund 40 von ihnen. Doch die Halter haben’s nicht leicht: Ausgerechnet das Haushuhn ist ein Stie ind der Forschung. Also hat Drapela Erkenntnisse gesammelt, was die Hühner kognitiv und kommunikativ so auf dem Kasten haben, und spickt das mit Anekdoten ihrer eigenen Hühnerschar. Und damit Sie’s gleich wissen: „Hühner werden unterschätzt!“
vor, mit denen Sie die Landwirtschaft besser verstehen, die Lösungen aufzeigen und Lust machen, selbst Hand anzulegen

Rupert Ebner, Eva Rosenkranz: Pillen vor die Säue. Warum Antibiotika in der Massentierhaltung unser Gesundheitssystem gefährden. oekom, 256 S., € 20,60
„Die größte Gesundheitskrise unserer Zeit ist da“: Bagatellen wie eine Blasenentzündung könnten kün ig wieder tödlich enden, Operationen seien kaum noch durchführbar. Der Grund ist der inflationäre Einsatz von Antibiotika vor allem in der Intensivtierhaltung. So entwickeln sich immer mehr resistente Keime, und die Wirkstoffe helfen nicht mehr. Ein Weckruf.

Marie Diederich: Selbstversorgung. Dein eigenes Gemüse anbauen, mit Hühnern kuscheln, in selbstgebackenes Brot beißen. Löwenzahn, 312 S., € 32,90
Milch in Joghurt verwandeln, Brot backen, Ziegen halten: Marie Diederich hat all das erprobt. Gutgelaunt und mit vielen Fotos zeigt sie, wie’s geht (Deutscher Gartenbuchpreis 2023!). Ihre Begeisterung für die Selbstversorgung vermittelt sie auch via Blog und Instagram (221.000 Follower). Und sie schwört: So schwer ist es nicht, und so viel Zeit braucht es auch nicht.
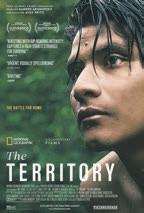
Alex Pritz: The Territory. National Geographic, 2022
Es ist eine Grenze, die nicht deutlicher sein könnte: Dort, wo das satte Grün au ört und die staubigen Viehweiden beginnen, endet auch die Heimat der Urueu-wau-wau, eines indigenen Stamms im brasilianischen Amazonas-Regenwald. Die Linie markiert auch eine Konfliktzone: Denn das Gebiet der Indigenen ist geschützt, selbstverwaltet und darf nicht abgeholzt werden. Eigentlich. Denn viele (weiße) Brasilianer sehen das anders – vor allem, während der

Shawn Bannon: The Smell of Money. Beyond the Pines, 2022
Stellen Sie sich vor, Ihr Leben wäre von einem wahnsinnigen Gestank geprägt: Er würde sich in Ihre Wäsche einnisten, Ihre Kinder krankmachen und Sie davon abhalten, Zeit im Garten zu verbringen. So in etwa geht es den Menschen in ländlichen Gegenden North Carolinas, USA. Dort, wo „Big Pork“, also riesige Schweinefarmen, den Weltbedarf an Speck und Barbecue-Fleisch decken wollen. Nur Sie haben ein Problem: Wohin
rechtsextreme Jair Bolsonaro das Land regierte (2019–2022).
The Territory gibt unglaubliche Einblicke in das Leben der Uru-euwau-wau, schafft es aber gleichzeitig, den illegalen Kolonisten, Landwirten und Umweltaktivistinnen zu folgen. Und erklärt wie kaum ein Film, was auf dem Spiel steht, wenn wir Landwirtscha nicht nachhaltig denken. Denn wie viel Wissen, Klimaschutz und Biodiversität im Amazonas versteckt ist, ist noch nicht mal erhoben.

Eric Guéret:
La Vie est dans le pré (Life beyond Monsanto).
Bonne Pioche, 2020
Der französische Landwirt Paul François baut Getreide an. Doch ein paar Atemzüge genügen, um den Rest seines Lebens zu verändern. Als er 2004 Dämpfe des Unkrautvernichtungsmittels „Lasso“ einatmet, wird er mit schweren Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gebracht. 2007 beschließt François, Monsanto, den Hersteller des Produkts und heute Teil des Unternehmens Bayer, zu verklagen. Er gewinnt den Prozess, auch nachdem der
Konzern dreimal Einspruch erhoben hatte. Seither hat er die konventionelle Landwirtscha hinter sich gelassen und lebt als Bio-Bauer im Westen Frankreichs. Die Dokumentation „La Vie est dans le pré“ (Life Beyond Monsanto; zu Deutsch: Das Leben liegt in der Wiese) begleitet ihn bei diesem Umstieg und beim Rechtsstreit und wurde 2021 beim Innsbrucker Nature Film Festival als bester Film in der Kategorie „Environment“ ausgezeichnet.

Teresa Distelberger:
„Re et das Dorf“ NGF – Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH, 2020
mit dem Dreck, der dabei entsteht?
Die Dokumentation folgt Elsie Herring, einer Anwohnerin, die sich gegen diesen „Smell of Money“ (so nennen die Betreiber den scheußlichen Geruch) wehrt. Eine Geschichte, die bedrückt, ermutigt und aufzeigt, wie es anders gehen könnte.
Dörfer sind Projektionsflächen für Idyllen: Ein Hauptplatz als Mittelpunkt, eine Kirche, ein Greißler, ein Wirtshaus. Und am Dorfrand der Blick über satte Wiesen, alte Höfe, schöne Wälder. Und sie sind Orte, wo viele Probleme der Gegenwart zusammenkommen: Die Jungen wollen weg, in die Stadt, wo es mehr Jobs und Unterhaltung gibt; kleine Geschä e stehen leer, weil sie Konkurrenz von Amazon und Co be-
kommen; Höfe werden von größeren Landwirtscha en aufgekau , weil sie alleine zu sehr straucheln.
„Rettet das Dorf“ dreht den Spieß um und fragt Leute, die für ihr Dorf brennen: Wie kann man dieses weiterleben lassen? Wieso entscheiden sich Ärztinnen oder Wirte bewusst, dortzubleiben? Und wie können Gemeinden gut Ausgebildete wieder zurück aufs Land bringen?
Hummel, Fledermaus, Rind: Unser Tierexperte hat nachgefragt, wie Klimakrise und Artensterben heimischen Tieren zusetzen. Was ihnen fehlt: die politische Unterstützung
UMFRAGE:
PETER IWANIEWICZ
?Biodiversitätsverlust und Klimakrise sind Geschwister. Der rasante Anstieg der Temperaturen hat massiven Einfluss auf die komplexen Beziehungen zwischen Tierund Pflanzenarten und die Zerstörung von Ökosystemen ist ein wesentlicher Faktor der Erderhitzung. Dazu haben wir die Sichtweisen einiger zentral betroffener Tierarten zu ihrer Situation eingeholt
Cricetus cricetus
» Wir sind als Nahrungsgeneralisten und durch unsere hohen Reproduktionsraten als Nagetiere eigentlich keine typischen Aussterbekandidaten. Aber in der industriellen Feldbewirtscha ung und durch den Klimawandel rei das Getreide früher im Jahr und wird dann sehr effizient von einem Tag auf den anderen geerntet. Nicht einmal die Ackerwildkräuter an den Feldrändern lasst ihr uns, sondern räumt diese als „Unkraut“ mit Herbiziden weg. Monokulturen, Flächenversiegelung und zerschnittene Lebensräume: Wir bekommen das ganze Paket ab und werden laut einer Prognose bis spätestens 2050 ausgestorben sein.
Polyommatus damon
» In den Alpen beginnt der Frühling im Durchschnitt sechs Tage früher als im vergangenen Jahrhundert. Die Durchschnittstemperatur stieg hier seit 1970 um 0,39 Grad pro Jahrzehnt. Das hat Auswirkungen! Wir Weißdolch-Bläulinge sind auf Almwiesen zuhause und an kältere Temperaturen angepasst. Also müssen wir jetzt bergauf fliehen. Doch die einzige Nahrungsgrundlage in unserer Jugend sind Esparsetten, verschiedene Arten von Hülsenfrüchten, und diese wandern nicht ebenso schnell mit. Die wenigen Pflanzen, die wir weiter oben noch finden, fressen uns dann auch noch Schafe und Rinder weg, die von den Bauern gezielt an diese nahrha en Stellen zur Weide geführt werden. Ohne Nahrung keine Streifen-Bläulinge. So einfach und so traurig ist das!
Salmo tru a fario
» Auch die Fließgewässer werden wärmer, aber wir Forellen brauchen kaltes, klares Wasser. Dadurch steigen die Zonen, in denen wir leben können, um etwa 70 Höhenmeter an und wir müssen sukzessive bis zu 30 Kilometer flussaufwärts wandern. Doch jeder weiß, Flüsse sind in den Quellregionen eher schmal und bieten uns so weniger Lebensraum. Bereits jetzt gehört mehr als die Häl e der heimischen Fischarten zu den stark vom Aussterben bedrohten Arten und das wird in den Tieflandflüssen durch den Eintrag von Pestiziden nicht besser.
Bos taurus subspecies
»Man macht uns mitverantwortlich für den Klimawandel, weil wir Rinder das Treibhausgas Methan bei der Verdauung abgeben. Was aber weniger bekannt ist: Da wir auf ständig steigende Milchleistung gezüchtet werden, braucht es zwar zunehmend weniger Kühe, aber diese müssen energiereicher ernährt werden. Deswegen erhöht sich zwar die Methan-Emission je Milchkuh, die Emissionen gehen aber insgesamt zurück, weil es eben weniger von uns gibt. Was uns wirklich Sorgen macht: Der Temperaturanstieg in den Alpen ist mit circa 1,6 Grad Celsius doppelt so hoch wie im globalen Durchschnitt und hat stärkere Sommertrockenheit zur Folge. Die Verdoppelung der Hitzetage mit mehr als 30 Grad erzeugt bei uns Hitzestress und stört die Futterproduktion.
Myotis myotis
» Der Zusammenhang ist simpel: Alle heimischen Fledermäuse ernähren sich von Insekten. Daher nimmt uns der großflächige Einsatz von Insektiziden die Nahrungsgrundlage. Es gibt zwar eine Zuwanderung wärmeliebender Arten aus dem Süden, doch viele von ihnen bevorzugen nährstoffarme Lebensräume. Was uns aber durch den Temperaturanstieg auch zu schaffen macht, ist die schlechtere Schallübertragung hoher Frequenzen in wärmerer Lu . Dadurch verringert sich der Radius, in dem wir mit Ultraschalllauten unsere Beute orten können.
Alauda arvensis
» Man kennt unsere Gesänge, mit denen wir im Flug über der offenen Landscha unser Revier markieren. Aber unsere Nester liegen am Boden, o in der Nähe von Feldern. Zunehmend verschwinden diese Feldraine, während der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln zunimmt. Jetzt wird vermehrt Mais als Energiepflanze angebaut, doch in diesen Feldern können wir nicht brüten. Lasst uns doch kleine Brachflächen, wo wir unsere Nester anlegen können und hohes Getreide nicht unseren An- und Abflug behindert!
Cricetus cricetus
» Sie nennen uns zwar Ökosystemdienstleister, weil wir neben der Honigbiene ganz wesentlich für die Bestäubung von Wild- und Nutzpflanzen verantwortlich sind. Aber Anerkennung bekommen wir dafür keine. Als Königin brauche ich bei den bisherigen Temperaturen täglich 600 mg Zucker als Energie, um eine erste Brut aufzuziehen. Dazu muss ich bis zu 6000 Blüten besuchen. Alle Insekten sind wechselwarme Tiere, daher steigt bei höheren Temperaturen auch unser Stoffumsatz und damit unser Nahrungsbedarf. Aber Hitze und Trockenheit machen auch den Pflanzen zu schaffen. Unsere Bestände gehen seit einiger Zeit deutlich zurück, sodass man von einem Hummelsterben spricht. Wir verhungern mitten im Hochsommer wegen zu wenig Angebot an Nektar. Denn wir können nicht wie andere Insekten Stärke oder Fette speichern, unser Treibstoff sind ausschließlich bestimmte Zucker. Aber wo finden wir diese Nahrung in ausgeräumten Landscha en, gemähten Wiesen und sterilen Monokulturen?

Gernot Stöglehner
Böden spielen eine wichtige Rolle im Wasser- und CO 2 -Kreislauf. Innovative Lösungsansätze zeigen, wie Bodenschutz trotz wachsender Inanspruchnahme für Bauland und Infrastruktur gelingen kann.
216 Seiten, € 24,90

SCHAU DIR AN, WAS AUS WIEN NOCH WERDEN KANN
WIENMORGEN.AT