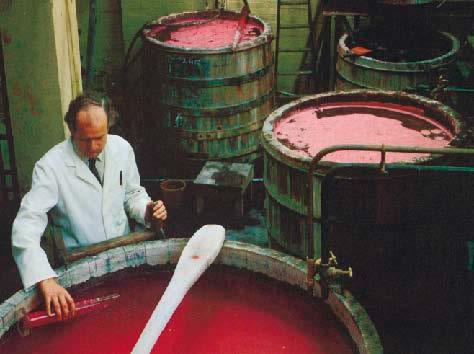kulturstiftung des bundes
Kathrin Fahlenbrach, Martin Klimke und Joachim Scharloth «Macht Happening und schmeißt Genossen raus»
Manuel Gogos Generation Super 68
Klaus Theweleit 68 total hybrid Rainer Rother Vorahnung der Wende?
Marcel Beyer Vergessen machen, Proust László Márton Vergiss nicht, was du versprochen hast!
Judith Kuckart In Sehnsucht sesshaft
Ekkehard W. Haring Kafka in Frankenstein
Irene Grüter «... hier darf ich‘s sein.»
Olaf A. Schmitt «Wer sind nun wir?»
Ulrike Gropp Auf Stelzen Ada Raev Macht und Freundschaft
Meldungen Gremien
herbst 2007 4 6 8 10 12 14 26 28 30 32 34 36 38 39
Luis Jacob wurde 1970 in Peru geboren und lebt heute in Toronto/Kanada. Der Künstler, der auch mit zwei Installationen bei der documenta XII vertreten war, nutzt Formate wie Video, Fotografie, Perfor mance und Aktionen im öffentlichen Raum. Eigens für dieses Magazin stellte Jacob eine Serie von zehn Tableaus zusammen. Sie ergeben sich aus der Anordnung von Fotografien, die zunächst völlig zusammenhangslos wirken, bei näherem Hinschauen jedoch einer bestimmten Assoziation folgen: Farben, Formen, Linien, Bewegungen, Materialien usw. Beim Betrachten der Bilder entstehen neue Assoziationsketten, die wiederum jedem einzelnen Bild eine neue Bedeutungsaura verleihen. Wie in seiner großen 159 teiligen Arbeit Album III auf der documenta zeigt sich auch in dieser Serie ein zentrales Anliegen des Künstlers: Er will uns die eigenen assoziativen Prozesse bewusst machen, mit denen wir unsere disparaten Eindrücke ordnen und mit Bedeutung versehen.

Mit der W M 2006 schwappte eine Welle der Euphorie über Deutschland. Nicht nur im Ausland bekam das Bild der Deutschen einen helleren, leichteren Farbklang. Die Fähnchen in den Nationalfarben flat terten umso fröhlicher, als sie anscheinend nicht mehr mit dem ‹Pathos der Deutschen› beschwert wa ren. 2006 wurde als Jahr der Neuerfindung der Deutschen gefeiert. Ob und wie weit das neu deutsche Lebensgefühl trägt, wird sich in den beiden nächsten Jahren, 2008 und 2009, zeigen. Dann nämlich, wenn das gegenwärtige Selbstverständnis der Deutschen anlässlich von runden ‹Jubiläen› auf seine historischen Grundlagen befragt wird. Mit deutscher Gründlichkeit, so zeichnet sich jetzt schon ab, wird es um nichts weniger als eine Inventur gehen. Die Kulturstiftung des Bundes sieht sich mit einer ganzen Reihe von Anfragen und Anträgen zu Themen rund um diese Jubiläen konfrontiert und wird auch einige größere Projekte dazu entwickeln. >>> Das Jahr 1968 markiert eine Wende im Selbstbild der Deutschen. Die Ambivalenz, die den Rückblick auf die seit 1968 vergangenen 40 Jahre kennzeich net [ vgl. die Aufsätze von Klaus Theweleit und Manuel Gogos ] , kann möglicherweise als ein Indikator für ein differenziertes Geschichtsbild interpretiert werden, das selbst ein viel zu wenig gewürdigter Ef fekt der 68 er ist: Die heutige Gedenkkultur der Deutschen verweigert sich einem Erledigungsgestus und ist Ausdruck einer Kultur der kritischen Annäherung geworden. Inwieweit ist unser heutiges Selbstverständnis durch die Geschichte geprägt worden, was haben wir davon in unser kulturelles Erbe übernommen? Solche Fragen liegen auch den Aufsätzen in der vorliegenden Ausgabe des Magazins zugrunde. >>> Der Aufsatz von Fahlenbrach/Klimke/Scharloth lenkt den Blick beispielsweise auf die europäische, wenn nicht globale Dimension der 68 er-Bewegung, eine Perspektive, die angesichts der heutigen internationalen Verflechtungen eine neue Qualität gewinnt. >>> Ähnliches gilt auch für die Ereignisse, derer im Jahr 2009 gedacht wird, die Gründungen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR 1949, der Beginn der deutschen Teilung und die Wiedervereinigung 1989, die eine ‹Wende› vor allem im gesamteuropäischen Kontext markiert. Inwiefern sich schon vor dem Fall der Berliner Mauer speziell in der Kultur seismographisch feine Erschütterungen abzeichneten, spürt der Aufsatz von Rainer Rother «Vorahnungen der Wende?» im Bereich der ostdeutschen und osteuropäischen Filmproduktion nach. Hat die Kultur (noch immer) den Stellenwert für unser kulturelles Gedächtnis, dass in ihren künstlerischen Ausdrucksformen große Ereignisse ihre Schatten vorauswerfen?
>>> In ande ren Fällen werfen künstlerische Bearbeitungen ein Licht auf gesellschaftliche Ereignisse oder erhellen unsere dunkel-unbewussten oder gesellschaftlich eingeübten Strategien im Umgang mit historisch be dingten Herausforderungen der Gegenwart. Dafür stehen in diesem Heft die literarischen Beiträge von Marcel Beyer, László Márton und Judith Kuckart, die die europäische Dimension erinnerungskultu reller Auseinandersetzungen am Beispiel deutsch-ungarischer Kulturbeziehungen kenntlich machen.
>>> Der Philosoph Ludwig Wittgenstein hat einmal den für alle Kulturschaffenden (und auch Kultur förderer!) bedenklichen, aber eben auch bedenkenswerten Satz formuliert: «In der Kunst ist es schwer, etwas zu sagen, was so gut ist wie nichts zu sagen.» Sofern Kunst dazu beiträgt, zeitgemäße Formen der Verständigung zu finden, die mehr zum Ausdruck bringen als das, was in Diskussionen und wissen schaftlichen Texten seinen Niederschlag findet, ist sie für die Auseinandersetzung mit dem kulturellen Erbe unentbehrlich. Kunst gibt eben auch ‹Vor-Ahnungen›, dem Vorbewussten, dem noch nicht Erfah renen, dem Vergessenen und dem noch nicht Gedachten, vielleicht sogar dem Unaussprechlichen, Gestalt. Im Wittgensteinschen Sinn kann im Rahmen der hier versammelten Artikel deshalb auch nur annähernd zur Sprache kommen, welche menschlichen Kräfte angesprochen und mobilisiert werden, wenn die Kultur Raum und Rahmen zur Verfügung stellt, in denen Menschen sich in ihren individuellen und gesellschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten erproben [ vgl. die Reportagen und Berichte von Ulrike Gropp zum bürgerschaftlichen Engagement in Kulturprojekten in den neuen Bundesländern, Irene Grüter und Olaf A. Schmitt zu Heimspiel Theaterprojekten in Weimar und Heidelberg]. Es muss erfahren, erlebt, getan — und, ja auch! — finanziert werden.

editorial 3 editorial
Hortensia Völckers, Alexander Farenholtz [Vorstand Kulturstiftung des Bundes]
von kathrin fahlenbraCh, Martin kliMke und joaChiM sCharloth
«M aCht happening und sChMeisst genossen raus»
Kultur und Protest
«Macht Happening und schmeißt Genossen raus. Nicht jeder hat ei nen Buchholzkopf.» So beschrieb die situationistische Provokations gruppe Kommune I den im Juni 1968 bei der Besetzung des Germanistischen Seminars der FU Berlin schwelenden Konflikt mit den Genossen des SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund) Westber lin. Betont öffentlichkeitswirksam hatten die Kommunarden laute Beat-Musik aus den Fenstern des Seminars erschallen lassen und sich über die Art und Ziele der Besetzung mokiert: «Als wir ins Germanis tische Seminar kamen, war alles schon ‹vergesellschaftlichtes Produk tionsmittel› geworden (‹Bücherklauen ist konterrevolutionär› stand auf Plakaten, mit Reißzwecken festgemacht, damit nichts beschädigt wurde).» Während Mitglieder des SDS die Beat-Musik als unpoli tisch einstuften und das Spielen der Internationale sowie politische Diskussionen forderten, vermisste die Kommune jeglichen Aktions charakter eines Happenings bei der Besetzung. Der Streit schien un lösbar, sodass sich die Kommune nach dem Abschalten des Stroms gezwungen sah, resigniert das Institut zu verlassen und zu resümieren: «Wir wollten das Institut verändern, die andern wollten es beschützen.»
Trotz dieser Berliner Episode muss die Revolte der Studenten und Ju gendlichen in den 1960 er Jahren und insbesondere das magische Jahr 1968 zuallererst als globales Phänomen gesehen werden. In ihr laufen verschiedenste politische und kulturelle Entwicklungen zusammen, deren Ursprünge man in der westlichen Welt bereits in der zweiten Hälfte der 1950 er Jahre ausmachen kann. Eine, wenn nicht sogar die wichtigste, Bedingung für die Entstehung der Achtundsechziger-Be wegung ist die immense wirtschaftliche Konjunktur der 1950 er Jahre. Ob in den USA, Großbritannien oder der Bundesrepublik, die 1950 er Jahre bescherten einen wirtschaftlichen Boom, der die Tür zur Kon sumgesellschaft aufstieß, wovon besonders die Mittelklasse profitierte. Diese Prosperität schuf ebenso gesellschaftliche Freiräume, die sich in einer verstärkten Freizeitkultur niederschlugen. Damit einher gingen die Entdeckung und der steigende Einfluss der Jugend als ökonomischer Faktor. Die Nachkriegs-Generation der ‹baby boomer› sorgte nicht nur für eine Explosion der Studentenzahlen und eine strukturelle Überforderung der Universitäten am Anfang der 1960 er Jahre. Sie ver fügte bereits ebenso über eine Kaufkraft, die sie insbesondere für die Mode- und Musikindustrie zu einer äußerst attraktiven Zielgruppe machte. Kommerzialisierung und kulturindustrielle Verwertung von Jugendkultur finden also bereits hier ihren Anfang und ziehen sich wie ein roter Faden durch das gesamte Jahrzehnt.
Dass all diese Prozesse und Diskurse international rezipiert wurden, war vor allem der Entwicklung der Kommunikationstechnologie, insbesondere dem Fernsehen und internationaler Satellitenkommuni kation zu verdanken. Im Juli 1962, ein Jahr nach Gründung des ZDF, ermöglichte der von der NASA entwickelte Satellit Telstar 1 bereits die erste internationale Satellitenübertragung von Fernsehbildern aus den USA nach Europa. Darüber hinaus vervielfachte ein Ausbau der internationalen Passagier-Luftfahrt im Laufe der 1960 er Jahre die Zahl der Flugziele und ließ zugleich die Ticketpreise sinken. Der Kalte Krieg und die verstärkten kulturdiplomatischen Anstrengun gen beider Supermächte im Kampf um die globale öffentliche Mei nung forcierten ebenso den Anstieg des transnationalen Austausches zu Beginn der 1960 er Jahre. Technologische Möglichkeiten sowie eine sich internationalisierende Medienlandschaft sorgten so bereits Anfang des Jahrzehnts für eine Verkürzung internationaler Kommu nikationsräume und eine qualitativ neue Stufe der soziokulturellen Vernetzung über die Staatsgrenzen hinweg.
Dieses System internationalen Austausches begünstigte auch früh die Entstehung transnational bedeutsamer Subkulturen und Protestbe wegungen. Das Beat-Movement oder Phänomene wie die Halbstar ken lieferten so mit ihrer Wut auf die Konsumgesellschaft und die spirituelle Verödung der Gesellschaft der 1950 er Jahre entscheidende Inspirationsquellen für die junge Generation. Auch künstlerische Avantgarden wie die Situationistische Internationale ( SI) formierten sich auf transnationaler Ebene und führten, beeinflusst vom Existen tialismus Sartres und Camus‘, sowie vom Dadaismus, Surrealismus und den Lettristen, Künstler und Künstlerinnen aus verschiedensten Ländern zusammen. Andere Bewegungen, wie die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung, entfalteten durch ihre Ikonographie, Protesttechniken und politisch-moralischen Botschaften transnationale Inspirationskraft über die Grenzen hinweg. Ob Rosa Parks, Martin Luther King oder Freedom Rides; die Demonstrationsformen der di
rekten Aktion wie Sit-ins, mediale Inszenierung und das Anprangern eines Apartheidsystems in einem Zentrum der westlichen, ‹freien Welt› spielten eine entscheidende Rolle im Politisierungsprozess westlicher Aktivisten. Die aus der Bürgerrechtsbewegung erwachsene Black-Power-Bewegung inspirierte hierbei zu wachsender Entschlossenheit und Militanz gegenüber einem scheinbar kompromissunwilligen Estab lishment. Darüber hinaus sorgte sie auch für eine verstärkte Hinwen dung zu den Befreiungsbewegungen der Dritten Welt und den Spät folgen europäischer Kolonialpolitik. Am deutlichsten wurde dieser Zusammenhang in Vietnam. Der amerikanische Krieg in Südostasien avancierte zum Symbol imperialistischer Unterdrückung der Dritten Welt durch den freien Westen. Die 1965 in den USA auf brei ter Front einsetzende Anti-Kriegsbewegung wirkte daher nicht nur international stilbildend in ihren Protestformen wie des Teach-ins. In der Traditionslinie eines seit den 1950 er Jahren fest etablierten internationalen pazifistischen Netzwerkes gegen die Atombombe erzeugte sie in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre vielmehr den kleinsten gemeinsamen Nenner aller Protestierenden weltweit: die Opposition gegen den Vietnamkrieg. Der Viet Cong, Che Guevara, aber auch Mao Zedong wurden aus dieser Perspektive heraus mit zunehmender Eskalation des Konflikts zu international verwendbaren Protestiko nen, die die Unbeugsamkeit gegen einen übermächtigen, global ope rierenden Imperialismus illustrierten.
Doch auch die Neue Linke selbst war transnationalen Ursprungs. Ent standen im Kreise der britischen New Left unter dem Einfluss des Historikers E P. Thompson war sie ein europäisches Produkt, das An fang der 1960 er Jahre seinen Weg über den amerikanischen Soziolo gen C. Wright Mills und andere in die USA fand. Durch den amerika nischen SDS (Students for a Democratic Society) und sein 1962 veröf fentlichtes, programmatisches Port Huron Statement erhielt sie ihre weitere Ausprägung und etablierte sich fortan in einem transatlan tischen Zusammenhang. Denn gemeinsam war Aktivisten auf beiden Seiten des Atlantiks die Absage an den traditionellen Marxismus und seinen Fokus auf die Arbeiterklasse, eine fundamentale Unzufrie denheit mit dem Kalten Krieg (seiner Abschreckungspolitik der nu klearen Vernichtung und der Ideologie des Anti-Kommunismus), so wie die Anklage von gesellschaftlicher und politischer Apathie, Mate rialismus und kapitalistischem Konkurrenzdenken.
Die internationalen Wechselwirkungen zwischen den Protestkulturen der westlichen Welt speisten sich also zum einen durch eine kollektive Protestidentität, die sowohl kulturelle als auch politische Bezugs punkte aufweisen konnte und durch einen globalen Mediendiskurs verstärkt wurde. Zum anderen gewannen diese Vernetzungen ihre Kraft auch dadurch, dass das Problem (Imperialismus, Bipolarität des Kalten Krieges, etc.) als ein internationales aufgefasst wurde und somit auch die Konstruktion eines gemeinsamen globalen Feind bildes zuließ, welches lokal anschlussfähig war. Ausgehend von den Universitäten und befördert durch gemeinsame intellektuelle Quel len oder Personen wie Herbert Marcuse, entwickelt sich in der zwei ten Hälfte der sechziger Jahre eine internationale Sprache des Dissens, die oftmals US -amerikanischer Provenienz war.
Lebens- und Kommunikationsstile zwischen Kommune und SDS
Was im Rückblick als transnationale lingua franca des Protests er scheint, war in Wahrheit ein höchst vielfältiges Gemisch unterschied licher Dialekte, deren Sprecher einander nicht immer verstehen konn ten. In Deutschland standen sich die lustbetonten Revolutionäre des Alltags aus der Kommunebewegung und die Agitatoren der Arbeiter klasse im SDS oft reichlich verständnislos gegenüber, wie die Vorgän ge bei der Besetzung des Germanistischen Seminars der FU zeigen. Dutschke etwa nannte die Mitglieder der Kommune I in einem Inter view im Spiegel «bedauernswerte Neurotiker». Und auf die Kommu nemitglieder wirkten die abstrakt debattierenden Marxisten merk würdig verklemmt und lustfeindlich. «Nur die rationale Diskussion verhindert allgemeine Kopulation», hieß es provozierend auf einem ihrer SDS -kritischen Flugblätter.
Die ideologischen Differenzen fanden ihren Ausdruck auch in konträren Lebens- und Kommunikationsstilen. Während die Mitglieder des SDS sich bestenfalls durch das Tragen von Freizeitkleidung in allen Lebenslagen von der Mehrheitsgesellschaft abgrenzten, griffen die Kommunarden — ähnlich den amerikanischen Hippies — tief in den Fundus von Kostümverleihen und Second-Hand-Läden. Selbst die Frankfurter Allgemeine Zeitung lobte anlässlich eines Gerichtsprozesses gegen Fritz Teufel und Rainer Langhans begeistert, dass gegen die bunte Eleganz des Kommunarden-Looks selbst Dressmen nur ein
2
4 2008 40 jahre dana C h s
1
internationale prote stkulturen uM 1968 und ihre kulturges ChiChtliChen folgen
müder Husten seien. Fritz Teufel war in einem orangefarbenen, mit Goldknöpfen besetzten Mao-Kittel, der mit lila Manschetten und Krägelchen besetzt war, vor dem Richter erschienen und Langhans hatte eine lindgrüne Jacke angelegt, die durch rosa Knöpfe, einen rot leuchtenden Ring am Finger und die hellblaue Bluejeans einen apar ten Kontrast erhielt. Dagegen wirkten die verbandlich organisierten linksradikalen Studenten in ihren Hemden und Pullovern, in ihren Jacketts und Cordhosen eher blass. Doch nicht nur in der Kleidung unterschieden sich Kommunarden und SDS ler; auch Körpersprache, Wohnformen und Kommunikationsstile vertieften die ideologischen Gräben. Während sich Kommunemitglieder betont locker und unge zwungen gaben und sich das Kommuneleben bevorzugt im Sitzen auf Matratzenlagern abzuspielen schien, drückte sich der Anspruch, intellektuelle Avantgarde zu sein, bei den Kollegen vom SDS in reduzierten Formen expressiver Selbstdarstellung aus; allenfalls gelesen wur de ostentativ.
Umso komplexer war dagegen die Sprache, die im SDS gepflegt wurde. In atemlosem Stakkato wurden Fachwörter aus Marxismus, Kritischer Theorie und Psychoanalyse aneinandergereiht. Redner produ zierten nicht enden wollende Satzungetüme, und wer nicht mit Zi taten aus den Klassikern aufwarten konnte, hatte in Diskussionen ei nen Nachteil. Der sprachliche Sound der Kommunebewegung war ein ganz anderer. Hier nannte man die Dinge beim einfachen Namen: Man ‹bumste› oder ‹vögelte› und hatte dabei ‹Orgasmusschwierig keiten›, und das Wort ‹Scheiße› entwickelte sich zum Hochwertwort. Man duzte bald nicht nur Genossen. Ich-Aussagen hatten Konjunk tur, denn nur im subjektiv Empfundenen glaubte man Authentizität zu finden. Über die eigenen Gefühle und Probleme zu sprechen, wur de zum Fetisch des Kommunemilieus. Wer nicht mitmachte, der flog raus. Zeigte der Kommunikationsstil im SDS den Anspruch, die Re volution auf wissenschaftlicher Basis zu verwirklichen, so inszenierten die Kommunarden in ihrem Sprachgebrauch eine unmittelbare Emo tionalität, durch die die zwischenmenschlichen Beziehungen revoluti oniert werden sollten. «Was uns den Eltern und Lehrern überlegen macht, ist nicht die stärkere sexuelle Potenz, sondern unsere größere Empfindungsfähigkeit». So heißt es auf dem 1 Flugblatt des antiauto ritären Menschen. Die Unterschiede in der Selbstdarstellung gingen aber noch weiter. Während sich die SDS -Mitglieder gegen den Hang der bürgerlichen Presse wehrten, ihre prominentesten Mitglieder zu Leitfiguren zu stilisieren, arbeiteten die Kommunarden gezielt an ih rem Medienimage und verfolgten und dokumentierten mit wachsen der Begeisterung alle Zeitungsberichte: bot das mediale Interesse an ihrem performativen Protest doch völlig neue Möglichkeiten der Ein flussnahme auf den kulturellen Common Sense.
Massenmedien und Protest um 1968
Dennoch gab es auch gemeinsame Wurzeln der Protestformen von Kommune I und dem SDS . Sowohl die politischen Protestaktionen des SDS im öffentlichen Raum (Go-ins, Sit-ins, Teach-ins, usw.) als auch die situationistischen Performanceaktionen der Happeningsze ne, die mehr auf die Veränderung des kulturellen Common Sense ab zielten, griffen auf spontaneistische Weise in die symbolische Ord nung des öffentlichen Raumes ein. Die Protestierenden inszenierten sich hierbei als symbolische Kollektivkörper, welche die bestehenden Codes öffentlicher Repräsentation zu verändern suchten. Durch kör perliche Mobilmachung und die visuelle Inszenierung ihrer Aktionen setzten beide Protestszenen die statischen und hierarchischen Ord nungsregeln der ‹langen fünfziger Jahre› außer Kraft, indem sie ge zielt die Möglichkeiten der ‹begrenzten Regelverletzung› nutzten. Da bei war es vor allem ein emotionsbeladener Generationenkonflikt zwi schen der Kriegs- und Nachkriegsgeneration und ihren Kindern, den die Studenten- und Jugendbewegung katalysatorisch verstärkte. Denn ihre Aktionen trafen im Kern tradierte Werte der älteren Generation, wie Sicherheit, Autorität, Statusdenken, materielle Existenzsicherung usw., und repräsentierten gleichzeitig in nuce Individualismus, Emotionalität und Expressivität als neue Werte der jungen Generation.
In bisher noch nicht da gewesener Weise produzierte eine Protestbewe gung so neue Codes der öffentlichen Repräsentation und erreichte damit eine breite massenmediale Öffentlichkeit. Denn ihre visuellen Protest-Ereignisse zogen unweigerlich die Aufmerksamkeit der Mas senmedien auf sich. Vor allem das Fernsehen und die auf Visualität gepolten Printmedien (wie Bild-Zeitung, Stern u.a.) entdeckten die neuen Protestcodes als visuelles Spektakel. Auch wenn die rechtspopulistischen Medien, allen voran die Springer-Presse, die Protestie
renden bekanntlich kriminalisierten, erkannten die Massenmedien doch sehr rasch, dass sie von den visuell-symbolischen Tabubrüchen im öffentlichen Raum profitieren konnten. Das massenmediale Inter esse an den Protestaktionen war dabei eingebunden in einen umfas senden Strukturwandel öffentlicher Kommunikation, der Ende der 1960 erJahre durch den Siegeszug des Fernsehens zum neuen Leitme dium stattfand: die Umstellung auf visuelle Codes. Angestoßen durch einen technischen, institutionellen und ästhetischen Entwicklungs schub, entdeckte das Fernsehen zu diesem Zeitpunkt eigene Formen der Visualität: Neben avantgardistischen Formen, wie sie in der Mu siksendung Beat-Club entwickelt wurden, zählten hierzu auch neue Formen des Dokumentarismus (Panorama ). Im Konkurrenzdruck zum Fernsehen erhielt Visualität als Modus öffentlicher Kommuni kation auch in den Printmedien einen immer prominenteren Stellen wert (wie dies eindrucksvoll am Stern-Magazin zu beobachten ist). In dieser massenmedialen Schwellensituation erwiesen sich die visuellsymbolischen Tabubrüche und Protestaktionen der Studenten- und Jugendbewegung daher als Katalysator in der Etablierung neuer, auf Visualität umgestellter Codes öffentlicher Repräsentation und Kom munikation, die auch zunehmend mit einer Emotionalisierung öf fentlicher Diskurse verbunden war. Damit entstand ein ambivalentes Wechselverhältnis zwischen den Massenmedien und der Protestbewegung der 1960 er Jahre. Auch wenn die Studenten- und Jugendbewe gung vornehmlich die Massenmedien als Institutionen des kapitalis tischen Systems kritisierten und ablehnten, entwickelten sich diese zu ihren wichtigsten Allianzpartnern. Auf zunächst unintendierte Weise erhielten sie ein massenmediales Forum für ihre Aktionen, welche ih nen die breite Mobilisierung von Sympathisanten ermöglichte und zudem für eine langfristige Verankerung ihrer Ziele im kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft sorgte.
1968 und die Folgen
Die erfolgreichste, weil mediengerechteste Protestinszenierung war hierbei der Lebensstil der Kommunen. Bereitwillig zahlten auch Springer-Zeitungen für Interviews und Homestories aus der Kommune I Das Verlangen nach provozierenden Bildern befriedigten die Kom munarden durch die Stilisierung ihrer Körper, durch Kleidung oder durch provozierende Nacktheit. Das Bedürfnis der Medien nach in timen Details bedienten sie mit Erzählungen von den sexuellen Frei heiten des Kommunelebens («Wer zweimal mit derselben pennt...») und mit der radikalen Aufhebung des Gegensatzes von privat und öf fentlich. Sie veröffentlichten Protokolle von Gesprächen über ihre zwischenmenschlichen Beziehungen, dokumentierten in eigenen Bü chern penibel ihren Alltag und publizierten freimütig ihre Erfah rungen bei der Sexualerziehung ihrer Kinder, deren praktische As pekte heute wohl von Gerichten als sexuelle Übergriffe bewertet wür den. Einige träumten sogar von der Gründung eines Popkonzerns. Nach dem großen Tanz von 1968 jedoch verlor sich das mediale Inter esse an den Kommunen, dennoch wuchs ihre Bedeutung stetig. Nach der Auflösung des SDS wurden Wohngemeinschaften zum organisa torischen Rückgrat der Protestszenen, ganz gleich ob in FrankfurtBockenheim oder Berlin-Kreuzberg. Im Sponti-Milieu lebten die Grundgedanken der Ur-Kommunen weiter: In ihnen wurde auf For men kein Wert gelegt, wichtig war die Authentizität, die sich in Infor malität, Spontaneität und Emotionalität äußerte. Jeder war dem an deren nah, man konnte sich leichter anfassen, in den Arm nehmen und Duzen war Pflicht. Konflikte wurden psychologisierend disku tiert und man relativierte seine Aussage als subjektiv. Die offene Zur schaustellung von Betroffenheit galt als schick und wer über seine Gefühle sprechen konnte, war ein dufter Typ. Die Inszenierung von Gefühl und Nähe wurde zum zentralen Signum des Alternativmilieus, das sich zum langen Marsch in die Mitte der Gesellschaft aufmachte. Als nach der Wahl 1983 bei der konstituierenden Sitzung des Bundes tags zum ersten Mal ein Grüner im Parlament sprach, da tat er etwas, was Parlamentarier noch nie in einer konstituierenden Sitzung des Bundestags gemacht hatten. Er eröffnete seine Rede mit den Worten: «Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde.»
Die Jahre um 1968 wirkten nicht nur in der Bundesrepublik als Kataly sator für die Aufweichung der Grenzen zwischen öffentlichem und privatem Leben. Inszenierungen von Informalität und Nähe durch ziehen heute unseren Alltag. Einigen erscheint das als eine Tyrannei der Intimität, anderen als eine humanere Gesellschaft, wieder ande ren als Amerikanisierung der Alltagskultur. Ermöglicht wurde diese Transformation durch breite Kommerzialisierung gegenkultureller Versatzstücke, einen fundamentalen Wandel in der Repräsentations ästhetik der Medien sowie die vielfältigen Inspirationen einer globa len Protestkultur, vor allem deren erfolgreichster Komponente: dem lebensstilistischen Protest in der Kommunebewegung. Dr. Kathrin Fahlenbrach ist Wissenschaftliche Assistentin am Institut für Medienund Kommunikationswissenschaften der Universität Halle. Dr. Martin Klimke ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Heidelberg Center for American Studies ( HCA) der Universität Heidelberg und zur Zeit Postdoctoral Fellow am Deutschen Histo rischen Institut, Washington, D C. Dr. Joachim Scharloth ist Wissenschaftlicher As sistent am Deutschen Seminar der Universität Zürich. Kathrin Fahlenbrach ist Auto rin von Protest-Inszenierungen. Visuelle Kommunikation und Kollektive Identitäten in Protestbewegungen (2002). Martin Klimke und Joachim Scharloth sind Herausgeber von 1968. Handbuch zur Kultur- und Mediengeschichte der Studentenbewegung (2007) und 1968 in Europe. A History of Protest and Activism 1956 77 (erscheint April 2008). Zusammen leiten die Autoren das von der Europäischen Kommission geförderte MarieCurie-Projekt European Protest Movements since 1945. (www.protest-research.eu)
4 3
� 2008 40 jahre dana C h
von M anuel gogos j
generation super 68
Im Jahr 2008 wird es eine ganze Reihe von Veranstaltungen geben, die die Ereignisse des Jahres 1968 und ihre Folgen historisch einzuordnen versuchen und auf ihre Nachwirkungen in der Gegenwart untersuchen. Die Kulturstiftung des Bundes fördert unter anderem eine kulturhistorische Ausstellung Die 68er — Kurzer Sommer, lange Wirkung in Frankfurt am Main. Die verschiedenen Aufbrüche von 1968 werden aus der Perspektive der Nachgeborenen betrachtet. Die jungen Kuratoren aus eben dieser Generation setzen sich mit Werten und Einstellungen der 68 er auseinander, mit ihren politischen Zielen und den Konflikten mit der Vätergeneration, der Alltagskultur der 68 er und ihren Idealen einer anderen Le bensführung. Manuel Gogos’ Beitrag ist ein vergnüglich zu lesendes Beispiel für die Dialektik der Aufklärung über die 68 er. ede Generation wählt sich ihre Generationsobjekte. Aber es macht staunen, wie nachhaltig die Kohorte 68 ihren Zusammenhang durch jahrgangsspezifische Erlebnisse und ekstatische Milieuwirkungen begründet hat. Und wir Nachgeborenen, zu umständlicher Deutungsarbeit aufgerufen, graben nun in einer Art Archäologie der Gegenwart im eigenen Vorgarten ihre glücklich pubertären Wünsche aus, Kroko dilstränen der Revolution, betrachtet aus der sicheren Entfernung der späten Geburt. Kritik war euer Leitmotiv, die Republik irgend wo zwischen Marx und Freud intellektuell nachzugründen: O Ton einer Generation: «Mitmachen wollten wir nie, wir waren anders und wir wussten es besser. Wir nahmen unsere Träume für die Wirk lichkeit.» Sprüche traumatisierter Trümmer- und halbstarker Täter kinder, die auf dem Zivilisationsbruch den Kalten Krieg ausbalan cierten. Mit den befremdeten Augen des Ethnologen und dem ver zeihenden Blick des Therapeuten lächeln wir euch über den Graben der Generationen hinweg zu. Durch die Fronten zwischen Staats macht und Außerparlamentarischer Opposition geschleust, betreten wir die Vergangenheit wie einen Film. Eingetaucht ins gelbliche Licht von Super 8 schwimmen Menschenmassen gegen den Strom. Und da wird sie, leicht verwackelt, sichtbar, die Bewegung. («Nieder mit Par menides, es lebe Heraklit», stand an der Sorbonne zu lesen )
Es ist nicht leicht, es zu besichtigen, dieses schizoide Jahr, in dem Vorle sungen gesprengt und Puddingattentate verübt wurden, in dem Kauf häuser des Westens den Flammen übergeben und mit dem Gedanken gespielt wurde, darin gleichfalls deutsche Schäferhunde von ihrem Nationalismus zu heilen. Es ist einfach zuviel passiert. Good Old En zensberger berichtet von den psychedelischen Doppelbelichtungen: «Ein Gewimmel von Reminiszenzen, Allegorien, Selbsttäuschungen, Verallgemeinerungen und Projektionen hat sich an die Stelle dessen gesetzt, was in diesem atemlosen Jahr passiert ist. Die Erfahrungen liegen begraben unter dem Misthaufen der Medien, des ‹Archivmate rials› […] einer Wirklichkeit, die unter der Hand unvorstellbar gewor den ist. Mein Gedächtnis, dieser chaotische, delirierende Regisseur, liefert einen absurden Film ab, dessen Sequenzen nicht zueinander passen. Vieles ist mit wackelnder Handkamera aufgenommen. Die meisten Akteure erkenne ich nicht wieder. Je länger ich mir das Material ansehe, desto weniger begreife ich. […] Es war nicht möglich, das alles gleichzeitig zu verstehen.» (Erinnerungen an einen Tumult, in: Jirˇi Kolàrˇ, Tagebuch 1968)
Die Rekonstruktion des Jahres 1968 wird deshalb eine surreale, eine ku bistische Form annehmen: ein Auge zu groß, ein Ohr an falscher Stel le angeklebt. Die Echos von damals mal emphatisch, mal ironisch: «Adenauer ins Altersheim»; «De Gaulle ins Museum». Jetzt seid ihr eben selber dran. Vom Ereignis zum Gegenstand der Geschichtswis senschaft kommt die Musealisierung des Alltagslebens über euch, die ihr erst gesellschaftsfähig gemacht habt; eure Kulturrevolution aus gestellt als rotstichiges Stilleben, (gescheiterte) Utopien als begehbares Ensemble. (Aber schließlich hattet ihr roten (Avant-)Gardisten selbst schon damit begonnen, aus euren Idolen Pop-Ikonen zu ma chen, hattet in Abendveranstaltungen Aus euren Prozessakten gelesen oder Materialien zur Kommuneforschung herausgegeben.)
Ihr Frauen habt uns aus der Hocke hineingeboren in die Pflicht zum Ungehorsam: Spiel (nicht) mit den Schmuddelkindern, sing (nicht) ihre Lieder. Und uns die Leviten gelesen: Ihr Jungen seid so wenig wild, so zahnlos zahm. Und Hair habt ihr auch kaum mehr. Ihr Män ner habt uns gelehrt. Lauter kleine bunte Nazijäger, imprägniert mit bösen Ahnungen, durchbohren seither jeden über siebzig mit argwöhnischem Blick.
Das sind Splitter unseres gemeinsamen Familienromans, die uns im Herzen stecken, eines kulturellen Erbes, mit dem wir die von euch in Scherben geschmissene Welt behutsam wieder zusammensetzen. Da tauchen Bilder des deutschen Nachwuchsrevolutionärs Rocky Dutschke auf, den hatte keiner gewählt, der war erwählt. Eineinhalb Stun den lang predigt er auf Zehenspitzen die Revolution, der apostelhaft schöne Apo-Sprecher, und verbreitet Pfingststimmung: «Genossen! Wir haben nicht mehr viel Zeit. In Vietnam werden auch wir tagtäg lich zerschlagen, und das ist nicht ein Bild und keine Phrase!»
Dann dämmern und lügen die Bilder der Kommune I, Ikonen einer Si tuationistischen Internationale, Abteilung Deutschland: Langhans, der Anti-Struwwelpeter, und seine knospende Uschi Obermeier mit ihrem Konzept vom Modeln für die Revolution sind mit dem Teufel im Bunde. Mit den Bilderserien ihrer avantgardistischen Freak-Show wollen sie Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit erregen. (Doch wer hat je einem Kommune-Bewohner ins Herz geschaut?) Nackte Leiber, von künstlerisch begabten Stern-Reportern im Setzkastenformat in einander gesteckt. Die Hofnarren der Nation verhandeln ihren Preis, um das Alltagsleben als kolonisierten Sektor zu entlarven: Revolutio näre Spieler aller Länder, vereinigt euch! Während sich die internationalen Spaßguerilleros so links und lustig an Marx zurückbinden, flattert ihnen Fanpost ins Haus: «Lässt man sich lange Haare wach sen, ist man da gleich ein Gammler?» «Darf ich einmal bei euch über nachten? Ich bin 14 und meine Mutter ist dagegen.» Und aufrechte Sozialisten aus der Provinz schreiben ihnen ins Poesiealbum: «Ihr Pri madonnen in Berlin seid doch alle nur Spießer.»
Dann verfing sich der Schuss. Die Revolution begann ihre Kinder zu fressen. Angesichts des ganzen Ohnesorg-Theaters stellte sich die Frage nach der Gewalt. Und bald wurde aus allen Rohren scharf geschos sen, mit Buchstaben, Bildern und Kugeln. Nach dem Anschlag auf seine Person schrieb Dutschke einen Brief an seinen Attentäter Josef Bachmann: «Du warst nur ein Rädchen im Getriebe.» Bachmann antwortete: «War nicht persönlich gemeint.» Blut trat aus, das Private war öffentlich geworden. Aber noch tanzte Andreas Baader mit Fritz Teufel auf der Straße. Der Rest: terroristische Aktionen mit den Waf fen des Weiberrates (Stichwort: Busenattentat.) Der arme Adorno, genannt ‹Teddy›, der nicht mit den Mädchen spielen durfte. Gerade noch von Kofferträgern umringt, mit aufklärerischen Lichtmetaphern die Nachkriegsgesellschaft erhellend, erlag er den Verletzungen durch seine eigene negative Dialektik.
Im Grunde macht das beim Blick zurück am meisten Staunen. Die phan tasmagorischen Erregungszustände dieser Achsenzeit, ihre Sprach formen und -formeln, ihre Rhetorik der Naherwartung, Hier spricht die Revolution: «Was wir heute weltweit sehen, das sind keine Demons trationen, das sind keine Streiks mehr, das ist eine Bewegung. Es wird in absehbarer Zeit zu einer dramatischen Krise des Kapitalismus kom men. Aber die Bourgeoisie wird ihre Macht niemals kampflos aufge ben, ohne den Druck der revolutionären Massen. Folglich liegt das Problem einer sozialistischen Strategie von nun an in der gezielten Er richtung der objektiven und subjektiven Bedingungen der Revolution. Was wir jetzt als Nächstes erwarten, ist der Sturz der Regierung.»
So sieht man sie beim Gang aufs Holodeck in Aktion — in Berlin, im Prager Frühling und Pariser Mai. Und lässt sie auf sich wirken, diese unwahrscheinlichen, diese unmöglichen Orte mit tausend verschie denen Anschlägen, Wandzeitungen, Klo- und Mauersprüchen. Pro klamationen, die das falsche Bewusstsein vertreiben sollen, Manifes te, Sprüche und Parolen, überfallartige, aufrüttelnde Appelle an Pas santen im Gewohnheitstrott. In ihrer ganzen breitgefächerten Materialität aus Flugblättern und Stein, Typen und Handschrift, Sieb druckfarbe und Blut. Des Nachts hergestellt, wie verrückt hinge schrieben, hingedruckt, hingeklebt: «Die Angst vor der roten Farbe überlassen wir den Rindviechern.» «Die Gesellschaft ist eine Fleisch fressende Pflanze.» «Nur die Wahrheit ist revolutionär.» «Vergewaltigt eure Alma Mater.» «Sartre ist ein Opportunist.» «Daniel CohnBendit ist nicht Brigitte Bardot.»
Auf den Säulen, die diese Weltanschauungsbörse in allen Himmelsrich tungen flankieren, prangen die Säulenheiligen Mao, Che, Ho. Trikon tinentale Trinität, die den Dschungelkampf der Dialektik überstrahlt: Antikapitalistisches, Antiimperialistisches, Antikolonialistisches, Anti diktatorisches, Antiautoritäres. Martin Luther King zitiert Mahatma Gandhi, der Thoreau zitiert. Degenhardt zitiert Mikis Theodorakis, der Pablo Neruda zitiert. Sartre zitiert Fanon, der Sartre zitiert: KubaSolidarität, Griechenland-Solidarität, Spanien-Solidarität, Chile-So lidarität, verbale Care-Pakete und Schnabeltassen für pensionierte Diktatoren. Der neuralgische Punkt des international synchronisierten (Auf-)Begehrens liegt in der Höhle des Löwen, den USA , dem Pentagon. Hier sitzen die Regisseure vom Schaukastenkampf Vietnam selbst im Glashaus, The Whole World is Watching.
6 2008 40 jahre dana C h
«Vietnam ist das KZ der Amerikaner», weiss Peter. Damit werden wir uns nie aussöhnen. Mit dieser Selbstsicherheit, dass sie die Gerechten waren. Ihre Kunstfertigkeit, anderen eine lange Nase zu ziehen. «Ihr seid alle nur Banditen» (KD Wolff vor dem amerikanischen Untersu chungsausschuss), «wir haben uns glänzend amüsiert» (Daniel CohnBendit vor dem französischen Untersuchungsausschuss), und dann chorisch: «Wir sind alle deutsche Juden.» Dieser großspurige, groß sprecherische Stil damals (griechisch: «megaphon»), diese Übersteu erung, wie bei dem großen Vorsitzenden Mao: «Alle Imperialisten sind Papiertiger.» Die neue Linke läuft ihm auf der Suche nach dem revolutionären Subjekt direkt in die Arme. Die Arbeiter waren es, die «Gastarbeiter» sind es, die dritte Welt ist es. Und der sanfte Revolutio när Che Guevara ihr Messias: «Es ist die Pflicht des Revolutionärs, die Revolution zu machen.» In der «Botschaft an die Völker der Welt» ruft er die USA zum Erzfeind des Menschengeschlechts aus, lange vor der Zeit: «Tragt den Krieg in die Metropolen. Schafft zwei, drei, viele Vietnam.» (Auch die RAF fand die palästinensischen Kumpels ein fach nur ‹dufte›.) Alle Händler aus dem Vorhof einer Welt vertreiben wollte er, die einmal dem ‹Volk› gehören sollte. Bis heute hängt der Pantokrator der Subkultur im Tabakladen von Algier, zwischen den Ketten gegen den bösen Blick, und raucht seine kubanische Zigarre. Ihr habt das vorausgesehen. Das gemorphte, das geklonte Photo Al berto Kordas in der libanesischen Autobahnunterführung, in der Wohnung der chinesischen Prostituierten: Che als Weltkulturerbe, als Sta chel im Fleische der Globalisierung.
Hätten die Befreiungstheologen in euren K Gruppen nur nicht alles so ernst genommen: Mit stalinistischer Selbstkritik zu belegen, wer in euren Kommunen sein falsches Bewusstsein verriet. Marxistischleninistisch agitieren gehen in den Fabriken, eigene Lebenszeit zu opfern für diese Arbeitersache. Diene dem Volk und gehorche dem Kommando in allem, was du tust. Ein Zeitzeuge, der immer dabei, immer mittendrin war, erzählt, dass er nach den Aufregungen dieses Jahres erst einmal nach Italien gefahren ist, aufs Land, um sich diese ganzen Sensationen endlich wieder aus dem Kopf zu schlagen, dass er sie nachts gehört hat, die charismatischen Reden der Stimmführer, und dass es Jahre gedauert hat, seine Nerven zu beruhigen und sie zum Schweigen zu bringen. Darum stehen uns die Hippies näher: «Wer seine Feinde besiegt, ist ein Held. Aber nur wer sich selbst be zwingt, ist der Meister.» Das steht in der Bhagavad Gita, die sie da mals aus Indien eingeschleppt haben: Die Beatles (habt ihr sie in Rishikesh gesehen?) haben es besungen: You say you want a revolution / Well you know / We all want to change the world. / You better free your mind instead / But if you go carrying pictures of Chairmen Mao / You ain’t going to make it with anyone anyhow.
Darum, ihr lieben 68 er, danke für alles. Die Umkehrung aller Hierarchien, das Ende aller Autorität, die grenzenlose Ausdehnung des Vergnügens. Für einen kurzen Augenblick war euch alles möglich er schienen, ihr hattet die Phantasie an die Macht geputscht. Unser Schicksal ist es, zwischen Anverwandlung und Verwerfung das Vater morden zu beenden. Die erwachsene Gestalt unserer Folgegenerati on sucht eure groben Konturen ins rechte Licht zu setzen und kultu rell abzurunden. Eins müsst ihr doch zugeben: Die ‹Nacht der Barri kaden› im Pariser Mai, das war nichts weiter als ein Zitat. Aber dass «unter dem Pflaster der Strand liegt», das glauben wir noch immer. So können wir uns nun, da wir gemeinsam alt werden, beim vierzigsten 68 er-Revival zuprosten. Molotow Cocktail in der Happy Hour, der Geschmack der Revolution rinnt uns die Kehle hinunter und wir prosten uns zu: All the good die young.
Gogos, geboren 1970, ist promovierter Literaturwissenschaftler, Philosoph und Religionswissenschaftler, Literaturkritiker und freier Autor u.a. für DLF, NZZ, 3 Sat. Er ist Mit-Kurator des Ausstellungsprojekts des Historischen Museums Frank furt/M. Die 68er — Kurzer Sommer, lange Wirkung.
Die 68 er — Kurzer Sommer, lange Wirkung. Ausstel lung im Historischen Museum Frankfurt am Main, 1.5 31.8.2008 Künstlerische Leitung: Jan Gerchow. Kuratiert von Andreas Schwab (CH), Beate Schap pach (CH) unter Mitwirkung von Manuel Gogos.
Neben Informationen über die gesellschaftliche Situation im Som mer 1968 besteht das Ziel der Ausstellung darin, die Lebenswelten der 68 er anschaulich zu vermitteln. Mit detailliert nachgebauten In stallationen — wie z B. einer Kommune, eines Versammlungsraumes (‹Revolutionärer Club›) oder einer Straßenszene (nach fotografischen Vorlagen) soll vor allem einem jungen Publikum ein Bild der 68er vermittelt werden, das die historischen Spannungen zwischen programmatischen Ideen und dem Lebensalltag einfängt, aber auch die historischen und mentalen Veränderungen seitdem aufzeigt. Die gesellschaftliche Entwicklung in den vergangenen 40 Jahren bezeugt einerseits die ‹lange Wirkung› der 68 er-Bewegung. Andererseits er möglicht der historische Abstand aber auch eine kritischere Beurtei lung von 68 und seinen Folgen. Die als multimediales Erinnerungspanorama konzipierte Ausstellung bezieht Originaldokumente (Flugblätter, Transparente, Wandzeitungen etc.), Fotografien, Alltagsob jekte, Ton- und Videoaufnahmen, Musikbeispiele u a ein.
Manuel
7 2008 40 jahre dana C h
von klaus theweleit
68 total hybrid
chtundsechzig ist Phantom, Gegenstand und Produkt von Legenden. 40 Jahre danach ist das normal. Normal, weil Geschichte immer in ver wandelter Form in den Gegenwärtigen vorliegt (wenn sie überhaupt vorliegt); unnormal, wenn ein spezieller Grad von Entstellung am Werk ist wie gegen 68: die deutschen Speicher für Historisches sperren sich gegen jede Aufbewahrung halbwegs ‹revolutionärer› Vorgänge im ei genen Land; sie bevorzugen Geschichtslöschung als Bewältigungsver fahren; oder, milder, einen sarkastisch-ironischen Umgang, der diese Vorgänge auf Distanz hält bei der Umschiffung des belastenden Le bens der untoten Älteren. (Frage: Welcher deutsche Speicherkopf weiß etwas vom bewaffneten Aufstand der Ruhrarbeiter im März 1920?)
Legenden. Eine gängige Legende besagt, die 68 er hätten Schluss ge macht mit der politischen Tristesse der grauen Adenauerjahre. Daran ist etwas wahr, aber im Kern ist sie falsch, wie alle Legenden. Die in den letzten Jahren von WK II Geborenen — das Gros des 68 er Perso nals war Mitte der 50 er um vierzehn Jahre alt und damit Akteur eines kulturellen Umbruchs. An Schulen verboten waren Jeans, Jungs mit langen Haaren, Mädchen in Hosen überhaupt. Im Lauf von 1956 wurden flächendeckend durchgesetzt: langhaarige Jungs, Jeans, Jeans für Mädchen, Rock ‘n‘ Roll auf Schulbällen, öffentliches Küssen von Teenagern, Rauchen; lauter Dinge, die 1955 noch verboten bzw. nicht existent waren. Für uns, die Jugendlichen, waren diese Jahre nicht trist, sondern höchst aufregend.
Das ließ nicht nach. Anfang der 60 er ist unsere die erste Generation (mit anderen 20jährigen anderer Länder), die Sexualität mit der Pille leben kann. Nicht immer gleich ein Kind (=Todesstrafe). Das Radio steuert jene Negermusik bei, die 15 Jahre zuvor bei Todesstrafe verboten war, Be Bop. Oh Lord, don‘t let them drop that Atomic Bomb on me. Don‘t let them drop it! Stop it! Be bop it! Charlie Mingus. 68 ist nicht zu be greifen ohne diese Vorläufe. Der ersten Nachkriegsgeneration ge schahen lauter Dinge, die es vorher nicht gab und nicht geben sollte. Entsprechend fragte man die Alten, was sie getan hatten im Hitler reich, und als sie antworteten: «Nichts. Nichts Schlimmes», sagten die 15 jährigen: «Ihr habt sie ja nicht alle» und hörten auf, mit den Al ten zu sprechen, was auch noch nie dagewesen war. Die Akteure von 68 sind generationell geübte Gewohnheits Übertreter. Das unterschei det ihre Haltungen vom üblichen generation gap. Ich als heute Junger würde sie irgendwie beneiden (und das abwehren müssen).
ii .
68 ist eine widersprüchliche Angelegenheit. Diese Wahrnehmung fehlt fast allen Legenden und insbesondere den Ironisierungen. Grundle gend dieser Widerspruch: Make Love Not War steht gleichberechtigt neben Waffen für den Vietcong, das nahm sich nichts, verstand sich von selbst. Gleichzeitig pro- und anti-amerikanisch zu sein, auch. Die Reihe von Widersprüchen in derselben Person und derselben Organi sation ergibt sich aus der Verfasstheit moderner Menschen, aus dem Grad ihrer realen psychischen Gespaltenheit. Das galt 68, wie es heu te gilt, bloß sind alle Parteien, Institutionen, Vereine oder sonstige Tonangeber der Gesellschaft zu feige oder zu blöd, Menschen derart anzusprechen. Sie tun, als ginge es widerspruchsfrei, lieben Wörter wie «logisch» und «konsequent» und halten das ‹für Argumentieren›. 68 war weder logisch noch konsequent, scherte sich nicht um herr schende Denksysteme, versuchte mit einer selbstgebastelten Version des in der BRD verpönten Marxismus «sich vom Stigma der Gas kammern zu befreien» (wie Norbert Elias anmerkte) und stellte, nach den Zwängen des Spontaneismus, allerlei Unsinn an. Die Lektionen des Widersprüchlichen sind bis heute nicht gelernt worden von ‹der Gesellschaft›; also macht sie Witze.
iii .
Die erste Generalabrechnung mit 68, die mich traf, hatte etwas erfasst von den grundlegenden Ambivalenzen des 68er Auf- und Ausbruchs. Sie stand in einem der vielen Szene-Magazine der 70 er und 80 er, die es auf drei, vier Nummern brachten, um dann wieder ins UndergroundNirvana zu sinken. Geschrieben von einer der nachgeborenen Stim men, die uns als eine Art Vätergeneration behandelten, wenn der Al tersunterschied auch nur 15 Jahre betrug. Der Autor beschwerte sich über die Unersättlichkeit von 68, die Unmäßigkeit unseres Wirklich keitszugriffs: Wir hätten den Nachkommenden nichts zum Leben übrig gelassen, keine Entfaltungs- und Erfahrungsfelder. Alles hätten wir irgendwie besetzt (um nicht zu sagen: besatzt). Vom Aufstand ge gen die Elterngeneration, gegen den Staat, Anrennen gegen deren Schweigen über die Nazi-Zeit bis hin zur sexuellen Revolution hätten wir jedes öffentliche wie private Feld experimentell abgegrast, Dro gen, Musik, die Kommune; die Revolution der Universitäten und der Wohnformen, von freier Liebe bis Kinderladen, die Läden der Selbst erfahrung, die Beatles und Indien, das Guruwesen; alle sexuellen und sonstigen Perversionen im Underground Comic, in der Warhol Fac tory das Transvestitische; die Psychoanalyse geplündert, Marx und die Theoretiker des Anarchismus, den antikolonialen Kampf der un terdrückten Völker reklamiert für uns selbst, Tupamaros gespielt und Black Panthers, angemaßte Experten in Internationalismus mit Ein mischungsrecht in jeden Konflikt irgendwo auf der Erde, Feminismus und Ökologismus mitgestartet: Nichts, NICHTS hätte 68 unberührt gelassen, am Kino schmarotzt, die Literatur und Philosophie für beendet, die politische Praxis als Übertretungspraxis zur alleinigen Kunst erklärt, die anderen Künste ersetzend. Als Krone der Verheerungen den Terrorismus etabliert, Karikatur des bewaffneten Kampfes. Alles
iv. v. vi .
abgegrast und leer gefressen und dabei alles — so der Zentralvorwurf — irgendwie verpfuscht, angefangen und nicht zu Ende geführt, die Liste der schönen Dinge kontaminiert, unberührbar gemacht für die Folgenden, den ganzen Brei verdorben und schließlich die politischen Organisationsformen ruiniert in den autoritären K Kader-Gruppen, unter der Führung von Alt-68 ern. Stoff für sarkastische Talente also en masse.
Nicht weniger also als der Vorwurf der verbrannten Erde; ein Tief schlag, was er auch sein wollte. Aber nicht distanziert, sondern schwer getroffen. Sehr dicht dran. Natürlich ungerecht den heroischen Mü hen der Revoltierenden gegenüber; dem Karriereverzicht vieler 68er, den selbstlosen Mühen zur endlichen Zivilisierung der deutschen Nachkriegs-Gesellschaft, wie die Wühlarbeit von 68 später hier und da ge würdigt wurde; aber beschönigend gewürdigt. Ich glaube tatsächlich nicht, dass 68 historisch zu ‹verarbeiten› ist ohne die Realisierung des Anteils eigener Barbarismen in unseren Aktionen und Aktivitäten. Nicht die klassischen Barbarismen aus kultureller Rückständigkeit, sondern barbarisches Verhalten aus den Zwängen von Selbstüberfor derung und Selbstüberschätzung. Die meisten der von 68 anvisierten Aufgaben waren schlicht zu groß für eine Lösung durch uns selber: umfassende permanente Weltrevolution, etwas wahnsinnig. Wenn man sich an Probleme wagt, die ‹zu groß› sind für die eigenen Möglich keiten, für das eigene Wissen und Können, fängt man an zu pfuschen. Und, um den Pfusch zu vertuschen, zu betrügen. In den Zustand des Selbstbetrugs waren die Reste von 68 gegen Ende der 70 er tatsächlich geraten, in den Zustand des undefinierten Sympathisantentums mit dem Killer-Club der wirklichen Ober-Pfuscher, den ganz und gar un wirklichen RAF -Helden. Das ist aber überhaupt nicht lustig.
Der Autor jenes Abrechnungsartikels war über all das im Bilde. Er hatte etwas wahrgenommen — um es mit dem Hauptwort meiner eigenen Theoriebildung zu sagen. Verlässlich ist nur die überprüfte und mit anderen nahen Menschen geteilte Wahrnehmung von etwas Wirklichem, nicht irgendein eingebildetes selbstbehauptetes Postulat oder Diktum, von wem auch immer. Es hat zu stimmen, was man sagt. Was man denkt, tut, schreibt. Genau dies war der Rest-68 abhanden ge kommen in ihrem General-Verfall, an die RAF 1977
Im Übrigen rief der Anklagegestus im Underground-Magazin etwas wach in mir. Ähnliche Gefühle hatten mich beschlichen Anfang der 60 er beim Eintauchen in die Bücher Henry Millers und der amerika nischen Beat-Poeten. Die hatten auch schon alles gemacht, was einem vorschwebte als Bohème-Student mit zwanzig, alles entdeckt, auspro biert, die Kultur durchreflektiert, verworfen, anders gelebt, anders ge liebt, die Welt anders aufgenommen und es aufgeschrieben in einem Bandwurm länger als The Road, von der sie zehrten und schwärmten: die sexuelle Befreiung, das Aufgehen im Jazz, die Auflösung der auto ritären ödipalen Schreibweisen, vorgemacht von Joyce und den zahl losen unglaublichen Lyrikern der Moderne — alles doch schon bea ckert und vorhanden; welches Feld konnte man noch betreten, aus welchem vernünftigen Grund etwa zur Feder greifen? Der Grund ergab sich 1967: in und auf Flugblättern. Diesen Ohnesorg-Raum hatten sie frei gelassen: den Direktangriff auf den Staat, den Anspruch auf die politische Macht; hier waren sie zu übertreffen, hier war was zu holen. Und mächtig holte 68 aus in eben diesem Punkt — mit einem Schwanz von Texten, länger als die Straßen, die ab 1967 demonstrativ betreten wurden und nicht wieder hergegeben für die nächsten drei, vier Jahre. (Dass es diesen Schwanz von Texten auch schon gegeben hatte in der internationalen Arbeiterbewegung der 20er und 30er Jah re war uns nur rudimentär bekannt. Wir ließen uns nicht ausbremsen von rosaluxemburgischen und Komintern-Vergangenheiten.) Der 68erGestus des allumfassenden Neubeginns hatte somit etwas Lächer liches in den Augen der vernünftigen Älteren, die es ja auch gab. Sie hielten Distanz, begründet.
Dass das Gros der 68 -Texte historisch nicht haltbar war, ergibt sich aus solchen Mängeln. Anders als die europäische Frühmoderne mit ihrer reichen Buchernte hat der Moment 68 kein überlebendes Theorie-Buch hervorgebracht, und als Folgebücher in den 70 ern gerade zwei: Alice Schwarzers Kleinen Unterschied und die Männerphantasien. Nicht zufällig beides Bücher im Gender-Feld; das war etwas neues.
Dieser Befund ist aber nicht ein allein negativer, er umschreibt ein fast immer übersehenes Zentralmoment von 68: die nicht nur in Kauf ge nommene, sondern gewollte und akzeptierte Flüchtigkeit der Aktionen und Produktionen. 68 wollte nicht für die Geschichte produzie ren, sondern für den aufgeladenen Moment. Fidel Castros ‹Anrufung der Geschichte› vor einem Gericht in Havanna hatte einen durchaus lachhaften Zug: ‹ein großer Führer spricht›. So sprechen wir nicht (Dutschke eingeschlossen — dachte ich wenigstens).
Dass zum Ende des Jahrtausends ein alter eingefleischter Literatur-Ber serker wie Peter Rühmkorf mit Tagebüchern aus der Kulisse treten würde, war vielleicht abzusehen. Tagebuch abgekürzt als TABU. Der Titel beschwor den Bruch, setzte aber eine Tradition fort: Goethe & Eckermann in 1 Person. Das TABU-Papier schreibt fest: die Figur des Autors in Überlebensgröße. Für mich war diese Sorte des Selbst entwurfs des Autor bzw. des großen Individuums vor der Folie der Ewigkeit untergegangen, obsolet geworden in den Umbruchsformen von 68. Erledigt und zu Ende geschrieben von all den TABU-Schrei
8 2008 40 jahre dana C h
a i.
bern der Henry-Miller-Generation, ein für alle Mal. Und dann tritt Gretchen Dutschke aus der Kulisse mit einem TABU-Bündel in der Hand: Ihr Mann! Der Kerl schrieb Tagebücher. Was für ein Verrat! (Stoff für sarkastische Kommentare meinerseits).
Worüber man lachen kann oder auch nicht: das Entscheidende an 68 waren nicht Politreflexionen, entscheidend war in jedem Moment der Versuch des Ausbruchs ins Unbekannte: anders leben, anders lieben, anders hören, anders sehen, anders wissen, anders reden. Nur wusste niemand wie man das macht. Revoltierend, umwälzend, ja: Aber fast in jeder Hinsicht ahnungslos, wie das geht, dieses anders. Anders lie ben? Woher denn? Ein paar schüchterne Versuche auf Platten, in Ki nos. Godards Masculin-Feminin 1966, Eustaches La Maman et la pu tain, 1973; die Beatles, All You Need Is…aber da war es auch schon zu Ende mit ihnen. Ein paar Sprüche: «Im Bett zart, gegen Bullen hart». Tolles Programm. Wahrscheinlicher war in beiden Fällen die Härte. Wer sagte oder zeigte einem, wie dieses anders lief? Ein paar Gleichalt rige. Zum Glück gab es andere, die zur selben Zeit mit derselben Inten sität dasselbe wollten. Angeleitet von Buchautoritäten, den Wilhelm Reichs, Laings, Marcuses, Coopers, deren ‹Lehren› erprobt oder auch nur nachgeahmt wurden. Wer etwas ausprobiert, also — etwas erfah ren, oder nur etwas nachgeahmt hatte, war nicht gleich zu sehen. 68 ist ein Konglomerat neu auftauchender Alltagsprobleme. Bei der Frage nach der Aufteilung des je vorhandenen Geldes starb manche WG schon in der Planung. Oder: Wie offen ist eine Wohnung? Offen für jeden (angeblichen) Lehrling on the road (Spitzel?), Freund, oder gewöhnlicher Dieb, der sich davonstahl im Morgengrauen? Prak tische Fragen. Wie macht man das andere Leben; andere Freunde, andere Lieben, andere Kinder? Man macht Regeln, Wohnregeln, Codes, die so schnell übertreten wie aufgestellt sind. Abstimmungsbeschlüs se ohne wirkliche Sanktionsgewalt. «Es gibt überhaupt keinen Kom munismus. Wir müssen mit der Anarchie auskommen» (Wandspruch). Erfahrung selbst war ein verbotenes Wort, unter Quarantäne gestellt nicht nur in R D. Brinkmanns wütenden Ausbrüchen gegen dies Zen tral-Schutz-Wort der Alten: Lebenserfahrung. Mit dem sie ihre Lügengebirge zukleisterten, ihre dreiste Aufforderung, sie doch einfach nur nachzuahmen (unter gütigem Absehen von Auschwitz, von dem sie nichts gewusst.) Lauter ehrliche Verführte. Ihre Erfahrung! Wie man Hitler geliebt hatte also und von Allem nichts mitbekam. Scheiße im Quadrat. Anders leben? War erst zu erfinden, zu zweit und in Grup pen. Ein verletzlicher Zustand; man kann ihn mit Empathie betrach ten — oder als Groteske. Als Groteske besonders dies: Die Autoritäten verließen die Bücher und nahmen Gestalt an in konkreten tonange benden Genossen an den Küchentischen. Drei, vier Vietnams draußen und ein, zwei Obergurus drinnen pro WG Zum Lachen.
Die 1001 Nacht nicht endender Diskussionen, alkoholisiert, verqualmt, bekifft, bevor man sich erschöpft in die Arme sank, sind weniger gro tesk; sind die schönste und vielleicht verdrängteste Seite von 68. Zum Tod von Ingmar Bergmann vor ein paar Monaten findet sich auf der ersten Seite der taz eine Würdigung, die Bergmanns Film Szenen einer Ehe von 1973 als «den Beginn» aller Beziehungsdiskussionen feiert. Falscher kann man nicht schreiben. 1972 beschlossen die K-Gruppen gerade, Beziehungsdiskussionen, Relikte der Studentenrevolte, abzu schaffen und zu ersetzen durch ordentliche disziplinierte Betriebsarbeit. 68 ist Leben in Widersprüchen auf der Flamme von Dauerdiskussionen. Latent oder manifest autoritäre Figuren predigen den anti-autori tären Menschen. Dagegen schmeißen anti-autoritäre Frauen Toma ten. Frauen, die kurz darauf, zu Feministinnen emanzipiert, in den eigenen Gruppen nicht weniger autoritär fuhrwerken als die MannGenossen, gegen die sie tomatös geworden waren. Anders als satirisch kann man damit kaum umgehen, das haben Comic-Zeichner wie Seyfried bündig vorgeführt.
Oder: Jede/r ist frei zu tun, was er/sie will. Morgen früh müssen Flugblät ter verteilt werden. Es gibt Freiwillige; die aber am Morgen nicht ver teilfähig sind. Verteilen tun die, die es immer tun. Auf wen ist überhaupt Verlass? Beim Ausprobieren des neuen Lebens, Liebens, Hörens, Se hens? Ein Problem von 68? Dass ich nicht lache. Aber 68 zum ersten Mal offen gestellt. Was ist das überhaupt, ein Genosse? Einer, der für dich durchs Feuer geht (heute) und dich aufhängen will (morgen), weil er die Gruppe gewechselt hat, den Verein, die Partei. Kam vor. Musste verar beitet werden. Hat eine komische Seite, durchaus. Oder eine traurige. Der heute noch beeindruckendste Tatbestand liegt im Mut: Alles ge schah ohne Scheu vorm Risiko. Einsatz: das eigene — geteilte — Le ben. Leben, als gäbe es tatsächlich keins jenseits der dreißig. Will man was kapieren von ihrem Moment, ist es unerlässlich, 68 von seinem Ende her zu beschreiben, vom ersten Ende, seinem ersten Zu sammenbruch um 1970 herum. Drei Jahre auf Hochtouren, ein per manentes Rotieren, Ausbruch als Lebensform. Die durchschnittliche Dauer, für die die Einzelnen einer Gruppe das aushielten, durch hielten, habe ich Ende der 80er auf 2 bis 3 Jahre taxiert. Dann war die Frustrationstoleranz am Ende; Einzel- wie Gruppenkörper fragmen tierten und zerstoben in Auflösungskriegen mit der Folge umkämpfter Übernahme von Mietverträgen, Übernahme gebrochener Lieben, persönlicher und politischer Ausschlüsse, neuer Versprechen, nie ge heilter Verletzungen. Nicht viel anders bei den Frauengruppen, was die durchschnittliche Aktivitätsdauer angeht. (Das interne Verhalten kenne ich nicht.) Hier ist eine Frage für heute: Hat sich etwas geändert in der Konstanz von persönlichem Verhalten; in der VerlässlichkeitsStruktur der Einzelnen in politischen Gruppen und in ihren Bezie hungen? Fragen für Nicht-Satiriker.
Das Bewusstsein der eigenen Flüchtigkeit, für mich ein Kern des 68er Aktionismus, kam zum Ausdruck u. a. in der Selbstauflösung des SDS
Ende 1969. Angesichts der explosiv in alle Richtungen stiebenden Elemente der Organisation wurde durch Mehrheitsbeschluss festge stellt: «Diese Sache ist vorbei, nun. Hiermit beenden wir sie». Dass ei nige dabei eine Zukunft gebaut auf den Granit von Parteien im Sinn hatten, stimmt allerdings. Für die andern galten eher ein paar StonesZeilen: I‘ve got no expectations, to pass through here again. Und, weitergehender, schärfer: Our love is like our music / It‘s here and then it‘s gone No Expectations, 1968 (von wegen: jeder hatte einen Arbeitsplatz in Aussicht. Total -Legende.) Bassklarinetten-Gott Eric Dolphy hatte es ähnlich formuliert: the music we play…it‘s in the air…and then you‘ll never hear it again…in einem der letzten Bühnenauftritte, kurz bevor er sich auf den Olymp schwarzer verausgabter Hornbläser ver abschiedete. Aber er täuschte sich. Irgendwer schnitt es mit, irgend wer schnitt immer alles mit, der ewige Mitschneider, um es dem Archiv einzuverleiben; unersättlichen Archiven, die die Musik des Moments zwar festhalten, aber nicht entfalten. Die Verausgabung, die Selbst verschwendung, das pulsierende Herz von 68, fassen sie damit nicht. Dieser Punkt ist am schwersten nachzuvollziehen für die später Ge borenen. Niemand glaubt 68 — diesen Auf-den-Putz-Hauen das Fee ling einer Lost Generation. (Har har).
Anders als Eric Dolphy, John Coltrane oder Albert Ayler bliesen sich die Stones nicht mit vierzig die Seele aus dem Hals, sie blasen ihre Songs noch heute, möglichst unverändert — No Expectations! — und wollen dies auch noch mit achtzig tun, als ihr eigenes tönendes Phara onengrab. Gegen das Überleben gibt es selbstverständlich berechtigte Einwände. I‘ve got nothing, Ma, to live up to, singt Bob Dylan 1965, singt Bob Dylan 1968, singt Bob Dylan (manchmal) noch heute. Und betreibt seine Projekte, große. Einige, die mit einem Bein schon im Jenseits des Terrorismus waren, im Jenseits der Selbstaufgabe, sind doch noch Professoren geworden, verlässliche Eltern und, zur Hölle, sogar Minister. Da kann man ja nur lachen.
Zumindest gehört zu 68 die Geste einer partiellen Selbst-Ironie. Pigs waren nicht einfach nur die Anderen. Frank Zappa, der an die Rampe tritt, seine Hose öffnet und das Konzert startet mit den Worten «Greet you, pigs». (Animiertes Quieken der Schweinchen im Saal.) Spaßgue rilla war das bessere Erbe als Grün.
Legenden und falsche Erbfolgen. 68 war nicht die Grünen. 68 war nicht nur außer-, es war antiparlamentarisch. Anti-stalinistisch, antibolschewistisch. Rätedemokratie! Die Industrie-Betriebe hatten wir nicht als Praxisfeld. Und in der WG ? Unter WG -Bedingungen wird praktizierte Anarchie daraus, mit Individual-Nischen. Ein psycho physisches Selbst-Experiment ohne Versuchsleiter und aufzeichnende Supervision. Total hybrid. Ich kann mitlachen mit allen, die sich darüber lustig machen. Nicht mitlachen mit Herrn Westerwelle, der 68 unter Kriminalität und RAF abhaken und entsorgen möchte. Die Befürchtungen zum Schicksal emanzipativer politischer Gruppen im Parlamentarismus haben sich aus der Sicht von 68 voll bestätigt. Eindrücklicher als ein grüner Außenminister Fischer, der — laut Kol legin Antje Vollmer — das Prinzip ‹Putztruppe› zum Prinzip auch der innerparteilichen Auseinandersetzung machte; der Belgrad (ohne UNO - oder NATO -Beschluss) als Mit-Täter bombardieren ließ (aus Sicht der Serben in Nachfolge des Willkür-Bombardements Belgrads durch die Nazis 1941); eindrücklicher als Putztruppen-Fischer, der dies öffentlich und wiederholt als Akt der Verhinderung eines «zwei ten Auschwitz» ausgab, kann man die Unvereinbarkeit von 68 mit manchen Handlungen rot-grüner Parlamentsmehrheiten und Regie rungen nicht unterstreichen. Wie so oft schlägt die Wirklichkeit die Satire.
Heute liegt 68 vor in Formen, die nicht 68 sind; in eher ruhiger selbst bewusster Alltäglichkeit. Dylans He not busy being born is busy dying stimmt noch, im Kern, aber she würde das nicht so sagen. Weiterge boren wurde und wird man nicht alleine.
Bei Noam Chomsky, einem jener ungebrochenen Linken, die daran festhalten, dass nicht nur Stalin, sondern auch Lenin und Trotzki Feinde des Sozialismus waren, lese ich gerade die Sätze: «Der Anar chismus, wie ich ihn verstehe, ist menschliches Denken und Handeln, das Autoritäts- und Herrschaftsstrukturen zu erkennen sucht, ihnen Rechenschaft abverlangt, und falls sie diese nicht ablegen können, sie zu durchbrechen versucht.» Etwas hölzern formuliert, aber machbar als Programm. Er sieht diesen Anarchismus auf einem guten Weg in der Welt heute. «Viele Formen von Unterdrückung und Ungerechtig keit, die kaum erkannt und noch weniger bekämpft wurden, nimmt man heute nicht mehr hin.» Wenn es genug Leute gibt, die sich beteili gen an diesem Nicht-Hinnehmen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, kann man 68 getrost vergessen; es überführt sich dann in andere Da seinsformen. Das genau war der Sinn.
Klaus Theweleit ist Schriftsteller, Professor für Kunst und Theorie an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe und Dozent am Institut für Soziologie der Universität Freiburg i. Br., zahlreiche Lehraufträge in Deutschland, den USA, der Schweiz und Österreich. Durchschlagenden Erfolg hatten seine Bücher Männerphan tasien, Bd. 1: Frauen, Fluten, Körper, Geschichte, Frankfurt a. M. 1977; Männerphanta sien, Bd. 2: Zur Psychoanalyse des Weißen Terrors, Frankfurt a. M. 1978. Theweleit ist Autor zahlreicher Schriften. 2003 wurde Theweleit mit dem Johann-Heinrich-MerckPreis für literarische Kritik und Essay ausgezeichnet. Zuletzt erschien von Klaus Theweleit absolute(ly) Sigmund Freud Songbook, Freiburg 2006
iX. Xi . X.
9 2008 40 jahre dana C h vii. viii
.
vorahnung der wende ?
Die Wende im Herbst 1989 kam für die meisten Menschen im Osten und Westen Deutschlands unerwartet und unverhofft. ‹Gerechnet› hatte wohl niemand mit ihr. Wenn im Jahr 2009 aus Anlass des 20jährigen Jubiläums der Ereignisse des Mauerfalls gedacht wird, wird der Eindruck, wenn nicht gar der Mythos einer historischen Überraschung weiter verblasst sein. Dadurch kann der Blick für die seismographisch feinen Erschütterungen im bis zur Wende fest gefügten Systemdenken geschärft werden. Die Kulturstiftung des Bundes hat mehrere Kulturprojekte zum Jubiläumsjahr Deutschland 2009 ent wickelt. Dazu gehört ein Filmprogramm, das nach Spuren einer Vorahnung der Wende in ostdeutschen und osteuropä ischen Filmen der 1980 er Jahre sucht. Der Filmwissenschaftler Rainer Rother beschreibt Hintergrund, Material und Ziele der Filmretrospektive.
von r ainer rother
1
Die Wende — ein unvermuteter Umschwung
Der große britische Historiker Hugh R. Trevor-Roper hielt 1988 eine inspirierende Vorlesung zu den «verschollenen Krisenmomenten der Geschichte». Damit meinte er jene Bewegungen, die einen grundle genden Richtungswandel in der historischen Entwicklung bewirkten, Momente, die sich dadurch auszeichnen, dass gerade hier alles auch hätte anders ablaufen können. Zur Verdeutlichung der besonderen Mischung aus verschiedenen Faktoren, die ein bislang stabiles Gebilde und seine vorgezeichnet erscheinende Entwicklung radikal umzugestalten vermögen, verwies er auf die deutsche Geschichte nach 1945. «Wenn die Spaltung in gegensätzliche politische Systeme noch länger andauert und die ideologischen Motive der Teilung sogar über dauern, diese schließlich ein strukturelles Eigengewicht ausgebildet haben: Wer wird dann noch sagen, dass die Teilung Deutschlands nicht dieselbe Permanenz erreichen werde wie die der Niederlande im 16. Jahrhundert? Denn so und nicht anders entstanden auf Dauer die Nationalstaaten mit ihren Grenzen.»
In der damaligen Bundesrepublik wurde der brillante Text im August 1989 veröffentlicht, in der Zeitschrift Merkur. Und sein Gedankenspiel — unveränderte Bedingungen vorausgesetzt, werde die Existenz zwei er deutscher Staaten ganz unterschiedlicher Art sich verfestigen passte durchaus in den Rahmen damaliger Überlegungen. «Die Deut schen im Westen waren auf die Wiedervereinigung wenig vorbereitet und erwarteten sie nicht — 1989 merkwürdigerweise weniger als je zuvor» (Dietrich Thränhardt). Aber als Trevor-Ropers Artikel im Merkur erschien, als Mehrstaatlichkeit fast als eine deutsche Normallage gelten konnte, da waren die Dinge schon in Bewegung gekommen.
Es ist leicht, die noch im Herbst 1989 weit verbreitete Verkennung dieser Dynamik zu kritisieren. Die Krisenmomente der Geschichte sind je doch unvermutete Umschwünge, und die Faktoren, die zu ihnen bei tragen, liegen nicht offen zu Tage. Eben deshalb war die Reaktion der Zeugen dieser radikalen Veränderung des bislang Gewohnten freu diges Erstaunen. Karl Heinz Bohrer begann sein Editorial zum De zember-Heft 1989 des Merkur mit einem anonymen Zitat: «Det is Ge schichte, Mann!» Es stimmt: Alles war erstaunlich, unglaublich, die durch die eben geöffnete Mauer in den Westteil der Stadt strömenden Ostberliner hatten dafür das gleiche Wort wie die mit großen Augen die Flut der Trabbis bestaunenden und mit ihren Fahrern feiernden Westberliner: «Wahnsinn». Dies war der Ausdruck größter Freude, die sich so gar nicht als Erfüllung der Erwartungen sah, vielmehr das schon längst nicht mehr auf der Tagesordnung der Geschichte Ste hende als das anerkannte, was es tatsächlich auch war: als Einbruch von Bewegung, Dynamik, Umsturz ins Posthistoire. Der Fall der Mauer dementierte das Ende der Geschichte.
Im Rückblick der Historiker ist die Wende erklärbar, sind die Faktoren, die zum Zusammenbruch des sowjetischen Systems beitrugen, deut licher erkennbar geworden. Ökonomische und ökologische Krisen, die Unglaubwürdigkeit des Systems selbst, seine moralische Diskre ditierung — all das ist als Bündel von Ursachen zusammengetragen worden. Die historische Erkenntnis hat den Ereignissen der Wende jahre jedoch das Erstaunliche der Veränderung — von Zeitgenossen als unerwartete und beispiellose Dynamik empfunden — belas sen. Was sich damals in den Kommentaren der Betroffenen tatsäch lich oft nur als fröhlicher Wahnsinn, als gänzlich unvorhergesehener Einbruch von Veränderung in einen als erstarrt und unwandelbar ge glaubten Zustand beschreiben ließ, ist in seiner historischen Erklä rung keineswegs eine Notwendigkeit. Noch immer klingt das Staunen nach, mit dem damals die Berichte von Botschaftsflüchtlingen, De monstrationen von Zehntausenden, von Grenzöffnung und Mauer fall aufgenommen wurden. Noch immer bleibt als wesentliche Erfah rung dieser Jahre, dass eine Entwicklung, die niemand zu prognosti zieren gewagt hätte, in kürzester Zeit die gewohnten Bedingungen des politischen Lebens umstürzte.
In den Jahren und Monaten vor dem Herbst 1989 gab es allerdings auch die Erwartung, untergründige Prozesse der Veränderung in den sozialistischen Gesellschaften, die damals noch keineswegs als ein in ab sehbarer Zeit auslaufendes Modell galten, in verschiedenen Zeichen aufspüren und damit besser verstehen zu können — auch verstehen
zu können, wie groß die Dynamik tatsächlich war und in welche Rich tung sie zielte. Unverkennbar war es eine an Siegfried Kracauer ge schulte Hoffnung, mit der nun Filme aus dem Ostblock, nicht zuletzt auf den Festivals in Moskau, Karlovy Vary und Leipzig aufgenom men wurden: Denn wenn Filme aufgrund ihrer spezifischen arbeits teiligen Produktion «weniger explizite Überzeugungen als psycholo gische Dispositionen» reflektieren, dann gab es gute Chancen, in den neuen Filmen Spuren zu finden von den sich vollziehenden Umbrü chen. Diese waren zunächst nicht auf das Grundsätzliche des Sys tems bezogen, aber sie reagierten auf seine unverkennbaren Schwä chen. Wie dies sich niederschlug in Filmen, das konnte Aufschluss ge ben über sie hinaus.
2 a b
Spuren des Umbruchs im Film ‹Perestroika-Filme›
In der Sowjetunion führten die Diskussionen auf dem 5. Kongress der Filmschaffenden im Frühjahr 1986 zu eingreifenden Änderungen der bisherigen Produktionspraxis. Die ‹Perestroika-Filme›, zunächst die endlich veröffentlichten ‹Regalfilme› wie Aleksandr Askoldovs Die Kommissarin (1967) oder Aleksej Germans Straßenkontrolle (1971), dann aktuelle Filme sowohl bereits etablierter Regisseure (Kira Mu ratova, Sergej Solovjev) sowie junger Filmemacher (Aleksandr Sokurov, Vasilij Picˇul, die Brüder Aleinikov) griffen bislang tabuisierte Themen auf. Die stalinistische Vergangenheit, bislang ausgesparte Problemfelder des sozialistischen Alltags traten ins Zentrum; neue Formen wurden erprobt, mit ungewohnter Zuspitzung und Radikali tät sowohl der symbolischen wie der realistischen oder grotesken Filmsprache. Zugleich wurden Sexualität, Außenseitertum, Verbre chen, auch in spekulativer Weise, in Filmen ungewohnt offen darge stellt. Die Dokumentarfilme fanden eine Zeit lang ein erstaunlich großes Publikum: «Die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung und differenzierten Darstellung ließen den Dokumentarfilm für kur ze Zeit sogar über seine ‹Spiegelfunktion› hinauswachsen und zu einem Motor der Veränderung werden» (Christine Engel, Geschichte des sowjetischen und russischen Films, 1999).
Dokumentarfilme
In anderen Ländern Osteuropas vollzogen sich ähnliche Aufbrüche, teilweise setzten sie schon früher ein. Die nationalen Kinematogra phien wurden meist noch immer von Zensur und Gängelung behin dert — am stärksten in der DDR —, doch kann man fast von einer allgemeinen ‹Welle› kritischer Produktionen sprechen. Sie schuf in dieser sehr kurzen Zeit ein neues Bild der sozialistischen Gesellschaften — widersprüchlicher, pointierter, härter als in den Jahrzehnten zuvor. So deutete sich in etlichen Filmen eine grundsätzliche Wende an. Nicht allerdings so, dass die Tage des Alten schon eindeutig als abgelaufen gekennzeichnet wurden. Wenn der Untergang eines politischen und ökonomischen Systems in Filmen reflektiert werden kann, dann nicht in den Maßeinheiten eines Countdowns. Eine Verände rung registrieren, sogar eine, die zu einem Ende hin drängt, bedeutet nicht, sie in ihrem weiteren Verlauf sicher prognostizieren zu können. Unter den Bedingungen der noch immer mächtigen Zensur und Gän gelung entstanden also Filme, die mit einer besonderen Sensibilität seismographisch registrierten, dass etwas und was da in Gang gekom men war.
Zunächst waren es Dokumentarfilme, die auf neue Art und mit neuer Deutlichkeit ihre Gesellschaften in den Blick nahmen. Zum Leipziger Festival 1987 schrieb Jutta Voigt im Sonntag: «Man sah öfter Eigen williges, weniger Eintöniges, man erlebte vor allem mehr Offenheit in der Darstellung der Probleme in sozialistischen Ländern.» Die Bewe gung, die hier in den sozialistischen Film gekommen schien, war zu gleich eine, die die sozialistischen Gesellschaften selbst erfasst hatte. Auch davon sprechen manche Rezensionen schon. «Daß es Aggressi vität, Alkoholismus, Zweifel am Sinngehalt der Arbeit auch unter so zialistischen Bedingungen gibt, wissen wir, es steht ja in den Zeitungen, wenngleich meist erst als Gerichtsbericht. Daß Filme darüber ge macht werden, ist so selbstverständlich noch nicht» (Jutta Voigt). Filme wie Ist es leicht, jung zu sein? von Juri Podnieks (1986), der die Situ ation Jugendlicher illusionslos darstellt, wären kurz zuvor nicht mög lich gewesen. Nun gab es sie und wovon sie erzählten, war nicht mehr zu leugnen.
10 2009 20 jahre dana C h
weitere proje kte zuM gedenkjahr 2009
Allerdings konnte das Sprechen über die realen Verhältnisse behindert und verboten werden. Nicht alle kritischen Dokumentationen fan den ihr Publikum, insbesondere nicht in der DDR . Dort konnte Volker Koepps kleine Studie Feuerland (1987) zwar auf dem natio nalen Festival in Neubrandenburg laufen, nicht aber in Leipzig. Ein Jahr später blieb Märkische Ziegel (1988/89) im Regal: Diese Beob achtungen aus Zehdenick bekamen mehr als ein Zensurproblem. Unter anderem, weil hier Arbeiter das Unsinnige des Verbots der sowjetischen Zeitschrift Sputnik beklagten und über das ‹neue Den ken›, das in der Sowjetunion propagiert werde, diskutierten. Vermut lich wären schon die Abbilder der Ziegelfabrik in Zehdenick, in der noch mit den gleichen Maschinen wie Ende des 19. Jahrhunderts pro duziert wurde, anstößig gewesen: Das UNESCO -Zeichen für denk malgeschützte Gebäude gewinnt hier Doppeldeutigkeit, weist es doch auf real-sozialistische und zutiefst anachronistische Verhältnisse hin. Mindestens ebenso deutlich spricht die Resignation der Arbeiter an gesichts der seit Jahren beklagten und dennoch niemals renovierten desolaten Dusch- und Sanitärräume ihr Urteil über die innere Refor mierbarkeit des Systems.
Doch auch von der DDR wurden auf dem Dokumentarfilmfestival in Leipzig Filme vorgestellt, die den Blick vor den großen Problemen nicht mehr verschlossen. Gitta Nickels Wenn man eine Liebe hat (1987) ermöglichte, so Heinz Klunker im Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt, «fernab sozialistischer Mythologisierungen, Einblicke in den Industriealltag, die das Schema sprengten und sich der Realität zumindest näherten. Wie zu hören war, ging das einigen Administra toren bereits zu weit — was freilich über deren Engstirnigkeit mehr besagt als über die Qualität des Films.» Werke wie Winter Ade von Heike Misselwitz, der 1988 in Leipzig die Silberne Taube gewann, bra chen dann tatsächlich der Wahrnehmung eine neue Bahn. Jutta Voigt schrieb, wiederum im Sonntag. «In Leipzig frenetisch gefeiert, mit einem Applaus, der mehr meinte als diesen Film, er meinte den rich tigen Umgang mit der eigenen Wirklichkeit, furchtlos. Hier war es, das überzeugende Beispiel für eine neue soziale Sensibilität, etwas, das die Sehnsucht nach Wahrhaftigkeit stillte, das Verlangen nach wohl dosierter Respektlosigkeit auch.»
Osteuropäische Filme
Den Dokumentarfilmen dieser Jahre stehen ähnlich aufmerksam ei ne Krisensituation registrierende Spielfilme zur Seite. Wenn sie nicht, wie Krzysztof Kieslowskis Kurzer Film über das Töten (1987) oder Vasilij Picˇuls Kleine Vera (1988), im Rahmen einer vergleichsweise realistischen (oder im letzteren Fall sogar konventionellen) Narration blieben, verstörten sie allerdings oft. Verstörung war das Programm der sich herausbildenden alternativen Filmproduktionen in der UdSSR, dem ‹Parallelen Kino› etwa, dessen Grotesken all das aufkündigten, was lange wie zementiert existierte: das realistische Erzählen ebenso wie den Glauben an die Utopie. Auf andere Art verunsicherten hoch symbolische Filme, wie z.B. Konstantin Lopuschanskis Der Museums besucher (1989). An Filmen wie diesem irritierte Beobachter die meta phorische Überhöhung, die Tendenz zur Ausweglosigkeit in der Er zählung. Lopuschanskis Film erschien damals nicht als Symptom des nicht mehr zu heilenden Verfalls, sondern als zu übertrieben in seinen Mitteln und zu düster in seinem Pessimismus.
Die Filmretrospektive Vorahnung der Wende?
Die revolutionären Veränderungen der Jahre um 1989 wurden in den ersten Nachwendejahren in ihrem Kern als Überraschung erinnert. Nicht einmal die Geheimdienste, hieß es später, hätten die Dynamik der Entwicklung richtig eingeschätzt — geschweige denn, diese Ent wicklung selbst vorhergesehen. Was sich unvermutet ereignete, das hatte in den unmittelbar folgenden ‹Evaluationen› der Kunstwerke des nun Überwundenen ein gewisses Übermaß an Kritik zur Folge. Zum Film der DDR hieß es, die DEFA habe nichts hervorgebracht, was die damals herrschenden Verhältnisse ungeschminkt auf den Punkt gebracht hätte, von investigativer Arbeit ganz zu schweigen. Im Grunde galt der Film vor 1989 in dieser Sichtweise als blind gegenüber den tatsächlichen Verhältnissen im Land, als bestenfalls beschönigend, im schlimmeren Fall aber ideologisch eindeutig sich festlegend. Und doch gab es Zeugnisse davon, dass ‹dies alles› eines Tages entzwei platzen könne. Sie mochten unscheinbar sein, verborgen, verboten. Sie konnten aber auch ‹übersehen›, in der Schärfe ihrer Diagnose nicht wahrgenommen worden sein. Die Zeichen sprangen zwar nicht ins Auge, aber sie waren doch vorhanden: in Filmen eingeschrieben, die sich ihren Gesellschaften mit der Tugend der genauen Beobachtung stellten oder ihren Zustand in Metaphern fassten, die jegliche Über einstimmung mit der offiziellen Version vom Stand der Dinge aufkün digten. Diese Filme sagten keine ‹Wende› vorher, doch vermittelten sie eine Ahnung davon, dass es ‹so› jedenfalls nicht weiter gehen könne. Das Projekt Vorahnung der Wende? wird die oft vergessenen Filme der Vorwendezeit sichten: Produktionen aus Osteuropa, der DDR und der Bundesrepublik Deutschland. Die herausragenden Beispiele dieses einzigartigen Filmkorpus — Spiel- und Dokumentarfilme, ex perimentelles und Untergrundkino — sollen sodann gesichert und in neuen untertitelten Kopien zur Verfügung gestellt werden. Die ku ratorische Zielsetzung besteht darin, eine Filmreihe aus etwa 15 Pro grammen zusammen zu stellen. Erstmals soll diese Filmreihe auf einem deutschen Filmfestival aufgeführt werden; in der Folge soll sie in verschiedenen deutschen und ausgewählten osteuropäischen Ki nos dem Publikum präsentiert werden. Es wird angestrebt, die ausge wählten Filme längerfristig durch Verhandlungen mit den Rechteinhabern für Vorführungen in der Bundesrepublik Deutschland ver fügbar zu halten. Die Deutsche Kinemathek — Museum für Film und Fernsehen wird diese Filme zudem in ihr Archiv übernehmen. Unter titelungen in deutscher Sprache sichern dabei die Zugänglichkeit für ein breiteres Publikum, und in der Kooperation mit Vision Kino ist zudem sichergestellt, dass eine Auswahl des Programms bundesweit auch für Schulen zur Verfügung steht.
Rainer Rother, geboren 1956, lehrte Filmwissenschaft in Hannover, Hildesheim und Saarbrücken. Rother ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zur deutschen und in ternationalen Filmgeschichte. Rother war Programmleiter des Zeughauskinos im Deutschen Historischen Museum und Ausstellungskurator in Berlin und ist seit April 2006 Leiter der Deutschen Kinemathek — Museum für Film und Fernsehen, die im Auf trag der Kulturstiftung des Bundes gemeinsam mit Vision Kino und der Fédération In ternationale des Archives du Film (FIAF) die Filmretrospektive zusammenstellt.
Die Kulturstiftung des Bundes wird sich mit zwei weiteren größeren Vorhaben am Gedenkjahr 2009 betei ligen. Auch bei diesen Projekten geht es um den Beitrag von Künstlern und Kulturschaffenden in ihrer Rolle als Chronisten, Kommentatoren und Kritiker der deutsch-deutschen Zeitgeschichte. Die Projektezeigen Verbindungen zwischen Kunst, Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit auf, die für die Kultur(en) des geteilten Deutschland charakteristisch waren. Das Theater-Projekt 60 Jahre Deutschland fördert die Kulturstiftung des Bundes im Rahmen ihrer Allgemeinen Projektförderung.
deutschland — eine wiedererfindung Literarisch-künstlerische Montage zu sechs Jahrzehnten deutscher Nachkriegsgeschichte Hörbuc hedition, Sendereihe zum 6 0 Jahrestag der Bundesrepublik Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges bis Ende der sechziger Jahre war das Radio das wichtigste Massenmedium in Deutschland. Das Radio setzte Themen, prägte den kulturellen Disput und hat den de mokratischen Aufbau und das kulturelle Leben in der Bundesrepublik geprägt. Einen besonderen Rang nimmt das Hörspiel ein: Die meisten großen deutschen Autoren schrieben für das Hörspiel, das einerseits an literarische Traditionen anknüpfte und sich andererseits dem akustischen Experiment öffnete. Mit der Entwicklung des Fea tures als eigenständige Kunstform wurde schon früh eine Überwin dung der Genregrenzen in Gang gesetzt, wodurch akustische Kunst, Literatur und Musik in einen produktiven Dialog eintraten. Auf Ini tiative der Kulturstiftung des Bundes entsteht gemeinsam mit dem Hörverlag, dem Bayerischen Rundfunk und dem Hessischen Rund funk eine Hörbuchedition, die das kulturelle Erbe der Radioarchive neu erschließt und 60 Jahre deutscher Geschichte in den Stimmen von Autoren, Komponisten und weiteren Künstlern akustisch lebendig werden lässt. Das außerordentlich umfängliche Material soll aus do kumentarischer und aus literarischer Perspektive gesichtet und kom poniert werden. O-Töne, Reden, Essays, Features und Collagen, in denen sich die kulturellen und gesellschaftlichen Debatten ihrer Zeit abbilden, sollen wieder zugänglich gemacht werden. So wird deutlich, wie sich künstlerische Innovationen in Musik und Radiokunst her ausgebildet haben Die Edition von 20 CD s (Spieldauer 24 Stunden) soll im Mai 2009 erscheinen.
berliner geschichtsforum 2009 Aufbruch 1989 — Wege aus der deutschen und europäischen Teilung Internationales Forum für Wisse nschaftler, Kulturschaffende, Politik, Medien und Öffentlic hkeit zum 20 Jahrestag der friedlichen Revolution Gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung, der Stif tung zur Aufarbeitung der SED -Diktatur, dem Zentrum für Zeithis torische Forschung Potsdam und dem Institut für Zeitgeschichte München richtet die Kulturstiftung des Bundes im Frühsommer 2009 ein mehrtägiges Geschichtsforum in Berlin aus, das sich mit den fried lichen Revolutionen von 1989/90 in Deutschland und Osteuropa und ihrer Bearbeitung in Literatur, Theater, Kunst und Musik sowie ihrer Vermittlung in den Medien, in der politischen Bildungsarbeit und den Wissenschaften befasst.
60 jahre deutschland Annäherung an eine unbehagliche Identität Theaterprojekt Künstlerische Leitung: Thomas Ostermeier I Dramaturgie: Jens Hillje I Autor/innen: Oliver Bukowski, Simon Froehling (CH), David Gieselmann, Kri stof Magnusson, Dorota Masl/owska (PL), Marius von Mayenburg, Mark Ravenhill (GB), Falk Richter, Rafael Spregelburd (RA), Gerhild Steinbuch (A) u a. I Regisseure: Be nedict Andrews (AUS), Dominic Cooke (GB), Grzegorz Jarzyna (PL), Sebastian Nübling, Thomas Ostermeier, Falk Richter, Rafael Spregelburd (RA) u a. I Veranstaltungsort undzeitraum: Schaubühne am Lehniner Platz Berlin; 1 8 07 31 7 09
Die Berliner Schaubühne entwickelt gemeinsam mit jungen und re nommierten Dramatikern ein umfangreiches Programm zur deut schen Nachkriegsgeschichte. Es besteht aus einer Reihe von neuen ‹Minidramen›, einem Komödienwettbewerb und weiteren Stückauf trägen. Die Lesungen und Inszenierungen in der Schaubühne am Lehniner Platz werden durch ein Themenwochenende und ein Festival ergänzt.
3
c
11 2009 20 jahre dana C h
von M arC el beyer
vergessen M proustaChen,
w
enn man später in einer Runde an die Nachkriegszeit zurückdachte, an jene lange, fließend in die Aufbaujahre übergehende, bis weit in die fünfziger Jahre reichende Phase, von der umso häufiger die Rede war, je älter wir wurden, weil sie mit der Zeit unserer Jugend zusammenfiel, saß Klara, wie es eigentlich nicht ihre Art war, meist still daneben. Wenn Erinnerungen ausgebreitet wurden, wenn einer dem anderen mit Namen, Jahreszahlen, Orten auf die Sprünge half, wurde Klara schweigsam, man lachte, stritt, fiel einander ins Wort, niemand be merkte es, doch ich sah Klara an, ihr war unwohl dabei. Sie schien kaum zuzuhören, wirkte abwesend, während alles lauschte, einer übertrumpfte den anderen mit noch genaueren Einzelheiten, mit ei ner noch verwegeneren Geschichte, Klara aber hielt sich zurück, als gelte es, sich aus einer unangenehmen Angelegenheit herauszuhalten.
Und das, obwohl in unseren Kreisen keine Gefahr bestand, ein Abend könnte sich darin erschöpfen, Erinnerungen an die Mückensalbe Leopek, Fleischfrost-Produkte oder Filme wie Mazurka der Liebe heraufzubeschwören. Niemand sprach von den ‹Sparwochen›, es gab kein leuchtendes ‹Durch unserer Hände Fleiß› und keine patinierten ‹Hafermotoren›, die sich mit albernem Augenzwinkern in einer Bemerkung zur Trümmerberäumung hätten unterbringen lassen. Klara musste sich nicht anhören, wie «Der Dresdner Aufbaulöwe lacht», geschweige denn, dass ihr jemand mit «Der Feind steht im ei genen Land» gekommen wäre. Trotzdem. Solche Abende ertrug sie nicht.
Einmal verließ Klara einfach für eine halbe Stunde die Gesellschaft im Haus entfernter Bekannter, um — in ihren eigenen Augen der Gipfel der Unhöflichkeit — draußen im Flur das Ende einer Unterhaltung über den 17. Juni 1953 abzuwarten. Sie sei, meinte sie hinterher, beim besten Willen nicht in der Lage gewesen, den Raum wieder zu betre ten, ehe der letzte Gast sich seiner Erinnerungen an dieses Datum ent ledigt hatte. Sie habe die ganze Zeit in Hörweite dagestanden, ein paar Schritte von der Tür entfernt, leicht benommen, den Rücken an ein Bücherregal gelehnt, und einen körperlichen Widerwillen dagegen empfunden, die erinnerungsgeschwängerte Luft im Salon zu atmen.
Ein Gast berichtete, er habe sich am Wasaplatz, als er eben aus der Bä ckerei trat, in den aus Niedersedlitz kommenden Demonstrationszug eingereiht und sei mit seiner Brötchentüte bis in die Innenstadt mitgelaufen, ein anderer behauptete, neben Streikleiter Grothaus mar schiert zu sein, ein dritter memorierte eine Streikrede, sagte ganze Ab schnitte auswendig auf. Von Bild zu Bild stand den Beteiligten das Geschehen klarer vor Augen, schließlich konnten sich alle daran erin nern, wie sie einander mittags im Gedränge auf dem Postplatz begeg net waren. Es folgte ein Moment des Schweigens, da jeder die Erleb nisse für sich Revue passieren ließ, und Klara erschien wieder im Tür rahmen. Niemandem war aufgefallen, dass sie hinausgegangen war, niemand hatte sie in der Zwischenzeit vermisst.
Auf dem Heimweg — die Runde hatte sich danach bald aufgelöst — konnte ich Klara nicht viel mehr entlocken, als dass sie die Ge schichten eben nicht ertragen habe, den Gestus, in den die Erzählen den verfielen, als könnten die Erinnerungen einen Halt geben, wo doch im Gegenteil die Rückschau uns zutiefst erschüttern, unser jet ziges Leben aus den Fugen geraten lassen müsste. «Wir haben alle unsere Alpträume, soll mir keiner etwas sagen», erklärte sie, wie um das Thema zu beenden, und: «Alle haben wir Fehler gemacht, jeder einzelne von uns, mich selber nehme ich dabei bestimmt nicht aus.» War abzusehen, man würde sich für den Rest eines Abends der Vergan genheit widmen, fand Klara in der Regel einen Grund, sich zu verab schieden, ohne die Gastgeber in Verlegenheit zu bringen, Erschöp fung nach einem langen Tag, der weite Heimweg, eine sich anbah nende Erkältung. Wenn sie sich zu schwach fühlte, um auch nur eine passende Entschuldigung vorzubringen, machte sie mir Zeichen, dass wir aufbrechen sollten, und ich ließ mir etwas einfallen, nahm Zu flucht zu einer Exkursion, vor Sonnenaufgang aus dem Bett, um die Vögel zu beobachten, damit konnten wir uns immer unauffällig aus der Affäre ziehen.
Gab es keine Möglichkeit zu entrinnen, wurde Klara gar auf den Kopf zu gefragt, welche besonderen Ereignisse sie mit den fünfziger Jahren verbinde, bestand sie kategorisch darauf, sie habe weiter keine Erin nerung an jene Zeit, als dass die deutsche Übersetzung des «Proust» erschienen sei. Müde klang sie, wenn sie es sagte, keine Spur ihres fre chen Tons, kein Funke Angriffslust, «Der Proust, sonst nichts», sie war ganz einfach der Geschichten müde.
Und trotzdem überraschte sie mich damit beim ersten Mal ebenso wie die anderen in der Runde, ich hätte nicht sagen können, ob Klara sich, auch wenn ich kein Blitzen in ihren Augen bemerkte, einen Scherz er
laubte. Ein trockener, böser, düsterer Scherz, da ich doch wusste, mit welchen Erinnerungen die fünfziger Jahre für Klara, für Klara und mich verbunden waren.
Wer nicht begreifen wollte, dass ihr die Unterhaltung zuwider war, dem legte Klara im Einzelnen dar, wie die sandgrau eingeschlagenen Bän de einer nach dem anderen in ihre Hände gelangt waren. Diesen hatte sie bei einem Besuch in Westberlin erstanden, jener lag an ihrem Ge burtstagsmorgen auf dem Tisch, zwei weitere kamen aus einem Paket zum Vorschein, in dem Klara Wurstkonserven vermutet hatte. ‹Der Proust›, das seien ihre Erinnerungen an die fünfziger Jahre, Klara hat immer nur vom ‹Proust› gesprochen, für sie gab es keine ‹Gefangene›, keine ‹Entflohene› und keine ‹Wiedergefundene Zeit›.
Sofern die Runde damit nicht zufrieden war, verstieg sich Klara zu der Behauptung, es sei vor allem jene berühmte Szene gewesen, in der sich der Erzähler die Hände wäscht, die sie durch den gesamten «Proust» getrieben habe, ja, die erste ausführliche Handwaschszene im Roman habe ihr dieses Jahrhundertwerk überhaupt erst erschlossen. Das lau warme Wasser in der Emailleschüssel, dessen Temperatur noch ein mal von der Großmutter — oder war es die Bedienstete? — geprüft wird, ehe der Erzähler seine zarten, wächsernen Finger hineintauchen darf, der Seifenduft, der Schaum, die linke in der rechten Hand, und währenddessen ein langer, staunender Blick des Knaben aus dem Fenster, ehe er zum Essen gerufen wird.
Man näherte sich in einem Gespräch der Zeitspanne nach Stalins Tod, kam auf die Geheimrede, man ging bis zu den Ärzteprozessen, bis zu Slansky zurück, und Klara zuckte zusammen, es würde nicht mehr lange dauern, bis man auch von ihr eine Bemerkung dazu erwartete. Sie spürte schon die Blicke auf sich ruhen, sah sich herausgefordert, ein Ablenkungsmanöver einzuleiten, horchte nun aufmerksam, bis sie ein Stichwort gefunden hatte, das passende Stichwort — hinterher hätte niemand sagen können, wie es ihr so elegant gelungen war, einen Themenwechsel herbeizuführen.
Nach der ersten großen Handwaschszene habe Klara gespannt auf jede kleine, mitunter nur zart angedeutete Szene gewartet, in der diese all tägliche Verrichtung zur Sprache kommt, Nebensätze, Nebenfiguren, einer der unzähligen Salonabende, und jemand verlässt kurz die Run de, um sich die Hände zu waschen — in solchen flüchtigen Momenten, die sich der Leser selbst ausmalen müsse, wenn er ihrer habhaft werden wolle, liege vielleicht das ganze Geheimnis des ‹Proust›. Warum, fragte Klara, wischt sich zum Beispiel der Maler, als er im Atelier unerwartet vom Erzähler Besuch bekommt, die farbverschmierten Hände am Lappen nicht mit Terpentin, sondern mit Spucke ab, ehe er den Gast begrüßt?
Und was steckt hinter jener Szene, da sich Odette von Swann nach einem Abend in Gesellschaft zu dessen Kutsche führen lässt, um mit ihm ei ne Fahrt durchs nächtliche Paris zu machen — warum ist der Kut scher in diesem Augenblick nicht zur Stelle, warum sehen wir ihn nicht pflichtbewusst vom Bock springen, um die Wagentür zu öffnen, kaum dass Swann und Odette auf die Straße getreten sind? Da taucht er hinter den Pferden auf, peinlich berührt, und murmelt etwas, sein Herr würdigt ihn keines Blicks, der Kutscher macht sich umso beflis sener daran, den dienstfertigen Geist zu spielen. Odette und Swann aber sehen nur einander, der Kutscher hält die Hände hinter dem Rü cken verborgen, er benimmt sich, als wollte er, da die beiden eingestie gen sind, den Türgriff nicht berühren, und wir, die Leser, sind die Ein zigen, die bemerken, dass Swanns Kutscher in dieser Szene — aus welchem Grund? — keine Handschuhe trägt, da er die Wagentür von außen schließt. Was hat er da vorher gemurmelt zur Entschuldigung, fragen wir uns, war nicht von einer «Waschgelegenheit» die Rede, hat te er nicht «Rasch» und «Leider» und «Vergeblich» gesagt?
Tauchte in diesem Zusammenhang nicht auch jene Formulierung auf, über die Klara gestolpert war, etwas wie «kleine Schmutzigkeit», hat te nicht Swanns Kutscher «nur eine kleine Schmutzigkeit» gemurmelt, was jeden Leser ratlos zurücklassen musste? Gebrauchte Proust da mit einen Bedienstetenausdruck, verfiel er in den Argot? Nein, dafür klang es zu manieriert — also handelte es sich möglicherweise bloß um eine in der Übersetzung nicht ganz geglückte Stelle? Niemand konnte Klara eine Antwort geben.
Man erinnerte sich banger Nächte am Radio, Panzer in Budapest und Leichen, die in grotesken Verrenkungen erstarrt auf dem aufgeris senen Straßenpflaster lagen — was Klara ein Stichwort lieferte, um der Frage aus dem Weg zu gehen, ob sie — ja, hatten wir — damals ebenfalls schlaflos am Radio gesessen habe. Von den Budapester — oder waren es Prager? — Pflastersteinen gelangte sie innerhalb weni
12 ungarn / b
ipolar
ger Sätze spielend zu jener Unebenheit im Straßenpflaster, über die Prousts Erzähler einmal stolpert, als er sich auf dem Weg zu einer Abendeinladung befindet. Ist er nicht eben im Begriff, darüber nach zudenken, wann er sich zuletzt die Hände gewaschen hat, ob es nicht besser wäre, zur Sicherheit noch einmal eine Toilette aufzusuchen, be vor er der Gastgeberin gegenübertritt? Ein Augenblick der Schwebe, verhalten, leise kündigt sich eine dieser ausführlichen Reflexionen an, die unseren Helden immer wieder im Fluss des Geschehens wie einge froren dastehen lassen, als er sich unversehens an einem Stein im Bo den stößt. Seine Hände, seine Füße, die Aufmerksamkeit macht einen Sprung, eine Irritation wird von einer anderen überlagert, und schon stolpern auch wir, mitten in die berühmte Schilderung einer unwill kürlichen Erinnerung hinein.
Man hielt sich bei Ereignissen aus dem näheren Umfeld auf, die Nieder legung der Ruinen an der Rampischen Gasse 1956, deren baulicher Bestand hätte gerettet werden können, oder Professor Manfred von Ardenne und sein im Frühjahr 1957 gegründeter Dresdener Klub, oder wie er später heißen sollte, Klub der Intelligenz — Klara kon terte mit der Erinnerung an jenen kurzen, in einem Satzeinschub ver steckten Moment, da man den Eindruck gewinnen kann, die Schar der jungen Mädchen bücke sich am Strand von Balbec, wie auf ein verabredetes Zeichen, zwei, drei Sekunden nur, mit dem Rücken zur Promenade, zum Betrachter, als wollten sich die vier Mädchen — un schickliches Benehmen in der Öffentlichkeit — einmal in ihrem Le ben Meerwasser über die Hände laufen lassen. Alles geschieht in wei ter Ferne, die sanften Wellen, Gischt, der salzige Geruch, Geschmack, ein Hauch von Seesternen und Fisch. Man möchte sich dieses An blicks vergewissern, schaut ein zweites Mal zu den auslaufenden Wel len hinunter, aber da haben die Mädchen ihren Nachmittagsspazier gang schon fortgesetzt, als sei nichts gewesen. Man ist sich nicht ein mal sicher, ob der Erzähler das Geschehen wahrgenommen hat, und so bleibt man mit der Frage allein, wie vier derart vornehme junge Damen gleichzeitig, nein, wie sie überhaupt unsaubere Hände haben können, vielleicht der Sand, klebrige Süßigkeiten, vielleicht haben sie Mädchen-, haben Jungenhaut berührt.
Klara konnte sich sicher sein, nach einer solchen Beschreibung werde man ihr willig folgen, und sie kam auf den merkwürdigen Abschnitt im «Proust» zu sprechen, wo der Erzähler heimlich eine ihm unbe kannte Person beim Händewaschen beobachtet. Die Szene spielt im Ersten Weltkrieg, eine der wenigen Pariser Szenen dieser Zeit, jeden Moment können die Sirenen heulen, kann es einen weiteren Bomben angriff geben, doch der Erzähler liegt geduldig auf der Lauer, späht durch ein halb offenes Fenster in einen unbeleuchteten Raum auf der anderen Hofseite, vielleicht in einen Hausflur, wo ein junger Mann im Unterhemd erscheint, eine Tür hinter sich ins Schloss fallen lässt und seinem Drang nachgibt, die Hände unter den nächstgelegenen Was serhahn zu halten. Ein grober Spülstein, den man sonst nur zum Auf füllen von Putzeimern benutzt, kein Handtuch, keine Seife, aber der Mann im Unterhemd kann offenbar nicht warten, bis er eine Toilette gefunden hat.
«Es hat etwas Obszönes», meinte Klara einmal zu mir, nachdem man sie auf eine Proustbemerkung hin den Abend lang in Ruhe gelassen und sich wieder den Anekdoten aus der eigenen Jugend zugewandt hatte. «Das halte ich nicht aus. Etwas Obszönes, und zugleich etwas Verzweifeltes, diese in einen Plauderton gekleidete Verbissenheit, als könne man sich, indem man von früher erzählt, selber unschuldig werden lassen.»
Klara ertrug die Schwere der Geschichten nicht, nur so habe ich es mir erklären können. Diese Schwere, die sich nach und nach verliert, je länger eine Geschichte im Erzählen hin und her gewendet wird, je mehr Details ans Licht gezogen werden, so dass am Ende hinter jedem tra gischen Ereignis eine im Rückblick doch recht komische Verwicklung von Zufällen zu stecken scheint. Weil ich aber weiß, wie Klara aus sieht, wenn sie tagelang verdüstert am Küchentisch sitzt, und weil ich weiß, mit welchem Entsetzen in den Augen sie mich einmal betrachtete, als sie nicht bemerkt hatte, wie ich zur Tür hereingekommen bin, musste mir Klara nie erläutern, warum sie sich nach Möglichkeit im mer auf ihren «Proust» herausgeredet hat.
Marcel Beyer, geboren 1965 in Tailfingen/Württemberg, lebt in Dresden. Er wurde be kannt mit seinen Romanen Das Menschenfleisch (1991) und Flughunde (1995). Falsches Futter, sein lyrischer Debütband, erschien 1997. Marcel Beyer wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet, darunter die Johannes-Bobrowski-Medaille zum Berliner Litera turpreis 1996 und der Uwe-Johnson-Preis 1997. Zuletzt veröffentlichte er den Roman Spione (2000), den Essayband Nonfiction (2002) und den Gedichtband Erdkunde (2002).
Fragen der Erinnerungskultur bilden einen Themenschwerpunkt bei den deutsch-ungarischen Kulturprojekten Bipolar. Das Projekt Kreatives Vergessen versammelt Texte von sechs deutschen und sechs ungarischen Schriftsteller/innen, die sich mit den gesellschaftlichen Tabus im Prozess der Erinnerung und des Vergessens auseinandersetzen. Wir veröffentlichen zwei der Texte, einen des deutschen Schriftstellers Marcel Beyer und einen des Ungarn László Márton (vgl. S. 14 /15), die im Rahmen des Bipolar-Projekts entstanden und in der Zeitschrift Sprache im technischen Zeitalter Heft 183 / September 2007 erschienen sind.
13 ungarn / b ipolar
vergiss niCht, was du versproChen hast! von l aszlo Ma rton e
s ist gut zu vergessen. Oder besser: manchmal kann es gut sein. Die Ar beit des Vergessens befreit mitunter von seelischem oder emotionalem Druck, sie eröffnet der Phantasie unbekannten Spielraum und besei tigt die Hindernisse vor neuen und wichtigen Erkenntnissen. Sein Unglück zu vergessen bedeutet Glück. Sein Glück zu vergessen kann auch Glück bedeuten, ein anderes, kleineres zwar, aber dennoch Glück, denn was so in Vergessenheit gerät, ist in Wahrheit das Be wusstsein des Verlusts. Einmal erzählte mir jemand von einer Frau, die die Fähigkeit des Vergessens in Liebesdingen zu bewunderns werter Perfektion getrieben hatte. Immer, wenn sie von jemandem enttäuscht worden war, schrieb sie dessen Namen auf einen Zettel, zerriss diesen und spülte ihn das Klo hinunter. So vergaß sie binnen Sekunden den nunmehr nicht mehr geliebten Mann, für den sie vor kurzem noch aus dem Fenster gesprungen wäre.
Einmal erzählte mir jemand von einem Mann, den man für sehr diskret hielt, weil er die ihm anvertrauten Geheimnisse für sich behielt. In Wahrheit behielt er sie nicht für sich, sondern vergaß sie einfach, wes halb er sie nicht weitersagen konnte.
Oder nehmen wir jene Erzählung von Anatole France, in der sich Pilatus an alle Personen und Momente seines Lebens genau erinnern kann, nur eben nicht an Jesus.
Antiquariaten finden, die Schriftsätze aber wird man weggeworfen haben. Der Bleisatz wird in Vergessenheit geraten. Ganz langsam wird auch das Schreiben per Hand in Vergessenheit geraten, oder bes ser, es wird in den Hintergrund gedrängt werden. Was so in Verges senheit gerät, ist die Kultur der Kalligraphie, die im 19. Jahrhundert ihre Blütezeit hatte und die Schreibkundigen von den Schreibunkun digen trennte. Die Vulgarisierung der Handschrift — die im Übrigen ein Prozess von Jahrhunderten ist und bei uns mit der sogenannten «Schnurschrift» im Regime unter Horthy begann — wird früher oder später selbst in Vergessenheit geraten, und die Graphologie, die frü her organischer Bestandteil des lebendigen Wissens war, wird zur Hilfswissenschaft degradiert werden.
Aus dem Ungarischen von Heike Flemming; die Übersetzung der Gedichte von Mihály Babits und Mihály Vörösmárty folgt den Übertragungen von Annemarie Bostroem sowie Hans Leicht und Géza Engel.
Dann gibt es Arten des Vergessens, die mit der Vermehrung des Wissens im Zusammenhang stehen. In der Wissenschaft bzw. in den verschie denen Wissenschaftszweigen schreitet das Vergessen mit erstaunli cher Geschwindigkeit voran. Ich bin kein Wissenschaftler, aber ich habe Freunde, die es sind und häufig hervorheben, wie schwer es sei, auf engstem Fachgebiet mit neuen Forschungsergebnissen Schritt zu halten. Mitunter sind von ihnen Aussagen folgender Art zu hören: Was gestern noch gültig war, das kann (bzw. muss) man heute schon vergessen. Ich habe den Eindruck — wenn man sich als Außenstehen der überhaupt eine Vorstellung davon machen kann —, je mehr die Naturwissenschaften sich verzweigen, desto mehr verlieren sie auch den Kontakt zu ihrer eigenen Geschichte. Das Vergessen wird so nicht nur durch die Masse der immer wieder neuen Ergebnisse vorangetrieben, sondern auch durch die Zersplitterung des Wissens.
Diese Feststellung gilt, so glaube ich, in hohem Maße für die Gehirnforschung, die sich unter anderem mit den physiologischen Prozessen des Gedächtnisses beschäftigt.
Demgegenüber scheint die Philosophie — und auch das ist nur der Ein druck des Außenstehenden — zu sehr von der Besinnung auf sich selbst beherrscht zu sein, was zu einem unlösbaren Dilemma führt. Denn die Geschichte der Philosophie lässt sich nicht so leicht von den Problemen ihrer einzelnen Denker trennen wie in den Naturwissen schaften, wo die Teilgebiete bzw. die darauf tätigen Forscher ihrer eigenen jüngeren und natürlich auch älteren Vergangenheit meist den Rü cken zukehren. (Die wissenschaftsgeschichtliche Rekonstruktion siehe etwa Feyerabends menippeische Satire mit Galilei als Hauptheld oder Koestlers märchenhaften Nachtwandler-Roman über einen Bra marbas namens Kopernikus und einen Draufgänger namens Kepler — ist dabei eher von ethischem oder geschichtsphilosophischem Interesse und bietet zudem die Möglichkeit beschaulicher Betrachtung.)
Das Vergessen, das mit der Entwicklung des Wissens einhergeht, muss nicht unbedingt produktiv sein. Parallel zur Geschichte der fortleben den Erfindungen und Entdeckungen könnte man eine Geschichte der vergessenen Erfindungen und Künste schreiben. Im dritten Band von Johann Beckmanns monumentaler Arbeit über die Geschichte der Erfindungen von 1792 etwa finden sich Hunderte Stoffe, Werkzeuge und Verfahren, die heute, wenn überhaupt, nur noch in Fußnoten existieren, weil sie von den folgenden Generationen nicht über nommen worden sind. Offensichtlich glaubte man, diese Dinge und Kunstgriffe nicht zu brauchen. Wir wiederum können die Notwen digkeit dieser vergessenen Erfindungen heute nicht mehr beurteilen, weil sie uns nicht zur Verfügung stehen. (Von den meisten hatten selbst Polydorus Vergilius und Theophilus Presbyter keinen blassen Schim mer, obwohl sie wirklich alles auf der Welt kannten.)
Jene Reiseschreibmaschine mit Typenhebeln, auf der ich die vorliegenden Zeilen zu Papier bringe (vor dem Computerbildschirm schaltet sich mein Gehirn aus, mir fällt da einfach überhaupt nichts ein), diese späte, gezähmte kleine Schwester der römischen Kriegsgeräte wird wahrscheinlich in zwanzig, dreißig Jahren keiner mehr reparieren können, und mit dem Verschwinden der Schreibmaschine wird auch in Vergessenheit geraten, wie Verlag oder Redaktion von ihrem Klap pern nur so widerhallten. In ein, zwei Generationen wird sich keiner mehr daran erinnern, was in der Drucktechnik Mono- oder Linotype bedeuteten. Die so gesetzten Bücher werden sich noch lange in den
Das Schwarzweißfoto auf Papier, ein vollkommen gewöhnliches und selbstverständliches Requisit meiner Kindheit, wird in gar nicht allzu langer Zeit genauso zum Kuriosum wie seinerzeit die Daguerreotypie. Mit seinem Verschwinden im Museum wird auch in Vergessenheit ge raten, wie dieser Faktor die Sichtweise der Menschen ein Jahrhundert lang in bedeutendem Maße prägte und gleichzeitig demokratisierte. Das Foto zeugt dabei von einer Ding- und Architekturkultur, die ohne es in Vergessenheit geraten wäre und die mit ihm verloren gehen wird. (Die digitale Fotografie ist natürlich eine großartige Sache, aber sie steht für die heutige Zeit. Sie kann nicht das zeigen, ausdrücken, bewahren,was das schwarzweiße Papierfoto zeigen, ausdrücken, bewahren konnte.)
Auch der Plattenspieler wird in Vergessenheit geraten und mit ihm die schwarzen gerillten Schallplatten. Die 33 er wird langsamer in Verges senheit geraten als die 78 er, aber das spielt keine Rolle. Das Abschrei ben von Noten wird in Vergessenheit geraten, der Eilbrief wird in Ver gessenheit geraten, das im Umschlag zugestellte Telegramm und die mit der Zustellung verbundenen Minidramen. Der Telegrammzustel ler ähnelt gespenstisch dem heutigen Pizzaboten, allein mit dem Un terschied, dass er die Telegramme regelmäßig öffnete und las, um das zu erwartende Trinkgeld zu kalkulieren. Und auch diese Parallele selbst wird in Vergessenheit geraten.
Es wird in Vergessenheit geraten, wie das Leben vor der Verbreitung heutzutage üblicher Dienstleistungen oder Erfindungen ausgesehen hat. Als es zum Beispiel vor fünfzehn oder zwanzig Jahren noch kein Mobiltelefon gab, wie die Menschen da ein Rendezvous verabredeten, ein Missverständnis aufklärten, ihre Lieben an einem unbekannten Ort suchten. Oder nehmen wir die ungarische Redewendung, dass bei einem «der Tantus gefallen ist». Sie ist zwar vorläufig noch gebräuch lich, der Tantus selbst aber, jene Münze, mit der die alten Fernsprech anlagen funktionierten, ist zusammen mit dem sie schmückenden Emblem der Post in Vergessenheit geraten. Es gibt auch bereits eine andere Variante der Redewendung, dass nämlich bei einem «die zwanzig Filler gefallen sind», mit zwanzig Fillern allerdings speiste man nicht die Fernsprechanlage, sondern die Personenwaage auf der Stra ße. Diese aber ist ebenfalls in Vergessenheit geraten, und genauso die Zwanzigfillermünze mit ihren drei stilisierten Weizenähren.
In Vergessenheit geraten verwüstete Landschaften, abgerissene Gebäu de, der Geschmack nicht mehr zubereiteter Speisen. Sprachen gera ten in Vergessenheit: erst sterben sie aus, dann vergisst man sie, doch es kann auch umgekehrt geschehen oder Hand in Hand. Man vergisst die Personen, die einem nahestanden, und man vergisst auch, wie na he sie einem standen. Die Aussage «Ich werde dich nie vergessen!», bedeutet eigentlich, dass ich dich schon vergessen habe, und diesen Verdacht oder diese Erfahrung vergisst man ebenso.
Auch uns selbst vergessen wir. Anders ausgedrückt vergessen wir uns durch uns. Wir vergessen eine Reihe von Episoden unseres Lebens, un sere Taten und unser Leiden. Wir vergessen unsere einstigen Ziele und Prinzipien (wenn wir welche hatten), unsere Charakterzüge (wenn wir sie überhaupt gekannt haben), unsere alten Einsichten und Irrtümer. Wir vergessen mit unserem heutigen Selbst das weniger erfahrene, we niger verbrauchte, vielleicht weniger verdorbene Selbst von einst.
Ich kannte einen Mann, der seiner Frau innerhalb von fünf Jahren drei mal dasselbe Verhältnis zu derselben Geliebten gestand, weil er ver gessen hatte, dass er es ihr schon gestanden hatte. Ich kannte einen Mann, der zu bekennen vergaß, dass er ein Spitzel gewesen war, und auch die Tatsache selbst, dass er also ein ehemaliger Spitzel war, ver gaß er und erklärte im aufrichtigsten Tonfall, dass er nie ein Spitzel gewesen sei, und er war aufrichtig gekränkt, als man ihn an seine Ver gesslichkeit erinnerte.
Ich kannte einen Mann, eine Person des öffentlichen Lebens, der vor großem Publikum feierlich erklärte, dass er noch nie gelogen habe.
14 ungarn / b ipolar
Zum einen hatte er seine Lügen vergessen, zum anderen hatte er auch vergessen, was der Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge ist, und seine Anhänger ermunterte er ebenfalls, diese unbedeutende Distink tion so schnell wie möglich zu vergessen. Meine Frage ist deshalb, was wir denn eigentlich hinsichtlich der verschiedenen Untiefen, Nischen, Sektoren des historischen und kulturellen Gedächtnisses erwarten können? Was wir eigentlich sehen werden, wenn wir uns unserer soge nannten gemeinsamen Vergangenheit zuwenden, unserer netten klei nen rosenfingrigen Vergangenheit?
Meine Damen und Herren, ich bin Schriftsteller, Erzähler. Während der letzten anderthalb Jahrzehnte habe ich historische Romane geschrie ben, schwer lesbare, ernste, dicke Bücher. Jahrelang habe ich in Bibliotheken und Archiven gesessen, um meinen Helden, dem Stoff und den Verhältnissen verlorener Zeiten näher zu kommen. Ich habe geschichtsphilosophische und andere theoretische Arbeiten gelesen, um in bestimmten Grundfragen klarer sehen zu können. Ich habe Historiker und andere Sachkundige konsultiert, zum einen um Daten und Informationen zu erhalten, zum anderen um herauszufinden, ob ich mit meinen immer schwerwiegenderen Zweifeln über unsere klei ne anbetungswürdige Vergangenheit allein bin.
Während des Schreibens habe ich Tagebuch geführt, habe in Essays, Aufsätzen, Rezensionen über auftauchende Fragen und Gedanken Auskunft gegeben, und während ich die Art und Weise des ungarischen historischen Gedächtnisses in den ungarischen Romanen auf merksam verfolgte, habe ich vielleicht auch ein oder zwei wesentliche Züge der ungarischen literarischen Tradition — unserer netten klei nen Tradition richtig wahrgenommen.
Meine Damen und Herren, das Ergebnis der angespannten Arbeit die ser anderthalb Jahrzehnte könnte ich kurzerhand so zusammenfas sen: Nichts werden wir sehen. Oder vorsichtiger und verschwommener formuliert: fast nichts.
Ich behaupte nicht, dass derjenige, der sich auf eine solche Betrachtung einlässt, von vornherein verrückt, blind oder unwissend ist. Im Gegen teil, schon das bloße Vorhaben kann hinsichtlich der Auffassungsgabe, ja der Tugenden des Betreffenden hoffen lassen. Nur ist das Problem ein anderes: dass nämlich die Erfahrungen des historischen oder kul turellen Gedächtnisses keine gemeinsamen Erfahrungen werden kön nen. Jene stellvertretende Rede, die durch die erste Person Plural, das Wörtchen «wir» gekennzeichnet ist, ist durch und durch eine Lüge. Ich könnte es auch so formulieren: Sie ist das Zauberwort der kollektiven Amnesie. Und nur zum Spaß, in Erinnerung an die beängstigenden Wochen des vergangenen Herbstes, füge ich hinzu, dass sich in Ungarn Amnesie und Amnestie noch nie so grundlegend und brutal gegenübergestanden haben wie jetzt. In Ungarn bedeutet heutzutage Amne sie, dass selbst noch innerhalb derselben politischen Richtung, inner halb der sich wie Indianerstämme gebärdenden Gruppen jeder etwas anderes sieht und interpretiert, wenn er sich einer Person oder einem Ereignis der Vergangenheit zuwendet. Amnestie hingegen bedeutet — könnte bedeuten —, was Mihály Babits am Ende des Ersten Weltkriegs so formuliert hat: «Nicht mehr fragen nach der Schuld, lasst uns Blu men pflanzen.» Die Frage nach der Schuld aber ist nach den traumatischen Erfahrungen der letzten hundert Jahre in Ungarn unmöglich geworden, und statt erinnernd einander zu verzeihen, leben wir in einer rachsüchtigen Amnesie, wobei das Wörtchen «wir» hier jeden bedeu ten kann.
Dafür, dass wir uns auch über die persönliche Erinnerung hinaus erin nern, müssten wir zuallererst darüber nachdenken, im Namen welcher Gemeinschaft wir eigentlich das Wort ergreifen können bzw. die stell vertretende Rede vermeiden sollten. Es gibt einen Staat, dieser besteht aus seinen Bürgern. Es gibt eine Sprache, diese hat ihre Sprecher. In dieser Sprache existiert eine Unmenge an Stereotypen, leeren Klischees, gesunkenen Kulturgütern, und all dies steht der Erinnerung im Weg. Versuchen wir zum Beispiel unsere heilige nationale Dichtung, Ferenc Kölcseys Hymne, bei deren grotesker Musik wir geschlossen stillste hen, oder unsere andere heilige nationale Dichtung, Mihály Vörös mártys Mahnruf, bei deren nicht weniger falscher Begleitmusik wir ebenso automatisch stillstehen — versuchen wir also diese beiden großartigen Dichtungen heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, inner halb der Grenzen der EU zu interpretieren! Ich brauche sicher nicht zu sagen, dass die Entstehungsbedingungen der beiden Gedichte zusam men mit ihrem Kontext schon lange in Vergessenheit geraten sind. Ich werde auch niemanden mit der Aufzählung dieser Bedingungen lang weilen. Schauen wir lieber, was diese beiden maßgebenden Dichtungen uns heute, 2007, sagen können. Sagen sie uns überhaupt noch etwas darüber hinaus, dass sie uns jährlich ein paar Mal in Jack-in-the-Boxes, in hochschnellende Schachtelteufel verwandeln?
Ist das «Hier musst in Segen oder Fluch / du leben, sterben hier!» auch heutzutage, wo die Mitglieder bestimmter gesellschaftlicher Schich ten ohne jede Schwierigkeit im Ausland studieren und arbeiten kön nen, noch gültig? Und war es gültig, als im Herbst und Winter 1956 Hunderttausende das Land verließen? Und im Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg, zur Zeit der Auswanderungswelle, war es da gültig? (Und nur in Klammern füge ich hinzu: Wer ist denn der «Ungar», für den der Befehl zu unerschütterlicher Treue gilt und den Petõfi ein paar Jahre später aufspringen lässt? Und für wen gilt er nicht? Allein darü ber nachzudenken ist schon erschreckend. Da ist es doch wesentlich beruhigender, Vörösmártys reimenden Leitartikel selbstvergessen als heilige Schrift zu lesen.)
Und wie soll ich heute, 2007, jene Aussage verstehen, dass Gott über unsere Sünden in Zorn entbrannte? Dass er uns also wegen «unserer» Sünden mit Mongolensturm und Türkenjoch, bzw. dann später ent sprechend mit Trianon, der deutschen und sowjetischen Besatzung schlug? Führt das nicht schließlich und endlich zum Konzept der kol lektiven Verantwortung? Wird dabei nicht die konkrete Verantwor tung der jeweiligen politischen Elite zu sehr auf das Ganze der Gesell schaft ausgedehnt, die natürlich «das Volk» heißen muss? Und kann dieses «Volk» im Geiste dieser kollektiven Verantwortung tatsächlich schon für Vergangenheit und Zukunft, für alle Zeit gebüßt haben? Wie kann man erwarten, dass es in Ungarn ein wirksames kollektives Gedächtnis gibt, das uns das Wissen um die gemeinsame Vergangen heit bewusst und die Gegenwart lebenswert macht, wenn sich histo rische Forschung und politische Sprache, welche letztere sich ständig auf die Geschichte beruft, nicht einmal Guten Tag sagen?
Wie kann man nüchtern und objektiv an einzelne wichtige Ereignisse der ungarischen Geschichte denken, wenn diese Ereignisse Gegen stand eines Kultes sind? Wie kann man in der Geschichte der letzten zweihundert Jahre den tragischen Zusammenstoß der Idee der natio nalen Unabhängigkeit und der Idee der bürgerlichen Entwicklung verfolgen, wenn dieses Wörtchen «national» wie beim Pawlowschen Reflex sofort den aggressiven Nationalismus auf den Plan ruft, das Wort «bürgerlich» wiederum genauso aggressiv und ausschließlich von einer bestimmten politischen Partei besetzt ist? Das kollekti-ve Vergessen schreitet mit überraschender Geschwindigkeit voran. Nicht nur, dass «wir», die Mitglieder einer nicht existierenden Gemeinschaft, die Ereignisse des Jahres 1956 vergessen haben (sie wurden schon während der Konsolidierung unter Kádár unterdrückt und gerieten dabei unbemerkt in Vergessenheit), nein, wir, «wir Ungarn», erinnern uns ja nicht einmal mehr an den Niedergang des Kádárismus, an die seichte Diktatur. Was umso erstaunlicher ist, da wir doch angeblich in ihr gelebt haben und vorläufig weder an Gehirnverkalkung noch an Alzheimer leiden.
Ich als Privatperson kann mich natürlich erinnern. Ich kann mich daran erinnern, was mir guttut. Als Schriftsteller kann ich sogar noch vor geben, ein kollektives Gedächtnis wachzurufen, aus dem ich schöpfe. Aber das ist natürlich nur literarische Fiktion, und wenn sie zusätzlich noch mit einer willkürlichen Struktur des Erzählens einhergeht, dann postmoderne Wurzellosigkeit.
Darüber hinaus habe ich keinen Spielraum, ich stoße an die unsichtbaren und doch harten Mauern des Vergessens. Wenn ich mich vor einer an deren Privatperson darauf berufe, dass die Aufdeckung der jüngsten Vergangenheit kontinuierlich und mit großer Kraftanstrengung vor anschreitet, dass zum Beispiel in Zeitung X oder Zeitschrift Y je eine Artikelserie über dieses Thema erschienen ist, dann kann ich todsicher damit rechnen, dass mich der andere Staatsbürger nur scharf und durchdringend ansieht und verlauten lässt: «Sie lesen also Zeitung X und Zeitschrift Y!». Womit er mir den Rücken kehrt und ausspuckt. So muss man sich heutzutage in Ungarn das Vergessen vorstellen.
Könnte ich mich in meiner Phantasie ein wenig über jene Landschaft erheben, in der mein und «unser» Leben ablaufen, könnte ich meinen Blick auf den breiten Strom der Zeit lenken, müsste ich den ersten Satz dieser Zeilen so ergänzen, dass es gut ist, sich in das Vergessen zu verlieren. Freilich nicht in sein Subjekt als vielmehr in sein Objekt. Einstweilen aber gilt für mich die Aufforderung des Titels.
László Márton, 1959 in Budapest geboren, studierte Hungarologie, Germanistik und Soziologie. 1983 debütierte Márton als Schriftsteller mit einem Band Erzählungen. Von 1983 bis 1990 war er Lektor beim Helikon-Verlag (Budapest), seither ist er freier Schriftsteller und Übersetzer. Übertragungen deutscher Literatur ins Ungarische (u.a. Novalis, Kleist, Goethe). Auszeichnungen: u.a. DAAD -Stipendium in Berlin 1998/99, Belles Lettres-Preis 2001. Auf Deutsch erschien zuletzt die Erzählung Im österreichischen Orient, Edition Thanhäuser 2005. László Márton lebt in Budapest.
1� ungarn / b ipolar



























































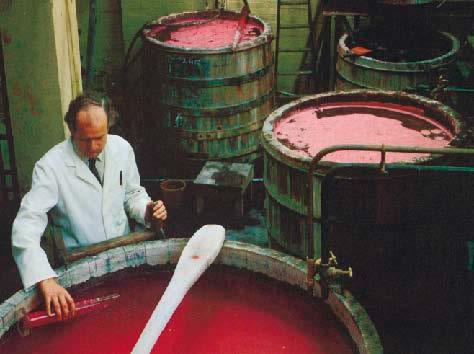




















in sehnsuCht sesshaft
Die Schriftstellerin Judith Kuckart reiste Anfang 2007 nach Pécs, in jene Stadt in Ungarn, die im Jahr 2010 den Titel Kulturhauptstadt Europas tragen wird. Diesen Titel teilt Pécs sich dann mit Essen und dem Ruhrgebiet, die europäische Kulturhauptstadt in Deutsch land 2010. Die Kulturstiftung des Bundes beteiligt sich am deutschen Kulturhauptstadtereignis mit einem großen Projekt zur kulturellen Bildung. Die gut 200.000 Grundschul kinder im Ruhrgebiet bekommen alle die Möglichkeit, im Rahmen des Schulunterrichts ein Musikinstrument unter Anleitung von Lehrer/innen aus den örtlichen Musikschulen zu erlernen. Wir berichteten im Magazin 9 über das Projekt Jedem Kind ein Instrument. Uns hat interessiert, was Judith Kuckart auf ihrer Lesereise nach Ungarn und ihren Besuchen von Schulen in Pécs erlebt hat: Eine sehr persönliche deutsch-ungarische Kulturbegeg nung in Briefen an eine Freundin.
eine Freundin M H. kam vergangenen Sommer zum ersten Mal in ih rem Leben nach Pécs und sagte bei ihrer Rückkehr nach Berlin: Pécs sei eine Stadt, in der man unter Feigenbäumen sitzen, an Sommerabenden im ärmellosen Kleid über die Hauptpiazza — den István Platz — schlendern und sich beim Einfahren in Tiefgaragen oder Buddeln im eigenen Garten nicht über Fundstücke aus spätrömischer Zeit wundern sollte. In Pécs würde sie gern bleiben und ein Kino eröff nen. Es sei viel schöner als Budapest, nicht so feierlich, so künstlich, so leblos und steif. Fahr doch mal hin! In Pécs hat die erste öffentliche Bibliothek Ungarns gestanden. So ist dann alles gekommen. Ein Jahr später fuhr ich wegen der Bücher hin.
Liebe Frau H.,
Pécs, 17. Januar 2007
ich bin im Januar hergekommen, aus Budapest und in roter Skijacke. Morgens um kurz vor Zehn nahm ich den schnellen Zug auf dem äu ßersten Gleis am Keleti/Ostbahnhof. Der Zug fuhr nach Sarajevo, hatte Gardinen an den Fenstern, war überheizt, und der Morgen war grau und unfreundlich wie ein Hauswart. Lange fuhren wir durch Ebenen, bei denen meine Großmutter immer «Puszta Puszta» geru fen und dabei an einen scharfen Salat aus ihrer Jugend gedacht hätte. Nach gut zwei Stunden tauchten am Fenster links die ersten Hügel auf. Südwestungarn, wo Schwaben, Kroaten, Serben und Ungarn zu sammen leben und den Wein von den Südhängen trinken, der inter national bekannt ist. Aber wer weiß schon etwas über ihr friedliches Zusammenleben hier? Nach drei Stunden Fahrt sind wir da. Im Bahn hof Pécs hängen ebenfalls prachtvolle Gardinen an den Schalterfenstern, die geschlossen sind wie Schlösser. Ein junger Mann mit dickem Schal und Fotografen im Schlepptau kommt auf mich zu. Es trifft mich der erste Blitz, bevor ich etwas sagen kann. Herzlich willkom men, sagt der junge Mann, und ich vergesse den Fotografen — für eine Weile wenigstens.
Der Plan für heute steht fest. Wir fahren zuerst ins Gandhi-Gymnasium, ein Internat für Roma-Kinder. Das ist ein ganz berüchtigtes Viertel hier, sagt der junge Mann, während er fährt, und lockert seinen Schal, das ist hier eine ehemalige Bergarbeitersiedlung. Meszes, sagt er. Wie bitte, frage ich. Meszes heißt sie, wiederholt er. Viele gehen gar nicht und manche gehen hier im Dunkeln nicht hin, sagt er, aber Pécs hat einiges und schon Schlimmeres ausgehalten als Meszes. Von Außen sieht hier alles ganz friedlich aus, sagt der junge Mann mit dem Schal und zeigt auf unauffällige, nicht schöne zweistöckige Häuser in Rei hen am Straßenrand von Meszes, aber wie gesagt, wenn es dunkel wird... Schon klar, Meszes, wiederhole ich und vergesse den Namen gleich wieder. Diese ungarische Sprache will nicht in mein Hirn. Dieses Land Ungarn funktioniert bei mir nur über Erinnerung, aber nicht über mein Gedächtnis.
Vor dem Roma-Gymnasium werden wir begrüßt von einer großen, blas sen Frau, die Englisch mit mir spricht und die Frau des tödlich verunglückten Direktors des Gandhi-Gymnasiums ist. Es war ein Auto unfall, der Mann war zweiundvierzig. Der Mann war die Schule, so kommt es mir vor, wenn ich die anderen hier von ihm sprechen höre. Er war Roma, seine Frau ist Ungarin, sie haben vier Söhne, die besu chen die deutsche Schule. Dann begrüßen uns zwei ehemalige Schüler, jetzt Lehrer für Deutsch. Deutsch ist die erste Fremdsprache im Gan dhi-Gymnasium. Der eine, József (Joka) Orsós, ist groß und hat einen breiten Schädel, der andere Lakatos Csaba, ist kleiner als die meisten Schüler, die im Flur an uns vorbei laufen. Der dritte Deutschlehrer heißt Attila, ist nicht Roma, sondern Ungar. Er hat blaue Augen. Sichtlich begeistert von unserem Besuch ist nur eine energische ältere Dame mit vielen harten, roten Haaren auf dem Kopf, die Karin heißt, aber dem Nachnamen nach einmal einen Ungarn geheiratet haben muss. Sie sei hier die Großmutter von allen, sagt sie, und gibt ihr Alter mit 120 Jahren an. Niemand widerspricht. Ich auch nicht, denn ich glaube, dass ihr noch nie jemand widersprochen hat. Auch der junge Mann mit dem Schal ist jetzt still und nimmt sich eine Flasche Mine ralwasser.
Was ist das, frage ich, als wir in der Bibliothek der Schule stehen, die of fensichtlich keine heilige Halle ist, sondern nur unter anderem Biblio thek, ansonsten auch Aufenthaltsraum und Computerraum. Ich zei ge auf eine Leiter, die mitten im Raum nach oben führt zu einer Luke. Da unter dem Dach lernt die letzte Klasse für das Abitur, das ist deren Klausur, sagt Großmutter Karin.
Neben der Leiter zur «Klausur» steht ein Regal mit Roma-Literatur. Es gibt zwei Sprachen bei den Roma, eine ältere und eine neuere. Lovari und Baesch. Verbindlich für alle Roma ist die ältere. Richtig geschrie bene Romane gibt es aber bei uns nicht, sagt der kleine Lehrer Csaba, aber Märchen. Zärtlich nimmt er ein blaues Buch aus dem Regal und liest mir einige Zeilen vor.
Das klingt wie, wie...? frage ich. Er lächelt. Und die Dialekte, sagt er, die unterscheiden sich bei uns nach dem Handwerk. Die Fischer sprechen den Dialekt der Fische, die Zeltbauer den der Zelte, die Pferdehändler den der Pferde. Und jetzt machen wir einen Rundgang durch die Schule, sagt er im Ton eines Lehrers.
Theatersaal/schwarz, Werkraum/hell mit Drehbänken aus Dänemark, Kunstraum mit Wandgemälden, vollgestopfter Regal-Raum, in dem es nach Räucherstäbchen und Ölfarben riecht. Jemand gibt mir eine sehr schöne, hohe Schale, die die Kinder gemacht haben. In der Scha le liegt ein Zettel: Auf dem Zettel steht «Geschenk».
Schnell kriege ich mit: Jungen dürfen nicht in den Mädchentrakt, we gen der Unterwäsche, die herumliegen könnte. Die Schüler sitzen gern auf dem Boden, das sind sie so gewöhnt. Das tun sie zu Hause auch, in den Zimmern, in denen Betten, Fernseher und Musikanlage stehen, aber selten Stühle und Tische. Was ich nicht sofort sehe, wird mir auf dem Rundgang erzählt: Roma-Frauen sterben früh. Viele Kinder wachsen ohne Mütter auf. Häufige Todesursachen sind: Lun ge und Herz, bei den Männern ist es oft der Rücken, wegen der Arbeit im Wald ohne Geräte. In einer Klasse sind zwölf Kinder ohne Mutter, ein hübscher Junge mit den goldenen Turnschuhen ist Vollwaise, das Mädchen mit dem Haarband neben ihm am runden Tisch, wo sie Deutsch lernen für das Abitur, hat vor kurzem erst bemerkt, dass es noch zwei Geschwister hat anderswo. Und das Mädchen mit den lan gen langen Haaren und den Ellenbogen auf dem Wörterbuch ist total ihren Stimmungen unterworfen, sagt Großmutter Karin, weil sie vor einem halben Jahr dabei war, als der Vater die Mutter erstach. Ach, sage ich. Der Fotograf blitzt. Die Kinder tanzen gern und musizieren viel, sagt die Großmutter. Ach, sage ich, der Fotograf blitzt die Groß mutter, was mir nur recht ist. Ach der Tod, sagt die Großmutter, und ich sehe, sie mag diese frühreifen, dunklen, anlehnungsbedürftigen Kinder sehr, die sesshaft zu sein scheinen in einer Sehnsucht, die wir nicht kennen.
Nachmittags sind wir im Lenau-Haus, wo es drei nette Menschen im Bü ro, ein Zimmer für mich unter dem Dach für die Nacht und auf dem Weg zu diesem Zimmer Scharen von Puppen in Trachten gibt, die stumm und mit ausgebreiteten Armen auf den Schränken stehen, als hätten sie eine Erscheinung, weil wir vorbeigehen. Nachtblau ist die Farbe, die hier vorherrscht in den Stoffen. Dieses spezielle Nachtblau ist die Farbe, die die Deutschen nach Ungarn mitbrachten und so ihre Gardinen und Decken und vielleicht auch ihre Bettwäsche einfärbten. Das würde ich gern meiner Tochter erzählen, das mit den Puppen, sage ich, wo gibt es denn hier ein Telefon? Der freundliche Mann aus dem Büro erklärt mir, wo es hier einmal ein Telefon gab, im ersten Stock, zwischen Tür 3 und Tür 4, ein Telefon, das es schon längst nicht mehr gibt. Aber es steht mir so deutlich vor Augen nach seiner langen Er klärung, als wäre es noch da. Ich ziehe einen Rock an, in meinem Zim mer unter dem Dach, denn wir gehen in die Komitatsbibliothek zu meiner Lesung, die einer der Gründe ist, warum ich hergereist bin mit dem Auftrag, Menschen und Bücher zusammen zu bringen. Wir ge hen auf dem Weg in die Bibliothek an dem Dom vorbei, der fast aus sieht wie der Dom von Speyer. Dort wohnt der Bischof Meier, ein Ungarndeutscher, der neulich, so sagt der junge Mann, einen Antrag der Eltern des katholischen Gymnasiums auf eine Turnhalle ablehnte. Katholiken brauchen keinen Sport! Aber ich brauche ein paar Ohr stöpsel für die Nacht, sage ich. In einer Apotheke mit sieben sehr trä gen Damen in Weiß warte ich eine Viertelstunde, bis ich meine Stöpsel habe. Fast kommen wir zu spät zu meiner Lesung, und der Fotograf ist immer dabei und macht Fotos von unserer Eile.
Meine Lesung findet in der Komitatsbibliothek Gyozo-Czorba statt. Die Leiterin ist eine eigenartige Person, die offensichtlich ein Gespür für Schnee hat, so stelle ich es mir wenigstens beim Anblick ihres Ge sichts vor. Wir sitzen in einer pompösen Sitzgarnitur mit Biedermei ermuster in ihrem Büro, die so feierlich ist wie die Emails, die sie mir auf Deutsch schickte, als sie mich nach Pécs in ihre Bibliothek einlud. Jetzt, wo sie mich endlich sieht, findet sie mich hübsch. Sagt sie auf Ungarisch, und der Fotograf hebt erstaunt seinen Apparat, denn das ist ihm noch nicht aufgefallen.
M 26 ungarn / b ipolar
von judith ku C k art
Das Publikum ist zahlreich und sehr jung. Zum Glück liest eine hüb sche blonde Judith aus Weimar die Kurzgeschichte von mir, Judith aus Zürich, in ungarischer Übersetzung vor und liest so, dass ich alles verstehe, obwohl ich kein Wort Ungarisch kann. Sie ist sehr schick, trägt braune Netzstrümpfe, hat einen langen Hals und ein schönes Dekolleté, das beim Lesen sehr hell aussieht. Die Moderation macht der junge Mann mit Schal, und das macht er sehr gut, ausnahmsweise ohne Schal im überheizten Raum, vor einer schweren Bücherwand, zwischen Grünpflanzen und Möbeln, die ich aus dem Land kenne, das einmal die DDR war. Irgendwann fällt mein Blick während der Veranstaltung auf ein ausgestelltes Buch mit Marlon Brando auf dem Cover. Offensichtlich eine Biografie auf Ungarisch. Was machst du denn hier, denke ich erfreut und zerstreut, während mich eine kluge, junge Frau von der Universität Pécs, Fachbereich Deutsche Literatur, nach Mittelbarkeit und Unmittelbarkeit in meinem Text fragt. Mit dem gleichen Gesicht, mit dem ich Brando anlächelte, lächle ich sie an, denn mir fällt keine kluge Antwort ein. Ein älterer Herr hilft mir aus der Verlegenheit: In Ungarn, sagt er, heißt ein Dichter nicht «Dichter», sondern übersetzt «Grübler». Da, sage ich, da haben wir den Unterschied zwischen Ungarn und Deutschen. In Ungarn hat Schreiben weniger mit Verdichten zu tun, sondern ist ein Brüten und verwandter also dem Akt des Sich-drauf-Setzens und Wärme-Abge bens? Er nickt. Richtig, sagt er, und nach der Lesung am Tischchen mit dem Wein, wo uns die Bibliotheksleiterin die Gläser hinstreckt und noch immer dieses Gespür für Schnee im Gesicht hat, fragt er mich, ob ich mich nicht, wenn ich wieder in Berlin sei, um seine schö ne Tochter kümmern könne? Sie sei dort sehr allein und wolle Schau spielerin werden. Ungarische Eltern begleiten ihre Kinder bis ins Grab, hat meine Freundin Márta Nagy aus Budapest einmal gesagt.
Den Abend beschließen wir im Café Dante nah dem Palais, wo Bischof Meier, der etwas gegen Sport hat, nah den Katakomben wohnt. Sie erinnern sich, liebe Frau H.? An Bischof Meier aus Fünfkirchen, mei ne ich? Das Café Dante ist ein stolzer Raum, der mich an alte Bahn hofswartehallen erinnert. Mir kommt in den Kopf, was Wartehalle auf Französisch heißt. «Salle des pas perdus», Saal der verlorenen Schritte. Der junge Mann mit dem Schal hat noch tausend Infos zur Stadt, er spricht über die Augustinuskirche mit den Fenstern einer früheren Moschee, über das Pécser Nationaltheater im Elefantenhaus, das wir noch nicht gesehen haben, über das Puppentheater Bóbita und das Kroatische Theater, das wir auch noch nicht gesehen haben, er spricht über einen frühchristlichen Friedhof, der auf der Liste des Weltkulturerbes steht, und den wir unbedingt noch sehen müssen, er trinkt keinen Alkohol und ich merke, ich werde mir all dies nicht mer ken können. Bevor ich unzufrieden werde mit mir, erinnere ich mich daran, was Uwe Johnson einmal gesagt hat: Die Information ist die Feindin der Erinnerung.
Ich grüße Sie herzlich, Ihre JK
Pécs, Donnerstag,18. Januar 2007 Liebe Frau H.,
Attila, der Deutschlehrer mit den blauen Augen vom Gandhi-Gymnasi um, ist nicht unser bester Anwalt, als wir am frühen Morgen die Abi turklasse fragen, wie es aussieht mit einer Theaterwerkstatt in deut scher Sprache. Er scheint nicht an das Gelingen eines solchen Unter nehmens zu glauben. Bekommen wir dafür schulfrei, fragt der Junge mit den goldenen Turnschuhen. Machen wir dann auch was mit Tanz, fragt ein Mädchen neben ihm und streckt die Beine aus. Ich glaube, sie haben Angst, dass das, was ich machen will, irgendetwas mit den di cken deutschen Wörterbüchern zu tun hat, die vor ihnen liegen und in denen sie erst vor kurzem zu suchen gelernt haben. Anfangs, sagt Großmutter Karin, haben sie auf der ersten Seite zu lesen begonnen, wenn sie ein Wort wie «Zange» oder «Zorn» gesucht haben.
Im Valerie-Koch-Gymnasium, der deutschen Schule, ist der «Antritts besuch», der auf eine Schreiberwerkstatt bei meinem zweiten Besuch im April hinauslaufen soll, einfacher. Der Direktor erwartet uns per sönlich an der Tür, und man hat das Gefühl, schon Verdienste errun-
gen zu haben, nur weil er uns so ehrenvoll grüßt. 120 Schüler sitzen in einem Saal, der sich mit einer rosa Gardine vom Flur abtrennen lässt. Keine Lesung, denke ich, bloß hier keine Lesung jetzt machen, und während ich das noch denke, höre ich mich schon fragen, ob sie, die Schüler, einmal aus Pécs weggehen wollen? Ja, einige nicken. Warum? Warum bleiben? sagt ein Junge. Ich will aber hier bleiben, sagt ein dickliches Mädchen und hat die Hand auf dem Oberschenkel des Jungen neben ihr, ich will hier bleiben, ich bin hier geboren, ich gehöre hierher. Und wenn Ihr morgen Euch ein Reiseziel aussuchen könntet, was würdet Ihr aussuchen? frage ich. NY, Japan, Stuttgart, Mallorca stehen im Raum. Und Berlin, sagt ein Junge mit abstehenden Haaren, wegen der Kultur. Welche Kultur? frage ich. Na, die Mauer, sagt er. Aber als die Mauer wegkam, da waren Sie doch noch gar nicht gebo ren, sage ich. Stimmt, sagt er, trotzdem.
Eine Stunde später. Eine Dame, die wie eine adrette Sowjetfrau aussieht, sitzt vor einem Kuchen, den sie nicht anrührt, und nickt bei meinen Vorschlägen, was ich bei meinem nächsten Besuch an der Universität im Fachbereich Deutsche Literatur machen könnte. Entscheiden aber wird der oberste Lehrstuhl, und das ist ein kleiner, etwas zerstreuter Mann mit einem großen Lachen, der schließlich auch den Kuchen der Sowjetfrau isst. Schreibwerkstatt? frage ich. Oder Textanalyse einer meiner Erzählungen unter Anleitung der jungen Professorin, die mir schon bei meiner Lesung gestern in der Komitatsbibliothek Eindruck machte? Oder Thomas Mann-Vortrag? Raten Sie, liebe Frau H., was ausgesucht wurde. Richtig, Thomas Mann. Der oberste Lehrstuhl, undurchsichtig wie Napoleon, verneigte sich vor mir und sagt: Tho mas Mann, aber nur an einem Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag.
Wir hasten weiter, der junge Mann und ich, zum Haus der Jugend, denn dort treten Tanz- und Musikgruppen aller Schulen von Pécs auf, und auch die vom Gandhi-Gymnasium. Wir kommen zu spät, sie tanzen schon. Die Mädchen auf hohen Absätzen unter ihren langen Röcken, sie tanzen mit schnellen kleinen Schritten, und die Arme wehen leicht von den angewinkelten Ellenbogen an aufwärts im roten Scheinwer ferlicht. Anmut, liebe Frau H., besser könnte es auch Kleist nicht sa gen. Die Füße bestimmen den Tanz, Torso und Gliedmaßen folgen. Ich denke daran, was Großmutter Karin gestern zu mir sagte: Die Mädchen sind sehr früh reif, werden schwanger, es gibt manchmal heimliche Abtreibungen, von denen nur die Mutter, aber nicht der Va ter etwas weiß. Wir haben deswegen die Briefkastenschule eingerich tet, wo Mädchen ihre Prüfungen von zu Hause aus machen, während sie gleichzeitig das Baby versorgen. Dann kommt die Gitarrengruppe vom Gandhi-Gymnasium, von sechs fehlen fünf, so können sie leider nicht auftreten, sagt die Ansagerin und zieht vorwurfsvoll an ihrem kurzen Tigerkleid. Aber da kommt noch ein zweiter Junge zu dem ei nen hinzu, und sie spielen doch, spielen für eine der dicken Mütter, die mit Kopftüchern vor uns sitzen und zwei Plätze einnehmen, einen für sich und einen für den abwesenden Vater.
Nach einer Stunde springen wir wieder ins Auto und fahren nach Skeks zárd. Auf der Hinfahrt hatten der junge Mann und ich Zigeunermu sik im Auto gehört und Gespräche über ungarische Kultur geführt. Auf der Rückfahrt hören wir Velvet Underground und sprechen über Berlin, die Volksbühne und den berühmten Jürgen Kuttner. Wir spra chen also über — Heimat? Gegen 22 00 Uhr, während draußen noch immer Sturm ist, bin ich wieder in Pécs, wieder im Café Dante und mit einem kleinen Bier allein. Gegen 22 25 Uhr tritt Windstille ein, und McDonald’s neben dem Rathaus am Hauptplatz, nah beim aus fahrbaren Glockenturm der Basilika, schließt. Wenn Pécs Kultur hauptstadt wird in drei Jahren, wird all das anders sein? Was hat der junge Mann noch gesagt, am Mittag, als wir zwischen den Terminen so müde bei einem Kaffee saßen zwischen lauter deutschen Medizin studenten, die in Pécs das Studium mit dem Geld ihrer Eltern been den? Wo sollen bis 2010 die nötigen Hotels herkommen, und wohin mit all den Hotels, danach? hat er gesagt und besorgt seinen Schal fes ter gezogen. Ich schlafe im Lenau-Haus bei den bösen Puppen.
Gute Nacht, Ihre JK
Judith Kuckart, geboren 1959 im Ruhrgebiet, lebt als Schriftstellerin und Regisseurin in Zürich und Berlin. Ihr jüngster Roman Kaiserstraße erschien im Frühjahr 2006 bei DuMont. Im Herbst 2008 kommt ebenfalls dort ein Kriminalroman von ihr heraus. 27
ungarn / b ipolar
kafka in frankenstein
Franz Kafka ist zu einer Art Ikone der wechselvollen historischen Kulturbeziehungen zwischen Deutschen und Tschechen geworden. Wer meint, über Kafka sei doch das meiste schon erforscht und erzählt, und alles andere sei nur noch eine Ange legenheit unter Philologen, dem liefert der Artikel von Ekkehard W. Haring neue Einsichten: Auch in der Geschichte der Heilstätte Frankenstein unweit der deutsch-tschechischen Grenze hat Kafka Spuren gelegt, und umgekehrt hat Franken stein einen Abdruck in seinem Werk hinterlassen. Im Jahr 2008 jährt sich der 125. Geburtstag Franz Kafkas, dessen Ruf als einer der herausragenden Schriftsteller der europäischen Moderne von der wechselvollen Geschichte der deutschtschechischen Kulturbeziehungen letztlich unbeschadet blieb. Die Kulturstiftung des Bundes setzt in den kommenden drei Jahren (2007 2009) mit dem Programm Deutsch Tschechische Kulturbegegnungen die bilateralen Kulturprojekte fort, die mit Polen (Büro Kopernikus) und Ungarn (Bipolar) begannen.
von ekkehard w. h aring d
as Sanatorium Frankenstein (Podháji) bei Rumburg, dessen Gründung sich gerade zum 100sten Male jährte, ist ein Schauplatz, an dem sich die Lokal- und Regionalgeschichte Nordböhmens mit den großen historischen Linien des vergangenen Jahrhunderts kreuzt: mit der po litischen Geschichte und dem bewegten Verhältnis zwischen Tsche chen und Deutschen ebenso wie mit der Medizingeschichte und sogar mit der Literaturgeschichte. Bereits vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges hatte sich die Heilanstalt des Großindustriellen Carl Dit trich aus dem benachbarten Schönlinde (Krásná Lípa) einen interna tionalen Ruf als physikalisch-diätetische Heilanstalt erworben. Das Spektrum der ‹Heilbehelfe› erstreckte sich von traditionellen Anwen dungen bis hin zu den damals neuen und verheißungsvollen Verfah ren wie der Elektrotherapie. Letzteres mag, neben dem finanziellen Engagement Dittrichs, der Grund dafür gewesen sein, dass sich im Verlaufe des Weltkriegs aus dem privaten Kurbetrieb eine staatliche Anstalt mit ‹nationalem Auftrag› bilden konnte. Als die 1915 in Prag eingerichtete Staatliche Landeszentrale für das Königreich Böhmen zur Fürsorge für heimkehrende Krieger eine geeignete Einrichtung für die Behandlung der seit Kriegsbeginn zahlreich von der Front heim kehrenden ‹Kriegsneurotiker› suchte, fiel die Wahl nach einer sorgfältigen Suche schließlich auf das Sanatorium in Frankenstein. Zum Zeitpunkt der Umwandlung des Sanatoriums in eine Volksnervenheilanstalt im Frühjahr 1917 war eine solche Einrichtung freilich nicht mehr eigentlich als staatliche, sondern nur noch als nationale, als Deutsche Volksnervenheilanstalt für das Königreich Böhmen realisier bar.
Eine wichtige Rolle bei der Einrichtung der Anstalt und ihres Träger vereins spielte ein Dichter, dessen Werk sich, ähnlich wie die Nerven, nur mit einigem politischen Aufwand national identifizieren lässt: Franz Kafka, dessen Prager Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt (AUVA) die Trägerin der Staatlichen Landeszentrale war, hatte dort zusammen mit seinem Vorgesetzten Eugen Pfohl die Verantwortung für das Projekt ‹Volksnervenheilanstalt› übernommen. Kafka, der bereits im Sommer 1915 als Patient und möglicherweise sogar als ‹Testinsasse› einen Aufenthalt in Frankenstein verbracht hatte, war nicht nur nachweislich an den Sitzungen des Komitees zur Auswahl einer geeigneten Einrichtung beteiligt; er schrieb auch neben dem Grün dungsaufruf für den Trägerverein eine Reihe von Zeitungsartikeln und -aufrufen, in denen er um politische und finanzielle Unterstüt zung für das Projekt warb. Zwischen diesen Texten und seinem dich terischen Werk lassen sich eine Reihe aufschlussreicher Verbindungs linien ziehen.
Das Sanatorium als literarischer Ort
Denkt man an die Sanatorien Thomas Manns, Rainer Maria Rilkes, Hermann Hesses, Robert Musils, Arthur Schnitzlers, so scheint es fast, als hätte die klassische Moderne der deutschsprachigen Litera tur eine Affinität zu inszenierten dichterischen Auftritten in Heilan stalten. Solche Orte, als Topoi der Krisis, übten auf Schriftsteller des 20. Jahrhunderts eine geradezu verführerische Macht aus, über ihre destabilisierenden Welterfahrungen zu reflektieren. Dieser Umstand ist kaum verwunderlich, sieht man in dem Sanatorium einen jener vielbesuchten Grenzorte, die für die Gesellschaft um 1900 in der Grauzo ne zwischen Genie und Wahnsinn, Anerkennung und Selbstverlust, Vergesellschaftung und Isolation, Normalität und Ausnahme, kurz: zwischen Heil und Unheil lagen. Die ausdauernde Beschäftigung mit Nerven, auch die komfortable Verrückung der Alltagswelt in die ge schlossene Gesellschaft von Höhensanatorien waren nicht immer frei von artifiziellem Kalkül. Wenn es, wie Nietzsche behauptet hatte, tatsächlich eine veritable geistige Krankheit dieses Zeitalters gab, dann war das Sanatorium nicht nur ihr vorrangiger Schauplatz, son dern auch ihre erste Bühne. Dabei sollte freilich eines nicht übersehen werden: Manche Schriftsteller zogen mit ihren literarischen Figuren gleich, insofern sie selbst der Behandlung in Sanatorien bedurften.
Für Franz Kafka bildeten Heil- und Kuranstalten bereits seit 1903 einen besonderen Fluchtpunkt innerhalb seiner Bemühungen um leib-see lische Regeneration. Hier wurde — wenn auch nur temporär — der Rahmen für eine alternative Lebensweise geboten, den Kafka wie so viele seiner Zeitgenossen als vielversprechend und stabilisierend emp fand. Fast alljährlich suchte er Sanatorien auf, um vom nervenaufrei benden städtischen Leben Prags Abstand zu gewinnen, nicht zuletzt,
um seine nervösen Leiden, die Neurasthenie, zu kurieren. Bis in die Jahre des ersten Weltkrieges bzw. vor Ausbruch seiner Lungentuber kulose 1917 besuchte er eine beachtliche Anzahl an Kuranlagen und Sanatorien. Verfolgt man diese biografischen Stationen genauer, so fällt auf, dass Kafka hier keineswegs nur als Patient in Erscheinung trat. Oftmals strebte er an diesen Orten vor allem günstigere Schreib bedingungen an. Gerade von den frühen sanatorischen Aufenthalten gingen Aktivitäten und Impulse aus, die für sein Leben und Schreiben von nachhaltiger Bedeutung waren. Das bekannte Hydrotherapeutische Sanatorium Zuckmantel (Schlesien), wo er seine erste intensive Beziehung zu einer reiferen Frau durchlebte, besuchte er gleich zwei mal (1905 und 1906). Die Eindrücke dieses Arrangements fließen er zählerisch in die Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande ein. Ähnlich erlebnisreich erging es Kafka 1913 in der Wasserheilanstalt (Riva). Hier freilich wurde er zugleich auch Zeuge am Selbstmord seines Tischnachbarn — eine Episode, die im Jäger Gracchus literarische Verarbeitung fand. In Adolf Justs Musteranstalt für reines Naturleben Jungborn (Harz) traf er 1912 auf eine Kurgemeinde, die jenseits der Städte und Metropolen, im Bewusstsein einer täglich heilspendenden Naturbühne — mit Lufthütten, Nacktkultur, Lehmpackungen, Son nenbädern, vegetarischer Kost, Chorsingen und nächtlichen Mondspaziergängen — auf ihr nacktes, erdverbundenes Dasein verpflichtet wurde und darin die Utopie einer archaischen Gesellschaft lebte. Für den Schriftsteller Kafka, der an einer neuen Fassung seines Amerika Romans schrieb, drängte sich angesichts solcher Darbietungen die Inspiration zum Naturtheater von Oklahoma buchstäblich auf. Wie in Jungborn, Riva und Zuckmantel sammelte Kafka auch in Lahmanns Naturheilsanatorium Dresden Weißer Hirsch (1903) und in der Natur heilanstalt Fellenberg bei Zürich (1911) reichhaltige Eindrücke. Liest man seine Berichte und Notizen zu Sanatorienerlebnissen, so ist es immer wieder erstaunlich, dass seine gewohnte distanzierte Betrach tungsweise an diesen Orten bereits durch den Fakt der aktiven Teilha be aufgehoben wird. Kafka war keineswegs nur ein skeptischer Beob achter der Kur-Szene, sondern ganz offensichtlich auch ein Anhänger natürlicher Heilverfahren, wie sie in den oben genannten Sanatorien praktiziert wurden.
Naturheilverfahren
In allen diesen Kuranstalten wurden naturheilkundliche Lebenskonzepte befolgt und umgesetzt. Über die — mitunter eigenwillig ambitio nierten — Profile der Anstalten informierten Kataloge, jährlich her ausgegebene Sanatorienführer halfen Rat suchenden Interessenten bei der Recherche nach dem geeigneten Kuraufenthalt. Der Besucher fand so, je nach seinen finanziellen Möglichkeiten, ein mehr oder weniger breites Spektrum an therapeutischen Angeboten vor: Lichttherapien, Wasserkuren, Elektro-Faradisation, Hydro-elektrische Bäder, fleischlose Kost, Heilgymnastik und nicht selten auch Hypnosen und Psychotherapien. Ein Programm, das von Anhängern wie Kafka in einigen Punkten mit unerbittlicher Selbstdisziplin umge setzt wurde und durch individuelle Exerzitien noch ergänzt werden konnte — in diesem Falle: «Fletschern» (sehr gründliches, verdau ungsförderndes Kauen von Nahrung nach Anweisungen des amerikanischen Gesundheitsapostels Horace Fletcher), «Müllern» (spezielle Turnübungen nach dem dänischen Arzt Jens Peder Müller), Rudern, Schwimmen, Reiten, Wandern, sowie das Tragen atmungak tiver, luftiger Bekleidung. Angeregt durch seinen Onkel, den Land arzt Siegfried Löwy — einem Freiluftfanatiker aus Triesch —, hatte Kafka schon früh begonnen, sich für alternative Lebensweisen zu in teressieren. Seine Erfahrungen auf diesem Gebiet sammelte er suk zessive auf Kuraufenthalten. Nicht selten waren es auch Vorträge, Lektüren oder Begegnungen, die ihre Wirkung taten. So hatte Kafka gelegentlich einer Dienstreise nach Warnsdorf 1911 den Industriellen und Naturheilkundigen Moriz Schnitzer kennen gelernt, den er als Autorität in Sachen Lebensreform und Vegetarismus und nicht zu letzt als eingeschworenen Gegner von Arznei und Impfbehandlung schätzte. Begeistert von dieser Begegnung berichtete er seinem Freund Max Brod, der am 4./5. Mai 1911 sichtlich irritiert in seinem Tagebuch vermerkt: «… Kafka erzählt sehr hübsche Dinge von der Gartenstadt Warnsdorf, einem ‹Zauberer›, Naturheilmenschen, reichen Fabrikan ten, der ihn untersucht, nur den Hals im Profil und von vorn, dann von Giften im Rückenmark und fast schon im Gehirn spricht, die in
28 ts C he C hien / k afka
Als ein Sonderprojekt im Rahmen der Deutsch Tschechischen Kulturbegegnungen er hält die von Roland Reuß und Peter Staengle in Zusammenarbeit mit dem Stroemfeld Verlag herausgegebene Historisch-kritische Ausgabe sämtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte Franz Kafkas eine Förderung durch die Kulturstiftung des Bundes.
folge verkehrter Lebensweise entstanden seien. Als Heilmittel emp fiehlt er: bei offenem Fenster schlafen, Sonnenbad, Gartenarbeit, Tä tigkeit in einem Naturheil-Verein und Abonnement der von diesem Verein, respektive dem Fabrikanten selbst, herausgegebenen Zeit schrift. Spricht gegen Ärzte, Medizinen, Impfen. Erklärt die Bibel ve getarisch: Moses führt die Juden durch die Wüste, damit sie in vierzig Jahren Vegetarianer werden.» (Max Brod: Über Kafka. Frankfurt a. M., Ausg.1991, 97f.) Trotz dieser eigenwilligen Empfehlungen und Ausle gungen erhielt sich die Bewunderung für den «Zauberer» aus Warns dorf über lange Jahre. «Hätte ich doch die Kraft», heißt es im Tage buch März 1912, «einen Naturheilverein zu gründen» (Tagebuch 5 3 1912). Noch 1917, als seine Schwester Ottla eine landwirtschaftliche Ausbildung anstrebte, wandte sich Kafka Rat suchend an Schnitzer (der freilich die Antwort schuldig blieb).
Moriz Schnitzer, der charismatische Gründer des Vereins der Naturheil kunde und Herausgeber des Reformblattes für Gesundheitspflege, war es auch, der bereits 1896 die Idee einer Naturheilanstalt in Nordböh men angeregt hatte. Problematisch war die Verwirklichung der Idee insofern, da sich von Seiten der Schulmedizin ein großes Ressenti ment, teilweise sogar massiver Widerstand regte. Die Sorge, dass der artige Heilanstalten den Arztpraxen ein nicht unerhebliches Kontin gent an Patienten abführen würde, war nicht unberechtigt. Überall im Lande schossen Sanatorien wie Pilze aus dem Boden und fanden regen Zuspruch. Die böhmische Ärzteschaft brachte dazu, ganz in aufklärerischer Tradition, ein eigenes Anti-Reformblatt heraus — die Zeitschrift Der Gesundheitslehrer.
Schnitzers Konzeption einer Heilanstalt auf der Basis «neuester Heil methoden» wurde schließlich im benachbarten Rumburg durch ein eigens gegründetes Consortium zur Erbauung des Sanatoriums Fran kenstein in die Tat umgesetzt. Bei der feierlichen Eröffnung 1901 ver fügte das Sanatorium über eine beachtliche Grundausstattung aus Bade- und Packräumen, Inhalatorium, Zandersaal mit heilgymnasti schen Apparaten, elektrischen Lichtbädern sowie Sonnen- und Koh lensäurebad. Von Anfang an war die Anlage vor allem für Patienten mit nervösen Leiden konzipiert. Deren Zulauf wurde allerdings erst durch den Ausbau weiterer Spezialbehelfe und räumlicher Verbesse rungen gesichert, denn neben den heiltherapeutischen Einrichtungen bedurfte es vor allem eines ansprechenden Ambientes. Wie in vielen anderen Heilstätten war auch hier das Gesamtkonzept entscheidend: Gewiss stellte das Sanatorium einen Ort alternativer therapeutischer Praxis dar, doch es bildete stets auch einen Brennpunkt gesellschaft lichen Lebens; soziale, politische, ästhetische und kulturelle Ansprü che der zahlenden Klientel erforderten weit mehr als nur den spartanischen Funktionalismus einer Krankenstation. So entstanden neben den neuen Behandlungsräumen mit modernsten Apparaten des Lichtheilverfahrens selbstverständlich auch eine weitläufige Parkan lage, Gartenvilla, Speiseveranda, Bibliothek und Wandelhalle. 1905 wurde das Sanatorium Frankenstein mit dem K K. Staatspreis als «besteingerichtete Anstalt Böhmens» und 1906 «für die Einführung neuer Heilmethoden» mit dem goldenen Ausstellungspreis ausge zeichnet. Ein Musterbetrieb war binnen weniger Jahre entstanden: Man rühmte sich einer «Physikalisch-diätischen Kuranstalt ersten Ranges» und warb seine Gäste mit vergleichsweise «mäßigen Preisen». Hinsichtlich der Idee reiner Naturbehelfe und -verfahren musste aber auch Frankenstein unter dem Druck der Konkurrenz anderer Sana torien von seinem ursprünglichen Credo abgehen. Die breite Vielfalt technischer Apparaturen und neuester Therapieformen sorgte letzt lich für ein eher verschwommenes Profil in der weiträumig ausdiffe renzierten Heilstätten-Landschaft. Wirtschaftliche Aspekte — ganz jähriger oder eingeschränkter (Sommer)Betrieb, preiswerte Breit bandtherapien oder teure Spezialbehandlungen, Personalfragen, Pa tientenprofile, Dienstleistungen usw. — mussten sorgfältig kalkuliert werden, um ein florierendes Unternehmen zu führen.
Während des 1. Weltkrieges und den damit verbundenen einschneidenden Veränderungen, mussten sich auch die Kureinrichtungen umstel len. Unter den Bedingungen des Krieges rückten die zivilen Bedürf nisse nach naturorientierten Neurastheniker-Kuren in den Hinter grund — zugunsten anderer nervenpolitischer Optionen. Personal mangel, Patientenarmut, Lebensmittelknappheit taten ein Übriges.
Bald schon wurden Sanatorienbetriebe zu Schleuderpreisen verkauft oder geschlossen, denn es war abzusehen, dass sich der allgemeine Notstand auf lange Sicht halten würde. Vermutlich hätte auch Fran kenstein ein solches Schicksal gedroht, wäre nicht die Prager AUVA beauftragt worden, für eine geeignete Pflegeanstalt der in Scharen von der Front heimkehrenden Kriegszitterer zu sorgen.
Als Kafka 1915 zum ersten Mal die Anstalt Frankenstein betrat, fand er eine gut ausgerüstete, aber insgesamt ernüchternde Heilstätte vor, die nur noch äußerlich an ihre besseren Zeiten erinnerte. Dies vor Augen schreibt er seiner Entlobten Felice Bauer: «Sanatorien gibt es in Böh men keine guten, das beste in Rumburg ist noch schlecht genug.» (Brief an Felice Bauer, 31 5 1916) Der Einschätzung der Staatlichen Landeszentrale nach, erfüllte die Anstalt freilich alle Voraussetzungen hinsichtlich ihrer Aufnahmekapazitäten und vor allem auf Grund ihrer guten technischen Ausstattung. Im Mai 1917 wurde die Volks nervenheilanstalt mit 80 nervenkranken Soldaten-Patienten im ehe maligen Sanatorium eröffnet. Nicht zuletzt die gefürchtet-gepriesenen elektrischen Verfahren zur Behandlung der Kriegsneurosen konnten hier ohne weiteres praktiziert werden — bis sie schließlich gegen Ende des Krieges aus humanistischen Bedenken verboten wurden. Aus der diätischen Kuranstalt war eine ‹Versuchsstation des Weltunter gangs› geworden, ungeeignet für Hungerkünstler und Naturanbeter. So wirft auch die Episode «Kafka in Frankenstein» ein Streiflicht auf die facettenreiche Geschichte der deutsch-böhmischen Sanatorien. Am Ende seiner durch ganz Europa führenden privaten und beruf lichen Suche nach Orten des Heils stand für den versierten Patienten Franz Kafka vorläufig fest: «Was mich betrifft, habe ich voriges Jahr mit den Sanatorien endgültig abgeschlossen; Kranke [...] sollen Sana torien lieber ausweichen» — «ich will nicht mich massieren, packen, elektrisieren, heilbaden, untersuchen, durch besonders gute Diagno sen mich besonders gut über meine Krankheiten informieren lassen ... (an Felice Bauer 31 5 1916) Er konnte nicht wissen, dass die wirkliche Reise durch die Krankenstuben dieser Welt für ihn erst beginnen soll te. 1917 brach seine Lungentuberkulose aus, 1918 erkrankte er an der weltweit grassierenden Spanischen Grippe; die Jahre bis zu Kafkas Tod 1924 sind geprägt durch Aufenthalte in Lungensanatorien.
Die physikalisch-diätische Kuranstalt Frankenstein indes durchlief nach dem Zerfall des Habsburgerreiches und der tschechischen Staatsgründung eine wechselhafte — und derzeit nur lückenhaft rekonstruierte — Geschichte. Obwohl die Anstalt in den Jahren nach 1918 unter neu er Verwaltung noch einmal zu einem gut funktionierenden Betrieb mit breit gefächertem therapeutischen Angebot avancierte, konnte an die Bedingungen der Vorkriegszeit nicht mehr angeknüpft werden. Noch in den 20er Jahren bestand Frankenstein unter dem Namen Deutsche Volksnervenheilanstalt fort; während des Zweiten Weltkrieges diente es den deutschen Besatzern als Feldlazarett; in der CSSR wurde es bis Anfang der 60er Jahre als Nervensanatorium weiterge führt. Seither werden die Gebäude in Frankenstein von der Städtischen Klinik Rumburg genutzt und beherbergen u.a. die Rehabilitati onsabteilung.
Aus der Muster-Heilstätte zwischen den Nationen und Diskursen ist heute ein vergessener Schauplatz geworden, ein Ort, an dem die Ge schichte stehen geblieben scheint. An den nervösen Patienten Franz Kafka und dessen Teilhabe an der böhmischen Nerven-Politik erin nert kein Denkmal und auch kein Hinweis mehr — den seltenen Be suchern hat Frankenstein / Rumburg die Male seines Gedenkens auf andere authentische Weise bewahrt.
Ekkehard W. Haring, geboren 1966, Germanistik/Komparatistik-Studium an den Universitäten Leipzig und Athen, Promotionen an den Universitäten Leipzig und Paris VIII, ist derzeit DAAD -Lektor in Tschechien. Zahlreiche Veröffentlichungen zur Pra ger Literatur, zur deutsch-jüdischen Kultur und zur Medizingeschichte. Unter Lei tung von Ekkehard W. Haring und Benno Wagner arbeitet derzeit eine Gruppe deutsch-tschechischer Historiker, Literaturwissenschaftler, Medizinhistoriker und Regionalforscher an einer Dokumentation über die fast schon vergessene Geschichte dieser einmaligen exemplarischen Heilanstalt im Herzen Europas.
Das Sanatorium Frankenstein
29 ts C he C hien / k afka
von irene gruter
hier darf iCh´s sein.»
Der Heimspiel-Fonds der Kulturstiftung des Bundes fördert Theaterprojekte, die neue Berührungspunkte zwi schen Städten und ihren Bewohnern schaffen. «Theater, für wen eigentlich?», fragte das Deutsche Nationalthea ter (DNT) in Weimar und öffnete die große Bühne für die Skater vom Theaterplatz. My God Rides a Skateboard, ein Projekt mit 17 Laiendarstellern und zwei Schauspielern, provozierte eine Diskussion über den fehlenden Raum für Subkultur in der Klassikerstadt.
t
au auf den Tischen vor dem Eiscafé, eine Katze huscht hinter den «City Kebab», zwei Damen mit Henkeltaschen steuern zum Kaufhaus schräg gegenüber. Die Welt dreht sich noch langsam an diesem stillen Vormittag auf dem Weimarer Theaterplatz. Ein Panflötenspieler brei tet seine Decke aus, drei Bärtige mit Bierflaschen richten sich nach der ersten Morgensonne und Musikstudenten, die Instrumentenkästen gebuckelt, ziehen eine eilige Diagonale über den Platz, ohne einen Blick für das berühmte Denkmal vor dem Stadttheater. Goethe tät schelt Schiller gönnerhaft die Schulter, beide blicken unbeteiligt ins Weite, als wäre alles, was nach ihnen kam, nur ein zu lang geratener Epilog auf die Meisterwerke der Deutschen Klassik. In ihrem Rücken strebt die tempelartige Säulenfront des Deutschen Nationaltheaters nach Höherem: eine adrette Kulisse für unzählige Gruppenfotos, die vor dem Denkmal arrangiert werden. Gegen Mittag belebt sich der Platz, Jugendliche kurven mit Skateboards auf dem glatten Belag, fliegen über den welken Blumenkranz hinweg, den jemand den Dichter fürsten zu Füßen gelegt hat.
«Nicht immer verläuft das Nebeneinander so friedlich wie heute. Be sonders die BMX-Fahrer und Skater sind ungern gesehen, weil sie nicht ins herausgeputzte Stadtbild passen, die Theaterbesucher stö ren und die Sandsteinstufen beschädigen», erzählt Lutz Keßler, der vor zwei Jahren als Dramaturg ans DNT kam. Seither fasziniert ihn das kleine Welttheater auf dem Vorplatz. Und doch bleibt es befremd lich, dass die vielen Akteure, die den Ort für sich als Bühne nutzen, mit dem Haus nicht in Berührung kommen. Ein Stadttheater, das zwar im Zentrum steht, aber mit einem Großteil der örtlichen Bevöl kerung nichts zu tun hat? «Theater, für wen eigentlich?» Die Grund satzfrage wurde zum Untertitel eines Projekts mit dem Ziel, Men schen auf dem Vorplatz zu ihrer Sicht des Theaters zu befragen und sie einzuladen, einen Abend auf der großen Bühne zu gestalten.
Die Recherchen führten schnell weg vom Theaterplatz, zu lokalen Ver einen, nach Weimar West und in die Sprayerszene. Das ursprüngliche Ziel, Teilnehmer aus möglichst verschiedenen Alters- und Bevöl kerungsgruppen zu finden, ließ sich nicht so leicht umsetzen. Viele waren interessiert, doch kaum jemand hatte genug Zeit und Disziplin, fünf Wochen regelmäßig zu proben. Sicher trug auch das Thema da zu bei, dass sich vor allem junge Leute angesprochen fühlten, denn im Mittelpunkt des Projekts sollte der Konflikt mit den Skatern stehen. Skater und BMX-Fahrer auf der großen Bühne des Deutschen Natio naltheaters? Wo die Meisterwerke der Deutschen Klassik, wo Wagner und Liszt uraufgeführt, wo die Weimarer Republik gegründet wurde? Keine geringe Provokation in einer Stadt, die traditionell von ihrem Ruf als Hort der Hochkultur lebt. «Viele Jugendliche, auch Künstler beklagen sich darüber, dass es in der Kulturstadt Weimar keinen Raum für Subkulturen gibt», sagt Jonathan Loosli, der an den Vorbe reitungen für das Heimspiel -Projekt beteiligt war. Seit zwei Jahren ist er im Ensemble des DNT, und auch er verspürt ein Unbehagen mit dem Stadttheaterbetrieb, der ihm, bei aller Freude an der Arbeit, oft hermetisch erscheint. «Es gibt eine Identitätskrise, eine Leerstelle in dieser Form der Hochkultur», sagt er. «Eigentlich ist es doch absurd, dass hoch subventionierte Betriebe zusätzlich gesponsert werden müssen, damit sie etwas mit der Stadt zu tun haben.»
Etwas mit der Stadt zu tun haben. Im Vergleich zu Schillers Hoffnung, die Bühne solle zur «vierten Macht im Staate» werden, klingt der Wunsch fast bescheiden. Wer die Forderung der Aufklärer, die Bühne als Forum bürgerlicher Öffentlichkeit zu begreifen, heute ernsthaft realisieren will, steht vor einer großen Aufgabe. Denn die Auseinan dersetzung im Theater bleibt auf einen sehr kleinen Kreis beschränkt; immer wieder kommt der Vorwurf des Elitären auf. Nicht Aufklä rung kann also die Aufgabe sein, sondern Partizipation.
Ein Gang durch das gepflegte Idyll der Innenstadt macht deutlich, warum Subkultur hier kaum Fuß fassen kann. Im Disneyland für Kultur freunde schläft man im Johann-Sebastian-Bach-Zimmer, frühstückt vor Lottes Schattenriss, promeniert an Hitlers Lieblingshotel vorbei zu den grünen Gärten an der Ilm. Vor Goethes Gartenhaus wandeln ältere Herren mit Studiosus-Rucksack und rezitieren laut aus dem Ge dächtnis. In Weimar einen Ort zu finden, wo eine Sprungrampe für Skater nicht das Stadtbild stören würde, fällt tatsächlich schwer.
Mit dem Bus in Richtung Buchenwald. Die Probebühne des Deutschen Nationaltheaters Weimar liegt an der Peripherie der Stadt, irgendwo zwischen Brachland und Neubauten. Auf einer bräunlichen Haus wand steht in roten Lettern: «Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn macht,
egal wie es ausgeht.» Auf der Wand eines Obdachlosenheims wirken Václav Havels vielversprechende Worte beinahe zynisch. Auf der an deren Straßenseite, in einer ehemaligen Offizierszentrale, liegt der Proberaum. Ein übermannshoher Pandabär schaut aus dem Fenster, neben Skateboards ein Rollstuhl, bunte Kittelschürzen liegen herum. Die Teilnehmer haben sich die Requisiten aus dem Fundus zusam mengesucht, nun sitzen sie in einer Sofaecke und diskutieren, was sie mit dem gemeinsamen Theaterabend eigentlich wollen. Erstaunlich vertraut wirkt die Gruppe, obwohl sie erst eine Probenwoche hinter sich hat.
Tom, mit 19 Jahren einer der Jüngsten, macht eine Lehre als Sportfach verkäufer und gehört zu den BMX-Fahrern, die auf dem Theater platz üben. Er habe gleich Lust gehabt, auf der großen Bühne aufzu treten, «um einmal zeigen zu können, was das für eine Körperbeherr schung braucht, was wir machen». Zusammen mit seinen Kollegen baut er während der fünfwöchigen Probenzeit in den Werkstätten des Theaters eine Rampe, die während der Vorstellung auf der großen Bühne stehen wird. Auch Lucian, ein Experte aus der Sprayerszene, möchte öffentlich demonstrieren, welche Kunstfertigkeit sich hinter der Graffiti-Technik verbirgt. Mario, mit 34 Jahren der Älteste, ist als Sozialarbeiter in mehreren Projekten engagiert, findet aber keine fes te Anstellung und lebt von Hartz IV
Auf den ersten Blick wirken die siebzehn Teilnehmer wie vergnügte Pfadfinder, doch in den Pausen tauchen Fetzen am Gesprächsrand auf, die andeuten, dass nicht alle Biographien so bruchlos verlaufen sind, wie es den Anschein hat. Beim Kochen auf zwei lauwarmen Herdplatten ist vom Jugendgericht die Rede, von Drogenerfahrungen, Gewalt in der Beziehung, Begegnungen mit der rechten Szene, Teenager-Schwangerschaften. Das Wasser für die Spaghetti kocht, Sven Miller streckt hungrig den Kopf durch den Türrahmen, es ist drei Uhr nachmittags. «Wir machen übelst viel», versichert Frizzi mit ihrem blausten Augenaufschlag, und der Regisseur befindet, das sei genau die richtige Menge. Später wird er sagen, dass er Theater als Lebens form begreift; die politische Dimension der Kunst sehe er in der Ar beit im Kollektiv. Der ausgebildete Schauspieler stammt aus dem Ruhrpott, lebt seit rund 20 Jahren in den USA und unterrichtet heute an einer Universität in Bloomington. Es ist nicht sein erstes Projekt mit Laiendarstellern, unter anderem arbeitete er mit den Insassen eines New Yorker Gefängnisses, in Psychiatrien und Schulen.
Sein Konzept für den Abend hört sich zu diesem Zeitpunkt noch vage an. Die Teilnehmer sollen selbst bestimmen, was sie auf der Bühne zeigen wollen. Er hat sie beauftragt, kurze Texte zu schreiben, die et was mit ihrer Biographie zu tun haben. Nach dem Essen assoziiert die Runde weiter. Es ist kaum vorstellbar, dass in vier Wochen aus den lo sen Ideen ein zusammenhängender Theaterabend werden soll. Frizzi malt Herzchen in ein rosa Notizbuch, schaukelt mit dem Stuhl und guckt ihren demonstrativen «Ich-denk-an-was-ganz-anderes-Blick». Steini trommelt energetisch auf dem Bühnenrand, bringt mit zwei Holzschlägern alles ins Klingen, was ihn umgibt. Noch steht die Gruppenbildung im Vordergrund, von einer Dramaturgie ist wenig zu er kennen. Es gehe nicht in erster Linie um das künstlerische Resultat, sagt Sven Miller. «Wichtig ist der Prozess.»
Später kommen drei ältere Frauen vom Obdachlosenheim vorbei, die Interesse am Projekt bekundet hatten. Vor Verlegenheit albern sie rum wie kleine Mädchen, spüren, dass sie nicht recht zur jungen Gruppe passen. Eine hat vor vielen Jahren als Putzfrau im DNT gear beitet. Wann sie zum letzten Mal im Theater war? «Och Mensch!» Sie kichert, winkt ab. «War noch zu DDR-Zeiten.» Auf die Frage, ob sie nun mitmachen wollen, antworten die drei verlegen: «Das is nüscht so eenfach.» Dann zotteln sie ab. Die Gruppe wirkt halbwegs erleichtert, doch es bleibt ein Unbehagen zurück.
Wieder wird diskutiert, ein gereizter Unterton macht sich breit. Frizzi erzählt, wie sie sich ihren Auftritt vorstellt. Wie eine Diva möchte sie erscheinen, sich über den Flügel legen und singen. Dann möchte sie das puppenhafte Bild in irgendeiner Form brechen: «Damit die Leute sehen, wie ich wirklich bin», sagt sie. Als Eve Kolb, eine Schauspiele rin aus dem Ensemble, genau nachfragt, was sie damit beabsichtigt, bekommt Frizzi glänzende Augen und geht raus. Es ist noch nicht so lange her, dass sie sich bei Deutschland sucht den Superstar beworben hat, in den Endrunden der Vorauswahl gescheitert ist, kommentiert von Dieter Bohlen und der Boulevardpresse. Sackgasse in der Dis kussion. Wie umgehen mit den Bedürfnissen von nicht professionellen Darstellern, die auf der Bühne aus ihrer Biographie erzählen sol len? Irgendwann platzt Eve die Hutschnur: «Soll das so ne Art Selbsttherapie werden, oder was?!»
«...
30 hei M spiel
Selbsttherapie — weder der Regisseur noch der Dramaturg finden den Ausdruck angebracht, doch zeigt der kurze Moment der Irritation, wie heikel die Arbeit mit Laiendarstellern sein kann. «Man muss wahnsinnig Acht geben, dass man die Leute nicht vorführt», sagt Jo nathan. Und Eve erklärt, sie werde eine grundsätzliche Ambivalenz in Bezug auf solche Projekte nicht los: «Was will das Theater, wenn es sich dem ‹kleinen Mann› von der Straße zuwendet? Da bin ich unsi cher. Wenn ich es ernst meine, dass ich etwas verändern will im Leben der Leute, muss ich mich doch fragen, warum ich dann nicht Sozialarbeiter werde wie Mario.»
Wo hört die Wirkungsmacht des Theaters auf, wo beginnt die Sozialar beit? Projekte mit Laien bewegen sich in einer schwer definierbaren Schnittmenge, auch was den künstlerischen Anspruch betrifft. Ohne zusätzliche Mittel sind Stadttheater dieser Aufgabe nicht gewachsen, sagt Stephan Märki, Generalintendant am DNT, und spricht vom Grundauftrag des Theaters: «Ein Stadttheater macht nur Sinn, wenn es eine Kommunikation mit der Stadt herstellt.» Gerade in Weimar sei das keine einfache Aufgabe. Zwar gibt es eine starke Bür gerbewegung, die sich vehement für ihr Theater einsetzt, wenn die Landesregierung wieder einmal das Thema der Fusion mit dem be nachbarten Theater Erfurt aufs Tablett bringt. Doch zwei Drittel der Theaterbesucher sind Touristen, die mit einer klaren Erwartungshaltung an den Klassiktempel herantreten. Dagegen richtet sich My God Rides a Skateboard dezidiert an die Einwohner: «In einer kleinen Stadt wie Weimar funktioniert ein solches Projekt wie ein Brenn glas», sagt Märki. «Ich hoffe, dass hier eine Toleranz gegenüber an deren Lebensformen geweckt wird. Beide Seiten brauchen diese Rei bung, das Publikum wie die Skater.» Und auch das Haus selbst, denn viele Mitarbeiter sind nicht einverstanden, dass die große Bühne des Deutschen Nationaltheaters den Skatern zur Verfügung gestellt wer den soll.
Vier Wochen später. Nach der holprigen Generalprobe auf der großen Bühne feiert die Gruppe noch einmal ungestört am Kebab-Stand. Was am nächsten Tag geschehen wird, wenn die Spieler mit ihren per sönlichen Geschichten vor 600 Zuschauern stehen werden, kann sich in diesem Moment keiner vorstellen. Eine Dreiviertelstunde vor der Premiere füllt sich der Theaterplatz. Izak, der Rapper, und Steini zie hen wie die Marktschreier durch die Gassen, treiben das Publikum mit Megaphon und Schlagzeug herbei. Das prunkvolle Portal bleibt zu; kein Foyer in Samtrot, kein Goldrand an diesem Abend. Die Dar steller führen die Zuschauer zu einem schäbigen Hintereingang, durch die Kantine und verzweigte Gänge, vorbei an Requisiten und Kos tümständern, mitten auf die große Bühne. Von dort steigen die Zu schauer herab in den Saal. Die erste unsichtbare Grenze ist überschritten, hier sind alle als Akteure gefragt. Während des Einlasses werden Antworten aus den Umfragen abgespielt. «Subkultur ist, wenn man meint, man kann seinen Müll überall hinschmeißen», sagt eine Frau enstimme. Greifbare Spannung im Raum.
Martin, mit Goethe-Perücke, dreht weite Kreise mit dem Skateboard, springt ab, stellt sich frontal zum Publikum. Abwechselnd kommen die Schauspieler an die Rampe, stellen sich vor. «Für mich ist Adrenalin», sagt Mario, «wenn ich Post vom Arbeitsamt bekomme.» Izak antwortet: «Für mich ist Adrenalin, wenn ich keine Post vom Arbeits amt bekomme.» Mit enormer Bühnenpräsenz performen sie ihre An liegen, immer mit einer Spur ironischer Distanz. Als hätten sie natur gemäß erfasst, was Brecht mit dem Verfremdungseffekt gemeint hatte.
«Ich spiele mich selbst in der Form von Goethe», sagt Martin auf die Frage, was er eigentlich darstellt.
Mario stöckelt als Queen of Night an die Rampe, berichtet in Lackleder und Platinblond von seiner Erfahrung als Homosexueller in Weimar und lässt sich nicht von Kommentaren aus dem Publikum beirren. Als er seine Perücke abnimmt und mit spiegelnder Glatze von seinem Alltag als Sozialarbeiter in den Vororten erzählt, wird es still im Saal. Frizzi, im weißen Glitzerkleid und goldblonder Lockenpracht, lüm melt sich auf dem Flügel wie ein Mädchentraum und singt, von einer Kamera gefilmt und medial vergrößert. Später kommt sie in ihren Alltagskleidern zurück. «Ich weiß, dass ich schön bin», sagt sie und doppelt nach, als die Zuschauer lachen: «Das ist eine Tatsache.» Dann spricht sie über ihr Selbstbild, tritt von ihrer Funktion als Projekti onsfläche zurück.
Auf der Leinwand erscheint die Schrift: «Graffiti, für wen eigentlich?» Lucian fragt das Publikum, ob Kunst sich dadurch auszeichne, dass Bilder im Museum hängen. Ein Video zeigt, wie er die Säulen des Theaterportals besprüht; geschützt von zwei Stellwänden, die nun mit sei
nem Werk vom Bühnenhimmel heruntergelassen werden. Schritt für Schritt bricht der Außenraum ins Theater ein, bis das geschützte In nere endgültig implodiert.
Die große Stunde der BMX er. Was sie auf der selbstgebauten Rampe zeigen, gleicht einer Akrobatiknummer auf Zirkusniveau. Das Publikum zuckt bei jedem Sprung, antwortet mit überwältigendem Ap plaus auf das Spektakel unter dem Goldportal. Ein Fahrer nimmt das Mikrophon: «Wir haben jetzt zwar eine Rampe, aber noch keinen Ort, wo sie stehen kann. Wer hat einen Vorschlag?» Gäste aus dem Publikum werden auf die Bühne gebeten. Die Streetworkerin Kathrin Schuchardt, die das Projekt begleitet hat, moderiert die Diskussion über die Problematik der Skater auf dem Theaterplatz. Zwei Wochen später wird das Gespräch mit dem Oberbürgermeister fortgesetzt. Der Höhepunkt des Abends gehört Izak. «Schwarz oder weiß / rechts oder links ich weiß nicht / wenn ich meinen augen trau / dann ist grau geradeaus / sag mir was beeinflusst / ob du freund oder feind bist / musst du dich entscheiden.» Rhythmische Wellen laufen durch seinen Körper, er verflicht eigene Texte mit Passagen aus dem Prolog zu Goe thes Faust. «Hier bin ich Mensch» ruft er, und aus dem ehrwürdigen Saal des DNT kommt es rhythmisch zurück: «Hier darf ich‘s sein.» Als er nach der Vorstellung auf dem Balkon steht und über den Thea terplatz hinweg rappt, wirkt er wie ein Eroberer am Ende seines Tri umphzugs. In der Menge stehen Goethe und Schiller auf stämmigen Waden und blicken ins Nachtdunkel.
Er werde die Skater in Zukunft mit anderen Augen sehen, sagt ein älterer Abonnent nach der Vorstellung, auch wenn ihm die Behandlung der Themen in der dynamischen Nummernrevue insgesamt zu ober flächlich schien. «Ich verstehe das als Aufschrei, als Protestveranstal tung, und daher sollte man den Abend nicht nach den Kriterien be werten, die für die normale Theaterkultur gelten. Es ist eine Heraus forderung, Stellung zu nehmen.» Wenn Kunst wahrnehmungsverän dernd wirken soll, so hat dieses Projekt das Ziel in mehrerer Hinsicht erreicht. Der Austausch hat funktioniert; schließlich haben die sym pathischen jungen Wilden auch dem Theater seine Dialyse verschafft, wie es Eve grinsend formuliert. Viele der Spieler sind zum ersten Mal im Theater gewesen, brennen darauf, weiterhin zusammenzuarbei ten. Und auch für die Rampe der Skater hat sich, zumindest vorüber gehend, ein Platz gefunden. Die örtliche Leiterin der Deutschen Bank sicherte nach der zweiten Vorstellung spontan einen Beitrag für den Unterhalt zu.
Zwei Monate später trauert Lutz Keßler, dass die Arbeit endgültig vor bei ist. «Es waren so starke Talente dabei. Da ist ein großes Bedauern, weil man weiß, dass viele wieder verschüttet werden.» Und nach einer Pause fügt er hinzu: «Jetzt bräuchte es Nachhaltigkeit. Die Zeit hat bei allen Mitwirkenden unglaublich viel bewegt, aber nun müsste man kontinuierlich weiterarbeiten, damit sich bei ihnen wirklich etwas verändert.» Hier stößt das Theater an Grenzen. Mehr, als hier erreicht wurde, kann ein einzelnes Projekt nicht leisten. Doch um das Potential ernsthaft zu nutzen, das in der Verbindung von sozialer Arbeit und Theater steckt, müssten noch ganz andere Mittel mobilisiert wer den. Die Diskussion, mit welcher langfristigen Wirkung, mit wel chem gesellschaftspolitischen Ziel sich die Stadttheater für «theater ferne» Gruppen öffnen sollen, bleibt noch zu führen. Am nächsten Morgen wirkt der Theaterplatz ganz unberührt. Auf Schillers Kopf sitzt eine Taube, der Blumenkranz auf den Stufen des Denkmals ist verschwunden.
Irene Grüter, geboren 1979 in Zug (CH), studierte Germanistik und Geschichte in Bern. Sie lebt in Berlin und arbeitet als freie Journalistin. Irene Grüter gehörte zu den Nachwuchsjournalistinnen, die für die tt-festivalzeitung des Berliner Theatertreffens 2006 schrieben.
31 hei M spiel
«w er sind nun wir?»
Unter dem Titel Des Knaben Wunderhorn veröffentlichten die Heidelberger Romantiker Clemens Brentano und Achim von Arnim von 1805 bis 1808 eine Sammlung von Volksliedern. Das Heimspiel-Projekt des Theaters und Philharmonischen Orchesters der Stadt Heidelberg knüpfte daran an und sammelte aktuelle Texte und Lieder in der Stadtbevölkerung für Das neue Wunderhorn. Über 400 Menschen machten bei den vier Aufführungen am Ende der letzten Spielzeit mit. Die Heidelberger Bevölkerung tanzte, sang und spielte im ganzen Theater. Zusammen mit dem Orchester und dem Chor gelangten 25Werke junger Komponisten zur Uraufführung. Der Dramaturg Olaf A. Schmitt berichtet aus der Heidelberger Heimspiel -Werkstatt.
von olaf
a
.
sC hMitt d
er neunjährige Joshua steht im Büro des Generalmusikdirektors neben dem Steinway-Flügel und kämpft sich durch den komplizierten Rhythmus eines neukomponierten Werkes für Sprecher und Orchester. Die Wörter erscheinen ihm wahllos aneinandergereiht, der Rhythmus er gibt keinen Sinn: «du glaubst nur dir selbst Mensch eins daß nur du Wert besitzt». Generalmusikdirektor Cornelius Meister, der selten ei nen so jungen Solisten für eine Einzelprobe trifft, nimmt die Sprech stimme schließlich für ihn auf CD auf. Mir kommen Zweifel, ob unser Wunsch, Menschen aus der Stadt als Solisten bei zeitgenössischen Kompositionen für das Philharmonische Orchester einzusetzen und somit völlig unterschiedliche Erfahrungshorizonte miteinander zu konfrontieren, aufgehen wird.
Eine gute Woche später steht der Junge auf der Großen Bühne des Staatstheaters Saarbrücken, in einem weißen Kostüm, das Menschen aus Heidelberg mit Wörtern beschrieben haben. Er steht neben dem Dirigenten und spricht wieder diesen Text, nun mit großer Sicherheit, aber das Blatt noch in der Hand. Bei dieser Werkstattaufführung im Rahmen des Kongresses Kinder zum Olymp! drei Wochen vor der Pre miere lösen sich viele Fragezeichen plötzlich in Luft auf. In Heidelberg schließlich steht Joshua ganz vorne an der Rampe, spricht auswendig und mit einer Leichtigkeit, als wären die Worte seine eigenen. Er hört das Orchester, das hinter ihm auf der Bühne sitzt, und erklärt dem Pu blikum mit klarer Geste: «Wer sind nun wir? Mensch vier?»
Die Breakdancer ernten bei ihrem Auftritt besonders viel Applaus. Sie bewegen sich zu einer Musik, deren Sprache ihnen völlig fremd ist und der das wesentliche Element für Breakdance fehlt: das durchge hende Metrum. In einem unserer Wunderhorn-Camps in der Heidel berger Werkstattbühne zwinger 1, wo einmal im Monat ein im besten Sinn neugieriges Publikum uns bei unserer Probenarbeit über die Schulter blicken kann, probieren die vier Tänzer verschiedene Bewe gungen zu dem kurzen Orchesterstück aus. Ein paar Tage vorher hat te der Kopf der Breakdance-Gruppe zum ersten Mal im Leben in ei ner Orchesterprobe gesessen und sich für die Antonitische Groteske entschieden, die mit dem Klarinettenmotiv aus Gustav Mahlers Ver tonung eines Wunderhorn-Liedes arbeitet. Bei der Camp-Veranstal tung bringe ich das originale Mahler-Lied mit und erkläre den Tän zern und dem Publikum, wie darauf in der neuen Komposition Bezug genommen wird. Zwanzig Minuten lang entstehen kurze Bewe gungen aus dem Breakdance-Vokabular, doch noch funktioniert gar nichts, noch nicht einmal die alten Tricks. Die Breakdancer hören, sie probieren, sie sprechen, sie fluchen, sie raufen sich zusammen. «Wir haben gesagt, dass wir dieses Stück machen, jetzt ziehen wir die Sache auch durch!» nimmt der 23 jährige André seine etwas ratlose Truppe schließlich in die Pflicht. Das Publikum und wir alle finden den Pro zess sehr aufregend, obwohl es kein wirkliches Probenergebnis gibt. In den nächsten Tagen hören sich die Breakdancer immer wieder die Aufnahme der wenigen Minuten an und sie durchdringen deren Struktur. Sie suchen nach musikalischen Anhaltspunkten, einem Pizzicato oder der Wiederholung eines Motivs, und erfinden eine kleine Ge schichte um Macht und Missgunst. Der Komponist kommt zu einer Probe dazu und spricht mit ihnen über sein Werk. Zuerst schien ihm Breakdance zu seiner Musik ebenso absurd wie den Breakdancern, nun entdeckt er seine Musik durch deren ‹moves› neu.
Wir wollten es uns beim Neuen Wunderhorn nicht leicht machen und ha ben bewusst versucht, Menschen im Theater zusammen zu bringen, die woanders nicht aufeinander getroffen wären: kleine Kinder und Senioren, Rapper und Orchester, Rockbands und Blaskapelle. Das Thema für dieses spartenübergreifende Projekt kommt direkt aus der Stadt. Vor gut zweihundert Jahren haben Clemens Brentano und Ach im von Arnim in Heidelberg Lieder und Gedichte gesammelt und in der Anthologie Des Knaben Wunderhorn veröffentlicht. Sie wurde zu einer der wichtigsten Sammlungen von Volksliedern und stiftete da durch im kleinstaatlichen Deutschland eine gemeinsame Identität. Ist so etwas heute auch möglich? Wir haben uns die Methode von damals zu Eigen gemacht und eine Recherche mit Medien unserer Zeit gestar tet: persönliche Interviews vor laufender Kamera, Fragebogen im In ternet und beschreibbare Plakate in der ganzen Stadt, vor Schulen, an Bushaltestellen, auf zentralen Plätzen. Die Plakate wurden von einem Recherche-Team aus Studenten abfotografiert und dokumentiert. Die Ergebnisse reichten vom extra zum Plakat getragenen und abgeschrie benen Gedicht bis zur wilden Kritzelei. Der erste Satz, der gar nicht für das Plakat gedacht war, sondern den Zweifel an dieser Aktion ausdrü cken wollte, wurde zu einem zentralen Satz des gesamten Projekts: «Man kann die Sprache nicht festhalten.»
Die Sprache einer Stadt kann man heute nicht mehr so festhalten wie 1806. Schon bei unseren ersten Recherchen im Februar 2006 im Stadt teil Emmertsgrund erzählte man uns von über siebzig verschiedenen Nationalitäten, die dort leben. Das war auch uns neu. Diese Polypho nie wollte unser Künstlerischer Leiter Jan Linders ins Theater bringen. So sollten alle Experten und Potentiale des komplexen Theaterappa rats für eine große Aufführung in möglichst vielen Räumen des Hauses den Menschen der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Das auf wändigste Ensemble eines Theaters, das Orchester, wurde ebenso ein geplant wie Chor, Schauspieler und alle technischen Abteilungen. Wie die Aufführung konkret aussehen würde, wusste zum Zeitpunkt der Planung keiner, schließlich begaben wir uns gerade erst auf die Suche nach dem Material. Die Fragen vieler Mitarbeiter des Theaters nach Aufwand der Ausstattung und der Kostüme, der benötigten Anzahl von Proben, der Anzahl der Mitwirkenden konnten teilweise erst in den letzten Wochen vor der Aufführung beantwortet werden. Das war für das Theater mit all seinen notwendigen Planungsstrukturen eine ziemliche Herausforderung!
Die erste hatten wir zu dem Zeitpunkt schon bewältigt: die Menschen in der Stadt aufzusuchen und zu begeistern. Der wichtigste Partner wurde schnell das Haus der Jugend. Dort wurden die Tanzpädagogin mit ihren über einhundert Tänzern als Choreographin und die Kunst pädagogin als Leiterin der Recherche und künstlerische Mitarbeite rin gewonnen. Junge Komponisten der Hochschule Mannheim und ihr Lehrer wurden mit Uraufführungen für Orchester betraut. Über dreihundert Briefe wurden zum Auftakt in die Stadt geschickt, an Schulen, Stadtteilvereine, Musikensembles, Chöre, Karnevalsvereine, Sportgruppen, Ausbildungsstätten … Als wirklich effektiv stellte sich aber nur die persönliche Ansprache heraus: Bei Aufführungen in der Stadt, bei Schul- und Stadtfesten, Empfängen und am Telefon war ben wir für unser Projekt und animierten Menschen zu Interviews und zum Mitmachen. In Briefen und Anrufen boten die Bürger ihre Lieder und Texte an: selbstgeschriebene Gedichte, Volkslieder aus der fremden Heimat, wiedergefundene Texte eines verstorbenen Vor fahren, Schnulzen aus Heidelberg. Eine Dame sang ein Lied vor, das ihr seit Jahrzehnten im Kopf herumspukt, weil sie es von einem unbekannten Menschen kurz nach dem Krieg gehört hatte.
Monatlich erprobten wir im Camp Wunderhorn neue Formate und lu den die Stadt zum Mitdenken, Auswählen, Erzählen ein. Im Camp erfuhren Kinder und Jugendliche von zwei Experten zum ersten Mal von Des Knaben Wunderhorn, improvisierten zwei Musiker des Orchesters mit Rappern, woraus zwei Rap-Songs mit dem ganzen Orchester entstanden, und beschrifteten die Bürger weiße Kostüme und den weißen Bühnenboden mit Wörtern, die in der Recherche gesammelt wurden. Im Camp erkundeten die Menschen das verwinkelte Theater, das sie sich in den folgenden Wochen zu Eigen machten: Bei den Auf führungen führten insgesamt 25 Bürger das Publikum in fünf Routen durch die geheimnisvollen Räume des Theaters, wo das gesammelte Material in künstlerischen Installationen präsentiert wurde. Jeder von ihnen erzählte dabei eine persönliche Geschichte. Eine Dame zum Beispiel zeigte ihrer Gruppe einen alten Koffer, den sie nach dem Tod des ihr unbekannten Vaters geerbt hatte. Die Fotos und Texte darin veränderten ihr idealisiertes Bild von ihm.
An den Aufführungstagen wurde das Stadttheater in einem emphatischen Sinn zum Stadt-Theater. Das Theater mit seinem Theaterplatz, auf dem Bands spielten und Migranten ihre Speisen feilboten, wurde zum Ort, wo die Hauptrollen aus der Stadt selbst besetzt wurden, mit den Geschichten und persönlichen Erlebnissen ihrer Bewohner. Ein Ort, an dem sich die Stadt im künstlerischen Prozess erneuern kann. Dass diese Erneuerung weiter stattfindet, zeigen die spontanen Ver knüpfungen, die sich gebildet haben: die Breakdancer mit einer Schü lerband, ein Orchestermitglied und ein Komponist, die Rapper und ein traditionelles Heidelberg-Lied. Die wichtigste Verknüpfung aber scheint mir die zu sein: das Theater und seine Stadt. Mit dem Neuen Wunderhorn endete die Spielzeit 2006/07. Mit dem Neuen Wunderhorn haben wir die neue Spielzeit 2007/08 wieder eröffnet. www.dasneuewunderhorn.de Olaf
Konzertspielplan wurde 2006/07 vom Deutschen Musikverlegerverband als bester in Deutschland ausgezeichnet. Schmitt war Stipendiat der Akademie Musiktheater heu te der Deutschen Bank Stiftung und ist zusammen mit Patrick Primavesi Herausgeber von AufBrüche. Theaterarbeit zwischen Text und Situation (Berlin 2004). 32
hei M
A Schmitt ist Dramaturg am Theater und Philharmonischen Orchester der Stadt Heidelberg. Der von Generalmusikdirektor Cornelius Meister und ihm erarbeitete
spiel
kulturstiftung des bundes erweitert ihre theaterforderung
Die Theaterlandschaft Deutschlands ist geprägt von Vielfalt, Innova tionsbereitschaft und der Verantwortung gegenüber dem kulturellen Erbe. Ihr Reichtum zeigt sich schon im breiten Spektrum der Einrich tungen und Initiativen, die mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Zielsetzungen für eine lebendige Theaterszene in Deutschland sorgen: Stadttheater mit eher regionalem Einzugsbereich und große Häuser mit überregionaler Anziehungskraft, eine große Anzahl von Theaterfestivals und experimentierfreudigen Projekten der freien Theaterszene. Dazu kommen singuläre oder repräsentative Theaterereignisse wie das jährliche Theatertreffen in Berlin oder spektakuläre Theateraufführungen zu besonderen Anlässen wie Jubiläen und Ge denktagen. Die Kulturstiftung des Bundes fördert die Theaterland schaft in all diesen Facetten. Sie hat verschiedenartige Förderinstru mente entwickelt, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Thea terschaffenden reagieren.
Das Theaterereignis des Jahres 2007 war die von der Kulturstiftung des Bundes geförderte Inszenierung der kompletten Wallenstein-Tri logie in einer ehemaligen Berliner Brauerei durch den Ausnahmere gisseur Peter Stein. Im Jahr zuvor hatte die Kulturstiftung Auffüh rungen von Bernd Alois Zimmermanns selten gespielter Monumen tal-Oper Die Soldaten in der Bochumer Jahrhunderthalle ermöglicht. Das internationale Theaterformen-Festival in Hannover hat in die sem Jahr ein großes, zumeist junges Publikum angezogen und die Fachkritik begeistert. Im November 2007 wird dann noch das inter nationale Impulse-Festival für freie Theater in Nordrhein-Westfalen der Theatergemeinde einen weiteren Höhepunkt bescheren. Diese wenigen Beispiele mögen nicht nur für das breite Spektrum der Theaterförderung stehen, sondern auch ein weiteres Anliegen der Kulturstiftung des Bundes verdeutlichen. Die Stiftung legt auf die Stär kung der internationalen Zusammenarbeit großes Gewicht, insofern sie der Vielfalt und Weiterentwicklung der Theaterformen zugute kommt. Dem Ideenreichtum, aber auch dem Kreis der Antragsteller sind kaum Grenzen gesetzt, um alle Kreativen im Theaterbereich zu erreichen: Große Häuser und alternative Spielstätten, Newcomer und Altmeister — renommierte Regisseure, junge Dramatiker, Inten danten und Theaterwissenschaftler — nutzen die Förderung der Kul turstiftung des Bundes für die Entwicklung von internationalen The aterprojekten, deren Realisierung häufig so außergewöhnlichen An forderungen genügen muss, dass sie im normalen Theaterbetrieb oh ne zusätzliche Unterstützung nicht umsetzbar wären. Den regulären Spielbetrieb an den Theatern kann die Kulturstiftung des Bundes al lerdings nicht fördern.
In der antragsgebundenen Allgemeinen Projektförderung wurden seit Gründung der Stiftung 131 Projekte im Bereich Darstellende Künste mit insgesamt 13,4 Mio. Euro gefördert. Informationen zur Allgemeinen Projektförderung finden sie auf unserer Web site www.kulturstiftung-bund.de).
Besonderes Augenmerk verdient der Heimspiel -Fonds im Spektrum der Theaterförderung der Kulturstiftung des Bundes. Er soll die The ater zur Entwicklung von Projekten anregen, mit denen sie gezielt theaterferne Bevölkerungsgruppen in der Stadt ansprechen und zur aktiven Beteiligung an Theaterprojekten animieren kann. Bisher wurden 26 Theaterprojekte im Heimspiel-Fonds gefördert. Wegen der großen Nachfrage bei den Theatern, die mit ihren Heimspiel-Produk tionen großen Erfolg in der städtischen Öffentlichkeit ernten, wurde der Heimspiel -Fonds um drei Jahre bis 2011 verlängert. Eine Übersicht über alle bisher geförderten Projekte und weitere Informationen zum Heimspiel-Fonds finden Sie auf unserer Website www.kulturstiftung-bund.de.
Bisher gibt es nur wenige Theater in Deutschland, die regelmäßig mit ausländischen Theatern kooperieren. Um sich neben der Betreuung des normalen Spielbetriebs noch zusätzlich um Kooperationen mit Häusern außerhalb Deutschlands kümmern zu können, fehlt es den künstlerischen Mitarbeitern der Theater häufig schon am Notwen digsten: den zeitlichen und finanziellen Voraussetzungen für Recher chen und Informationsreisen. In Gesprächen der Kulturstiftung des Bundes mit Intendanten, Vertretern des Deutschen Bühnenvereins, Regisseuren und Dramaturgen wurde deshalb immer wieder der Wunsch nach einer effektiven Stärkung der internationalen Vernet zung speziell der deutschen Stadt- und Staatstheater geäußert. Die Kulturstiftung hat deshalb einen Fonds für internationale Theaterpartnerschaften der deutschen Stadt- und Staatstheater entwickelt, der längerfristige Partnerschaften über einen Zeitraum von zwei bis drei Spielzeiten durch den Austausch des künstlerischen Personals ermöglichen und fördern soll. Die Zusammenarbeit soll sich am En de in einer gemeinsamen Produktion bewähren.
Vorgesehen ist, dass im ersten Jahr zunächst der Austausch von künst lerischem Personal erfolgt, im zweiten Jahr sich die Theater am jeweils anderen Ort mit einem Gastspiel präsentieren und im dritten Jahr ei ne gemeinsame Produktion der beiden Häuser entsteht, die an beiden Orten gezeigt wird. Insgesamt sollen bis zu 30 Partnerschaften in den Jahren 2009 bis 2012 ermöglicht werden.
Der erste Einsendeschluss für Anträge ist der 15. Oktober 2008 für Partnerschaften, die ab der Spielzeit 2009 /2010 realisiert werden sollen. Weitere Informationen sowie die Online-Anträge stehen voraussicht lich ab Oktober 2007 auf der Website der Kulturstiftung des Bundes unter www.kulturstiftung-bund.de zur Verfügung.
In ihrer 11. Sitzung hat sich die Jury der Kulturstiftung des Bundes für die Förderung von 34 Projekten mit einer Gesamtfördersumme von 4 Mio. Euro ausgesprochen. Darunter waren 10 Theaterprojekte, von de nen wir Ihnen hier zwei vorstellen, die im Herbst 2007 stattfinden.
road theater Transatlantisches Theaterprojekt Künstleri sche Leitung und Regie: Ronald Marx (USA) I Projektkonzept und -entwicklung: Ronald Marx (USA), Dagmar Domrös (D), Birgit Lengers (D) I Beteiligte Künstler/innen: Claudia Rohrmoser (A), Marcel Schobel (A), Roland Schimmelpfennig u.a. I Veranstaltungsorte und -zeitraum: Berlin Prolog: Berliner Festspiele, 26.9.07 I Berlin Epilog: 29.3. 15.4.08 Haus der Berliner Festspiele u.a. I New York (USA): Performance Space 122, 9. 13.10.07 Tour USA : 15.10. 2.12.07, NEW FRONTIERS : New York City, New York (4 Vorstel lungen) I Pittsburgh, Pennsylvania, 16.10. I Cincinnati, Ohio, 19 10. I Louisville, Kentu cky, 20 10. I Edmonton, Kentucky, 22 10. I Nashville, Tennessee, 24 10. I Atlanta, Ge orgia, 26 10. I Clarkesville, Georgia, 28 10. I Birmingham, Alabama, 30 10. I Memphis, Tennessee, 1.11 I Jackson, Mississippi, 3.11 I Baton Rouge, Louisiana, 5.11 I New Or leans, Louisiana, 7.11 I Paris, Texas, 9.11 I Oklahoma City, Oklahoma, 11.11 I Austin, Texas, 13.11 I El Paso, Texas, 15.11 I Santa Fe, New Mexico, 17.11 I Albuquerque, New Mexico, 18.11 I Phoenix, Arizona, 20.11 I Clarkdale, Arizona, 21.11 I Las Vegas, Nevada, 26.11 I Death Valley Junction, Kalifornien, 27.11 I Los Angeles, Kalifornien (3 Vorstellungen, 30.11 2.12.)
Die Berliner Produktionsgesellschaft German Theater Abroad (GTA ) begibt sich nach einem Prolog in Berlin mit Roland Schimmelpfen nigs Stück Start up auf eine ungewöhnliche USA -Tournee: Mit einem Bus wird GTA das Land einmal von Osten nach Westen durchqueren und dort spielen, wo ein verlassener, leerer Raum zur Verfügung steht.
Die Aufführungen zwischen New York City und Los Angeles der schwarzen Komödie Schimmelpfennigs, die ebenso vom «clash of cul tures» erzählt wie vom amerikanischen Traum junger deutscher Ein wanderer, werden dabei in Zusammenarbeit mit Schülern der jewei ligen lokalen High-Schools vorbereitet und begleitet. Um einen Epilog angereichert, der die Erfahrungen der USA-Tournee aufarbeitet, wird das Stück anschließend wieder in Deutschland präsentiert.
whats next Theaterprojekt für Nachwuchskünstler im Rahmen des Festivals Spielart Kuratoren: Tilmann Broszat, Romeo Castellucci (I), Tim Etchells (GB), Jan Lauwers (B), Johan Simons (NL) I Mitwirkende / Künstler: Simone Aughterlony (CH/NL), Nico Çelik, Maarten Seghers (B), Gruppe Or thographi (I) I Veranstaltungsorte: Münchner Kammerspiele; Haus der Kunst, Mün chen; Tanzquartier Wien (A); Theaterhaus Gessnerallee, Zürich (CH); Forum Freies Theater, Düsseldorf; Kampnagel Hamburg; schauspielfrankfurt, Frankfurt am Main I Veranstaltungszeitraum: 15 11 1 12.2007
Lern- und Ausbildungssituationen, künstlerische Produktionspro zesse, aber auch die sozialen Erfahrungen haben sich für Theaterma cher in einem Maße gewandelt, das das wechselseitige Verständnis verschiedener Generationen im Theaterbereich erschwert. Internati onal erfahrene, etablierte Theatermacher wie Romeo Castelluci, Tim Etchells, Jan Lauwers und Johan Simons arbeiten als Kuratoren mit von ihnen selbst ausgewählten Nachwuchskünstlern an einer gemein samen Bühnenproduktion. Dadurch soll ein generationsübergreifen der Dialog entstehen, der die erfahrenen Künstler/innen motiviert, sich mit der Situation und den Vorstellungen der nachwachsenden Künstlergeneration intensiver zu befassen. Umgekehrt profitiert der Nachwuchs aus den Bereichen Theater, Regie und Performance von den Erfahrungen der älteren Generation, die sich auch mit eigenen, aber für sie bewusst «untypischen» Arbeiten in das Projekt einbringt und damit selbst «Newcomer»-Erfahrungen macht: Jan Lauwers z.B. mit einer Ausstellung, Tim Etchells mit einem Kinderprojekt usw. Neben der künstlerisch-praktischen Zusammenarbeit werden in öffent lichen Künstlerdialogen zwischen den Generationen Fragen nach den Unterschieden in der künstlerischen Sozialisation früher und heute diskutiert.
33 hei M spiel theater [ auswahl ]
neu: fonds fur internationale theaterpartners C haften
die
auf stelzen
Mit dem Fonds zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements für die Kultur in den Neuen Bundesländern (Fonds Neue Länder) unterstützt die Kulturstiftung des Bundes Initiativen, die sich durch ein hohes Maß an bürgerschaftlichem Engagement für die Kultur auf lokaler und regio naler Ebene auszeichnen. In diesem Jahr veranstaltete die Kulturstiftung des Bundes ein Arbeits treffen unter dem Motto Engagement für Kultur — Perspektiven in Ostdeutschland, zu dem sie alle Vertreter der 89 Einrichtungen eingeladen hatte, die bislang im Fonds Neue Länder gefördert wur den. Das Treffen diente dazu, den Informations- und Erfahrungsaustausch untereinander zu in tensivieren, Entwicklungen der Projekte im Fonds Neue Länder zu analysieren sowie über die Per spektiven für das bürgerschaftliche Engagement in der Kultur zu diskutieren. Den Anlass und Rahmen dafür gaben die diesjährigen Stelzenfestspiele BEI REUTH , die ebenfalls in diesem Fonds gefördert werden.
von ulrike gropp a
uf zwei Stühlen sitzen sie an einem verregneten Samstag Ende Juni ne beneinander: die erfolgreiche Gegenwart in Gestalt des Leipziger Ge wandhaus-Bratschisten und Initiators der Stelzenfestspiele, Henry Schneider — und die möglicherweise erfolgreiche Zukunft, die sich in Christina Tast personifiziert, die in einem kleinen brandenburgischen Dorf in der Prignitz in diesem Jahr den Sommernachtstraum als Mu siktheater aufführt, mit Profimusikern aus Berlin und Laien aus dem Dorf und der Umgebung. Gesungen, gespielt, getanzt und gefeiert wird «in und rund um unser Festspielhaus — und das ist der ehema lige Schweinestall der Dorf-LPG» , wie die Initiatorin nicht ohne Stolz verkündet.
Während Henry Schneider, 15 Jahre nach dem Urknall der Stelzenfest spiele, schon fast wie ein Veteran auf sein Werk blicken kann, fiebert die mit Mann und zwei Kindern in einem brandenburgischen 70 -See len-Dorf lebende Innenarchitektin gerade der dritten Ausgabe ihres Festivals Dorf macht Oper entgegen. Medienprofis sind beide (noch) nicht. Und doch machen Schneider und Tast ‹bella figura› bei einer Pressekonferenz der Kulturstiftung des Bundes, auf der sie stellver tretend für zahlreiche andere Initiativen, Vereine und Netzwerke aus den ostdeutschen Bundesländern auf dem Podium sitzen. Und dort berichten, wie sie in den vergangenen 24 Stunden zusammen mit vier zig anderen Akteuren erstmals zu einer Art informellen Konferenz regionaler Kultureinrichtungen zusammengetroffen waren.
Zwar haben nur wenige Journalisten den Weg ins Sächsisch-Thüringisch-Tschechisch-Bayerische Vierländereck, sechzehn Kilometer hinter Plauen, gefunden. Doch die anwesenden Kulturakteure aus den fünf neuen Ländern registrieren, je nach Charakter voller Genugtuung oder mit leisem Staunen, dass sich überhaupt jemand dafür interessiert, wie sie tun, was sie anscheinend, allen Widerständen zum Trotz, nicht lassen können.
Tast, Schneider und Kollegen sind mitsamt ihren Kulturprojekten exemplarische Vertreter eines gar nicht so neuen Trends, den Sozial- und Gesellschaftswissenschaftler schon länger, vor allem im Rahmen der Debatten um den Dritten Sektor, als ‹empowerment› bezeichnen und dessen Übertragung in kulturpolitische Diskurse nur noch eine Frage der Zeit zu sein scheint. Gleichzeitig gehören Kulturmacher, die Festspiele auf dem Lande oder nichtsubventionierte Kunst in der Stadt ‹erfinden›, insbesondere in den Neuen Ländern, häufig einer Spezies an, die angesichts der abnehmenden staatlichen Gestaltungs möglichkeiten auf gesteigertes Interesse stößt: den ‹social entrepre neur›. Auch hier scheint ein neues Modewort der Kulturpolitik kurz vor dem Durchbruch zu stehen, das sicher, wie schon andere key words zuvor, ein Anlass für gewichtige Konferenzen und dickleibige Publikationen sein wird. Ob man Henry Schneider und Christina Tast dann, nach ihrer Kanonisierung, ‹social entrepreneurs der Kunst- und Kulturszene› nennen wird oder ‹cultural entrepreneurs›, wird ihnen vermutlich ziemlich egal sein und spielt hier auch keine Rolle.
Wenn die Praxis der Theorie trotzt...
Viel interessanter erscheint der Berichterstatterin vom Workshop in Stelzen jedoch die hier mit Händen zu greifende Erfahrung, dass das (Kultur-)Leben in Deutschlands Osten ohne diese Spezies trister und weniger spannend wäre. Dass ohne Akteure wie Schneider, Tast und andere vielerorts nichts (mehr) ginge. Die Szenarien, und zwar sowohl die des Gelingens als auch die des Misslingens bürgerschaftlichen En gagements, die sich seit Jahren in den fünf östlichen Bundesländern abspielen (jenseits des Wiederaufbaus der Frauenkirche in Dresden), werden in der Öffentlichkeit nur gelegentlich wahrgenommen und sind noch lange nicht ins Bewusstsein der (westdeutschen) kulturpo litischen Fachöffentlichkeit und Verwaltungen vorgedrungen.
Kulturerfinder in Dörfern und Städten, die normalerweise eher unter Krisenberichterstattung in den Fokus geraten, schaffen mit freiwilli gem Engagement, beharrlicher, meist unbezahlter Arbeit und klugen Netzwerken die notwendigen Rahmenbedingungen und Strukturen — und die Inhalte gleich mit dazu. Im besten Falle (Stelzen kann dafür als Beispiel gelten) erreichen sie mit unkonventionellen Mitteln, wor an sich Wirtschaftsförderer, Denkmalschützer, Stadt- oder Regional planer und Kulturpolitiker allzu oft die Zähne ausbeißen: Sie aktivie
ren Mensch und Wirtschaft, schaffen Lebensqualität in gottverlas senen Gegenden oder Stadtvierteln, erfinden neue soziale Beziehungen, manchmal sogar Arbeitsplätze — und halten Kunst & Kultur am Leben. Sie sind — zumindest in den erfolgreichen Fällen — nicht mehr und nicht weniger als «echte Unternehmer», auch wenn ihnen dies oft nicht gedankt wird. Entweder deshalb, weil es noch niemand gemerkt hat — oder weil ihre Projekte nicht in die Schemata passen. Der einzige Unterschied zwischen einem dieser Kulturmanager und Festivalgründer und einem ordentlichen Mitglied einer Industrieund Handelskammer besteht darin, dass erstere von ihrem Unterneh mertum persönlich nicht profitieren. Zumindest nicht in materieller Hinsicht. Sonst schon: menschlich, künstlerisch, als gesellschaftliche Wesen. Und zwar über alle Maßen.
Moderne Madrigale: Traktor, Hydraulik, Motorsäge
Einen besseren Ort als die kleine Gemeinde Stelzen bei Reuth, einen besseren Zeitpunkt als das lange Festspielwochenende Ende Juni hät te man sich schwerlich ausdenken können, um über die Bedeutung freiwilliger, ehrenamtlicher Arbeit für Kunst- und Kultureinrichtungen in den neuen Ländern nachzudenken. Auch, um ein Zwischenre sümee in einem für die Kulturstiftung des Bundes eher ungewöhn lichen Förderprogramm zu ziehen — und vor allem, um zu versuchen, die Protagonisten von bemerkenswerten ostdeutschen Initiativen, die im Fonds zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements für die Kultur in den neuen Bundesländern der Kulturstiftung des Bundes ge fördert werden, miteinander in Kontakt zu bringen.
Eine sterbende Kulturlandschaft, wie sie manchmal für die neuen Bun desländer analysiert oder zumindest prognostiziert wird, hört und fühlt sich anders an: Bei der abendlichen Eröffnung der 15. Stelzen festspiele geht es laut und fröhlich zu. Gut 1000 Zuschauer sitzen auf Bierbänken in der hölzernen Festspielscheune und verfolgen, wie die diesjährige Aufführung der Landmaschinen-Sinfonie über die Bühne geht. Es schluchzen Bratsche und Saxophon, es tuckert ein feuerroter ‹Konzerttraktor› mit sattem Dieselmotor. Zwei stämmige Typen kommen mit heulenden Kettensägen zum Crescendo-Einsatz. Ungewöhnlich poetische Collagen aus bäuerlichen Maschinen, Klängen und Rhythmen zwischen Stomp und Ravel. Musiker im Konzertfrack be völkern die Bühne — in einträchtigem Tun mit Dorfbewohnern in Alltagskluft. Zwischen den zarten Einsätzen des Singende-Säge-Or chesters knallen funky beats aus Bass und elektronisch verstärkten Landmaschinen: Es ist diese Mischung aus Ernsthaftigkeit der großen, der klassischen Musikkultur — und den archaischen Momenten eines entfesselten Gesamtkunstwerks in einem neuen Land-Art-Stil, der alt und jung beglückt. Nicht nur die ‹großen Jungs›, die sich da oben auf der Bühne ausleben dürfen. Und es ist die ganze Veranstal tung, die die Frage aufwirft: Wie kann es so etwas geben, wie kann so etwas bestehen (fast) ohne Subventionen der öffentlichen Hand?
Das Stelzener Rezept «von Idealisten und Künstlern erdacht, durch Eh renamtliche entworfen, mit Spendengeld von außen und eigener Kraft des Dorfes erbaut» taugt als modernes Heldenepos. Und nicht nur ‹Stelzen›: In den meisten Gründungs-Stories ostdeutscher Kulturini tiativen entfaltet der Widerspruch zwischen realer oder eingebildeter Misere und dem Widerschein der Schönheit und der Utopie in Kunst und Kultur eine Dynamik von großer Strahlkraft. Die Kommerziali sierung und Inszenierung kultureller und künstlerischer Events, der immergleiche vermeintliche Edel-Look, ist hier bislang (noch) nicht angekommen. Das macht neugierig, garantiert Erlebnisse, die das ur bane Publikum so nirgendwo anders findet.
Kulturpolitischer Sprengstoff?
Die Stelzenfestspiele bei Reuth, Dorf macht Oper und viele andere Initia tiven werfen die Frage auf: Wie packen diese Leute das überhaupt? Zwar gehört es für angereiste Städter zum guten Ton, Initiatoren wie Schneider und Tast zu beglückwünschen und zu belobigen, wenn ei ne Aufführung gelungen ist. Doch für die Hintergründe, das ‹making of›, reichen Zeit und Interesse, zumal von Kulturpolitikern, in aller Regel nicht aus. Lob und nette Worte kosten ja auch nichts, schon gar kein Geld. Was manche von ihnen noch nicht gemerkt haben dürften: ‹Stelzen› ist inzwischen, zumindest in Mitteldeutschland und im be
34 fonds neue länder
Das Forum Engagement für Kultur — Perspektiven in Ostdeutsch land begann mit zwei Impulsreferaten: Kristina Volke, Kunst- und Kulturwissenschaftlerin aus Berlin, stellte in ihrem Beitrag Kultur und Krise eine Typologie des ‹kulturellen Akteurs› vor und akzen tuierte die gesellschaftspolitische Funktion von Kulturarbeit. Klaus Winterfeld, Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Studienganges Kultur und Management an der TU Dresden und städtischer Referent für Film und Medienkultur Dresden, behandelte in seinem Vor trag Erlebt die Ostkultur eine ‹Renaissance›? den Bedeutungswan del von Kultur in Ostdeutschland seit der Wende. Beide Vorträge sowie weitere Informationen zum Fonds Neue Länder finden Sie auf unserer Internetseite www.kulturstiftung-bund.de unter dem Menüpunkt: Themen / Deutsche Einigung / «Engagement für Kultur — Perspektiven in Ostdeutschland».
nachbarten bayerischen Franken, unter Fachleuten zu einem Synonym für die ‹Kulturentwicklungsplanung› eines neuen, ländlich-ost deutschen Typs geworden: Ohne Kapital, aber mit Ideen, unter Ein satz von Kreativität, persönlicher Leidenschaft und hochkompetenten Netzwerken werden — oftmals über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte komplexe Vorhaben und Ideen realisiert, die das herkömmliche kul turpolitische Denken herausfordern, ja manchmal sogar ad absurdum führen.
Neue alte Liaison zwischen Stadt & Land Natürlich muss inmitten dieses Lobs auch erwähnt werden, dass es einige Voraussetzungen gibt, die eine entscheidende Rolle spielen: per sönliche Verbindungen, das richtige Wort und die richtige Tat zum rechten Zeitpunkt, die ‹passenden Partner›, glückliche Fügungen und gelegentliche finanzielle Wunder. Und im Falle der sommerlichen Kulturevents auf dem Lande ist die enge Verbindung städtischer Mi lieus und ländlicher Bio- und Soziotope unverzichtbar. So stammt der spiritus rector der Stelzenfestspiele aus dem Dorf Stelzen und lebt dort auch, wenn ihn der Dienst nicht ins Gewandhaus nach Leipzig ruft. Doch ohne Impulse aus der Stadt wäre ‹Stelzen› nicht geworden, was es ist. Denn nicht nur die Idee einer Konzertreihe entstand mit Freunden in Leipzig und wurde zurückgespielt aufs Land, auch die Planung der Festspielscheune geschah durch uneigennützige Archi tektenfreunde in der Messestadt.
Eine Symbiose zwischen Stadt und Land steht auch am Beginn von Dorf macht Oper: Christina Tast lebt seit 15 Jahren in Klein Leppin, obwohl ihre Familie ein ‹zweites Standbein› im nur eine Stunde ent fernten Berlin hat. Die Verbindung von Urbanität und Land ist bei allen Projekten auf dem Lande offensichtlich günstig. Unabdingbar ist, dass die Initiatoren über eine wirtschaftliche Absicherung verfü gen müssen, sei es ein festes Einkommen, eine mehr oder weniger si chere Rente, einen verdienenden Lebenspartner.
Die Kulturentwicklung made in Stelzen bringt mit der Festspielscheune nun erstmals einen großen, privat initiierten Kulturbau in einer der ländlichen Realität angepassten Art hervor. Einen Boden hat die Festspielscheune nicht, die Toiletten sind, wie auf dem Rummelplatz, draußen im Wagen. Es gibt weder Garderobe noch Foyer. Dass die Rückwand des Gebäudes zur Eröffnung nicht fertig geworden ist, macht nicht nur nichts, sondern erhöht noch den Spaßfaktor — so kann der Spielmannszug nämlich ohne Gedränge durch die Wand einziehen, direkt aus der mondhellen Nacht, zu seinem Auftritt am Ende der Landmaschinensinfonie.
Und die Gedanken können dank fehlender Rückwand freier schweifen: Was wohl den Unterschied ausmacht zwischen einem Dorf wie Stel zen, das die Hälfte des Jahres auf dieses Festival hinfiebert, und einem x-beliebigen Dorf, hier im Vogtland oder irgendwo in Sachsen, Meck lenburg oder Thüringen, dessen einziger Höhepunkt ein klassisches ‹Dorffest› ist. Durch die fehlende Wand, hinaus in die Nacht, fliegt aber auch der Gedanke: Wo steht die Kulturlandschaft Deutschland Ost an ihren wegbrechenden Rändern im Jahr 2007? Wie passen der Grün dergeist, die Unverdrossenheit, der Mut dieser (subventionstechnisch gesprochen) Habenichtse hier zu den landauf, landab schließenden Bi bliotheken, Galerien, Theatern, den kapitulierenden Sozio- und Ju gendkulturzentren in den Städten? Was haben diese Erfolgreichen, das andere Initiativen nicht haben? Die, die es auf Dauer nicht packen, die die Entmutigung durch knappe Ressourcen und bürokratische Zu mutungen (z.B. aufwendige Anträge für Zuschüsse von 150 Euro pro Jahr) nicht aushalten oder die nicht über die Kontakte verfügen, die nötig sind, um die Aufmerksamkeit von Juroren oder Talentsuchern zu gewinnen? Welches sind die Rezepte der Erfolgreichen? Was von diesem Erfahrungswissen wäre operationalisierbar und übertragbar auf andere? Und wo gelangen die in diesem System der Zufälligkeiten erfolgreich Agierenden an ihre Grenzen? Wann setzt mit der Kommer zialisierung vielleicht auch das Ende des Zaubers ein?
Bestandsaufnahmen gegen den Schwund Resümees des bislang zurückgelegten Weges beim Versuch, die kultu relle Substanz nach § 35 des Einigungsvertrages zu erhalten, scheinen derzeit angesagt — vor allem auch im Westen. So unternahm bei
spielsweise das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt/M. kürz lich unter dem Titel Neu Bau Land eine durchaus stolze Bilanz öffent licher und privater Bauvorhaben in den neuen Ländern. Dass diese beeindruckt, liegt nicht nur an der Auswahl von Forschungseinrich tungen, Schulen, Bibliotheken, Theatern und Verwaltungsgebäuden, die von den Kuratoren getroffen wurde (es hätten sich sicherlich ge nauso viele misslungene Werke finden lassen). Sondern an einem Ge fühl der Erleichterung. Die Zwischenbilanz der ‹haltbaren› Kunst des Bauens zeigt: Die deutsche Wiedervereinigung hat, was wir Deutsche oftmals übersehen, nicht nur Kosten und Desillusionierung gebracht, sondern auch kulturelle, künstlerische, bauliche und technische Er rungenschaften ermöglicht, um die wir im Ausland zu Recht Bewun derung erfahren.
Ganz anders und doch ähnlich wie die architekturkritische Bestands aufnahme über das Neu Bau Land müsste eine Dokumentation aussehen, die sich angesichts einer ungewissen Zukunft vieler ostdeutscher Kultureinrichtungen mit dem status quo in Kulturinstitutionen und freien Initiativen zu beschäftigen hätte. Viele Ansätze einer solchen Bestandsaufnahme waren auch zu spüren, als während eines Work shops die von der Kulturstiftung des Bundes geförderten Projektträ ger des Fonds zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements für die Kultur in den neuen Bundesländern über Erfahrungen und aktuelle Nöte bzw. Freuden berichteten. Auch wenn die Akteure anhand ihrer Flyer, Erzählungen, Broschüren aus einem lebendigen Prozess nur Impressionen vermitteln konnten, zeichneten sich die Umrisse ‹typischer› Kulturgeschichten aus dem Kulturlabor Ostdeutschland deut lich ab. Da hat es die Architekturfotografie mit ihren Bestandsauf nahmen im Neu Bau Land leichter.
Quintessenz des Sozialen
Es ist immer wieder das gleiche: Die neue, alte Erfahrung eines geteilten (Kultur-)Erlebens zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Schicht unter dem Zeichen von Kunst und Kultur begeistert, ent faltet Energien, elektrisiert. «Wir haben etwas gemeinsam auf die Bei ne gestellt» — diese unreligiösreligiöse Urerfahrung, der aus eigener Kraft erzeugte Glanz inmitten der vermeintlichen Misere, inmitten des Krisengeredes, trifft ein Bedürfnis und lässt Menschen die Orte aufsuchen, an denen Kultur zum Kristallisationspunkt wird. Sei es als Macher oder als Zuschauer — die sich bei solchen Events oftmals weniger als Konsumenten denn als Teil des Geschehens fühlen. Alle Workshopteilnehmer konnten solche Geschichten der immer wieder zu erlebenden magischen Momente erzählen, die sie zu dem gebracht hätten, was sie heute tun. Wenn kleine Kinder und Jugend-liche eines Dorfes als Opernballett im Elfenkostüm (mit Gummistiefeln an den Füßen) durch den Schweinestall tanzen, dann ist dies ein solcher Mo ment. Oder wenn eine Kirche, die schon fast Ruine war, einmal im Monat zum Konzertsaal wird. Das Beispiel Stelzen: Tausende sind es, die inzwischen dorthin reisen. Die meisten aus der Umgebung, aber die Effekte auf die Hotels der Umgebung sind beträchtlich. Beispiel Klein Leppin: Da kamen statt der erwarteten 200 Gäste gleich im ersten Jahr mehr als 1000. Es sind Zahlen wie diese, die neugierig ma chen — in einer Zeit, in der im Kulturleben keine Ressource so knapp ist wie die Aufmerksamkeit des Publikums und kein Gut so kostbar wie die Bereitschaft, sich für ein Kulturereignis auf den Weg von A nach B zu machen — und dafür auch noch zu bezahlen. Museumsdirektoren und Theaterintendanten wissen davon allüberall ein (Kla ge-)Lied zu singen. Es sei denn, sie können sich das Label MOMA einkaufen.
Ulrike Gropp ist freiberufliche Journalistin für Hörfunk und Print in Leipzig. Sie macht Radio im Auftrag von WDR und Deutschlandfunk, schreibt für die deutschpolnische Zeitschrift Dialog, die Neue Zürcher Zeitung und für das Leipziger Stadt magazin Kreuzer
3� fonds neue länder
M aCht und freundsChaft
Ungeachtet der seit längerem kühlen politischen Beziehungen zu Russland bereitet die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg in Zusammenarbeit mit renommierten Partnern aus Russland, der Staatlichen Eremitage und dem Staatlichen Museumsreservat Peterhof die Ausstellung Macht und Freundschaft. Berlin — St. Petersburg 1800 1860 vor, die vom 13. März bis zum 26. Mai 2008 im MartinGropius-Bau Berlin und danach — mit einem veränderten kuratorischen Konzept — in St. Petersburg gezeigt wird. Die Kulturstiftung des Bundes fördert damit weitere große Ausstellungen zu den deutschrussischen Kulturbeziehungen, nachdem sie mit den Ausstellungen Berlin — Moskau, Moskau — Berlin 1950 2000 im Jahr 2004 einen viel beachteten Akzent im deutsch-russischen Kulturdialog gesetzt hatte. Die Kunsthistorikerin Ada Raev erläutert den Stellenwert der Ausstellung Macht und Freundschaft als Wieder entdeckung einer kulturhistorisch vernachlässigten Epoche europäischer Geschichte.
von ada raev s
eit Michail Gorbatschows Perestroika-Politik gab es in der Bundesrepublik Deutschland und namentlich in Berlin wiederholt Möglichkeiten, sich mit der Kunst jenes Landes vertraut zu machen, das den Deut schen im 20. Jahrhundert durch historische Katastrophen fremd ge worden war. Die Revolution in Russland und der darauf folgende Sta linismus einerseits und der durch die Nationalsozialisten entfesselte Zweite Weltkrieg andererseits sowie der Kalte Krieg hatten nachhaltig dazu beigetragen. Doch auch ins 19. Jahrhundert zurückreichende Stereotypen von Russland als dem ‹Anderen› im Verhältnis zu Westeuro pa hatten zu Klischeevorstellungen geführt, die schließlich in Winston Churchills Ausspruch kulminierten: «Russland ist ein Rätsel inner halb eines Geheimnisses umgeben von einem Mysterium.» Unbeha gen und Faszination schwingen darin gleichermaßen mit.
Es waren zunächst die zahlreichen, seit den 1970 er Jahren gezeigten Aus stellungen der russischen Avantgarde, die es dem westlichen Publikum ermöglichten, sich einen Zugang zur russischen Kunst zu verschaffen. Die in ihrer formalen Kühnheit zuweilen atemberaubenden Werke von Chagall, Kandinsky, Malewitsch, Popova und Rodtschenko wa ren durchaus dazu angetan, sowohl die Zugehörigkeit der russischen Künstler und Künstlerinnen zu den universalen Entwicklungssträn gen der Moderne als auch die nationalen Quellen ihrer Kunst zu verge genwärtigen. Dennoch rekurrieren so manche Ausstellungstitel bis auf den heutigen Tag auf eine scheinbar von anhaltendem Unwissen und diffusen Erwartungen geprägte Haltung Russland und seiner Kultur gegenüber: Man denke an die in Saarbrücken und in Berlin mit Erfolg gezeigte Ausstellung Auf der Suche nach Russland. Der Maler Ilja Repin oder die im Sommer 2007 in der Ausstellungshalle der Bun desrepublik Deutschland in Bonn gezeigte Schau Russlands Seele. Ikonen, Gemälde, Zeichnungen aus der Tretjakow-Galerie Moskau. 2003 war am selben Ort und anschließend im Martin-Gropius-Bau Berlin die kulturhistorische Ausstellung Der Kreml. Gottesruhm und Zaren pracht mit spektakulären Objekten, die Russland nur selten verlassen, zu sehen. Mit der Betonung von Frömmigkeit und Prunkentfaltung im Ausstellungstitel wurden dabei absichtsvoll die kulturellen Para meter benannt, mit denen sich auch das heutige offizielle Russland Wladimir Putins unter Berufung auf einen zeitlosen Byzantinismus nach innen und nach außen darstellt.
Im Abstand von knapp zehn Jahren, 1995 /1996 und 2003/2004, war der Martin-Gropius-Bau zweimal Schauplatz von Ausstellungen russischer Kunst, die den Nerv des Publikums insofern trafen, als sie die russische Kunst des 20. Jahrhunderts nicht als ‹Ding an sich› präsentierten, sondern sie parallelen künstlerischen Entwicklungen in Deutschland gegenüberstellten. Gemeint sind die Ausstellungen Ber lin — Moskau 1900 1950 und Berlin — Moskau 1950 2000, letztere gefördert von der Kulturstiftung des Bundes.Während diese den Aus stellungsbesucher mit einem nicht chronologisch konzipierten, dafür von kuratorischen Spitzfindigkeiten bestimmten Parcours irritierte und überforderte, fesselte erstere durch zeitparallel angelegte Gegen überstellungen der einzelnen Kunstgattungen, einschließlich Litera tur, Musik, Fotografie und Film.
Die geplante Ausstellung Macht und Freundschaft. Berlin — St Peters burg 1800 1860 knüpft mit dem Fokus auf den Zusammenhang von Geschichte und Kunst und der Berücksichtigung der deutschen wie der russischen Seite an die erwähnten Ausstellungen an. Nach der wiederholten Konzentration auf Moskau wird der Blick nun auf jene Stadt gerichtet, die seit ihrer Gründung 1703 als das ‹Fenster nach Europa› galt und von 1712 bis 1917 die Hauptstadt des Russischen Reiches gewesen war.
Im Mittelpunkt der Ausstellung Macht und Freundschaft. Berlin — St. Petersburg 1800 1860 stehen die gleichermaßen von politischem Kal kül wie von kulturellen Aktivitäten geprägten Beziehungen zwischen Preußen und Russland. Die Napoleonischen Kriege und die in ihrem Ergebnis geschlossene ‹Heilige Allianz› zwischen Russland, Preußen und Österreich, aber auch die revolutionären Ereignisse von 1830 und 1848 verliehen ihnen eine gesamteuropäische Dimension. Zwischen den Bündnispartnern im Kampf gegen Napoleon, Zar Alexander I ., König Friedrich Wilhem III . und Königin Luise entwickelte sich eine
persönliche Freundschaft durch die 1817 erfolgte Eheschließung des russischen Großfürsten Nikolai Pawlowitsch und nachmaligen Za ren Nikolaus I . mit Prinzessin Charlotte von Preußen. Nach ihrem Übertritt zum orthodoxen Glauben (fortan hieß sie Alexandra Feo dorowna) gewann die Beziehung zwischen Preußen und Russland zusätzlich einen persönlichen, von Zuneigung und Sympathie getra genen Charakter. Beide Ebenen, so wird in der Ausstellung zu erleben sein, bestimmten das kulturelle Klima in Berlin und St. Petersburg. Besonderes Augenmerk gilt dem regen beidseitigen Austausch, in den Architekten wie Wassily Stassow und Karl-Friedrich Schinkel, Intel lektuelle wie Alexander von Humboldt und Wassily Shukowski, Ma ler wie Franz Krüger, Eduard Gaertner und Grigori Tschernetzow sowie Bildhauer wie Christian Daniel Rauch, Carl Friedrich Wich mann und Baron Peter (Pjotr) Clodt von Jürgensburg involviert wa ren. Der Ausbau der Kulturlandschaften von Berlin und Potsdam, Petersburg und Umgebung weist viele Parallelen und gelegentliche Souvenirs auf, wie zum Beispiel das sorgfältig restaurierte russische Dorf Alexandrowka in Potsdam. Bildnerische Zeugnisse auf Lein wand, Papier und Porzellan sowie Requisiten von höfischen Ereignis sen wie dem Fest Lalla Rookh 1821 und dem Fest der weißen Rose 1829 in Potsdam und der Parade von Kalisch 1835. Aber auch die Rei sezeichnungen von Friedrich Wilhelm IV. lassen eine Epoche leben dig werden, die politisch konservativ und dennoch von Vorboten der Moderne berührt war. Dazu gehört die einsetzende Trennung von ‹öffentlich› und ‹privat›. Sie manifestiert sich im Kontrast zwischen spätklassizistisch geprägten städtebaulichen Großprojekten einerseits und der biedermeierlich anmutenden Gestaltung der Wohnbereiche sowohl der Zaren- als auch der Königsfamilie, denen jeweils eigene Ausstellungsräume mit Architekturzeichnungen und Interieurdarstellungen gewidmet sein werden.
In Deutschland wie in Russland setzte sich allmählich eine versachlich te Sicht auf die Wirklichkeit durch, womit auch neue Bevölkerungs schichten Bildwürdigkeit erlangten, doch behielt die der Adelskultur eigene Prachtentfaltung ihren Stellenwert, wie repräsentative Bildnisse der Monarchen, monumentale Prunkvasen und erlesene Mala chitarbeiten zeigen werden. Im Kontrast dazu werden unter anderem Fotografien aus dem Krimkrieg zu sehen sein, die nicht nur den Be ginn einer neuen medialen Epoche, sondern auch eines neuen poli tischen Zeitalters ankündigen, in dem das Klima der deutsch-rus sischen Beziehungen rauer wurde.
Für ein halbes Jahrhundert aber, so dürfte aus der Ausstellung zu lernen sein, waren das an Naturressourcen reiche Russland und das diesbe züglich eher bescheiden ausgestattete Preußen in einem vielgestalti gen Dialog damit beschäftigt, die Herausforderungen der sich ankün digenden Modernisierung in allen Lebensbereichen zu bewältigen. In romantischen Träumereien mit arkadischen wie national konno tierten Motiven wurden hier wie dort Zeugnisse des industriellen Fortschrittes und damit menschlicher Erfinderkraft heimisch. In dem erweiterten Europa der Gegenwart und einem sich wandelnden Russ land wird das kulturelle Klima von anderen Parametern bestimmt als von Hochzeitspolitik oder kriegerischen Auseinandersetzungen, und auch persönliche Freundschaften oder Sympathien zwischen Staa tenlenkern haben keinen nennenswerten Einfluss auf die Kulturbe ziehungen. Möge die gegenwärtige kulturelle Zusammenarbeit zu ei ner Klimaerwärmung beitragen und mehr sein als romantisches Wunschdenken oder politisches Kalkül.
Ada Raev, geboren 1955 in Berlin, studierte Kunstgeschichte und promovierte an der Lomonosov-Universität Moskau. Seit 1999 ist sie Privatdozentin am Kunstgeschicht lichen Seminar der Humboldt-Universität zu Berlin. Demnächst erscheint: Ada Raev & Isabel Wünsche (Hgg.): Kursschwankungen. Russische Kunst im Wertesystem der europäischen Moderne. Lukas Verlag Berlin 2007
36 aus den projekten
p rojekte bild und rau M
au swahl ]
Von den insgesamt 34 Projekten, die die Jury der Kulturstiftung des Bundes auf ihrer 11. Sitzung im April 2007 für eine Förderung ausgewählt hat, stammen 13 Projekte aus dem Bereich Bildende Kunst. Wir möchten Sie hier auf einige Ausstellungen aufmerksam machen, die in den nächsten Monaten (Oktober 2007 –. April 2008) stattfinden. Eine Übersicht über alle Ausstellungsprojekte finden Sie auf unserer Internetseite www.kulturstiftung-bund.de unter dem Menüpunkt Sparten / Bild und Raum.
ökomedien / eco-media Ausstellung Künstlerische Leitung: Sabine Himmelsbach, Yvonne Volkart I Mitwirkende / Künstler: Ieva Auzina / Esther Polak (NL), Critical Art Ensemble und Beatriz da Costa (USA), Free Soil (USA/DK/D/AU), Tue Greenfort (DK), Christina Hemauer / Roman Keller (CH), infossil (D), Natalie Jremi jenko (USA), Franz John (D), Christoph Keller (D), Tea Mäkipää (FIN), Eva und Franco Mattes a.k.a. 0100101110101101.org (I), Iñigo Manglano-Ovalle (ES), Andrea Polli (USA), Sabrina Raaf (USA), Transnational Temps (ES/F/USA), Insa Winkler (D), Yonic (CH/BR) I Veranstaltungsort und -zeitraum: Edith-Ruß-Haus für Medienkunst, Oldenburg; 13 10 07 13 1 08
Überlegungen zur Fragilität von Ökosystemen, zu Nachhaltigkeit, alternativen und erneuerbaren Energien bilden die Grundlage für das Ausstellungsprojekt, in dem die Rolle der Kunst und der Neuen Me dien für das Verständnis von Ökologie im Vordergrund steht. Das Verhältnis von Menschen und Tieren oder auch organischen und an organischen Substanzen wird immer mehr als ein Austauschverhält nis von labilem Gleichgewicht verstanden, das durch naturwissen schaftliche Aufzeichnungsweisen nur unzureichend erfasst wird. Die Arbeiten in diesem Projekt erproben neue Verbindungen von Kunst, Wissenschaft und Technik zur Entwicklung und Darstellung neuer Wahrnehmungsmuster über die Kommunikation und Interaktion im ökologischen System.
vom funken zum pixel Zur Entwicklung zeitgenössischer Kunst im Zusammenspiel mit interaktiven und digitalen Medien Ausstellung Künstlerische Leitung: Richard Castelli I Künstler: Dumb Type (J), minim++ (J), Studio Az zurro (IT), Romy Achitiv (IL), Jean Michel Bruyère (F), Olafur Eliasson (DK), Kai Fuhr mann, Doug Hall (USA), Nam June Paik, Jeffrey Shaw (AUS), Saburo Teshigawara (J), James Turrell (USA), u a. IVeranstaltungsort und -zeitraum: Martin-Gropius-Bau Berlin; 28 10 07 14 1 2008
Im Brennpunkt der großen Ausstellung im Berliner Martin-GropiusBau steht der Zusammenhang von aktuellen Kunstformen und tech nologischer Energie. Sie präsentiert international hochrangige Künst ler/innen, die mit interaktiven und digitalen Medien in großem Maß stab und mit hohem technologischen Aufwand arbeiten. Im Medium der Kunst wird gezeigt, wie das Pixel als Kernzelle des elektronischen Bildes und das elektronische Bild als Träger einer Form von Energie, die keine fossilen Eigenschaften mehr hat, unsere Vorstellungen von prinzipiell beherrschbarer Energie radikal in Frage stellt. Die Ausstel lung holt viele großformatige und technisch hoch komplizierte Instal lationen zum ersten Mal nach Deutschland und zeigt auch neue Auf tragswerke.
islands & ghettos Ausstellung, Symposien und Rah menprogramm Künstlerische Leitung: Johan Holten (DK) I Co-Kuratoren und Recherche: Stefan Horn (D), Kevin Mitchell (USA), George Katodrytis (GR), Hubert Klumpner (A) und Alfredo Brillembourg (YV) I Künstler/innen: Ursula Biemann (CH), Angela Sanders (CH), Sabine Bitter und Helmut Weber (A), Simone Bitton (A), Stefano Boerri und Multiplicity (I), Christoph Büchel (CH), Oliver Chanarin (GB) und Adam Broomberg (ZA), Nikolaj Larsen (DK), Bettina Lockemann, Dorit Margreiter (A), Mar jetica Potrè (SLO), Daniela Rossel (MEX), Andreas Siekmann, Vangelos Vlahos (GR), Sil ke Wagner, Carey Young (GB), u a. I Veranstaltungsorte und -zeitraum: Heidelberger Kunstverein, Mannheimer Kunstverein, Forum 76-Heidelberg, Ruprecht-Karls-Uni versität Heidelberg; 1 3 14 9 08 An Stelle herkömmlicher, staatlicher Territorialgrenzen strukturieren zunehmend neue, private, wirtschaftliche und sicherheitstechnische Grenzen die globalisierte Welt. Das internationale Projekt Island & Ghettos beschäftigt sich mit Phänomenen territorialer Ein- und Aus grenzungen. In einer Ausstellung mit Arbeiten von 35 Künstler/innen untersucht der Heidelberger Kunstverein zwei Beispiele für die Ten denz zur sozialen ‹Verinselung›: die künstlichen Inselgruppen vor Dubai als ästhetische Überhöhung sozialer Abgrenzung und die ‹ga ted communities› von Caracas — Wohnkomplexe der Ober- und Mit telschicht, die sich gegen die verarmten ‹barrios› mit hohem sicher heitstechnischen Aufwand abschotten. Die Ergebnisse gemeinsamer Recherchen diskutieren die beteiligten Künstler zusammen mit loka len Architekten und Urbanisten auf verschiedenen Symposien.
könig lustik!? Jérôme Bonaparte und der Modellstaat Königreich Westphalen Ausstellung Veranstaltungsort und -zeitraum: Museum Fridericianum, Kassel; 19 3 29 6 2008
Zentralfigur der Ausstellung über das Königreich Westphalen ist der als ‹König Lustik› geschmähte französische Monarch Jerôme Bona parte (1784 1860). Bedeutende Kulturleistungen in Musik und Thea ter, Architektur und Kunsthandwerk sind der kurzen Regierungszeit Jérôme Bonapartes, eines Bruders von Napoleon, zu verdanken. Die kurze kulturelle Glanzzeit war jedoch dadurch getrübt, dass sich Na poleon entschied, die europäischen Kunstschätze im Louvre zu kon zentrieren. Dadurch entstanden den landgräflichen Sammlungen in Kassel schwere Verluste. Die kulturhistorische Ausstellung unter sucht zum ersten Mal die Licht- und die Schattenseiten dieses histo risch einzigartigen Modellstaates und möchte mit etwa 750 Objekten einen umfassenden Einblick in die facettenreiche Geschichte des Kö nigreichs Westphalen gewähren.
lovis corinth und die geburt der moderne Ausstellung Künstlerische Leitung: Serge Lemoine (F), Hans-Werner Schmidt, Ulrike Lorenz I Ver anstaltungsorte und -zeitraum: Musée d’ Orsay Paris, 31 3.–22 6 08; Museum der bil denden Künste Leipzig, 9 7.–12 10 08; Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg, 9 11 08 15 2 09
Lovis Corinth, unter den Malern ein Solitär zwischen Tradition und Moderne, hat weit bis ins 20. Jahrhundert das Werkschaffen nachgeborener Künstler beeinflusst. Anlässlich des 150. Geburtstags des Künstlers wird eine große Retrospektive mit Werken aus den Bestän den des Leipziger Museums der bildenden Künste und des Kunst forums Ostdeutsche Galerie Regensburg in den Städten Leipzig, Re gensburg und Paris gezeigt. In Frankreich wird mit der Ausstellung im Musée d’ Orsay erstmals das Werk Corinths in einem solchen Um fang präsentiert. Die Ausstellung untersucht die Wirkung Corinths auf die Malerei des 20. Jahrhunderts und setzt an ihren drei Stationen unterschiedliche Akzente. So werden zum Beispiel in Leipzig Bezüge sichtbar, die Corinths Spätwerk unter anderem mit Sighard Gille, Bernhard Heisig und Willi Sitte verbinden.
jewgeni chaldej — eine retrospektive Ausstellung Künstlerische Leitung: Ernst Volland I Mitwirkende: Jacqueline Köster, Ingrid Fenner, Enno Kaufbold, Bernd Ulrich, Bernd Hüppauf, Peter Jahn, Heinz Krimmer I Veran staltungsorte und -zeitraum: Martin-Gropius-Bau Berlin, 1 4 15 7 08; Centre of Con temporary Art Kiew (UA); September – Oktober 08 Jewgeni Chaldejs Bild, das russische Soldaten beim Hissen der roten Fahne auf dem Berliner Reichstag zeigt, ist eine Ikone der Fotografie geschichte des 20. Jahrhunderts geworden. Zehn Jahre nach dem Tod Chaldejs widmet die Berliner Ausstellung dem Fotografen eine um fangreiche Retrospektive. Chaldejs Schaffen ist biografisch, historisch und ästhetisch eng mit der deutschen Geschichte verbunden. Die Aus stellung erschließt diese Zusammenhänge erstmals einem Publikum in Deutschland, Russland und der Ukraine. Die Ausstellung würdigt das Lebenswerk eines ukrainischen Juden, der zum Opfer sowohl des deutschen als auch des stalinistischen Antisemitismus wurde.
37 aus den projekten
[
Meldungen
biennale der tanzausbildung gegründet
Vom 27 2.– 4.3.08 findet erstmals die Biennale der Tanzausbil dung statt. Das Projekt wird vom Tanzplan Deutschland finan ziert und gemeinsam mit dem Theater Hebbel am Ufer durch geführt. Sie ist — vergleichbar dem Theatertreffen der Schauspielschulen — als Plattform gedacht, um Arbeiten von und mit Studenten der staatlichen Ausbildungsinstitutionen einem brei ten Publikum bekannt zu machen. Neben den Präsentationen werden ein Workshop-Programm sowie eine Fachtagung für Studenten und Pädagogen angeboten. U.a. wird William Forsythe das Multi-Media Projekt Motion Bank als neues Ausbildungs tool für Tänzer und Choreografen präsentieren. Nach dieser ersten Biennale in Berlin soll das Projekt zukünftig an wechseln den Orten in Deutschland stattfinden. Weitere Infos unter: www.tanz plan-deutschland.de
publikation ‹wissen in bewegung› zum tanzkongress deutschland erschienen Zum Tanzkongress Deutschland, der im letzten Jahr im Haus der Kulturen der Welt stattfand, ist eine Publikation erschienen. Un ter dem Titel ‹Wissen in Bewegung› (‹Knowledge in Motion›) entsteht im transcript-Verlag in der von Prof. Gabriele Brandstetter und Prof. Gabriele Klein betreuten Reihe ‹Tanzscripte› eine deutsche und eine englische Ausgabe. Mit Beiträgen von Irene Sieben, Claudia Jeschke, Norbert Servos und Jason Beech ey zu Themen wie ‹Tanzgeschichte und Rekonstruktion› oder ‹Körperwissen und Gedächtnis›. Scott de Lahunta führt ein Ge spräch mit Meg Stuart über ihre neuesten Arbeiten und Felix Ruckert erläutert unter der Überschrift ‹Berühren statt Fum meln› seine Vorstellungen von einem partizipativen Theater. Die Publikation erscheint zur Frankfurter Buchmesse 2007
jedem kind ein instrument startet an 223 grundschulen im ruhrgebiet 34 Kommunen im Ruhrgebiet waren beim Programmstart von Jedem Kind ein Instrument dabei. Damit nehmen zunächst 7 211 Erstklässer an 223 Grundschulen im jetzigen Schuljahr am ge meinsamen JEKI-Projekt der Kulturstiftung des Bundes, der Landesregierung Nordrhein-Westfalen und der Zukunftsstif tung Bildung teil. Einmal pro Woche stellen Musikschullehrer den Grundschülern verschiedene Instrumente spielerisch vor: von der Geige über das Akkordeon bis hin zur Baglama. Zum Ende des Schuljahres können die Kinder dann wählen, welches Instrument sie während ihrer Grundschulzeit erlernen möchten. Jedem Kind ein Instrument ist der Beitrag der Kulturstiftung des Bundes zur Kulturhauptstadt 2010. Alle Grundschulkinder im Ruhrgebiet sollen bis dahin die Möglichkeit haben, ein Instru ment ihrer Wahl zu erlernen. Das in Bochum ansässige Projekt büro unterstützt die Musikschulen und Grundschulen in allen Fragen der Umsetzung, es stellt Unterrichtsmaterialien bereit, begleitet den Instrumentenkauf und bietet Weiterbildungen für die beteiligten Lehrer an. Sitz des Projektbüros ist Bochum. Dort stehen Mitarbeiter für Auskünfte und Informationen zum Pro gramm unter folgender Adresse zur Verfügung: Jedem Kind ein Instrument, Willy-Brandt-Platz 1 3, 44787 Bochum, Tel: 0234 5417470 Weitere Informationen finden Sie unter: www.kulturstiftung-bund.de/jedemkind ausstellung nationalschätze aus deutschland von luther zum bauhaus in warschau Mehr als 20 bedeutende Kultureinrichtungen der neuen Bundes länder haben eine Auswahl ihrer Werke zusammengestellt, die 2005 in der Bonner Bundeskunsthalle und 2006 in der National galerie Budapest präsentiert wurde. Vom 30. Oktober 2007 bis zum 13. Januar 2008 ist diese Ausstellung der Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen (KNK) nun im Königsschloss Warschau zu sehen. Sie umfasst rund 300 eindrucksvolle Kunstwerke sowie Exponate aus Natur und Wissenschaft. Die Ausstellung stellt den Wandel unterschiedlicher Museums- und Sammlungstypen im europäischen Kontext dar und zeigt, dass dabei entscheidende Impulse vom Osten Deutschlands ausgegangen sind.
gesamtwerk von alexander kluge auf dvd
Das Filmfestival in Venedig nimmt in diesem Jahr seinen eigenen und den Geburtstag von Alexander Kluge zum Anlass, den Re gisseur mit einer Retrospektive seines filmischen Werks zu be trauen. Rechtzeitig hierzu erscheinen die von der Kulturstiftung des Bundes geförderten und vom Goethe-Institut gemeinsam mit dem Filmmuseum München entwickelten ersten acht Bände einer umfassenden Werkausgabe Alexander Kluges. Insgesamt 15 DVD s präsentieren das umfangreiche filmische Werk eines der vielfältigsten und einflussreichsten Filmemachers, Schrift stellers und Medienphilosophen der deutschen Geschichte: an gefangen von den frühen Spiel- und Montagefilmen bis hin zu den jüngeren TV-Produktionen Alexander Kluges. Nähere Infor mationen, auch zum Vertrieb der Edition, finden Sie unter: www.edition-film museum.com.
world cinema fund fördert erstes projekt aus afrika
Der World Cinema Fund (WC F) hat seine neuesten Jury-Ergeb nisse bekannt gegeben: In Israel fördert der WCF unter anderem den Dokumentarfilm Justice Must Be Seen des Regisseurs Ra’ anan Alexandrowicz, im Iran den Spielfilm The House under the Water unter der Regie von Sepideh Farsi; zum ersten Mal fördert der WCF zudem eine Spielfilmproduktion in Angola: O Grande Kilapy (Le Coup du Siècle) unter der Regie von Zezé Gamboa. Seit Gründung des WCF im Oktober 2004 wurden 603 Projekte aus 53 Ländern eingereicht. 40 Projekte erhielten Produktionsbzw. Verleihförderung, 17 Filme konnten inzwischen fertig ge stellt wurden — darunter international ausgezeichnete Werke wie Paradise Now von Hany Abu-Assad oder Stilles Licht von Carlos Reygadas. Nähere Informationen zum World Cinema Fund finden Sie unter: www.berlinale.de.
litrix.de startet mit brasilienschwerpunkt in die dritte runde Ziel des internetbasierten Projektes Litrix.de ist es, einen Eindruck von der Vielfalt der deutschsprachigen Literaturlandschaft zu vermitteln und im Ausland das Interesse an deutschsprachiger Literatur zu steigern sowie zu Übersetzungen aktueller Bü cher anzuregen. Jährlich wählt Litrix.de Schwerpunktländer und -regionen aus, um dort gezielt den kulturellen Austausch mit Deutschland zu verstärken. Die Aktivitäten in Brasilien, die das Übersetzungsförderungsprogramm begleiten, haben im Juni 2007 begonnen und laufen noch bis 2008. So finden etwa Lesungen und Diskussionen mit deutschen Autoren, Workshops für Verleger und Übersetzer statt, die von den Goethe-Instituten in Brasilien und verschiedenen lokalen Partnern aus der brasilia nischen Literatur- und Verlagsszene unterstützt werden. Eine aus brasilianischen Literaturkritikern und Übersetzern bestehende Jury berät das Projekt. Weitere Infos unter: www.litrix.de
schicht !
wenn sie dieses magazin regelmäßig beziehen möchten, …
… schicken Sie eine E-Mail mit Ihrer Postadresse und Telefon nummer an: info@kulturstiftung-bund.de oder rufen Sie uns unter der Telefonnummer +49 (0)345 2997 124 an. Wir nehmen Sie gern in unseren Verteiler auf!
die website
Die Kulturstiftung des Bundes unterhält eine umfangreiche zweisprachige Website, auf der Sie sich über Arbeit und Aufgaben der Stiftung, die geförderten Projekte, die Programme und vieles mehr informieren können. Besuchen Sie uns unter: www.kulturstiftung bund.de
bipolar endet mit hommage an györgy ligeti Mit einer Hommage an den ungarischen Komponisten György Ligeti geht Bipolar, das Programm für deutsch-ungarische Kul turbegegnungen, im Oktober feierlich zu Ende. Im Mittelpunkt des Abends steht Ligetis Kammerkonzert für dreizehn Instru mentalisten, gespielt vom Ensemble Ligatura Berlin unter Lei tung von Ferenc Gábor. Im Rahmen des gemeinsam mit dem Ungarischen Akzent ausgeschriebenen Kompositionswettbewerbes präsentiert das Ensemble zudem die Uraufführungen der Kompositionen von Balázs Horváth (H ), Martin Grütter (D ) und Péter Koszeghy (H ). Der Sieger des Wettbewerbs wird am selben Abend durch eine internationale Jury unter Leitung des un garischen Komponisten Péter Eötvös ermittelt. Die Kulturstif tung des Bundes hat mit dem Programm Bipolar in den Jahren 2006 2007 mehr als 30 Kooperationsprojekte zwischen deut schen und ungarischen Kulturschaffenden auf den Weg ge bracht. Nähere Informationen finden Sie unter www.projektbipolar.net. Das Konzert findet am Samstag, 13. Oktober 2007, um 19 00 Uhr in der Berliner Akademie der Künste am Pariser Platz statt.
Im Rahmen des Programms Arbeit in Zukunft hat die Kulturstif tung des Bundes gemeinsam mit dem Suhrkamp Verlag Schrift stellerinnen und Schriftsteller eingeladen, Expeditionen in ver schiedene Berufssphären zu unternehmen. Dabei sollten sie sich in die Position eines Beobachters versetzen, der aus der Zukunft zurückblickt und unsere heutige Arbeitswelt beschreibt und kommentiert. Mit 16 Arbeitsreportagen für die Endzeit liegen nun die Ergebnisse der Recherchen vor. Aus der Arbeitswirklich keit des Jahres 2006 berichten Bernd Cailloux, Dietmar Dath, Felix Ensslin, Wilhelm Genazino, Peter Glaser, Gabriele Goettle, Thomas Kapielski, Georg Klein, Harriet Köhler, André Kubic zek, Thomas Raab, Kathrin Röggla, Oliver Maria Schmitt, Jörg Schröder und Barbara Kalender, Josef Winkler, Feridun Zai moglu und Juli Zeh. Am 16. November 2007 wird das Buch in Berlin und im Januar 2008 in Köln jeweils in einer langen ‹Lese schicht!› präsentiert. Die Autorinnen und Autoren lesen ihre Texte, geben Einblick in die unterschiedlichen Berufssphären, er zählen von ihrer Reportagetätigkeit oder laden sich Gäste und Gesprächspartner ein. Die genauen Termine und weitere Infos zu der Veranstaltung finden Sie unter www.kulturstiftung-bund. de Ca.300 Seiten, Frankfurt 2006, ISBN -Nr. 978 3 518 12508 3 Das Buch Schicht ! Arbeitsreportagen für die Endzeit erscheint im Oktober 2007
``
auszeichnungen für filme der kurzfilmrolle mach doch was du willst
dvd von panzerkreuzer potemkin
erschienen Die deutsche Presse feierte Sergej Eisensteins rekonstruierten Revolutionsfilm Panzerkreuzer Potemkin aus dem Jahre 1925 bei seiner Premiere in Berlin als «Filmereignis von aufwühlender Bedeutung». Noch heute gilt der Panzerkreuzer als Meilenstein der Filmgeschichte — insbesondere in Kombination mit der von Edmund Meisel komponierten kongenialen Filmmusik. Zwei Jahre nach Abschluss des von Enno Patalas geleiteten Res taurierungsprojektes hat die Deutsche Kinemathek gemeinsam mit Transit Film eine aufwändig gestaltet DVD vorgelegt — in klusive der von Helmut Imig neu arrangierten Filmmusik von Edmund Meisel und mit einem zusätzlichen Dokumentarfilm, der die wechselhafte Geschichte des Panzerkreuzer Potemkin er zählt. Weitere Informationen zur DVD finden Sie unter www.transitfilm.de.
ausstellung schrumpfende städte auf tournee 2007 bis 2008 Nach internationalen Erfolgen u.a. in Venedig, Detroit und To kio kehrt die Ausstellung Schrumpfende Städte ab Herbst mit mehreren Schauen nach Europa zurück: an seine ursprünglichen Untersuchungsstandorte, die ehemaligen Industriemetropolen Manchester und Liverpool (14 11 07 20 01 08), und ins Deut sche Architekturmuseum DAM in Frankfurt/Main (30 11 07 20 1 08).Vom 17.Februar bis 27.April 2008 wird die Ausstellung dann im Ruhrgebiet (Dortmund: Museum am Ostwall / Duis burg: Liebfrauenkirche) zu sehen sein und schließlich, als letzte Station, im Museum für Stadtgeschichte von St. Petersburg in der Festung Peter and Paul (7 3.–2 8 4 08). Weitere Infos unter www. shrinkingcities.com
Die Filme der Kurzfilmrolle mach doch, was du willst aus dem Programm Arbeit in Zukunft der Kulturstiftung des Bundes sind auf zahlreichen Festivals ausgezeichnet worden. Wie ich ein frei er Reisebegleiter wurde von Jan Peters erhielt nicht nur den Juryund den Publikumspreis im Wettbewerb des Internationalen KurzFilmFestivals Hamburg, sondern auch den Jury- und den Publikumspreis des Internationalen Videofilmfestivals in Bo chum sowie den Preis der deutschen Filmkritik des Jahres 2007 in der Sparte Experimentalfilm. Outsourcing von Markus Diet rich war in der Next-Generation-Kurzfilmrolle auf dem Cannes Filmfestival vertreten und wurde mit dem Murnau-Kurzfilm preis 2007 ausgezeichnet. Der Autor und Regisseur Markus Dietrich erhielt den dkf-Regieförderpreis 2007 Bus von Jens Schill möller und Lale Nalpantoglu war der einzige deutsche Beitrag im Wettbewerb der Berlinale 2007. Momentan tourt die Kurz filmrolle durch deutsche Kinos.
Termine unter: www.machdochwasduwillst.org buch- und filmveröffentlichung 100 000 euro job — nützliche ansichten zur arbeit
Im Projekt 100 000 EURO JOB zeigten junge Menschen in Fil men, Videos, Performances, Aktionen, Podcast-Opern, Thea terstücken oder Ausstellungen, was für sie Arbeit heute und in Zukunft bedeutet. Im Herbst 2007 erscheint nun das Buch zum Projekt: Eine Sammlung von Texten zur Arbeit für jede Lebens lage mit Beiträgen u.a. von Jörg Albrecht, Holm Friebe, Johnny Häusler, Markus Kavka, Jörn Morisse, Kathrin Passig, Lisa Rank, Jochen Schmidt, Ulrike Sterblich u.a. Die 47 Projekte des 100 000 EURO JOB s werden vorgestellt und vom Supatopcheckerbunny kommentiert. Das Buch Der 100 000 EURO JOBRatgeber: nützliche und neue Ansichten zur Arbeit (inkl. DVD ) kann ab sofort unter www.10 0 00 0 EURO JOB .de bestellt wer den.
38 M eldungen
Vorsitzender des Stiftungsrats für das Auswärtige Amt für das Bundesministerium der Finanzen für den Deutschen Bundestag
als Vertreter der Länder als Vertreter der Kommunen als Vorsitzender des Stiftungsrats der Kulturstiftung der Länder als Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur
kulturstiftung des bundes
stiftungsr at
Bernd Neumann
Der Stiftungsrat trifft die Leitentscheidungen für die inhaltliche Ausrichtung, insbesondere die Schwer punkte der Förderung und die Struktur der Kulturstiftung. Der aus 14 Mitgliedern bestehende Stiftungsrat spiegelt die bei der Errichtung der Stiftung maßgebenden Ebenen der politischen Willensbildung wieder. Die Amtszeit der Mitglieder des Stiftungsrates beträgt fünf Jahre.
Staatsminister bei der Bundeskanzlerin und Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien Georg Boomgarden Staatssekretär
Dr. Barbara Hendricks Parlamentarische Staatssekretärin
Dr. Norbert Lammert Bundestagspräsident
Wolfgang Thierse Bundestagsvizepräsident
Hans-Joachim Otto Vorsitzender des Kulturausschusses
Dr.Valentin Gramlich Staatssekretär, Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt
Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig Staatssekretär, Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur Rheinland-Pfalz Klaus Hebborn Beigeordneter für Bildung, Kultur und Sport, Deutscher Städtetag Uwe Lübking Beigeordneter, Deutscher Städte- und Gemeindebund
Roland Koch Ministerpräsident des Landes Hessen Senta Berger Schauspielerin, Präsidentin der Deutschen Filmakademie Durs Grünbein Autor
Prof. Dr. Dr. hc.Wolf Lepenies Soziologe
jury
Die Jury, die aus Fachleuten der verschiedenen künstlerischen Sparten zusammengesetzt ist, befindet über die Anträge in der Allgemeinen Projektförderung.
Prof. Dr. Heinrich Dilly Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Dr. Ulrike Groos Künstlerische Leiterin der Kunsthalle Düsseldorf Dr. Christoph Heinrich Kurator am Denver Art Museum
Prof. Ulrich Khuon Intendant des Thalia Theaters, Hamburg Dr. Petra Lewey Leiterin der Städtischen Kunstsammlungen Zwickau Helge Malchow Geschäftsführer des Verlags Kiepenheuer & Witsch, Köln Christian Petzold Filmemacher, Berlin
Thorsten Schilling Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn Steffen Schleiermacher Komponist, Pianist, Leipzig Ilona Schmiel Künstlerische Leiterin Beethovenfest, Bonn
stiftungsbeirat
Der Stiftungsbeirat gibt Empfehlungen zu den inhaltlichen Schwerpunkten der Stiftungstätigkeit ab. In ihm sind Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik vertreten.
Dr. Christian Bode Generalsekretär des DAAD Jens Cording Präsident der Gesellschaft für neue Musik e.V. Prof. Dr. Max Fuchs Vorsitzender des Deutschen Kulturrats e.V.
Prof. Dr. Jutta Limbach Präsidentin des Goethe-Instituts Dr. Michael Eissenhauer Präsident des Deutschen Museumsbundes e.V. Martin Maria Krüger Präsident des Deutschen Musikrats
Prof. Dr. Oliver Scheytt Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft und Kulturdezernent der Stadt Essen Johano Strasser Präsident des P.E.N. Deutschland Isabel Pfeiffer-Poensgen Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder Frank Werneke Stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft ver.di e.V. Prof. Dr. Clemens Börsig Vorsitzender des Kulturkreises der Deutschen Wirtschaft im BDI e.V. Prof. Klaus Zehelein Präsident des Deutschen Bühnenvereins e.V.
Impressum
für den Inhalt] Redaktion Friederike Tappe-Hornbostel Redaktionelle Mitarbeit Tinatin Eppmann, Julia Mai Bildnachweis Luis Jacob Gestaltung cyan Herstellung hausstætter herstellung Auflage 20.000 Redaktionsschluss 15.8.2007
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. © Kulturstiftung des Bundes — alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung insgesamt oder in Teilen ist nur zulässig nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Kulturstiftung des Bundes.
der vor stand
Völckers Künstlerische Direktorin Alexander Farenholtz Verwaltungsdirektor
tea M Referentin des Vorstands Lavinia Francke Justitiariat Dr. Ferdinand von Saint André Kommunikation Friederike Tappe-Hornbostel [Leitung] / Tinatin Eppmann / Julia Mai / Christoph Sauerbrey / Arite Studier Allgemeine Projektförderung Kirsten Haß [Leitung] / Bärbel Hejkal / Kristin Schulz Wissenschaftliche Mitarbeit Dorit von Derschau / Dr. Holger Kube Ventura / Antonia Lahmé / Dr. Lutz Nitsche Uta Schnell / Eva Maria Gauß [Mitarbeit Fonds Neue Länder] Verwaltung Steffen Schille / Steffen Rothe / Kristin Salomon / Tino Sattler Zuwendungen und Controlling Anja Petzold / Ines Deák / Susanne Dressler / Marcel Gärtner / Andreas Heimann Berit Ichite / Lars-Peter Jakob / Berit Koch / Fabian Märtin Sekretariat Beatrix Kluge / Beate Ollesch [Büro Berlin] / Christine Werner Herausgeber Kulturstiftung des Bundes Franckeplatz 1 06110 Halle an der Saale Tel 0345‒2997 0 Fax 0345‒2997 333 info@kulturstiftung-bund.de www.kulturstiftung-bund.de
Hortensia Völckers, Alexander Farenholtz
Hortensia
das
Vorstand
[verantwortlich
39 gre M ien + i M pressu M
Filmstill aus der Videoinstallation A Dance for Those of Us Whose Hearts Have Turned to Ice von Luis Jacob (Mit freundlicher Genehmigung von Birch Libralato, Toronto.)