frühjahr 2011
das magazin der kulturstiftung des bundes
texte von jutta brückner ute frevert assaf gavron friedrich w. graf margot käßmann noémi kiss thomas lehr sibylle lewitscharoff dorota masłowska jürgen mlynek volker mosbrugger herfried münkler armin nassehi aleks scholz raoul schrott michel serres andrzej stasiuk andreas weber harald welzer



Ob Klima- oder demographischer Wandel, kulturelle Bildung oder Integration, religiöse Toleranz oder soziale Gerechtigkeit, der Ruf nach einem Bewusstseinswandel und der Appell an die Zukunftsfähigkeit unseres Denkens und Handelns werden im mer eindringlicher: Was brauchen wir für die Zukunft und was wollen oder sollten wir hinter uns lassen? Was können wir für das Überleben auf unserem Planeten tun und wie bewahren wir menschenwürdige Verhältnisse?
Die Kulturstiftung des Bundes widmet sich diesen Fragen in einem facettenreichen Programm mit dem Titel Über Lebens kunst [www.ueber-lebenskunst.org]. Er setzt bewusst auf se mantische Mehrdeutigkeit über Lebenskunst UND Überle benskunst: Angesichts weltweiter krisenhafter Entwicklungen rückt die individuelle Lebenskunst, das aus der Antike stammen de Konzept der ars vivendi, immer stärker in die globale Perspektive einer Kunst des Überlebens und der ebenso überlebenswich tigen Vorsorge für die kommenden Generationen. Vom 17. bis 21. August 2011 findet im Rahmen des Über Le benskunst -Programms ein Themenfestival in Kooperation mit dem Haus der Kulturen der Welt in Berlin statt, zu dem wir Tausende Besucher erwarten. Dafür wurden schon im vergangenen Jahr erste Vorbereitungen getroffen, denn dieses Festival soll in tatsächlich jeder Hinsicht, bis ins kleinste praktische Detail,
von einer konsequent durchdachten Lebenskunst zeugen, ange fangen bei so elementaren Dingen wie Schlafen und Essen. Zum Beispiel legte die Künstlerinnen-Gruppe myvillages.org eine ganz reale Vorratskammer für Lebensmittel an, mit denen sie die vie len Besucher über mehrere Tage bewirten will. Vorratskammern sind im Zeitalter der Tiefkühlkost und der Billigsupermärkte mit ihren industriell gefertigten, aus aller Welt im portierten Produkten etwas aus der Mode gekommen. Wir fin den, es geht auch anders. Dabei geht es uns nicht bloß um die Bewirtung und den Versuch, vom Getreide fürs Brot über Leinsaat für Speiseöl bis zur Milch für den Käse alles aus eigener, energiesparender Produktion vor Ort herzustellen und zu verarbeiten. Auch die Prozeduren und Geschichten um das Sammeln und Konservieren, die Herstellung der Lebensmittel oder die Formen des Handels und Tauschens sind Teil des Vorratskammer-Projekts: Die Idee der Vorratshaltung hat in der Konsum- und Wegwerfgesell schaft eine kulturelle Dimension. Ihre praktische Umsetzung verlangt planerische Voraussicht und ökonomische Logistik. Uns hat die reale Vorratskammer inspiriert und den Wunsch nach einer mentalen Vorratskammer geweckt: Was brauchen wir mor gen? Auf welches Wissen wollen wir später zurückgreifen können? So haben wir diese Ausgabe des Magazins der (Über)Lebenskunst gewidmet und eine Reihe von Persönlichkeiten aus Kultur und
Wissenschaft gefragt, mit welchen Gedanken sie die Vorratskam mer bestücken wollen. Wir haben viele Antworten bekommen, zum Teil sehr persönlich gehaltene, und waren beeindruckt von ihrer Vielfalt. Die kleinen Geschichten, Essays und Reflexionen präsentieren wir Ihnen so , dass sie an Speisekammern mit ihren ganz verschiedenen Vorräten zu erinnern vermögen wo der Schinken neben den Würsten hängt, die getrockneten Peperoni neben den Zwiebeln liegen und das eingemachte Obst neben den Gurkengläsern steht. Eines allerdings ist in der mentalen Vor ratskammer anders: Deren Produkte haben kein Verfallsdatum. Weniger von der Lebenskunst als ganz speziell von den Widrig keiten und Glücksbedingungen des Überlebens handeln die drei längeren Texte. Der österreichische Schriftsteller Raoul Schrott macht sich auf die dramatisch verlaufende Suche nach den ersten geologischen Überlieferungen unserer planetarischen Entstehungsgeschichte, der französische Philosoph Michel Serres fragt, wie unser Planet überlebensfähig wird und baut gedankliche Ret tungsboote, und die Filmemacherin Jutta Brückner schreibt einen berührenden Text über ihre an Demenz erkrankte Mutter, die sich in eine eigene Welt hinübergerettet hat.
vorratskammer harald welzer moralische vorratshaltung 6 ute frevert mit-freude 6 andreas weber menschen haben, pflanzen sind begriffe 7 sibylle lewitscharoff hamstern 8 margot käßmann lesen lehren 8 assaf gavron die zeitkapsel 9 armin nassehi eine zukunftsverweigerung 9 andrzej stasiuk und wie wäre es… 10 herfried münkler eine [fast] unmögliche kunst 10 thomas lehr der traum von der goldenen nuss 11 friedrich wilhelm graf klug werden 12 jürgen mlynek diagnose und therapie 12 aleks scholz der innere idiot 13 volker mosbrugger nicht gott, nicht teufel 14 noémi kiss mutter in der kammer 14 dorota masłowska slow mind 15 michel serres alle in die rettungsboote! 17 raoul schrott die erste erde 23 jutta brückner im zwischenreich der geister 29 meldungen 32 neue projekte 34 gremien + impressum 38
Die Bildstrecke Zeichnungen, Fotos, Aquarelle, Textcollagen verdanken wir der 1967 im niedersächsischen Heiligendorf geborenen Künstlerin Antje Schiffers , die 2003 die Künstlerinitiative myvillages.org mit Kathrin Böhm und Wapke Feenstra gründete. Sie beschäftigt sich mit dem Dorf als Ort kultureller Produktion. Antje Schiffers, die in Berlin lebt, war Blumenzeichnerin in Mexiko, Wandermalerin in Italien, Russland, Kasachstan, Kirgistan und Usbekistan, Werkskünstlerin in der Reifenindustrie so wie Botschafterin und Korrespondentin der Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig. 2007 bis 2009 arbeitete sie gemeinsam mit Thomas Sprenger am Projekt Ich bin gerne Bauer und möchte es auch gerne bleiben , das die Kulturstiftung des Bundes im Rahmen des Programms Arbeit in Zukunft förderte. Aus der Beschäftigung von myvillages.org mit der Landwirtschaft, lokaler Produktion und dem Internationalen Dorfladen entstand die Idee für die »Über Lebenskunst«Vorratskammer. Etliche Bilder in diesem Magazin entstanden im vergangenen Herbst auf einer mehrwöchigen Reise durch Chile.
kulturstiftung des bundes magazin 17






moralische vorratshaltung. eine streckübung. von harald welzer
Als Daniel Defoe Anfang des 18. Jahrhunderts durch das Gebiet um Newcastle reiste, dem damals wichtigsten Kohlefördergebiet Englands, zeigte er sich ratlos angesichts der »ungeheuren Hau fen, ja Gebirge von Kohlen, die aus jeder Grube gefördert werden, und wie viele solcher Gruben gibt es; uns erfüllt Staunen und wir fragen uns, wo wohl die Menschen wohnen mögen, die sie ver brauchen können.«1 Inzwischen wissen wir, wo die Menschen wohnten, die fossile Energien in den ungeheuren Mengen ver braucht haben, wie sie in Newcastle gleichsam schon mal bereitgelegt wurden: zunächst eben in England, dann auch in Deutsch land, in Nordamerika und mit erheblicher zeitlicher Verzöge rung in ganz Europa und in vielen anderen Teilen der Welt. Die Kohle ist leider noch immer nicht verbraucht; tatsächlich liegt nicht wenig Tragik darin, dass sie noch lange vorhalten wird, wes halb viele Länder und Konzerne auch mittelfristig auf Energie aus Kohleverbrennung setzen, trotz aller hinlänglich bekannter Klimaschäden, die das anrichtet. Doch darum soll es hier, in meiner moralischen Vorratskammer, gar nicht in erster Linie gehen, sondern vor allem um Defoes Er staunen. Der äußerst fantasiebegabte Autor des Robinson Crusoe , der sei es in Gestalt des Romans oder einer seiner vielen Verfilmungen Generationen von westlichen Kindern und Jugendlichen die Segnungen einer rational ordnenden Zivilisation nahegebracht hat, kann sich an dieser Stelle auf seine Fantasie überhaupt nicht verlassen: Was sich gerade vor seinen Augen vollzieht nämlich das Vorspiel zu jener industriellen Revolution, die das Antlitz Englands, dann Europas und schließ lich des ganzen Planeten radikal und nachhaltig veränderte , versteht er nicht. Wie auch? Niemand konnte zu diesem Zeit punkt ahnen, dass die zunächst industrielle Anwendung der fossilen Energie Kohle sukzessive die ganze Gesellschaft energe tisch revolutionieren und überhaupt erst alle Vorstellungen von Fortschritt, Wachstum und Unendlichkeit in die Welt bringen würde, denen die Ökonomen, Politiker und Manager bis heute huldigen.
Und noch weniger konnte jemand voraussehen, dass genau im Namen dieser Unendlichkeitsvorstellungen der Planet so sehr
geplündert und verdreckt wurde, dass er heute, 200 Jahre später, vor dem Kollaps steht. Nein, das ist falsch: Nicht der Planet steht vor dem Kollaps, sondern die meisten menschlichen Gesell schaften, die ihn besiedeln. Vielen von ihnen ist derzeit noch gar nicht klar, dass sie sich gegenwärtig gerade in Gewinner und Ver lierer des Klimawandels sortieren, und dass weder die Deutschen noch die vielzitierten und ökologisch geschmähten Chinesen zum Beispiel das Jahr 2030 in dem Zustand vorfinden werden, in dem sie es heute noch imaginieren: Und damit befinden sie sich exakt in derselben Situation wie Defoe vor zwei Jahrhunderten. Ihnen fehlt, mit einem Begriff von Günter Anders, die moralische Fantasie, sich vorstellen zu können, was man herstellen kann. Aber diese moralische Phantasie muss unbedingt in jede Vorrats kammer. Eine solche wird ja in Antizipation einer künftigen Si tuation gefüllt: um im Winter das im Sommer geerntete Gemüse essen oder in schlechten Zeiten das in reichen Jahren Gehortete verbrauchen zu können. Freilich ist den Bewohnern der fossilen Welt die Vorstellung ziemlich abhanden gekommen, was Saisons des Anbaus und Verbrauchs sind oder »schlechte Zeiten« sein sollen: Die halten sie allenfalls für eine Fernseh-Soap und an sonsten gibt es Alles immer, nämlich bei Lidl oder, je nach dem, bei denn’s.
Jedenfalls scheint gegenwärtig weder den Normalkonsumenten noch den LOHAS klar zu sein, dass ihre Konsumwelt drei Stützen voraussetzt: dass die Energiepreise so niedrig (und falsch) blei ben wie jetzt, dass die Ressourcenlage konstant ist und dass an sonsten nichts Dramatisches passiert, dass zum Beispiel also kein Ozean seinen Tipping Point erreicht und keine Megacity durch ein Extremwetterereignis zerstört wird. Bricht eine dieser Stüt zen weg, wird die Zeit des Alles immer vorüber sein; und wenn aus dem Lifestyle of Health and Sustainability ( LOHAS 1 0 ) der Lifestyle of Health and Survival ( LOHAS 2 0 ) geworden ist, wird man sehen, wer damit dann besser zurechtkommt: ein Bauer aus Afrika oder ein Banker aus Frankfurt.
Vorratswirtschaft jedenfalls können Menschen, die es gewohnt sind, am Rande des Minimums zu leben, erheblich besser trei ben als die, die bislang von der Möglichkeit des Mangels gar nichts ahnten. Und in gewisser Weise ist jenen die Zukunft auch viel präsenter als diesen: weil sie immer schon kalkulieren müs sen, ob sie nächste Woche, nächsten Monat noch genug haben. Hier ergibt sich die moralische Fantasie schon existentiell; um die hochgezüchteten, abstrakten Lebens- und Wirtschaftsver hältnisse, in denen unsereins lebt, mit moralischer Fantasie aus zustatten, bedürfte es freilich mehr Anstrengung. Nach Günter Anders besteht »die heute entscheidende moralische Aufgabe in der Ausbildung der moralischen Phantasie, d.h. in dem Versuche, das ›Gefälle‹ zu überwinden, die Kapazität und Elastizität un seres Vorstellens und Fühlens den Größenmaßen unserer eige nen Produkte und dem unabsehbaren Ausmaß dessen, was wir
anrichten können, anzumessen; uns also das Vorstellende und Fühlende mit uns als Machenden gleichzuschalten.«2 Unterzieht man sich der Mühe nicht, das prometheische Gefälle auszugleichen, das zwischen dem Zerstörungspotenzial unserer Lebenspraxis und unserem defizitären Vorstellungsvermögen besteht, sieht man nicht, was vor sich geht und zwar auf weni ger harmlose und unschuldige Weise, als es bei Defoe der Fall war. Denn wir wissen ja, sind aber so installiert in unserer Komfortzone, dass uns jede Bewegung aus ihr heraus nicht bloß als lästig, sondern als ganz und gar unmöglich erscheint. Das Anlegen einer Vorratskammer wäre freilich eine solche Bewe gung: Wenn man sie für nötig hielte, dann nur, wenn man die Wirklichkeit als jene unter gigantischem Ressourcenaufwand hergestellte Illusionsmaschine erkennen würde, die sie längst ge worden ist. Tatsächlich ist die Vorratskammer, metaphorisch wie real, das Gegenkonzept zu der zukunftslosen, apokalypseblin den Praxis der Konsumgesellschaft, die inzwischen etwa 40 Pro zent der Lebensmittel nicht mehr verbraucht, sondern wegwirft und viele Dinge lediglich noch kauft, aber gar nicht mehr konsu miert. Das ist das exakte Gegenteil von Bevorratung es ist eine Entsorgung im Voraus, die bloße Verwandlung von Ressourcen in Dreck.
Ist eine Gesellschaft mal so weit gekommen, hat sich ihr Überle benssinn verflüchtigt, und mit ihr all die vorkonsumistischen Fähigkeiten zur Verantwortung, Gerechtigkeit, Achtsamkeit. Ohne solche Kompetenzen wird es aber schwer sein, jenseits der Komfortzone zurechtzukommen. Insofern müsste man schon jetzt beginnen, sich in einer anderen Praxis zu üben. Günter An ders empfiehlt ganz in diesem Sinn »moralische Streckübungen«, »Überdehnungen seiner gewohnten Phantasie- und Gefühlsleis tungen«. Damit könnte man sich schon mal vorbereiten auf die Zeit nach dem Peak Oil, Peak Soil, Peak Everything. Oder besser noch: Damit könnte man die Zeit nach dem Alles immer vorwegnehmen und schon mal jetzt sein Leben umstellen auf Vorrat.
Harald Welzer lehrt Sozialpsychologie an der Universität St. Gallen und ist Direktor des Center for Interdisciplinary Memory Research am Kultur wissenschaftlichen Institut in Essen. Zuletzt gab er zusammen mit Christian Gudehus und Ariane Eichenberg das Buch Erinnerung und Gedächt nis Ein interdisziplinäres Handbuch . Stuttgart: Metzler, 2010, heraus. Bereits 2008 erschien Klimakriege. Wofür im 21. Jahrhun dert getötet wird Frankfurt: S. Fischer, 2009. Im April 2011 erscheint Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben (ge meinsam mit Sönke Neitzel) bei S. Fischer, Frankfurt.
1 Zit. nach Wolfgang Schivelbusch, Geschichte der Eisenbahnreise. Zur Industriali sierung von Raum und Zeit im 19. Jahr hundert Frankfurt/M.: Fischer 2004 , S. 9 2 Günter Anders, Die Antiquiertheit des Menschen. Bd. 1. München: Beck 1979 , S. 273
mit-freude von ute frevert
Zur Kunst des Lebens und Überlebens gehört das, was ich emotionale Ökonomie nenne. Dabei denke ich nicht an Märkte und knappe Ressourcen, an Angebot und Nachfra ge. Stattdessen steht mir der altgriechische oikos vor Augen: ein komplexes sozialmoralisches Gebilde mit Aufgaben, die weit über die Produktion und Verteilung von Gütern hinausgingen. Darauf spielte 1728 Francis Hutcheson an, als er über die durch Gewohnheit, Erziehung und Ge sellschaft verursachte Unordnung der Gefühle sinnierte. Es gelte, so seine These, Leidenschaften in eine »just Ballance and Oeconomy« zu überführen, um auf diese Weise das größte Glück des Einzelnen und das Wohlsein der Gesamtheit zu befördern.
Von Hutcheson und seinen Nachfolgern kön nen wir noch heute viel lernen. Sicher hatte sich schon vorher so mancher darüber ausgelassen,
wie am besten mit den menschlichen Affekten und Leidenschaften umzugehen sei. Periodisch flammte die Angst vor zuviel Hitze und Feuer auf, und oft stimmte man das Lob auf die gesun de Mitte an, auf das rechte Gleichgewicht zwi schen heiß und kalt, gefühlig und fühllos. Die Moralphilosophen des 18. Jahrhunderts sattelten darauf auf, versuchten aber zugleich, jene Bal lance and Oeconomy auf grundlegende Formen sozialer Kommunikation zu beziehen. Welche emotionale Ökonomie brauchte eine moderne Gesellschaft, wie sie sich damals auf der britischen Insel zu entwickeln begann? Welche Lei denschaften waren gut oder schlecht für ein ka pitalistisches Wirtschaftssystem, dessen Theo rie Adam Smith 1776 begründete? Nur Egois mus und Eigenliebe reichten definitiv nicht aus (obwohl sie wichtig waren und gegen religiös oder politisch motivierte Vorwürfe in Schutz genommen werden mussten).
Solche Fragen und Überlegungen klingen er staunlich zeitgemäß. Auch heute denken wir wieder (und immer noch) verstärkt darüber nach, wie sich der Egoismus Einzelner mit dem Wohl der Gesamtheit verbinden lässt. Die extreme Gier vieler Investment-Banker und der hemmungs lose Ehrgeiz mancher Wissenschaftler sitzen auf
der Anklagebank. Andererseits wird die Güte und Selbstlosigkeit philanthropischer Aktivis ten gepriesen, und neben Mutter Teresa sind die Ärzte ohne Grenzen zu Ikonen moderner Empathie geworden. Die diversen humanitären Interventionen, die mit dem Kampf gegen die Sklaverei im späten 18. Jahrhundert began nen, gehören heute zu den umsatzstärksten Un ternehmungen überhaupt. Alljährlich setzen sie mehrere Milliarden Euro um, Tendenz stei gend.
Damit scheint das, was David Hume und Adam Smith sympathy nannten, zu einer weltumspan nenden Aktivkraft geworden zu sein. Beide Phi losophen hatten der Eigenliebe das ebenso na türliche wie notwendige Gefühl der Sympathie gegenübergestellt. Moderne Gesellschaften, so ihr Argument, waren dringend darauf angewie sen, dass ihre Bürger einander nicht nur als Egoisten, sondern auch mitfühlend begegneten. Smith beschrieb es als fellow-feeling, womit er die Fähigkeit meinte, sich an die Stelle eines anderen zu versetzen und dessen Gefühle mitzuemp finden. Diese Fähigkeit sei naturgegeben und allen Menschen prinzipiell zugänglich. Das be stätigen aktuelle neurowissenschaftliche Expe rimente und Untersuchungen.
Dass etwas naturgegeben und damit möglich ist, heißt allerdings noch nicht, dass es auch wirk lich und tatsächlich passiert. Über die Bedin gungen, unter denen das Smith’sche fellow-fee ling (das wir heute Empathie nennen) zum Ein satz kommt, wird seit fast dreihundert Jahren nachgedacht. Dabei geht es fast immer um das Mitempfinden von Leid. Ob Mit-Leid nur mit dem Nächsten oder auch mit dem Fernsten ge lingt, ob es an die Unschuld des Leidenden ge bunden ist, ob es dem Leidenden hilft oder eher dem Mit-Leidenden Macht gibt: Solche Debat ten füllen Bände und Bücherregale, Talkshows und TV-Dokumentationen.

Viel weniger Gedanken hat man sich über die Mit-Freude gemacht. Dabei hatte Smith aus drücklich betont, dass Menschen nicht nur das Leid, sondern auch die Freude anderer mitemp finden könnten und sollten. Im privaten Um gang, in Familien und unter Freunden wird dies auch gemeinhin praktiziert. Wir freuen uns an der Freude unserer Kinder und Eltern, wir erle ben die Freude unserer Freunde, als wenn es die eigene wäre. Aber wie steht es um die Freude de rer, die uns nicht so nah und lieb sind? Freuen wir uns mit Kollegen, die einen ehrenvollen Preis gewonnen haben? Oder denken wir insge

menschen haben, pflanzen sind begriffe von andreas weber
Füllen wir also unsere Vorräte! Ich würde Blumenzwiebeln in unser Magazin legen. Bei der richtigen kühlen Temperatur hal ten sie sich lange. Jede Zwiebel ist winzig, schrumpelig braun und unscheinbar. Aber sie besitzt viel Energie. In jeder schlummert eine Geburt frisch wie die Schöpfung und der stetig gegenwär tige Tod. So gesehen sind diese unscheinbaren Überwinterungs organe wie Leibniz’ Monaden: in sich geschlossen, und doch Brennpunkte der ganzen Welt.
Ich würde die Zwiebeln der Schneeglöckchen auswählen. Sie sind freilich ein bisschen giftig. Aber Schneeglöckchen, die am Ende des Winters ihre Kelche in die graue Luft hängen, sind ein echter Anfang. Inbegriffe des Anfangens. Vor zwei Jahren habe ich verwilderte Schneeglöckchen entdeckt. Sie wuchsen in dem aufgelassenen Schrebergarten, wo die Schnittabfälle des letzten Jahres unter welken Blättern eines mageren Apfelbäumchens ruhten. Ein Dutzend Blüteninseln schoben sich unter dem Laub hervor. Anscheinend hatte die Blumen der ausnehmend harte Winter über ihren Köpfen überhaupt nicht gestört. Mit der Aus dauer, zu der nur die Wahrheit fähig ist, hatten sie sich im Dun keln und Gefrorenen so entwickelt, wie es ihnen bestimmt war. Ich war durch das Dickicht des aufgelassenen Grundstückes zu der Stelle unter dem Apfelbaum gegangen, ohne recht zu glau ben, etwas zu finden. Zuerst entdeckte ich nichts. Aber dann, nach einer Minute suchender Blicke zwischen den körnigen Eis
perlen, machte ich die feinen Halme aus, die weißen Knospen und schließlich erste Glocken, die an hauchdünnen Stielen aus schwenkten. Die Kelche hingen wie mit zarten Muskeln an ihren Stängeln, an biegsamen Hälsen eingelenkt, als wären sie mit einem elastischen Band an die Erde geknüpft. Blumen-Fesseln.
Die Kelchblätter, zusammengerollt wie verschlungene Hände, drängten sich Blüte und Stiel aus einer feinen Haut, die beim Aufblühen am Stängel zurückblieb wie eine feine Zwiebelschale. Schicht um Schicht wurde es unaufhaltsam Frühling, schälte sich der Winter vom Licht ab. Um Frost, Kälte und Ödnis zu trotzen, brauchte es offenbar das größte Maß an Zerbrechlich keit und Zartheit.
Ich kniete lange in der Grazie der Schneeglöckchen. In dieser war ich vorläufig gerettet, für die Frist, die man den Blumen noch ge stattete, hier zu wachsen. Die Gärten wurden gerade planiert. Ein Park war geplant. Ich kniete bei den Blüten und spürte die Taubheit meiner Beine nicht. Von den Kelchblättern perlten klei ne und immer kleinere Kristalltröpfchen herab, reflektierten die Ränder, warfen weiße Lichteffekte auf helle Biegungen der zar ten Hälse, an denen die Glocken hingen, flackerten im fast nicht vorhandenen Wind. Durch die Tauperlen wurde jeder hängende Kelch zu einem gläsernen Lüster, unmerklich schwankend über der bodenlosen Schlucht eines weißen Himmels.
Der Frühling ist eine Periode der Rekonvaleszenz, die Endphase einer Krankheit, welche das frische Leben schon in sich trägt, so wie die Kruste einer Wunde die neue weiche Körperoberfläche birgt. Sah man ganz nah hin, so zeigte sich in der ganzen Land schaft ein Netz hauchfeiner Sprünge, die sie durchzogen und durchliefen, um sie durch die farblose Oberfläche hindurch zu neuem Beginn zerbersten zu lassen. Je länger ich blickte, desto mehr Blüten schienen sich befreit zu haben. Vielleicht geschah es unsichtbar unter meinen Augen. Die Kelche der Schneeglöck chen bohrten sich als harte Spitzen durch feuchtes Laub, dessen Zerfall die Blumen eingehüllt hatte. Sterben ist ein Geburtspro zess, der rückwärts läuft; an seinem Ende steht wieder die Un fassbarkeit eines Neubeginns aus dem Nichts.
Jeden Tag kehrte ich in den Leuchtbereich der Schneeglöckchen zurück, an manchen mehrmals. Ich vergewisserte mich, dass sie noch da waren. So sehr hatte ich das Gefühl, dass in der winzigen Geste der Blumen bereits alles enthalten war; dass die schlanken Hälse, die grünen Lanzetten der Blätter, das weißeste Weiß der Kelche, das plötzliche Dasein an einem Tag im März, das unwei gerlich bevorstehende Verschwinden in den Strudeln des Früh jahrs (das Begrabenwerden von dem aufschießenden Leben) durch nichts mehr zu ergänzen waren. Was für ein Fest das Leben ist, was für ein dauerndes, rauschendes Fest, mächtig wie das All und zerbrechlich wie ein gesponnener Glasfaden im Wind. Es ist diese mühelose Kraftverschwendung, die wir Menschen nicht verstehen, diesen zum Zerspringen angespannten Muskel, der nichts fasst als einen Hauch von Licht und der doch jegliches Tagen in seiner Hand hält. Die Blumen waren angekommen, mit der Geduld der ganzen Schöpfung hatten sie das vergangene Jahr auf diesen Moment gewartet, an dem sie sich dem Licht hinge ben konnten. Frühlingsnarren heißen die Schneeglöckchen im Dänischen. Wir sollten uns an ihren schmalen Hals schmiegen und uns von ihm halten lassen, über einem Abgrund von An mut.
An einem Morgen waren die Blumen fast alle fort. Jemand hatte sie mit ihren Zwiebeln ausgegraben. Als ich hinkam, als ich die Reste aus der Ferne sah, schoss mir durch den Kopf: Sie sehen von Weitem doch sehr unscheinbar aus, diese aus der Nähe alles überstrahlenden Lichtinseln. Dann sah ich die Löcher. Wild schweine, dachte ich zuerst, Wildschweine fressen also auch die se Zwiebeln. Aber dann wurde mir klar, dass jemand sie ausgegraben hatte. Vorsichtig versuchte ich mich an den wenigen ver bliebenen zu freuen, als ob ich mich an einer Streichholzflamme wärmte, die jederzeit erlöschen konnte.
Andreas Weber , 1967 in Hamburg geboren, ist Publizist, studierter Biologe und promovierter Philosoph. 2008 veröffentlichte er Biokapital. Die Versöhnung von Ökonomie, Natur und Menschlich keit im Berlin Verlag. 2011 erscheint Mehr Matsch. Kinder brau chen Natur im Ullstein-Verlag, Berlin.
heim, dass wir selber diesen Preis auch, vielleicht sogar eher verdient hätten? Freuen uns der Er folg und das Glück eines anderen? Oder berei ten uns sein Unglück und Missgeschick klamm heimliches Vergnügen? Nicht zufällig gibt es den Begriff der Schadenfreude mitsamt ihren Begleitern Hohn, Spott und Häme. Und inter essanterweise existiert dieser Begriff als deutsches Lehnwort auch im Englischen, ebenso wie im Französischen, Italienischen, Spanischen, Portugiesischen und Polnischen. Das muss nicht unbedingt heißen, dass das Ge fühl der Schadenfreude vor allem in deutschen Landen heimisch war und ist. Es kann auch da mit zu tun haben, dass der Begriff durch Kulturund Wissenschaftstransfer (die Psychoanalyse hat dabei vermutlich eine Rolle gespielt) Ein gang in andere Sprachen fand. Wie dem auch sei: Dass Menschen sich am Schaden anderer freuen, kommt nicht nur in Deutschland, Österreich und der Ostschweiz vor. Psychologen und Neurowissenschaftler aus Japan, Israel, den USA und den Niederlanden finden in ihren Ländern genügend Probanden, um die Bedingungen und Folgen von Schadenfreude zu studieren. Weit weniger Forschungsenergie fließt in das, was wir positiv konnotieren: nicht Schaden-, sondern
Mit-Freude. Das hat vielfältige Ursachen; ähn lich wie im Journalismus bad news good news hei ßen, beschäftigt sich der öffentliche Diskurs vornehmlich mit dem, was als problematisch, gefährlich und irritierend wahrgenommen wird. Feel good-Themen bleiben schlechten Romanen, Ratgebern und Wellness-Magazinen vorbehal ten. An dieser Arbeitsteilung will ich nicht grundsätzlich rütteln. Mir geht es auch nicht darum, Freude als autosuggestives Elixier zur Steigerung der eigenen Lebens- und Leistungs kraft anzupreisen oder mit Erich Kästners Le sern zu fragen: Wo bleibt das Positive?
Vor Augen steht mir vielmehr Friedrich Schil lers Jubelgesang mitsamt seinem musikalischen Echo, das nicht zufällig zur europäischen Hym ne bestimmt wurde. Schiller beschreibt Freude nicht nur als starke Antriebsfeder individuellen Handelns, sondern auch als Ferment mensch licher Vergesellschaftung. Freude stiftet einen »Bund«: zwischen Freunden, zwischen Liebenden, aber auch zwischen »Brüdern« womit potenziell »alle Menschen« gemeint sind (ob Frauen dazugehören, bleibt allerdings unklar).
»Was den großen Ring bewohnet, huldige der Simpathie«: Hier klingt das neue Smith’sche Motiv an, versetzt mit ein bisschen älterer Kos
mologie. Sympathie und Mit-Freude sind die großen Aktivposten einer gesellschaftlichen Ordnung, die Schiller sich europäisch-kosmopoli tisch vorstellt, offen, meritokratisch, solidarisch (und trinkfest).
Wie kraftvoll dieser Aktivposten tatsächlich sein kann, zeigt sich in den zugegeben seltenen Situationen, in denen Mit-Freude im großen Maßstab erzeugt und kommuniziert wird: beim Berliner Mauerfall am 9 11 1989, bei der Inauguration Barack Obamas am 20 1 2009, bei der Rettung der chilenischen Grubenarbei ter am 13 10 2010. Die Bedingungen und Voraus setzungen solcher kollektiv geteilten Glücksmomente zu studieren und ihre Folgewirkungen zu untersuchen wäre mindestens ebenso wich tig und aufregend wie über Schadenfreude Be scheid zu wissen. Man könnte sogar darüber nachdenken, ob die Fähigkeit zur Mit-Freude nicht auch pädagogische Anstrengungen wert wäre. Wie angelsächsische Schulen Programme zur Empathieförderung kennen, ließe sich auch Mit-Freude als Erziehungsziel bestimmen nicht nur in der Schule, sondern auch in der Fa milie, am Arbeitsplatz, im Sport etc. Nun haftet solchen Trainingsutopien zwangsläufig etwas Künstliches und Gestelztes an. Aber
zum einen wissen wir, dass Gefühle, und zwar alle Gefühle, nichts Naturwüchsiges sind, son dern Pflege, Kultivierung und Anreize brau chen. Zum anderen kann man jede Utopie mit dem Hinweis auf ihre Extreme und Gefähr dungen hier etwa: das Land des gefrorenen Lächelns demontieren. Drittens schließlich geht es nicht um eine totalitäre Totalvision, son dern um das schlichte Plädoyer, der mensch lichen Fähigkeit zur Mit-Freude in der moder nen emotionalen Ökonomie mehr Raum zu ge ben. Die Kunst des Lebens und Überlebens würde davon, so steht zu hoffen, profitieren.
Ute Frevert , geboren 1954 , Historikerin mit den Forschungsschwerpunkten Sozial- und Kulturgeschichte der Moderne, Emotionsgeschichte, Geschlechtergeschich te und Neue Politikgeschichte, ist seit 2007 Direktorin des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin. 1998 erhielt Frevert den Leibniz-Preis. 2009 gab sie das The menheft Geschichte der Gefühle. Geschichte und Gesellschaft bei Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, heraus.





hamstern von sibylle lewitscharoff
Meine größte Sorge ist, dass die Männer ver schwinden. Womöglich haben wir es in unseren Breiten bald nur noch mit diesen säuglingshaften Exemplaren zu tun, die sich weigern, scharfe Züge zu entwickeln oder zumindest bis ins Alter von vierzig, fünfzig Jahren ein paar Haare auf dem Kopf zu behalten. Deshalb müssen in die geistige Vorratskammer Bücher, in denen Män ner vorkommen. Männer in gebrochener, raffi nierter Heldenhaftigkeit, auf die ich ein klein wenig schmachtende, um nicht zu sagen süße Gedankenblicke werfe. Raymond Chandlers Der lange Abschied darf da nicht fehlen. Oh, oh, oh, wie eine Frischverliebte sehe ich den betrunkenen Terry Lennox aus seinem Sport wägelchen torkeln was für eine Gestalt! Ein höflicher Betrunkener mit Narben im sehr wei ßen Gesicht und wie sich nach und nach ent hüllt mit dramatischer Kriegserfahrung. Wenn wir schon bei Sportwagen sind, dann bitte gleich noch Jack Bickerson Bolling, den Kinogeher von Walker Percy, aufs Vorratsregal. Ein eben falls sehr höflicher Held, frisch aus dem Pazifik krieg gezogen und in den Roman gesetzt, exzellenter Sportwagenfahrer tiefgelegter MG , bei dem jeder Bodenhoppel sofort ins Fahrwerk
schlägt melancholisch, aber nicht schlapp der Mann, feinfühlig und trotzdem kein an sich selbst herumnagendes Sensibelchen.
Man wird einwenden, ich sei zu alt für erotische Schwimmgefühle und für Sportwagen sowieso.
Wohl wahr. Ein echter Junkie lässt aber nicht auf gute Worte hin von seiner Lieblingsdroge. Des halb sei gleich noch ein dritter Held in die Kam mer geschmuggelt, ein durchaus ähnlich gelagerter zumal: Scott Fitzgeralds Grosser Gatsby , auch so ein unwahrscheinliches Bürschchen, sehr reich, sehr ehrenhaft bei unehrenhafter Vergangenheit, an seiner ersten Liebe klebend wie nicht gescheit, ein Charakter, den es in der Wirklichkeit darauf fresse ich einen Besen samt Stiel nie gegeben hat.
Nun aber Schluss mit der eroslispelnden Vor ratshamsterei. Zu den ernsteren Dingen, zu Kafka. Franz Kafka ist natürlich unverzichtbar, das leuchtet jedem sofort ein, der ein Literaturfex ist. Unverzichtbar insbesondere sein Tagebuch; Tagebuch aller Tagebücher, so überraschend, springlustig und dabei von bohrender Intros pektion wie gewiss kein zweites auf der Welt. Den Amerika -Roman, den Prozess bitte nicht vergessen, und wenn möglich packen wir das Gesamtwerk ein; es handelt sich ja eh um keinen zig Regalmeter okkupierenden Platzver dränger.
Kommen wir zu Herman Melville. Mit muss sein Bartleby , dieser schlanke, wundersame Sonderling, der auf intrikate und elegante Weise Nein zu allem sagt, was von ihm verlangt wird, und damit fast die Welt umstürzt; ein amerika
nischer Messias der Beharrung, der einem mit sanfter Stimme einbläut, dass nichts so sein muss und bleiben wird, wie es ist. Und schon gerät mir Mrs. Dalloway in den Blick, dieses herrliche Schwebphänomen aus dem Nach kriegslondon der frühen Zwanzigerjahre, das sich so frisch und zart und klar bis heute erhal ten hat. Alles gleichzeitig, alles in leisem Auf ruhr, die Phänomene berühren sich durch ener getischen Kontakt, den die hochsensiblen Fin gerspitzen der verehrten Virginia Woolf über ihr Grab hinaus gestiftet haben. Was für ein Zauberwerk!
Amüsieren will ich mich aber auch. Die drei gerechten Kammacher von Gottfried Keller kämen da gerade recht. Alles, was Züs Bünzli anstellt, um ihre drei Verehrer bei der Stange zu halten, ist von so schwindelerregender Komik, dass ich schon lachen muss, wenn nur ihr Vorname fällt. Züs, auch genannt Züssi, Du steckentrockene Jungfer, bös wie eine Wes pe, erfinderisch wie ein Nähkästchenmachiavelli, sei mir gegrüßt!
Apropos Wespe. Ungern würde ich auf das kleine Wespenstück von Francis Ponge verzichten, ungern auf seine Auster, die Feige, das Kiefernwäldchen , die Hummel, den Kiesel stein, den Frosch, das Moos, seine Zigarette oder die Molluske organisch, anorganisch, nicht menschlich zwar, aber doch ein klein we nig menschelnd geneigt, die Augen aufzuschla gen und uns anzulächeln oder gar mit rudernden Ärmchen eine winzige Rede zu halten. Ver sänke die Welt um uns her, wären Reden, wie sie
im Dunkeln die Zigarette an uns hält, von be sonderem Gewicht.
Jetzt aber werde ich von der Kulturstiftung des Bundes ermahnt, schleuniger zu packen; was rein soll, muss rein ohne langes Warum und Wieso. Wunschloses Unglück von Peter Handke, der Versuch über die Jukebox , rein damit, Westend von Martin Mo sebach und Was davor geschah ebenso, dann der federleichte Pigafetta von Felicitas Hoppe, Porzellan und Vom Schnee von Durs Grünbein, nicht zu vergessen die grim mige Holzfällerei von Thomas Bernhard und wie könnte ich ihn übergehen meinen ge liebten Verwaiser von Samuel Beckett. Wahrlich, es bedürfte eines langgezogenen Warums, warum die Bibel mit hinein muss, natür lich in der originalen Übersetzung Martin Lu thers und nicht in pflegeleichtem Schmier deutsch, und gewiss Homers Odyssee und gewiss Dantes Göttliche Komödie (viel leicht in zwei Übersetzungen, davon eine die exzentrische von Rudolf Borchardt); und wenn jetzt bei der Husch-Husch-Packerei zwischen diese hochmögenden Kaliber aus Versehen ein blutfetter Elroy-Krimi geraten sollte auch recht!
Sibylle Lewitscharoff , 1954 in Stuttgart ge boren, ist eine seit dem Ingeborg-Bachmann-Preis 1998 mit vielen weiteren Literaturpreisen ausgezeichnete Schrift stellerin, zuletzt mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2009 für ihren jüngsten Roman Apostoloff , im selben Jahr bei Suhrkamp erschienen. Derzeit arbeitet die Schrift stellerin an einem Roman über den Philosophen Hans Blu menberg.
lesen lehren von margot käßmann
Als ich Kind war, da war das Geld knapp. Wir waren vier Kinder, ein Bruder starb als Säugling, die drei anderen sollten zur Schule gehen, Abitur machen, sich bilden. Bei uns gab es keine gelehrten Bibliotheken, wie ich sie später bei Menschen erlebte, die in den Haushalten von Theologen oder Juristen oder Philosophen auf gewachsen waren. Aber für Bücher war unserer Mutter kein Geld zu schade. Wir durften lesen. Egal was. Ob Karl May oder Enid Blyton. Es ging nicht um »hochwertige Literatur«, es ging um Le selust.
Und wie großartig ist das, in ein Buch einzutauchen, sich hinein nehmen zu lassen in eine andere Welt, der Fantasie freien Lauf zu lassen, sich hineinzudenken in andere Welten. Lesen hat eine beeindruckende Sogkraft. Ich erinnere mich daran, als Kind un ter der Bettdecke mit Taschenlampe gelesen zu haben, weil ich einfach nicht aufhören konnte, wenn es längst geheißen hatte: »Licht aus!«
Im Studium dann und vor allem während der Doktorarbeit wur de Lesen zum Beruf. Je mehr ich gelesen habe, desto unbelesener fühlte ich mich! Da erschloss sich eine Bildungswelt in Philoso phie und Kirchengeschichte, in Praktischer Theologie und Sys tematik, die manches Mal schwer verstehbar war. Aber wenn um das Verstehen gerungen wurde, gab es diese Glückserfahrungen: Ich begreife. Wir können gemeinsam verstehen und weiter den ken.
Es gab Zeiten, da konnte ich weniger lesen. Als berufstätige Mut ter von vier Kindern fehlte mir einfach die Kraft, abends noch
ein Buch aufzuschlagen, die Muße, hineinzutauchen in andere Welten, die Konzentration, literarische Spannungsbögen zu ver folgen. Großartig waren die Sommer, die wir meist mit vielen Fa milien verbrachten. Und es waren die Mütter, die sich jedes Jahr auf ein Buch einigten, das sie gemeinsam lasen. Ich erinnere mich an einen Frankreichurlaub, zu acht lasen wir Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit . Ent sprechend wurden Madeleines dazu verspeist. Ich habe gelernt: Ein gemeinsam gelesenes Buch vergisst der Mensch noch weni ger als ein allein gelesenes. Gespräche über Lektüre vertiefen sie ungemein.
Meine älteste Tochter las viel, immer, ständig. Die beiden mittle ren Töchter, Zwillinge, lasen wenig, sie waren mit Sport und Mu sik beschäftigt. Später im Studium aber haben sie Lektüre unerwarteterweise geradezu verschlungen. Bei der Jüngsten dachte ich, sie wird nie lesen, das Zeitalter von Computer und Internet war angebrochen. Doch dann bekam sie Herr der Ringe in die Hand. Ich habe das Kind tagelang nicht gesehen. Es folgte Harry Potter . Sie ist mit den Protagonisten in den Filmver sionen sozusagen parallel aufgewachsen. Den dritten Band hat sie glatt in Englisch gelesen, obwohl ihr Englisch noch gar nicht so gut war. Da war sie wieder zu spüren, zu erleben, die Faszination des Lesens, das Erschließen neuer Welten, die Begeisterung, das Nicht-Aufhören-Können. Wunderbar, großartig! Es muss nicht gleich Goethe oder Descartes sein. Lesen ist Kulturgut! Und Lesen ist eine Frage von Gerechtigkeit und ethischer Verantwortung. Martin Luther hat die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt, damit Menschen selbst lesen können. Bis dahin wur de die Messe auf Latein gelesen, die Gläubigen hatten nur Bilder, keine Worte für das Evangelium von Jesus Christus. Die Über setzung war eine ungeheure Kulturleistung. Bis dahin konnten sich ein Bayer und ein Ostfriese kaum verständigen in ge wissem Sinne gilt das heute natürlich auch noch. Aber Sprache bildete und integrierte! Außerdem war die Übersetzung eine
ungeheure Bildungsleistung. In seinem Brief an den »christli chen Adel deutscher Nation« forderte Luther von den Fürsten Schulen für alle, für Jungen und Mädchen, damit sie lesen und schreiben lernen. Und folglich ihr Gewissen an der Bibel individuell schärfen könnten. Das war eine revolutionäre kulturelle Leistung!
Ja, Lesen gehört für mich zur Lebenskunst! Versinken in ein Buch. Nicht aufhören können, auch wenn es eigentlich Zeit ist zum Schlafen. Mit den Charakteren fiebern! Die Welt neu deu ten, anders verstehen, verändert begreifen. Das ist im Übrigen ein gut biblisches Motiv. In der Apostelgeschichte des Lukas, Ka pitel 8, wird erzählt, dass ein »Kämmerer« den Propheten Jesaja las. Es heißt in Apostelgeschichte 8,30: »Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du liest?« Philippus erklärt ihm die Bibel. Der Kämme rer kommt zum Glauben und lässt sich taufen. Philippus ist des halb für mich der erste Lesepate. Oh, hätten wir mehr davon. Menschen, die sich Zeit nehmen, Kindern das Lesen beizubrin gen. Großartige Projekte gibt es inzwischen welche Welten werden da erschlossen! Lesen ist schlicht auch zentraler Aspekt von Integration. Texte und Literatur teilen das verbindet. Mit einander um Texte ringen das ist ein Beitrag zum Frieden. Ge meinsame Texte kennen das beheimatet.
Insofern ist für mich Lesen ein gewichtiger Aspekt von Lebens kunst.
Margot Käßmann , Landesbischöfin a.D ., war 2009 /10 Ratsvorsit zende der Evangelischen Kirche Deutschlands ( EKD ). Käßmann unterrichtet 2011 als Gastprofessorin für Ökumene und Sozialethik an der Ruhr-Universität Bochum. Aktuelle Veröffentlichungen: Zu Gast in Amerika … Frank furt/Main: edition chrismon, 2011 ; Sehnsucht nach Leben Aßlar: adeo-Verlag, 2011
die zeitkapsel von assaf gavron
»Ja, wer sind Sie?«
Zwei Menschen sitzen hinter einem silberfarbenen Tisch. Män ner, soviel ich erkennen kann. Ernst, soweit ich verstehe. Der Raum ist riesig, hat vielleicht die Größe eines Flugzeughangars. Doch von innen sieht er aus wie ein Zimmer. Weiße Wände. Ein silberner Tisch, zwei Männer. Ich nähere mich ihnen. »Verzei hung?«
»Wer sind Sie?«
»Gavron.«
»Ja, Gavron. Von wann sind Sie?«
Nun fällt es mir ein. Man hat mich mitten in der Nacht geweckt. Mir gesagt, ich solle rasch meine Zeitaccessoires einpacken, die Insignien der Epoche, wegen einer dringenden Mission in der Zukunft. Wie immer in solchen Fällen ließen sie mir nicht genug Zeit. Ich stopfte schnell ein paar Dinge in drei Fächer meiner Kapsel und dann ich kann mich nicht erinnern. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist dieser Raum. Der silberne Tisch. Die Männer.
»Ich bin aus der Gegend der Jahrtausendwende.« »Welche Millennien?«
»Ende des zweiten, Anfang des dritten. Ein paar Jahrzehnte von hier und von da. In welchem Jahr sind wir?«
Einer der beiden durchbohrt mich mit einem strengen Blick.
»Wir sind in der Zukunft«, antwortet er und senkt den Kopf. »Ja, hier sehe ich es. Gavron. Sie meinen die christliche Zeitrechnung. Und höchstwahrscheinlich nach Christus. Okay. Was haben Sie für uns?«
»Drei Sachen. Das erste sind Kulturprodukte.« Sie blicken einander an und dann mich. »Kulturprodukte?«
»Kulturerzeugnisse: Scheiben, deren Rillen Musik enthalten. Rollen, auf denen sich Streifen mit Bildern darauf drehen. Lesewerke, die aus Seiten bestehen, welche aus Papier gemacht sind. Produkte. Dinge. Die man spüren kann. Berühren kann.
»Wozu ist das gut?«
»Die Menschen lieben, liebten die Berührung. Sie haben es ger ne, wenn Kunst etwas Konkretes ist. Etwas, das in der Perspekti ve existiert, Platz im Raum einnimmt. Etwas, das nicht nur Luft ist. Eine Luft, die sich zwar speichern lässt, der man lauschen kann, die man in diversen schönen und eleganten Versionen ei-
nes Computers anhören und anschauen kann, aber eben nur Luft, Töne, Bilder und Worte, nach denen man nicht mit der Hand greifen und sagen kann, ›ich habe‹.«
Sie schweigen, also fahre ich fort. »Sie finden es schön zu geben und zu nehmen, zu streicheln, zu riechen. Sie lieben es auch, sich zusammenzuscharen und gemeinsam Filme anzusehen, Thea terstücke, Musik zu hören.«
»Gemeinsam?«
»Viele Menschen zusammen im gleichen Raum. Eine gemein same gesellschaftliche Erfahrung. Gemeinsamer Konsum von Kultur. Ist das etwas, das es bei Ihnen jetzt, in der Zukunft, auch gibt?«
»Herr Gavron, diese Übung beschäftigt sich nicht mit uns in der Zukunft, sondern mit Ihrer Gegenwart. Was befindet sich im zweiten Fach Ihrer Kapsel?«
»Flüssigkeiten«, antworte ich.
»Welche Flüssigkeiten?«
»Ich habe hier zwei Flaschen, von denen jede mit einer anderen Flüssigkeit gefüllt ist. Eine enthält Benzin, die zweite Wasser. Kennen Sie Wasser?«
Sie blicken mich weiter an, ohne zu antworten, also fahre ich fort. »Benzin braucht man, um mit Autos und Flugzeugen zu reisen. Wasser braucht man, um zu leben. Beides verschwindet zuneh mend in meiner Zeit, und daher streiten sich die Menschen dar um. Wegen dieser Flüssigkeiten gibt es Kriege.« Mir scheint, dass ich ein Runzeln auf einer ihrer Stirnen erkenne. »Um Öl hat es bereits einige Kriege gegeben, inzwischen ist es auf der Welt si cher schon ausgegangen.« Ich blicke zur Seite, auf die weiße Wand rechts von mir, als suchte ich dort ein Fenster, durch das ich hinausschauen könnte, um zu erfahren, welches Jahr wir ha ben und wie es mit dem Erdöl steht. »Und Wasser ist eine neuere Geschichte, doch es beginnt ebenfalls zu verschwinden, denn die Welt erwärmt sich. Auch darum fängt man zu streiten an.« »Schlagen Sie uns vor, diese beiden Flüssigkeiten aufzuheben?« »Nein, ich hoffe nur, dass Sie eine ergiebigere und sauberere En ergiequelle als Öl gefunden haben. Und dass es Ihnen irgendwie gelungen ist, das Wasser zu erhalten. Wasser ist ganz entschieden etwas aus meiner Periode, das, wie ich glaube, für die kommen den Generationen erhalten werden muss.« Sie schweigen. Einer von ihnen trommelt mit einem stiftähnlichen Objekt auf den silbernen Tisch. Ich frage mich, ob ich sie enttäuscht habe.
»Im dritten Fach befindet sich ein illegaler Stützpunkt.« »Verzeihung?«
»Ein illegaler Stützpunkt. Das ist etwas, das an dem Ort passiert, an dem ich lebe. Es würde zuviel Zeit in Anspruch nehmen, die komplette Geschichte zu erläutern, also werde ich Sie nicht da
mit belasten: Verschiedene Menschen erheben Besitzanspruch auf das gleiche Stück Land. Diverse Kräfte, zu unterschiedlichen Zeiten, haben versucht, das Land aufzuteilen und Grenzen fest zulegen, jedoch ohne Erfolg. Die Grenzen sind unklar, die Füh rungsriegen schwach, die Bürger und Untertanen sind wütend, und es gibt welche, die das Gesetz in die eigenen Hände nehmen und machen, was sie wollen. Zum Beispiel errichten sie Siedlungen ohne gesetzliche Genehmigungen, mit verschleierter Unter stützung einiger Regierungsstellen sowie in Opposition zu ande ren Behörden. Sie erzeugen Unordnung, Widerstand und manchmal Gewalt. Sie und ihre Gegner sind häufig von einer kompro misslosen Machtideologie angetrieben, die sich auf Religion und Nationalismus stützt, auf Gesetze und Lehren, die ihrem An spruch nach eine ewige Wahrheit widerspiegeln, deren verpflichtende Gültigkeit nicht hinterfragt werden kann.«
Der Mann, der mit dem Stiftobjekt trommelt und bisher nichts gesagt hat, blickt mich interessiert an. Diesmal öffnet er den Mund. »Und was soll Ihr illegaler Stützpunkt den kommenden Generationen bringen? Was daran möchten Sie für uns bewah ren?«
»Vielleicht nur eine Warnung: vor der Gefahr, die in Religion liegt, vor der Gefahr, die in Grenzen liegt. Ich weiß nicht, in wel cher Welt Sie leben, doch falls ausreichend Zeit vergangen sein sollte, dass man gelernt hat, ohne Grenzen zu leben würde mich das für Sie freuen. Wenn die Menschen im Laufe der Jahre weiter über die ganze Welt gewandert sind, sich die Rassen ver mischt und vermehrt haben, so dass die Anzahl der ›reinrassigen‹ Menschen erheblich ausgedünnt wurde, die ›Mischungen‹ zur Mehrheit geworden und Nationalismus und Rassismus damit tatsächlich bedeutungslos geworden sind, da man sie im Namen von niemandem mehr unterstützen und gegen niemanden mehr richten kann dann seid ihr glücklich. Und sollte die Religion ihre Macht verloren haben oder wenigstens nicht mehr dazu be nutzt werden, um Taten ohne Moral und ohne Rücksicht zu rechtfertigen, die keine komplexere Logik haben als die, sich auf einen tausendjährigen Text zu stützen dann beneide ich Sie.« Sie blicken einander an. Mir scheint, als lächele der Stifthalter seinem Gefährten zu. Und dieser senkt seine beiden Hände flach ausgebreitet auf den Tisch und ruft laut: »Der Nächste bitte!«
Assaf Gavron , 1968 geboren, wuchs in Jerusalem auf, studierte in Lon don und Vancouver und lebt heute in Tel Aviv. In Israel ist Gavron mit seinen fünf bisher erschienenen Büchern Bestsellerautor. Er hat außerdem u.a. Jonathan Safran Foer, Philip Roth und J D . Salinger ins Hebräische übersetzt und ist Sänger und Songwriter der israelischen Kultband ›The Mouth and Foot‹. 2010 war Gavron Stipendiat des DAAD -Künstlerprogramms in Berlin. Im vergangenen Jahr erschien auf Deutsch sein Roman Alles Paletti , übers. von Bar bara Linner, im Luchterhand Verlag, München.
Die Übersetzung aus dem Hebräischen stammt von Barbara Linner.
eine zukunftsverweigerung von armin nassehi
Über die Zukunft zu sprechen ist einfach und über die Zukunft zu sprechen ist riskant. Es ist einfach, weil wir die Zukunft nicht kennen. Und es ist aus demselben Grunde riskant. Die Zukunft ist die Projektionsfläche schlechthin im wahrsten Sinne des Wortes, sie ist ein VorWurf auf etwas, das nie Zukunft sein wird, wenn es ist, sondern selbst wieder gegenwärtiger Aus gangspunkt für entsprechende Entwürfe. Nicht umsonst sind moderne Utopien stets Zukunfts vorstellungen gewesen, weil sie damit letztlich den Test auf sich selbst nie zu dem Zeitpunkt machen mussten, als sie entworfen wurden. War um also über etwas reden, was es nie geben wird, zumindest nicht als das, als was es beschrieben wird?
Auf den ersten Blick mag das wie eine Position aussehen, die sich der Themenstellung verwei gern will. Und das ist sie auch. Aber sie erfolgt auf den zweiten Blick nicht aus einer Position intellektueller Wohlgenährtheit, die ohnehin keine Prüfung ihrer selbst bestehen muss, kommt sie doch im Gestus des unbeteiligten Beobach ters daher, zumal in Zeiten, in denen es en vogue ist, den Zukunftserzählungen unter Hinweis auf ihre insuffizienten Vorgänger zu misstrauen. Aber vielleicht enthält diese Position mehr als jene Flucht aus der Verantwortung, denn bei der Frage nach unserer Zukunft geht es immerhin um unsere Zukunft.
Es lohnt sich ein Blick auf frühere Zukunftsent würfe. Die Geschichte von Zukunftsentwürfen ist eine Geschichte vergangener Gegenwarten, und zwar von je gegenwärtigen Illusionen bzw. Wünschen oder Befürchtungen über die eige nen Zukünfte. Es reicht schon ein Blick auf die kulturelle eurozentrische Euphorie des 19. Jahr hunderts oder auf die Technikfantasien der 1960er Jahre über großstädtische Zukünfte, die vor allem von der technischen Machbarkeit der Welt und vom Optimismus westlicher Mittel schichtsrealiäten ausgegangen sind. Solche Zu
kunftsvorstellungen haben letztlich ihre Gegenwarten extrapoliert und daraus ihre Zukünfte nach dem Bild ihrer Gegenwarten geformt aber was sollten sie sonst auch tun? Gut, sie hät ten es wenigstens wissen können, aber sie wuss ten es nicht.
Letztlich sind alle Zukunftsentwürfe, wie wir sie heute machen, ebenso erwartbar wie konsen suell. Sie beziehen sich vor allem auf Fragen der Demokratie, der Demografie und der Demotoxie also auf die Staatsformen und legitimen Entscheidungsroutinen der Zu kunft, auf die unterschiedlichen Bevölkerungs entwicklungen der Weltgesellschaft und auf die Vergiftung der Menschen mit zu viel Information, mit Umweltgiften und mit den Folgen der Energieerzeugung. Diesen Zukunftsszenarien möchte ich keine weitere Beschreibung hinzu fügen.
Wenn ich nun nicht mit konkreten Vorstellun gen über die Zukunft aufwarte, sondern mit ei ner Reflexion über die merkwürdige Perspekti vität aller Zukunftsvorstellungen, dann sieht es nur auf den ersten Blick so aus, als wollte ich das Unvermeidliche vermeiden. Denn der Hinweis auf die Perspektivität, also auf das Gefangensein
jeglicher Vorstellung in der eigenen Perspektive, könnte genau das Signum sein, das die gesell schaftliche Gegenwart ausmacht. Vielleicht sollten wir weniger Zukunftsentwürfe machen, we niger Überlebensstrategien für die Zukunft ent werfen und weniger wissen wollen, was wird. Vielleicht sollten wir wissen wollen, wie etwas werden kann.
Das dürfte die moderne Grunderfahrung sein: dass es unser Blick auf die Welt ist, der jene Welt erzeugt, die wir sehen und nicht umgekehrt. Was uns poststrukturalistische, kyber netische und systemtheoretische Theorien und neurophysiologische Forschungsergebnisse in schwierigen Diskursen beizubringen versuchen, ist inzwischen als einfache Selbsterfahrung für jedermann zu haben: Man kann an den Sinnen nicht vorbei wahrnehmen nicht am Auge vorbeisehen, am Ohr vorbeihören, an der Zun ge vorbeischmecken oder an der Nase vorbeirie chen, nicht an unserem Tastsinn vorbeitasten und nicht an unserem eigenen Bewusstsein vor beidenken. Wir sind verstrickt in das, was unse re Augen, unsere Ohren, unsere Zunge, unsere Nase, unsere Haut und unser Bewusstsein uns vermitteln. →
Verstrickt sind wir auch in unsere Perspektiven auf die Welt die sich ökonomisch eben an ders als politisch, wissenschaftlich anders als re ligiös und juristisch anders als nach der Logik der Massenmedien darstellen. Wir kennen dieses Verstricktsein auch daher, dass unsere alltäg lichen Konflikte und Missverständnisse sich nicht einfach auflösen lassen schon weil man über sie kommunizieren muss. Kommunikati on will manchmal nur schwer gelingen, eben weil Kommunikation gerade nicht Verschmel zung ist, sondern die Differenz der Perspektiven bearbeiten muss. Vielleicht gibt es Kommuni kation nur, weil wir füreinander unerreichbar bleiben, intransparent sind. Zugleich verspricht Kommunikation, diese wechselseitige Intrans parenz aufzuheben. Aus dieser Paradoxie gibt es kein Entrinnen aber wir müssen lernen, mit ihr umzugehen.
Und jetzt rede ich doch über die Zukunft: Was wir zukünftig, also: jetzt, brauchen, ist mehr Einsicht in das Verstricktsein in unsere Perspek tiven. Wir müssen lernen, dass Probleme und Lösungen dieser Welt aus unterschiedlichen Perspektiven aus funktionalen, also ökonomischen, politischen, religiösen, wissenschaftlichen oder juristischen, ebenso wie aus kulturellen ganz unterschiedliche Implikationen und Bedeutungen haben. Wir brauchen Lösungen, die mit dieser Perspektivität rechnen.
Ist das zu abstrakt? Vielleicht, aber womöglich waren unsere bisherigen Lösungen zu konkret, weil sie immer schon wissen wollten, wie sie ein mal aussehen werden, wenn sie in Betrieb sind.
In terms of ›Lebenskunst‹ denkt man viel leicht an Gelassenheit, an das Aushalten eigener Gegenwarten, an die gleichzeitige Kontingenz und Unüberbietbarkeit der eigenen Perspektive. Vielleicht müsste sich Über Leben(s) Kunst tatsächlich auf Kunst reimen. Denn wenn Kunst etwas lehrt, dann ist es zweierlei: die Unüberbietbarkeit von Formen und Perspektiven begreifen zu lernen und zwischen totaler Kontingenz und Notwendigkeit zu vermitteln. Dass die Kunst mehr sieht, weil sie das Sehen sieht das ist übrigens die älteste moderne Utopie. Eine neue braucht es nicht, wenn es gelingt, unsere Perspektivität nicht zu bekämpfen, sondern operativ nutzbar zu machen.
Armin Nassehi , 1960 in Tübingen geboren, ist Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Uni versität München. Zuletzt erschien von ihm Mit dem Taxi durch die Gesellschaft. Soziologische Storys. Hamburg: Murmann, 2010
und wie wäre es… von andrzej stasiuk
… wenn man, statt sich auf ein nicht näher definiertes Überleben einzurichten, einen Plan B in Betracht ziehen würde? Einfach den Abgang in Betracht ziehen, das eigene Verschwin den? Es sieht so aus, als hätten wir keine anderen Ziele mehr als das biologische Überleben der Gattung. Einige Vertreter dieser Gattung werden immer reicher sein und immer länger leben. Die anderen ganz im Gegenteil. Weder die eine noch die andere Aus sicht ist besonders verlockend. Wir werden immer länger leben und uns immer länger langweilen. Um uns nicht zu langweilen, werden wir immer mehr kaufen müssen. Immer mehr Dinge, im mer mehr Gesundheit, immer mehr Leben, immer mehr Organe zum Austausch. Eine langweilige Langlebigkeit wird das sein, langweiliger noch die Ewigkeit, in deren Genuss einige womög lich kommen. Man mag sich das gar nicht vorstellen. Noch schwerer zu ertragen ist der Gedanke an jene, die niemals in ir gendeinen Genuss kommen werden. Sie werden geboren, ster ben rasch und niemand erfährt je von ihrem Dasein. Sie sterben vor Hunger, an Krankheiten, vor Angst und Trauer. Sie sterben im Bewusstsein dessen, dass irgendwo die Satten, Gesunden und Unsterblichen leben.
Vielleicht ist es so, dass wir schon alles getan haben und Zeit für den Abgang ist, Zeit für den Plan B . Von dem großen religiösen, metaphysischen Entwurf ist nichts geblieben. Wir haben ihn nicht realisieren können. Wir konnten weder das Wissen ertra gen, dass wir nicht allein auf dieser Welt sind, noch den Glauben daran, dass dies nicht die letzte aller Welten sei. Das hat nicht ge klappt. Plan A ist gescheitert. Unser Leben hat sich als so zufällig und egoistisch erwiesen wie das Leben der Affen und Garnelen. Sogar mehr als jenes, denn die Affen dienen uns als Versuchstiere und die Garnelen ernähren die Wale. Unser Leben dagegen ist Selbstsucht in Reinkultur und dient allein dem eigenen Über dauern, der eigenen Vervielfältigung. Mag sein, dass die Krank heiten, Viren und Bakterien noch irgend etwas von uns haben. Eine ziemlich ironische Wende des Schicksals: Früher dienten wir Gott, heute den Mikroorganismen. Schwerlich wird man Wesen finden, deren Dasein ärmer ist an Sinn. Basta. Der letzte historische und hysterische Versuch, einen Rest Menschenwür de zu bewahren, hat vermutlich im Jahr 1917 stattgefunden. Da mals hat wenigstens ein Teil von uns versucht, so etwas wie die Schöpfungsgeschichte oder den Urknall zusammenzuschustern. Tatsächlich hätte nicht viel gefehlt und die Welt wäre in die Luft geflogen. Die Idee war dennoch verwegen: einen neuen Men schen zu schaffen, weil der bisherige sich als nicht sehr befriedi gend erwiesen hatte.
Wie man es auch sieht, die Sache steht nicht gut: als Masse, als Menge, als globalisierter Mist werden wir einigen wenigen den Weg zur Unsterblichkeit düngen. Am Ende wird es so kommen die Biotechnologie als Erbin von Religion und Revolution wird siegen. Auserwählte werden so lange leben können, bis sie es satt haben oder ihnen langweilig wird. Gleichzeitig werden sie dafür sorgen, dass der Rest kurz genug lebt so kurz, dass er keine Konkurrenz darstellt. Denn könnt ihr euch vorstellen, dass eine Generation nach der anderen auf die Welt kommt und nicht stirbt? Dass sie lebt und lebt und lebt und die Reste von Energie, die Reste an Lebensmitteln, an Luft und Licht auf diesem engen Planeten verbraucht? Das ist keine Vision, sondern eine kosmische Horrorgeschichte. Die Reichsten und Unsterblichen wer den schon dafür sorgen, dass wir verrecken wie die Ameisen oder Termiten, sobald wir keinen Nutzen mehr bringen. Man braucht ja auch gar keine Zukunftsprognosen, die Gegenwart zeigt deut lich genug, worum es geht. Man braucht sich nur vorzustellen, dass man zum Beispiel ganz Afrika von der Weltkarte entfernen könnte und niemand (außer den Afrikanern selbst) würde etwas merken. Ja, man könnte dieses Stück der Landkarte einfach mit der Schere abschneiden und zusehen, wie es im Blau des Ozeans und dann in den Weiten des Kosmos versinkt. Vorher müsste man natürlich alles aus dem Boden herausholen, was einen Wert hat, Erdöl, Mineralien und so weiter. Aber stellen die dort leben den Menschen irgendeinen Wert für den Rest der Welt dar? Ver mutlich nur als billige Arbeitskraft. Jedenfalls solange, wie sie noch ein letztes bisschen Kraft haben.
Kraft? Menschenkraft wird doch immer weniger benötigt. Wir zanken wie die Hunde um die Reste, die die Reichsten uns hin werfen. Wir wedeln mit den Schwänzen, damit uns überhaupt noch irgendjemand für nützlich hält. Dabei werden wir von Tag zu Tag überflüssiger. Wie die Afrikaner, nur ein bisschen lang samer und in einem etwas gesünderen Klima. Was unser Leben erleichtern sollte, wird es letztendlich überflüssig machen. Des halb mag der Plan B wie eine Verzweiflungstat wirken, aber we nigstens ist er ehrenvoll. Wenn die Dinosaurier gegangen sind, warum sollten wir dann bleiben? Ich sehe keinen Sinn und mehr noch, ich sehe keine Chance, dass wir irgendwann noch einmal einen solchen Sinn hervorbringen könnten. Eine Weile dürfen wir noch leben in dem Bewusstsein, dass die Viren und Bakterien uns brauchen. Doch auch dieser Sinn wird am Ende verschwun den sein.
Frankfurt/Main: Insel Verlag, 2009. Die Übersetzung aus dem Polnischen stammt von Olaf Kühl
kulturstiftung des bundes magazin 17
Mit dem Wandel der Zeiten ändert sich auch der Blick auf Mitte und Maß: Manchmal gelten Mitte und Maß, zumal wenn sie von Älteren eingefordert werden, als Höhepunkt der Spießigkeit, Ausdruck von Zukunftsangst und Indiz konservativer Verbohrt heit. Aber dann mehren sich auch wieder die Stimmen, denen zufolge eine Gesellschaft nur dann eine Zukunft hat, wenn sie Mitte und Maß zu halten vermag. Wird im ersten Fall die Orien tierung an Mitte und Maß als Ausdruck von Mittelmäßigkeit ge sehen, als Ideologie der Mittelmäßigen, so avanciert sie im zwei ten Fall zur Voraussetzung für das Überleben der Menschheit.
Nur durch die Orientierung am Maß der Mitte, so die Botschaft, könne es gelingen, der selbstzerstörerischen Kräfte eines entfes selten Eigennutzes und der fatalen Neigung zu Übertreibung und Übersteigerung Herr zu werden. Die Orientierung an Mitte und Maß wird hier als Barriere gegen den kollektiven Weg in den Abgrund begriffen.
Die Kritik an Mitte und Maß als der menschlichen Selbstver wirklichung entgegenstehende Lebensweisheit der Mittelmäßigen ist in Deutschland um das Jahr 1968 dominant geworden, als die Forderung nach Radikalität zum politischen Gegenbegriff von Mitte und Maß avancierte. Radikal sein hieß, die Dinge an der Wurzel zu packen und sich nicht länger auf »faule Kompro misse« einzulassen. Ein aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges stammender Sinnspruch Friedrich von Logaus »In Gefahr und großer Not / Bringt der Mittelweg den Tod« wurde zur Formel für das angeblich zwangsläufige Scheitern der nivellier ten Mittelstandsgesellschaft, als die Helmut Schelsky die junge Bundesrepublik bezeichnet hatte. Gegen die gesellschaftliche Statik der Mitte-und-Maß-Parolen setzte die Neue Linke die Dyna mik einer Zukunftsorientierung, bei der Ideale und Visionen die versteinerten Verhältnisse zum Tanzen bringen sollten. Von der damaligen Aufbruchstimmung ist nicht viel geblieben. Viele Frontleute des 68er-Aufbruchs sind inzwischen nicht nur sozial, sondern auch politisch in der Mitte angekommen, und
Andrzej Stasiuk , 1960 in Warschau geboren, schreibt für große pol nische und deutsche Tageszeitungen Kritiken und Essays. In den frühen 1980er Jahren engagierte er sich in der polnischen pazifistischen Oppositionsbewe gung, seit Mitte der 1990er Jahre betreibt er einen eigenen Verlag. 2005 wurde er mit dem Nike-Preis für das beste polnische Buch des Jahres ausgezeichnet. Zuletzt erschien von ihm auf Deutsch Winter Fünf Geschichten , übersetzt von Renate Schmidgall und Olaf Kühl.eine [fast] unmögliche kunst: die mitte zu treffen und das maß zu halten von herfried münkler
der traum von der goldenen nuss von thomas lehr über leben kunst über kunst leben leben über kunst kunst über leben
Wäre ich bildender Künstler, hätte ich mit die sem permutativen Rückspiel zum sachten Ver schluss des Wortzwischenraums zwischen Über Lebenskunst und Überlebenskunst wohl schon zur Genüge geantwortet. Auch als Schriftsteller reichten mir, rein egoistisch und lebenspraktisch gesehen, die oben stehenden vier Dreiwortrei hungen aus, um meine existenziellen Fragen zu quadrieren. Soll ich die Kunst über das Leben stellen oder umgekehrt? Kommt die Kunst erst nach dem Überleben? Lohnt es sich, zu überle ben, ohne Kunst? Müssen wir mehr über das Kunstleben wissen, um zu überleben, wobei wir einmal offenlassen, ob wir das künstliche oder
das künstlerische Leben damit meinen, welches zu überleben wir durchaus beabsichtigen soll ten.
Für mich ist die Antwort einfacher als es die Vielfalt der Fragen vermuten lässt: Ich mache Kunst, um zu überleben, und ich finde, ein Überleben ohne Kunst ist es nicht wert, erlebt zu werden. Spannend wird das Nachdenken über das artifizielle Survival aber eigentlich erst, wenn man dem verloren gegangenen oder un terdrückten Buchstaben S in der Überleben-skunst nachspürt. Man könnte und sollte gerade das Soziale daran knüpfen. Dadurch eröffnet sich das Spannungsfeld zwischen individueller Überlebenskunst und dem Überleben der Gat tung, die in einem komplizierten, sowohl anta gonistischen als auch symbiotischen Verhältnis stehen. Zwischen dem James Bond’schen To live and let die und dem Imma nuel Kant’schen Kategorischen Imperativ kön nen sich die Maximen für den individuellen Willen ansiedeln.
Geht es nur um meine ganz eigene Überlebens kunst, dann kann ich den Rest der Welt hinter hältig und skrupellos nutzen und dabei so intelligent (hier kommt die Kunst) vorgehen, dass mich keiner erwischt und niemand belangt.
Ich kann auch weniger kriminell veranlagt sein und nach eigenen Kräften so gut leben, wie ich es vermag, ohne mich um die anderen zu küm mern, sofern es diese zulassen, wodurch ich nur das Verbrechen der Gleichgültigkeit begehe und auf mein Glück setze, nie von den Erinyen heimgesucht zu werden. Will ich aber nichts weiter, als dem großen Ganzen stets den ganz großen Gefallen tun, kostet mich das in der Re gel alles, wenigstens aber die Glaubwürdigkeit. Eine Lösung für den scheinbar eingeborenen Antagonismus zwischen individuellem und kollektivem Nutzen könnte durchaus in der Idee der Vorratskammer liegen. Im materiellen Sinn allerdings lässt sich der Konflikt nicht beseiti
gen. Denn es ist evident, dass wir nur eine einzige gegenständliche Vorratskammer haben, den Planeten Erde. Über dessen Nutzung, Ausplün derung oder Konservierung streiten wir schon tagtäglich und werden wir immer streiten. Was sich das Individuum hier herausnimmt, wird stets die Gemeinschaft zahlen müssen et vice versa. Man bräuchte aber so etwas wie eine goldene Nuss alle Vorratskammern lassen an Nagetiere denken , etwas, das man beliebig hinein- und hinaustragen könnte, ohne Wider spruch zu ernten und ohne Konkurrenz der Ressourcen.
Es ist klar, dass es sich bei dieser goldenen Nuss um einen Traum handeln muss oder, im wei teren Sinne, um einen geistigen Gegenstand. Noch hat die Menschheit hier enorme Vorräte. Ob sie wirklich helfen, ist die spannende Frage. Große ethische Maximen und Allgemeinplätze sind unbegrenzte Ressourcen, aber oft auch un glaubwürdige. Die Religionen, die zur Zeit wie der globale Schlagzeilen machen, können mich ebenfalls nicht recht fröhlich stimmen, allein schon, weil es mir widerstrebt, soziales Verhal ten an Jenseitsvorstellungen geknüpft zu sehen (in der Regel geht auch wenig angenehme Le benskunst daraus hervor). Und wer wagte es gar noch, den blutverkrusteten Fetisch der Revolu tion wohin, zu was, von wem in die Kam mer zu tragen?
So erscheint es mir am besten, nach einer kon kreten, lebenspraktischen Antwort zu suchen, als fragte mich mein bester Freund oder besser noch mein eigenes Kind. Denn gerade kommt meine zehnjährige Tochter herein und will wis sen, was ich hier schreibe. Nachdem ich es ihr erklärt habe, verlangt sie natürlich auch die Ant wort. Also sage ich: Wissen und Liebe. Der In halt der goldenen Nuss, zwei Hälften, die nicht zufällig einem Gehirn ähneln. Wissen und Liebe als Grundlage und Maxime des menschlichen Verhaltens anzusehen, habe ich als jun-
ger Mann durch die Lektüre von Bertrand Rus sell gelernt, der es wiederum von Baruch de Spinoza hat. Russell argumentiert mit englischem Pragmatismus: Ohne Liebe gibt es keinen guten Grund für sich oder andere etwas zu tun. Ohne Wissen wird diese Liebe hilflos und ineffizient bleiben und muss sich in den meisten Ernstfäl len geschlagen geben. In Spinozas Ethik fin det man dazu ein großartiges, kristallin schönes Gedankensystem, das man zwar nicht mehr glauben, aber gleichsam nachspielen kann, mit hohem geistigen Gewinn.
Aber zurück zu meiner zehnjährigen Tochter, die nicht ganz zufrieden wirkt. Ich drehe den Spieß um und lasse mir erklären, was sie zur Vorratskammer beisteuern möchte. Sie sagt: »Frieden, Übereinstimmung, Naturschutz, Vertrau en, Nicht nur arbeiten sondern auch Spaß und außerdem noch Bescheidenheit.« Das ist nicht viel schlechter als Russell und Spinoza, finde ich. Sie findet meine Antwort auch sehr gut und elegant, aber doch knapp. Also nehme ich noch den Mut dazu, gleichsam als Schale der Nuss, vielleicht in der Variante von Franz von Assisi: jenen Mut, der immer dann handelt, wenn er entscheiden kann, dass es ihm tatsäch lich gegeben ist, etwas zu ändern. Lebensfreude fehlt, sagt meine Tochter und dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
Thomas Lehr , 1957 in Speyer geboren, studierte Biochemie, bevor er Schriftsteller wurde. Für seine Roma ne erhielt er zahlreiche Preise, u.a. den WolfgangKoeppen-Literaturpreis der Stadt Greifswald (2000 ). Mit seinem jüngsten Roman September. Fata Morgana (München: Hanser Verlag, 2010 ) kam er auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2010 2011 erhält Lehr den Berliner Literaturpreis der Stiftung Preußische Seehandlung. Der Autor lebt in Berlin.
angesichts eines neoliberal entfesselten Kapitalismus nimmt sich die Forderung nach dem richtigen Maß längst nicht mehr so spießbürgerlich aus wie in den späten 1960er Jahren. In der unter dem Eindruck der Finanz- und Wirtschaftskrise geführten Gier debatte, die sich an den Bonuszahlungen für Banker und Bör senbroker entzündet hatte, wurde eine Vorstellung von Maß und Maßhalten sichtbar, die politische Linke und bürgerliche Mittel schicht miteinander einte. Die Vorstellung von Mitte und Maß bekam eine antikapitalistische Stoßrichtung. Angesichts einer sich überschlagenden sozio-ökonomischen Entwicklung, die zu ständig neuen Verwerfungen führte und Blasen bildete, deren Platzen ganze Volkswirtschaften in den Abgrund riss, wurde die Forderung, Mitte und Maß zu halten, zur Suche nach dem Bremspedal bei rasender Fahrt auf den Abgrund. Standen Mitte und Maß in den späten 1960ern für gesellschaftliche Statik und kulturelle Langeweile, so wurden sie nunmehr zum Inbegriff für Entschleunigung in einer Dynamik, der die Versprechungen des Fortschritts abhandengekommen waren.
Die politische Semantik von Mitte und Maß ist variabel und hängt offenbar davon ab, wie die gesellschaftliche Gesamtsitua tion wahrgenommen wird. Je nachdem, handelt es sich dabei um resignatives Einfinden ins Bestehende, das nun eben »nicht zu ändern« sei, oder entschlossenen Widerstand gegen Entwicklun gen, von denen man befürchtet, dass sie verheerende Folgen ha
kulturstiftung des bundes magazin 17
ben werden. Der Malerpoet Wilhelm Busch, ein Schopenhaue rianer reinsten Wassers, hat Ersteres in Wort und Bild gefasst und ist so zum Sentenzengeber kleinbürgerlicher Behaglichkeit ge worden: Die Maßlosen, die Gierigen und Bösartigen scheitern und werden im Räderwerk der Gesellschaft zermahlen, wie Max und Moritz. Die Schaulust am Scheitern der anderen ist die mo ralische Prämie, die den Mittelmäßigen ausgezahlt wird. Oder die Figuren Buschs übernehmen sich und müssen einsehen, dass es besser ist, den Kopf nicht zu hoch zu tragen und sich mit einem maßvollen »Dann und Wann« zu begnügen. Resignation wird zur vorauseilenden Einsicht in das unabwendbare Schicksal der Mittelmäßigen.
Die Gegenvorstellung dazu findet sich bei dem antiken Philo sophen Aristoteles, der das Treffen der Mitte, des kleinen Punkts in einem System aus Kreisen, an die bemerkenswerte Fähigkeit der Bogenschützen gebunden hatte, die Schwerkraft des Pfeiles sowie den Einfluss des Windes mit der eigenen Neigung zu Ab weichungen beim Anvisieren eines Zieles zu verbinden. So wird das Treffen der Mitte zum Gegenteil des Mittelmaßes. Es stellt eine außerordentliche, eine herausragende Leistung dar, zu der nur wenige in der Lage sind. Die Mittelmäßigen dagegen, bei de nen Absicht und Fähigkeit selten deckungsgleich sind, treffen nicht die Mitte; weil sie äußeren Einfluss und innere Disposition nicht exakt zu berechnen vermögen, enden sie an den Rändern
und finden sich wider Willen auf den Außenpositionen, den Ex tremen. Sie wollen vielleicht Maß halten, aber sie können es nicht. Zurzeit ist das aristotelische Bild der Bogenschützen die angemessene Vorstellung für die große Kunst, die Mitte zu treffen. Aber das schließt nicht aus, dass irgendwann Wilhelm Busch erneut aktuell wird, weil Mitte und Maß aus Orten des Widerstands wieder zu solchen einer resignativen Behaglichkeit geworden sind.
Herfried Münkler , geboren 1951, ist Professor für Theorie der Poli tik an der Humboldt-Universität zu Berlin. 2010 erschien im Rowohlt Verlag sein Buch Mitte und Mass. Der Kampf um die richtige Ordnungklug werden von friedrich wilhelm graf
»Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden«, lautet Luthers Übersetzung von Psalm 90, Vers 12. In der Zürcher Bibel, die auf die Reformation Ulrich Zwinglis in Zürich zurückgeht, wird dieser Vers so wiedergegeben: »Lehre uns unsre Tage zählen, dass wir ein weises Herz gewinnen«. Beide Überset zungen lassen erkennen: Der Beter dieses alten Psalmes hat eine klare Vorstellung von Lebenskunst. Die entscheidende Aufgabe des Menschen sieht er darin, seiner Endlichkeit, Sterblichkeit in ne zu werden. Dabei geht es ihm nicht um irgendeine ars morien di, also die in vielen alten Ethiken und religiösen Traktaten ent faltete Kunst, in Demut vor Gott und im Wissen um die eigene Sündhaftigkeit und Erlösungsbedürftigkeit würdig von dieser Welt Abschied zu nehmen. Man mag einwenden, dass das Ster ben ein entscheidender Moment unseres Lebens ist und Lebens kunst deshalb auch Sterbenskunst einschließen muss. Aber den Beter des 90. Psalms interessiert nicht die letzte Lebensphase vor dem Tod oder das Ende des Lebens als ein bestimmter Zeitpunkt, sondern, sehr viel grundsätzlicher, ein ganz neuer Blick aufs Le ben insgesamt, ein grundlegender Perspektivenwechsel. Für ihn liegt die entscheidende Lebenskunst in einer spezifischen, religi ös vermittelten Reflexionshaltung, dem permanent präsent zu haltenden Wissen um die eigene Endlichkeit. Solche Todessensi bilität dient hier nicht etwa dazu, einen dunklen, depressiv stim menden Schatten aufs Leben zu werfen. Sie soll vielmehr Le benssteigerung bewirken und fördern. Die Reflexion aufs eigene Sterbenmüssen steht hier im Dienst des Lebens, seiner Stärkung und Intensivierung: »Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir leben lernen.«
Leben lernen heißt vor allem: Im Wissen um die unausweich liche Endlichkeit unseres Lebens die Lebenszeit, die uns ge schenkt ist, in ihrer Fülle auszukosten. Sehr viele Menschen sind leider nur kaum dazu bereit oder imstande, im Hier und Jetzt zu leben. Sie verlegen ein besseres, erfüllteres Leben in eine mehr oder minder nahe Zukunft ihres Lebens, etwa in den Ruhestand oder in eine Lebensphase, in der sie über sehr viel mehr Geld ver fügen als jetzt, und hoffen, dass ihr Leben dann, wenn dies und jenes endlich erreicht und eingetreten sei, schöner sei. Diese Menschen leben auf eine imaginäre Zukunft hin, auf jenes Mor gen oder gar Übermorgen, an dem dann alles sehr viel besser sein soll. Solche Glücksverschieber sind notorisch gegenwartsunfähig.
Sie haben durchaus je eigene Vorstellungen vom guten Leben. Auch möchten sie gerne Lebenskünstler sein aber eben erst später, unter subjektiv geeigneteren Bedingungen. Aber sie leiden unter einem elementaren Mangel an lebensdienlichem Kunst sinn und an Kunstfertigkeit. Gelingende Lebenskunst setzt nun einmal die Bereitschaft und Fähigkeit voraus, sich zum Lebens künstler bilden zu lassen. Eine religiös vermittelte, ganz unfana tische, gelassene Todessensibilität ist die entscheidende Schule der Lebenskunst. Sie erlaubt es, zwischen Wichtigem und weni ger Wichtigem zu unterscheiden, und sie verhilft dazu, das Hier und Jetzt, den aktuell zu lebenden Moment ernst zu nehmen. Wer den jeweiligen Lebensmoment als gehaltvoll zu deuten, ei nen bestimmten Moment als mir gewährte kostbare Zeit in sei ner möglichen Fülle zu gestalten und auszukosten weiß, der stei gert die Intensität seines Lebens und so auch seinen Lebensge nuss. Es ist durchaus weise, momentsensibel im Hier und Jetzt zu leben denn die Zukunft steht uns nicht zur Disposition, sie ist gerade dadurch bestimmt, dass wir von ihr trotz aller sozialtech nologischen Bemühungen um Vorhersage, Prognose und Risikofolgenabschätzung nichts Genaues wissen können. Dem hier empfohlenen Präsentismus des Lebens scheinen die moralischen Intuitionen zu widerstreiten, die viele mit Blick auf die zerstörerischen, die Lebenschancen kommender Generationen gefährdenden Züge vieler gegenwärtiger Lebensweisen emp finden. Aber die intensivierte Wahrnehmung des je gegenwärtigen Moments schließt es keineswegs aus, Bedingungen des Über lebens der Kommenden in den Blick zu nehmen. Weisheit ei ne im ethischen Diskurs der Gegenwart leider unterschätzte Tu gend gebietet es, so im Hier und Jetzt zu leben, dass man auch morgen und vielleicht gar übermorgen möglichst heiter, ver gnügt und gelassen die gewährten Momente zu genießen vermag. Aber man muss sich als freies Individuum vor jener moralischen Arroganz schützen, die mir als Einzelnem gleich die Verantwor tung für das ganze Überleben der Nachgeborenen oder gar das Schicksal des Planeten zuweist. Auch hier hilft der Blick in die Symbolspeicher der religiösen Überlieferungen. Die Heiligen Schriften vieler Religionen, nicht zuletzt die Bibel, sensibilisie ren uns für die Knappheit von Zeit und die Endlichkeit unserer Lebensressourcen. Deshalb lege ich eine Bibel (oder, wäre ich ein Muslim, einen Koran) in meine mentale Vorratskammer. Denn ab und zu bedarf ich der aktiven Erinnerung daran, dass ich pri mär in der Gegenwart zu leben habe, wenn ich, auch um anderer willen, eine Zukunft haben will.
Friedrich Wilhelm Graf , geboren 1948, ist protestantischer Theologe und Professor für Systematische Theologie und Ethik an der Universi tät München ( LMU ). 1999 erhielt er den Leibniz-Preis der Deutschen For schungsgemeinschaft. Soeben erschienen sind die Bücher Kirchendämme rung . München: C H . Beck, 2011 sowie Der heilige Zeitgeist . Tübin gen: Mohr Siebeck, 2011
diagnose und therapie von jürgen mlynek
Mit der Theorie der Evolution beschrieb Charles Darwin 1859 die Gesetzmäßigkeiten, die über den Fortbestand aller Spielarten des Lebendigen entscheiden: Es sind die ›Passendsten‹, die überleben und sich fortpflanzen, also diejeni gen, die am besten auf ihre Umwelt eingestellt sind und sie zu ihrem Vorteil nutzen können. Akribische, jahrzehntelange Analyse seiner un zähligen Beobachtungen hatte Darwin zu die ser Erkenntnis geführt. Als Wissenschaftler ließ er die alten Erklärungsmuster hinter sich und entwarf eines, das sich immer noch bewährt und weitere Fortschritte in Biologie und Medi zin ermöglicht. Das Erkennen der Gesetze der
Natur ist eine der wichtigsten Früchte wissen schaftlicher Arbeit, aber nicht die Einzige. Unsere Kenntnis der Naturgesetze gibt uns auch eine gewisse Gestaltungsmacht: Auf der Basis von Forschung entstehen neue Technologien. Durch den Einsatz von Verstand und Erfin dungsgeist konnte sich die Spezies Mensch bis in die unwirtlichsten Lebensräume der Erde ausbreiten. In diesem Sinne ist Wissenschaft selbst eine Überlebenskunst des Menschen, ich meine sogar: die entscheidende.
Kann sie diesem Anspruch auch in Zukunft ge recht werden? Gerade der Erfolg der Spezies Mensch stellt uns heute vor globale Herausfor derungen neuer Qualität. Dass unsere Lebens weise bereits begonnen hat, die Erde tiefgreifend zu verändern und unsere natürlichen Lebens grundlagen zu erschöpfen, ist schon jetzt beun ruhigende Gewissheit untermauert durch wissenschaftliche Evidenz. Nun muss die Wis senschaft nicht nur die Diagnose liefern, son dern auch die Therapie. Das ist ihr Beitrag zu unserem Überleben auf unserer sich wandeln den Erde. Doch welche Antworten können wir
kulturstiftung des bundes magazin 17
der innere idiot von aleks scholz
»Wir sind alle Wissenschaftler und zwar sehr schlechte.« Das könnte ein Zitat sein, zum Beispiel von Feynman oder Chand rasekhar, ist aber von mir ausgedacht. Der erste Teil immerhin war Titel eines Essays von Thomas Henry Huxley, Zeitgenosse, Kollege und Unterstützer von Charles Darwin sowie Großvater der womöglich bekannteren Brüder Aldous und Julian. Huxley argumentiert darin glaubwürdig, dass die wesentlichen Denk techniken, die Wissenschaftler beim Ableiten von Naturgeset zen verwenden, genauso das Alltagsgeschäft von vollkommen normalen Leuten bestimmen. Sein einleitendes Beispiel dreht sich um Äpfel: Beißt ein wissenschaftlich ungebildeter Äpfel käufer nacheinander in zwei harte, grüne Äpfel und stellt er fest, dass beide sauer schmecken, so wird er daraus genau wie ein Wis senschaftler ein allgemeines Naturgesetz ableiten und es sich schenken, in den dritten harten, grünen Apfel auch noch zu bei ßen.
Huxleys Apfelbeispiel illustriert gleichzeitig, warum wir schlechte Wissenschaftler sind: Wir sind viel zu ungeduldig. Besessen von seinem Schlussfolgerungsdrang, präsentiert unser Geist, die ser innere Idiot, fertige Naturgesetze (hart und grün, also sauer), selbst wenn die Stichprobe winzig ist. Im Apfelfall ist die Anzahl der Messwerte immerhin n=2 , in vielen Fällen begnügt sich der innere Idiot mit n=1. Ein repräsentatives Beispiel, das man in diesem Winter oft hört: »Kalt heute, also kann das mit der globa len Erwärmung nicht stimmen.« Wenn ich eben »oft« sagte, mei ne ich natürlich »ein- oder zweimal«. Anekdotisches n=1-Schlussfolgern ist nicht das einzige Problem des inneren Idioten. Außerdem hat er Schwierigkeiten mit der
sauberen Auswahl und Behandlung der Stichproben, zum Bei spiel, weil er seine eigenen Erfahrungen für wichtiger hält als die des Nachbarn oder weil er Erfahrungen, die weit zurückliegen, längst vergessen hat. Der innere Idiot beherrscht mehrere hun dert solcher Fehlmechanismen, und das sind nur die, von denen wir bereits wissen. Unser n=1-Problem beispielsweise ist unter dem Namen Fallacy of the lonely fact bekannt, aber weit exotischere Tiere finden sich im Zoo der Fehlschlüsse, zum Beispiel die No True Scotsman Fallacy: Eine tollkühne Behauptung, die auf n= 0 beruht, also ohne jeden empirischen Test aufgestellt wird (»No Scotsman is gay.«), wird nach ihrer Widerlegung (es findet sich ein schwuler Schotte) trotzdem unter fachkundigem Ausschluss des Gegenbeispiels beibehalten (»No true Scotsman is gay.«). Das ist eine bewundernswerte Meisterleistung, die Krokodile sicher nicht draufhaben. Warum beharrt der innere Idiot auf anekdotischen Schlussfolge rungen? Weil diese Anekdoten seine Existenz ausmachen. Ein Leben ist eine Serie aus subjektiven Anekdoten, einmaligen Er lebnissen und Empfindungen, die nicht exakt reproduzierbar sind, und eben keine objektive Datensammlung unter kontrol lierten Bedingungen. Wer will sich schon tausendmal die Hand am Herd verbrennen, bevor er etwas über die Verkohlungseigen schaften von menschlichem Fleisch behauptet? Ohne diesen Strom aus einmaligen, subjektiven Episoden würde sich der in nere Idiot auflösen und in etwas ganz anderes verwandeln, zum Beispiel in einen Gartenzwerg, der keine Ahnung hat, was ihn vom identischen Nachbarzwerg unterscheidet. Astronomie ist die Wissenschaft, die dem inneren Idioten relativ nahe steht, weil sie ihre Objekte nicht in ein Labor stellen und untersuchen kann. Man kann nicht einfach 100 000 grüne, har te Sterne kaufen und reinbeißen, sondern muss nehmen, was das Weltall bietet. Bis heute zum Beispiel gibt uns das Weltall nur ei nen einzigen Planeten wie die Erde, und dementsprechend man gelhaft sind daher unsere Schlussfolgerungen über die Entste hung der Erde eine tragische Notlage. Ansonsten aber wollen Naturwissenschaften mit Anekdoten nichts zu tun haben. Sie ent-
fernen den inneren Idioten und machen damit den Weg frei für massive, objektive Stichproben.
Damit ist etwas Interessantes passiert: Um überhaupt empirisch arbeiten zu können, hat sich der Naturwissenschaftler selbst aus seinen Schlussfolgerungen entfernt. Ihn selbst, den Baumeister seines naturwissenschaftlichen Weltbildes, gibt es in diesem Weltbild nicht. Das ist ein Problem, weil man eigentlich gern alles er klären würde, und nicht nur alles minus einen wesentlichen Be standteil. Wie geht der innere Idiot mit diesem Problem um? Zum Beispiel mit Hilfe der Petitio Principii, eines weiteren beliebten Fehlschlusses: Nachdem er sich selbst, das beobachtende Subjekt, ausgeklammert hat, behauptet er, dass es dieses Subjekt gar nicht gibt, oder wenigstens, dass er es rein naturwissenschaftlich erklä ren kann, genauso wie Sterne oder Steine also. »Wir haben uns daran gewöhnt«, so der Münchner Philosoph Ruben Schneider, »mit dem Subjekt umzugehen, als sei es sowas wie eine Banane oder ein Klumpen Eiweißschleim.«
Die größte Stärke der Naturwissenschaft die Aussperrung des inneren Idioten ist gleichzeitig auch ihre größte Schwäche. Sie kann ziemlich viel, aber nur in klar umrissenen Grenzen, und am Subjekt scheitert sie per Design. Man kann das Subjekt nicht mit Rastertunnelmikroskopen und Positronen-Emissions-Spek troskopen ansehen; wenn man das Hirn aufschraubt, ist nichts vom Subjekt zu sehen. Egal, wo man nachsieht, es ist immer wo anders. »Free the inner idiot«, das könnte wieder ein Zitat sein, vielleicht von Nietzsche oder Homer Simpson, ist aber von mir ausgedacht.
Aleks Scholz 1975 in Gera geboren, ist promovierter Astronom. Nach Forschungsaufenthalten in Kanada und Schottland arbeitet er zurzeit als Schroedinger Fellow am Dublin Institute for Advanced Studies in Irland. Zusammen mit Kathrin Passig veröffentlichte Scholz das Lexikon des Unwissens (Berlin: Rowohlt, 2007) sowie Verirren eine Anleitung für An fänger und Fortgeschrittene (Berlin: Rowohlt, 2010 ). Bei den 34 Tagen der Deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt 2010 gewann er mit sei nem Text Google Earth den Ernst-Willner-Preis.
erwarten? Von extremen Haltungen gegenüber der Wissenschaft sollten wir uns dabei verab schieden: Weder übertriebener Gestaltungsop timismus angesichts neuer Technologien noch die pauschale Ablehnung von Wissenschaft und Technik werden uns in eine lebenswerte Zukunft führen. Stattdessen wünsche ich mir eine Geisteshaltung, die aus Kenntnis der wis senschaftlichen Denk- und Arbeitsweise nicht nur die Grenzen der Forschung einschätzen kann, sondern vor allem auch ihre Möglichkeiten beherzt nutzt.
Zwei Dinge an dieser Geisteshaltung betrachte ich als entscheidend für den Erfolg der Wissen schaft als Überlebenskunst der Zukunft: Das Streben nach Systemlösungen und den sinn vollen Umgang mit der Unvollkommenheit des Wissens. Die Suche nach Systemlösungen ist ei ne der großen wissenschaftlichen Herausforde rungen unserer Zeit. Aktuell fehlen uns zur Be einflussung wichtiger komplexer Systeme nicht nur die Technologien, sondern auch die Wissens grundlagen. Wir haben große wissenschaftliche Erfolge erzielt mit der Zergliederung von natür
kulturstiftung des bundes magazin 17
lichen Systemen in ihre Bausteine und verste hen beispielsweise gut, wie eine einzelne Nervenzelle funktioniert. Das Zusammenwirken der rund hundert Milliarden Nervenzellen im Ge hirn bleibt aber nach wie vor ein Forschungsde siderat. Ähnlich verhält es sich für das System Erde: Auch wenn wir einzelne Phänomene wie z.B. die Entstehung von Wirbelstürmen schon gut durchdringen, können wir komplexere Pro zesse wie die Dynamik des Klimas bislang nur lückenhaft erklären.
Natürlich ist die Gefahr des wissenschaftlichen Irrtums bei der Erforschung komplexer Systeme in der Regel größer als bei der Untersuchung von Teilproblemen. Deshalb bedeutet Forschung immer auch, die Restungewissheit bewusst zu benennen. Und zwar auch und sogar gerade dann, wenn wir unter Zeitdruck Entscheidungen treffen müssen und nicht abwarten können, bis der fragliche Sachverhalt wissenschaftlich gänzlich zweifelsfrei geklärt ist. Das jüngste Bei spiel für diese Problematik ist die Debatte um den Klimawandel. Menschen ohne wissenschaftliche Sozialisierung, die beispielsweise als Ent
scheider in Politik und Gesellschaft wirken, er warten häufig eindeutige Aussagen und Progno sen von der Wissenschaft; sie empfinden das Benennen der Unsicherheiten nicht als Stärke, sondern als Schwäche der Forschung. Dies be ruht auf einem grundlegenden und folgenreichen Missverständnis: Wissenschaftliche Er kenntnis wird nicht dadurch entwertet, dass sie vorläufig und nicht absolut ist. Auch tentative Aussagen befähigen zum Handeln, sie erfordern allerdings einen bewussten Umgang mit dem Risiko des Irrtums.
Vor allen Dingen dürfen wir nicht glauben, dass einzelne Irrtümer ein Indiz für das Versagen der Wissenschaft als Prinzip und damit als Überlebenskunst sind. Das Erfolgsprinzip der wissen schaftlichen Arbeitsweise beruht gerade darauf, dass der gegenwärtige Wissensstand immer Raum für Interpretationen und damit Theorieund Hypothesenbildung lässt, die dann empi risch überprüft werden müssen. Denn auch das gehört zur Wissenschaft als Geisteshaltung, die unser Überleben auf der Erde sichern kann: Die Anerkennung empirisch erhärteter Annahmen
als Wirklichkeit, mit der wir uns arrangieren müssen; und zwar unabhängig von unseren weltanschaulichen Präferenzen. Es gibt immer einen ultimativen Prüfstand für das, was wir von der Welt zu wissen glauben, und das ist die Natur. Im immer neuen Aufstellen und Testen von Hypothesen durchläuft das Wissen selbst einen evolutionären Prozess der ständigen Ver besserung durch empirische Bewährung. Wir sind gut beraten, ihn voranzutreiben und die Wissenschaft als Überlebenskunst unserer Spe zies weiter zu entwickeln. So werden wir hof fentlich durch neue Einsichten verhindern kön nen, dass das große Experiment unseres Überle bens auf diesem Planeten zu unseren Unguns ten verläuft.
Jürgen Mlynek , geboren 1951, ist Physiker und seit 2005 Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft in Berlin, der größten Forschungsorganisation Deutschlands. Von 1996 bis 2001 war er Vizepräsident der Deutschen For schungsgemeinschaft. Im September 2000 wurde er Präsi dent der Humboldt-Universität zu Berlin. Mlynek wurde mit zahlreichen wissenschaftlichen Preisen und dem Bun desverdienstkreuz ausgezeichnet.
nicht gott, nicht teufel von volker mosbrugger
»Was ist der Mensch?
Was kann ich wissen?
Was soll ich tun?
Was darf ich hoffen?«
— dies sind die von Immanuel Kant (1724– 1804) formulierten, zeitlos aktuellen Kernfragen des Menschen und der Philosophie. Sie sind ent scheidend für unser Selbstverständnis und die Gestaltung unserer Zukunft, jeder mag sie für sich je nach persönlichem Hintergrund, phi losophisch-religiösen und politischen Vorlie ben unterschiedlich beantworten. Doch gibt es dazu auch eine Sicht der modernen Naturfor schung, die die Entwicklung der Erde und des Lebens, einschließlich des Menschen, als eine System-Evolution betrachtet. Diese Sicht ist be
ruhigend und beunruhigend zugleich, mahnt auf jeden Fall zu Bescheidenheit und Gelassen heit.
Was ist der Mensch? Aus Sicht der Naturforschung zunächst einmal eine Art wie jede andere auch, ein »darwinischer Afrikaner«, wie der Anthropologe Volker Sommer zu sagen pflegt, entstanden vor etwa 200 000 Jahren in Afrika aus einer Evolutionslinie, die sich vor rund 6 Millionen Jahren von der Entwicklung zu den modernen Menschenaffen abgetrennt hatte. Einmalig ist der Mensch in der Tat, aber auch das ist nichts Besonderes, weil jede biolo gische Art auf ihre spezifische Weise Einmalig keit beanspruchen kann. In unserer anthropo zentrischen Sicht mögen wir uns als besonders wichtig und erfolgreich sehen, biologisch be trachtet sind wir nicht besser, aber auch nicht schlechter als die insgesamt rund 2 Millionen bekannten Tier- und Pflanzenspezies. So ist ›na türlich‹ nicht verwunderlich noch verwerflich, dass wir uns die Erde wie jede andere Art im Rahmen unserer Möglichkeiten untertan ma chen.
Was kann ich wissen? Viel, aber nicht alles so lautet die Antwort der evolutionären Erkenntnis-
theorie. Wenn das menschliche Gehirn im Lau fe einer langen Evolution entstanden ist, darf es nicht verwundern, dass es ähnlich wie die Gehirne anderer Tierarten bestimmten (menschlichen) Erkenntnisgrenzen unterworfen ist, den vieldimensionalen Raum ebenso wenig wie das Universum und sich selbst jemals voll ständig verstehen wird. Auch der Lügenbaron Münchhausen kann sich, wie bekannt, nicht an seinem eigenen Schopfe aus dem Sumpf ziehen, in den er geworfen ist! Die offensichtliche Be schränktheit unseres Erkenntnisvermögens sollte die (Natur-)Wissenschaft zu etwas mehr Be scheidenheit ermuntern Raum für eine Me ta-Physik ist allemal. Andererseits dürften sich die Geistes- und Sozialwissenschaften durchaus stärker mit den evolutionären Bedingtheiten unseres Denkens und Handelns befassen. So findet sich in dem 2010 erschienenen wunderbaren Buch von Amartya Sen, Nobelpreisträger für Wirtschaft, über Die Idee der Gerech tigkeit kein Hinweis auf Charles Darwin und die Evolutionstheorie. Können wir ernsthaft glauben, unsere Vorstellungen von Ethik, Ästhetik oder Gerechtigkeit hätten nichts mit unserer Entwicklungsgeschichte zu tun? Repräsentiert
das großartige, in Tübingen angesiedelte Projekt Weltethos nicht gerade die Suche nach den evolutionären Wurzeln und Gemeinsamkeiten unserer Ethik?
Was soll ich tun? Der eigenen Art langfristig zum Überleben verhelfen dies ist zunächst der evolutionäre Auftrag an jede Art, auch an Homo sapiens. Daraus lässt sich Vieles, aber kei nesfalls Alles ableiten. Offensichtlich geht es um Nachhaltigkeit, um die Sicherung unserer Lebensgrundlagen für die Zukunft ange sichts der großen Herausforderungen, wie Kli mawandel, Artensterben, Energie- und Ressour cen-Verknappung, sicher keine leichte Aufgabe. Ziel ist dabei keinesfalls das einfache Bewahren eines bestimmten Status Quo, sondern eine evolutionäre Nachhaltigkeitsstrategie, die eine auch aus sich heraus dynamische Erde dyna misch gestaltet. Nachhaltigkeit wird es ohne ein cleveres Erdsystemmanagement, das alle Umwelt eingriffe auf Langzeit- und System-Auswirkungen überprüft, nicht geben.
Was darf ich hoffen? Alles, nur nicht das offen sichtlich Unmögliche! Hoffnungslos sind also alle Bemühungen um Allwissenheit, um ein Paradies oder ewiges Leben auf Erden. Hoffen darf →
mutter in der kammer von noémi kiss
Vor Kurzem schenkte ich Kindern das Leben. In meinem Fall handelte es sich dabei um Überlebenskunst, wenn man so will. Ich nahm mir vor, dass ich die Kinder wie zwei Eier in der Speise kammer aufbewahre, konserviere, damit sie so bleiben würden, wie ich sie mir anfangs vorgestellt hatte. Inzwischen ist klar, dass es sich um Wunder aus Fleisch und Blut handelt, für die eine Vorratskammer nicht der geeignete Lebensraum ist. Mich beglü cken weder die unzähligen Windeln mit Kaka noch das nächt liche Brüllen, weil die Decke wegrutschte oder ihnen um Mitter nacht einfiel zu spielen. Sie fieberten, hatten Hunger, Angst, be kamen Beklemmungen, schrien. Sie wollten an die Brust und ich wollte sie ihnen verweigern, lag todmüde auf einem Teppich, wie aufgebahrt. Keineswegs möchte ich sie nochmal mit acht Mona ten einander an den Haaren ziehen sehen, vom Arzt hören, et was stimme nicht mit der Entwicklung des Jungen, die Muskula tur sei schwach, er bleibe hinter dem Mädchen zurück. Wir tur nen mit unserem Jungen, rollen mit ihm auf dem Rollerbrett, wi ckeln ihn in Laken. Wie Zirkusesel kriechen mein Mann und ich jeden Morgen auf allen vieren vom Wohnzimmer zum Essplatz. Während dieses Programms brechen die Zwillinge in Gelächter aus. Auch Lachen fördert die Gesundheit!
Ich habe keine Wahl, die Kinder zu konservieren oder nicht. Denn für mich bleiben sie ja die Gleichen, auch wenn sie einmal groß werden; das Tohuwabohu um ihre Frühgeburt wird mir si cherlich nicht fehlen. Viel mehr bedrückt mich die dicke Luft in diesem netten, exotischen Land, wo ich sie empfing. In meinen heimlichen Sehnsüchten möchte ich meinen Kindern das Er wachsenwerden hier und jetzt ersparen, genauer, sie davor be wahren, dass irgendjemand an ihr Erwachsenwerden Hand an legt.
Meine Kinder sind Retortenbabys. Sie trafen zu Weihnachten ein, das Christkind brachte sie. In ihrer kurzen Geschichte stie
ßen mindestens zwei metaphysische Kräfte aufeinander. Die Kraft eines Poeten und die des Arztes. Kürzlich schrieb nämlicher Poet (männlich, volkstümliche Richtung, vielfacher Preis träger) in seiner Neujahrsbotschaft in der Tagespresse, dass IVF Zwillinge nichts anderes als Wunder seien, denn »in der Natur« sei die »künstliche Zeugung von Zwillingen nicht möglich«. Als ich damals in der Klinik nachfragte, wovon es abhinge, ob der Embryo sich in der Gebärmutterschleimhaut einniste, sagte der Arzt, von Gott. Das heißt, dass die unbefleckte Empfängnis in der Retorte der Vorstellungskraft des Herrn überlassen ist. In die Sache der Natur könnten weder der Arzt noch der Biologe noch ich eingreifen. Wie kommt dann dieser Poet darauf, dass die künstliche Befruchtung eigentlich »wider die Natur« sei? Während der Poet Aphorismen sammelt und hinter seinen Zei len kaum verhohlen ein gesellschaftliches Vorurteil steht die Karrieristin gebiert in fortgeschrittenem Alter Retortenbabys, bereitet Doktor Josef die Eierstöcke Marias vor, stimuliert sie mit Medikamenten, saugt die reifen Eizellen ab, führt die Schwester das Röhrchen in die Scheide ein und pumpt der Biologe aus der Petrischale die bereits von kleinen Soldaten befruchteten Embryonen im Zellstadium hinein. Alles Weitere ist Sache des Herrn.
Die Biologie hat also viel mehr mit dem Wunder gemeinsam als unser Poet und seine Vorstellungskraft. Der Arzt fand tausend mal schönere Worte als er. In unserer Stadt passiert es täglich, dass sich jemand in die Angelegenheiten der Frauen einmischt.
Als erschöpftes Mitglied einer patriarchalischen Gesellschaft könnte ich sowas ignorieren, ging dem jedoch nach. Ich war neu gierig, was Mütter darüber denken.
Ich befragte mehrere Dutzend werdende Mütter, die ich im Krankenhaus traf, erkundigte mich auf dem Spielplatz, beim Kinderarzt, bei der Frühchenförderung Wiegenlied , wohin wir wöchentlich gehen. Ausnahmslos bekam ich die Antwort, sie seien überzeugt, dass ihnen ein Wunder zuteil würde. Kam jemand schon einmal auf die Idee, dass Marias Sohn Jesus ein Retortenbaby sei? Dabei ist das Schema das Gleiche. Die Heili gen Drei Könige bestätigten die Geburt des Wunderkindes. In unserem Fall stellten eine Hebamme, ein Kinderarzt und eine Säugamme auf der Intensivstation im Krankenhaus die Beschei nigung aus. Jahrelang, als ich nicht schwanger wurde und dachte, dass ich nie Kinder haben werde, durchstöberte ich die Internetforen für un fruchtbare Frauen. Ich war neugierig, welche Praktiken sich an
dere Frauen einfallen ließen, um zu überleben. Sie wollten Müt ter werden und beteten fortwährend. Es gab natürlich auch Frau en, die zum Esoteriker gingen, Wahrsagerinnen und Zigeune rinnen befragten, Nadeln in sich hineinstechen ließen, um Hilfe zu bekommen bei der Empfängnis. Im statistischen Durch schnitt verschwanden diese Frauen nach und nach aus dem Fo rum, fünfundzwanzig Prozent der Patientinnen bekamen früher oder später ein Baby. Manche Frauen brachten Zwillinge zur Welt, mit zwei oder sogar drei Säuglingen auf dem Arm verließen sie die Klinik, manche adoptierten ein Kind, auch ein Wunder. Langsam schlugen sich diese Frauen durch zu den Internetnut zerinnen mit Baby. Sie schrieben, dass etwas Außergewöhn liches mit ihnen geschehen sei, erzählten immer wieder, dass sie fassungslos seien und niemals daran geglaubt hätten, ein Kind zu bekommen. Das nicht enden wollende Baby-Geschrei einer fiebrigen Nacht brach endlich den Zauber und beendete den be sinnungslosen Zustand. An einem winterlichen, nebelig-grauen Tag wie heute rollte ich mich todmüde und völlig verbittert auf dem Sofa zusammen, weil meine hungrigen und verschnupften Babys den ganzen Tag greinten. Ich tröstete mich mit dem ersten Ultraschallbild, als alles noch gut war. Zerknittert und voller Milchflecken trage ich es in meiner Hosentasche. Eigentlich ge hört es in die Vorratskammer.
Manchmal würde ich die Kinder am liebsten in meinen Bauch zurückbugsieren. Einerseits, weil sie zu früh kamen und meinem Sohn offensichtlich das fötale Hin- und Herschaukeln fehlt. An dererseits, weil sie auf dieser Welt mit soviel Unsinn vollgestopft werden. Sollten sie nicht mehr in meine Gebärmutter hineinpas sen, begeben wir uns eben gemeinsam in die Speisekammer, zurück in die Retorte. Wir lesen zusammen, mithilfe einer Ta schenlampe, denn dort ist es natürlich dunkel. Wir lesen nur solche Märchen, die mit unserem Wunderglauben übereinstim men.
Noémi Kiss , geboren 1974 in Gödöllö, Ungarn, studierte Hungarologie, Komparatistik und Soziologie, zeitweise auch in Deutschland. Sie ist promo vierte Literaturwissenschaftlerin und veröffentlichte zahlreiche Erzählungen, Essays und Kritiken in deutscher und ungarischer Sprache. Kiss ist seit 2000 Dozentin für Vergleichende Literaturwissenschaft an der ungarischen Univer sität Miskolc. Zuletzt erschien von ihr auf Deutsch Was geschah, wäh rend wir schliefen. Erzählungen . Berlin: Matthes und Seitz, 2009 Für 2012 sind die Erzählungen Verfallene Schmuckdose. Reisen in den Osten in Vorbereitung. Die Übersetzung aus dem Ungarischen stammt von Silvia Petzoldt und Anna Roth
man dagegen, dass sich die 4 Milliarden Jahre lange Erfolgsgeschichte der Evolution des Sys tems Erde-Leben noch eine Weile fortsetzen wird mit und ohne Menschen.


Die Zukunft nachhaltig zu entwickeln, ist eine umfassende Aufgabe, die alle Bereiche mensch lichen Denkens und Handelns fordert. Die mo derne Naturforschung legt uns nahe, diese Auf gabe mit einem evolutionären Selbstverständ nis anzugehen, das den Menschen als das sieht, was er ist: das Produkt einer langen Evolution, weder gut noch böse, weder gott- noch teufels gleich, weder allmächtig noch ohnmächtig. Wir dürfen und müssen unsere Zukunft und unsere Erde aktiv gestalten. Mut und Demut sind ge fragt.
Volker Mosbrugger 1953 in Konstanz geboren, Paläobotaniker und -klimatologe, ist Generaldirektor der Sen ckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt am Main. Er ist gleichzeitig Professor für Geowissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt. Seit 2008 ist er außerdem wissenschaftlicher Koordinator des Biodiversität und Klima Forschungszentrums Frankfurt. 1998 erhielt Mosbrugger den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft
slow mind von dorota masłowska
Als Mutter einer sechsjährigen Person komme ich seit längerer Zeit nicht umhin, mir die neuesten Errungenschaften der FilmImperien von Disney und Pixar zu Gemüte zu führen. Als eine Person, die im Alter von sechs Jahren mit Kastanien spielte und Märchen von eiernden Schallplatten hörte, komme ich gewöhn lich mit zerstörter Frisur und unvergleichlich größerem Spei chelverlust aus dem Kino als die sechsjährige Person, die von der bedrohlich zunehmenden Perfektion und Monumentalität die ser Bilder angetan ist, wenn sie ihnen auch mit einer gewissen Portion Kühle und Selbstverständlichkeit begegnet. Diese Filme, in 3D betrachtet, extrem beschallt, extrem bunt, vi suell und akustisch zu höchster Intensität gesteigert, erreichen ein paradoxes Niveau von Realität sie sind viel wirklicher als die Wirklichkeit selbst. Versteckt im großen Schatten, den die Technologieexpresse der Produzenten werfen, flimmert nur noch wie ein Vorwand die bruchstückhafte Handlung: Eine Figur ist gut, eine ist böse, eine der Trottel, den es immer unausweichlich dorthin zieht, wo gerade eine Bananenschale weggeworfen wur de. Dazu die symbolische Prise Moral, die das Werk durchgeis tert wie das einsame Eiweißmolekül den großen Gummibären von Haribo: Du sollst die Tiere und die aussterbende Natur ach ten, Geldgier lohnt sich nicht, denn das allerwichtigste im Leben ist die Freundschaft. Um des lieben Friedens willen belässt man es bei dem Anschein eines Märchens. In Wahrheit hat es sich längst in eine Serie atemberaubender Bilder mit der Dynamik eines Rollercoasters verwandelt. Fehlt nur der Kunstwind, der das Haareraufen beim Gedanken an die bevorstehende Apoka lypse der Kultur für mich besorgt. Denn wenn man davon ausgeht, dass der große Rüstungswett lauf der Animationsimperien, vor dessen Leinwände wir unsere Kinder setzen, die moderne Entsprechung des Märchenerzäh lens oder Vorlesens ist, dann dürfte Bruno Bettelheim ( Kinder brauchen Märchen ) sich im Grabe umdrehen. Das Mär chen, das die finsteren Winkel der menschlichen Natur durch dringt, das Kind in die dunklen Ecken der Welt mitnimmt und es darin übt, das Licht des Guten in der Finsternis zu suchen, war ursprünglich eine Art Impfung, die den kleinen Menschen auf das Leben auf dem Planeten Erde vorbereitete. Dieses Leben weist außer vielfältigen Rosatönen auch eine große Zahl anderer, weniger schöner Farben auf. Die Märchenversion von heute, in der die Geschichte nur Vorwand zur Erzeugung betäubender Bil der ist, gleicht in ihrer hohlen Rasanz eher einer Karussellfahrt, in manchen Fällen auch dem Schleudergang einer Waschma schine.
Natürlich will ich hier mit meinen 27 Jahren nicht die Greisin spielen, die mit rheumatischem Finger fuchtelt, früher sei alles besser gewesen und von nun an sollten alle Kinder wieder mit Zweiglein, Blindgängern und Katzen spielen und abends Ander sen lesen (und zwar selbst!), und, ganz wichtig, die malerische Beschreibung des Todeskampfes kleiner Mädchen, die Mordtaten und die Aufzucht von menschlichen Schädeln in Blumentöpfen. Meine Befürchtung geht tiefer: dass die Entwicklung der visuellen und kommunikativen Techniken gegen klassische Ver standestechniken wie die der Erzählung gerichtet ist. Bei der täg lich wachsenden Verbreitung von Mitteln zur Fixierung der Wirklichkeit des Fotoapparats, der Videokamera oder des Mobilte lefons büßt die Wirklichkeit erschreckend rasch an Daseins berechtigung ein. Wir verlassen uns darauf, dass Fotografien und Filme nicht nur den anderen, sondern sogar uns selbst von unse-
rem Urlaub erzählen werden; unsere Fähigkeiten zu erinnern und Fakten zu ordnen treten wir sorglos an die Festplatten der Computer ab, ja mehr noch: Nonchalant entledigen wir uns der Lebenswirklichkeit und geben sie an die Geräte weiter. Die Mü hen technischer Aufnahmen ersetzen immer mehr unsere sinn liche Wahrnehmung.
Ich frage mich, wann ich aufgehört habe, Konzerte zu besuchen. Sie sollen ja eigentlich Versammlungen sein, spontane Gemein schaften, deren Zweck das Anhören von Live-Musik ist. Ich spre che hier nicht von der ekstatischen geistigen Vereinigung und dem kollektiven Nirwana, dem gegenseitigen Kleiderzerreißen im allgemeinen Rausch, wie es schon die Generation der 60er Jahre pflegte, bevor sich herausstellte, welche Drogen schädlich sind. Ich spreche von dem ganz normalen Vergnügen, sich ge meinsam eine Musikaufführung anzuhören. Ich glaube, meine Fähigkeit dazu endete in dem Moment, als hinter Hunderten von gierig in die Höhe gereckten Mobiltelefonen die Musiker fast verschwanden, so als könnte man diesen Augenblick in Besitz nehmen und festhalten, indem man ihn mit dem Handy fixiert. Was für ein seltsames Missverhältnis zwischen der totalen Hin gabe an den Akt des Aufnehmens und dem zwangsläufig damit verbundenen totalen Verlust an Energie für das Sein. So als wäre das Sein allein allzu gewöhnlich, unfruchtbar, zu wenig gewinn versprechend, geradezu verschwendet: aufnehmen, festhalten und aufbewahren muss man es, den Augenblick erwerben, und mir scheint, der grammatisch richtige Ausdruck dafür wäre wohl die Konstruktion ›gewesen haben‹, wenn diese auch nur ein Fünkchen Logik besäße. Was das alles mit der Erzählung zu tun hat? Nun, von diesem Konzert, das neunzig Prozent der Besu cher aufgenommen haben, wird niemand sprechen, niemand sich daran erinnern, niemand daran denken, denn jeder von ih nen wird es ›haben‹. Indem wir unsere Erinnerung an die Fest platten der Computer und Telefone abtreten, indem wir zwang haft jeden Augenblick fotografieren, als wollten wir ihn mit nach Hause nehmen und in einem ungewissen Später wieder hervor holen, machen wir uns nicht klar, wie ernsthaft wir dadurch un sere Fähigkeit zu sein, zu fühlen, zu denken und zu kommunizieren gefährden.
Bislang kommen wir noch einigermaßen zurecht, schreiben wir doch ständig SMS oder Mails, aber auch sie sind Mutationen und Verkürzungen ausgesetzt, verwandeln sich in Chiffren. Immer zu verführt uns das »Gefällt mir« auf Facebook zum Weiterkli cken und verlangen unsere Konten, unser Login. Ständig führen wir Gespräche, aber sie bewegen sich immer weniger in erzählerischen Dimensionen, es geht immer mehr um den Austausch tro ckener Daten, wer, wo und wann. Unsere Organe haben die Nei gung, bei mangelnder Benutzung zu schrumpfen. Schwer zu sa gen, wie lange es dauern wird, bis die für die Erzeugung und Auf nahme von Erzählungen verantwortlichen Hirnzentren ganz und gar abgestorben sind. Deshalb sollten wir die Fähigkeit zur Erzählung als grundlegende Ausdrucksform des mentalen Slow Food oder besser Slow Mind unter Schutz stellen und in die kulturelle Vorratskammer aufnehmen.
Dorota Masłowska 1983 im polnischen Wejherowo geboren, schrieb ihren Debütroman Schneeweiss und Russenrot im Alter von 18 Jahren. Er wurde in Polen als literarische Sensation gefeiert und mit dem renommierten Polityka-Preis sowie dem Nike-Preis ausgezeichnet. Zuletzt erschien von ihr auf Deutsch Die Reiherkönigin. Ein Rap übers. von Olaf Kühl. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2007. Masłowska hat in den letzten Jahren hauptsächlich Theaterstücke geschrieben. Ihr Stück Wir kommen gut klar mit uns wurde in der Schaubühne Berlin 2009 urauf geführt. Die Übersetzung aus dem Polnischen stammt von Olaf Kühl.


 Berghütte, Lagunillas, Cajón del Maipo, Chile, Dezember 2010
Berghütte, Lagunillas, Cajón del Maipo, Chile, Dezember 2010
alle mann in die rettungsboote!
Welthistorisch steht erstmalig nichts Geringeres als die Zukunftsfähigkeit unserer Zivilisation auf dem Spiel. Dennoch gelingt es uns nicht, vom Wissen um die Notwendigkeit einer ökologisch-kulturellen Revolution zum Handeln zu gelangen. Anlässlich des Festivals Über Lebenskunst vom 17. – 21. Au gust 2011 einem Initiativprojekt der Kulturstiftung des Bundes in Kooperation mit dem Haus der Kulturen der Welt erscheint als Teil des Projekts die Anthologie Über Lebenskunst . Initiative für Kultur und Nach haltigkeit , hrsg. von Susanne Stemmler und Katharina Narbutovicˇ, im Suhrkamp Verlag. Die Herausgeberinnen haben fünfzehn Autorinnen und Au toren aus Asien, Afrika, Europa, Australien und Ozeanien sowie den beiden Amerikas gebeten, die Zukunft aus einer kosmopolitischen Sicht zu entwerfen und damit die Lebenskunst nach Platon und Aristoteles für das 21. Jahrhundert zu aktualisieren. Mit Beiträgen u.a. von María Sonia Cristoff (Argentinien), Louis-Philippe Dalembert (Haiti), Sema Kaygusuz (Türkei), Michel Serres (Frankreich), Vladimir Sorokin (Russland), Ngugi wa Thiong’o (Kenia), Abdourahman Waberi (Dschibuti), Alexis Wright (Australien) und Liao Yiwu (China). Wir ver öffentlichen vorab den Beitrag von Michel Serres.
von michel serres
Unlängst habe ich in Paris ein Buch mit dem Titel Der Welt krieg veröffentlicht. Es handelt sich um eine Abhandlung über das Thema des Überlebens, betrachtet unter genau jenem Ge sichtspunkt, um den mich meine Berliner Freunde nun bitten.
wachsende gewalt
Das Buch beginnt mit einer Beschreibung der Dynamik, die der Gewalt eigen ist. Ganz gleich, ob man ihre Entfesselung auf öf fentlichen Plätzen, im Stadion oder in einer Kneipe unter ange trunkenen Matrosen, die in Streit geraten, beobachtet … jede Prügelei beginnt fast immer mit einer nichtigen Kleinigkeit, zieht mehr und mehr Kampfhähne an und gerät in Windeseile zu ei ner Angelegenheit, deren Verlauf niemand zu stoppen vermag. Doch wer hat diese Macht inne?
Im Stadion kann ein Piff des Schiedsrichters das Foulspiel been den, auf dem Marktplatz versucht die Polizei eine Händelei ohne Waffengewalt zu stoppen und in der Kneipe führen die vom Wirt gerufenen Beamten die Kampfhähne in Handschellen ab.
Was kann Gewalt stoppen? Die Antwort lautet: die legitime Ge walt, die ihrerseits Gewalt, allerdings eine rechtmäßige ist. Wes halb die Gewalt nicht mit dem Krieg verwechselt werden sollte. Der Krieg wird durch eine Erklärung eröffnet und durch einen Waffenstillstand sowie ein Friedensabkommen beides Rechts handlungen beendet.
geschichte
Seit Anbeginn stellt sich die Frage der stetigen Zunahme der Ge walt und ihrer unmöglichen oder möglichen Beendigung. Durch die Mehrzahl der Kulturen, die ich kenne die hinduistische, die hebräische, die ägyptische … , zieht sich eine konstante Geschichte, die der Sintflut. Sie ist die anschaulich gewordene Form menschlicher Gewalt. Die Flut steigt so sehr an, dass sie die Welt zerstört und die gesamte Menschheit auslöscht.
Die Bibel berichtet nicht nur über eine, sondern von zwei dieser großen Fluten. In letzterer tritt der Patriarch Noah auf, der sich vor der allumfassenden Zerstörung auf seine selbst gebaute Ar che rettet, mitsamt seinen Kindern und einem Paar von jeder Tierart. Die Urflut aber findet ohne eine solche Rettungsmög lichkeit statt. Bereits in den ersten Zeilen der Genesis steht ge schrieben, dass allein der Geist Gottes über den Wassern schwebt. Nichts hat offensichtlich diese Urflut, diese völlige Auslöschung überlebt. Es bedarf mindestens eines Allmächtigen, um die Welt und seine Bewohner neu zu erschaffen.
bericht von der auslöschung
In jüngerer Zeit erzählt Agatha Christie in ihrem berühmten Ro man Zehn kleine Negerlein eine ganz ähnliche Geschich te: Auf einer durch ein schweres Unwetter unzugänglich gewor denen Insel die ein Mikrokosmos, ein kleines Modell unserer Welt und unserer Gesellschaft ist finden sich für einen be stimmten Zeitraum zehn Leute versammelt. Als das Unwetter nachlässt und die Insel wieder betreten werden kann, stellen die ersten Zeugen fest, dass niemand überlebt hat. Alle haben sie sich gegenseitig umgebracht. Ebendieses Drama könnte oder muss jenen Zivilisationen widerfahren sein, von denen aus genau die sem Grund kaum Spuren überliefert sind. Wissen wir, warum unsere Vorfahren aus dem Neandertal ver schwunden sind?
die moderne
Die Gefahr, dass die Menschheit sich selbst auslöscht, ist so alt wie die Welt selbst und reicht bis zu den Ursprüngen der Men schen zurück. Seit Kurzem ist sie wieder präsent, und zwar auf zweierlei Weise. Seit wir die Massenvernichtungswaffen, die Atombomben, zunächst erfunden und dann auch eingesetzt ha
ben, seit dem Manhattan-Projekt also, seit Hiroshima und Na gasaki, leben wir mit der unbestimmten Angst, unsere Mensch heit könnte sich selbst auslöschen. Daher die hier ge stellte Frage nach unserem Überleben. Und seit wir uns der Gefahren bewusst geworden sind, die unsere industriellen Techniken, unsere Wirtschaft auf der Erde verbrei ten, leben wir mit der ähnlich diffusen Angst, dass es für die künftigen Generationen sehr schwer werden dürfte, auf dem Planeten zu überleben, den wir ihnen hinterlassen.
Wir haben es also mit zwei Hauptgefahren zu tun: Die erste ist kollektiv und unserer eigenen Gewalt unterworfen; die zweite ist an unsere gewaltvollen Eingriffe in die materielle Welt geknüpft.
der krieg
Ich habe eingangs behauptet, dass nur das Recht die Gewalt ein schränken könne. Der Krieg, so wie wir ihn aus der Geschichte kennen und wie er seit Jahrtausenden praktiziert wird, ist eine Einrichtung des Rechts. Städte, Staaten oder Nationen erklären ihn, offiziell, und er wird durch ebenso offizielle Unterschriften beendet, die das Ende der Kampfhandlungen besiegeln.
In seinem Buch Vom Kriege beschreibt Carl von Clausewitz, wie die Gewaltsamkeit der Schlachten bis ins Unermessliche wächst. Und in der Tat nahm die Zahl der Toten in den letzten Jahrhunderten beständig zu, selbst wenn man das weltweite Bevölkerungswachstum berücksichtigt. Trotzdem schränkt der Krieg als rechtliche Instanz jene unumschränkte Gewalt ein, die zur Auslöschung führt.
In jüngster Zeit jedoch erleben wir aus unterschiedlichen Gründen das Ende dieser Form von Krieg. Die wichtigste Ur sache ist, dass es keine Supermacht mehr gibt, die über den Lö wenanteil der schlagkräftigsten Waffen verfügt, und auch keine symmetrischen Konflikte, in denen sich ungefähr gleich starke Kräfte gegenüberstehen. Selbst wenn eine Macht heute mit un
gleich stärkeren Waffen ausgestattet ist, kann sie sich nicht mehr über kleine und schwache Nationen erheben. Bedeutet dies das Ende der Kriege? Zweifellos.
Nur ist dies keine gute Nachricht. Denn mit dem Ende dieser Art von Kriegen verschwindet auch der rechtliche Rahmen, der die stetige Zunahme unserer Gewalt beschränkte. Ohne das Recht aber, das sie im Zaum hält, beginnt die Gewaltsamkeit, die man auch als terroristisch bezeichnen könnte, wieder zuzunehmen. Die Angst vor Sintflut und Auslöschung kehrt zurück. Wie kann man sie stoppen? Wie kann man sich das Überleben vorstellen, inmitten der Gefahr?
an bord prügeln sich die matrosen
Kommen wir zu den sich prügelnden Matrosen zurück nun aber nicht mehr in einer Hafenkneipe, geschützt vor den Stür men auf hoher See, sondern an Bord ihres eigenen Schiffes. Weil die Mechaniker die einfachen Matrosen hassen, greifen sie diese an. Und weil die Heftigkeit des Kampfes sich hochschaukelt, oh ne dass sie beendet werden könnte, ist die Besatzung nahe daran, sich gegenseitig umzubringen.
Da ist sie wieder, die Geschichte von Agatha Christie, mit dem Unterschied, dass es sich nicht mehr um eine Insel handelt, son dern um ein Schiff, das dem Wellengang des Meeres und höherer Gewalt ausgesetzt ist, ohne dass sich auch nur ein Zipfel Land am Horizont zeigte. Da ist er wieder, der Mikrokosmos, das Sinnbild unseres Planeten ist. Nur dass an Bord des seiner Umgebung aus gelieferten Schiffs-Planeten kein Ufer, kein Ankerplatz, keine Zuflucht, kein geschützter Hafen in Sicht ist. An Bord tobt ein Kampf auf Leben und Tod. alarmstufe rot
Plötzlich ertönt über all dem Tumult der Verletzen und des von gegenseitigem Hass erfüllten Lärms ein Schrei. Die Matrosen hören, wie die Schiffswandung auseinanderbricht. Unmengen von Wasser ergießen sich über Deck, und das Meer strömt durch die offene Wandung herein, durchnässt die Maschinen und reißt einen Teil der Kämpfenden mit sich. Auf den Schock, den alle trotz ihrer Raserei verspürt haben, folgt ein Alarmsignal, das al len vertraut ist, auch wenn sie es nie gehört haben. Auf das krachende Bersten des Schiffs folgt der allgemeine Auf schrei: alle mann in die rettungsboote! Das Schiff geht gleich unter.
Wie reagieren nun die Kampfhähne beider Lager? Man kann darauf wetten, dass sie sofort mit der Händelei aufhören und zum einströmenden Wasser stürzen, um die klaffenden Löcher zu stopfen. Dass sie, wenn auch widerstrebend, ihre Kräfte verei nen, um die Gefahr, der sie alle ins Auge blicken, die große Be drohung, den sicheren Tod abzuwenden. Ende der Gewalt? Ja. Frieden? Ja.
Das ist die beste Nachricht.
der weltkrieg
Das Buch, das mit obigem Aufschrei endet, habe ich Der Weltkrieg genannt. Gemeinhin bezieht sich dieser Begriff auf zwei große Kriege dieses schrecklichen 20. Jahrhunderts, in welchem die angeblich klügsten und kultiviertesten Nationen grausame Verbrechen begingen, die mehr als hundert Millionen Tote zur Folge hatten.
Mein Buch aber schreibt diesem Begriff einen gänzlich anderen Sinn zu: der Krieg, der uns in Opposition zur Welt bringt. Es geht nicht mehr um den oder die Konflikte zwischen Menschen, sondern um den Kampf, der gegen die Welt geführt wird. Nicht mehr dieses grausame Spiel zu zweit, das man früher als Krieg bezeichnete, sondern ein neues zu dritt, bei dem sich mitten in unseren unverbesserlichen Kampfhandlungen ein unvorhergesehener Mitspieler hinzugesellt: der Planet selbst.
Wir befinden uns auf offener See. Allein im weiten Raum hat unser Schiff keinen Hafen oder Kai zum Ankern mehr. Ebenso wenig harmonierend wie die Mechaniker und die einfachen Ma trosen, liefert sich die Besatzung dieses Schiffes Griechen und Perser, Römer und Gallier, Mongolen, Chinesen und Europäer, Engländer, Inder und Aborigines, Deutsche und Franzosen … permanent tödliche Schlachten. Aus welchem Grund, das ver mag ich nicht zu sagen, meistens einfach so, aus Kinderei oder aus rohem Machtstreben. Sie kümmern sich nicht um die Schä den, die sie ihrem Boot zufügen, dem Dritten im Spiel. Diese aber sind so gravierend, dass sie das Schiff in Gefahr bringen und somit auch die gesamte Besatzung, ohne jeden Unterschied. Angesichts des hereinströmenden Wassers finden sich alle Ma trosen im gleichen Lager wieder.
die zweite bedeutung des weltkriegs folgt also auf die erste.
Die nun aufziehende Bedrohung bringt die komplette Besatzung in Lebensgefahr und ist mit den Gefahren der vorangegangenen Kriege, die allesamt lokale und partielle waren und wie bei Noah nach der Sintflut einen Hoffnungsschimmer ließen, nicht zu vergleichen. Über unserem Horizont erhebt sich wie eine schwar ze Sonne die Auslöschung der Menschheit. Es wird weder Sieger noch Besiegte geben die ganze Welt wird ins Verderben stür zen. Keine Arche mehr, kein Noah. Die ganze Welt wird ihren Lebensraum und das Leben verlieren, ganz so wie in den ersten Tagen der Genesis, als Sein Geist über den Wassern schwebte. Der Weltkrieg in dem von mir skizzierten Sinn gewinnt plötz lich über den Weltkrieg im landläufigen Sinn die Oberhand.
die gute nachricht
Diese tragische Perspektive ist zweifellos das Beste, was wir un seren Kindern erzählen können. Aber ich irre, die Kinder sind unsere Vorfahren und wir selbst. Wir hatten unser grausames Vergnügen daran, uns erbarmungslos zu prügeln, allein mit der Ab sicht, brutale Überlegenheit zu zeigen. Und wir hatten einen ebensolchen Spaß daran, einen dummen Krieg gegen die Welt zu führen, ohne jegliche Umsicht.
Neue Weisheit. Wenn wir nicht umgehend diesen Abschnitt der ebenso tödlichen wie törichten Geschichte beenden, laufen wir Gefahr, uns selbst auszulöschen. Kein fragiles, auf einem Vertrag beruhendes Recht wird uns mehr Einhalt gebieten, sondern nur der letzte Aufschrei vor dem Untergang: alle mann in die rettungsboote!
Dies ist der beste Appell, den man sich denken kann. Ich hätte beinahe gesagt, der schönste der Geschichte!
Zwei Ergebnisse wird er zeitigen. Erstens: den Frieden. Vielleicht sogar den ewigen, denn wir müs sen für lange Zeit aufhören, einander zu bekämpfen, und langwierige Allianzen schmieden, um unser aller Schiff auszubessern. Zweitens: eine neue Geschichte, die es uns ermöglicht, andere Techniken, eine andere Wirtschaftsweise, ein anderes Recht, ei ne andere Politik zu ersinnen, die ihrerseits wiederum einen Frie densvertrag mit der Welt schließen, einen Naturvertrag. Zwei Elemente des Überlebens.
Michel Serres , geboren 1930 in Agen, ist ein französischer Wissen schaftsphilosoph und Mitglied der Académie Française. Zentral in seinem Werk ist die Idee eines neuen Vertrages des Menschen mit der Natur. Zuletzt er schien von ihm auf Deutsch Das eigen tliche Übel . Berlin: Merve Ver lag, 2009. Die Übersetzung aus dem Französischen stammt von Susanne Stemmler.










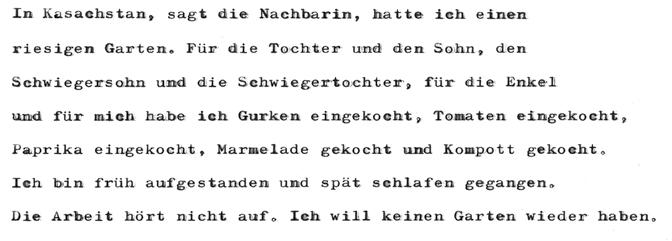
die erste erde
Die Kulturstiftung des Bundes fördert ein mehrjähriges Projekt des Schriftstel lers Raoul Schrott. Sein Ziel ist es, alle für die Welt- und Menschheitsgeschichte bedeutsamen Stationen aufzusuchen und Fundstellen oder Grabungsorte, aus denen wir unser Wissen schöpfen, erzählerisch einzukreisen. Die auf den Rei sen gemachten Erfahrungen und Entdeckungen sind die Grundlage für sein über drei Bücher geplantes Epos Die Erste Erde :
Ich interessiere mich seit zwei Jahrzehnten für die unterschiedlichs ten natur- und humanwissenschaftlichen Disziplinen, aus einer, wie soll ich sagen, existenziellen Neugierde heraus: vor meinem Tod möchte ich gerne verstehen, was diese Welt um mich so hat werden lassen, wie sie ist. Da ich kein gläubiger Mensch bin, bleiben mir nur die Fakten, die die Wissenschaften herausgearbeitet haben. Einen Bezug dazu zu entwickeln gelingt mir zumindest erst, wenn ich sie auch mit Reellem verbinden kann: daher das Bedürfnis, an all jene Orte reisen zu wollen, die zu den weithin unbekannten Stationen einer modernen Genesis geworden sind. Selbst dann aber werden diese Eindrücke und Erfahrungen erst fassbar, wenn sie sich auch zur Sprache bringen, poetisch formen und schließlich erzäh len lassen.
Statt einer Pilgerfahrt zum Berg Sinai war es so eine Reise mit dem Kanu, den Flüssen am kanadischen Polarkreis entlang, um zu den ältesten identifizierten Gesteinen zu gelangen den Resten jenes Kontinents, der sich erstaunlicherweise bereits kurz nach der Entste
von raoul schrott
hung unseres Planeten bildete. Halb verhungert, weil das Kanu in einer Stromschnelle gekentert und unsere gesamte Ausrüstung da von getrieben war, von Mücken zerstochen, war meinen zwei Be gleitern und mir nur das Erzählen geblieben, um das Hungergefühl zu vertreiben: wir redeten über unser Ziel, davon, was die Geologen über den Anfang der Erde an diesem Ort berichteten. Diese Frag mente dieser ersten Erde dann schließlich in der Hand zu halten und das Gewicht eines schweren, grauen und 4 ,2 Milliarden Jahre alten Gneisbrockens zu spüren, machte allen Ursprung plötzlich fühlbar: dieses Stück Fels wurde so auratisch wie jede Reliquie. Statt der biblischen Geschichte von der Erschaffung der Welt in sieben Tagen wurde so eine andere Schöpfungsgeschichte mit Fingern greifbar; und jede herkömmliche Vorstellung von Transzendenz durch die ebenso unermesslichen Zeiträume der Geologie ersetzbar. Damit stellte sich die Ahnung des unvordenklich und urzeitlich Anderen mitten im Hier und Jetzt ein um sich mit der Reise durch eine der Peripherien unserer Zivilisation zu verbinden.
Spät in der Nacht mit dem Auto von Saarbrücken nach Mainz, morgens mit den Taxi zum Bahnhof und weiter zum Flughafen; in Calgary unter Plakaten, die vor Nilfieber warnen, durch die Zoll- und Passkontrollen, um die Maschine nach Edmonton zu erwischen und in einem Hotelzimmer zu landen, von dem der Rezeptionist behauptet, Leonard Cohen habe hier seine Sis ters of Mercy geschrieben. Dann viel zu früh wieder mit einem Bus zur nächsten Maschine hinauf in die kanadischen North Western Territories, wo die Stewardess eine Lokalzeitung verteilt, aus der die Annonce eines B & B heraussticht, dessen Adresse Norbert und ich schließlich mittags in Yellowknife dem Taxifahrer nennen, worauf dieser murmelt, es sei geschlossen, weil es einem deportierten deutschen Terroristen gehöre, der ge rade im Flugzeug nach Deutschland sitze: es ist, als wechselte mit den Zeitzonen auch der Zusammenhang und geriete man von einer Geschichte in die andere, rast- und ortlos, die Reise ohne einen Anfang, die Ankunft noch kein Ende.
Zwei Stunden später saßen wir im Büro der Air Tindi und beka men samt Preis des Kanus und der Campingausrüstung den Treibstoffverbrauch des Wasserflugzeugs vorgerechnet, das uns am nächsten Tag gegen acht Uhr abends 350 km weiter nördlich
absetzen sollte. Wouter Bleeker, der kanadische Geologe, mit dem ich E-Mails austauschte, hatte Wort gehalten und uns die Zielkoordinaten gefaxt, vom bestellten Führer dagegen fehlte je de Nachricht. An seiner Stelle kam, während wir warteten und auf die Wandkarte starrten, auf der Flugdistanzen mit einer ro ten Schnur abgemessen wurden, ein Inuit an die Tür, Baseball kappe, riesige Brillen, Schnauzbart wie ein Walross, die oberen Zähne fast alle ausgefallen, dafür ein Grinsen breit im Gesicht. Er wollte bloß eine Tasse Kaffee, legte aber schließlich seine Par ka ab und sah sich mit uns die Route an: Nein, dort wäre er noch nie gewesen, die Gegend kenne er trotzdem gut, ja, er hätte vielleicht Lust, unter Umständen auch Zeit, er heiße Ben. Wer wir seien? Ein Arzt und ein Schriftsteller? Hm…
Das Gefühl, irgendwo angekommen zu sein, stellte sich erst mit den ersten Schritten zu Fuß ein, die Sonne über dem bis zum Horizont reichenden Great Slave Lake, Yellowknife eine Silhouette aus drei Hochhäusern, die sich als Fassaden eines von Goldund Diamantminengesellschaften errichteten potemkinschen Dorfes erwiesen: einer Wintersiedlung mit Plattenbauten zwi schen Holzhäusern und mit Wellblech gedeckten Tonnendä chern inmitten eines Sommers von Felsen, Birken und Wasser,
das Zentrum so wenig belebt, dass die Kinder auf dem Asphalt Murmeln spielten. Seinen Namen verdankte der Ort Pelzhänd lern, die hier im vorletzten Jahrhundert auf Indianer mit kupfer nen Messern getroffen waren, und er hatte sich mit seinen Aus rüstern, Lebensmittelläden und einem gut sortierten Kartenge schäft das Provisorische eines Außenpostens bewahrt.
Auf den in Europa erhältlichen Karten war der Fluss, den wir hinunterpaddeln wollten, nicht eingetragen gewesen; die zwi schen großen Binnenseen und dem Eismeer abgebildete Land schaft glich einem Fehldruck, relieflos grau und von einer Moiré aus hellem Blau überzogen. Ihre Legenden Coppermine River , Prosperous und Trapper Lake erinnerten an Prospektionszeiten, sie führten das Territorium mit Bezeich nungen wie Redrock Lake , Scented Grass Hills oder Whitewolf bloß generisch vor Augen, um es durch Na men wie Mystery , Desperation und Bliss Lake desto ungreifbarer werden zu lassen. Jetzt aber, die eben erstandenen schwarz-weißen 50 000er und die geologischen Überblickskar ten in unserem B & B ausgebreitet, malten wir uns diese abstrak ten Flächen von Orange, Rot und Braun als Gegend aus, mach ten an den Zahlen Meereshöhen und Gefälle aus, je nach Symbol

einen Sumpf, Wälder und Stromschnellen, um zu bestimmen, wie weit der Lauf befahrbar war, wo uns das Flugzeug absetzen und wo nach einer Woche wieder abholen könnte. Erst da, auf dem Tisch, konnten wir zum ersten Mal den schwarzen Schrift zug des Acasta River sehen, die Unterlängen zu seinem Ursprung verfolgen und wieder zurück, über Senken und Seenketten bis dorthin, wo sich die Koordinaten zu jener Insel schnitten, die unser Ziel war.
Seit Jahren hatte ich Artikel über die ältesten Gesteinsformationen der Erde gesammelt. Mein Interesse an der Geologie hatte auch mit dem Reisen zu tun: fremder Menschen und Land schaften wegen unternommen, ist es nur die Auseinanderset zung mit beiden, wodurch sie mehr werden als bloße Kulisse. Ei nen Berg zu besteigen, Eis-, Sand- oder Wasserwüsten zu durch queren, weil sie da sind, wie Hillary meinte, mag Grund genug sein; doch ohne Wissen dessen, was sie geformt und hat entste hen lassen, bleibt es ein ignorantes Unterfangen und man selbst blind: sie zu überqueren heißt auch, mit jedem Schritt auch Zeiträume durchmessen, eine Erdgeschichte vor Augen, in der ein Hier immer nur vorläufig ist. Vielleicht ist deshalb jede Reise auch vom Verlangen getragen, schließlich an einen Ort zu gelan gen, der weil er stets auf der abgewandten Hälfte der Welt liegt auch außerhalb von Raum und Zeit zu sein scheint: eine Uto pie, gewiss, doch eine solche haben die paradiesischen Vorstel lungen eines El Dorado oder Shangri La noch in jedem Jahrhun dert verheißen. Geht man diesen Mythen dann jedoch nach, er kennt man, dass jede Sehnsucht letztlich darauf gerichtet ist, sich dem Fremden gegenüber des Eigenen zu versichern, um einen gemeinsamen Ursprung zu entdecken, einen begreifbaren An fang: der eine Punkt, auf den sich alles zurückführen ließe, auch das eigene Leben. Und es wird daraus eine Suche nach dem, was davon überdauert haben mag: nach der ersten Erde Von ihr also hatte ich gelesen, ihren Datierungen und Orten: von Isua nord östlich von Nuuk, am Rande des grönländischen Eisschildes, wo sich das erste Sediment verwitterter Gebirge findet, 3 ,8 Milliar den Jahre alt; vom Acasta-Gneis im präkambrischen Schild Ka nadas; und den auf 4 ,3 Milliarden Jahre datierten Zirkonen der Narryer Berge Westaustraliens. Während diese Kristalle jedoch nur Zeugnisse einer längst verschwundenen Erdkruste sind, ein gelagert in weit jüngerem Trägergestein und bloß noch unter einem Mikroskop sichtbar, ist der Gneis am Acasta als Ganzes erhalten geblieben. Ein Stück davon einmal in Händen zu hal ten, seine Schwere zu spüren, schien mir so, als könnte man et was berühren, das unverändert geblieben ist, real im Irrealen der Zeit: den ältesten Stein.
Die Nacht ist kurz; vor soviel Licht, der Luft, die einem zu Kopf steigt, der seltsamen Härte über dem See, der nur ein Ufer zu ha ben scheint, und dem Schlaflosen der letzten Tage bleibt ein Druck hinter der Stirn, der kurzatmig macht, als befänden wir uns auf 4 000 Metern Höhe. Wir machen die letzten Besorgungen, packen die Ausrüstung zusammen und hinterlassen im B & B die Nachricht, wann wir zurück sein werden. Während die Me chaniker die Twin Otter beladen und das Kanu am Schwimmer festzurren, gehen wir mit dem Piloten die Route durch: er soll uns 20 km nördlich unserer Insel absetzen und später am Little Crapaud Lake weiter südlich abholen.
Von oben erscheint das von langen Gräben zerscherte und von Gletschern flachgeschliffene Schild als langsam abtauchender Kontinent: die nackten Felsbuckel wie Walrücken zwischen ineinander übergehenden, stehenden Gewässern, das Grün der Taiga mit ihren Baumgruppen schorfig dazwischen. Kaum ein Fluss lauf ist auszumachen, auch keine Schotterpisten oder Dächer, einmal nur die Landepisten einer aufgegebenen Mine, überall aber in der Sonne aufglänzendes Schmelzwasser, auf dem an manchen Stellen noch eine Eishaut liegt. Je weiter wir dabei in Richtung Polarkreis fliegen, desto dichter werden jedoch die Rauchflächen, über Hunderte Kilometer hergeweht von brennenden Wäldern an der Grenze zu Alaska. Ich vergleiche die Karte mit dem Land und dieses wiederum mit ihr, um den Überblick zu behalten, und als nach mehr als einer Stunde der Little Cra paud Lake vor uns auszumachen ist, packt mich eine seltsame Erregung: das ist der Acasta jetzt, wo er einfließt, dort beginnt unsere Strecke. Der Pilot schwenkt ab, unter uns bleibt das schwarzblaue Band mit seinen Schlingen und Schleifen, das sich an einer Stelle durch einen weiten Sumpf zieht, die weiß geripp ten Stromschnellen sehen breit aus, ich sehe die Insel plötzlich mitten im See und deute hinunter, da ist etwas, das metallisch aufgleißt, daneben ein Rot wie von Zelten. Wir gehen nach und nach tiefer, landen, ohne das Aufsetzen zu spüren, und laufen auf die Koniferen einer Strandlinie zu, während sich ein Weiß
kopfseeadler aufschwingt. Er wäre schon einmal hier gewesen, er hätte Archäologen abgesetzt, sagt der Pilot.
Halte ich den Zeiger auf meinem 24 h-Ziffernblatt zur Sonne, kann ich zu jeder Stunde ablesen, wo die Himmelsrichtungen liegen. Es ist Mitternacht jetzt, ihre Scheibe in diesem Mittsom mer knapp über dem Horizont, rot vor Rauch, und bevor wir noch ausgeladen haben, stehen wir schon in Schwärmen von Mücken. Unterhalb unserer Schuttmoräne zieht sich der Sand streifen zu einer schmalen Furt hin, voll Fährten: Wölfe, Karibus, Elche und ein Bär, behauptet Ben. Was für einer? Grizzly; vor denen aber braucht man keine Angst zu haben wenn sie sehen, dass wir zu dritt sind, weichen sie aus. Aggressiv werden eher einzelne Schwarz bären: kommt einer, schaut ihm nicht in die Augen und legt euch lang sam auf den Bauch, die Hände über dem Nacken. Falls mir aber etwas zustoßen sollte, ist‘s besser, ihr wisst, wie das Gewehr funktioniert. Er holt eine Pumpgun aus den Bündeln am Strand und erklärt uns den Mechanismus. Sechs Patronen habt ihr, die letzte müsst ihr euch aufsparen, bis er auf fünf Schritte heran ist, dann reißt sie ihm ein kopf großes Loch in den Pelz. Er lässt Norbert und mich am Baum vor uns üben, bis zum trockenen Klick des Schlagbolzens, lädt dann aber durch. Wir halten auf den See; in der vollkommenen Stille ist der Schuss so laut, als geriete die Welt aus den Fugen. Und als hätte die Zeit endlich innegehalten, sich verlangsamt auf ein menschlicheres Maß.
Wir sind müde genug, um bei dieser Taghelle zu schlafen. Ein paar Stunden danach weckt uns das Klappern des Kochgeschirrs. Norbert nimmt sich die Rute, wirft sie an der Furt aus und kur belt; erst scheint es, als wäre bloß der Blinker hängen geblieben, aber es hängt eine armlange Forelle dran. Er nimmt sie ab, wirft nochmals aus und hat eine zweite am Haken, die er aus dem torf braunen Wasser holt, und beim nächsten Mal auch. Wir grinsen breit übers Gesicht, er ist noch nie angeln gewesen, und jetzt gleich diese Fischergeschichte, die ihm niemand zuhause abneh men wird. Während Ben sie brät, spazieren wir durch das Busch werk in eine Senke dahinter. Von den Ausgrabungen, von denen der Pilot erzählt hat, ist nichts zu erkennen; erst später werde ich lesen, dass man dort auf die ältesten Zeugnisse der amerikanischen Urbevölkerung gestoßen ist, die über die Beringstraße ein wanderte, auf Kohlenreste von Lagerfeuern und Pfeilspitzen.
Wir beladen das Kanu, stoßen ab und arbeiten uns zunächst am Ufer entlang; wir liegen tief im Wasser, haben kaum mehr als ei ne Handbreite Freibord, und es dauert, bis wir einen Rhythmus finden und halbwegs Kurs halten. Schwarzfichten ragen verein zelt zwischen den Felsen auf, ein Geäst dürrer junger Zweige, die der Winter erfriert; an ihrer Grenze geht die Taiga in Tundra über, in ein Unterholz von Weiden, Moos und Sumpf. Auf einer Insel halten wir Rast; gelbe Rentierflechten auf den Gesteinsbrocken, Zwergsträucher, dazwischen kleine weiße Blüten. Vielleicht hat der Fluss seinen Namen von ihnen, der Akaste, jener Tochter des Ozeans, die Apollo nach ihrem Tod in eine Blume verwandelte: Akanthen sind es dennoch keine, sondern Silberwurz.
Die Sonne sticht, es riecht nach Ozon, das Plastik der Schwimm westen wird heiß; der Wind mitten im See dörrt einen aus, wir trinken immer öfter aus der hohlen Hand, und das Wasser schmeckt süß, ohne dass der Mund dadurch weniger trocken würde. Für die erste Stromschnelle bleiben Ben im Boot und Norbert, dem die Vorstellung einer Wildwasserfahrt nie geheuer gewesen war; doch der See, kaum irgendwo tiefer als zwei Meter, fließt flach in den nächsten über, so dass beide das Kanu über Geröll schieben, ziehen und staken. Ich gehe inzwischen über den Hügelrücken und stoße im Gras auf kreisrunde Rinnen, ne ben ausgebleichten und überall verstreuten Elchschaufeln; es müssen die Reste eines Zeltlagers sein, doch vor wie vielen Som mern, ist nicht zu sagen. Wir kommen gut voran.
Die nächste Stromschnelle ist nicht auf der Karte verzeichnet, ihr Rauschen aber von Weitem zu hören. Wir gehen sie ab; der Fluss beschreibt hier ein S und wird eng, weiße Wellen über den Wacken bis zu einem Felsklotz, der ihn zweiteilt. Dieses Mal knie ich vorne. Was vom Ufer harmlos aussah, wird im Kanu zu einem Gefälle, in dem es sich kaum steuern lässt. Paddel härter, verdammt! schreit Ben von hinten. Ich steche mit aller Kraft in das Spritzwasser ein und stoße uns vorn von den größten Hin dernissen ab, während er gegenrudert. Alles wird schneller, ich kann kaum mithalten, und in der zweiten Biegung laufen wir im Wildwasser an den Fels, bekommen Schieflage, mein Fehler, dass ich mich instinktiv am Bordrand halte, sie vergrößert sich dadurch, von der Seite strömt alles ein, breit und kalt, der erste Packen schwimmt davon, der Bug ist voll Wasser, ich steige aus,
auf den Fels, und will das Kanu daran hochziehen. Lass los! brüllt Benn, und ich gebe ihm einen Stoß, stehe nur und schaue, wie er zur Mündung hinuntertreibt, das Kanu bereits unter der Ober fläche, er hilflos darin, bis zum Hals in Wasser, rechts und links unser Gepäck, das abtreibt, fast hat die Szene etwas Komisches, bis alles aus dem Blick gerät. Rechts komme ich nicht ans Ufer, ich finde zu wenig Halt, um mich gegen den Fluss zu stemmen, auf der anderen Seite steht er mir hart bis zur Brust, ich weiß erst nicht, wo hochklettern, und muss dann lange Minuten ei nen Bogen um das Gestrüpp schlagen, um an ein Ende zu gelangen.
Norbert steht drüben, er deutet irgendwohin, aber ich sehe weder Ben noch das Kanu, nur unsere Ballen sich mit der Strömung verfächernd, von ihr hinaus in die Seemitte geschwemmt. Ich wate zu ihm hinüber; Ben hat das Kanu zwischen zwei Bäumen hochgezogen und umgedreht, wir sind nass bis auf die Knochen und setzen uns erst einmal, um zu Atem zu kommen. Ph! bläst Ben die Backen auf, ich hab geglaubt, mein letztes Stündlein hat ge schlagen; ich kann nicht schwimmen… holt sich aus der Brusttasche seine Packung Zigaretten, aber die sind ebenfalls feucht. Norbert macht nicht die geringste gereizte Bemerkung, dafür bin ich ihm dankbar; steht auf, sagt er bloß, wir müssen nach unserem Gepäck sehen. Am Ufer ist nichts zu entdecken. Zwei Paddel haben wir noch, ich halte mich längsseits und tauche den Grund in diesem braunen Wasser ab, ohne etwas zu sehen, bis ich vor Kälte zu zit tern beginne und nur zufällig mit dem Fuß an Norberts Ruck sack stoße. Wir breiten das Zeug darin zum Trocknen aus: ein Schlafsack, ein Regenschutz, Pullover, Hose, Necessaire. Sonst haben wir nur mehr, was wir am Leib tragen, ich ein All-Weather Field Book, Bleistift und Sackmesser; Ben sein Feuerzeug. Alles Essen, Kochzeug und Gewehr, Kamera, die Zelte, selbst die An gelrute ging verloren, das GPS und auch meine Uhr. Schlimmer ist, dass es keinen Mückenspray mehr gibt; so durchnässt und er schöpft wie wir sind, merken wir nun erst, wie sie uns zusetzen und durch die klammen Kleider stechen. Wir kriegen ein Feuer an und setzen uns eine Zeitlang in den Rauch: entweder Husten oder Kratzen.
Lange halten wir weder das eine noch das andere aus. In dem, was sonst Nacht wäre, paddeln wir wieder los, weil es am Wasser er träglicher ist, suchen erneut alles nach unseren Packen ab, finden jedoch einzig den Sack mit dem Nylonseil für die Portagen und darin wiederum eine von Bens Angelschnüren. Doch dass wir die Karten verloren haben, ist noch schlimmer. Um weiter nach Süden zu gelangen, bleibt uns so einzig, jede Bucht auszufahren, auf der Suche nach dem nächsten Übergang. Wir wechseln uns an den Paddeln ab; Ben fabriziert aus einem bunten Stück Plastik und der Sicherheitsnadel des Nähbriefchens, das Norbert vom Hotel in Edmonton mitgenommen hat, einen Blinker. Der nächsten Stromschnelle entlang tragen wir das Kanu am Rücken, nur um zu merken, dass es von diesem See aus nicht weitergeht, und wieder umzukehren: so wird es uns noch öfter gehen.
Der Wind steht gegen uns, von Südwest oder West, und schmeckt nach Rauch. Ben redet mit den Fischen: Come fishy, fishy! I can taste you, fishy, fishy…You got to be crazy about my hook; come fishy, fishy! Wir fangen nichts; die Wellen laufen quer zum Bug, bis sich einer der Seen verjüngt und zum Flusslauf wird. Wir steigen auf einen Hügel, die höchste Erhebung weit und breit, und schauen: das ist der Mäander des Flusses im Braun und Grün der Marsch, durchbrochen von den Pinselstrichen der Schwarzfichten, eine aus der Entfernung beinah bukolische Landschaft. Später ein versetzt in der Strömung treibendes Schwanenpärchen; jedesmal wenn wir dem Männchen zu nahe kommen, gibt es einen Warn ruf ab und flattert ungelenk mit seinen übermäßig großen Flos sen und Flügeln auf, um beim Weibchen mit einem Rauschen niederzugehen, wieder und wieder von uns gestört, das Bild einer in dieser Wildnis unmöglichen Schönheit. In der nächsten Fluss biegung plötzlich eine Wolke winziger Fliegen, die auf uns nie dergeht, dass ich meinem Vordermann mit der Hand über die Schwimmweste fahre und die Bewegung einen weißen Streifen in ihrem Schwarz hinterlässt.
Abends liegen wir vor dem Feuer, das wir mit den harzig aufflam menden Polstern der Schwarzbeeren füttern. Wir bereiten uns ein Lager aus Weidenzweigen und flechten sie zu einer Barriere, hinter der sich der Rauch sammelt und uns so vor den Mücken bewahrt; der Mond ist aufgegangen und steht ein paar Handbreit neben der Sonne. Ich habe euch eigentlich für typische Cityslickers ge halten, sagt Ben trocken, aber… Nur, was interessieren euch die Steine denn ? Sie sind der Anfang von allem, will ich ansetzen und gerate ins Stocken. Neun Milliarden Jahre lang war da, wo wir jetzt lie



gen, Leere. Es gab zwar Sterne, an Materie jedoch war noch nicht mehr vorhanden als die Rußpartikel, die wir hier den ganzen Tag über riechen. Bis dieser Nebel sich zu verdichten begann, vor vier einhalb Milliarden Jahren. Hätten wir noch eine Orange, sage ich des Beispiels halber, wäre sie die Sonne, die daraus entstand, und die Erde nicht größer als ein Sandkorn in zehn Schritt Ent fernung, nein: der eine Funken gerade, dort unten beim Kanu. Mann, du klingst wie die vom Discovery Channel , meint Ben; ich war schon mit Typen vom MIT im Eis, und die waren auf der Suche nach Meteoriten, die so alt sind wie das Sonnensystem, älter also noch als eure Steine morgen. Aber das ist nur Schlacke, werfe ich ein. Als ob Stei ne was anderes wären Ja bloß dass es diese zehn Schritte sind, die sie zur Erde machen: allein in dieser Entfernung bleibt Was ser, ohne das es kein Leben gäbe, auch flüssig. Fische gibt‘s deswe gen aber noch lang keine, entgegnet Ben und lacht; aber red‘ nur wei ter. Ich zähle an den Bedingungen des Lebens auf, was ich noch weiß. Wäre es nicht, noch bevor die Erde eine Kruste hatte, zur Kollision mit einem Planetoiden namens Theia gekommen, die den Mond entstehen ließ, gäbe es weder Tag und Nacht, nur Mo nate von Licht und Dunkel. Erst dieser Einschlag beschleunigte die Erdrotation so weit, dass die Temperaturen keine extremen Ausmaße erreichten. Der dadurch aus dem Lot geratenen Erd achse verdanken wir auch die Jahreszeiten. Durch den Zusam menprall wuchs zudem die Erdmasse, sodass das Magnetfeld stark genug wurde, um die Sonnenwinde abzulenken, die sonst die Ozonschicht aufgelöst und alles Leben im Keim zerstört hät ten. Hätten, hätten, hätten, wirft Ben ein; das denk‘ ich mir auch, jedesmal, wenn ich hier an den Steinen rumklopfe, weil ich vielleicht eine Goldader finde. Wir starren ins Feuer. Und du, wendet Ben sich an Norbert, glaubst du an Gott ? Norbert zuckt mit den Schultern und erwidert schließlich: ob Steine oder Gott, es kommt aufs Gleiche raus; aber was ist mit dir, bist du gläubig? Ben hat nur auf diese Frage gewartet und sieht ihn spöttisch aus den Augenwinkeln an: im Augenblick glaube ich lieber an eure nicht existierende Orange. Viel leicht haben wir morgen Glück und treffen auf eure Geologen, dass die uns etwas abgeben…
Wir waschen uns und sehen, dass wir am ganzen Körper zersto chen sind, münzgroße Blutergüsse selbst noch an den Fußsoh len. Steif vor Muskelkater paddeln wir, am Hang ein wandernder heller Fleck, ein weißer Wolf, der uns begleitet, den Fluss entlang und zum nächsten See. Eine der hereinragenden Landzungen erweist sich endlich als die Spitze jener namenlosen Insel, die wir gesucht haben. Was vom Flugzeug aus metallisch geglänzt hat, ist eine kreisrunde Nissenhütte an einer Bucht, die an einem Hü gelbuckel ausläuft. Die Tür ist mit Eisenstäben verbarrikadiert, aber nicht verschlossen; über dem Eingang hängt eine Sperr holzplatte, auf die Wouter Bleeker in großen Lettern ACASTA CITY HALL FOUNDED 4 GA geschrieben hat. Drinnen fin den wir Schaumgummimatratzen, Sessel, Tische, alles, was man nur brauchen kann, um hier den Sommer zu verbringen, sogar einen Grill, dutzende Dosen Mückenspray, gottseidank, aber nichts zu essen, keine Angel, keine Dose, keinen einzigen Keks, vielleicht der Bären wegen. Von den Geologen keine Spur, und was in der Luft nach Zelten aussah, sind leere Kerosinfässer; wir sind allein. Ein Pfad führt den Hügel entlang, wo die Felsflächen mit der Drahtbürste solange von Flechten gesäubert wurden, bis sich die Schichtung darunter zeigt, und weiter durch verkrüppel te Fichten zu einer nackt abfallenden Klippe. Wir klettern im Geröll hinunter zur Wasserlinie und entdecken Bohrlöcher, Lun ten und Sprengkapseln: es ist der Felsbruch, dessen Gestein auf 4 ,03 Milliarden datiert wurde. Die scharfkantigen rauen Splitter und die Brocken, die sich nur zu zweit aufheben lassen, sind grau wie eine mit grobem Bleistift schraffierte Seite, von weißen Ein sprengseln durchzogen, manchmal auch schmalen roten Adern und einem Strich tiefschwarzer Kristalle, die unter den Fingern brechen. Der Gneis selbst wirkt so unscheinbar, dass wir kaum einen zweiten Blick darauf geworfen hätten; Bedeutung verleiht ihm einzig, was wir wissen; begreifbar an ihm werden nur Theo rien einer ersten Erde. Dennoch will ich aus dem Stein, den ich jetzt beim Schreiben auf dem Tisch hier in der Hand halte, un willkürlich mit dem Daumennagel etwas herauskratzen, ich kralle fast die Hand um ihn, dass wenigstens der Druck ihn in seiner Wirklichkeit bekräftigt.
Der Hunger gräbt tiefer. Wir paddeln das stehende Gewässer auf der Suche nach einem bisschen Strömung ab, wo sich vielleicht Fische halten, und fangen schließlich einen Weißfisch, den wir nur mit größter Sorgfalt ins Kanu bringen, weil er sich nur allzu leicht vom zurechtgebogenen Haken lösen kann. Auf dem Rück weg zur Insel halten wir an einem vorgelagerten Felsrücken, auch er der ganzen Länge nach von den Geologen geputzt, Stück um Stück freigelegt und mit nummerierten Steinchen versehen, von
kulturstiftung des bundes magazin 1726
denen nicht zu sagen ist, was sie bedeuten; aber was zu Tage liegt, sind unzählige Striche, eine Partitur der Erde mit ihren von der Zeit gezogenen Linien, die leer bleiben, bis das Fiepen eines Strandläufers Noten darauf setzt, c, f und g, die im Blau des Himmels nachhallen.
Vor der Hütte spiele ich mit einem der Brocken und versuche, mir diese erste Erde vorzustellen, die weißglühende Fläche, die der See einmal war zähflüssiges Magma, das unter dem an fänglichen Kometeneinschlag und radioaktiven Strahlungen nur langsam aushärtete, brodelnd Wasser dabei ausscheidend, ohne das kein Gestein entstehen kann, Wasser, das in die glasig erstarrten Klüfte des Basalts dringt, ihn in sich zu verändern, während er auskühlt und zugleich auch der Dampf am Himmel als heißer Regen niedergeht: nach 200 Millionen Jahren bereits gibt es einen Ozean. In ihm sinkt dieser Basalt wieder ab und tief in die Erde, um zu schmelzen, dadurch jedoch erneut hochzu steigen, zu Gneis nun geworden und leicht genug, um eine Insel im Meer zu bilden, an der sich weitere Gneisbögen anlagern, die nach und nach eine Landmasse formen, Hunderte von Kilome tern breit. All dies zeigt die oberste Schicht dieses anthrazitfar benen Steins, sie ist so rau und abgewittert, weil sie offen unter dem Himmel lag, der erste Kontinent, unter einer braun durch schweflige Schwaden schimmernden Sonne, einem Mond, der dunkler, doch größer noch war, weil er der Erde näher lag, in einem Tag, der nur fünf Stunden dämmrige Helligkeit kannte und fünf Stunden Nacht.
Wir nehmen den Fisch aus, sein Magen voll mit der klebrigen Masse verschluckter Insekten, und braten ihn; er schmeckt nach Gras und stillt den Hunger nicht einmal halb. Die Rauchschwa den werden im Abend dichter: entweder ist es der Wind oder der Waldbrand kommt näher. Und je tiefer die Sonne sinkt, desto klarer tritt der Umriss des Hügels hervor, die aufgewölbte Mitte eines Schildes. Die Klippe drüben am anderen Ende dieser Nie mandsbucht leuchtet rötlich auf, Zeile um Zeile aus den Anna len der Erde, und es ist jetzt erst, dass der griechische Name stim mig wird, für alles, was wandelbar ist, ständig im Fluss: a-casta Doch die Sprache macht diesen Zeitraum nicht denkbar, sie kann ihn bestenfalls auf die Spanne eines einzigen Tages über tragen, um darin Kontinente und Meere in der ersten, das Leben in der vierten Stunde und uns in den letzten vier Sekunden ent stehen zu lassen doch auch diese vierundzwanzig Stunden verdanken wir dem Mond, seiner nun fahler werdenden Sichel, deren Anziehungskraft die Erddrehung beständig bremste, bis der Tag sich längte zu diesem Kreisen der Sonne jetzt um den See.
Der Stein in meiner Hand war außen noch eine Zeitlang Kome teneinschlägen und innen weiterhin Hitze und Druck ausgesetzt, der Granit und Gabbro in die kleinsten Risse presste, jene Kris talle, hellroten Streifen und milchigen Einsprengsel in seinem monochromen Grau; aber er ragte weiter knapp über einen Oze an, in dem die Chemie des Lebens bereits entstand, nachweisbar in den grönländischen Sedimenten. Das Massiv wurde vor 3 Mil liarden Jahren angehoben und zu Gebirgen aufgeworfen, die erodierten und sich am Meeresgrund ablagerten, aber es wuchs wei ter und baute sich auf zu einem Urkontinent, der für Äonen be stand, bis Plattenbewegungen einsetzten und ihn schließlich zerrissen. Erst vor 1 8 Milliarden Jahren fügten sich seine Schol len wieder zu einer Landmasse zusammen, vor 1 Milliarde erneut, und vor 200 Millionen ein weiteres Mal zu jenem Pangaea, von dem sich schließlich unsere Erdteile abspalteten, so dass die Bruchstücke dieser ersten Erde heute in Montana und Wyoming liegen, im Enderby Land der Antarktis, an der chinesisch-korea nischen Grenze, in Goa, rund um die grönländische Hauptstadt Nuuk und über Brasilien und ganz Afrika verstreut.
Es bleibt kaum Zeit, um wenigstens in die Nähe des Lake Cra paud zu gelangen, wo das Flugzeug uns abholen soll. Wir haben stundenlang nach schönen Gesteinsproben gesucht und werfen noch einmal den Haken aus. Zum Abfluss des Sees ist es nicht weit, aber wir haben zu tun, um das Kanu zu schultern und einen Weg entlang der unschiffbaren Stromschnelle zu finden; es geht uns die Kraft aus. Wir paddeln mit Blasen an den Händen, schla fen kaum, und dann unruhig, haben Hunger und erzählen uns Geschichten dagegen, bis uns keine mehr einfallen und wir wie der von vorne beginnen. Am liebsten mag ich die über Bens Vet ter, der mit seiner ersten Snowmachine einen Mountie auf seiner Runde zu den Dörfern der Inuit im Norden begleitete. In einem White-Out blieb er in einer Schneewächte stecken, ohne es zu merken, er gab weiter Gas, bis der Polizist im Schlitten dahinter aufstand, zu ihm vorstapfte und dem Fahrer auf die Schulter klopfte, dass der vor Überraschung zusammenzuckte, als stände
plötzlich der Teufel neben ihm. In einem ähnlichen White-Out gehen auch die nächsten Tage ineinander über, wir verlieren un ser Zeitgefühl ebenso oft wie den Verlauf des Flusses.
Hinter einem großen Sumpfgebiet geraten wir wieder zwischen die Hügel, und bei einer der Portagen schrecken wir einen Schwarzbären aus dem Unterholz. Jetzt kann ich mich bloß noch an seinen großen dunklen Umriss erinnern; wir blickten ihm nicht in die Augen, traten vor ihm zurück und legten uns auf die Erde, dass ich bloß die Sohlen von Norberts Bergschuhen vor mir sah, hörte, wie er näher kam und an ihm herumschnüffelte, laut in der Stille, bis er zu mir trottete. Ich presste die Hände auf den Nacken, aber nicht, wie ich glaubte, weil er mich am Genick packen würde, sondern weil er mit der Schnauze versuchte, jeden von uns auf den Rücken zu drehen, während wir dagegen nur die Beine und Ellbogen auf den Boden stemmen konnten, seinen faulen Geruch in der Nase, seine feuchte Schnauze am Arm, eine Gewalt spürbar, der wir nichts entgegenzusetzen hatten. Das Blut schoss mir in den Bauch, ich vermochte keinen Gedanken zu fassen und war dennoch wach und klar, lebendig wie nie, bis wir nichts mehr hörten und uns vorsichtig aufsetzten, zitternd bis in die Fingerspitzen.
Den Sack mit den Felsbrocken vor mir dann im Kanu, zu müde, um noch müde zu sein, hatte ich mit einem Mal das Gefühl, dass alles zusammengehörte: das Gleißen über dem schweren dunk len Wasser, ein Licht, das von dem allerersten Element ausging, das der Urknall gebildet hatte: dem Wasserstoff, der im Inneren der Sonne zu Helium wird und dabei dieses Licht abstrahlt. Was ser und Licht machen dieses Universum beinahe zur Gänze aus, erst durch sie bildeten sich auch all die übrigen Elemente, um sich schließlich auch zu Gestein zu verfestigen, zu jener Vorstel lung von Beständigkeit, an der sich alles Leben misst: in stetem Wandel begriffen wie das Wasser, dessen Moleküle schon vom Anbeginn an da waren, von diesem Licht jedoch immer wieder gespalten wurden, um sich aufs Neue miteinander zu verbinden, verändert sich nichts, nicht wirklich: und all dies ließ sich nun mit einem Mal auch denken, innehaltend im Fluss, innewer dend.
Zum Lake Crapaud gelangten wir nie. An dem Samstag, an dem wir das Flugzeug gegen Mittag erwarteten, waren wir noch an die siebzig Kilometer von ihm entfernt. Wir hatten unsere wenigen Sachen so gut es ging zur Markierung ausgebreitet und horchten auf das Dröhnen der Motoren, versuchten es aus dem Summen der Mücken, dem Brummen der Bienen, Hummeln und Fliegen um unsre Köpfe herauszuhören, hofften, dass es zwischen den Bäumen auftauchte, aber jedesmal war es falscher Alarm und das Warten zermürbender als die Tage vorher. Gegen Abend kam es unvermittelt von hinter dem Hügel, flog knapp über uns hinweg, Norbert schoss die bleistiftgroße Signalrakete ab, die wir in der Hütte der Geologen gefunden hatten, doch das rote Magnesium licht hob sich kaum vom Himmel ab und fiel zu schnell in sich zusammen, als dass es die Piloten, deren Profil wir im Cockpit sahen, erkennen konnten. Wir winkten vergeblich, und die Twin Otter verschwand wieder hinter den Wipfeln am anderen Ufer.
Als sie auch nach einer Stunde nicht zurückkehrte, zuckte Ben mit den Schultern. meinte er stoisch; wir brauchen genügend zu essen, Wintersachen und einen Schlafsack: das macht drei Karibufelle für jeden von uns als Kleidung, nochmals sechs, um uns einen Schlafsack zu nähen; sie zu erlegen ist nicht schwer, sie sind kurzsichtig, und die Herden laufen fast blind an einem vorbei; das Fleisch räuchern wir. Was er da sagte, schien völlig normal, den Umständen angemessen, und wäre es vielleicht auch geworden, wenn uns das Flugzeug am nächsten Vormittag nicht doch noch am Fluss gesichtet hätte. Begrüßung gab es kaum eine, die Piloten waren missgestimmt, weil sie nicht wussten, ob sie zu ihrem Geld kommen würden; unsere Gastgeberin hatte sie zu einem weiteren Suchflug gedrängt, sobald ihr klar geworden war, dass wir festsaßen.
Raoul Schrott , geboren 1964 , ist ein vielfach ausgezeichneter Schrift steller, Übersetzer und habilitierter Literaturwissenschaftler. Großes öffentliches Aufsehen erregte Schrotts Neuübertragung der Ilias . München: Hanser, 2008. Kürzlich erschien von ihm (zusammen mit Arthur Jacobs) Gehirn und Gedicht Wie wir unsere Wirklichkeiten konstruieren . München: Hanser, 2011







 oben: Santiago de Chile, Dezember 2010 unten: Meseberg und Klosterfelde, Herbst 2010
oben: Santiago de Chile, Dezember 2010 unten: Meseberg und Klosterfelde, Herbst 2010


im zwischenreich der geister
von jutta brücknerDu willst, dass ich Dir mein Leben erzähle, ich weiß aber nicht, warum Dich das interessiert. In meinem Leben gab es nichts Beson deres. Wie man leben soll, weiß man, wenn es vorbei ist.
«
Dies sind die ersten Sätze meines ersten Films Tue recht und scheue niemand von 1973. Die, die sie spricht, ist meine Mutter. Sie ist fast 60 Jahre alt und diese schüchterne und unsi chere Frau, die nie geglaubt hatte, wichtig zu sein, schwankt zwi schen der Angst, nicht zu genügen und der Lust, dass ihr jemand zuhört, zuerst ich und dann die vielen Tausend Zuschauer des Fernsehens, das das Geld für den Film bereitgestellt hat. Die Sät ze, die sie spricht, stammen aus langen Tonbandgesprächen, die ich vorher mit ihr geführt hatte.
Ich hatte sie gebeten, mir ihr Leben zu erzählen, das prototy pisch abgelaufen war in dieser metaphysischen Wesenlosigkeit, wie die damalige Geschichte es für Frauen vorgesehen hatte, mit den Anforderungen und Verhinderungen, denen sich die Frauen zu beugen hatten, ihren verdeckten Kämpfen und ihrer oft laut losen Rache, den uneingelösten Hoffnungen eines zu braven, weil ewig kindlichen Lebens und der möglichen Auflehnung da gegen.
Es ging mir um die weibliche Sicht auf die Gesellschaft und die deutsche Geschichte, denn jedes Leben in dieser Zeit war ge zeichnet von den deutschen Katastrophen und hatte sich dazu zu verhalten in Anpassung oder Widerstand. Am Leben dieser Frau würde deutlich werden, wie schwierig es war, sich von den kollektiven Erwartungen und Zuschreibungen zu distanzieren und dass es doch geschehen musste.
Meine Mutter erzählt ihr Leben in diesen 60 Jahren in Hunder ten von Fotos: privaten Fotos, Fotos von gesellschaftlichen und politischen Situationen, vielen Fotos unidentifizierter Privatper sonen. In diesen Bildern nimmt das gesellschaftliche ›man‹ Ge stalt an und über weite Strecken des Films ist ihr Körper verbor gen in den anonymen Körpern der vielen Unbekannten, die ge meinsam den kollektiven Corpus des Films bilden. Aber das Rückgrat des Films sind die wunderbaren Fotos von August San der, dort gemacht, wo auch sie aufgewachsen war, und in ihnen zeigte sich das, was auch das Leben meiner Mutter zu Beginn ge prägt hatte: das Individuelle und das Archetypische waren noch nicht auseinandergefallen. Diese Menschen, die, meist in Berufs kleidung, aufmerksam und frontal in die Kamera sehen, legen selbstbewusst Zeugnis ab von sich und ihrer Welt gleichermaßen, ohne den Riss, der eines der Kennzeichen der Moderne ist.
Während wir diesen Film machten, begann meine Mutter, sich ihrer selbst als eines unverwechselbaren Individuums bewusst zu werden. In ihr entstand eine geheime und langsam wachsende Lust an sich selbst. Am Anfang war sie sehr zögernd gewesen. Sie wollte zwar, dass der Film entstand, aber sie wollte keinesfalls als Person in ihm auftauchen. Doch erst, als ich ihre Cousine, die ein sehr ähnliches Leben geführt hatte, abfilmen wollte, erklärte sie sich bereit. Als ich ihr den fertigen Film am Schneidetisch vorführte und mit heftiger Angst ihr Urteil erwartete, denn da mals war es noch etwas Unerhörtes, einen Film über die eigene Mutter zu machen, sagte sie: »Ich kann es nicht leugnen, das ist mein Leben.« Sie identifizierte sich so vollkommen mit dem Bild von sich selbst, dass sie, als der Film dann im Fernsehen lief, meinem Vater sagte: »Das siehst Du Dir jetzt an, das ist mein Leben und Du weißt nichts davon. «
Dieser Film wurde zu ihrer Waffe und auch zu ihrer Rache. Und je mehr ich mit diesem Film im Auftrag des Goethe-Instituts um die Welt reiste und ihr davon erzählte, desto zufriedener wurde sie. Eines ihrer Lieblingsworte war »schlicht und bescheiden«, aber sie wollte in dieser Bescheidenheit glänzen.
Inzwischen ist meine Mutter 96 Jahre alt, sie hat Alzheimer und lebt in einem Pflegeheim, nur zwei Straßen von meiner Woh nung entfernt. Wer einmal Zeuge eines solchen Prozesses der langsamen Verdämmerung gewesen ist, weiß, dass es die Hölle ist für den Kranken, der merkt, wie er sich verliert, aber auch für den Angehörigen, der nicht helfen kann. Die Sätze meiner Mut ter wurden zusammenhangloser und chaotischer, ihre Hör schwäche wurde zur Taubheit und je weniger sie noch hörte, desto größer wurde ihr Mitteilungsdrang. Sie sprach jetzt ohne Punkt und Komma und es reichte, irgendetwas zu sagen, nur um ihren Redefluss in Gang zu halten. Es reichte sogar, wenn ich einfach ab und zu die Lippen bewegte. Wir hatten eine Unsinns kommunikation.

Aber langsam begriff ich, dass dieser Zustand nicht einfach nur ein Verfall war, sondern seine eigenen Wahrheiten hatte. Die De menz meiner Mutter war von der alltäglichen Vernunft her gese hen nur Chaos, aber in diesem Meer von Worten tauchten, wie Inseln, Einsichten von tiefer Wahrheit auf. Wünsche, die sie nie ausgesprochen hatte, die ihr wahrscheinlich noch nicht einmal bewusst waren, verwandelten sich in Erlebnisse. Diese ängstlichprüde Frau »erlebt« im Heim eine Romanze mit einem Pfleger, die sie großmütig beendet, weil sie nicht will, dass er sich ihretwe gen von seiner Frau scheiden lässt. Sie »rettet« ein kleines Türken mädchen, das in einer Schachtel in ihrem Zimmer wohnt, mit meiner Hilfe vor dem gewalttätigen Vater und der Polizei. Sie »dirigiert« ein Möbelunternehmen, das Wagenladungen von Möbeln in meinem Keller verstaut. Sie »kümmert« sich liebevoll um meine drei Kinder (ich bin kinderlos), besonders um die Kleine, die ihr Leben in einem Weidenkörbchen in meinem Bü cherschrank verbringt, sie gibt mir Tipps für die Erziehung und das Kochen (sie hat das Kochen ein Leben lang gehasst). So repa rierte sie wieder die Generationenkette, die ich zerrissen habe. Sie »schlichtet« den ewigen Streit der Verwandten und sorgt für Versöhnung. Sie lebt nach dem von ihr vor fast 40 Jahren ausge sprochenen Satz: »Wie man leben soll, weiß man, wenn es vorbei ist.«
In ihrer Demenz gestaltet meine Mutter den letzten Akt ihrer Biografie. Alle Biografien sind ein Objekt des Begehrens und nichts, was sich durch die Summe des Gelebten zwangsläufig er gibt. Alle Menschen werden zu Erfindern ihrer eigenen Vergan genheit. Meine Mutter schreibt ihr Leben um, unter dessen Enge, Ärmlichkeit und Angst sie immer gelitten hatte. Ihr Redefluss beschreibt ihre Metamorphose, nicht logisch-narrativ, aber me taphorisch und emblematisch. Und damit ›überschreibt‹ sie auch den Film Tue recht und scheue niemand , mit dem sie sich, noch im Vollbesitz ihres Verstandes, so vollkommen identi fiziert hatte. Sie verändert ihn und führt ihn fort.
Die Demenz meiner Mutter war fast zwei Jahre lang ein Dasein auf der Schwelle, ein Nicht mehr / Noch nicht, das die
einfache Abfolge von Leben und Tod unterläuft. Dieses Zwi schenreich der Geister ähnelt nicht dem, was in unserer Kultur immer mit »Würde und Selbstbestimmung bis zum Ende« be zeichnet wird, denn damit wird immer die volle Kontrolle über den Verstand gemeint. Die Seele ist uns bestenfalls »das innere Afrika«, wie Freud gesagt hat. Aber die Entgrenzung, die meine Mutter in ihren halluzinierten Erlebnissen betrieb, hatte mehr mit Selbstbestimmung zu tun als vieles andere in den früheren Jahren ihrer Existenz. In der langen Phase ihres Dementwerdens gab es immer wieder Momente, in denen ich dachte: Nie war sie so lebendig wie jetzt. Wer redet, ist nicht tot.
Den Wert dieses Zwischenzustands können wir in unserer mate rialistischen Kultur nur schwer begreifen. In seinem Buch der Trauer um den Tod seiner Mutter schreibt Roland Barthes, dass das Zeitalter des abendländischen Materialismus zu Ende ist und ein Wesen nicht mit dem Körper verschwindet.
In meinem ersten Film bin ich stumm, ich lausche der Mutter sprache. Um als Filmemacherin in Bildern sprechen zu lernen, hatte ich mir Stimme und Bild meiner Mutter geliehen. Ich woll te von ihr fort, aber ich wollte sie nicht verlassen, ich wollte auf brechen, aber nicht gegen sie. Meine Generation des feministi schen Aufbruchs war die erste, die mit Hilfe der Pille klar die Entscheidung treffen konnte, nicht Mutter zu werden. Wir hat ten das Glück und die Notwendigkeit, uns völlig neu erfinden zu können und in allem das Leben der Mutter zu verwerfen. Wir konnten, wenn wir wollten, diesen jahrhundertealten Generati onenvertrag aufkündigen, der die Frauen verpflichtete, ihren Körper immer wieder zum Spiegel des mütterlichen zu machen. Wenn es aber wirklich so ist, dass das eigene Kind der beste Halt gegen die Tendenz der Tochter ist, sich in der Mutter aufzulösen, und bis zu dem Zeitpunkt, als Freud das schrieb, keine anderen gesellschaftlichen Riten bekannt waren, die denselben Zweck verfolgt hätten, dann musste die erste feministische Generation ein Ersatzritual dafür finden, wenn sie nicht mit dem Problem der Mutter-Tochter-Fusion ein Leben lang kämpfen wollte. Mein Ersatzritual war dieser Film. Wenn ich ihn nicht hätte machen können, hätte ich, die filmische Autodidaktin, wohl nie einen gemacht.
Durch diesen Film bin ich zum ersten Mal mit meiner Mutter überhaupt in ein Gespräch gekommen. Mir ging es wie vielen von uns, die mit den Eltern nicht sprechen können, solange sie noch leben. Ich wollte herausfinden, was für eine Frau das war, die ich nur als meine Mutter kannte. Durch den Film hatte ich sie auch mitnehmen wollen auf meinem Aufbruch und sie war dankbar dafür. Wie groß die Anstrengung, der sie sich dabei un terzog, für sie gewesen war, davon zeugt einer ihrer letzten Sätze im Film »Das Alte kann ich nicht mehr und das Neue weiß ich nicht, wie das geht.« Ich habe lange unterschätzt, in welche Turbulenzen meine Mutter geriet. Auch sie hat das damals nicht gemerkt, der Zuwachs an Möglichkeiten war zu befreiend. Aber jetzt, in ihren Monologen, kamen die un terdrückten Ängste hoch. Was ist das eigene Leben noch wert, wenn die Tochter sich so radikal davon abwendet? Ein Leben lang hatte meine Mutter Angst gehabt, den Anforderungen der anderen nicht zu genügen, die immer gesagt hatten, was zu tun
sei. Jetzt war ich »die anderen«. Sie hatte Angst, dass sie in mei nen Augen nicht gut genug sei, nicht schnell genug, nicht tapfer genug. Die Frau in meiner Mutter, die durch den Film wieder ge weckt worden war, Jahre nachdem sie in der Mutter untergegan gen war, hat mich beneidet und sie hat sich vor mir gefürchtet. Und so entwickelte meine Mutter ein exzessives Verlangen nach Bestätigung und Liebesbeweisen, um ihre Unruhe zu besänfti gen. Und immer wieder erneuten Versicherungen, dass sie als Mutter doch noch eine Instanz sei.
Und darunter litt ich. Denn es rührte an das ständige Schuldbe wusstsein, dem keine Tochter entgeht, die ihre Mutter in ein Heim gibt. Denn natürlich hatte sie gesagt: »Du musst mir eines versprechen: mich niemals in ein Heim zu geben.« Und natür lich hatte ich es ihr versprochen. Hier setzt die archaische Logik an, die es in jedem Mutter-Tochter-Verhältnis gibt: mein Leben gegen Deines. Immer wieder geriet ich in diesen Mutter-TochterZusammenhang von Pflicht und Aufopferung, Schuldbewusst sein und Enttäuschung. Und dagegen wehrte ich mich mit allen Kräften. Die Einsicht, dass Moral auch darin besteht, sich nicht freiwillig zum Opfer zu machen und dann darunter zu leiden, musste ich immer wieder gegen die Anfälle von Selbstbestrafung behaupten. Auch ich lebte in der Ambivalenz, in die auch meine Mutter geraten war, auch für mich galt: »Das Alte kann ich nicht mehr und das Neue weiß ich nicht, wie das geht.«
Und so begann auch ich zu reden, über die Mechanik hinaus, mit der ich ihren Monolog in Schwung hielt. Ich fing an, ihr Din ge zu sagen, die ich nicht zu sagen gewagt hätte, solange sie bei vollem Verstand war. Mir war nicht klar, ob sie das überhaupt noch hören konnte, sie war so gut wie taub. Aber für mich war es wichtig, diese Sätze auszusprechen solange sie noch da war. Nur in diesem Zwischenreich waren sie keine Abrechnung und nicht vergeblich. Ich sprach über unseren Film. Ich hatte ihn gemacht, weil ich meine Mutter zur Lieferantin der weiblichen Sicht auf die Geschichte erklärt hatte, zum Modell für »Frauen und Deutschland«, prototypisch in ihrem masochistischen Wieder holungszwang, dem wahren Leben nachzulaufen, und erklärte ihren Konsumeifer und ihren hektischen Drang, Versäumtes nachzuholen als Klassen- und Generationsproblem. Das war nicht falsch, denn Geschichte wird nur als Biografie erfahrbar und Biografie formt sich unter dem Druck der Geschichte, aber es war nicht die ganze Wahrheit. Ich hatte ihn auch gemacht, um in der großen deutschen Geschichte und dem Bildercorpus vie ler Unbekannter das Bild meiner Mutter zu verstecken. Die Ent wertung, die darin lag, sie zum sozialen Paradigma zu machen, kam aus der Angst, sich mit dem Einmaligen, was die Mutter für die Tochter ist, in einem Film zu konfrontieren. Die Mutter ist der Körper, nicht nur eine Bezugsperson. Die Gebärerin, aus de ren Leib man kommt, hat eine ungleich größere symbiotische Bedeutung als der Erzeuger.
Das zu zeigen ging nur in einem Film, dem Medium, das ja wie kein anderes die Prozesse des Unbewussten in Gang hält. Film erlaubte die Distanz zu diesem Körper und gleichzeitig die Kon frontation mit ihm. Ich wurde zur Schöpferin eines von mir un terschiedenen und abgetrennten mütterlichen Objektes. Das ge
kulturstiftung des bundes magazin 17
schah natürlich völlig unbewusst. In Bildern kann man etwas wissen und doch nicht wissen, so wie man lebendig sein kann und tot gleichzeitig. Wenn ich meinen Film heute ansehe, sehe ich auch, dass Film, der moderne Friedhof der Bilder, auch das Medium der Reinkarnation ist.
Denn inzwischen ist meine Mutter vollkommen in ihrer eigenen Welt. Sie spricht nicht mehr, sie nimmt mich nicht mehr wahr, wenn ich sie besuche. Ich tue das nicht mehr, denn es geht über meine Kraft, dieses Schweigen zu ertragen. Sie wirkt nicht un glücklich. Niemand erwartet mehr etwas von ihr, was sie nicht leisten kann. Und vor allem, sie selbst erwartet es nicht mehr von sich. Physisch angekommen beim Zustand eines Kindes, ist sie wieder da, wo sie am glücklichsten war und ich bin zu ihrer Mut ter geworden, verantwortlich dafür, dass sie bekommt, was sie braucht. Eine Frau, die sich immer als Mutter definiert hat, kennt nur einen glücklichen Gegenpol: das Kind.
Als meine Mutter verstummte, hatte ich nur den einen Wunsch, das Bild, das ich von ihr hatte, zu retten gegen die zunehmende Entfernung dieses Menschen, der im Rollstuhl vor mir saß. Auf dem Tisch vor mir stehen jetzt vier Bilder. Auf dem ersten sehe ich meine Mutter mit mir als Baby, sie, eine lachende, junge Frau und mich, ein unwilliges weißes Bündel, das nicht mehr auf dem Arm gehalten werden will. Auf dem zweiten sehe ich eine ele gante, lächelnde junge Frau, auf deren Schoß ein Kleinkind steht, das mit riesigen Augen auf das Vögelchen wartet, das jetzt aus dem Fotoapparat kommen soll. Dieses Bild wurde gemacht, da mit mein Vater, der Soldat, es bei sich tragen konnte. Ich habe meine Mutter und mich in diesen Bildern eingefroren. Sie hat mich immer für ihr Glück verantwortlich gemacht. Wenn es ihr schlecht ging, wenn sie traurig war, war ich verpflichtet, sie glück lich zu machen. Jetzt stehen diese beiden Fotos für ein Glück, das sich meine Mutter immer nur als starkes, reines Gefühl vor stellen konnte, ohne jede Ambivalenz. In diesen Bildern kann sie ein Liebesobjekt sein ohne jeden Zwang, ohne jedes Opfer, ohne jede Strafe.
Das dritte Bild zeigt meine Mutter neben ihrer eigenen Mutter und ihren Geschwistern. Die 12jährige sieht als einzige aus dem Bild heraus, als suche sie da etwas, während alle anderen in die Kamera starren. Ist es der fehlende Vater? Auf dem vierten Foto ist sie selbst ein Baby auf dem Schoss ihrer Mutter, umgeben von den Geschwistern und dem Vater in Uniform. Auch dieses Bild wurde gemacht für einen Soldaten, ihren Vater, der in einem an deren Krieg kämpfte. In dem Jahr ihrer aktiven Demenz hatte meine Mutter mich immer wieder für ihre Mutter gehalten. Nie hat sie so geschrien wie bei der Beerdigung ihrer eigenen Mutter. Das Baby umsorgt von der Mutter, gleichgültig wer hier die Mut ter ist und wer das Kind, war der letzte Moment, den sie mit mir teilte, bevor sie in dem Schweigen verschwand, zu dem ich kei nen Zutritt mehr habe.
Jutta Brückner ist Drehbuchautorin, Regisseurin und Produzentin, Buchautorin und Verfasserin von Hörspielen und Theatertexten. Ihre Spielund Dokumentarfilme, zuletzt der Spielfilm Hitlerkantate (2005), er hielten zahlreiche Auszeichnungen. Von 1986 bis 2006 war Brückner Professo rin an der Universität der Künste in Berlin. Seit 2009 ist sie Direktorin der Sektion Film- und Medienkunst der Akademie der Künste.
die untoten. kongress und inszenierung, 12.–14. mai 2011, kampnagel hamburg
Wann beginnt heute ein Leben? Wann endet heute ein Leben? Und wer bestimmt darüber? Moderne Bio- und Medizintechnologien eröffnen immer weitreichendere Möglichkeiten, in Lebensprozesse einzugreifen, und ver langen mehr denn je nach einer neuen Definition des Zwischenbereichs von Leben und Tod. Das Projekt Die Untoten. Life Sciences & Pulp Fiction der Kulturstiftung des Bundes in Kooperation mit Kampnagel Hamburg und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wis senschaften sondiert, wie dieses ›verbesserte‹, ›verlän gerte‹ oder ›neue‹ Leben beschrieben und betrachtet werden kann. Die populäre Kultur gibt ihrerseits Antwor ten auf diese Fragen: Unsere Filme, Romane, Comics, Feuilletons und Bestsellerlisten sind derzeit bevölkert von einer Welt der ›Untoten‹. Sie liefern Visionen, Albträu me und Karnevalisierungen der neuen Denk- und Mach barkeiten und begleiten die Entwicklung der Life Sci ences seit ihren Anfängen mit Drastik und Drama. Unter der künstlerischen Leitung von Hannah Hurtzig ver knüpft der transdisziplinäre Kongress in einer Inszenie rung Bilder, Filme und Diskurse der populären Kultur mit denen der Lebenswissenschaften. Weitere Informationen unter www.untot.info

 Grigoriopol, Transnistrien/Republik Moldau, 2004
Grigoriopol, Transnistrien/Republik Moldau, 2004
meldungen
kulturagenten für kreative schulen
Die Kulturstiftung des Bundes wird das mehrjährige Programm zur Kulturellen Bildung mit dem neuen Titel Kulturagenten für kreative Schulen in Kooperation mit der Stiftung Mercator durchführen. Beide Stiftungen beteiligen sich mit jeweils 10 Mio. Euro an dem Programm, das mit bis zu 50 Kulturagenten in fünf Bundesländern in dem Schuljahr 2011 /12 starten soll. Die beteiligten Bundesländer stehen jetzt fest: Es sind Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. Sie unterstützen das Modellprogramm durch eine Kofinanzierung und sind eng in die Umset zung eingebunden. Weitere Informationen unter www.kulturstiftung-bund.de/kulturagenten
fonds neue länder wird verlängert
Der bereits 2002 von der Kulturstiftung des Bundes eingerichtete Fonds zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements für die Kultur in den neuen Bundesländern wird bis 2015 verlängert und um weitere 2 Mio. Euro aufgestockt. Ziel dieses Fonds ist die strukturelle Weiterentwick lung und Professionalisierung der Kulturarbeit in Ostdeutsch land. Bislang wurden 143 Einrichtungen und Projekte mit einer Gesamtsumme von 3 ,3 Mio. Euro gefördert. Wegen seines großen Erfolges wurde der Fonds seit seiner Gründung bereits zwei mal verlängert. Der Fonds möchte durch die Förderung des bür gerschaftlichen Engagements in kulturellen Einrichtungen zur Verbundenheit der Menschen mit ihrer Region beitragen. Weitere Informationen unter www.kulturstiftung-bund.de/fnl
›verrücktes blut‹ auf tournee
Vor dem Hintergrund der Debatte um Integration und Interkul tur in Deutschland hat der Vorstand der Kulturstiftung des Bundes im Januar 2011 beschlossen, das Theaterstück Verrück tes Blut , eine Koproduktion des Berliner Ballhaus Naunyn straße mit der Ruhrtriennale 2010, als Gastspielreise deutsch landweit zu zeigen. Die zweijährige Tournee beginnt in Mün chen und Osnabrück. Verrücktes Blut des Regisseurs Nur kan Erpulat ist politisch hochaktuelles Theater. Neben der künstlerisch äußerst gelungenen Arbeit mit einem Ensemble junger Schauspieler/innen meist nichtdeutscher Herkunft sind es die im Stück verhandelten gesellschaftlichen Fragen und Ängste, die die Aufführung als Reflexionsfläche der aktuellen Integrationsdebatte besonders geeignet erscheinen lassen. Weitere Informationen unter www.ballhausnaunynstrasse.de
eingeladen
Die von der Kulturstiftung des Bundes geförderte Aufführung Simurghs letzte Feder , eine Koproduktion des Freiburger Theater im Marienbad und der Drama Academy Teheran ist zu Augenblick mal! , dem Kinder- und Jugendtheater Festival in Berlin, am 14. und 15. Mai 2011 eingeladen worden. Das Stück ba siert auf dem persischen Nationalepos Shanameh , wurde mit vier iranischen und vier deutschen Schauspielern zu den Themen ›Autonomie und Gehorsam‹ und ›Glaube und Vernunft‹ erarbei tet und in beiden Sprachen in Teheran und Freiburg gespielt. Wir gratulieren! Weitere Informationen unter www.marienbad.org
kulturstiftung des bundes magazin 1732
›kulturen des wirtschaftens‹: elektronische dokumentation erschienen
Im Mai und Juni 2010 veranstaltete die Kulturstiftung in Koope ration mit der Ludwig-Maximilians-Universität München im Berliner Radialsystem die dreiteilige Konferenzreihe Kulturen des Wirtschaftens . Eine umfassende Dokumentation der Veranstaltung ist jetzt online unter http://epub.ub.uni-muenchen.de kostenlos verfügbar. Gegen eine Unkostenpauschale von 5,90 Euro können Sie die Dokumentation auch als CD bei der Ludwig-Maximilians-Universität München telefonisch unter +49 [ 0 ] 89 21 80 — 61 80 bestellen.
zweite studienedition zu ›40jahrevideokunst.de‹ erschienen
Mit über 25 Stunden Laufzeit bietet die Studienedition des Pro jektes record>again! 40jahrevideokunst.de einen faszinierenden Überblick über die Frühzeit der Videokunst in Deutschland. Ob Kunstvideo, Performance-Mitschnitt, Interview oder Dokumentation insgesamt 60 herausragende Werke von 58 Künstlern und Künstlergruppen sind zu entdecken. Darunter der Boxkampf, den Joseph Beuys 1972 auf der documenta 5 veranstaltete, die Rekonstruktion der auf sechs Monitoren ge zeigten Arbeit Schafe von Wolf Kahlen aus dem Jahr 1976, der Mediengarten von HA Schult von 1978, ferner Arbeiten aus der Fernsehgalerie Gerry Schum mit Klaus Rinke und Ulrich Rückriem, eine Dokumentation über Anna Oppermann von 1977 und bisher unveröffentlichtes Videomaterial des Festi vals Genialer Dilletanten von 1981 im Berliner Tem podrom. Herausgeber der Edition sind Christoph Blase und Pe ter Weibel vom Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe. Die DVD -Studienedition kann unter http://shop.zkm.de für den Preis von 99 Euro von Bildungseinrichtungen zur nichtöffentlichen Nutzung für Lehre und Forschung erworben wer den. Weitere Informationen zum Projekt unter: www.zkm.de
publikation ›tanztechniken 2010
— tanzplan deutschland‹
Tanzplan Deutschland hat 2008 ein Forschungsprojekt zu zeitgenössischen Tanztechniken initiiert. Das Ergebnis dieser Recherche, an der renommierte Tanzhochschulen in Deutsch land und Europa beteiligt waren, liegt nun als Buch vor: Tanz techniken 2010 Tanzplan Deutschland , her ausgegeben von Ingo Diehl und Friederike Lampert. In dieser Publikation beschäftigen sich Tanzexperten und -künstler mit den wichtigsten Techniken des modernen, postmodernen und zeitgenössischen Tanzes (Humphrey/Limón, Cunningham, Jooss-Leeder, Release, Muller, Countertechnik und andere). Der jeweilige historische Kontext, die Philosophie und Ästhetik sind dabei ebenso Thema wie die körperlichen Voraussetzungen, die Bewe gungsmerkmale sowie die Vermittlungskonzepte und Arbeits weisen im Training. Begleitende Essays zum Begriff der Tanz technik und ihren Erscheinungsformen, mehr als 80 Abbildungen und zwei Training- DVD s runden das Buch ab. /Tanztechniken 2010 Tanzplan Deutschland 320 Seiten, [D ] 19,90 Euro, ISBN 978 3 89487 412 4 (Deutsch) /ISBN 978 3 89487 689 0 (Englisch). Weitere Informationen unter www.tanzplan-deutschland.de
dokumentarfilm ›behauptung des raums‹ jetzt auf dvd
Der Dokumentarfilm Behauptung des Raums Wege unabhängiger Ausstellungskultur in der DDR von Claus Löser und Jakobine Motz ist ab jetzt als DVD im Han del erhältlich. Der Film erzählt die Geschichte einer unangepass ten DDR-Kunstszene. Er schlägt einen Bogen von der Galerie Eigen +Art und dem Herbstsalon in Leipzig, über die Clara Mosch in Karl-Marx-Stadt bis hin zu Jürgen Schweinebradens Privatgale rie im Ost-Berlin der frühen 70er Jahre. Aktuelle Interviews mit wichtigen Akteuren wie Lutz Dammbeck, Christoph Tannert, Gerd Harry Lybke oder Olaf und Carsten Nicolai korrespondie ren mit bislang unbekanntem historischen Filmmaterial. Der Dokumentarfilm entstand im Rahmen des Geschichtsforums 1989 | 2009. Europa zwischen Teilung und Aufbruch der Kulturstiftung des Bundes. Die DVD mit englischen Untertiteln und einem Bonusfilm von Jörg Herold kostet 19,90 Euro, ist bei absolut Medien [www.absolutmedien.de] erschienen und über den Fachhandel zu beziehen.
›viceversa‹ — programm für internationale übersetzerfortbildung gestartet
Der von der Kulturstiftung des Bundes geförderte Deutsche Übersetzerfonds und die Robert Bosch Stiftung haben mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes und unter der Schirmherrschaft von Staatsministerin Cornelia Pieper ein Programm zur internationalen Fortbildung von Literaturübersetzern ins Leben gerufen. ViceVersa wird zweisprachige Übersetzerwerkstätten mit Teilnehmern eines bestimmten Sprachenpaares (Deutsch Russisch und umgekehrt zum Beispiel) ermöglichen. Die mehrtägigen Workshops schaffen einen idealen Diskussionsraum für die Feinheiten literarischer Übersetzungen. Die Teilnehmer erhalten ein qualifiziertes Echo auf die eigene Arbeit und knüpfen Arbeitsbeziehungen zu Kollegen aus den Ländern der Sprache, aus der sie übersetzen. Das Modell wurde erfolgreich erprobt und macht Schule neue Initiativen und Konstellatio nen an verschiedenen Orten sind in den vergangenen Jahren ent standen. ViceVersa bietet den zweisprachigen Werkstät ten eine Basisfinanzierung, Unterstützung bei der Akquisition von Partnern und Geldgebern sowie Beratung hinsichtlich der inhaltlichen und organisatorischen Durchführung. Im kommenden Jahr sind sieben ViceVersa -Projekte in Planung, darunter eine deutsch-hebräische Werkstatt im Literarischen Collo quium Berlin und eine deutsch-russische Werkstatt in Pusch kinskije Gory/Russland. Weitere Informationen unter www.uebersetzerfonds.de
›simurghs letzte feder‹ zum festival ›augenblick mal!‹
mehr musik! ist gut für junge ohren
Mehr Musik! , das Augsburger Projekt des Netzwerk Neue Musik, wurde gleich zweimal mit dem preis junge ohren 2010 ausgezeichnet: In der Kategorie ›Best Practice‹ teilt sich Die Abenteuer von Tom Dumm den 2. Platz mit Mon sieur Mathieu, was nun? der Oper Leipzig ein 1. Platz wurde nicht vergeben. Die Kinderoper Tom Dumm ist ein au ßergewöhnliches Musiktheaterprojekt, bei dem die Kinder und Jugendlichen in alle Produktionsabschnitte mit einbezogen wur den. In der Kategorie ›LabOhr‹ erhielt die Hörhülle den 1 Platz. Dieser Klang-raum wurde von Schülern speziell für das Erleben Neuer Musik entworfen und ist das Ergebnis des Schul projekts Neue Klänge brauchen Neue Räume. Mehr über Mehr Musik! unter www.mehrmusik-augsburg.de
jeki
Am 31. Juli 2011 geht der vierjährige Förderzeitraum der Kultur stiftung des Bundes bei Jedem Kind ein Instrument (JeKI) zu Ende; das Programm wird zukünftig in alleiniger Verantwortung des Landes NRW weitergeführt. Den Ausgangspunkt bildete ein Mo dellvorhaben, bei dem ab dem Jahr 2003 eine neuartige Kooperation zwischen der städtischen Musikschule und Bochumer Grundschulen erprobt worden war. Die Idee, wirklich jedem Kind aus den teilnehmenden Kommunen unabhängig von sozialen und finanziellen Voraussetzungen oder Bildungsinitiati ven der Eltern die Chance zu geben, ein Instrument zu lernen und bereits im frühen Grundschulalter mit anderen gemeinsam zu musizieren, überzeugte: Im Vorfeld der Kulturhauptstadt Ruhr 2010 beschlossen die Kulturstiftung des Bundes und das Land Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit der Zukunftsstif tung Bildung, das Projekt modellhaft auf das gesamte Ruhrgebiet auszudehnen. Mit neuem Konzept und unter der Trägerschaft einer eigens dafür gegründeten Stiftung startete JeKI im Schul jahr 2007 /2008. Bis heute konnten 42 Kommunen des Ruhrge biets mit 56 Musikschulen in kommunaler und freier Träger schaft als Partner der Stiftung und Teilnehmer gewonnen wer den; 54 200 Kinder waren im Schuljahr 2010 /11 an JeKI beteiligt. Der kulturpolitische Funke, den die Kulturstiftung des Bundes mit ihrem Engagement schlagen wollte, hat gezündet: Die Frage, wie eine musikalische Basisbildung für möglichst alle Kinder ge staltet und finanziert werden kann und welche Konzepte hierfür die besten sind, ist nicht nur in NRW längst vom Rande ins Zentrum der kultur- und bildungs-politischen Debatte gerückt. Weitere Informationen unter www.jedemkind.de
kleist-jahr 2011
Am 21. November 2011 jährt sich der Todestag Heinrich von Kleists zum 200. Mal. Die Kulturstiftung des Bundes beteiligt sich mit einer ganzen Reihe von Projekten am Kleist-Jahr 2011 , die den Dichter als Vorläufer der Moderne würdigen und die Aktualität seines künstlerischen Erbes in eine breite Öffent lichkeit tragen sollen. Dafür stellt sie insgesamt 2,13 Mio. Euro zur Verfügung. Neu hinzugekommen sind zwei Projekte, die die bis her geplanten Initiativen der Kulturstiftung ergänzen: Die Hör spiel-Installation Ein akustisches Kleist-Denkmal interpretiert Kleists Todesort am Berliner Wannsee. Und die lite raturhistorische Ausstellung Heinrich von Kleist Etap pen der Werkgeschichte zeigt vom 17. Juni 2011 an in der Heidelberger Heiliggeistkirche Original-Schriftstücke und Erst ausgaben des Dichters erstmalig der Öffentlichkeit. Weitere In formationen unter www.kulturstiftung-bund.de/kleist
silberner bär für den world cinema fund
Der von der Kulturstiftung des Bundes in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut gegründete World Cinema Fund war auf den 61. Berliner Filmfestspielen erneut erfolgreich vertreten. Die internationale Jury mit Isabella Rossellini, Nina Hoss und dem iranischen Filmemacher Jafar Panahi verlieh dem vom WCF geförderten argentinischen Film El Premio ( Der Preis , Regie: Paula Markovitch) den Silbernen Bären für her ausragende künstlerische Leistungen in den Bereichen Kamera und Produktionsdesign. El Premio erzählt aus der Perspekti ve eines kleinen Mädchens vom Überleben einer zerrissenen Fa milie in Zeiten der argentinischen Militärdiktatur. Nähere Infor mationen unter www.berlinale.de
mediathek der kulturstiftung
Seit Januar 2011 verfügt die Website der Kulturstiftung des Bundes über eine Mediathek. Video- und Audiobeiträge geben Ein blick in die Arbeit der Stiftung. Außerdem finden Sie dort Infor mationen zu Publikationen der stiftungseigenen Initiativpro gramme und -projekte, Online-Publikationen zum Download und einen Überblick über Blogs und Netzwerke der Kulturstif tung im Internet: www.kulturstiftung-bund.de/mediathek
die kulturstiftung bei facebook
Besuchen Sie die Kulturstiftung des Bundes auf Facebook und zeigen Sie uns, was Ihnen gefällt. Als Ergänzung zu unserer Web site informieren wir Sie auf unseren Facebook-Seiten über unsere Ausschreibungen, Fördermöglichkeiten und Programme. Wer tiefer einsteigen möchte und sich zu einem Thema austauschen will, kann die Seiten einzelner Programme besuchen. Viele un serer geförderten Projekte besitzen einen eigenen Facebookauf tritt, wie z.B. der Fonds Wanderlust für internationale Theaterpartnerschaften, Tanzplan Deutschland , das Netzwerk Neue Musik , das Programm Über Lebens kunst Initiative für Kultur und Nachhaltigkeit, das KUR Programm zur Konservierung und Restaurierung von mobilem Kulturgut sowie das Programm Die Untoten www.facebook.com/kulturstiftung www.facebook.com/wanderlust.fund www.facebook.com/tanzplan.deutschland www.facebook.com/NetzwerkNeueMusik www.facebook.com/UeberLebenskunst www.facebook.com/kur_programm www.facebook.com/dieuntoten
neue
jurymitglieder
ab 2011
Alle drei Jahre wird die Jury für die antragsgebundene allgemeine Projektförderung neu berufen. Jetzt hat es wieder einen Wechsel gegeben. Von 2011 bis 2013 setzt sich die interdisziplinäre Jury aus folgenden Mitgliedern zusammen:
Sophie Becker Dramaturgin Sächsische Staatsoper Dresden Dr. Andreas Blühm Direktor Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Köln
Karl Bruckmaier Moderator, Hörspielregisseur und -autor Johan Holten Direktor Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Dr. Lydia Jeschke Redaktionsleitung Wort / Musik SWR 2
Dr. Stefan Luft Politikwissenschaftler Universität Bremen Barbara Mundel Intendantin Theater Freiburg
Dr. Olaf Nicolai Bildender Künstler
Elisabeth Ruge Verlegerin, Berlin Verlag
können Sie Ihre Bestellung auf unserer Website unter www.kul turstiftung-bund.de aufgeben. Falls Sie keinen Internetzugang haben, erreichen Sie uns auch telefonisch unter +49 [ 0 ] 345 2997 124. Wir nehmen Sie gern in den Verteiler auf!
die website
Die Kulturstiftung des Bundes unterhält eine umfangreiche zweisprachige Website, auf der Sie sich über die Aufgaben und Programme der Stiftung, die Förderanträge und geförderten Projekte und vieles mehr informieren können. Besuchen Sie uns unter www.kulturstiftung-bund.de
wenn sie dieses magazin regelmäßig beziehen möchten,
neue projekte
In der Herbstsitzung 2010 erhielten auf Empfeh lung der Jury 27 Projekte aller Sparten eine För derzusage im Rahmen der antragsgebundenen Projektförderung.
bild und raum
über die metapher des wachstums ausstellung Der Frankfurter Kunstverein, der Kunstverein Hannover und das Kunsthaus Baselland haben gemeinsam eine Auswahl an künstlerischen Positionen zu Phänomenen des Wachstums zusammengestellt und entwickeln daraus drei Ausstellungen mit jeweils unterschiedlicher Akzentuierung. Die Kuratoren wollen den Begriff des Wachstums hinterfragen, seine posi tiven und negativen Konnotationen und seine Bedeutung in Natur, Gesellschaft und Ökono mie. Auf der einen Seite steht natürliches, orga nisches Wachstum, welches Werden und Verge hen beinhaltet. Auf der anderen Seite geht es um das Wachstum als einen metaphorischen Leitgedanken unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, das den Aspekt einer Sättigung, eines Ausgewachsenseins nicht kennt. Den Ausgangs punkt der künstlerischen Arbeiten bilden biolo gische Kreisläufe, Modelle utopischer Techno logien und die Auseinandersetzung mit einer expansiven Ökonomie. Begleitend finden Dis kussionsrunden statt, die sich den Themen ›Wirtschaftswachstum und Krise‹, ›Risiken und Grenzen des technologischen Fortschritts‹ sowie ›In formationstechnologie und Wissensexplosion‹ widmen.
Künstlerische Leitung: René Zechlin /Kurator/innen: Holger Kube Ventura, Sabine Schaschl (CH) , René Zechlin /Künst ler/innen: Michel Blazy (F) , Max Bottini (CH) , Mark Boulos (GB/NL) , Peter Buggenhaut (BE) , Armin Chodzinski, Dirk Fleischmann (KR) , Ulrich Gebert, Tue Greenfort, San Keller (CH) , Mika Rottenberg (USA) , Ene-Liis Semper (EST) , Pas quale Pennacchio & Marisa Argentato (I) Thomas Rent meister, Reynold Reynolds (USA/D) , Julika Rudelius (NL) , Ger da Steiner & Jörg Lenzlinger (CH) , Superflex (DK) , Sebastian Mundwiler (CH) , Vik Muniz (BR) , Franziska & Lois Weinber ger (A) , Andreas Zybach u.a. /Kunstverein Hannover, 16 4.–26 6 2011, Eröffnung am 15 4 2011 / Kunsthaus Baselland (Schweiz), 20 5.– 10 7 2011, Eröffnung am 19 5 2011 / Frank furter Kunstverein, 27 5.– 31 7 2011, Eröffnung am 26 5 2011 / www.kunstverein-hannover.de
wild sky ausstellung zur kartografischen erfassung, vermessung und aufzeichnung des himmels Die Ausstellung versammelt künstlerische Arbeiten aus Fotografie, Video und Installation, die sich mit Phänomenen des Himmels und seiner Er forschung beschäftigen. Der Wunsch, Sonnenund Sternensysteme und andere Himmelser scheinungen zu verstehen und aufzuzeichnen, begleitet die Menschheit von Anbeginn an. Doch noch immer gibt es unerforschte Bereiche und es werden neue Grenzen ausgemacht. Die präsentierten Künstler reflektieren in ihren Ar beiten den alten Menschheitstraum vom Ver stehen des Himmels und haben sich dabei von visuellen Technologien der Vergangenheit und von zeitgenössischen wissenschaftlichen Methoden inspirieren lassen. Sie zeigen auch das Un vermögen, das unendliche Potenzial des Him
kulturstiftung des bundes magazin 1734
mels jemals vollständig sichtbar zu machen, und leiten daraus ein irrationales, mystisches Moment der Himmelsbeobachtung ab, das im Kontrast zu seiner naturwissenschaftlichen For schung steht. Die Ausstellung wird begleitet von einem medienpädagogischen Programm für junge Menschen: In praktischen Projekten werden Kenntnisse über konzeptionelle, inhalt liche und formal-ästhetische Aspekte der künst lerischen Beschäftigung mit dem Himmel ver mittelt.
Künstlerische Leitung: Sabine Himmelsbach / Kurator: Mi chael Connor (USA) / Künstler/innen: Alex Ceccetti (I) , Peter Coffin (USA) Spencer Finch (USA) Lisa Oppenheim (USA) Tre vor Paglen (USA) Joe Winter (USA) u.a. / Edith-Ruß-Haus für Medienkunst Oldenburg, 27 5.– 7 8 2011, Eröffnung am 26 5 2011 /www.edith-russ-haus.de
the global contemporary kunstwelten nach 1989 Auf welche Weise prägen globale Prozesse die Kunst und wie reagieren Künstler/innen und Institutionen auf die zunehmende weltweite Verflechtung der Kunstwelt?
Die Ausstellung The Global Contemporary möchte anhand von circa 100 Arbeiten interna tionaler Künstler/innen sowie dokumentarischem Material die Effekte der Globalisierung auf die zeitgenössische Kunstproduktion und -rezeption nachzeichnen. Schwerpunkte sind u.a. Ausstellungen und Darstellungen einer global verstandenen Kunst, ihre Orte (Metropolen, Institutionen) und der globale Kunstmarkt. Teil des Projekts ist außerdem ein Residency Pro gramm für junge Künstler/innen, die sich mit der Globalisierung des Kunstsystems auseinan dersetzen. Sie erhalten die Möglichkeit, ihre Projekte vor Ort weiterzuführen und Formate zu entwickeln, die dem Publikum die ökonomischen und politischen Zusammenhänge verdeutlichen. Geplant sind darüber hinaus ein umfang reiches kunstvermittelndes Programm, Work shops, Diskussionen, Film-Screenings, Perfor mances und Konzerte. Das Konzept der Aus stellung schließt an das Forschungsprojekt Global Art and the Museum an, das seit 2006 am ZKM Karlsruhe angesiedelt ist und ein welt weites Netzwerk von Akteuren und Institutio nen der Kunstwelt umfasst. Nach der Präsenta tion im ZKM Karlsruhe soll die Ausstellung in weiteren internationalen Institutionen gezeigt werden und so den Dialog über das Thema Kunst und Globalisierung fortführen.
Kurator/innen: Peter Weibel, Andrea Buddensieg / Co-Kura tor/innen: Jacob Birken, Antonia Marten / Curatorial Com mittee: N’Goné Fall (FR/SN) , Carol Lu (CN) , Jim Supangkat (ID) , Patrick D. Flores (PH) / Kuratorin für Kunstvermittlung: Hen rike Plegge /Wissenschaftliche Beratung: Hans Belting /Aus stellungsarchitektur: Kuehn Malvezzi mit Samuel Korn / Teilnehmende Künstler/innen (u.a.): AES + F (RU) , Kader Attia (FR) , Yto Barrada (FR/MA) , Guy Ben-Ner (IL) , Tamy Ben-Tor (IL/US) , Ursula Biemann (CH) Zander Blom (ZA) The Blue Noses Group (RU) , Luchezar Boyadjiev (BG) , Ondrej Brody & Kri stofer Paetau (CZ/ FI) , Erik Bünger (SE) , Cai Juan & JJ Xi (UK) , Anetta Mona Chisa & Lucia Tkacova (CZ) , Chto delat? (RU) , Minerva Cuevas (MX) , Pauline Curnier Jardin (FR) , Ala Ebtekar (US) , Nezaket Ekici, Yara El-Sherbini (UK) , Brendan Fernandes (CA) , Meschac Gaba (BJ/NL) , Thierry Geoffroy (DK) , Matthias Gommel, Josh Greene (US) , Antonia Hirsch (CA) , Ashley Hunt (US) , Pieter Hugo (ZA) , Melanie Jackson (UK) , Christian Jankowski, Jompet (ID) Martin Kippenberger
Agung Kurniawan (ID) , Will Kwan (HK/CA) , Marysia Lewan dowska & Neil Cummings (PL/DK) , Liu Ding (CN) , Tirzo Martha (AN) , Gabriele di Matteo (IT) , Pooneh Magazehe (US) , Nástio Mosquito (AO) , Eko Nugroho (ID) , Ni Haifeng (CN/NL) , Mattias Olofsson (SE) Pinky Show (US) Tadej Pogacar (SI) Elodie Pong (CH) , Araya Rasdjarmrearnsook (TH) , RYBN (FR) , Ruth Sacks (ZA) , Sean Snyder (US/RU/JP) , Superflex (DK) , Stephanie Syjuco (US) , Michael Stevenson (NZ) , Mladen Stilinovic (HR) , Tsuy oshi Ozawa (JP) , The Xijing Men (JP/KR/CN) , You Are Here (AUS) / Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe, 17 9 2011 19 2 2012 , Eröffnung am 16 9 2011 /www.zkm.de
sprechen trotz allem erweiterung des videoarchivs am denkmal für die ermordeten juden europas Im Rah men des von der Kulturstiftung des Bundes ge förderten Projektes Leben mit der Erinnerung werden seit 2008 im Berliner HolocaustMahnmal Videoaufzeichnungen von über tau send Interviews mit Überlebenden präsentiert, in denen diese von ihren Erlebnissen vor, wäh rend und nach ihrer Verfolgung durch die Nati onalsozialisten erzählen. Dieses Archiv soll nun um vierzig neue Interviews mit einigen der letz ten Zeitzeugen ergänzt werden, die in den groß en ehemaligen jüdischen Gemeinden Ost- und Ostmitteleuropas den Holocaust überlebt ha ben. Die inhaltliche und technische Durchfüh rung des Projektes orientiert sich an der etablier ten Methodik des Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies der Universität Yale. Unmittelbar nach der Aufnahme werden die Inter views archiviert und in historiografischer, päda gogischer und textanalytischer Hinsicht ausge wertet. Ziel des Archivs ist weniger, Geschichte lückenlos zu dokumentieren, als vielmehr indi viduelle Erfahrungen und Erinnerungen zu vermitteln. Die Interviews stehen allen Interessier ten am Ort der Information zur Verfügung. Wissenschaftliche Leitung: Daniel Baranowski /Kurator/innen: Ruth Oelze, Gaby Zürn, Barbara Kurowska (PL) / Die Inter viewpartner stammen aus jüdischen Gemeinden der Städte Breslau, Czernowitz, Königsberg [Kaliningrad], Kowno [Kaunas], Krakau, Lemberg, Lodz, Prag, Pressburg [Bratis lava] und Riga. / Denkmal für die ermordeten Juden Euro pas, Berlin, 1 7 2011 30 6 2013 / www.stiftung-denkmal.de
wasser straße schiene luft ausstellung zum thema mobilität am bodensee Verkehr und Mobilität stehen thema tisch im Zentrum der Ausstellung, mit der das Zeppelin Museum Friedrichshafen die Verkehrsgeschichte der vergangenen 200 Jahre am Beispiel der Region Bodensee nachzeichnet. Lärmbeläs tigung, ein rasant wachsendes Verkehrsaufkom men und andere negative Begleiterscheinungen der Industrialisierung trübten schon bald die anfängliche Begeisterung für verkehrstechnische Neuerungen. Die Schau untersucht, wie der Fortschritt in unterschiedlichen Epochen die räum lichen und wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Gefüge der Bodenseeregion beeinflusste. An die Seite historischer und technischer Expo nate treten Arbeiten internationaler zeitgenös sischer Künstler/innen, mit denen diese auf die vielfältigen Herausforderungen individueller wie gesellschaftlicher Mobilität reagieren, die in Zeiten beschleunigter Arbeits- und Lebensverhält nisse an Brisanz gewinnen. Mit dieser kulturellen Querschnittsbetrachtung sucht die Ausstel
lung neue Antworten auf die Frage, was Mobili tät für unser Leben bedeutet.
Künstlerische Leitung: Frank-Thorsten Moll /Kurator/innen: Heike Vogel, Barbara Waibel, Jürgen Bleibler, Sabine Mücke /Künstler/innen: Michelle Atherton (GB) Marnix de Nijs (NL) Georg Keller, Andreas Lohrenschat, Bruce Naumann (USA) , Peter Piller, Michael Sailstorfer, Roman Signer (CH) , Hector Zamorá (MEX) u.a. /Zeppelin Museum Friedrichshafen, 20 5 – 11 9 2011, Eröffnung am 19 5 2011 /www.zeppelin-museum.de
bild dir dein volk axel springer und die juden »Das Herbeiführen einer Aussöhnung zwischen Juden und Deutschen« und »die Unterstützung der Lebensrechte des israelischen Volkes« fordert eine der Richtlinien, auf die der Axel Springer Verlag seine Redak teure bei der Vertragsunterzeichnung verpflichtet. Zehn Jahre nach dem Holocaust verschrieb sich Axel Springer (1912 1985), der Herausgeber der BILD -Zeitung, dieser pro-israelischen Haltung. Er parallelisierte die Hoffnung auf eine politische Einheit des jüdischen Volkes mit der Hoffnung auf die politische Einheit Deutschlands und Berlins. Die Berichterstattung in der BILD Zeitung nahm diese Linie auf und wurde als eine der auflagenstärksten Zeitungen Europas zu einer Art Flaggschiff pro-israelischer Politik. Die Ausstellung thematisiert das deutsch-israe lische Verhältnis, wie es sich aus der Perspektive der größten deutschen Boulevard-Zeitung dar stellt. Die BILD -Zeitung hat einen Prozess be schleunigt, so die These der Ausstellung, der bis heute zu den bemerkenswertesten Vorgän gen der deutschen Nachkriegsgeschichte gehört: Die deutsche Bevölkerung, die zwischen 1933 und 1945 die radikalste antisemitische Politik bis hin zur Vernichtung erlebt und betrieben hat, scheint ihre Einstellung gegenüber Juden wider spruchslos zu ändern. Axel Springer war eine Persönlichkeit, die polarisierte. Den 68ern galt er als Inbegriff »faschistischer« Medienmacht. Tatsächlich verpflichtete er sich aber persönlich und in seinem Verlag einem radikalen »Versöh nungsprojekt« Juden und dem jungen israeli schen Staat gegenüber in einer Zeit, als dies von konservativer Seite aus noch hochgradig unpo pulär war. Die Ausstellung versucht, diese faszi nierenden Widersprüche unter dem Begriff Phi losemitismus besser zu verstehen und darzustel len.
Künstlerische Leitung: Dmitrij Belkin (UA/D) / Jüdisches Mu seum Frankfurt am Main, 15 3 2012 29 7 2012 , Internatio nale Konferenz, Museum Judengasse und Goethe-Univer sität Frankfurt am Main: 27 3 2011 28 3 2011 / www.fritzbauer-institut.de
animismus ausstellung, kongress, vermittlungsprogramm Die unter indi genen Völkern verbreitete Religion des Animis mus ist spätestens mit Filmen wie Avatar oder Uncle Bonmee in der Massen- und Po pulärkultur angekommen. Ausgehend von dem gegenwärtig zu beobachtenden Animistic Turn möchten die FU Berlin und das Haus der Kul turen der Welt mit ihrem Projekt Wissenschaft ler mit politischen Akteuren und Künstlern zusammenbringen und erstmals das internationale und interdisziplinäre Interesse am Animismus mit seinen vorrationalen Welterklärungen konzentriert der Öffentlichkeit vorstellen. Die
vorhergehenden, komplementären Ausstellun gen in Antwerpen (2010 ), Bern (2010 ) und Wien (2011) mit ihren je unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten werden 2012 in Deutschland zusammengeführt. Als Modell eines expe rimentellen ›anthropologischen Museums der Moderne‹ stellt die Berliner Schau den Höhe punkt dieses europäischen Gesamtprojektes dar gemeinsam mit dem internationalen Kon gress New Animism , der in die Debatte über das moderne und künftige Weltverständnis ein greift und dabei wissenschaftliche mit Fragestel lungen der Ästhetik verschränkt. Die Ausstel lung ist als Montage aus Dokumenten, Archiv material und künstlerischen Arbeiten konzipiert. Sie greift in thematischen Sektionen Konzepte des Animismus neu auf und sucht Antworten auf Fragen wie: Wo verlaufen die Grenzen zwi schen Natur und Kultur, zwischen Leben und Nicht-Leben? Wie verhalten sich die kulturell verschiedenen Wissens- und Vermittlungsformen zueinander, die dieses Verhältnis bestimmen? Und welche Rolle kommt dem Menschen vor diesem Hintergrund in ökologischen Systemen zu?
Kurator: Anselm Franke /Projektleitung: Irene Albers /Künstler/innen: Bruno Latour (FR) , Philippe Descola (FR) , Eduardo Viveiros de Castro (BR) , Michael Taussig (US) , Esther Leslie (UK) , W.J.T. Mitchell (US) , Erhard Schüttpelz, Martin Zil linger, Gabriele Schwab, Angela Melitopoulos / Maurizio Lazzarato (D/I) , Paulo Tavares (BR) , Ken Jacobs (UK) , Didier Demorcy / Isabel Stengers (BE) , Kobe Mattys / Agency (BE) , Marcel Broodthaers (BE) Hayao Miyzaki (JP) u.a. / Haus der Kulturen der Welt, Berlin, 9 3 .– 6 5 2012 /www.fu-berlin.de
die herrschende ästhetik ist die ästhetik der herrschenden 2011 künstlerkollektive leiten alternative akademien Renovierungsarbeiten im Münchner Kunstverein brachten kürzlich an einer Wand Teile einer Ausstellung zum Vorschein, die sein da maliger Leiter Reiner Kallhardt 1970 realisiert hatte. Kallhardt stellte seinerzeit die Räume Akademiestudenten zur Verfügung, die hier ihrem Protest gegen das überlieferte künstlerische Bil dungssystem Ausdruck gaben, was die vorüber gehende Schließung des Kunstvereins zur Folge hatte. Der Zufallsfund gab den Impuls für das internationale Projekt, das den Titel der gleich namigen Schau von 1970 aufgreift und sich er neut mit Standards der Kunst und der Rolle der Akademie der Bildenden Künste München aus einandersetzt. Der Kunstverein will abermals den Diskurs über die vorherrschenden ästhetischen Bewertungskriterien aufgreifen ein Diskurs, der sich häufig im spannungsreichen Ver hältnis zwischen Kunstverein und solchen Ins titutionen widerspiegelt, die an einer Kanoni sierung im Bereich der Kunst festhalten: Beglei tend zur Ausstellung betreiben fünf Künstler kollektive eine ›alternative Akademie‹, die in öf fentlichen Vorlesungen und Workshops, Semi naren und Performances Kulturschaffenden die Möglichkeit bietet, neu zu definieren, was ange sichts gegenwärtiger Entwicklungen angemessene Formen der künstlerischen Bildung und Pro duktion sein könnten.
Künstlerische Leitung: Bart van der Heide / Kurator/innen: Bart van der Heide, Binna Choi (NL) / Künstler/innen: Elec tric Palm Tree (NL/RP) Grand Opening (USA) Slaws and Tar-
kulturstiftung des bundes magazin 1735
tars (PL/RU) u.a. /Kunstverein München 1 8.– 11 9 2011 /www. kunstverein-muenchen.de
the performing archive ausstellung, live-performances, filmvorfüh rungen, performancearchiv Zentrales Modul des Projektes ist ein mobiles temporäres Archiv, das Werke der internationalen, genderorientierten Performancepraxis der 1960er und 70er Jahre neben aktuellen Positionen dokumentiert. Es umfasst einen ständig wachsenden Fun dus an Bild-, Video- und Printmaterial; darun ter Interviews, Scores und Videoperformances sowie Dokumente zur Produktions- und Rezep tionsgeschichte. Basierend auf dem internatio nalen Netzwerk mehrerer Partnerinstitutionen wird das Performance-Archiv von 2011 bis 2013 an verschiedenen Standorten in Deutschland, Spanien, Kroatien, Polen, Estland und Däne mark auf je unterschiedliche Weise präsentiert und um weitere Module ergänzt: Ausstellungen und Live-Performances, Vorträge, Seminare und Screenings. Neben bisher weniger dokumen tierten regionalen Performancebewegungen z.B. in Süd-, Nord- und Osteuropa sollen dabei auch beispielhaft Positionen aus Lateinamerika und dem arabischen Raum einbezogen werden. Die assoziierten Partnerinstitutionen kooperieren unter anderem mit regionalen Universitäten und Kunsthochschulen in Form von Workshops und Seminaren, um den Dialog mit Wissenschaftlern, Studierenden und Künstler/innen zu befördern und das Archiv um jeweils regionale Beiträge zu erweitern. The Performing Archive wird ausführlich über eine Onlineplattform kommu niziert, ein zweisprachiger Katalog sichert seine langfristige Sichtbarkeit über das Projektende hinaus.
Künstlerische Leitung: Bettina Knaup, Beatrice Ellen Stammer / Künstler/innen: Helena Almeida (PT) , Arahmaiani (RI) , Pauline Boudry / Renate Lorenz, Lilibeth Cuenca (DK) , Dia mela Eltit (RCH) Valie Export (A) Theresa Hak Kyung Cha (ROK) , Sanja Ivekovic (HR) , Lea Lubin (RA) , Teresa Margolles (MX) , Dora Maurer (H) , Marta Minujin (RA) , Ana Mendieta (C) , Tanja Ostojic (SCG) , Ewa Partum (PL) , Adrian Piper (USA) , Ene-Liis Semper (EST) , Mierle Landerman Ukeles (USA) u.a. / Centro Cultural Montehermoso, Vitoria-Gasteiz (E) , 23 9.– 23 12 2012 / Galerija Miroslav Kraljevic, Zagreb (HR) , 10.– 17 2 2012 / Wyspa Institut of Art, Gdansk (PL) , 15.–30 3 2012 / Museum of Contemporary Art, Roskilde (DK) 20 4.– 15 6 2012 / Tallinn Art Hall (EST) 8.– 16 9 2012 / Fundaçio Antoni Tapies, Barcelona (E) 10 10.– 15 12 2012 / Akademie der Künste, Berlin, 10 2 .– 10 4 2013
film und neue medien provokation
der wirklichkeit 50 jahre oberhausener manifest Am 26. Febru ar 1962 unterzeichneten 26 Filmschaffende, dar unter die Regisseure Alexander Kluge, Edgar Reitz und Peter Schamoni, das Oberhausener Manifest. Sie konstatierten darin den Zusam menbruch des alten deutschen Films und forderten die Erneuerung der westdeutschen Filmpro duktion. Die Periode des Oberhausener Mani fests gehört zu den berühmtesten und zugleich am wenigsten bekannten Kapiteln der deutschen Filmgeschichte. Eine systematische Sicherung und Sammlung der filmischen Arbeiten, die die Unterzeichner in ihrer aktivsten Zeit (1958 1967)
hergestellt haben, ist bisher nicht unternommen worden. Zum Teil befindet sich das Material in den Archiven in desolatem Zustand. Die Ver dienste und Irrtümer der damaligen »Provoka teure« sollen wieder sichtbar und zugänglich ge macht werden. Dazu findet ein internationales Symposium an der Universität Wien statt und es entstehen Filmreihen, eine DVD -Edition, eine Buchpublikation und eine Internetplattform. Mit der Premiere einer Dokumentation von Alexander Kluge und einem Empfang der Stadt München soll das Jubiläum des Manifests im Februar 2012 gefeiert werden. Die Filmreihen werden ab April 2012 in Berlin, München, Ober hausen, Wien, im M oMA in New York, auf dem Filmfestival in Pesaro sowie in Goethe-Institu ten weltweit zu sehen sein.
Künstlerische Leitung: Ralph Eue / Kurator: Lars Henrik Gass / Künstler/innen: Christian Doermer, Bernhard Dör ries, Rob Houwer (NL/D) , Alexander Kluge, Pitt Koch, Dieter Lemmel, Ronald Martini, Jason Pohland (F/D) , Edgar Reitz, Peter Schamoni, Haro Senft, Wolfgang Urchs / Filmmuseum München, 28 2 2012 (Premiere) / Internatio nale Kurzfilmtage Oberhausen, Mai 2012 / Kino Arsenal Berlin, Mai 2012 / Österreichisches Filmmuseum Wien, Mai 2012 / Pesaro Film Festival, Juni 2012 / Museum of Modern Art und Goethe-Institut, New York, Juli 2012 / www.kurzfilmtage.de
musik und klang
israel in egypt von der sklaverei zur freiheit Georg Friedrich Händel verarbeitete 1738 in seinem Oratorium Israel in Egypt den Exodus des Volkes Israel aus Ägypten. Die sen alttestamentarischen Stoff, den Thora und Bibel gleichermaßen beschreiben und der auch im Koran anklingt, gestaltet nun Werner Ehr hardt mit seinem interreligiösen Vorhaben in musikalisch breit angelegter Form neu. Das Konzertprojekt verbindet erstmalig Händels Opus mit liturgischer Musik der drei monotheistischen Weltreligionen und Neukompositionen. Exper ten der Barockmusik erarbeiten gemeinsam mit israelischen und Künstlern aus dem arabischmuslimischen Kulturkreis einen neuen Zugang zu Händels Werk. Im konzertanten Dialog wol len sie die bloße Gegenüberstellung musikalischer und inhaltlicher Elemente überwinden und neue Möglichkeiten der interkulturellen Begegnung aufzeigen. Das Stück wird 2011 bei den Händel-Festspielen in Halle und beim international renommierten Israel Fes tival in Jerusalem beides Koproduzenten des Projektes aufgeführt. Künstlerische Leitung: Werner Ehrhardt / Künstler/innen: Yair Dalal (IL) , Yaniv d’Or (IL) , Barockorchester l’arte del mondo, Tölzer Knabenchor / Marktkirche, Händelfest spiele Halle, 5 6 2011 (Uraufführung) /The Jerusalem Cent re for the Performing Arts, 13 6 2011 / Bayer Kulturhaus, Leverkusen, 4 9 2011 /www.lartedelmondo.de
hybride musik für mensch und ma schine Was fasziniert an maschinell er zeugter Musik und was unterscheidet sie von menschlich produzierten Klängen? Das Projekt Hybride Musik geht dieser Frage nach und lässt in einem einzigartigen Mensch-Ma schine-Ensemble das renommierte Kammeren semble Neue Musik Berlin und sechs Solisten auf
sieben Musikmaschinen und zwei Musikinstal lationen des englischen Künstlers Martin Riches treffen, dessen Arbeiten normalerweise in Aus stellungen zu besichtigen bzw. zu hören sind. Während des gemeinsamen Konzertabends kommen Werke zur Aufführung, die eigens für eine solche Besetzung komponiert wurden. Die Komponisten, u.a. Masahiro Miwa (Japan) und Ro bert Pfrengle, behandeln in ihren Stücken die Thematik des Gegenübers von Musik und Tech nologie und die Funktion der Maschinen in der Musik auf je eigene Weise: Teils korrespondie ren die Musiker mit den Maschinen, widerspre chen ihnen oder imitieren gar ihre Eigenschaften und Funktionen. Die Maschinen werden im Gegenzug »humanisiert«, spielen zu schnell oder zu sanft. Der ironische Aspekt dieses Zusammentreffens kulminiert in den Musikmaschinen von Riches, die zwar auf der Automaten-technik des 18. Jahrhunderts beruhen, jedoch durch moderne Computertechnologie gesteuert werden. Als Aufführungsorte wurden die Suntory-Hall, der bedeutendste Konzertsaal Japans, und der neue Saal der Folkwang Univer sität der Künste in Essen gewählt.
Künstlerische Leitung: Dirk Reith / Künstler/innen: Martin Riches (GB) , Masahiro Miwa (JP) , Roland Pfrengle, KNM Ber lin, Günter Steinke, Thomas Neuhaus, Amelia Cuni, Les ley Olson / Suntory-Hall Tokyo, Oktober 2013 / Folkwang Universität der Künste, Essen, November 2013 / www. folkwang-uni.de
moers festival 2011 ornette coleman artist in residence Anlässlich der 40. Ausgabe des alljährlich am Niederrhein stattfin denden Moers Festivals präsentiert der künstle rische Leiter Reiner Michalke 2011 den Musiker und Komponisten Ornette Coleman als Artist in Residence. Bereits seit Jahren laden die Festi valmacher wichtige Künstler der Neuen Impro visierten Musik nach Moers ein besonders Vertreter der avancierten Szenen aus Chicago und New York, aus Tokio oder London. Neben herausragenden Ensembles präsentierten sie immer auch Einzelkünstler, die für die Entwick lung der Improvisierten Musik von zentraler Bedeutung sind. So auch den heute achtzigjährigen Ornette Coleman, einen der einflussreichsten noch lebenden Musiker der Neuen Improvi sierten Musik. Coleman wird mit seinem aktu ellen Ensemble und in verschiedenen anderen Besetzungen auftreten; geplant ist zudem, sein Projekt Song X in veränderter Instrumentie rung weiterzuentwickeln. Von ihrem Artist in Residence-Projekt erwarten sich die Veranstalter einen signifikanten künstlerischen Impuls und gesteigerte internationale Aufmerksamkeit. Künstlerische Leitung: Reiner Michalke / Künstler: Ornette Coleman u.a. / Moers Festival 2011, Festivalzelt, 10.– 12 6 2011 /www.moers-festival.de
kommeno ein weiterer fall von krimi nalität im krieg Der Perkussionist Günter Baby Sommer besuchte 2008 anlässlich eines Konzertes das griechische Dorf Komme no . Dort erfuhr er von seinen Gastgebern, dass die etwa sechshundert Einwohner zählende Ge meinde während des Zweiten Weltkrieges Ziel eines Massakers geworden war, bei dem Solda ten der Deutschen Wehrmacht im August 1943
neue projekte
über dreihundert Zivilisten ermordet hatten. Die Erinnerungen, die ihm die Überlebenden des Massakers schilderten, bilden die Grundlage für das Musikprojekt Kommeno. Zusammen mit vier griechischen Musikern wird Sommer eine CD einspielen, auf der sie Lieder neu arrangie ren, die zu jener Zeit in dem Dorf gesungen wur den. Begleitend dazu erscheint eine dreisprachige Buchpublikation, die mit vielen Originaldo kumenten über das Massaker von Kommeno informiert und auf Lücken in der offiziellen his torischen Aufarbeitung hinweist. Eine interna tionale Konzerttour wird das Programm mit Künstlern aus Griechenland, Deutschland und anderen Ländern auf verschiedenen europäischen Bühnen präsentieren.
Künstlerische Leitung: Günter Baby Sommer / Künstler/in nen: Floros Floridis (GR) , Savina Yannatou (GR) , Eugenios Voulgaris (GR) , Spilios Kastanis (GR) / Marktplatz Kommeno (GR) , 16 8 2012 / Jazzwerkstatt Berlin, 12 10 2012 / Jazz club Neue Tonne, Dresden, 19 3 2011 und 13 10 2012 / Mega ron Mousikis, Tessaloniki, 18 10 2012 / Megaron Mousikis, Athen, 19 10 2012 / Rote Fabrik, Zürich, 21 10 2012 / www. jazzclubtonne.de
singing garden eine konzertinstalla tion Musikalische Schilderungen von Na turphänomenen wie Stürme, Gewitter, Jahres zeiten und Licht sowie das musikalische Nach empfinden und die Reflexion von Natur spielen in der Musikgeschichte eine zentrale Rolle. Eines der bekanntesten Beispiele der europäischen Musiktradition sind die Vier Jahres zeiten von Antonio Vivaldi. Auch in der japa nischen Musik ist die Natur ein Schlüsselthema. Einer der wichtigsten zeitgenössischen Kompo nisten Japans, Toshio Hosokawa, entwickelt mit Singing Garden eine Komposition, in die er Vivaldis Concerti einbindet. Das Konzert, das die barocke italienische mit zeitgenössischer japanischer Musik verbindet, wird aufgeführt von Musikern der renommierten Akademie für Alte Musik. Die Raumkünstlerin Claudia Doderer entwickelt dazu eine visuelle Umsetzung auf der Bühne. Lichtinstallation und musikalische Interpretation lassen das Bild eines Gartens ent stehen.
Künstlerische Leitung: Folkert Uhde und Jeremias Schwarzer /Künstler/innen: Toshio Hosokawa (JP) , Jeremias Schwarzer, Akademie für Alte Musik Berlin, Claudia Doderer / Radialsystem V Berlin, 8 9.– 11 9 2011, Premiere am 8 9 2011 / www.radialsystem.de
cinema jenin a symphony for peace live-vertonung des dokumentarfilms »project cinema jenin«
Im August 2010 öffnete das seit Beginn der ersten Intifada 1987 geschlossene und seither stark beschädigte Kino der Stadt Jenin im Westjordanland wieder seine Tore. Neben zwei weiteren Lichtspielhäusern in Ramallah und Nablus ist es heute das einzige der Öffentlichkeit zugängliche Kino der gesamten Westbank. Die Idee zu seiner Wiederherstellung fasste der Regisseur Marcus Vetter bei den Dreharbeiten zu seiner viel fach ausgezeichneten Dokumentation Heart of Jenin . Gemeinsam mit Ismail Khativ initi ierte er den Wiederaufbau und begleitete die fol genden Arbeiten bis zur Neueröffnung mit sei ner Kamera. Aus diesem Material entsteht der
zeit die Dokumentation Cinema Jenin . Ihre Uraufführung im Herbst 2011 werden die Dresd ner Sinfoniker unter der Leitung von Andrea Molino live vor Ort musikalisch begleiten. Dazu bilden sie gemeinsam mit israelisch-palästinen sischen Musikern ein internationales Orchester, das im Rahmen einer anschließenden Tournee weitere Konzerte in Ramallah, Haifa und Jerusa lem geben wird. Vor der offiziellen Urauffüh rung findet im Berliner Radialsystem V die öf fentliche Vorpremiere unter Begleitung der Dres dner Sinfoniker statt. Zum offiziellen Kinostart des Films in Europa wird das Orchester erneut mit dem Film auf Tournee gehen.
Künstlerische Leitung: Andrea Molino (CH) / Künstler/innen: Marc Sinan, Torsten Rasch, Dresdner Sinfoniker / www. dresdner-sinfoniker.de
jazz lines münchen 2011 festival für neue und improvisierte musik Jazz Lines München fand nach siebenjähriger Pause erstmals wieder im Jahr 2009 statt. Mit sei nem Fokus auf zeitgenössische und grenzüber schreitende Positionen des Jazz nimmt es in der Münchner Musiklandschaft seitdem wieder eine wichtige Stellung ein. Im Jahr 2011 unternimmt das Festival einen Brückenschlag zu Bildender Kunst, Literatur und Film. Ein Schwerpunkt wird die musikalische Interpretation von Film und Fotokunst sein: Der amerikanische Gitar rist Bill Frisell erarbeitet ein Programm zur Fo tokunst Michael Disfarmers, einem der großen amerikanischen Dokumentarfotografen; und der Saxophonist Francesco Bearzatti widmet der Fotografin und Femme fatale der 1920er Jah re, Tina Modotti, eine Hommage. Das Schwei zer Ensemble Koy vertont einen Stummfilm von Ernst Lubitsch und der französische Bassist Renaud Garcia-Fonds komponiert die Musik zu einem Scherenschnittfilm von Lotte Reiniger. Eingeladen sind außerdem Musiker und Ensembles, deren Arbeiten den Grenzbereich zwischen Jazz und Neuer Musik ausloten. So wird Beat Furrer ein Programm mit dem Münchner Kammerorchester entwickeln, das improvi sierte und Neue Musik zusammenführt.
Künstlerische Leitung: Annelie Knoblauch / Künstler/innen: Bill Frisell Quartet (USA) , Fred Frith (GB) , Louis Sclavis (F) , Ralph Towner / Paolo Fresu (USA/I) , Francesco Bearzatti
Tinissima Quartet (I) , Yitzak Yedid Quintet (ISR) , Münchner
Kammerorchester unter der Leitung von Beat Furrer (AT) Bruno Chevillon (F) Michael Riessler Bojan Z (F) Renaud
Garcia Fonds Ensemble (F) , Gunter Hampel, Kimmo Pohjonen (FIN) , Karl Ritter (A) , Les 1000 Cris (F) , Trygve Seim Ensemble (N) u.a. / Münchner Volkstheater, Schwere Reiter, Glyptothek, Allerheiligenkirchhof, Muffathalle Mün chen, 27 3 .– 3 4 2011 / www.kulturkontor.org
bühne und bewegung
impulse internationales off-theater festival Das Festival Impulse ausgerich tet vom NRW Kultursekretariat hat sich seit 1990 zu einem der bundesweit wichtigsten Tref fen freier Theater aus Deutschland, Österreich und der Schweiz entwickelt. Es gilt als Pendant des Berliner Theatertreffens das ebenfalls von der Kulturstiftung gefördert wird in der Off-Szene. Unter der Leitung von Tom Stromberg und Matthias von Hartz präsentiert
eine Werkschau ausgewählte Inszenierungen, Installationen und Performances an Theaterhäu sern in Bochum, Düsseldorf, Köln und Mülheim an der Ruhr. Das Festival zeigt Produkti onen, die für die Eigenart und impulsgebende Kraft der freien Szene stehen. Neue Ansätze, das Aufgreifen aktueller Themen und Kreativi tät im Umgang mit theatralen Formen sind ent scheidend für die Auswahl. Die interessanteste Aufführung wird von der Impulse -Jury ausge zeichnet und tourt anschließend unter anderem zum Berliner Theatertreffen und zu den Wiener Festwochen. 2011 richten die Veranstal ter das Festival erstmals im Sommer aus, um so verstärkt den öffentlichen Raum für ihre Auf führungen nutzen zu können. Darüber hinaus erweitern sie das internationale Kuratorenpro gramm und ergänzen es um ein Stipendiaten programm für junge Kuratoren und Festivalma cher.
Künstlerische Leitung: Tom Stromberg, Matthias von Harz / Prinzregenttheater Bochum, Forum Freies Theater Düssel dorf, Studiobühne Köln, Ringlokschuppen Mülheim an der Ruhr, 21 6.– 11 7 2011 / www.festivalimpulse.de
narziss / fritzl musiktheater-auffüh rung Narziss / Fritzl besteht aus zwei thematisch miteinander verbundenen, musika lisch jedoch voneinander unabhängigen KurzOperetten. Der erste Teil widmet sich der Figur des Narziss aus der griechischen Mythologie. Der zweite Teil nimmt die Fäden des Inzestdramas um den Österreicher Josef Fritzl aus Amstetten auf. Der kanadische Sänger, Pianist und Kom ponist Chilly Gonzales ist bekannt als Musiker, der sich zwischen verschiedenen Genres Pop, Klassik, Chanson, Cabaret oder Hip-Hop bewegt. Er schreibt die Musik und das Libretto der Kurz-Operetten und wird auch als Musiker und Sänger auf der Bühne stehen. In Narziss / Fritzl verbindet Gonzales den klassischen Korpus der Operette mit Minimal Musik und Pop. Für diese musikalische Grenzüberschrei tung steht auch die Besetzung der weiblichen Hauptrollen mit Ikonen der Pop- und Folkmu sik wie Peaches und Leslie Feist. Die Sängerin und Performancekünstlerin Peaches über nimmt die weiblichen Hauptrollen in der FritzlOperette, die kanadische Sängerin Leslie Feist steht als Nymphe Echo im Narziss-Drama auf der Bühne. Unter der Regie von Sebastian Baumgarten sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Erzählungen zur Darstellung kommen.
Künstlerische Leitung: Matthias Lilienthal / Mit: Chilly Gonzales (CA) (Komposition) , Sebastian Baumgarten (Re gie) , Joel Gibb (CA) , Peaches (CA) , Leslie Feist (CA) (Gesang) / Hebbel am Ufer Berlin ( HAU 1), 26.– 30 9 2011 /www.hebbelam-ufer.de
art into theatre II performance nach den nullerjahren Zum Festival Art into Theatre lädt das HAU sechs bildende Künstler ein, performative Formate zu ent wickeln, die an allen drei Spielstätten des HAU und zum Teil im Berliner Stadtraum aufgeführt werden. Für die radikalen Akteure der Perfor mancekunst aus den 1960er und 70er Jahren be ginnt gerade so die These der Veranstalter die Phase ihrer musealen Retrospektiven. Dank
großer Werkschauen werden die damaligen Ak tionen als kompaktes künstlerisches Erbe sicht bar. Demgegenüber versucht eine jüngere Ge neration von bildenden Künstlern, die Perfor mancekunst unter gegenwärtigen Vorzeichen neu zu definieren. Den ausgewählten Künstler/ innen ist gemeinsam, dass sie mit Video- und Audio-Aufzeichnungen und dem Rekurs auf den Körper in seiner mediatisierten Form spie lerisch umgehen. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeiten ist die Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum: So wird Pawel Althamer ei nen Monat lang in einem fahrenden Wagen der Berliner U -Bahn leben und dabei einen öffent lichen Raum künstlerisch privatisieren. Für das Festival kooperiert das HAU mit der weltweit einzigen Performancekunst-Biennale Perfor ma , die 2011 zum vierten Mal in New York statt finden wird.
Künstlerische Leitung: Matthias Lilienthal / Künstler/innen: Keren Cytter (IL) , Nevin Aladag, Phil Collins (GB) , Ari Benja min Meyers (USA) , Dominique Gonzales-Foerster (FR) , Pawel Althamer (PL) / Hebbel am Ufer Berlin ( HAU 1 3 ), 20.–30 10 2011 / www.hebbel-am-ufer.de
magic fonds theaterprojekt über das rätselhafte verschwinden des kapitals Das Deutsche Theater Berlin und das Theater Basel erarbeiten mit Jugendlichen aus beiden Städten eine Inszenierung über den Zusammenhang von Magie und Geld: Wie erhält ein Stück Papier einen Wert und verliert ihn wieder? Was macht das Geld auf meinem Konto oder als Aktie und wie kann Geld im Ver lauf von Bankenpleiten oder in Spekulations blasen verschwinden? Mit diesem Projekt geht es vor allem darum, die Erklärungen einer Ge neration, die keine Alternative zum globalisier ten Kapitalismus erlebt hat, in Szene zu setzen. Die 16 - bis 19 -Jährigen sind bei diesem Thema die Experten, ihr Blick und ihre Fragestellungen im Hinblick auf unseren Umgang mit Geld und die Erschütterungen der Finanzkrise sind maß geblich für die Entwicklung des Stückes. Die Perspektiven der Jugendlichen aus dem ver meintlich wohlhabenden Basel und dem »ar men« Berlin sollen sich bei diesem Projekt er gänzen. Nach einer umfangreichen Rechercheund Probephase in Berlin und Basel werden die Ergebnisse der Zusammenarbeit in beiden Städ ten präsentiert.
Künstlerische Leitung: Tobias Rausch Birgit Lengers Mar tin Frank (CH) / Künstler/innen: Eva Gruner, Jelka Plate, Matthias Herrmann, Tobias Graf, Ulrich Rausch, Sechs Jugendliche aus Basel (CH) , Sechs Jugendliche aus Berlin / Deutsches Theater Berlin (Box & Bar), 28 4.– 10 6 2011, Pre miere am 28 4 2011 / Theater Basel (Kleines Haus), 19 6.–12 7 2011, Basel-Premiere am 21 6 2011 / www.jungesdt.de
F.I.N.D.11 festival für internationale dramatik zum thema glaube und reli gion Das Festival Internationale Neue Dramatik F.I.N.D. der Schaubühne Berlin leistet seit seiner Gründung im Jahr 2000 einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der inter nationalen Theaterbeziehungen. Mit einer Neuausrichtung möchte das Festival in seiner elften Ausgabe speziell die Nachwuchsförderung auf diesem Gebiet voranbringen. Wie in den Jahren zuvor werden internationale Autoren, Regis-
seure und Schauspieler während der zehntägigen Veranstaltung ihre zeitgenössischen Stücke in Gastspielen, Uraufführungen, Studioinszenierungen und Autorenprojekten vorstellen oder neue Stücke entwickeln. Erstmalig werden dar über hinaus fünfzig Schauspiel- und Regiestu denten aus verschiedenen Ländern eingeladen. In Masterclasses begegnen sie den Künstlern des Festivals und beschäftigen sich in Szenenstudien, Analysen und Diskussionen mit der aktu ellen internationalen Dramatik. Schwerpunkt des F.I.N.D.11 ist Glaube und Religion. Damit greift die Schaubühne ein Thema auf, das derzeit viele internationale Künstler beschäftigt. Zu den eingeladenen Gastspielen zählen unter anderen Noli me tangere von JeanFrancois Sivadier und Schukschins Er zählungen von Alvis Hermanis. Die israeli sche Regisseurin Yael Ronen wird ihre aktuelle Produktion Science Fiction & Religion im Rahmen eines Workshops vorstellen, und der spanische Regisseur Rodrigo Garcia ist eingela den, zusammen mit Schauspielern der Schau bühne ein Stück zu Glaube, Aberglaube und den Sünden der Menschheit zu entwickeln. Künstlerische Leitung: Thomas Ostermeier / Künstler/innen: Cilla Back (FIN) , Rodrigo García (RA) , Ofira Henig (IL) , Alvis Hermanis (LV) , Wajdi Mouawad (CA) , Yael Ronen (IL) , Kirill Serebrennikov (RUS) , Jean-François Sivadier (F) und fünfzig internationale Schauspiel- und Regiestudierende aus Deutschland, Frankreich und Russland / Schaubühne am Lehniner Platz, Berlin, 3 .– 13 3 2011 / www.schaubuehne.de
dark was the night szene für zwölf musiker, zwei blinde guides und pu blikum Das Projekt untersucht die Rezeption von Musik in der Dunkelheit und platziert dazu die Zuhörer in einen dunklen Raum. Auf Reso nanzkörpern liegend hören sie Musiker, die im Raum verteilt spielen und sich dabei horizontal oder vertikal bewegen. Die Zuhörer können we der die Position der Klangquellen sehend veror ten, noch mit den Augen erkennen, welches Ins trument erklingen wird. Der optisch erzeugten Erwartungshaltung beraubt, müssen sie sich ganz auf das unmittelbare Hören und die kör perliche Klangerfahrung verlassen. Da im ›blin den‹ Zustand nur fest positionierte Klangquel len als Raum konstituierend erfahren werden können, wird durch die Bewegung spielender Ensembles der materielle Raum aufgelöst und durch den akustischen Raum überschrieben. Das Geleit der Besucher übernehmen blinde Guides dieser Rollentausch soll die Dominanz des Visuellen zusätzlich hinterfragen. Die Regisseu rin Sabrina Hölzer arbeitet für das Projekt mit zwölf Streichern des Instrumentalensembles Kaleidoskop zusammen. Zur Aufführung gebracht werden sowohl Werke internationaler zeitge nössischer Komponisten wie Sánchez-Verdú, Sciarrino, Hosokawa oder Xenakis als auch Kompositionen vergangener Epochen. Eigens für das Projekt werden zusätzlich Neukomposi tionen beauftragt, die mit Bewegung, Bewegungswechsel, Stimm- und Klangsprüngen oder der Übergabe von Motiven und Klängen arbeiten. Neben Aufführungen in Berlin und Salzburg sind weitere Konzerte weltweit geplant, für die eine mobile Rauminstallation geschaffen wer den soll.
Künstlerische Leitung: Sabrina Hölzer / Künstler/innen: La dislav Zajac (SK) , Solistenensemble Kaleidoskop. Mit Wer ken von: Sánchez-Verdú (ES) , Salvatore Sciarrino (IT) , Peteris Vasks (LV) , Lachenmann, Xenakis (GR) , Hosokawa (J) , Blind Willie Johnson (USA) Qu Xiao-song (CH) Marcelo Toledo (RA) / Sophiensaele Berlin oder Funkhaus Nalepastraße, Berlin, 12 .– 16 12 2012 / Rainberghalle, Salzburg (A) , 8.– 11 3 2013 / www.zeitgenoessische-oper.de
tanz im internet digitaler tanzatlas und werkedition Choreografen aus Deutschland haben in den vergangenen Jahrzehnten die internationale Entwicklung des zeitgenössischen Tanzes maßgeblich beeinflusst. Doch trotz weltweit bekannter Künstlerpersön lichkeiten wie etwa Mary Wigman, Dore Hoyer, William Forsythe oder Pina Bausch ist der mo derne Tanz in Deutschland eine Kunstsparte mit wenig erschlossener Geschichte und nur be grenzter öffentlicher Sichtbarkeit. Das Projekt hat sich das Ziel gesetzt, ein zeitgemäßes Inter net-Angebot für den Tanz zu entwickeln, das es bisher in Deutschland nicht gibt. Es soll vor allem historische Film- und Videoaufnahmen zum Tanz umfassen. Das zum Teil über mehre re Archive und Institutionen verteilte Material soll in einer zentralen Internetplattform erschlossen werden und öffentlich zugänglich sein. Da zu müssen Urheberrechte geklärt, das Material muss digitalisiert und zum Teil auch restauriert werden. Für die Entwicklung einer geeigneten Datenbank kann sich das Projekt auf einen Pro totyp stützen, der von Tanzplan Deutsch land , einem Initiativprojekt der Kulturstiftung des Bundes, entwickelt worden ist. Nach einer dreijährigen Implementierungsphase soll das Angebot unter Trägerschaft der Akademie der Künste in Zusammenarbeit mit anderen Institutio nen und Archiven fortgeführt werden.
Leitung: Franz Anton Cramer, Caroline Rehberg / Start des Internetauftritts am 15 9 2011 / www.adk.de
neunmal kleist interdisziplinäre reihe zu kleists briefen Anlässlich des 200. Todestages Heinrich von Kleists im Jahr 2011 konfron tiert das interdisziplinäre Projekt Biografie und Briefwechsel des Dichters mit einer Auswahl seiner literarischen Werke. Ein begehbares Büh nenbild führt die literarische mit der biogra fischen Welt zusammen und dient als Rahmen für eine Collage aus Briefen und Filmen, Vor trägen und doku-fiktionalen Gesprächen. So debattieren beispielsweise ein Psychologe und ein Medizinethiker mit Kleists Freundin Hen riette Vogel und anderen Figuren aus seiner Bio grafie über den Selbstmord des Dichters. In die ser theatralen Installation werden seine Briefe gelesen, vertont und inszeniert, thematisch un terteilt in drei Staffeln Kriege, Konzepte und Katastrophen zu insgesamt neun Modulen. Wissenschaftler erörtern in Diskussionsrunden gemeinsam mit Kulturschaffenden und Journa listen die Frage nach der Aktualität der Schriften Kleists.
Kuratorin: Miriam Sachs / Künstler/innen: Silke Wiegand, Eva van Heijningen (NL) , Angelina Kartsaki (GR) , Fritzi Ha berlandt, Miriam Sachs, Eva Jankovsky (AT) , Claudia Oberleitner (AT) , Leo Solter, Dieter Mann, Jürgen Ruoff, György Pongracz (HU) , Stephane Lalloz (FR) , Michel Keller (AT) , Lars Rudolph + Mariahilff Giorgos Kyriakakis (GR) Justin Le-
pany (FR) / Experten: Angelika Vaskinevitch (RU) , Wolf Kittler (USA) , Alexander Weigel, Günther Emig, Jens Bisky, Alex ander Opitz, Wolfgang Schmidbauer, Wolfgang de Bruyn und Bernd Heinrich von Kleist / Nach den Veranstaltun gen Neunmal Kleist in Berlin wird das Projekt unter dem Motto Unterwegs an verschiedenen Orten in Europa zu sehen sein. / Reihe Neunmal Kleist: Heinrich-BöllStiftung, Berlin, 30 4.– 2 5 2011 (Voraufführungen: Theaterkapelle, Berlin, 22 .– 24 4 2011). Theaterkapelle Berlin, 27./ 28 8. und im September 2011. Berlin (Ort noch unbekannt), 8./9 10 2011 / Reihe Unterwegs: Kleist-Archiv Sembdner, Heilbronn 25 1 2011. Theater Pygmalion, Wien, 24.– 26 2 2011. Deutsch-Russisches Haus, Kaliningrad 12 5 2011. Sek tionssaal des Universitätsklinikums Eppendorf, Hamburg 20 6 2011. Cantiere Internazionale d‘Arte, Montepulciano, 29 7 2011. Trickfilmpremiere Schlossmuseum, Thun, 19 8 2011 / www.theaterkapelle.de
keloglan in alamania oder die versöhnung von schwein und lamm Ke loglan zu Deutsch: der kahlköpfige Junge ist eine berühmte anatolische Märchenfigur. Emine Özdamar verlegt den Märchenstoff ins heutige Berlin und lässt den Witz und die schel mische List türkischer Volksmärchen auf Shakespeares Dramen treffen: Keloglan, der als kleines Kind mit seiner Mutter aus der Türkei nach Berlin kam, ist ohne Schulabschluss, arbeitslos und unverheiratet. Mit der Volljährigkeit erlischt seine Aufenthaltsgenehmigung. Er muss also entweder Arbeit finden oder eine Deutsche heiraten, sonst wird er in sein vermeintliches Heimatland abgeschoben, das er kaum kennt. In der Nacht vor seinem 18. Geburtstag beginnt Keloglans mythische Irrfahrt, er trifft auf Poli zisten, Räuber und Trolle, und im Shakespeare schen Sinne werden Alltagsrealität und Fantasie eins. Der Stoff wird vom Regisseur Michael Ro nen mit seinem Künstlerkollektiv Conflict Zone Arts Asylum ( CZAA ) als Open-Air-Stück in szeniert, das auf dem Naunynplatz in Kreuz berg als Sommertheater aufgeführt wird. Durch die Inszenierung im öffentlichen Raum wollen das Ballhaus Naunynstraße und das Künstler kollektiv CZAA eine breitere Öffentlichkeit mit den Themen erreichen, die vor Ort akut sind. Begleitend soll ein Theaterworkshop für Schü ler stattfinden, der die Möglichkeit bietet, eige ne ›keloglaneske‹ Erlebnisse auf die Bühne zu bringen.
Künstlerische Leitung: Michael Ronen (IL) / Künstler/innen: Emine Sevgi Özdamar (TR) Daniel Kahn (USA) Oktay Özde mir, Tuncay Kulaoglu (TR) u.a. / Ballhaus Naunynstraße, Berlin, 30 6.– 10 7 2011 / www.conflictzonetheatre.com
performing music vier strategien zur verbindung von musik und performance Konzerte, Liederabende und Musik theater finden immer öfter Eingang in die Thea terspielpläne. Im Gegenzug greifen Musiker und Bands zunehmend auf theatrale Mittel zurück, um ihre Auftritte aufzuwerten und als Live-Er lebnis zu inszenieren. Das Projekt Perfor ming Music stellt solche genreüberschrei tenden Arbeiten in den Mittelpunkt und zeigt vier herausragende internationale Konzepte für einen neuartigen Umgang mit Musik in Perfor mance, Theater und Choreografie. Den Auftakt bildet Delusion von Laurie Anderson, seit den 1970ern eine Ikone der Performance-Kunst
und Sound Art. Angelegt als eine Serie kurzer Plays kombiniert Anderson in ihrem Stück Violine, elektronisches Puppenspiel, Musik und Visuals zu einer bilderreichen und poetischen Sprache. Der Choreograf Xavier le Roy unter nimmt eine Neuinterpretation der Sixteen Dances (John Cage, 1951) ursprünglich ei ne Auftragsarbeit von Merce Cunningham für vier Tänzer mit einem zehnköpfigen Kam merensemble des NDR . Weiterhin entwickeln der amerikanische Theaterminimalist Richard Maxwell und die Schweizer Autorin Laura de Weck Stücke an der Schnittstelle von Theater, Konzert und Performance.
Künstlerische Leitung: Amelie Deuflhard / Künstler/innen: Laurie Anderson (USA) , Laura de Weck (CH) , Xavier le Roy (FR) , Richard Maxwell (USA) / Kampnagel Hamburg; (Delusion), 20.– 21 5 2011, (Neutral Hero), 20.– 22 5 2011, (John Cage, Sixteen Dances), 23 .–25 9 2011, (Sprachkonzert), 17.–19 11 2011 / www.kampnagel.de
jury
Der Jury, die über die Förderprojekte be riet, gehörten folgende Mitglieder an: Dr. Marion Ackermann, Direktorin k20k21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen / Dr. Jörg Bong, Programmgeschäftsführer S. Fischer Verlag Frankfurt / Prof. Dr. Gabriele Brandstetter, Professorin für Theaterwissenschaft mit Schwerpunkt Tanzwissen schaft FU Berlin / Dr. Simone Eick, Direktorin Deutsches Auswandererhaus Bremerhaven / Dr. Meret Forster, Musikredakteurin Bayerischer Rundfunk München / Dr. Ulrike Lorenz, Direktorin Kunsthalle Mannheim / Dr. Bert Noglik, Autor, Journalist, künstlerischer Leiter von Jazzfestivals und Konzertreihen / Wilfried Schulz, Intendant Staatsschauspiel Dresden / Hanns Zischler, Filmschauspieler, Publizist
gremien
stiftungsrat Der Stiftungsrat trifft die Leitentschei dungen für die inhaltliche Ausrichtung, insbesondere die Schwerpunkte der Förderung und die Struktur der Kultur stiftung. Der aus 14 Mitgliedern bestehende Stiftungsrat spiegelt die bei der Errichtung der Stiftung maßgebenden Ebenen der politischen Willensbildung wider. Die Amts zeit der Mitglieder des Stiftungsrates beträgt fünf Jahre.
Bernd Neumann
Vorsitzender des Stiftungsrates für das Auswärtige Amt für das Bundesministerium der Finanzen für den Deutschen Bundestag
als Vertreter der Länder als Vertreter der Kommunen als Vorsitzender des Stiftungsrates der Kulturstiftung der Länder als Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur
Staatsminister bei der Bundeskanzlerin und Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien Cornelia Pieper Staatsministerin
Steffen Kampeter
Parlamentarischer Staatssekretär Prof. Dr. Norbert Lammert Bundestagspräsident Dr. h.c. Wolfgang Thierse Bundestagsvizepräsident Hans-Joachim Otto Parlamentarischer Staatssekretär Dr. Valentin Gramlich Staatssekretär, Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt Walter Schumacher Staatssekretär, Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur des Landes Pheinland-Pfalz Klaus Hebborn Beigeordneter für Bildung, Kultur und Sport, Deutscher Städtetag Uwe Lübking Beigeordneter, Deutscher Städte- und Gemeindebund
Prof. Dr. Wolfgang Böhmer Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt Senta Berger Schauspielerin Durs Grünbein Autor
Prof. Dr. Dr. h.c. Wolf Lepenies Soziologe
stiftungsbeirat Der Stiftungsbeirat gibt Empfeh lungen zu den inhaltlichen Schwerpunkten der Stiftungs tätigkeit. In ihm sind Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik vertreten.
Prof. Dr. Clemens Börsig
Vorsitzender des Kulturkreises der Deutschen Wirtschaft im BDI e.V. Jens Cording Präsident der Gesellschaft für Neue Musik e.V.
Prof. Martin Maria Krüger Präsident des Deutschen Musikrats Prof. Dr. h.c. Klaus-Dieter Lehmann Präsident des Goethe-Instituts Isabel Pfeiffer-Poensgen Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder Dr. Volker Rodekamp Präsident des Deutschen Museumsbundes e.V. Dr. Dorothea Rüland Generalsekretärin des DAAD Dr. Georg Ruppelt Vizepräsident des Deutschen Kulturrats e.V. Prof. Dr. Oliver Scheytt Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. Johano Strasser Präsident des P E N. Deutschland Frank Werneke Stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft ver.di e.V. Prof. Klaus Zehelein Präsident des Deutschen Bühnenvereins e.V.
jurys und kuratorien Rund 50 Experten aus Wis senschaft, Forschung und Kunst beraten die Kulturstif tung des Bundes in verschiedenen fach- und themenspezi fischen Jurys und Kuratorien. Weitere Informationen zu diesen Gremien finden Sie auf unserer Website unter www. kulturstiftung-bund.de bei den entsprechenden Projekten.
vorstand team
Hortensia Völckers
Künstlerische Direktorin Alexander Farenholtz Verwaltungsdirektor Sekretariate Beatrix Kluge / Beate Ollesch [Büro Berlin ] / Christine Werner
Referent des Vorstands
Dr. Lutz Nitsche Justitiariat / Vertragsabteilung Dr. Ferdinand von Saint André [ Justitiar] / Doris Heise / Anja Petzold / Katja Storm Kommunikation Friederike Tappe-Hornbostel [Leitung ] / Tinatin Eppmann / Diana Keppler / Julia Mai / Christoph Sauerbrey / Arite Studier
Förderung und Programme Kirsten Haß [Leitung ] Allgemeine Projektförderung Torsten Maß [Leitung ] / Bärbel Hejkal / Steffi Khazhueva Wissenschaftliche Mitarbeit Dr. Ulrike Gropp / Teresa Jahn / Anne Maase / Annett Meineke / Uta Schnell / Friederike Zobel / Ines Deák / Marcel Gärtner / Kristin Salomon / Kristin Schulz Projektprüfung Andreas Heimann [Leitung ] / Berit Koch / Kristin Madalinski / Fabian Märtin / Antje Wagner / Barbara Weiß Verwaltung Steffen Schille [Leitung ] / Margit Ducke / Maik Jacob / Steffen Rothe
Herausgeber Kulturstiftung des Bundes / Franckeplatz 1 / 06110 Halle an der Saale /Tel 0345 2997 0 /Fax 0345 2997 333 /info@kulturstiftung-bund.de /www.kulturstiftung-bund.de Vorstand Hortensia Völckers / Alexander Farenholtz [verantwortlich für den Inhalt] Redaktion Friederike Tappe-Hornbostel Redaktionelle Mitarbeit Christoph Sauerbrey Gestaltung cyan Berlin / Tinatin Eppmann Herstellung hausstætter Redaktionsschluss 31 1 2011 Auflage dt. 26.000 / engl. 4.000 Bildnachweis © Antje Schiffers
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbe dingt die Meinung der Redaktion wieder. © Kulturstiftung des Bundes alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung insgesamt oder in Teilen ist nur zulässig nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Kulturstiftung des Bundes.


a Rodophiala rodholirion Baker [Amarillidaceae] b wahrscheinlich Tristagma sp. [Alliaceae] c Olsynium junceum [E.Mey. Ex C.Presl] Goldblatt [Iridaceae]




a b
c
