
There are a lot of good people around.
Wir lieben den SÜSSEN NACHGESCHMACK schöner Zeiten.


There are a lot of good people around.
Wir lieben den SÜSSEN NACHGESCHMACK schöner Zeiten.

Er erweckt Puppen zum Leben, begeistert Menschen als Kunstpfeifer und wirkte schon in unzähligen großen Theater- und Opernhäusern im deutschsprachigen Raum als Regisseur. Wie viel Kultur kann eigentlich in einer Person stecken? Ein Gespräch zwischen einem Bühnen- und einem Brotverliebten.

 Wenn Nikolaus Habjan mit seinen Klappmaulpuppen großes Theater macht, entwickeln sie schnell ein Eigenleben.
Wenn Nikolaus Habjan mit seinen Klappmaulpuppen großes Theater macht, entwickeln sie schnell ein Eigenleben.
Als Nikolaus Habjan vier Jahre alt war, bemerkte seine Grazer Kindergartentante Gabi, dass der kleine, energiegeladene Bub offensichtlich großes Interesse für klassische Musik zeigte. „Gehn’s doch einmal in die Oper mit ihm“, schlug sie seinen Eltern vor. Und bald darauf fand sich Nikolaus zum ersten Mal auf der Publikumsseite vor dem großen roten Bühnenvorhang wieder. Was sich wohl dahinter befand? Nach der sechsminütigen Ouvertüre von Mozarts Zauberflöte öffnete sich der Vorhang für Nikolaus. Und er hat sich nie wieder geschlossen. In der Brasserie im Palmenhaus beim Wiener Burggarten trifft der Mann, der die Klappmaulpuppen wieder in aller Munde gebracht hat, auf den, der dasselbe mit dem Natursauerteigbrot unternommen hat. Inmitten geschichtsträchtiger Architektur und exotischer Pflanzen beginnt ein Gespräch darüber, was Theater sein soll, welche Werte auch künftig eine Rolle spielen werden, wie man Puppen beseelt und Menschen begeistert.
MARTIN AUER Als ich mich mit deiner Person auseinandergesetzt habe, war ich direkt überwältigt. Du führst Regie, du bist Schauspieler, du bist Kunstpfeifer und verschreibst dich seit vielen Jahren dem Puppenspiel. Das ist so vielfältig! Wie bist du zu dem geworden, der du heute bist?
NIKOLAUS HABJAN Ich würde mich gar nicht als so vielfältig bezeichnen. Alles, was ich mache, geht auf die Bühne – da läuft alles sehr spitz zusammen. Entwickelt hat sich das so, dass mich meine Eltern einfach immer machen haben lassen. Die haben gemerkt, dass ich bei gewissen Dingen ruhig geworden bin. Ich war ein etwas nervöses Kind, und wenn zum Beispiel Opernmusik gelaufen ist, war ich entspannt. Mit zehn wollte ich schon Opernregisseur werden, und später kamen dann die Puppen dazu. Und das Theater.
MARTIN AUER Du warst sehr jung Direktor des Wiener Schuberttheaters. Das Theater ist deine große Leidenschaft geworden.
NIKOLAUS HABJAN Ja, das stimmt. Wobei ich aktuell ein großes Problem mit dem Theater an sich habe. Ich finde, da gibt es eine riesige überaufgeregte Stimmung. Normalerweise sollte das Theater von Diskussion geprägt sein. Von unterschiedlichen Meinungen, von Respekt. Genau so, wie Demokratie eigentlich funktionieren sollte. Jetzt ist es sowohl im Theater wie auch in Politik und Gesellschaft so, dass man entweder für etwas oder gegen etwas sein muss. Es gibt keine respektvollen Schattierungen mehr.
MARTIN AUER Ein Schwarz-Weiß-Denken! Wie meinst du das in Bezug auf das Theater?
NIKOLAUS HABJAN Für mich ist die Bühne ein Ort, an dem alles erlaubt sein muss. Ich muss auch Kontroverses zeigen. Und nun wird gerade ernsthaft diskutiert, ob Schauspiel kul-
turelle Aneignung sei. Natürlich ist es das, und das ist ja auch der Sinn der Sache! Irritation ist wichtig. Ich gehe ja nicht ins Theater, um die Realität zu sehen. Theater ist eine Verarbeitung der Realität. Und diese Verarbeitung braucht man, um einen kathartischen Moment erleben, und das auf die eigene Realität anwenden zu können.
MARTIN AUER Das bringt eben der Zeitgeist mit sich. Es ist ein neu verstandener Pluralismus, dem man generell fast überall begegnet. Warum im Theater stärker als in der Oper?
NIKOLAUS HABJAN Im Theater ist einfach viel mehr Raum für Diskussion, die aber immer mehr zu einer Leerdiskussion wird. Man muss entweder so sein oder so, es gibt kein Dazwischen. Und dann ist da auch noch eine so große Wehleidigkeit. In der Oper geht es mehr ums Handwerk. Das macht es für mich wesentlich geerdeter. Im Theater sollte man eigentlich gegen Schubladisierung und Klischees kämpfen, macht aber genau das Gegenteil. Das Wichtigste ist doch, dass Menschen miteinander und nebeneinander leben können – sie sollen so sein dürfen, wie sie sind. Ich tue mir einfach schwer mit der genauen Kategorisierung von Menschen und Themen.
MARTIN AUER Letztendlich geht es immer um Menschen. Das ist ja auch bei uns so. Wir sind ein gewachsenes Unternehmen mit 750 Kolleginnen und Kollegen. Wie geht man miteinander um? Das sind komplexe Fragestellungen, die sich da aufdrängen. In den letzten Jahren war es eine der schönsten Aufgaben, darüber nachzudenken: Wie arbeiten wir zusammen? Wie kann man das Beste für alle herausholen? Die Essenz aus diesem Kulturprozess haben wir auf einer Karte zusammengeschrieben. Da geht’s auch ganz viel um Begeisterungsfähigkeit.
NIKOLAUS HABJA N Begeisterungsfähigkeit, das ist ein ganz schönes Wort. Ich bin ja Kunstpfeifer und liebe es einfach, Menschen für die Oper zu begeistern, die damit noch nichts zu tun hatten!
MARTIN AUER Ja, das glaube ich. Für mich ist das auch so. Kolleg:innen für ihre Arbeit zu begeistern und Kund:innen für das, was wir tun – das mache ich aus Leidenschaft.
NIKOLAUS HABJAN Das ist meine Definition von Reichtum. Zu arbeiten, ohne dass es sich wie Arbeit anfühlt. Mir geht es auch so. Erst dann macht’s Spaß.
MARTIN AUER Apropos Spaß. Was ich auch bewundere bei dir, ist dein Humor, der immer mitschwingt.
NIKOLAUS HABJAN Ohne Humor möchte und kann ich gar nicht sein. Humor ist bei den schwierigsten Themen wichtig. Mein wichtigstes Werk, das ich bereits mehr als 600 Mal aufgeführt habe, ist ein Puppentheater über das Leben von Friedrich

Zawrel: „F. Zawrel – erbbiologisch und sozial minderwertig“. Er war ein Opfer der „Kinder-Euthanasie“ und musste auch darüber hinaus so einiges miterleben. Dabei war er einer der lustigsten Menschen, die ich jemals kennenlernen durfte. Sein Humor war komplett entwaffnend. Ein absolut wirksames Werkzeug im Kampf gegen seine Traumata.

MARTIN AUER Hatte er keine Angst, an seine Vergangenheit erinnert zu werden?
NIKOLAUS HABJAN Ganz im Gegenteil. Er musste an sie erinnert werden und von seinen Erfahrungen erzählen, damit er mit ihnen klarkommen konnte. Damit hat sein Martyrium Sinn gemacht.
MARTIN AUER Wenn man die Puppe sieht, die ihn darstellt, hat man das Gefühl, sie wäre am Leben. Du baust die Puppen ja alle selbst. Wo hast du das gelernt?
NIKOLAUS HABJAN Das ist alles ein großes Experiment. Ich habe viel herumprobiert, viel verbessert, mit vielen Materialien gearbeitet. Das Leben kommt meistens mit den Augen –und natürlich mit der Stimme. Es ist wunderbar, Puppen zu erschaffen. Wenn ich als Regisseur arbeite und mit Menschen etwas inszeniere, dann muss ich mit den Menschen eine Figur erschaffen. Wenn ich mit Puppen arbeite, dann sitze ich hier und kann genau das umsetzen, was ich mir vorstelle. Ich kann mit mir selbst in den Dialog treten. Und was die Puppen sagen, das ist mir manchmal richtig peinlich, aber sie entwickeln ihr eigenes Wesen.
MARTIN AUER Apropos Dialog – was du mit deiner Stimme machst, ist extrem beeindruckend.
NIKOLAUS HABJAN Ich liebe Sprache! Manchmal sitze ich in der U-Bahn oder im Café und höre einfach zu. Über Stimmmelodien und Dialekte kann man schon viel über den Charakter von Menschen herausfinden. Wenn ich Stimmen imitiere, dann sind manche sofort da und manche brauchen etwas länger.
MARTIN AUER Als Jugendlicher hat mir der Herr Karl vom Qualtinger gut gefallen. Früher kannte ich nur die Schallplatte und wusste gar nicht, dass es auch ein Stück davon gibt – einen einstündigen Monolog!
NIKOLAUS HABJAN Im Keller! Ich spiele den Herrn Karl ja auch. Wie der Qualtinger ihn wiedergegeben hat, ist faszinierend. Was er mit seinem Gesicht tut! Für mich ist er einer der größten Schauspieler überhaupt. Und was ich am Herrn Karl liebe, ist die Irritation, die ich meinte. Er hat den nettesten Plauderton und man hört ihm so gerne zu. Aber wenn man darauf achtet, was er sagt, dann wird einem schlecht. Sein Humor ist wie eine Injektionsnadel, die eine Botschaft transportiert.
MARTIN AUER Und du erweckst den Herrn Karl mit einer Puppe wieder zum Leben.
NIKOLAUS HABJAN Ja, es passt einfach hervorragend. Die Behauptung ist die stärkste Kraft des Theaters. Durch die Behauptung kommt die Magie. Und das Puppentheater ist noch eine Stufe darüber. Zu behaupten, dass ein totes Objekt ein selbstständiges Wesen ist, ist die größte Illusion.
MARTIN AUER Unsere Welt ist eben nicht logisch, sondern psychologisch.
NIKOLAUS HABJAN Eine Puppe benutzt man als Projektionsfläche. Jede:r empfindet eine Puppe komplett anders. Das war immer schon so.
MARTIN AUER In unserem Magazin beschäftigen wir uns mit Nostalgie in all ihren Facetten. Was ist deine Meinung zur Aussage „Früher war alles besser“?

NIKOLAUS HABJAN Das ist vollkommener Blödsinn. Die Gesellschaft war immer im Wandel. Es gibt Menschen, die aufhören, an der Welt teilzunehmen. Dann denkt man darüber nach, wie schön es war, in der Straßenbahn zu sitzen. In die neue steigt man aber nicht mehr ein, weil man nicht weiß, wohin sie fährt. Ich kenne eine 100-jährige Frau, die ist total offen und junggeblieben. Es kommt immer darauf an, wie weit man zurückdenkt. Und wie man damit umgeht.
MARTIN AUER Wach, aufgeschlossen und interessiert zu sein und das auch zu bleiben, hilft.
NIKOLAUS HABJAN Und man kann auf jeden Fall anerkennen, dass sich ganz viel verbessert hat. Das Leben vor 150 Jahren war geprägt von drei Dingen: Hunger, Krankheit und Krieg. Da wundert es nicht, dass Menschen früher so gläubig waren. Natürlich hat sich da einiges getan seit damals. Für Frauen, für Minderheiten.
MARTIN AUER Ausruhen darf man sich aber trotzdem nicht. Darauf muss man achten.
NIKOLAUS HABJAN Nein, und man soll irritieren. Der Liedermacher Georg Kreisler hat einmal gesagt „Wenn dir eine Menge zujubelt, freu dich nicht, sondern schau zuerst, wer dir zujubelt.“ Ich ziehe gern den Zorn der Menschen auf mich und betrachte das als Bestätigung. Wenn man irritiert und das Publikum zum Nachdenken anregt, dann kann man auch ein Umdenken herbeiführen.
MARTIN AUER Ja, das läuft wohl in den meisten Organisationen so ähnlich ab. Neue Ideen irritieren und erscheinen oft verrückt. Es kommt schon auch immer wieder vor, dass ich höre, „Der Martin spinnt“.
NIKOLAUS HABJAN Das Spinnen, das ist wundervoll, das sag ich immer. Einstein sagte schon, dass eine Idee nichts taugt, wenn sie nicht zuerst als verrückt abgetan wird. Das ist es, was auch das Theater leisten sollte.
MARTIN AUER Das gilt wohl für alles, das etwas in Bewegung setzen soll. Lasst uns doch alle weiterspinnen. Lieber Nikolaus, vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Wir sehen uns bestimmt bei einem deiner nächsten Auftritte!
Was Unternehmertum und Kultur gemeinsam haben, ist der Wunsch, die Dinge anders anzugehen.„Ohne Humor möchte und kann ich gar nicht sein.
Humor ist bei den schwierigsten Themen wichtig.“


Eine Hommage an unser Stammhaus.
Der Dietrichsteinplatz war für viele Jahrzehnte unser Zuhause. In der verwinkelten Backstube, die 1346 zum ersten Mal urkundlich als solche erwähnt wurde, haben wir uns mehr als nur wohl gefühlt. Doch irgendwann sind wir dort an unsere Grenzen gestoßen und haben der Seele des Brotes mit unserem ATELIER MARTIN AUER am St.-Peter-Gürtel eine neue Heimat geschenkt. Unser Stammhaus haben wir nun zu unserer wohl geschichtsträchtigsten Filiale umgebaut.

„Oh, wie viele Erinnerungen an diesem Haus hängen“, sagt Martin. Ganz klar, für ihn war das Gebäude mit der Adresse Dietrichsteinplatz 13 nicht nur der Arbeitsplatz seiner Eltern, sondern auch sein erstes Zuhause. Im ersten Stock wurde gewohnt, im Erdgeschoß wurde gebacken, verwaltet, verkauft und auch die Filiale am Hauptplatz wurde von hier aus beliefert. In der Backstube selbst hat sich Martin in seiner Kindheit nicht oft aufgehalten, was vor allem an seiner Roggenmehlallergie lag. Das Interesse und die Leidenschaft für das Backen kamen erst später. Um dann für immer zu bleiben.


Gut festhalten, nun reisen wir noch weiter in die Vergangenheit: Der Historiker Walter Brunner hat sich schon in den frühen Neunzigern auf die Suche nach den Ursprüngen der Backstube gemacht. Beim Durchwühlen und Entstauben alter Archive und Dokumente stellte er fest, dass an dieser Adresse bereits seit 1346 gebacken wurde. Ein gewisser „Wolfger der Peche“ – „Peche“ heißt nichts anderes als Bäcker – hatte damals in der Nähe eines Stegs über den Grazbach seine Backstube eröffnet. Und damit den Grundstein für eine Backtradition, die fast 700 Jahre andauern sollte, gelegt. Hätte er geahnt, wie es mit seinem Laden einmal weitergehen sollte, wäre er bestimmt stolz gewesen. Schade, dass wir den Kollegen nicht mehr zu einer Führung in unser Atelier einladen können. Die nächsten 342 Jahre wurde fleißig weitergebacken, und seit 1688 ist die Bäckerei auch in den offiziellen Registern auffindbar. Martin Auer IV, Martins Großvater, gründete seine Bäckerei 1936 in Marburg und zog 1944 nach Graz. Der Zufall wollte es, dass er sich am Dietrichsteinplatz niederlassen konnte. Fortan war die Backstube in Familienhand. Danke, lieber Zufall.
1964 verstarb Martin Auer IV ganz plötzlich, und Martin Auer V – heute bekannt als Martin Auer senior – musste sein Erbe mit nur 20 Jahren antreten. Als Student der Rechtswissenschaften hat er sich zuvor eigentlich mehr mit Paragraphen als mit Brot beschäftigt. Und schon bald wurde ihm bewusst, dass sich ein Jus-Studium und eine Bäckerei nicht vereinen ließen. So tauschte er die Kodizes gegen ein Studium des Natursauerteigs ein und war in Graz fortan als „der studierte Bäck“ bekannt.
Schon Martin Auer senior wollte die Dinge unbedingt neu denken und besonders machen. Nicht nur, dass er ein ehemaliges Pelzmodengeschäft am Grazer Hauptplatz für horrendes Geld anmietete, um dort 1974 die erste MARTIN AUERFiliale zu eröffnen. Nein, ihm war es auch ein Dorn oder besser gesagt: ein Brösel im Auge, dass so gut wie alle Bäckereien mit industriellem Kunstsauerteig arbeiteten. Brot war damals
mehr ein Überlebensmittel als ein Genussprodukt – es musste günstig, schnell und einfach herstellbar sein und hauptsächlich satt machen. Quantität über Qualität. Das wollte der „studierte Bäck“ so nicht stehen lassen. Einige Tage auf einem Bauernhof lösten in ihm etwas aus: Die Bäuerin tischte ihm selbst gebackenes Natursauerteigbrot aus Roggenmehl auf – Kunstsauerteig hatte es glücklicherweise nicht bis auf die Alm geschafft. Das Brot war innen weich, außen knusprig und schmeckte auch nach zehn Tagen noch richtig gut. Durch langes Backen bildete sich eine starke Kruste, die den Geschmack bewahrte und dem Brot eine längere Frischhaltung garantierte, weil so viel mehr Feuchtigkeit im Brot blieb und beim Backen nicht verdunstete. Martin Auer senior war verliebt. Und hatte nun eine Mission: dieses Natursauerteigbrot nach Graz zu bringen.
In der Backstube am Dietrichsteinplatz wurde fortan getüftelt, ausprobiert und optimiert. Tage und Nächte, Wochen und Monate. Martin Auer senior wollte etwas Besonderes schaffen, das dem Brot, das er auf der Alm kennengelernt hatte, so nahe wie möglich kam. Und so begann er, die Rezeptur zusammen mit seinen Bäcker:innen immer weiter zu überarbeiten. „Er wollte immer noch etwas mehr Wasser ins Brot hineinbringen, so lange, bis es nicht noch mehr aufnehmen konnte“, erzählt Martin heute. Skeptische Kolleg:innen meinten in der Backstube schon „Herr Auer, wenn wir es so machen, wie Sie sagen, dann müssen wir das Brot aufdressieren“ – doch er blieb bei seinem Plan. Und dann war er da: der erste Landbrotlaib. Anfangs verkaufte er sich noch nicht so gut, doch als Martin Auer senior begann, das Brot offen in den Regalen auszustellen – davor hatten die Brote wie allgemein üblich erst beim Kauf ihren großen Auftritt –, standen die Grazer:innen Schlange, sodass schon bald ein zweiter Ofen angeschafft werden musste. Mit dem Landbrotlaib aus Natursauerteig ging ein neues Kapitel in der Geschichte von MARTIN AUER los: Er machte das Unternehmen bekannt und beliebt. Auch über die Grenzen der Stadt hinaus.
Generationenwechsel
2011 kaufte Martin Auer junior seinem Vater das Unternehmen gemeinsam mit Barbara ab. Seither wurden viele Filialen umgebaut und neu eröffnet. Was Martin relativ bald änderte: Er hörte damit auf, Supermärkte mit seinem Brot zu beliefern. Bäckereien standen damals unter massivem Druck, den Mengenanforderungen und Preisvorstellungen des Einzelhandels gerecht zu werden. Der qualitätsverliebte Martin wollte sich jedoch nichts vorschreiben lassen und mit kreativen Lösungen aufzeigen, was Bäckerei alles sein kann. Nämlich nicht nur ein Ort für das Produzieren von Sattmachern und den schnellen Einkauf, sondern ein Wohlfühlort zum Verweilen und Genießen. Das Herz des Unternehmens blieb der Dietrichsteinplatz. Verwinkelt und erfüllt von viel Leben und Leidenschaft für das Handwerk. Lieb gewonnen von Mitarbeiter:innen und Kund:innen gleichermaßen. Trotzdem wurde irgendwann der Platz zu knapp.

„Das Herz des Unternehmens blieb der Dietrichsteinplatz.“
Die Entscheidung, den Dietrichsteinplatz nicht mehr als Unternehmenszentrum und Backstube weiterzunutzen, war keine einfache. „Uns ging’s dabei nicht darum, größer werden zu können. Wir wollen immer noch besser werden, in allem, was wir tun“, erklärt Martin. „Wir brauchten vor allem auch mehr Platz zur Kühlung. Damit wir unseren Teigen unter optimalen Bedingungen noch mehr Zeit geben können, sich zu entwickeln. Und um unser Handwerk von der Nacht in den Tag zu holen, damit wir auch in Zukunft viele tolle Kolleg:innen dafür begeistern können.“
Wenn man schon so einen einzigartigen, geschichtsträchtigen Standort aufgibt, dann darf es keinesfalls in einer funktionalen Blechhalle am Stadtrand weitergehen. „Wir wollten etwas ganz Besonderes daraus machen – und mit unserem Atelier ist uns das gut gelungen, denke ich“, sagt Martin. Das Atelier ist ein Arbeitsplatz für Kreative. Hell und geräumig, nachhaltig und offen. Gäste können nun direkt beim Backen zusehen, während sie sich im Café durch die Sortenvielfalt kosten. Ohne Glasabtrennung versteht sich, damit man Bäckerei spüren, sehen, schmecken und riechen kann. „Das alles hat eine völlig neue Energie“, so Martin, „eine, die nicht plötzlich hier im Atelier entstanden ist, sondern eine, die am Dietrichsteinplatz in all den Jahrzehnten immer weitergewachsen ist.“ Ah ja, apropos riechen: Eine eigene Kaffeerösterei gibt’s hier im Atelier nun auch. Dafür wäre am Dietrichsteinplatz auch kein Platz gewesen.
Und wer es noch nicht weiß: Das Stammhaus am Dietrichsteinplatz steht nun natürlich nicht leer. Gebacken wird hier zwar nicht mehr, aber die Liebe zu Brot und die Gastfreundschaft leben weiter – in einer ganz besonderen Filiale. Neue Elemente, spannende Materialien und Möbel mit Charakter unterstreichen den Charme des alten Gebäudes. Hier findet man unter anderem alte Exemplare der Stadthallenstühle von Roland Rainer, französische Zinnplatten und Fliesen wie in den U-Bahn-Stationen New Yorks. Und den Gästen wird viel Platz geboten. Zum Sitzen, zum Tratschen, zum Genießen. Drinnen und draußen. Denn dass man hier gerne Zeit verbringt, das haben seit 1346 schon so einige bewiesen.


„Uns ging’s dabei nicht darum, größer werden zu können. Wir wollen immer noch besser werden, in allem, was wir tun.“
Wenn diese Mauern sprechen könnten, hätten sie viel zu erzählen: Fast 700 Jahre wurde hier gebacken, verkauft, verwaltet und gelebt. Wer sich heute hier niederlässt, bleibt auch gern mal länger sitzen.

Es reicht die Koalition von Brot und Butter, um Bürgermeisterin Elke Kahr gut in den Tag starten zu lassen. Darum haben wir sie auch mit unserem bio Holzofen Bauernlaib im Gepäck besucht, um uns mit ihr über Brot zu unterhalten. Und über die Erinnerungen, die es weckt. Früher war es ihre Mutter, die sie und ihre Freund:innen in der Siedlung immer mit liebevoll belegten Broten versorgt hat. Damit sie vor lauter Spielen das Essen nicht vergessen. Heute ist es ihr Partner Franz, der sich morgens um ihre Stärkung kümmert, bevor es ins Rathaus geht. Wenn Elke nicht gerade an der Spitze der Stadt steht, dann leitet sie die eigene Küche. Denn für viele Menschen zu kochen, macht ihr große Freude. Dabei darf eines auf dem Tisch nie fehlen: Brot. Denn das, sagt sie, sei einfach „unverzichtbar“.
 Auf ein Brot mit Elke Kahr
Auf ein Brot mit Elke Kahr
Wer sich im Rahmen unserer Backstagetour Einblicke in unsere Backstube verschafft, kann sie neuerdings bewundern: die simplen Illustrationen von Emi Ueoka, die auf unseren Glasschiebetüren mit sanften Linien große Geschichten erzählen. Wir haben uns mit ihr unterhalten: über Brot, ihre Art zu zeichnen und Inspirierendes aus ihrem Alltag.
Emi Ueoka ist in ihrem Leben schon viel herumgekommen: In Japan, in der Karibik und in England hat sie schon gelebt – niedergelassen hat sie sich vor zehn Jahren jedoch im australischen Melbourne, wo sie seitdem professionell den Stift schwingt und mit ihren Illustrationen die ganze Welt begeistert. Ihre Arbeit bewundern und verfolgen wir schon lange, nun konnten wir endlich eine Australia-Austria-Connection aufbauen.
Emi ist – so sagt sie selbst – keine Frau der großen Worte, viel lieber lässt sie ihre Zeichnungen für sich sprechen. Und das tun sie in unvergleichlicher Genauigkeit. Und zwar, indem sie das Wesentliche abbilden. Inspiration sammelt Emi Ueoka draußen in der Welt. Sie begegnet Menschen, beobachtet Situationen und skizziert besondere Momente, die ihr Interesse

wecken. Das können Schulkinder sein, deren schwere Taschen fast so groß sind wie sie selbst. Eine Frau, die gedankenverloren aus dem Fenster blickt. Oder ein Bäcker, der gerade stolz sein Brot aus dem Ofen holt. Ebendieser und viele weitere Motive finden sich nun auf den Glasschiebetüren in unserer Backstube wieder.
Auch wenn Emi nicht um die halbe Welt zu uns nach Graz reisen konnte, um die Atmosphäre in unserer Backstube aufzusaugen, so entstanden in ihrem Kopf dank ausführlicher Erzählungen, Fotos und Videos doch lebendige Bilder. „Ich habe mich richtig in die Bäcker:innen hineingefühlt und davon geträumt, wie es wohl sein muss, hier zu arbeiten“, erzählt sie und fügt noch hinzu, dass ihr das gar nicht schwerfiel. Denn wenn sie an gutes Brot denkt, dann kommt die Inspiration
ganz von selbst. Gutes Brot, das ist für sie im Übrigen nicht nur Inspirationsquelle, sondern steht auch für das Wesentliche, das wir zum Überleben und Glücklichsein brauchen. Darum passt es auch so gut zu Emi Ueokas Arbeit, deren Illustrationen von charmantem Minimalismus geprägt sind. Mit nur wenigen, präzise gezogenen Linien gestaltet sie eindrucksvolle Erzählungen. „Ich möchte das Wesen von Menschen und Momenten in ihrer Essenz einfangen“, sagt sie. Dafür reichen Konturen vollkommen aus. Denn die lenken nicht ab.
Emis Werke erinnern uns daran, dass wahre Schönheit oft in der Reduktion liegt. Denn – und das trifft auf ihre wie auch auf unsere Arbeit zu – es kommt nicht auf die Anzahl der Zutaten an, sondern vielmehr auf das Handwerk und die Leidenschaft, die dahinterstecken.

Wenn man sie mit Mehl, Salz, Liebe und Geschick vermischt, lässt sie großartige, köstliche Dinge entstehen.
Wir haben sie zwar rund um die Uhr, aber irgendwie doch nie genug davon. Eine kurze Geschichte über die Zeit.
Wann ist eigentlich Zeit?
Die Antwort können wir gleich vorausschicken: Zeit ist immer. Zumindest seit dem Urknall. Sie ist ein Konstrukt, das immer untrennbar mit dem Raum zusammenhängt. Was Albert Einstein in seiner Relativitätstheorie Raum-Zeit-Kontinuum genannt hat, lässt sich so erklären: Wir leben in einer vierdimensionalen Struktur – dem einfacher zu fassenden dreidimensionalen Raum und der eindimensionalen Zeit. Fällt eine Dimension weg, sind wir alle ein bisschen aufgeschmissen. Ein Beispiel: Alleine würden weder der Vorschlag „Treffen wir uns am Freitag um 14 Uhr“ noch „Treffen wir uns bei MARTIN AUER am Hauptplatz“ dazu führen, dass ein erstes Date erfolgreich stattfinden kann. Die Liebesgeschichte be-
ginnt erst mit der Abmachung „Treffen wir uns am Freitag um 14 Uhr bei MARTIN AUER am Hauptplatz“. Vorausgesetzt, dass die Lovebirds auch die Koordinaten unserer Filiale kennen. Aber vielleicht hilft ja auch der Duft von frisch gebackenem Brot beim Navigieren – immer der Nase nach, sozusagen.
Die ganze Sache mit dem Raum-Zeit-Kontinuum spielt aber auch erst seit einem monumentalen Ereignis, das alles veränderte, eine Rolle. Oder besser gesagt: das dafür sorgte, dass es überhaupt etwas gab, das sich verändern konnte. Reisen wir also einmal ganz weit zurück. Dorthin, wo die Zeit ihren Ursprung findet.
Wenn man nicht aufpasst, rinnt sie einem durch die Finger. Wenn man noch so viel Stärke aufbringt, kann man sie nicht aufhalten.
Keine Planeten, keine Sonne, keine Dinosaurier, keine Menschen, keine Hundewelpen, keine Brunch-Hotspots, keine amüsanten Brot-Wortspiele, keinen MARTIN AUER – bis zum Urknall gab es nach dem aktuellen Stand unseres Wissens gar nichts. Und damit auch keine Zeit. Warum das so ist? Weil etwas existieren muss, damit es gemessen werden kann. Das ist gleichermaßen philosophisch wie auch physikalisch erklärbar: Die Naturwissenschaft beschreibt den Begriff Zeit als „zunehmende Unordnung“. Und wie man aus jedem Kinderzimmer der Welt weiß, ist Unordnung unvermeidbar. „Zeit geht nicht spurlos an einem vorüber“, sagt ein Sprichwort und meint: Die Haare werden grau, und die Staubschicht auf dem obersten Regal des Wohnzimmerschranks wächst. Unordnung macht die Zeit spür-, sicht- und messbar für uns alle, weil sie immer stattfindet und immer zunimmt. Und das tut sie seit ungefähr 13,8 Milliarden Jahren. Seit der Urknall den Startschuss für unser Universum gegeben hat, vergeht die Zeit. Und scheint dabei ihr Tempo zu erhöhen, möchte man meinen.
Viele Menschen haben den Eindruck, dass die Zeit immer schneller vergeht. Vor allem jene, die in ihren Haupttätigkeiten Routine entwickelt haben. Wenn unser Alltag aus derselben Abfolge derselben Dinge besteht – aufstehen, frühstücken, arbeiten, einkaufen, zu Abend essen, lesen, fernsehen, schlafen – dann prägt sich unser Gehirn diesen Ablauf schon so ein, dass kaum mehr Aufmerksamkeit gefordert ist. Und weniger Aufmerksamkeit bedeutet gleichermaßen, weniger im Moment präsent zu sein, wodurch wir im Großen und Ganzen empfinden, dass die Zeit verfliegt: Tage, Wochen, Monate und Jahre sind gefühlt im Nu vorüber. Im Kleinen jedoch trifft nicht selten das Gegenteil zu: Wird man bei einer Tätigkeit nicht gefordert oder mag sie einfach nicht, dann sehnt man in der Regel ihr Ende herbei. Und die Zeit, die scheint sich dann zu ziehen wie Kaugummi. Es stellt sich eine buchstäbliche Langeweile ein. So kann es also sein, dass uns manche Stunden wie Tage und Tage wie Wochen vorkommen, während der Abstand zwischen zwei „Prosit-Neujahr“-Rufen gefühlt immer kleiner wird.

Zeit ist eben komplex und Zeitwahrnehmung eine höchst subjektive Angelegenheit, weshalb sie sich nicht in eindeutige Regeln zwängen lässt. Ganz klar lässt sich aber sagen: Um uns die Zeit zur Freundin zu machen, können wir uns –wie so oft – Kinder zum Vorbild nehmen. Denn ihr Leben ist

Zeit für noch mehr Fakten
Als Albert Einstein sich mit Zeit und Raum beschäftigte, erkannte er auch, dass die Zeit schneller vergeht, wenn die Schwerkraft größer ist. Lebt man 80 Jahre lang im 10. Stock, ist man um 90 Milliardstel einer Sekunde älter als jemand, der dieselbe Zeit im Erdgeschoß verbringt.
Dinosaurier mussten länger auf ihren Geburtstag warten als wir heute. Denn vor 70 Millionen Jahren vergingen in jenem Zeitraum, in dem die Erde einmal komplett die Sonne umrundete, etwa fünf Tage mehr als heute. Grund dafür ist die Gezeitenreibung der Sonne und des Mondes, die die Rotation der Erde beeinflusst.

Die wohl berühmteste Darstellung der Zeit stammt von Salvador Dalí: In seinem Werk „Die Beständigkeit der Erinnerung” lässt er Uhren vor schroffen Felsen dahinschmelzen. Angeblich inspiriert von geschmolzenem Camembert.

Nach der Quantentheorie ist das kleinstmögliche Zeitintervall die Planck-Zeit. Sie ist 0,000000000 000000000000000000000000 0000000001 Sekunden lang.
In Literatur und Film liebt man Zeitreisen. Von H. G. Wells’ „Die Zeitmaschine” bis zum kultigen Mehrteiler „Zurück in die Zukunft” aus den Achtzigern. Dabei hat Stephen Hawking sogar einmal bewiesen, dass es keine Zeitreisenden gibt. Indem er eine Party für sie veranstaltet hat – und die Einladungen dafür erst nach der Feier veröffentlicht hat. Gekommen ist niemand.

Vor dem Urknall hatte niemand Zeit.
von Neugierde und emotionalen Lernprozessen geprägt. Zeit wird nicht mit Aufgaben oder Stress in Verbindung gebracht, sondern misst sich in Vorfreude auf Ereignisse und vollkommener Präsenz, wenn diese dann eintreten.
Vor der Einführung der ersten Mainstream-Uhr, der Räderuhr, um 1300 orientierten sich die Menschen am natürlichen Verlauf von Tag und Nacht – der Sonnenaufgang galt als Start in den Tag. Statt dem Wecker krähte höchstens der Hahn, später erklangen Kirchenglocken. Heute können wir uns gar nicht mehr vorstellen, den Tag so zu leben, wie die Natur ihn uns vorgibt. Bei Sonnenaufgang bereits im Meetingraum sitzen, zum After-Work schon im Pyjama, um bei Sonnenuntergang direkt einschlafen zu können. Bei Regen alles liegen und stehen lassen und schnell rauslaufen, um zu duschen. Eine amüsante Vorstellung, aber kaum umsetzbar.
Tipps für einen bewussteren Umgang mit unserem wohl wertvollsten Gut, der Zeit:
Zeitfresser ade – Bewusst Prioritäten setzen, damit wir die verfügbare Zeit mit dem verbringen können, was uns wirklich wichtig ist. Heißt auch, sich bei Gegenteiligem zu „trauen“, einmal „Nein“ zu sagen.


Die Teige für unseren bio Franciscus und unser bio Italienisches Landbrot gehen fast 24 Stunden lang. Das sorgt für die besonders saftige Krume und macht die Weizenbrote nicht nur köstlich, sondern auch sehr bekömmlich.
Eine der ältesten Sauerteigkulturen der Welt kommt aus Kanada und ist 120 Jahre alt. Nicht schlecht für etwas, das nur einige Tage braucht, um zum Leben zu erwachen.
Rekordzeit: Nur knapp 3 Sekunden brauchen unsere HandkaiserKaiser:innen, um eine Semmel zu formen. Zugegeben: Die Vorlaufzeit für diese Leistung erfordert jahrelange Übung.
Me - Time – Erholung und Reflexion in den Tagesablauf integrieren, um die eigenen Akkus aufzuladen. Das kann ein Telefonat mit einem Lieblingsmenschen sein, das SichGönnen eines Stücks Schokoladenkuchen oder das Lieblingslied auf Anschlag dreimal hintereinander abzuspielen und mitzutanzen.
Zeit für Abenteuer – Mehr Abwechslung in den Alltag einbauen, indem man aus Routinen ausbricht. Ein spontanes Abendessen mit Freund:innen, ein ausgedehntes Bad statt einer schnellen Dusche, unter der Woche einfach so eine Nacht im Hotel verbringen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Wir wissen aus eigener Erfahrung: Manches ist unpackbar, aber so gut wie nichts ist unbackbar. Das hat sich bestätigt, als wir einen Blick in den fernen Norden geworfen haben. Denn dort, im tiefsten Finnland, gibt es in Brot gebackenen Fisch, der seit vielen Jahrzehnten als traditioneller To-go-Snack genossen wird.
Eine Empfehlung für Fischverliebte!
Kalakukko. So heißt das gute Ding, das man in der Region Savo, etwa zwei Autostunden nördlich von Helsinki, seit bald 100 Jahren aus dem Backrohr fischt. Und das fast im wahrsten Sinne des Wortes. Im Herzen dieses besonderen Roggenbrotes wartet nämlich eine Überraschung: Fisch aus der Region, vorrangig Barsch oder Maräne, und – als wäre das noch nicht genug – Speck sowie Schweinefleisch. Die Bäckerei Hanna Partanen aus Kuopio, einer Stadt mit etwa 120.000 Einwohner:innen, gilt als Urheberin der nordischen Spezialität. Das Kalakukko hat man dort im Laufe der Zeit perfektioniert. Auch wenn’s immer noch fast so schmeckt wie damals, zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Früher einmal war das Fischbrot die Mahlzeit für Arbeiter:innen, die auf den Feldern und in den Wäldern gearbeitet haben. Man konnte es einfach einpacken und mitnehmen, und bis heute schätzt man seine Haltbarkeit: Der feine Roggenteig schließt die würzige Füllung luftdicht ein und bewahrt Saftigkeit und Aroma. So schmeckt es bei gekühlter Lagerung auch nach zwei Wochen noch wie am ersten Tag. Viele Finn:innen kaufen ihr Kalakukko daher gleich auf Vorrat und können sich lange über den heimischen Bio-Leckerbissen freuen. Getrunken wird dazu im Übrigen traditionellerweise Buttermilch.
Der Name Kalakukko setzt sich aus zwei finnischen Wörtern zusammen: „Kala“ steht für Fisch, „kukko“ für Hahn. Und auch wenn das Gericht inhaltlich nichts mit einem Hahn zu tun hat, war es die optische Ähnlichkeit mit einem Hühnerbraten, aufgrund derer man dem properen Laib Roggenbrot mit glatter Kruste den Namen „Fischhahn“ verlieh.
Die viele Arbeit sieht man dem Kalakukko von außen nicht an – die Zubereitung erfordert Fingerfertigkeit, Geduld und Routine. Angeblich dauert es Monate, bis man das Fischbacken heraus hat. Und wenn man’s dann einmal kann, dann muss man das Kalakukko je nach Größe bis zu acht Stunden backen, bis der Fisch gar und das Brot knusprig ist. Gut, dass es noch einige wenige Bäcker:innen in Finnland gibt, die diese wertvolle Backtradition bis heute fortsetzen. Notiz an uns: Vielleicht sollte sich ja in Österreich auch einmal jemand dieser speziellen Kunst annehmen.


„Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können“. Das hat der deutsche Schriftsteller Jean Paul einmal gesagt. Und damit hat er auch ein bisschen recht, finden wir. Denn Erinnerungen kann uns eben niemand nehmen. Das kann Vorteile, aber auch Nachteile haben: Erinnerungen sind vielfältig und hängen bleiben besonders die sehr guten und die sehr schlechten. Nostalgische Gefühle wecken vor allem erstere. Der Geruch eines alten Parfums, das Oma immer an Festtagen getragen hat. Ein wiederentdeckter alter Song von der abgegriffenen Bravo-Hits-CD, den man als Teenager auf und ab gehört hat. Ein Stapel Fotos vom ersten Adria-Urlaub, bei dem das Auto am Autogrill-Parkplatz liegen geblieben ist. Ein Spaziergang im Wald, vorbei an der geheimen Höhle, in die man zusammen mit den Kindern aus der Nachbarschaft als Mutprobe hineingeklettert ist. All das weckt einen Hauch von Sehnsucht in uns. Wie schön damals alles war! Wie sorgenlos wir waren! Wie frei! Wie … wie sehr verklären wir denn eigentlich diese Erinnerungen? Gehen wir der Sache einmal auf den Grund.
Nostalgie ist eine Emotion, die uns auf eine Reise in die eigene Vergangenheit mitnimmt. Dabei kann man Gefahr laufen, die vergangenen Tage zu idealisieren und im Jetzt darunter zu leiden, dass „früher doch alles besser“ war. Dann wieder zurück in unsere gegenwärtige Realität zu finden, kann sich anfühlen wie der Biss in ein hartes Stück Brot. Ursprünglich keimte der Begriff „Nostalgie“ im medizinischen Kontext auf. Man beschrieb damit ein krankhaftes Heimweh, das Soldaten befiel, die sich für lange Zeit in der Fremde aufhielten. Heute versteht man darunter eine Hinwendung zu bestimmten Zeiten im eigenen Leben – denken wir an diese zurück, fühlt es sich für uns gut an. Und wenn sich etwas gut anfühlt, dann ist das doch fein, oder? Vereinfacht dargestellt streben
wir Menschen (glücklicherweise) immer danach, uns gut zu fühlen. Und irgendwann einmal auf ein zufriedenes, aufregendes Leben zurückblicken zu können. Weswegen wir gewisse Erinnerungen auch dementsprechend „hinbiegen“ und damit idealisieren. Unser selektives Gedächtnis spielt da auch richtig gut mit: In unserem Gehirn archivieren wir vor allem schöne Momente in einem gut erreichbaren Regal. Mit zunehmender zeitlicher Distanz nehmen wir diese Momente noch schöner wahr, weil wir negative Aspekte ausblenden, also schlichtweg vergessen. Ja, Erinnerungen haben ihr Eigenleben. Je öfter wir an bestimmte Erinnerungen denken und von ihnen erzählen, desto mehr reichern wir sie an. Was spannend war, wird immer noch spannender. Was romantisch war, wird immer noch romantischer. Aber keine Sorge, trotz der leichten Übertreibungstendenz unseres Gehirns ist es keineswegs verboten, an schönen vergangenen Dingen festzuhalten. Ganz im Gegenteil: In der richtigen Dosis ist Nostalgie etwas Gutes. Davon weiß auch der amerikanische Psychologe Tim Wildschut zu berichten. Er fand heraus, dass uns nostalgische Gefühle Kraft geben können. Sie stärken unseren Selbstwert und fördern dadurch auch den sozialen Zusammenhalt. Da wir selbst die Protagonist:innen in diesen positiven Erinnerungen sind, die sich meist in einem sozialen Kontext abspielen, gewinnen wir beim Erinnern mehr Vertrauen in uns. Und vor allem gewinnen wir an Optimismus, dass ja doch meistens alles gut wird.
Als wir dieses Magazin vorbereitet haben, sind auch wir nostalgisch geworden. Haben daran zurückgedacht, wie wir als Familienbetrieb begonnen haben, es anders zu machen als die anderen. Und auch unsere Kolleg:innen haben wir dazu eingeladen, in ihren Fotoalben zu blättern und schöne Erinnerungen mit uns zu teilen. Erinnerungen, die sie dankbar machen und von denen sie auch heute noch zehren.
Man will ja nicht von gestern sein, aber früher war’s schon auch schön, oder? Kolleginnen und Kollegen haben für uns in ihren Erinnerungen gekramt, Fotoalben durchgestöbert und uns erzählt, was sie nostalgisch macht. Und wir haben darüber nachgedacht, was Nostalgie eigentlich ist.
Ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit.
So zum Beispiel Mediha, die unsere Brotküche am Jakominiplatz leitet, wo sie unsere Gäste vor allem mittags mit Quiches, Aufläufen, Suppen, anderen köstlichen Gerichten und … ja, richtig geraten … Brot glücklich macht. Gastfreundlichkeit hat sie bereits im Kindesalter gelernt – denn da war immer viel los. Man ist oft zusammengekommen, hat gemeinsam gegessen, sich unterhalten, miteinander gelacht und sich wohlgefühlt. Vor allem bei Medihas Oma, die in Velika Kladuša, ganz oben im nordwestlichen Zipfel von Bosnien-Herzegowina lebte. Ein jährliches Highlight war das Bayram, am Ende der Fastenzeit Ramadan, bei dem sich alle in ihrem Haus trafen. Irgendwann Ende der Neunzigerjahre ist eben während dieses Fests auch das Foto entstanden, das Mediha am orangefarbenen Sofa ihrer Oma zeigt. Das gibt’s auch heute noch. „Alle waren bei Oma“, erzählt Mediha „und dann wurde jedes Jahr Keške gegessen“. Das Schmorgericht aus Hühnerfleisch und Weizen ist übrigens auch heute noch ihr Lieblingsessen.

Unweit der Stadt, in der ihre Oma wohnte, wuchs Mediha auf. In Vrnogracˇ, um genau zu sein. „Wenn ich an meine Kindheit dort zurückdenke, dann denk ich immer an den Winter“,
sagt sie und deutet mit ihren Armen an, welche Schneehöhen zu dieser Zeit üblich waren. „Wenn es viel geschneit hat, wurden alle Straßen gesperrt. Aber das war das Beste für uns Kinder in der Siedlung!“ Wer Skier oder Rodeln hatte, nahm sie mit, und wer keine hatte, füllte einen Müllsack mit einem Polster und funktionierte ihn so zur Rutschunterlage um. Die Menschen waren erfinderisch und hatten Freude daran, zusammen zu sein. Dem tat für die Kinder nicht einmal der Bosnienkrieg einen Abbruch: „Als die Soldaten näherkamen, mussten wir zwei Mal umziehen“, aber was in ihrer Erinnerung vorrangig blieb, sind die Momente des Zusammenhalts. „Wir haben uns alle gegenseitig geholfen, und wir Kinder haben gespielt und Spaß gehabt.“ Als Jugendliche hatte Mediha einen Traum: Sie wollte Konditorin werden. Und dann Krankenschwester, weil sie gerne Menschen hilft. Und ein bisschen sind beide Träume in Erfüllung gegangen – auch wenn sie jetzt eher salzig kocht, als süß bäckt und nicht im Krankenhaus arbeitet, sondern am wichtigsten Grazer Verkehrsknotenpunkt. 2012 zog sie nach Österreich, und seit 2015 ist sie Teil unserer Brotküche. Dort hat sie sich von der Abwäscherin bis zur Filialleiterin nach oben gearbeitet. „Und irgendwie helfe ich Men-

schen hier ja auch. Zumindest habe ich ein wirksames Mittel gegen ihren Hunger“, sagt sie mit einem zufriedenen Lächeln.


Wenn Christian, regionaler Verkaufsleiter unserer Innenstadtfilialen, an die Vergangenheit zurückdenkt, dann läuft bei ihm sofort ein Film ab. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Christians Familie lebte nämlich für das Kino –und auch er spielte darin eine wichtige Rolle. Nichts ist für ihn mehr mit Kindheit und Jugend verbunden, nichts weckt mehr nostalgische Erinnerungen, als der Duft von frischem Popcorn. Denn das hat er nicht nur gern gegessen, sondern auch vor den elterlichen Kinosälen verkauft. Satt gegessen hat er sich bis heute noch nicht. „Kino ist auch heute noch eine Leidenschaft, obwohl ich nicht mehr so oft dazu komme“, sagt Christian. Als Kind und Jugendlicher kannte er aber so gut wie jeden Blockbuster. Später arbeitete er auch als Filmvor-
führer im Familienbetrieb: „Film einlegen, Karten abreißen, Film starten und dann nach Möglichkeit sitzen bleiben und zuschauen“, lautete die Devise. Neben dem Kino war sein Lieblingsort der große Garten hinter seinem Familienhaus in Graz. Der war nämlich Treffpunkt für sämtliche Kinder aus der Nachbarschaft. Für die Beschallung war meist sein Vater zuständig. „Der ist immer schon ein alter Rocker gewesen, der am Sonntag in der Früh schon seine Boxen ausprobiert hat“, lacht Christian und ergänzt: „Die Nirvana-CDs habe ich alle von ihm gefladert“. Mit der alten Puch vom Onkel war Christian in seiner Jugend unterwegs. Wem die Puch Maxi auf dem Foto gehört, das in den frühen Neunzigerjahren aufgenommen wurde, weiß er nicht mehr. Was er aber weiß, ist, dass er das motorisierte Fahren bald gegen das Fahrrad eintauschte. Und das ist neben dem Basketballspielen auch heute noch eine seiner großen Leidenschaften.
„Wir Menschen streben danach, einmal auf ein zufriedenes Leben zurückzublicken.“
Eine Leidenschaft kann man auch für Schokolade haben –das können vermutlich viele unterschreiben. Barbara Auer, unsere Co-Geschäftsführerin, ist eine davon: „Jedes Dessert und jeder Kuchen muss für mich schokoladig sein, das war schon immer so“. Ein Beweisbild stammt von ihrem dritten Geburtstag, aufgenommen in St. Anna am Aigen, wo sie ihre ersten Kindheitsjahre verbrachte. Dabei bäckt sie selbst gar nicht so gerne. Warum? „Weil ich mich nicht gerne an Rezepte halte“, sagt Barbara mit einem Schmunzeln. Das hat sie auch im Leben nicht gerne getan. Lieber hat sie experimentiert. Dinge ausprobiert. Dinge auf eigene Faust verbessert. Das macht sie auch heute noch im Familienunternehmen.

Mit sieben ging’s dann nach Graz. Eine neue Umgebung, in der sie sich rasch einlebte. Mit leichten Anfangsschwierigkeiten: „Ich war es vom Dorfleben gewohnt, jeden Menschen
auf der Straße zu grüßen. Weil mich die Leute schon komisch angeschaut haben, hat mir meine Mutter damals gesagt, dass das in Graz nicht notwendig sei“, erinnert sie sich.
Richtig nostalgisch wird Barbara, wenn sie an ihre Studienzeit zurückdenkt. „Diese lustigen Momente, diese Leichtigkeit und Gelassenheit, die damals das Leben bestimmt haben“, das präge sie noch heute. Denn diese Eigenschaften könne man im Leben immer gebrauchen. „Wenn ich mich an gute Zeiten erinnere, fühle ich auch eine gewisse Dankbarkeit, dies alles erlebt zu haben“, sagt sie. Und diese guten Zeiten sind sehr vielfältig: Von schneereichen Wintern („Das sind wirklich nostalgische Erinnerungen, denn das gibt es jetzt einfach nicht mehr!“) über die leuchtenden Augen ihrer Söhne zu Weihnachten bis hin zu den unvergleichlichen Momenten einer Geburt. „Daran denke ich wahnsinnig gern“, erzählt Barbara. Wie schön, dass

„Diese lustigen Momente, diese Leichtigkeit und Gelassenheit, die damals das Leben bestimmt haben.“
uns Momente, die einmal zu nostalgischen Erinnerungen werden, ein Leben lang begegnen können.
Die Geschichte von Yama beginnt in weiter Ferne, und zwar in Masar-e Scharif in der nordafghanischen Provinz Balkh. Hier wurde er mit zwei Geschwistern groß, wobei es eine Tradition gab: Alljährlich musste zum Geburtstag jedes Kindes ein Erinnerungsbild her. Und damit ein Termin beim städtischen Fotografen. Der hatte für das Porträt eigens zu wählende, bemalte Hintergründe, einer schöner als der andere. Seine Eltern wählten die fruchtbare Berglandschaft mit dem rauschenden Bach. Sieht ja beinahe so aus wie im Garten unseres Ateliers, wo Yama heute als Assistent der Betriebsleitung arbeitet.
Für jemanden, der aufgrund der schwierigen politischen Situation seine Heimat nur selten besuchen kann, ist die Nostalgie ein noch wichtigerer Anker. „Ich denke oft an meine Kindheit und Jugend in Afghanistan zurück“, sagt Yama. An Momente, in denen er mit seinen zwei Geschwistern und den Kindern aus der Nachbarschaft Drachen steigen ließ oder sie draußen auf der Straße spielten. Und natürlich auch wieder


an Momente der Gemeinschaft, als alle beisammensaßen, um klassische nordafghanische Gerichte zu essen: Reis mit Rosinen, Karotten und Fleisch zum Beispiel. Oder mit Lauch und Koriander gefüllte Teigtaschen. Der Duft dieser Speisen begleitet ihn noch heute. „Und ich koche das auch in Graz noch nach“, erzählt Yama. Geschmacks- und Geruchssinn sind eben ganz wichtig, wenn’s um Nostalgie geht. Um vor dem Bürgerkrieg zu fliehen, mussten Yama und seine Familie 1997 nach Pakistan ziehen. 2008 ging’s zurück nach Afghanistan, wo er als Englisch-Dolmetscher für die NATO arbeitete, bis er 2014 nach Österreich zog, wo er 2015 bei uns Fuß fasste und seitdem nicht mehr wegzudenken ist. Auch wenn die Erinnerungen an die alte Heimat sehr lebhaft sind, freut sich Yama, bald wieder hinzufahren – und sie neu zu erleben.
Und darum geht’s ja auch. Ums Neu-Erleben. Oder auch ums Wiederbeleben der nostalgischen Gefühle, die uns glücklich machen. Also: Einfach ab und zu in der inneren Souvenirkiste kramen und mit der Erinnerung wachsen. Denn aus den Erinnerungen von gestern können wir auch heute noch etwas Schönes bauen.
Der Frühstücksladen, bei dem man täglich sein Frühstück holen kann, ist ein fester Bestandteil des Alltagslebens der Taiwanes:innen. Hier rieche ich nicht nur gutes Essen, sondern auch meine Kindheit.
In meiner Heimat Taiwan geht man üblicherweise frühstücken. Und zwar zum Frühstücksladen seines Vertrauens. Das ist ein bisschen so wie beim Fußball – einmal Fan, für immer Fan. Ein typischer Frühstücksladen ist von 5 Uhr in der Früh bis etwa 10 Uhr vormittags geöffnet. In der Regel wird er familiär geführt, oft im Erdgeschoß des eigenen Hauses oder einem günstigen Geschäftslokal in einer unscheinbaren Seitengasse. Vorm Laden parken Dutzende Mopeds und Fahrräder der hungrigen Gäste, denen ein Wasserhahn mit einem kurzen Gartenschlauch zur Verfügung steht, um sich die Hände oder die Müdigkeit aus dem Gesicht zu waschen. Die Auswahl an herzhaften und süßen Speisen sowie Getränken ist riesig und preiswert. Die Menütafel hängt hinter der langen Theke, die aus einem breiten Gasherd – das Essen wird frisch vor dir zubereitet – und einem Bereich für verpackte Sandwiches besteht. Mit jeder Inflationswelle werden die Preise mit neuen Zahlen überklebt. Unbeliebte oder zu aufwendige Gerichte (z. B. „gebratene Udonnudeln mit Meeresfrüchten“) werden kommentarlos durchgestrichen oder durch neue überschrieben.
Der Frühstücksladen ist meist funktional und nicht besonders ansprechend eingerichtet. Klapptische und -stühle werden aufgestellt. Auf jedem Tisch stehen Tuben mit diversen Saucen und liegen bekleckste Tageszeitungen. Die Hierarchie ist klar definiert: Die Tische werden von Pensionist:innen und Familien mit Kleinkindern okkupiert. Die Schüler:innen und das arbeitende Volk essen nicht da, sie nehmen das Essen mit. „Wo ist die Klatschseite?” Eine alte Dame blättert die Zeitung durch und beschwert sich lauthals. „Hab Geduld, Großmütterchen, ich lese sie gerade!“, kommt prompt die Antwort vom Nachbartisch.
„Unser“ Block bestand aus sechs Reihenhäusern, meine Familie bewohnte das erste, und die dreiköpfige Familie im letzten Haus führte einen Frühstücksladen. Die Wirtin wurde von allen liebevoll Tante hànbaˇo (= Hamburger) genannt. Sie hatte eine mädchenhafte und sanfte Stimme. Alle Mädchen, die bei ihr frühstückten, nannte sie méimèi (= Schwesterchen) und die Buben dídì (= Brüderchen). In meiner Kindheit war Tante hànbaˇo stets die erste Person, der ich begegnete, wenn ich das Haus verließ und in die Schule ging. „Guten Morgen, méimèi. Was willst du heute essen?“, hat sie mich gefragt. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Bei einem meiner Heimatbesuche klagte ich scherzhaft: „Ich bin schon längst erwachsen. Und du nennst mich noch immer méimèi!“ Sie schaute mich amüsiert an und antworte knapp: „Für mich bist und bleibst du méimèi.“
Tante hànbaˇo hatte vor ihrer Theke eine mehrstöckige Vitrine auf Rollen stehen. Man kann sie sich wie eine Kuchenvitrine in einem Wiener Kaffeehaus vorstellen, nur statt Kuchen sind es pau-á (= gedämpfte, sehr fluffige Germknödel) mit verschiedenen Füllungen (Fleisch, vegetarisch, vegan, süß) und bán-thô (= gedämpfte Germweckerl), die mit Lebensmittelfarben gefärbt sind. Jedes „Stockwerk“ ist eine Schublade, die man herausziehen kann. Das Gebäck wird mithilfe eines eingebauten Wasserbades in der Vitrine warm und fluffig gehalten. Die folgende Szene hat meine Kindheit geprägt: Mehrere Gäste stehen vor der Theke und tratschen. Hupende Mopeds und schrille Fahrradklingeln sind die musikalische Untermalung. Irgendjemand öffnet eine Schublade der Vitrine und holt sich vorsichtig die heißen Knödel mit einer Brotzange heraus. Starke Dämpfe entweichen und mit ihnen die Gerüche von mariniertem Fleisch, Bambussprossen, Koriander, Pilzen, Goji-Beeren, Ingwer, Knoblauch, Nüssen, süßen Bohnen etc. Es duftet fluffig, nach Zufriedenheit und Glück.
Es schmeckt dem Ausländer!
Mein Mann Bernhard – damals mein neuer Freund – kam vor 17 Jahren erstmals mit mir nach Taiwan. Der erste Programmpunkt war „mein“ Frühstücksladen. Tante hànbaˇo, mittlerweile schon weit über 60, winkte mir mit ihrem Pfannwender zu und grüßte mich mit dem obligatorischen „Guten Morgen, Schwesterchen! Schön, dass du wieder da bist! Was möchtest du essen?“ Sie sah etwas eingeschüchtert drein, als sie den groß gewachsenen Blondschopf erblickte. Ich stellte ihn ihr vor und kündigte laut an: „Wir haben großen Hunger!“ Sie lächelte schüchtern und sagte aufgeregt: „Noch nie hat ein Ausländer bei mir gegessen. Was will dein Ausländer denn essen?“ „Mein Ausländer“ aß sich Tag für Tag durch die Speisekarte durch. Hier seine Favoriten: Sandwich mit kuschelweichem Toastbrot, zerriebenem geröstetem Fleisch, Erdbeermarmelade und Spiegelei (eine Geschmacksexplosion!) ; Rettichkuchen aus Reismehl und Tapiokastärke mit Speckwürfel-Zwiebel-Füllung (herzhaft, knusprig und chewy) ; Nñg-piánn (= Egg Pancakes) mit Toppings (ein echter Klassiker und mein Lieblingsfrühstück!) und Hamburger (fluffig, saftig und sehr umami – der Patty wurde vorher in einer süßen Sauce mariniert). Sogar den eiskalten Milchkaffee, den man ehrlicherweise Zuckerwasser mit einem Hauch Kaffeegeschmack nennen müsste, hat Bernhard ins Herz geschlossen. Tante hànbaˇo war auch der allererste Name, den er sich hier gemerkt hat. Voller Stolz erzählte sie anderen Gästen: „Dem Ausländer vom ersten Haus schmeckt mein Frühstück!“
Der Frühstücksladen von Tante hànbaˇo wurde nach ihrer Pensionierung noch einige Jahre von ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter erfolgreich geführt. Als ich erfuhr, dass das Ehepaar mit dem Frühstücksladen aufgehört hatte, weinte ich ein paar bittersüße Tränen. Nun war meine Kindheit wirklich vorbei. Auf einem kleinen Zettel, der noch lange an der Tür von Tante hànbaˇo hing, stand: „Danke für die gemeinsame Zeit! Es bereitete uns große Freude, euch mehrere Jahrzehnte hindurch in der Früh treffen und satt machen zu dürfen.“
–
Für den Teig: 90g Mehl Typ 550 (oder Universal), 45g Tapiokamehl (alternativ: Mais- oder Süßkartoffelstärke), 250g raumwarmes Wasser, ½ TL Salz, 1 Stück Jungzwiebel
Für die Fülle: 4 – 5 Eier (Größe M), Salz, weißer Pfeffer, weitere Zutaten nach Belieben: Mais, Paprikawürfel, Kräuter, etc.
ZUBEREITUNG
Mehl, Wasser und Salz in einer Schüssel gut verquirlen, bis ein glatter, flüssiger Teig entsteht. Den grünen Teil der Jungzwiebel in sehr feine Ringe schneiden und dazugeben. Pfanne auf kleiner Flamme vorwärmen, nach 1 – 2 Minuten sehr wenig Öl hinzufügen. Etwas Teig crêpeartig (3 – 4 mm dünn) über die gesamte Fläche verteilen. Wenn die Palatschinke fest ist, wenden und vom Herd nehmen.
1 – 2 Eier mit Salz, Pfeffer und evtl. weiteren Zutaten verrühren und auf mittlerer Stufe kurz anbraten. Es soll einer sehr flachen, glatten Eierspeis ähneln. Die Palatschinke auf die Masse legen, leicht drücken und wenden, sodass die Palatschinke unten und die Eierspeis oben ist. Vorsichtig einrollen und nicht (!) flachdrücken. Gegebenenfalls noch etwas Öl dazugeben. Eingerollte Egg Pancakes leicht goldbraun anbraten.
Rolle in 5 – 6 Stücke schneiden und Chili- oder dicke, süße Sojasauce dazugeben.
Chia-Tyan YANG (*1979, Pingtung, Taiwan) kam im Alter von 13 Jahren nach Österreich, um Musik zu studieren. Sie schlug in Graz neue Wurzeln und ist glücklich darüber, zwei „Heimaten” –Taiwan und Österreich – zu haben. Neben ihren musikalischen Aktivitäten schreibt sie und ist die dienstälteste Kolumnistin des steirischen Straßenmagazins MEGAPHON. Ihr erstes Buch auf Deutsch „Unterwegs mit Chia-Tyan Yang: Geschichten mit Migrationsvordergrund” wurde 2022 veröffentlicht.

Wenn der Rollkragenpulli wieder Saison hat, feiern auch unsere herzhaften Suppen ihr jährliches Comeback. Täglich wechselnd und in Begleitung einer Scheibe ausgewählten Brots, wärmen sie von innen, wenn’s draußen frisch wird. Mal cremig, mal klar mit feiner Einlage und immer zum Schlürfen und Wohlfühlen gemacht.

Herbstzeit ist Apfelzeit. Und weil’s schon etwas kälter wird, zieht sich der Apfel warm an: Zusammen mit Zimt, Zucker und Rosinen hüllt er sich in zarten Strudelteig, der bei uns jeden Tag von Hand gezogen wird. Klassisch aus Mehl, Wasser, Öl und etwas Salz gemacht, schmeckt’s wie bei Oma.

Eine muss den Ton angeben. Bei uns heißt sie Briemadonna und die Herzen der Snackliebhaber:innen fliegen ihr zu. Kein Wunder, bei diesem virtuosen Geschmacksensemble: Unsere knusprige Nusswurz’n trifft auf cremigen Brie, trifft auf fruchtige Preiselbeeren, trifft auf frische Kresse.

Fühlt sich an wie eine wärmende Umarmung an einem kühlen Herbsttag: unsere heiße Schokolade. Connaisseurs setzen ihr außerdem ein cremiges Sahnehäubchen auf. Dann löffelt sie sich nämlich besonders gut, wie schon damals in Kindertagen.


Wenn frühmorgens auf einem leeren Parkplatz Tapeziertische aufgebaut und sorgfältig Kuckucksuhren, Comic-Hefte, Secondhandkleidung und Porzellanfiguren darauf drapiert werden, dann scharren Jäger:innen und Sammler:innen schon in ihren Startlöchern.
Für einen schnellen Coffee to go – oder besser: einen Coffee to „stöber“ – muss noch Zeit sein, auch wenn sich sein Duft schon mit dem Geruch von alten Büchern und VintageKleidern vermischt. Pünktlich zum Einlass stehen Bianca und Gudrun bereit, um sich mit vielen anderen NostalgieBegeisterten der Suche nach besonderen Dingen und Relikten aus der Vergangenheit hinzugeben. Unter freiem Himmel werden hier, wo sonst eigentlich Hunderte Autos parken, Antiquitäten, Raritäten und allerlei Kunst und Krempel von erfahrenen Händler:innen feilgeboten. Konkretes Ziel für den Besuch gibt es keines. Ist auch besser so. Denn Flohmärkte sind ja auch immer ein bisschen Glücksspiel. Und zur richtigen Zeit am richtigen Ort wartet vielleicht auch genau das, was für eine:n bestimmt ist.
Dabei ist nicht nur die Ware interessant, sondern auch die Standler:innen. „Wir alle haben ein bisserl einen Vogel. Den brauchst auch, wenn du so was machst“, sagt einer grinsend, aber auch sichtlich stolz. Die meisten sind auch Sammler:innen aus Leidenschaft und erzählen, dass die ausgestellten Gegenstände nur einen minimalen Bruchteil ihres eigentlichen Besitzes darstellen. Jo aus Wien steht zum Beispiel vor einem Tisch, der sich unter dem Gewicht Dutzender alter Kameras biegt. „Ungefähr 6000 habe ich noch zu Hause, die kann ich gar nicht alle mitnehmen“, sagt er. Er habe einen Nachlass geerbt und verschreibe sich seitdem dem Handel mit alten Fotoapparaten. Ähnlich ist es bei Helmut, der früher Autos verkauft hat und sich in der Pension nun dem Restaurieren und Verkaufen alter Radios widmet. „Mittlerweile hab ich mehr als 70 zu Hause, funktionieren alle einwandfrei“, sagt er selbstbewusst. Nur seine Frau habe nicht so viel Freude damit, weil „viel Platz haben wir nicht mehr“, merkt er schmunzelnd an.
Den Händler:innen stehen Hobby-Stöbernde wie Gudrun und Bianca gegenüber, aber auch passionierte und versierte Sammler:innen. Franz etwa, der mitunter historische Münzen, Briefmarken und alte Geldscheine anbietet, ist gerade mit einem Herrn im Gespräch, der durch seine Lupe einzelne 1000-Schilling-Scheine beäugt. Höchste Konzentration. „Ich suche noch Tausender mit einer Seriennummer, die mit U oder V beginnt“, sagt er. Franz habe noch einige zu
Hause, meint er. Die beiden tauschen ihre Handynummern aus, der Kaufabschluss wird vertagt. Franz selbst ist regelmäßig als Händler auf Flohmärkten unterwegs, seit er von seinem Vater einen riesigen Fundus geerbt hat. Direkt am Nebenstand hat sich Mario niedergelassen, ein guter Freund von Franz. Er zeigt uns seine geschichtsträchtigsten Stücke, unter anderem einen Thonet-Sessel, auf dem im Wiener Parlament jahrzehntelang große Politik gemacht wurde.
Standler:innen kennen sich untereinander. Man winkt sich zu, trifft sich auf einen Kaffee und lässt sich besonders spannende Stücke zeigen, um vielleicht gleich vor allen anderen zuschlagen zu können. Händler:innengeschick ist das eben. Viele sind das ganze Jahr über auf Märkten in ganz Österreich unterwegs, für manche ist es eher ein Hobby. Eine adrette Dame mit einer Jacke in Leopardenfellprint beschreibt es gut: „Es ist wie eine Sucht“, sagt sie. „Wenn man einmal begonnen hat, kommt man nicht so leicht davon los.“ Als sie in Pension ging, hatte sie mehr Zeit für ausgedehnte Flohmarktbesuche – und auch, um mehr „Kunst und Klumpert“ zu kaufen, wie sie ihre Leidenschaft in eigenen Worten beschreibt. Da der Platz zu Hause begrenzt war, begann sie schließlich auch selbst auszustellen. „Damit ich wieder mehr kaufen kann“, lacht sie.
Auf dem Flohmarkt gibt es alles: von Heiligenfiguren aus der Kirche über Milchkannen bis hin zu antiken Uhrenblättern. Vor allem aber gibt es Geschichten. Und das ist es, was sowohl die Menschen als auch die Gegenstände besonders macht. „Ich kaufe so gerne auf Flohmärkten, weil man Dingen ein neues Leben gibt. Das ist schön, wenn man etwas erzählen kann, und natürlich ist es auch ökologisch sinnvoll“, erzählt Renate, die leidenschaftliche Besucherin ist und manchmal auch einen Stand betreibt und selbst verkauft. Weil man eben ab und zu auch ein bisschen aussortieren muss.
Nach drei Stunden haben Bianca und Gudrun noch lange nicht alles gesehen, sind aber schon um einige Schätze reicher. Und über die kann man lange erzählen. Wie auch über den Besuch am Flohmarkt – denn nirgendwo sonst ist die Nostalgie so lebendig wie hier.
Denn Flohmärkte sind ja auch immer ein bisschen Glücksspiel.
Unsere Kolleginnen Bianca und Gudrun haben sich für uns ins Getümmel gestürzt, um sie zu ergründen: die Faszination Flohmarkt.









… vor langer, langer Zeit, dass eine dunkle Wolke der Stille über die Menschen zog und sie kaum noch Worte füreinander übrighatten. Abseits ihrer Pflichten auf den Feldern und in den Wäldern verfielen sie der Einsamkeit. Nichts brachte sie zum Lachen, nichts zum Grübeln. Grau waren der Himmel und ihre Gemüter. Und wenn einmal ein Feuer entfacht wurde, dann nur, damit niemand Hunger leiden oder frieren musste. Doch eines Tages erschien eine wundersame Fee und erweckte die Fantasie, die in der Stille in einen langen, tiefen Schlaf gefallen war. Und mit ihr erwachten auch die Menschen. Sie wandten sich einander zu, versammelten sich ums Feuer und lauschten gebannt den Erzählungen der Fee: von mächtigen Königen und schönen Königstöchtern, von launischen Riesen und neckischen Zwergen, von bösen Stiefmüttern und weisen Zauberern. Aber sie war nicht nur gekommen, um den Menschen geselliges Vergnügen zu bringen, sondern auch moralische Lehren. Sie lehrte sie, gerecht miteinander umzugehen und Herausforderungen mit Klugheit und Entschlossenheit zu begegnen, wie es die Heldinnen und Helden in ihren Geschichten taten. Die Menschen erkannten sich in den Erzählungen wieder und verstanden:



DAS GUTE SOLL STETS ÜBER
DAS BÖSE SIEGEN.
Die Fee begleitete die Menschen von Generation zu Generation. Sie war zugegen, wenn Eltern ihre Kinder in die Nacht geleiteten und wenn Kinder mit Kindeskindern dasselbe taten. Sie reiste durch die Welt in vielerlei Gestalt und setzte sich für das Gute ein, wenngleich manchmal mit ungewöhnlichen Mitteln. Wo sie auch hinkam – ihre Ankunft ward stets herzlich erwartet und ihren Geschichten aufmerksam gelauscht. Die Jahre zogen ins Land und die Menschen wurden der Fee überdrüssig, verwehrten ihr bald Einlass in ihre Häuser und ihre Herzen. Statt wie einst um den wärmenden Feuerschein, versammelten sie sich nun in blau

flackerndem Licht. Statt wie einst zueinander, blickten sie nun wie erstarrt auf Bildschirme. Ohnmächtig musste die Fee dabei zusehen, wie die Fantasie wieder einzuschlafen drohte. Da war ihr ganz schwer zumute und sie weinte bittere Tränen. Und doch lag es ihr fern, der Welt der Menschen, die sie so lieb gewonnen hatte, Lebewohl zu sagen.
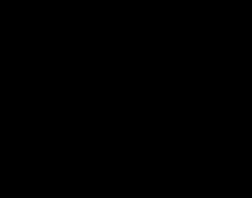

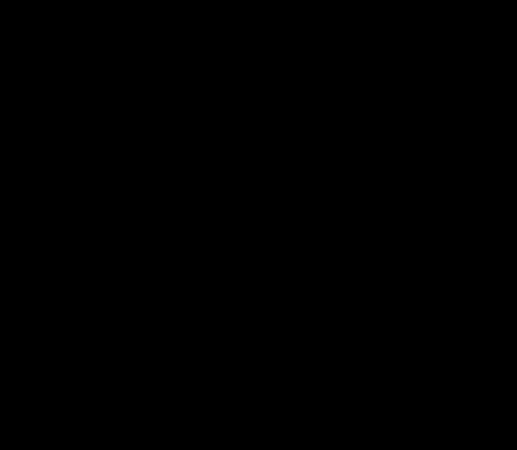
So begab sie sich zur Schneiderin der Zeit, um diese um Rat zu fragen. „Die Welt hat sich verändert“, sagte die weise Schneiderin, während sie die Werte, die Wünsche, die Ziele und Vorlieben der Menschen zurechtschnitt. „Wer in ihr leben will, muss sich wandeln“, sprach sie und schneiderte der Fee prächtige Gewänder, die sie in neuem Glanze erstrahlen ließen. Frohen Mutes zog die Fee los, um wieder an die Türen der Menschen zu klopfen. Doch sie erkannten sie nicht. Da fasste sich die Fee ein Herz, kleidete auch ihre alten Geschichten in neues Gewand und erzählte sie in einer Sprache, die die Menschen verstanden. Und siehe da: Erst zögerlich, dann neugierig und bald freudig gewährten sie der so treuen Begleiterin wieder Einlass.
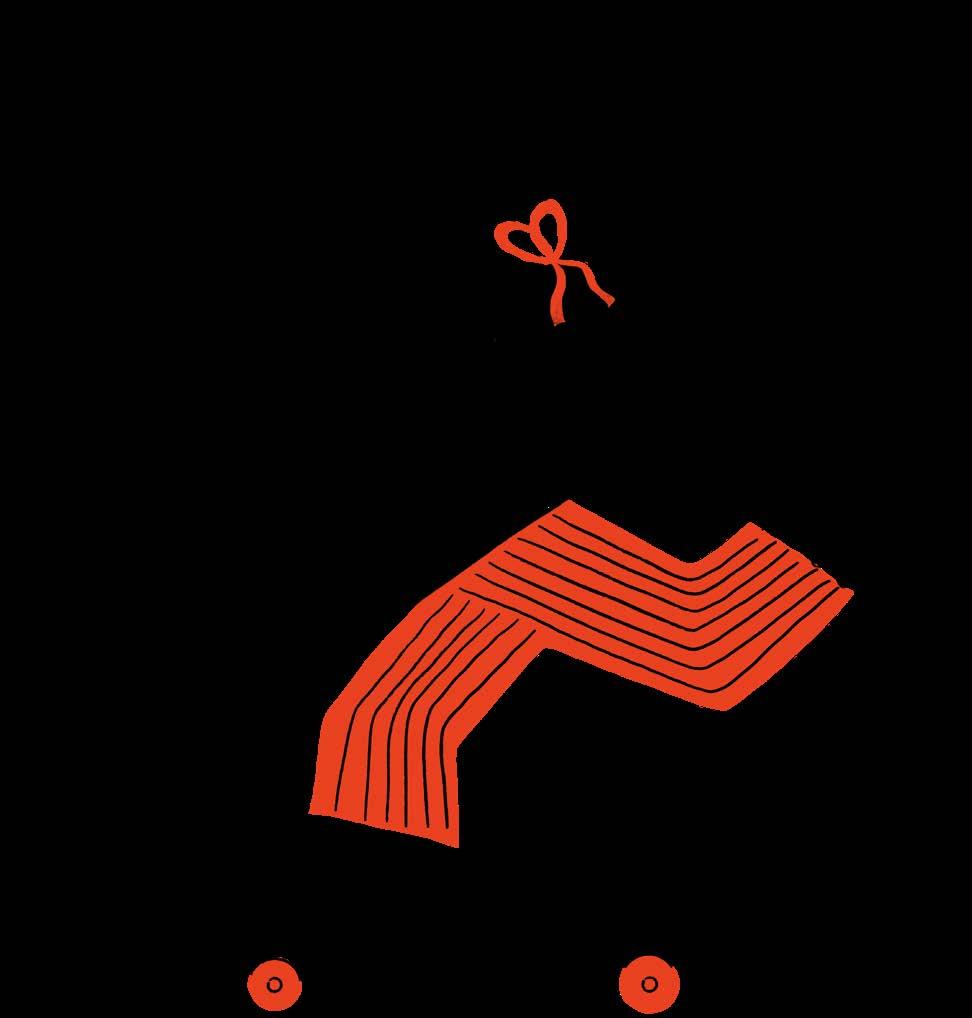

NUN LEHRTE SIE DIE MENSCHEN, DASS AUCH TAPFERE RITTER HILFE VON PRINZESSINNEN BRAUCHEN.
Dass Drachen nur in Frieden leben wollen, dass jeder und jede seines und ihres Glückes Schmied sei, Gerechtigkeit keine Rache brauche und Schönheit keine Tugend sei. Sie erzählte ihnen davon, dass sie alle aus demselben Stoff gewoben und darum gleichermaßen wertvoll, zugleich aber ganz und gar einzigartig seien. Und sie erinnerte sie daran, dass sie sich einander zuwenden können – ob im wundergoldnen Licht des Feuers oder im blauen Schimmer der Bildschirme. So wurde die Fee erneut zu einer weisen und illustren Wegweiserin, die ihre neuen alten Geschichten in Bücher schrieb und Einzug hielt in die Welt der Bildschirme und großen Leinwände. Und weil sie Mut zur Veränderung hatte, lebt sie auch heute noch, die Fee, die den Namen Märchen trägt.




Ausgerechnet zum Jahrestag hat mir mein Mann heuer einen Wackeldackel fürs Auto geschenkt. Jetzt wackelt der „Toni“, dieses reizende Stück Kult-Kitsch aus Kindheitstagen, hinten auf der Ablage. Und wenn der Verkehr nervt, schau ich im Rückspiegel in seine lustigen Knopfaugen und denk mir: Mach langsam! Früher, im kleinen alten Fiat der Eltern, ging’s auch nicht schneller – und plötzlich bin ich gut drauf.

Im Jahr 2000 haben mein Bruder und ich unsere Playstation 1 bekommen. Unzählige Rennspiele waren mit dabei. Samt den Spielen ist sie immer noch in meinem Wohnzimmer aufgebaut. Auch wenn sie nur noch einmal im Jahr läuft, sehe ich sie und erinnere mich sofort an meine Kindheit und die vielen aufregenden Rennen, die wir gefahren sind.

Meine Katzen! Schon im Kindesalter habe ich immer Katzen gehabt und sie heiß geliebt. Viele schöne Erinnerungen hängen dadran. Zwischendurch war es aus beruflichen Gründen nicht möglich, doch seit drei Jahren habe ich wieder zwei Katzen zu Hause: Coco und Chanel. Bin ich mit ihnen zusammen, freu ich mich noch genauso wie damals als Kind.

Bei mir zu Hause im Vorzimmer steht ein altes Telefon. Abgesehen davon, dass sich jemand einmal richtig Mühe gegeben hat, dieses hübsche Telefon zu bauen, finde ich eines besonders toll daran: die Tatsache, dass man damit einfach nur telefonieren kann, ohne abgelenkt zu sein. Mir gefällt der Fokus auf das Wesentliche, den’s früher gab.

Es ist für mich tatsächlich der Geruch in der Backstube, der mich nostalgisch macht. Insbesondere der von frisch gebackenem Brot. Er erinnert mich daran, wie meine Oma, eine Bäuerin, frisches Brot aus dem Ofen geholt hat. Damit hat sie mich auch inspiriert, Bäcker zu werden.

Mich machen Videokassetten nostalgisch. Sie erinnern mich an eine Zeit, in der man noch nicht alles über das Internet streamen konnte. Filme hat man sich bewusster ausgesucht und angeschaut, das war etwas Besonderes.
Ali, 32, Rösterei
 Susanne, 55, Service & Verkauf
Heidi, 36, Leitung Konditorei
Mario, 34, IT
Michael, 45, Backstubenleiter
Susanne, 55, Service & Verkauf
Heidi, 36, Leitung Konditorei
Mario, 34, IT
Michael, 45, Backstubenleiter


Besondere Dinge kann man nur gemeinsam schaffen –davon sind wir überzeugt. Darum ziehen wir auch alle an einem Strang. Oder gleich an mehreren, wenn unser Striezel Hochsaison hat. Und das nicht nur in der Backstube, sondern auch in unseren Filialen und in der Organisation. Ganz nach deinem Geschmack? Wunderbar!
Dann bewerben wir uns hiermit bei dir. Und laden dich ein, dich über welcome@martinauer.at bei uns zu melden, damit wir dir mehr über uns erzählen können. Wir freuen uns darauf, dich persönlich kennenzulernen!
martinauer.at/jobs
Es jeden Tag besser zu machen ist nur möglich, indem wir übers Backblech hinausdenken. Indem wir überlegen, was Brot ist. Was sicher reinkommt und was auf keinen Fall reinkommt.