Zeitschrift für Liechtenstein und die Region



Energiefachstelle Liechtenstein



Zeitschrift für Liechtenstein und die Region



Energiefachstelle Liechtenstein


ab Seite 6


energiebündel.li






Liebe Leserin, lieber Leser
In einer Woche sind Landtagswahlen 2025. 48 Männer und 21 Frauen bewerben sich am 9. Februar um 25 Sitze. Beide Grossparteien wollen die Landtagsmehrheit erringen, und sowohl die VU als auch die FBP buhlen um die Gunst der Wähler. In dieser Beziehung stehen ihnen die DpL wie auch die Freie Liste in nichts nach. Es ist noch nie in der Vergangenheit bei liechtensteinischen Landtagswahlen so viel Geld für Werbekampagnen ausgegeben worden wie bei dieser Wahl. Und alle sind gespannt auf den Ausgang.
Die FBP hat im Mai-Landtag 2024 mit der Postulatseingabe zum Thema «Betreuungs- und Pflegegeld» die Umsetzung diverser Massnahmen initiiert, damit dieses Modell der häuslichen Pflege der fortgeschrittenen Entwicklung bezüglich Bedürfnisse und Inanspruchnahme durch die Familien angepasst und damit verbessert wird. Was hat sich nun mit der Verordnungsabänderung aufgrund dieses parlamentarischen Vorstosses mit Inkrafttreten am 1. Januar 2025 verändert. Unser Mitarbeiter Johannes Kaiser gibt Antwort.


In der Rubrik «im:fokus» beschäftigt sich unser Mitarbeiter Heribert Beck mit der Gemeinde Balzers. In der südlichsten Gemeinde des Landes sind die Gemeindefinanzen immer wieder ein Thema, das die Bevölkerung beschäftigt. Derzeit ist Balzers dank des horizontalen Finanzausgleichs auf dem besten Weg, wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Eine vorzeitige Senkung des Gemeindesteuerzuschlags könnte diesen Erfolg aber zunichtemachen. Vorsteher Karl Malin erklärt, warum er für 170 Prozent Zuschlag plädiert und zeigt auf, was die Gemeinde mit den Geldern plant.
Karlheinz Ospelt widmet sich der Liechtensteiner Wirtschaft und lobt sie als hervorragendes Beispiel, wie ein Kleinstaat sich ökonomisch erfolgreich positionieren kann. Dieser beeindruckende Weg könne in Zukunft nur mit Erfindergeist, Flexibilität und Leistungsbereitschaft fortgesetzt werden, sagt der Wirtschaftswissenschaftler.
Vor 100 Jahren, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, kämpfte Liechtenstein mit finanziellen Problemen. In der Not verlegte sich das Land darauf, mit zweifelhaften Unternehmungen möglichst rasch zu Geld zu kommen, was beinahe den Staatsbankrott zur Folge gehabt hätte. Unser Mitarbeiter Günther Meier schaut zurück.
Vier Monate lang war der FC Vaduz in der Challenge League ungeschlagen. Beim ersten Rückrundenspiel am 24. Januar 2025 kassierte das Team von Trainer Marc Schneider beim Spitzenreiter FC Thun die erste Niederlage.
Ich wünsche Ihnen im Namen der Redaktion alles Gute und viel Freude bei der Lektüre der lie:zeit.
Herbert Oehri, Redaktionsleiter
Tel. 00423 / 791 020 4 www.bauer-maler-gipser.li


Die Liechtensteiner Wirtschaft
«Ein letzter WahlkampfEffort kann sich lohnen»
16
Balzers im:fokus

«Der Gemeinderat ist nicht per se gegen eine Steuersenkung»

Im Gespräch mit Noelia Ritter
«Wie wird die Zukunft mit der ganzen Digitalisierung sein?»
Impressum
Verleger: Zeit-Verlag Anstalt, Essanestrasse 116, 9492 Eschen, +423 375 9000 · Redaktion: Herbert Oehri (Redaktionsleiter), Johannes Kaiser, Vera Oehri-Kindle, Heribert Beck · Beiträge/InterviewpartnerInnen: Thomas Milic, Gemeindevorsteher Karl Malin, Tilmann Schaal, Karlheinz Ospelt, Noelia Ritter, Fränzi und Zeno «vegAluna», Rafael Ospelt, Dominik Matt, Christoph Kindle, Philipp Meier, Livio Meier, Willi Pizzi, Thomas Kugler, Sandro Wolfinger, Christian Imhof, Günther Meier · Grafik/Layout: Carolin Schuller, Daniela Büchel · Anzeigen: Vera Oehri-Kindle, Brigitte Hasler · Fotos: Adobe, Michael Zanghellini, Pamela Bühler, Daniel Schwendener, architekturhasler, Sara Rißlegger, Liechtensteinisches Landesarchiv, ZVG ·
Urheberschutz: Die Texte und Bilder dürfen ohne vorherige Genehmigung des Herausgebers/Verlegers nicht kommerziell genutzt, weitergegeben oder veröffentlicht werden. · Meinungsvielfalt: Die lie:zeit gibt Gastautoren Platz, um ihre Meinung zu äussern. Dabei muss der Inhalt mit der Meinung der Redaktion und der Herausgeber nicht übereinstimmen. · Druck: Somedia Partner AG, Haag · Auflage: 22’500 Exemplare · Online: www.lie-zeit.li · Erscheinung: 01. Februar 2025 · «lie:zeit» nicht erhalten? Rufen Sie uns an: Tel. 375 90 00 (Natascha Oehri). Zustellung erfolgt sofort. Nächste Ausgabe: 08. März 2025
Projektpräsentation «Jugendtreff Bendern»
Argentinischer Social-Media-Star Valentín Scarsini


Optimierung des Betreuungs- und Pflegegeldes noch nicht zufriedenstellend 14
Zahltag mit Fränzi & Zeno von vegAluna 34
Bildung & Jugend: Interview mit Rafael Ospelt 39 Erfolgreicher Unternehmerstammtisch in Mauren-Schaanwald 40
Grosses Interesse an marktautarker Energielösung der LIGEN 50
Projekt «Giessen Hotel & Coffeehouse, Vaduz» 52
Kleine Medien haben es in Liechtenstein schwer 66
Der Mobilitätsverein Liechtenstein stellt sich vor 68
FC Vaduz: Vaduzer Erfolgsserie endet beim Leader 72
Mit Lotterien nahe am Abgrund des Staatsbankrotts 82
1920 – Arbeiterinnen schliessen sich in einem Verein zusammen 85
Du im Mittelpunkt.

«Ein
lohnen»
«Fair, gesittet und sachlich»: Mit diesen Worten charakterisiert Thomas Milic, Forschungsleiter Politik am Liechtenstein-Institut, den laufenden Wahlkampf. Woran dies seines Erachtens liegt und wie sich die Kanäle ändern, auf denen die Parteien ihr Botschaften an die Wählerschaft bringen, schildert er im Interview. Ganz vorbei ist der Wahlkampf für Milic derzeit übrigens noch nicht. Selbst wenn die weitaus meisten Wahlberechtigten ihre Entscheidung bereits getroffen haben.
Interview: Heribert Beck
Wie haben sie den Wahlkampf seit der Nomination der Regierungskandidaten der beiden Volksparteien im vergangenen August generell erlebt?
Thomas Milic: Der Wahlkampf wurde recht intensiv geführt. Selten sind so viele Wahlsendungen auf so vielen Kanälen ausgestrahlt worden wie bei diesen Wahlen. Trotzdem blieben die Debatten zwischen den Kontrahenten meist fair, und man ging gesittet miteinander um – kein Vergleich etwa zum laufenden Wahlkampf in Deutschland. Aber auch im Vergleich zu Abstimmungskämpfen hierzulande – man denke etwa an die beiden Energievorlagen oder an den Spital-Neubau – wurde der laufende Wahlkampf nüchtern, konziliant und sachlich geführt. Persönliche Angriffe gab es kaum; meist gab man sich – wohl auch aufgrund der Unsicherheit, wer nach den Wahlen mit wem koaliert –staatsmännisch: Die Konkurrentin der heutigen Debatte ist vielleicht die Koalitionspartnerin von morgen. Für einige Beobachter war der Wahlkampf fast schon etwas zu sachlich und zu zahm. Tatsächlich sollte ein Wahlkampf auch die Differenzen zwischen den Parteien offenlegen, denn es geht ja um die Wahl zwischen Parteien und Programmen. Einige Debatten, insbesondere das Duell der beiden Spitzenkandidaten Brigitte Haas und Ernst Walch, hatten mitunter aber durchaus eine kontroverse Note.
Was waren für Sie die zentralen Argumente der einzelnen Parteien?
Die Parteien bespielen vor allem ihre bekannten Kernthemen. Das war aber auch zu erwarten. Parteienimages werden über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte aufgebaut und gepflegt. Die Wählerschaften verbinden die Parteien instinktiv mit den entsprechenden Themen. Eine inhaltliche Neuorientierung ist daher von vornherein kaum möglich. Ausserdem geht es in einem Wahlkampf zunächst darum, die eigene Anhängerschaft an die Urne zu treiben und nur sekundär darum, Unentschlossene von den eigenen Lösungen zu überzeugen. Gewiss, letzteres ist auch wichtig, umso mehr, wenn das Rennen knapp wird. Aber gewinnen kann nur, wer zuallererst das eigene Lager zu mobilisieren vermag. Und die Mobilisierung gelingt mit den eigenen Kernthemen am besten.
Welche Rolle haben die Regierungsteams im Wahlkampf gespielt?
Eine wesentliche Rolle. Aber das ist nichts Neues. Die designierten Regierungsteams, insbesondere der Regierungschef beziehungsweise die -chefin, waren immer schon eines der wichtigsten individuellen Wahlmotive bei den Landtagswahlen. Das ist auch im internationalen Vergleich nicht aussergewöhnlich. Bei den anstehenden Bundestagswahlen in Deutschland spielen die Kanzlerkandidaten ja auch eine
Titelstory
eminent wichtige Rolle, obwohl sie als Kanzler oder Kanzlerin gar nicht direkt zur Wahl stehen.
Wie beurteilen Sie als Politologe diese Situation? Ist es problematisch, dass die eigentlich zur Wahl stehenden Personen medial relativ wenig Beachtung finden?
Die Verfassung schreibt den Wählerinnen und Wählern keine Motive vor. Es muss nicht das inhaltliche Programm einer Partei oder die fachliche Kompetenz der Landtagskandidaten sein. Auch strategisches beziehungsweise taktisches Wählen ist «erlaubt». Also eine Wahl nicht etwa der eigentlichen Präferenzpartei, sondern einer anderen Partei, um die Regierungszusammensetzung effizienter beeinflussen zu können. Interessant ist dabei, dass diese Fokussierung auf die Regierungskandidaten von den Landtagsabgeordneten selbst kritisch gesehen wird. Bei der Landtagsdiskussion über eine mögliche Volkswahl der Regierung waren sich eigentlich alle Parteien einig, dass bei den Parlamentswahlen diejenigen, um die es geht, also die Kandidatinnen und Kandidaten für den Landtag, wieder stärker ins Zentrum gerückt werden sollten.
Aber diese im Wahlkampf forcierte Ausrichtung auf die «Spitzenkandidaten» ist eine beinahe schon zwingende Folge des Wahlsystems. Will man als Wählerin oder Wähler Einfluss nehmen auf die Zusammensetzung der Regierung, kann man das nur über die Wahl des Landtags tun. Änderungen des Wahlsystems, die eine «Aufwertung» der Landtagskandidaten bringen würden, schaffen an anderer Stelle neue Probleme oder haben sich als nicht mehrheitsfähig erwiesen. Die Initiative zur Volkswahl der Regierung beispielsweise wurde letzten Februar vom Volk deutlich abgelehnt. Zuletzt entspricht eine Konzentration auf die Spitzenkandidaten auch der Medienlogik und wohl ebenfalls den Wünschen eines Teils der Öffentlichkeit: Man kann keine sinnvolle Debatte mit allen 69 Kandidierenden gleichzeitig führen, aber ein Duell der beiden Regierungschefkandidierenden ist sehr wohl möglich.
Es scheint bisher so, als spielten Leserbriefe als Kanal zum Transport von politischen Botschaften dieses Mal eine untergeordnete Rolle. Täuscht dies oder hat der Leserbrief als traditionelle Liechtensteiner Wahlkampfplattform ausgedient?
Ich habe keine Zahlen darüber, wie viele Leserbriefe im Vergleich zu vor vier Jahren in den Redaktionen eingegangen sind. Aber persönlich hatte ich nicht den Eindruck, dass es merklich weniger waren. Gewiss, der klassische Leserbrief ist nicht das bevorzugte Kommunikationsmittel der Jungen. Diese sind digital unterwegs. Insofern ist schon anzunehmen, dass die Bedeutung des Leserbriefs mit der Zeit abnehmen wird. Aber bei diesen Wahlen ist das, so zumindest mein Eindruck, noch nicht wirklich der Fall.
Welche Medien beziehungsweise Kanäle haben den Wahlkampf dominiert und woran liegt es, dass die Parteien gerade auf diese setzen?
Auffallend ist schon, wie sich die Präsenz der Kandidierenden auf den sozialen Medien erhöht hat. Sei es Instagram, Facebook oder auch You-
Tube – überall wird emsig geworben oder gepostet. Auch Podcasts –namentlich jener von easyvote – finden einige Beachtung. Bei den US-Präsidentschaftswahlen haben Podcast-Interviews – etwa der Auftritt Trumps bei Joe Rogan – meines Erachtens die klassischen Medien nicht nur an Reichweite, sondern gar erstmals auch an Bedeutung überflügelt. So weit ist es in Liechtenstein noch nicht. Die neuen Medien dominieren hierzulande noch nicht. Aber der Trend geht, wenn auch langsam, in eine ähnliche Richtung.
Die FBP hat im Dezember Live-Duelle der Regierungskandidaten gefordert. Gemäss den Medien hat sie damit offene Türen eingerannt, da die Duelle damals bereits angekündigt gewesen seien. Ist der Wahlkampf dieses Mal später als sonst in seine heisse Phase gestartet oder werten Sie die Forderung der FBP als taktisches Manöver?
Der Wahlkampf begann zwar schon relativ früh, aber es ist richtig, dass die «heisse Phase» vergleichsweise spät einsetzte. Ich denke jedoch, dass dies mit den ungewöhnlich vielen Abstimmungen im letzten Jahr zu tun hat. Im Oktober und November waren Politik und Medien wegen der Abstimmungen zur LRFG-Aufhebung und zur staatlichen Pensionskasse noch mit den entsprechenden Abstimmungskämpfen beschäftigt. Erst ab Dezember war es möglich, auf vollen Wahlkampfmodus zu schalten. Und kaum hatte der Wahlkampf begonnen, setzte mit den Feiertagen über Weihnachten und Neujahr auch schon wieder eine «Zwangspause» ein.
Die Demokraten pro Liechtenstein haben ihre Landtagskandidaten, ihr Regierungsteam und ihr Wahlprogramm erst vergleichsweise spät präsentiert. Werten Sie dies als Vor- oder Nachteil?
Ich weiss nicht, ob dies ein bewusster Entscheid war oder ob sich das am Ende einfach so ergeben hat. Die Kandidatenrekrutierung, da sind sich eigentlich alle Parteien einig, fällt zusehends schwerer. Abgesehen davon glaube ich aber nicht, dass der Nominierungszeitpunkt eine wesentliche Rolle für den Wahlentscheid spielen wird, auch und gerade nicht für die DpL. Denn das Hauptmotiv der DpL-Wählenden ist das Programm der Partei. Das zeigte die Nachbefragung zu den Landtagswahlen 2021. Und die zentralen inhaltlichen Programmpunkte der DpL waren schon vor der Nomination der Kandidaten bekannt.
Seit vergangener Woche sind die Briefwahlunterlagen bei den Bürgerinnen und Bürgern. In rund zehn Tagen sind die Stimmen der Landtagswahlen 2025 bereits ausgezählt. Was erwarten Sie sich noch vom Wahlkampf und ergibt es für die Parteien Sinn, in der letzten Woche nochmals neue Akzente zu setzen?
Eine klare Mehrheit hat bereits gewählt. Bei den letzten Landtagswahlen 2021 entschied sich nur ein knappes Fünftel aller Wählenden in der letzten Woche. Aber: Sollte das Ergebnis wieder so knapp ausfallen wie vor vier Jahren, könnte sich ein letzter Wahlkampf-Effort eben doch lohnen. Eine inhaltliche oder thematische Umorientierung ist zum jetzigen Zeitpunkt indessen wenig sinnvoll. Die Themen, aufgrund welcher sich die Wählenden entscheiden, sind längst gesetzt.
Bitte beteiligen Sie sich an den Landtagswahlen 2025
Sollen die Demokraten pro Liechtenstein (DpL) in die Regierung einziehen? Mit einem unveränderten DpL-Stimmzettel unterstützen Sie die DpL am tatkräftigsten. Bitte beteiligen Sie sich an den Landtagswahlen 2025.
Mit Dr. Erich Hasler und Thomas Rehak stehen zwei langjährig erfahrene, volksnahe und bodenständige Persönlichkeiten als DpL-Regierungsratskandidaten zur Verfügung.
Der politische Leistungsausweis dieser Herren ist umfangreich.
Unser zehnköpfiges Team verfügt über Erfahrungen aus verschiedenen Branchen. Alle Kandidierenden stehen für eine bürgernahe, verantwortungsvolle und konstruktive Politik. Sie scheuen sich nicht, Sachverhalte kritisch zu prüfen und entsprechend zu handeln.
Haben Sie die Videos unserer Kandidierenden schon gesehen? Diese sind unter www.dpl.li/wahlen-2025/ zu finden, oder scannen Sie mit einem Smartphone den QR-Code beim jeweiligen Foto:













Unser Wahlprogramm




www.dpl.li/wahlen-2025/wahlprogramm
Oder scannen Sie mit einem Smartphone folgenden QR-Code:
Auch zukünftig werden wir in gewohnter Manier dahinter schauen.
DpL-Team Landtagswahlen 2025






So wählt man richtig
Duell der Chefkandidaten
VU-Wahlprogramm
Geschätzte Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner
In rund einer Woche kennen wir das Ergebnis der Landtagswahlen 2025. Sofern Sie Ihre Stimmen noch nicht abgegeben haben, besteht dazu bis zum kommenden Freitag per Briefwahl und am 9. Februar in den Wahllokalen die Möglichkeit. Machen Sie von dieser Gelegenheit Gebrauch und gestalten Sie die Zukunft unseres Landes mit.
Die Vaterländische Union hat Ihnen mit ihrem Landtagsteam einen starken Wahlvorschlag unterbreitet. Die acht Frauen und 17 Männer aus unterschiedlichsten Berufs- und Altersgruppen haben Ihre Unterstützung verdient. Eine starke VU-Fraktion im Landtag leistet Gewähr dafür, dass die Ziele des Wahlprogramms zum Wohle aller erreicht werden können. Denn die VU steht für eine starke Wirtschaft, eine bürgernahe und effiziente Verwaltung, eine engagierte Aussenpolitik, gesunde Staatsfinanzen, sichere Sozialwerke und Chancengerechtigkeit. Oder kurz gesagt: für ein tragfähiges «Metanand».
Diese Ziele teilt das Landtagsteam mit Regierungschefkandidatin Brigitte Haas sowie den
Regierungsratskandidaten Hubert Büchel und Emanuel Schädler. Sie setzen sich in einer zunehmend unruhigen Zeit für besonnene, überlegte und zukunftsweisende Entscheidungen ein, die Liechtenstein und die Bedürfnisse seiner Bevölkerung ins Zentrum stellen.
Dafür steht Regierungschefkandidatin Brigitte Haas, die mit ihrem reichen Erfahrungsschatz aus Wirtschaft, Kultur und Verwaltung über Jahrzehnte bewiesen hat, dass ihr das Wohl, die Anliegen und Bedürfnisse aller Generationen, von den angehenden Fachkräften, die unsere Zukunft sind, bis zu den Seniorinnen und Senioren, die unseren Wohlstand begründet haben, am Herzen liegen.
Dafür steht Regierungsratskandidat Hubert Büchel, ein Finanzexperte und bodenständiger Liechtensteiner, der neben seinem vielfältigen ehrenamtlichen Engagement, insbesondere im Sport, als stellvertretender Regierungsrat und Landtagsabgeordneter bereits vielfältige Erfahrungen in Exekutive und Legislative sammeln durfte und sich dabei stets durch grossen Einsatz ausgezeichnet hat.
Dafür steht Regierungsratskandidat Emanuel Schädler, der bereits in jungen Jahren auf eine beeindruckende akademische Karriere zurückblicken konnte und heute die Geschäfte der Erwachsenenbildung Stein Egerta führt. In der universitären Lehre wie in seiner derzeitigen Position hat er sich für die Bildung als Basis des Erfolgsmodells Liechtenstein eingesetzt und gleichzeitig viel Herzblut in die Förderung von Kultur und Heimatforschung investiert.
Brigitte Haas, Hubert Büchel und Emanuel Schädler sowie das Landtagsteam der VU haben in den vergangenen Monaten gezeigt, wie gut ihr Miteinander funktioniert. Und ich garantiere Ihnen, geschätzte Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner, dass sie dieses «Metanand» auch in Landtag und Regierung leben werden. Unterstützen Sie unser Regierungsteam mit Ihren Stimmen für die Landtagskandidatinnen und - kandidaten der VU.

Thomas Zwiefelhofer VU-Parteipräsident
Die Politik muss für Land und Leute da sein – für beide gleichwertig. Dieser selbstverständlichen Grundintention will die FBP und ihre Kandidatinnen und Kandidaten für Landtag und Regierung nachleben. Sie alle haben sich das Ziel gesetzt, nahe an die Menschen zu rücken, auf sie zuzugehen, für sie da zu sein, ihnen die Entscheide zu erläutern und ihre Probleme, Sorgen und Ängste ernst zu nehmen und sie in die Politik einiessen zu lassen.
Auf Basis dieser Grundausrichtung haben wir das Wahlprogramm erarbeitet. Dies unter der Prämisse der Förderung eines respektvollen und wertschätzenden Zusammenlebens in Liechtenstein und mit dem Fokus auf die Generationengerechtigkeit.
Die Ausrichtung der FBP ist in dem vom Parteitag fest geschriebenen «Selbstverständnis der FBP» festgelegt. Wir verstehen uns als Partei der Mitte und somit als bürgerliche, wertekonservative sowie wirtschaftsliberale Volkspartei. Wir stehen für unsere dualistische Staatsform ein, die auf zwei starken gleichwertigen Souveränen – Fürst und Volk – basiert.
Wir fühlen uns einer Politik der sozialen Marktwirtschaft verpichtet. Wir stehen damit für eine Gesellschaft ein, die primär auf Eigeninitiative, Wahlfreiheit und Leistungsbereitschaft setzt. Wir fördern eine Gesellschaft, in der sich Leistung lohnt und die Bildung von Eigentum ermöglicht wird. Dabei setzen wir uns konsequent für ein ziel gerichtetes, wirkungsvolles Sozialsystem ein.
Wir stehen für eine Politik der Kontinuität, die Fortschritt sowie bewährte Traditionen und Werte aufgeschlossen und zukunftsweisend zu verbinden sucht. Unsere Politik beruht auf christlichen Werten, wie Solidarität, Respekt und Gerechtigkeit. Wir fördern Chancengleichheit in Bildung und persönlicher Entfaltung und tragen Sorge für den Erhalt eines intakten Lebensraums. Solide Staatsnanzen, eine schlanke, leistungsfähige Verwaltung und Eigenverantwortung der Bürger bilden für uns die unverzichtbare Basis für efzientes und effektives staatliches Handeln.

Ernst Walch Regierungschefkandidat

Sabine Monauni Regierungsratskandidatin

Bruno Beck
B BrunoBeck M



Alexander Batliner Parteipräsident

Thomas H Hasler
Daniel Oehry Regierungsratskandidat Vizepräsident

Daniel Brunhart
DanielBrunhart
Sebastian Gassner




Nico Büc
Manfred Bischof
Kilian Büchel


Oliver Gerstgrasser


Fabian Haltinner

Helmut Hasler
Hl tH l
SebastianGassne Olivver G e erst e grass Andr d easHaber

Johannes Kaiser
Franziska Hoop

Lino Nägele
LinoNägel

Daniel Salzgeber

Florin Konrad
Judith Hoop

Bettina Petzold-Mähr

Iwan Schurte

Sieglinde Kieber
Fran annzisk z ziisk sk skaHo H aH a op Judith H h oop JhKi Sieg eg e linde K FlorinKonr


Martin Rechsteiner

Lorenz Risch
Sasc S ha Quaderer MtiRhti LRih

Daniel Seger


Karin Zech-Hoop
Alle volljährigen Personen mit liechtensteinischer Staatsbürgerschaft und Wohnsitz in Liechtenstein besitzen das aktive und passive Wahlrecht. Sie können somit wählen und abstimmen und auch selbst in ein Amt gewählt werden. Personen mit liechtensteinischer Staatsbürgerschaft und Wohnsitz im Ausland hingegen haben kein Wahlrecht.
Auch Ausländer mit Wohnsitz in Liechtenstein dürfen nicht wählen oder abstimmen, auch nicht auf kommunaler Ebene. Dies wird z. B. von der Kommission gegen Rassismus und Intoleranz des Europarats (ECRI) in ihren Empfehlungen von 2018 bemängelt.
In Liechtenstein wird dies kontrovers gesehen. Laut der jüngsten Umfrage der wahlhilfe.li unter den Kandidierenden, können sich nicht alle vorstellen, dass auch Ausländer wählen dürfen, wenn sie schon länger im Land leben.
Wie stehen Sie zum Stimm-und Wahlrecht für Ausländer?

Das Wahl- und Stimmrecht wird als ein wesentliches Element der Staatsbürgerschaft angesehen, da es den Bürgern das Recht gibt, Einfluss auf die politische Gestaltung ihres Landes zu nehmen. In vielen Demokratien ist dieses Recht auf Staatsbürger beschränkt.
Bereits im Jahr 2011 hat sich die Regierung in einer Interpellationsbeantwortung zu dieser Thematik geäussert. Sie betonte darin, dass die Förderung der Mitwirkung von in Liechtenstein lebenden Ausländerinnen und Ausländern in Kommissionen, Schulräten, Elternvereinigungen, Organisationen und Vereinen sowie die Überprüfung der Einbürgerungsbedingungen prioritär seien. Das Wahl- und Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer sah die Regierung damals bereits kritisch.
Ich teile diese Ansicht der Regierung. Das Wahl- und Stimmrecht sollte auch weiterhin an die Staatsbürgerschaft gekoppelt sein. Dies umso mehr, als die Bevölkerungsstatistik von Juni 2024 rund 14’200 Ausländerinnen und Ausländer ausweist, die zur ständigen in Liechtenstein lebenden Bevölkerung zählen. Auch wenn nicht alle diese Ausländerinnen und Ausländer mit Zuzug oder aufgrund des Alters sofort stimmberechtigt wären, ist dies für mich ein prozentual zu hoher Anteil an der Gesamtzahl der Stimmberechtigten. Durch diese prozentual hohe Anzahl könnte der Fall eintreten, dass ausländische Stimmberechtigte Entscheide gegen die stimmberechtigten Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner fällen. Dies wäre nachteilig für das gesellschaftliche Zusammenleben.

Es ist immer gut, über politische Beteiligung zu diskutieren. Kürzlich organisierte «Vielfalt in der Politik» gemeinsam mit dem Verein für Menschenrechte eine Veranstaltung zu diesem Thema. Geladen waren die Vertreter der politischen Parteien des Landes. Die Diskussion war sehr konstruktiv, und es wurden äusserst spannende Erkenntnisse aus dem Gespräch gewonnen. Die VU zeigte sich auch in der Vergangenheit immer offen gegenüber grössenverträglichen Massnahmen, um die politische Teilhabe zu erhöhen. Dabei war und ist es uns immer besonders wichtig, dass über die Volksrechte und deren Änderung auch die Stimmbevölkerung befragt wird. Die letzte grosse Abstimmung zum Thema «Doppelte Staatsbürgerschaft» vor knapp fünf Jahren zeigte aber klar: Obwohl sich wenige öffentlich dagegen aussprachen, wurde das Anliegen deutlich abgelehnt. Das heisst für uns, dass die Zeit nicht reif ist für solche Vorstösse. Womöglich wäre es wieder einmal an der Zeit, mittels öffentlicher Erhebungen die Stimmung hinsichtlich solcher Fragen in der Bevölkerung abzufragen, bevor man allfällige Massnahmen unternimmt.
Die VU hat sich in letzter Zeit mit der sinkenden Stimmbeteiligung befasst, welche die Legitimation politischer Entscheide auf die Dauer schwächt. Dieses Thema gehört unseres Erachtens prioritär adressiert, bevor wir eine Öffnung des Wählerinnen- und Wählerpools vornehmen und damit die Stimmbeteiligung noch stärker reduzieren.


Die Freie Liste ist überzeugt: Eine starke Demokratie lebt von der Teilhabe möglichst vieler Menschen. In Liechtenstein sind jedoch über ein Drittel der volljährigen Einwohnerinnen und Einwohner (rund 12’000 Menschen) von politischer Mitbestimmung ausgeschlossen, obwohl sie im Land ihren Lebensmittelpunkt haben, zur Wirtschaft beitragen und das gesellschaftliche Leben aktiv mitgestalten. Dieses Demokratiedefizit ist eine direkte Folge der restriktiven Einbürgerungspolitik und der fehlenden Möglichkeit einer Doppelstaatsbürgerschaft.
Andere Länder haben längst erkannt, dass die Einbindung aller Bevölkerungsgruppen nicht nur fair, sondern essenziell für die Legitimität demokratischer Systeme ist. In der EU können Bürgerinnen und Bürger an Kommunalwahlen teilnehmen, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit innerhalb der Mitgliedsstaaten. In Teilen der Schweiz ist das Stimm- und Wahlrecht für Ausländer ebenfalls bereits gelebte Praxis. Liechtenstein sollte diesem Beispiel folgen und ein kommunales Stimm- und Wahlrecht einführen – etwa für langjährig ansässige Menschen mit Niederlassungsbewilligung.
Ein solches Recht würde die Demokratie stärken, die Legitimität politischer Entscheidungen erhöhen und die Vielfalt unserer Gesellschaft besser abbilden. Die Freie Liste setzt sich dafür ein, dass alle, die Liechtenstein mitgestalten, auch eine Stimme erhalten.



Peggy Meuli

Das Stimm- und Wahlrecht ist ein zentrales Element der liechtensteinischen Verfassung und bildet den Kern der politischen Rechte. Dabei stellt sich die entscheidende Frage, wer Anspruch auf diese Rechte haben soll. Bislang ist die Staatsangehörigkeit eine zwingende Voraussetzung für das Stimm- und Wahlrecht.
Ein liechtensteinischer Staatsbürger mit Wohnsitz im Inland und in seiner Bürgergemeinde kann sowohl auf Landes- als auch auf Gemeindeebene abstimmen. Verlegt er seinen Wohnsitz in eine Nachbargemeinde, verliert er das Gemeindewahlrecht. Mit Wohnsitz im Ausland ist ein liechtensteinischer Staatsbürger überhaupt nicht mehr wahlberechtigt.
Für mich wäre die richtige Reihenfolge, erst die oben genannten Punkte zu harmonisieren, um dann in der Thematik voranzuschreiten.
Zum aktuellen Stand der Dinge möchte ich anfügen: Wer echtes Interesse am Stimmrecht hat, kann es durch eine Einbürgerung auch erlangen. Die Hürden hierfür sind überschaubar.
Das Stimm- und Wahlrecht ist ein zentraler Bestandteil demokratischer Teilhabe. In Liechtenstein ist dieses Recht aktuell ausschliesslich volljährigen Personen mit Staatsbürgerschaft und Wohnsitz im Inland vorbehalten. Menschen ohne liechtensteinische Staatsbürgerschaft sind von der politischen Mitbestimmung ausgeschlossen, auch auf kommunaler Ebene. Die Frage, ob dies geändert werden sollte, wird kontrovers diskutiert.
Die Position der MiM-Partei basiert auf den Prinzipien von Integration und Fairness. Es ist nachvollziehbar, dass politische Mitbestimmung an die Staatsbürgerschaft geknüpft ist, da diese eine tiefere Bindung an das Land und dessen Gesellschaft symbolisiert. Dennoch ist es wichtig, die Bedürfnisse und Beiträge von langjährig in Liechtenstein lebenden Menschen ohne Staatsbürgerschaft anzuerkennen. Sie leisten einen bedeutenden Beitrag zur Wirtschaft und Gesellschaft und sollten langfristig stärkere Möglichkeiten zur politischen Partizipation erhalten.
Die Empfehlungen der ECRI betonen, dass eine Ausweitung der Mitbestimmungsmöglichkeiten, etwa auf kommunaler Ebene, ein sinnvolles Zeichen für Integration wäre. Dabei muss jedoch sichergestellt werden, dass diese Veränderungen mit den Werten und Traditionen Liechtensteins vereinbar bleiben.
Statt einer Änderung des Wahlrechts plädieren wir für pragmatische Ansätze: Eine stärkere Einbindung in kommunale Gremien könnte zum Beispiel die gesellschaftliche Integration fördern, ohne bestehende Strukturen übermässig zu verändern. Ein behutsamer Ansatz, der breite Unterstützung findet, ist dabei der nachhaltigste Weg.

Die FBP hat im Mai-Landtag 2024 mit der Postulatseingabe zum Thema «Betreuungs- und Pflegegeld (BPG)» die Umsetzung diverser Massnahmen initiiert, damit dieses Modell der häuslichen Pflege der fortgeschrittenen Entwicklung bezüglich Bedürfnisse und Inanspruchnahme durch die Familien angepasst und damit verbessert wird. Was hat sich nun mit der Verordnungs-Abänderung aufgrund dieses parlamentarischen Vorstosses mit Inkrafttreten am 1. Januar 2025 verändert?
Text: Johannes Kaiser
Eingangs ist es als erfreulich festzuhalten, dass die Regierung einige Anpassungen im Bereich des Betreuungs- und Pflegegeldes vorgenommen hat, wie insbesondere die Tarifanpassung. Bei weiteren Anliegen der Familien, wie beispielsweise der Regelung, dass Spitalaufenthalte für bestimmte Personen nun bis zu zwölf Tage abzugsfrei bleiben, ist die Hilfestellung nur in marginaler Form verbessert worden. Leider wurde ein äusserst wichtiger Punkt völlig ausser Acht gelassen: Die Bestimmung im Ergänzungsleistungsgesetz (Art. 31bis Abs. 1 Bst. a ELV), die bis Ende 2020 bestand hatte, wurde nicht wieder eingeführt.
Die Rücknahme einer drastischen Verordnungsregelung durch die Regierung ab 1.1.2022 erfolgte nicht! Bis Ende 2021 konnten Menschen, die Hilfe im Haushalt oder Unterstützung durch eine
Drittperson benötigten – wenn diese nicht im selben Haushalt lebt –, diese Kosten über Ergänzungsleistungen (EL) abdecken lassen. Diese Regelung existierte schon vor der Einführung des Betreuungs- und Pflegegeldes und wurde über viele Jahre hinweg aufrechterhalten. Durch die Streichung des entsprechenden Artikels hat sich die Situation für Menschen mit sehr geringem Einkommen deutlich verschlechtert. Besonders betroffen sind Personen, die regelmässige, aber nur kurze Betreuungsleistungen benötigen – beispielsweise weniger als eine Stunde pro Tag. Für diese Menschen besteht kein Anspruch auf das Betreuungs- und Pflegegeld, da die Mindestbetreuungszeit für einen Anspruch bei einer Stunde pro Tag liegt.
Diese Veränderung belastet vor allem diejenigen, die ohnehin schon finanziell stark eingeschränkt sind. Menschen mit sehr geringen
Einkommen können sich die notwendigen Betreuungsleistungen häufig nicht leisten und geraten dadurch in noch grössere Schwierigkeiten. Dabei sind gerade solche kleinen Unterstützungen im Alltag oft entscheidend, um schwerwiegenderen Problemen vorzubeugen und die Lebensqualität aufrechtzuerhalten.
Warum die Wiedereinführung der alten Regelung wichtig ist?
Mit der Wiedereinführung der gestrichenen Bestimmung könnten Menschen, die keinen Anspruch auf das Betreuungs- und Pflegegeld haben, wieder Unterstützung erhalten – so wie es bis Ende 2021 möglich war. Diese Massnahme würde besonders denjenigen helfen, die finanziell am schlechtesten gestellt sind und die dringend auf Unterstützung angewiesen sind, um ihren Alltag zu bewältigen. Eine solche Entscheidung wäre nicht nur

sozial gerecht, sondern würde auch dazu beitragen, dass präventive Hilfen für diejenigen zugänglich bleiben, die sie am dringendsten brauchen. Sie könnte helfen, grössere Belastungen für die Betroffenen und auch für die Gesellschaft langfristig zu vermeiden.
Keine ausreichenden Ausnahmeregelungen für Familien mit schwerstkranken Kindern oder schwer Demenzkranke
Bereits in der Postulatsbeantwortung der Regierung, die im November 2024 im Landtag behandelt wurde, wurden Regelungen und Verbesserungen von Ausnahmesituationen, bei denen schwerstkranke Kinder oder schwer Demenkranze betroffen sind, völlig vermisst. Auch in der Verordnungsabänderung betreffend das Betreuungs- und Pflegegeld mit Inkrafttreten vom 1. Januar 2025 werden Ausnahmesituationen, bei denen Eltern beispielsweise ein schwerstbehindertes Kind 24 Stunden an sieben Tagen pro Woche begleiten, ausgeblendet:
• Zwölf Tage sind für viele Krankengeschichten von Menschen mit Behinderung eine viel zu kurze Zeitspanne. So können Betroffene Familien nicht nachvollziehen, dass man sich bei solch schwerwiegenden Krankengeschichten an der Anzahl Tage, wie sie für Ferienaufenthalte gelten, orientiert!
• Bei Kindern bis 18 Jahre wird auf die Rückforderung verzichtet. Bei Erwachsenen nur ab Pflegestufe 5 oder 6. Erwachsene Menschen mit Behinderung sowie ihre familiäre Betreuungsperson werden hier grossmehrheitlich ausgeschlossen!
Zwar Teuerungsanpassung –aber im Minimalbereich
Die FBP forderte von der Regierung mit dem Postulat betreffend «Massnahmen zur Optimierung und Weiterentwicklung des Betreuungs- und Pflegegeldes», die Tarife seit der Einführung des BPG im Jahre 2010 – also vor bald 15 Jahren – dringend der Teuerung anzupassen. So können mindestens die gestiegenen Lohnkosten im Betreuungs- und Pflegebereich ausgeglichen werden.
Dieser Forderung der Postulanten ist die Regierung per Verordnung vom 1. Januar 2025 (LGBl. 2024 Nr. 420) nachgekommen, in dem die Tarife der einzelnen Pflegestufen um jeweils 5 % (gerundet auf den nächsten Franken) gemäss der Entwicklung des Landesindexes der Konsumentenpreise erhöht wurden.
Steigende Lohnkosten belasten Bezüger viel mehr als Konsumentenpreisentwicklung
Das Problem besteht darin, dass der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) die Teu-
erung im Bereich des Konsums der privaten Haushalte in der schweizerischen Volkswirtschaft insgesamt misst (Warenkorb) und nicht die Teuerung eines bestimmten Haushaltes. Der einzelne Haushalt kann aufgrund der abweichenden Ausgabenstruktur stärker oder schwächer von der Preisentwicklung betroffen sein.
Für das Betreuungs- und Pflegegeld beziehungsweise den BPG-Bezüger fallen insbesondere die steigenden Lohnkosten für Betreuungs- und Pflegepersonal ins Gewicht. Dies wird mit dem Landesindex der Konsumentenpreise nicht adäquat abgebildet. Dies bedeutet, dass die reale Teuerung für den BPG-Bezüger von Betreuungs- und Pflegegeld höher liegt als der Landesindex für Konsumentenpreise. Die Tarifanpassung der Regierung bewegt sich somit im Minimalbereich.
«Der
ist nicht per se gegen eine Steuersenkung»
Die Gemeindefinanzen sind in Balzers immer wieder ein Thema, das die Bevölkerung beschäftigt. Derzeit ist die Gemeinde dank des horizontalen Finanzausgleichs auf dem besten Weg, wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Eine vorzeitige Senkung des Gemeindesteuerzuschlags könnte diesen Erfolg aber zunichtemachen.
Vorsteher Karl Malin erklärt, warum er für 170 Prozent plädiert und zeigt auf, was die Gemeinde mit den zusätzlichen Geldern zum Wohle der Bevölkerung plant.
Interview: Heribert Beck
Herr Gemeindevorsteher, Sie konnten zusammen mit Gemeinderat, Verwaltung und Bevölkerung im vergangenen Jahr gleich mehrere Meilensteine setzen. Dennoch ist die Gemeinde medial derzeit vor allem mit zwei Themen präsent. Beginnen wir mit jenem, das Sie direkt betrifft: Aufgrund welcher Argumente hat sich der Gemeinderat Ende November 2024 einstimmig entschieden, den Steuerzuschlag vorläufig bei 170 Prozent zu belassen?
Gemeindevorsteher Karl Malin: Bei einer Senkung des Gemeindesteuerzuschlags von 170 auf 150 Prozent würden der Gemeinde auf einen Schlag jährlich rund 1,5 Millionen Franken in der Kasse fehlen. Es ist ein Ziel des Gemeinderates, den Satz in den kommenden Jahren nach Möglichkeit zu senken. Die angespannte finanzielle Lage lässt dies jedoch im Moment noch nicht zu. Das vorliegende Budget 2025 wurde bewusst schlank gehalten, damit im Hinblick auf die anstehenden

Sanierungen, insbesondere den Neubau der im Jahr 1970 eröffneten Sportanlagen Rheinau, die Reserven noch aufgebaut werden können. Für das Jahr 2025 könnte übrigens erstmals seit 2019 wieder mit einem Aufbau der Finanzreserven in Höhe eines Betrags von rund 405'000 Franken gerechnet werden, wenn der Gemeindesteuerzuschlag bei 170 Prozent bleibt.
Wie steht es generell um die Gemeindefinanzen? Gerade auch angesichts des neuen horizontalen Finanzausgleichs.
Die IG «Gemeindesteuerzuschlag 150 %» «wirbt» damit, dass die Gemeinde per Ende 2023 ein Plus von 17,8 Millionen Franken hatte. Sie verschweigt aber, dass dieses Plus vor gerade einmal fünf Jahren noch 33,6 Millionen Franken betrug. Balzers hatte also innerhalb eines kurzen Zeitraums eine Abnahme von beinahe der Hälfte oder 15,8 Millionen Franken zu verzeichnen. Aktuell, also per Ende 2024, reduzierten sich die «flüssigen» Finanzmittel weiter auf rund 13,7 Millionen Franken, wobei 10 Millionen Franken zur Abdeckung der laufenden Geschäfte nicht unterschritten werden sollten. Nicht zu vergessen: mit dem bestehenden Gemeindesteuerzuschlag von 170 Prozent! Der grösste Teil des rasanten Abbaus der Finanzreserven wurde in den von der Mehrheit der Bevölkerung gutgeheissenen Dorfplatz investiert. Den Gemeindeverantwortlichen ist aber auch bewusst, dass weitere dringende Investitionen anstehen.
Was würde es für die finanzielle Situation der Gemeinde bedeuten, wenn der Steuersatz nach dem Willen des Referendumskomitees auf 150 Prozent gesenkt würde?
Es ist generell festzuhalten, dass sich der Gemeinderat nicht per se gegen eine Steuersenkung ausspricht. Es geht also nicht um das Ob, sondern um das Wann und Wie. Für den Gemeinderat ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Der Handlungsspielraum der Gemeinde in Bezug auf zukünftige Investitionen würde abrupt abnehmen. Was dem Grundgedanken des neuen Finanzausgleichs, nämlich der Stärkung der Gemeindeautonomie, diametral widersprechen würde. Wichtig ist auch zu wissen, dass es bei dieser Abstimmung nicht um die Frage 170 oder 150 Prozent Gemeindesteuerzuschlag geht. Es geht um die Zustimmung oder Ablehnung des Gemeinderatsbeschlusses vom 27. November 2024, mit dem der Gemeinderat einstimmig die Beibehaltung des Gemeindesteuerzuschlags von 170 Prozent für das Steuerjahr 2024 festgelegt hat.
Wie könnte ein Vorgehen einer für die Gemeinde vertretbaren und verkraftbaren Senkung des Gemeindesteuerzuschlags aussehen?
Der Gemeinderat hat die Finanzkommission der Gemeinde Balzers Ende letzten Jahres beauftragt, ein entsprechendes Strategiepapier zuhanden des Gemeinderates zu erarbeiten, dies in Zusammenarbeit mit externen Finanzexperten. Der Gemeinderat möchte eine Entscheidung für Balzers aufgrund einer fachlich und inhaltlich fundierten Analyse und aufgrund von Expertenempfehlungen fällen. Man muss sich im Klaren sein, dass ein einmal etablierter Steuersatz von 150 Prozent auch einen gewissen finalen Charakter in sich trägt. Eine Erhöhung, aus was für nachvollziehbaren Gründen auch immer, wäre nur sehr schwer zu erreichen. «Hüftschüsse» wären wohl der falsche Weg und würden der Wichtigkeit dieser Entscheidung, auch für kommende Generationen,





nicht gerecht. Unsere Aufgabe ist es, dieses Thema solide, fundiert und mit Balzner Augenmass anzugehen.
Welche grösseren Investitionen kommen auf Balzers zu, für die Sie die zusätzlichen Mittel aus dem Zuschlag von 170 Prozent gerne einsetzen würden?
Aktuellstes Beispiel, ich habe es bereits kurz angetönt, ist die Neuerstellung der über 50 Jahre alten Sportanlagen Rheinau. Ein generationenübergreifendes Projekt, das in Form einer Investition direkt der sportbegeisterten Bevölkerung zugutekommen würde. Die Realisierung ist schon mit der Beibehaltung des jetzigen Steuersatzes ein
Egerta 15 · 9496 Balzers 00423 388 28 28 www.evogt.li


zünftiger «Hosenlupf», aber einer, der dank der Mehreinnahmen aus dem neuen Finanzausgleich und einer etappenweisen Umsetzung auch realisierbar wäre.
Ein anderes Grossprojekt hat Balzers im vergangenen Jahr zu einem würdigen Abschluss gebracht. Welche Rückmeldungen erhalten Sie zum neuen Dorfplatz und wie wirkt er sich auf das Leben in der Gemeinde aus?
Das bestens besuchte Eröffnungsfest des Dorfplatzes wurde durchwegs als sehr positiv beurteilt. An drei Tagen war das Zentrum von Balzers ein Treffpunkt für Jung und Alt und zahlreiche Balznerinnen und Balzner, aber auch Gäste von nah und fern haben das Generationenprojekt Dorfplatz mit Stolz und Freude in Augenschein genommen. Sicherlich ist es nun eine Herausforderung, den Dorfplatz weiterhin mit Leben zu füllen. Der Gemeinderat hat dafür eine Arbeitsgruppe bestimmt und für Initialveranstaltungen finanzielle Mittel gesprochen. Wir sind zuversichtlich, dass in diesem Jahr wieder zahlreiche Veranstaltungen auf dem Dorfplatz stattfinden. Die grösste Veranstaltung wird das Landesfeuerwehrfest mit Gästen aus ganz Liechtenstein und der Region sein.
Ein weiteres Projekt, das nach längerer Vorarbeit vor einem Abschluss steht, ist die Integration der Lebenshilfe Balzers in die Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe, kurz LAK. Warum ist dieser Schritt nach vielen Jahren der Selbständigkeit notwendig geworden und wie steht es um die Umsetzung?
Sowohl der Vorstand der Lebenshilfe Balzers als auch die Gemeindeverantwortlichen haben sich dieses essenziell wichtigen Themas mutig und mit Zuversicht angenommen und Anfang 2024 wegweisende Entscheide getroffen. Die Beweggründe für die Integration sind das in den
Für das Jahr 2025 könnte erstmals seit 2019 wieder ein Aufbau der Finanzreserven im Betrag von rund 405'000 Franken erwartet werden, wenn der Gemeindesteuer zuschlag bei 170 Prozent bleibt.
Karl Malin, Gemeindevorsteher von Balzers
nächsten Jahren und Jahrzehnten zu erwartende starke Wachstum in der stationären und ambulanten Langzeitpflege mit Hinblick auf die demografische Entwicklung, der damit einhergehende Bettenbedarf im stationären Bereich, die betriebswirtschaftlichen Herausforderungen und das Thema Fachkräftemangel im Pflegebereich.
In sämtlichen Gremien wurde die angestrebte Integration mit grosser Zustimmung aufgenommen. Seit 1. Januar 2025 wird das Alters- und Pflegeheim Schlossgarten von der LAK geführt, und die Familienhilfe

LAK-Haus Schlossgarten
Liechtenstein betreut und unterstützt die Pflegebedürftigen ambulant. Gerade im Bereich Familienhilfe/Spitex profitieren nun viele Balznerinnen und Balzner von einem breiteren Angebot rund um die Uhr, 7 Tage in der Woche!
In Sachen öffentliche Mobilität geht Balzers ebenfalls neue Wege. Warum hat sich die Gemeinde für den ersten elektrisch betriebenen Ortsbus des Landes entschieden?
Balzers hat das Label Energiestadt und somit war klar, dass im Gemeinderat über ein Elektrobus diskutiert wird. Schliesslich hat sich der Gemeinderat klar für einen solchen Elektrobus entschieden. Erste


Der am 16. Dezember 2024 eingeführte Ortsbus Balzers mit Elektroantrieb.
Vorabklärungen bezüglich allfälliger Mehrkosten für einen Elektrobus dämpften die Erwartungen zwar, haben aber glücklicherweise ergeben, dass dem nicht so ist. Der Elektrobus war in der Anschaffung nicht teurer als ein Dieselbus. Dabei ist der Fahrkomfort wesentlich besser und die Ladekapazität der Batterie reicht selbst in der kalten Jahreszeit für einen ganzen Tag. Ja, Balzers ist stolz, als erste Gemeinde einen elektrischen Ortsbus zu betreiben!
Gleichzeitig kam in Sachen Ortsbus auch Kritik auf, dass er zu selten verkehre. Wie sehen Sie dies?
Bereits zu Anfang der Legislatur musste der neue Gemeinderat über

Vielseitige Seminarräume und charmante Übernachtungsmöglichkeiten.
Haus Gutenberg +423 388 11 33 gutenberg@haus-gutenberg.li

Balzers im fokus
die Weiterführung des Ortsbusses entscheiden. Die Diskussionen im Gemeinderat zeigten, dass die Weiterführung nur mehrheitsfähig ist, wenn die Kosten für den Ortsbus deutlich reduziert werden. In der Folge einigte man sich auf einen «optimierten» Fahrplan, zumal in den «gestrichenen» Zeiten gemäss Fahrgastzählungen nur sehr wenige Personen nachgewiesen wurden. Mittlerweile hat sich der neue Fahrplan etabliert, und die Fahrgäste freuen sich über den trendigen Elektrobus.
Das zweite, eingangs angesprochene mediale Thema in Bezug auf Ihre Gemeinde ist der Instagram-Hype um den FC Balzers. Er wurde natürlich nicht von der Verwaltung initiiert, passt aber gut zu einem Dorf mit einem so aktiven Vereinsleben wie Balzers. Wie schätzen Sie diesen Hype ein?
Zuerst einmal freut mich diese internationale positive Aufmerksamkeit für den FC Balzers und seine vielen Mitglieder. Balzers ist eine Gemeinde, die schon immer weit über die Region hinaus für ihr aktives, vielfältiges und erfolgreiches Vereinsleben bekannt war und ist. Jetzt hat die Reichweite der Bekanntheit nochmals deutlich zugenommen. Dieses Beispiel zeigt auch, wie die heutige vernetzte Welt


Skizzierte Plandarstellung der Sportanlagen Rheinau
funktioniert und was die Kommunikation über die sozialen Medien erreichen und bewirken kann. Ich würde mich freuen, wenn sich aus den unzähligen virtuellen Bekanntschaften auch die eine oder andere nachhaltige Freundschaft im realen Leben ergeben würde. Und natürlich wünsche ich allen grossen und kleinen Fussballerinnen und Fussballern des FC Balzers nach der Winterpause einen guten Start und dass sie diese positive Stimmung mit auf den Platz nehmen können.
Wenn wir beim Wünschen sind und angesichts des noch jungen Jahres: Was wünschen Sie sich und der Balzner Bevölkerung für 2025?
Für das Jahr 2025 wünsche ich allen Balznerinnen und Balznern viel Glück, Erfolg und Gesundheit. Ich wünsche mir, dass wir die «gelebte Gemeinschaft» in Balzers weiterhin pflegen und solidarisch und respektvoll miteinander umgehen, denn es gibt noch viel zu tun!


Organisationen, die von LGT Venture Philanthropy unterstützt werden, helfen der ländlichen Bevölkerung in Ostafrika, ihre Ökosysteme zu schützen und gleichzeitig ihre Lebensbedingungen zu verbessern.
Text: Tilmann Schaal



Die Natur blüht auf, wenn es den Gemeinschaften gut geht. Davon sind die Expertinnen und Experten von LGT Venture Philanthropy überzeugt und folgen deswegen der Strategie, skalierbare Massnahmen zu entwickeln, die Dörfer und Kommunen stärken und dabei gut für das dortige Ökosystem sind. Umgesetzt wird diese Strategie in Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen in Ostafrika.
Ein gutes Beispiel für diesen Ansatz findet sich in Kenias Maasai Mara, einem wichtigen Hotspot in Sachen Artenvielfalt. Aufgrund von Klimawandel und Bevölkerungsdruck ist das Ökosys-
Wiederherstellung von Grasland, Massnahmen zur Verringerung von Konflikten mit Wildtieren und die Schaffung nachhaltiger Einkommensquellen für die lokale Bevölkerung.
Daraus sind herausragende Initiativen wie die Einrichtung der Schutzgebiete Mara Naboisho und Pardamat entstanden. Land wurde dort von den Maasai-Landbesitzern gepachtet, um Schutzgebiete mit Wildtierkorridoren zu eröffnen, nachhaltige Einkommen zu schaffen und die Wildtierpopulation zu stärken. Bemerkenswert ist, dass im Mara Naboisho Schutzgebiet zwischen 2014 und 2017 ein Anstieg der Elefantenpopulation um 72 % verzeichnet wurde. 95 % der Ar-

tem dort jedoch unter Druck. Die Maasai und ihr Vieh leiden unter einem sich verschärfenden Wassermangel, was zu Konflikten zwischen Dorfbewohnern und Tierwelt führt. LGT Venture Philanthropy hat deshalb eine Partnerschaft mit Basecamp Explorer Kenya (jetzt Saruni Basecamp) und weiteren Organisationen geschlossen, um mit der Bevölkerung vor Ort konkrete Lösungen zu entwickeln, z. B. die
beitskräfte in den dortigen Tourismusbetrieben entfallen auf die lokalen Maasai.
Da der Tourismus in der Strategie eine wichtige Rolle spielt, musste auf die COVID-19-Pandemie und ihre Folgen reagiert werden. LGT Venture Philanthropy unterstützte den Opex Fund, der den Schutzgebieten in diesen schwierigen Zeiten operative Unterstützung bot, sodass
sie funktionsfähig bleiben. Zudem wurden Alternativen zum Tourismus als Einkommensquelle aufgebaut, zum Beispiel mittels CO₂-Gutschriften durch die Initiative One Mara Carbon Project. Mit den Kohlenstoffgutschriften zum Ausgleich von Emissionen schützt es das Grasland und schafft so eine nachhaltige Einkommensquelle für die Dörfer.
Abseits von Finanzhilfen unterstützt LGT Venture Philanthropy durch das LGT Impact Fellowship Program talentierte Fachkräfte in lokalen Organisationen. Sie werden in Bereichen wie Projektmanagement, Marketing und Wirkungsmessung geschult, damit sie mit ihrem
Know-how den Wandel vor Ort optimal vorantreiben. Insgesamt 86 Fellows haben zwischen 2009 und 2024 das Wachstum und die Skalierung der lokalen afrikanischen Organisationen und Firmen effektiv gefördert.
Die Partnerorganisationen und Massnahmen von LGT Venture Philanthropy folgen dem ehrgeizigen Ziel der 15. Konferenz der Vertragsparteien (COP15) zur biologischen Vielfalt. Danach sollen bis 2030 insgesamt 30 % der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz gestellt werden. Die Stärkung dörflicher Gemeinschaften und die Förderung strategischer Partnerschaften leisten dazu einen wichtigen Beitrag, jetzt und in Zukunft.

Über LGT Venture Philanthropy
LGT Venture Philanthropy ist eine unabhängige gemeinnützige Stiftung, die 2007 gegründet wurde und Teams in der Schweiz, Subsahara-Afrika und Indien unterhält. Die Stiftung setzt sich dafür ein, die Lebensqualität benachteiligter Menschen zu verbessern, zu gesunden Ökosystemen beizutragen und widerstandsfähige, inklusive und wohlhabende Gemeinschaften aufzubauen. LGT VP konzentriert sich auf die Stärkung der Fähigkeiten lokal verankerter Organisationen, die wirksame und skalierbare Lösungen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Umwelt anbieten und damit direkt zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beitragen.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.lgtyp.com
Die Liechtensteiner Wirtschaft ist ein hervorragendes Beispiel, wie ein kleiner Staat sich ökonomisch erfolgreich positionieren kann. Dieser beeindruckende Weg kann in Zukunft nur mit Erfindergeist, Flexibilität und Leistungsbereitschaft fortgesetzt werden. Dazu gehört auch das Glück, mitten in Europa gelegen und verschont von Kriegen geblieben zu sein.
Text: Karlheinz Ospelt
Wirtschaftsstruktur in Liechtenstein (Liechtenstein in Zahlen 2024)
Die Wirtschaft des Fürstentums Liechtenstein ist vorwiegend auf den tertiären (Dienstleistung mit knapp 65 % der Beschäftigten) und den sekundären (Industrie mit 35 % der Beschäftigten) Wirtschaftssektor konzentriert. In der Landwirtschaft arbeiten lediglich noch 0,6 % der Beschäftigten. Im Vergleich zu unseren Nachbarstaaten nimmt damit der Industriesektor einen wesentlich grösseren Anteil ein (CH = 20 %, A = 26 %), die Landwirtschaft einen kleineren (CH = 2,7 %, A = 3,5 %). Entsprechend gab es immer weniger Landwirtschaftsbetriebe (1980 = 494, 2020 = 95).
An die Bruttowertschöpfung trugen die Dienstleistungsunternehmen im Jahr 2021 insgesamt 57,8 % bei, die Industrie- und Gewerbeunternehmen 42 % und die Landwirtschaft 0.2 %. Von den rund 5'500 Unternehmen zählten 88 % weniger als 9 Beschäftigte, knapp 10 % zwischen 10 und 50 Mitarbeitende, knapp 2 % zwischen 50 und 250 und nur 20 Unternehmen bzw. nicht einmal 0,4 % mehr als 250 Arbeitnehmende.
Liechtenstein als Wirtschaftsmotor der Region
Gemäss der aktuellen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung Liechtensteins aus dem Jahr 2022 beträgt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) rund 7 Milliarden Schweizer Franken. Die Zahlen werden mit rund zweijähriger Verzögerung publiziert. Während das BIP während
vieler Jahren laufend zugenommen hat, sank es während der Coronajahre von 6,5 Milliarden Franken im Jahr 2018 auf 6 Milliarden Franken im Jahr 2020. Davon erholte sich das BIP sehr schnell, und es lag 2021 und 2022 bei 7 Milliarden Franken. Für 2022 bedeutet dies bei einer durchschnittlichen Inflation von 2,8 % jedoch einen entsprechenden Rückgang des realen BIP. Beim BIP liegt Liechtenstein mit rund 210'000 Franken pro Kopf an der absoluten Spitze der Länderliste. Damit ist Liechtenstein auch als Wirtschaftsmotor für die Bodenseeregion von grosser Bedeutung. Mit über 42'500 Arbeitsplätzen übertrifft es sogar die Anzahl der rund 41'000 Einwohner Liechtensteins. Die meisten Grenzgänger kommen aus der Schweiz (60 %) und aus Österreich (36 %).
Zölle und internationale Vorgaben: Die liechtensteinische Wirtschaft ist abhängig von offenen Grenzen, sowohl was die Industrie als auch die Finanzbranche betrifft. Die internationale Verflechtung hat im Lauf der Zeit stets zugenommen. Damit wurde auch deren Bedeutung immer wichtiger. Während lange Zeit (1852–1919) der Zollvertrag mit Österreich-Ungarn und ab 1924 jener mit der Schweiz im Zentrum standen, wurde nach und nach eine eigenständige internationale Einbettung angestrebt, die bis heute anhält. 1960 unterzeichnete Liechtenstein das Zusatzprotokoll über die Beteiligung an der EFTA, und 1991 wurde das Land selbständiges Mitglied. 1995 erfolgte der Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), später folgten Doppelbesteuerungsabkommen mit zahlreichen Ländern
und Handelsabkommen, in der Regel über die EFTA oder den EWR. Mehr als 90 % der in Liechtenstein hergestellten Produkte werden ins Ausland exportiert, primär in die EU, die Schweiz und die USA.
Finanzdienstleitungen, Konflikte in Steuerfragen und Neuorientierung
Der Finanzsektor mit Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Treuhandgesellschaften inklusive Rechts- und Steuerberatung sowie Wirtschaftsprüfung trägt knapp einen Viertel zum BIP bei. Liechtenstein verteidigte bis zur Jahrtausendwende eines der strengsten Bankgeheimnisse weltweit. Viele Jahrzehnte weigerte sich Liechtenstein, Steuerinformationen an andere Staaten weiterzugeben. Doppelbesteuerungsabkommen gab es lange nur mit den direkten Nachbarn Schweiz und Österreich, weil diese infolge der Grenzgänger notwendig waren. Diese Abkommen waren aber inhaltlich sehr beschränkt, und es gab auch mit den beiden Nachbarstaaten keinen Informationsaustausch über Bankdaten. Die im Handelsregister eingetragenen und hinterlegten Gesellschaften inklusive Sitzgesellschaften erreichten ihren Höhepunkt mit rund 85'000 im Jahr 2007. Heute sind es nicht einmal mehr 25'000.
In der Finanzkrise 2007, mit dem Zusammenbruch der Bank Lehman Brothers im September 2008, geriet die Liechtensteiner Finanzbranche zudem international in die Kritik, was zu einem massiven Einbruch und zu einer Umgestaltung des bis dahin prosperierenden Off-Shore-Geschäfts in der Treuhandbranche
führte. Mit dem Fall Heinrich Kieber und dessen Handel mit Kundendaten war der liechtensteinische Finanzdienstleistungssektor an einem Wendepunkt angekommen. Die Folgen waren Bestrebungen für einen internationalen Austausch von Steuer- und Bankdaten – vorerst auf Anfrage. 2010 trat das erste Tax Information Exchange Agreement (TIEA) mit den USA rückwirkend für das Steuerjahr 2009 in Kraft. Diesem folgten zahlreiche weitere solcher Abkommen. In den folgenden Jahren kam es zu Doppelbesteuerungsabkommen mit zahlreichen Ländern, die das Treuhandgeschäft neu ausrichteten. Statt Masse war nun Know-how gefragt, und Liechtensteins Finanzdienstleister konnten sich bis heute erfolgreich durchsetzen.
Staatsverschuldungen als Folge der Finanzkrise – Liechtenstein als Ausnahme
Die Finanzkrise 2007 forderte international zahlreiche Opfer. Auch die europäische Zentralbank war gefordert. Griechenland, Irland, Zypern und Island gerieten in eine schwierige Situation. Dazu kamen einige Jahre später politisch Umbrüche in Libyen, Ägypten und Syrien. Die Probleme führten zu hohen Staatsverschuldungen, die bis heute anhalten. Gemäss einer Liste des Internationalen Währungsfonds aus dem Jahr 2023 führen Japan (250 %), Griechenland (160 %) und Italien (140 %) die Liste der Staatsverschuldung in Prozent des BIP an. Aber auch Portugal, Spanien, Belgien Frankreich, das Vereinigte Königreich und Kanada weisen über 100 % des BIP an Staatschulden aus. Die gesamte Volkswirtschaft dieser Länder müsste somit mehr als ein Jahr gratis für den Staat arbeiten und die Erlöse abgeben, um die Staatsschulden zu decken. Die Schweiz mit einer Staatsverschuldung von ca. 35 % des BIP liegt auf Rang 143 der rund 190 Staaten umfassenden Liste.
Bei Wikipedia ist nachzulesen: «Die Angaben sind ohne Verpflichtungen für Beamtenpensionen, Krankenversicherung, Gesundheitspflege und Rentenversicherung, für die keine Kapitaldeckung besteht. Unter Einbeziehung der verdeckten Staatsverschuldung würde die Staatsschuldenquote um ein Vielfaches steigen.» Und der letzte Satz dazu ist bemerkenswert: «Es gibt –wenige – Länder ohne Staatsverschuldung, darunter Liechtenstein.» Liechtenstein hat auch eine geringe Staatsquote. Diese ist aber nicht nur einer guten Politik geschuldet, sondern auch dem Umstand, keine Militär- und Zinslasten tragen zu müssen.

Fachkräftemangel und der demographische Wandel Nicht nur in Liechtenstein, sondern weltweit werden mehr und mehr Fachkräfte gesucht. Dazu kommt, dass der Rentneranteil in Liechtenstein drastisch ansteigen wird. Liechtenstein ist gefordert, als Wirtschaftsstandort gut aufgestellt zu bleiben. Neben attraktiven, hoch bezahlten Arbeitsplätzen müssen dazu auch die Softfaktoren stimmen. Die Rahmenbedingungen in den Nachbarländern haben sich in den letzten Jahren stets verbessert, sodass Liechtenstein mehr und mehr unter Druck gerät. Mit der Einführung von Eltern- und Vaterschaftsurlaub, der Erhöhung des Kindergelds und der AHV-Rente wurde 2024 viel investiert, was aber die Unternehmen künftig belasten wird.
Vor allem jüngere Arbeitnehmer verlangen nach einer besseren Work-Life-Balance. Dazu gehört mehr Zeit für die Familie und für sich persönlich. In diesem Zusammenhang muss Liechtenstein dafür sorgen, dass die Arbeitswege für die Grenzgänger nicht unnötig durch Staus und Restriktionen zeitintensiver werden. Dauert der Arbeitsweg pro Tag durchschnittlich pro Arbeitnehmer nur 15 Minuten länger, so resultiert bei einem Medianlohn von aktuell 6850 Franken pro Monat ein Schaden von über 100 Millionen Franken pro Jahr – allein unter Berücksichtigung der Lohnsumme, ohne die zusätzliche Wertschöpfung der Unternehmen. Während beim Staat beschäftigte Grenzgänger von der Besteuerung ihres Gehalts in Liechtenstein profitieren können, entfällt dieser gewichtige Vorteil für in der Privatwirtschaft angestellte Grenzgänger. Dieser steuerliche Nachteil der Privatwirtschaft auf dem Arbeitsmarkt wurde kürzlich noch erhöht, weil der Gemeindesteuerzuschlag für beim Staat angestellte Grenzgänger von 200 % auf 150 % reduziert wurde, wo hin-
gegen dieser bei einzelnen liechtensteinischen Gemeinden nach wie vor bei 170 % liegt. Beim Staat und staatsnahen Betrieben zahlen also ausländische Arbeitnehmer weniger Steuern als gewisse dort angestellte Liechtensteiner.
Fazit
Auch Liechtenstein hat mit der unsicheren Weltwirtschaftslage zu kämpfen. Wenn die Leistungsbereitschaft und das Unternehmertum sowie eine gute Hand für richtige Entscheidungen in Wirtschaft und Politik die Basis bilden, können Liechtenstein und seine Bevölkerung trotz widrigen Umfelds positiv in die Zukunft blicken denn: Small is beautiful!

Lic. oec. Karlheinz Ospelt ist Vorsitzender des Immobilienfachausschusses der AHV/IV/FAK, Ehrenpräsident der Neue Bank AG, ehemaliger Bürgermeister von Vaduz und ehemaliger Landtagsabgeordneter, Verwaltungs- und Stiftungsrat diverser Unternehmen und Gründer sowie Inhaber der Firma FIDUCIA CONSULTING Est. (1992).

«Wie wird die Zukunft mit der ganzen Digitalisierung sein?»
Noelia Ritter aus Mauren ist 18 Jahre jung und beruflich als Pharmaassistentin FZ in der Laurentius Apotheke in Schaan tätig. Aufgrund des sehr erfolgreichen Lehrabschlusses mit der ausgezeichneten Note 5,3 durfte sie sich im September 2024 auf Schloss Vaduz ins Goldene Buch eintragen. Dazu gratulieren wir Noelia herzlich! Im Interview lässt sie einen Blick in ihre Welt zu und erklärt, welche beruflichen Ziele sie hat, was Jugendliche bewegt und beschäftigt und weiteres mehr.
Interview: Johannes Kaiser

Noelia, du hast deine Lehre zur Pharmaassistentin FZ in der Laurentius Apotheke in Schaan 2024 sehr erfolgreich abgeschlossen. War dies immer schon ein Wunschberuf von dir und was fasziniert dich an dieser Tätigkeit?
Noelia Ritter: In der Zeit der Berufswahl war für mich eigentlich schnell klar, dass ich einen Beruf in der Gesundheitsbranche lernen möchte. Beim Schnuppern hat sich das bestätigt. Ich finde es sehr schön, dass ich mit meinem Wissen Menschen helfen kann und geniesse auch den persönlichen Kontakt mit den Kunden. Mein privates Umfeld fragt mich natürlich ebenfalls regelmässig nach Tipps, was ich sehr schön finde.
Mit dem ausgezeichneten Abschluss deiner Berufsausbildung mit der Note 5,3 konntest du dich ins Goldene Buch eintragen. Wie war für dich dieses Erlebnis im September letzten Jahres auf Schloss Vaduz?
Natürlich war ich sehr stolz, dass ich die Lehre mit Auszeichnung
bestanden habe. Der Anlass auf Schloss Vaduz war sehr feierlich und den Erbprinzen Alois persönlich zu treffen, war auch sehr schön. Ich fand es interessant, mich mit anderen Geladenen auszutauschen und gemeinsam auf unsere Leistungen anzustossen.
Wo arbeitest du derzeit und was sind deine weiteren beruflichen sowie persönlichen Ziele?
Zurzeit arbeite ich in der Laurentiusapotheke in Schaan. Ich möchte mich in Zukunft noch weiterbilden, bin mir aber noch nicht sicher, in welche Richtung es geht. Zum Beispiel würden mich Mode und Design sehr interessieren.
Welche gesellschaftspolitischen Themen beschäftigen dich als junge Erwachsene?
Mich beschäftigt vor allem das Thema Nachhaltigkeit. Ich finde, wir leben in einer sehr verschwenderischen Welt. Mit diesem Thema bin ich vor allem beim Shoppen konfrontiert. Ich gehe gerne in Second-Hand-Läden etwas kaufen, das eine gute Qualität aufweist und dazu her noch güns-
tig ist. Ich freue mich jedes Mal, wenn, ich etwas Einzigartiges gefunden habe.
Welches sind für dich die zentralen Anliegen, welche die zukünftige Welt der Jugend betreffen?
Das Thema Klimawandel beschäftig mich schon. Ich möchte, dass auch die nächsten Generationen noch eine gesunde und lebenswerte Welt vorfinden. Zudem denke ich auch darüber nach, wie die Zukunft mit der ganzen Digitalisierung sein wird.
Werden die Jugendlichen in ihrer Meinungsbildung ausreichend gehört beziehungsweise ihre Meinung in die Entscheidungsprozesse integriert?
Ich denke, Jugendliche, die sich sehr für unsere Politik interessieren, haben schon die Möglichkeiten, sich und ihre Meinung sowie Ansicht einzubringen. Zum Beispiel in der Jugendunion der VU, in der Jungen FBP usw.
Wie könnte die Jugend bei der Mitgestaltung und Mitbe -
stimmung noch intensiver eingebunden werden? Wäre das Wahlalter 16 ein Weg?
Ich finde das Stimmalter 18 gut. Ich glaube nicht, dass ich mit 16 schon bereit gewesen wäre, aktiv in der Politik mitzubestimmen. Vielleicht wäre es sinnvoll, das Thema Politik in den weiterführenden Schulen in Liechtenstein stärker zu vertiefen. Da wir in die Schweiz zur Berufsschule müssen und dort nur die Schweizer Staatskunde lernen, fehlt oft einfach das vertiefte Wissen in unseren liechtensteinischen Verhältnissen.
Was machst du in der Freizeit –welches sind deine Hobbys?
Ich habe seit der ersten Klasse Primarschule für zehn Jahre Ballett getanzt. Leider musste ich aber aufgrund der LAP aufhören, da ich mich voll auf einen guten Lehrabschluss konzentrieren wollte. Momentan gehe ich gerne laufen, joggen oder ins Fitnessstudio.
Danke, Noelia, für dieses interessante und sehr sympathische Gespräch.


attraktive Werbepakete statt teure Sekundenpreise
hohe Aufmerksamkeitsspanne durch kurze Werbeblöcke
individuelle Werbelösungen
Sendegebiet von Liechtenstein über Ostschweiz, Vorarlberg bis Süddeutschland
Medienpartnerschaften | Reportagen | Podcast-Studiovermietung | Start-up-Pakete professionelle Telefonansagen | Sponsorings | Unternehmensportraits | Radiospots JETZT werben!

Mehr als nur
Fühlst du dich gestresst, erschöpft und ausgebrannt?
Im Lunar Soul Studio liegt mein Fokus darauf, einen besonderen Raum für Frauen zu schaffen. Mit individuellen Massagen, Energiearbeit und Workshops unterstütze ich dich dabei, mehr Selbstliebe, innere Zufriedenheit und ein tieferes Bewusstsein für deinen Körper zu entwickeln.
Buche jetzt deinen Termin online! www.lunarsoul.studio
Anna-Alexandra Negele
Therapeutische Masseurin
Reiki-Meister/Lehrer
Benderer Strasse 33
9494 Schaan
Liechtenstein
contact@lunarsoul.studio www.lunarsoul.studio
+41 79 519 22 15

Viele Menschen sind krank oder fühlen sich nicht wohl. Oft liegt dies an ungenügender Bewegung. Denn ausreichend Bewegung ist essenziell für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Wie kann man also mehr Bewegung in den Alltag bringen?
Wenn wir nicht wollen, müssen wir uns nicht bewegen. Vieles wird bequem von daheim aus erledigt, und wenn wir dennoch ausser Haus müssen, nehmen wir einfach das Auto. Diese Entwicklung wirkt sich früher oder später auf die Herz- und Kreislauf-Erkrankungen aus. Sie gehören zu den häufigsten nichtübertragbaren Krankheiten in der Schweiz und Liechtenstein. Allen diesen Krankheiten könnte mit genügend Bewegung vorgebeugt werden. Aber man muss etwas dafür tun.
Wer regelmässig seine Fitness trainiert, meistert den Alltag besser, geniesst noch im hohen Alter eine gute Lebensqualität und reduziert das Risiko verschiedener, oft tödlicher Krankheiten.
Fitness in vier Kategorien
Zur Fitness zählen die vier Kategorien Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordination. Die Auswirkungen sind bei jeder Fitness-Sparte anders:
• Ausdauer- und Krafttraining stärken vorwiegend das Herz-Kreislaufsystem und wirken Krankheiten wie Herzinfarkt, Bluthochdruck und Diabetes entgegen. In der Schweiz konnte im vergangenen Jahr jeder vierte Tod auf eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zurückgeführt werden.
• Beweglichkeits- und Koordinationstraining unterstützen dabei, tägliche Bewegungen problemlos auszuführen. In jungen Jahren wirkt sich dies durch bessere sportliche Leistungen aus, im Alter hilft es, mit möglichst wenigen Einschränkungen zu leben.
Was machen Sie für Ihre Gesundheit und Fitness?
Sie können Rad fahren, spazieren, schwimmen oder Aerobic mit geringer Belastung betreiben. Wenn Sie in der Lage sind, sollten Sie täglich 20 bis 30 Minuten mässig intensiven Sport treiben, um die empfohlene Gesamtdauer von 150 Minuten pro Woche zu erreichen.

Warum machen Frauen Fitness?
Viele Frauen wünschen sich schöne Fingernägel, Haare sowie Haut. Sport und Fitnesstraining aktivieren den gesamten Körper und dessen Prozesse, so auch das Wachstum der Haare, Fingernägel und die verbesserte Regeneration der Haut. Das Training strafft die Haut, indem Muskulatur aufgebaut wird.
Viel Bewegung lässt auch die Pfunde purzeln
Wenn Sie regelmässig Fitnesstraining machen, hat das auch einen Einfluss auf das Körpergewicht. Neben genügend Bewegung bedarf es aber auch einer gesunden Ernährung. Wichtig ist für Fitness-Anfänger, nicht zu schnell loszulegen. Gehen Sie vorsichtig vor und tasten Sie sich langsam heran, damit Sie Ihren Körper nicht überfordern oder schädigen.
Wenn Sie viel Gewicht verlieren möchten, sollten Sie einen Experten aufsuchen, der mit Ihnen einen abgestimmten Ernährungs- und Trainingsplatz zusammenstellt. Es wird davon abgeraten, selbst einen tiefgreifenden Abnehmplan zu erstellen.
Das Wichtigste beim Abnehmen ist die Ernährung. Die Menge an Kalorien, die wir zu uns nehmen, können wir gut kontrollieren. Wie viele Kalorien wir verbrennen, ist hingegen schwieriger zu beeinflussen.
Es ist wichtig zu verstehen, dass wir nicht nur Kalorien verbrennen, wenn wir uns bewegen, sondern immer.
Untersuchungen konnten zeigen, dass der gesamte Energiebedarf an einem gewissen Punkt stagniert. Wenn Sie sich viel bewegen, beginnt der Körper, an anderen Stellen Energie zu sparen. Das bedeutet: Durch Bewegung können Sie nur eine gewisse Menge an Kalorien verbrennen.


Wir sind aus dem Urlaub zurück! Praxen für Allgemeinmedizin, Dermatologie und Biochemie, Osteopathie und Craniosacraltherapie
Dr. med. Katja Oomen-Welke Ärztin für Allgemeinmedizin
Psychotherapie Homöopathie Akupunktur +423 340 40 76 dr.oomen@heilwerk.li
Dr. med. Claus Zeyher
Facharzt für Dermatologie Dipl. Biochemiker
Medizinische Klimatologie und Balneologie +423 340 40 75 dr.zeyher@heilwerk.li
Jakub Labudzki DO PDO
Diplomierter Osteopath und Kinder-Osteopath Diploma in Women’s Health Osteopathy D WHO +423 340 40 73 jakub@heilwerk.li
Nadine Stadtmüller
Diplomierte Craniosacraltherapeutin
Diplomierte Pflegefachfrau HF Kinder und Erwachsene +41 79 547 59 62 nadine@heilwerk.li
Kirchenbot 1 9493 Mauren www.heilwerk.li

Gönnen Sie sich eine Auszeit- Ihr Wohlbefinden wartet!
Verschiedene Massagetechniken für Ihre Bedürfnisse
Mehr erfahren: www shmassage li

Terminvereinbarung: 00423/ 78 280 88


vegAluna Zentrum, gesunder pflanzlicher Ernährung, Vaduz
vegAluna Zentrum gesunder, pflanzlicher Ernährung, Vaduz
«vegAluna» soll in der Region das Zentrum für nachhaltige, gesunde und pflanzliche Ernährung sein. Es bietet in erster Linie Aufklärung und beantwortet die Frage: Wie kann ich mich pflanzlich schmackhaft ernähren, damit ich mit allen Nährstoffen versorgt bin und dies ebenfalls zum Wohle von Natur und Umwelt? Von Kochkursen über Ernährungsschule, Events und Catering, Mittags-Take-away bis hin zum Reformhaus Bioladen in Vaduz ist bei «vegAluna» alles zu finden.
Interview & Fotos: Vera Oehri-Kindle
In welchem Jahr wurde vegAluna eröffnet? 2002

Wie viele Leute umfasst durchschnittlich eine Kursgruppe?
8
Wie viele unterschiedliche Kurse bietet ihr durchschnittlich pro Monat an?
2
Wie viele unterschiedliche Produkte habt ihr im Sortiment?
>500
Wie viele Menschen besuchen euch durchschnittlich pro Woche in eurem Geschäft?
100


Seit wie vielen Jahren esst ihr schon vegan?
6
Wie viel Minuten benötigt ihr für eine schnelle, vollwertige Mahlzeit? -15
An wie vielen Tagen in der Woche bietet ihr ein Mittagsmenüs an?
3
Wie oft geht ihr durchschnittlich pro Jahr auswärts essen?
12
Wie viele Stunden umfasst ein durchschnittlicher Arbeitstag bei euch?
10

„Verwittertes Pflaster?! –Die Alternative zur Neuverlegung.“
Die Steinpfleger Schweiz-Ost, das Team im Interview:
Eine kurze Einleitung bitte. Was genau bieten Die Steinpfleger an?
Wir haben uns darauf spezialisiert, Oberflächen im Außenbereich aufzubereiten und diese nachhaltig zu schützen. Im Grunde vergleichbar mit der Pflege eines Autos. Richtig geschützt hat man auch hier deutlich länger Freude daran und erhält zeitgleich den Wert.
Kurz zum Ablauf, wie kann man sich einen Steinpflegerbesuch vorstellen?
Zunächst schaut sich ein Mitarbeiter die Flächen an, legt eine Probereinigung, bspw. In einer Ecke an, und erstellt dann ein Aufmaßblatt inkl. Fotos. Dieses wird noch vor Ort an unser Büro versendet. Direkt im Anschluss erhält der Kunde ein schriftliches Angebot. Das Besondere bei uns: Bis hierhin ist alles kostenfrei und völlig unverbindlich. Für uns sind die Angebote verbindlich, es wird kein Cent mehr abgerechnet als vereinbart, auch wenn wir länger bleiben müssen.
Und wie läuft so eine Aufbereitung, bspw. die eines Pflasters ab?
Reinigung mit bis zu 100° C heißem Wasser (350 BAR Druck)
Gleichzeitige Absaugung von Fugenmaterial und Schmutzwasser
Wir reinigen mit bis zu 100°C heißem Wasser und einem angepassten Druck von bis zu 350 bar. Dabei saugen wir gleichzeitig das entstehende Schmutzwasser sowie das Fugenmaterial ab. Im Anschluss wird die Fläche einer umweltverträglichen Art der Desinfektion unterzogen. Damit entfernen wir selbst die kleinsten Rückstände und Sporen. Damit es aussieht wie neu verlegt und die Flächen ihre Stabilität behalten, werden diese neu verfugt. Im Anschluss imprägnieren wir die Flächen und schützen diese so langfristig.
Warum sollte man die Steinpfleger beauftragen?
Zum einen natürlich der Faktor Zeit. Ich denke, ein Garten ist in erster Linie ein Ort der Ruhe und Erholung. Wer möchte schon die wenigen Sonnenstunden damit verbringen, zu reinigen und Sachen von A nach B zu schleppen. Außerdem ist ja zu beachten, reinigt man selbst, ist das i. d. R. alle 3-4 Monate nötig. Dabei wird viel Dreck an Fenstern und Türen verursacht, teilweise werden die Fugen ausgespült, Pfützen entstehen und natürlich wird jedes Mal das Pflaster weiter angeraut. Dadurch ist das Pflaster im neuen Jahr noch schmutzanfälliger. Wenn wir da waren, bieten wir mit STEINPFLEGER Protect 4 Jahre Garantie, auch gewerblich! Und dank unserer hauseigenen festen

Neuverfugung mit unkrauthemmendem Fugenmaterial
Langzeitschutz dank Steinpfleger-Protect-Imprägnierung




Systemfuge ist auch eine nachhaltige chemiefreie Unkrauthemmung möglich.
Man hört und liest ja immer wieder von Drückerkolonnen, welche vor Ort direkt abkassieren und mit dubiosen Mitteln nachhelfen. Was unterscheidet Sie davon?
Einfach alles! Das beginnt schon damit, dass wir Angebote ausschließlich schriftlich versenden, geht über unsere Auftragsbestätigungen bis hin zu einer ordnungsgemäßen Rechnung, welche auch zum Teil steuerlich geltend gemacht werden kann. Nicht zuletzt sind wir einfach vor Ort und mit offenem Visier am Kunden. Das gibt Sicherheit. Garantiert haben wir auch in Ihrer Nähe Referenzen zu bieten.
Ein letztes Statement an alle Unentschlossenen, und wie man Sie erreichen kann!
Testen Sie uns. Bis zu Ihrem „Go“ zur Durchführung der Arbeiten ist es kostenfrei und unverbindlich, Sie können nur gewinnen!
Auf www.die-steinpfleger.ch haben wir ein informatives Video am Beispiel einer Auftragsdurchführung, telefonisch sind wir unter +41 71 510 06 40 erreichbar.
Fair und seriös - schriftliche Angebote und Topbewertungen
ca. 75 % günstiger als eine Neuverlegung


Idealerweise wird der Einbau einer energieeffizienten und ökologischen Haustechnikanlage mit einer gut gedämmten Gebäudehülle kombiniert.
Sie heizen energieeffizient – wir fördern!
Der Einbau von z. B. Wärmepumpen und Holzheizungen in Wohn-, Industrie- und Gewerbebauten wird gefördert.
Der Förderbeitrag des Landes basiert auf der Energiebezugsfläche sowie der Art der Haustechnikanlage.

Wärmepumpe – Luft
Wärmepumpe – Erdwärme
Energiefachstelle Liechtenstein
Amt für Volkswirtschaft | Haus der Wirtschaft | 9494 Schaan
T +423 236 69 88 | info.energie@llv.li | energiebündel.li | llv.li
CHF 6'352 + 6'352 = 12'704
CHF 7'544 + 7'544 = 15'088
Pelletsfeuerung CHF 7'714 + 7'714 = 15'428
Zentrale Holzheizung (+ Speicher) CHF 9'758 + 9'758 = 19'516
Fernwärme bis zu 100 % der Mehrkosten
Land + Gemeinde = Gesamt
Beispiel für bestehende Gebäude mit bis zu 500 m2 Energiebezugsfläche (EBF). Die Gemeinden fördern gemäss ihren eigenen Beschlüssen und verdoppeln meist bis zu ihren jeweiligen Maximalbeträgen.
Das Liechtensteinische LandesMuseum ist eine selbstständige Stiftung öffentlichen Rechts. Auftrag und Zweck des Liechtensteinischen LandesMuseums sind die Sammlung, Pflege, Ausstellung und Inhaltsvermittlung liechtensteinischen Kulturgutes.
Wir suchen ab 1. März 2025 oder nach Vereinbarung
Stellvertretung Leitung MuseumsShop und Empfang (w/m/d)
Teilzeit 60 %
Deine Aufgaben:
- Stellvertretende Leitung des Teams im Liechtensteinischen LandesMuseumsShop
- Beratung unserer Kundinnen und Kunden über das Sortiment
- Besucherbetreuung und -information
- Betreuung des Webshops
- Verantwortung für Kassenabschluss und Inventur
Dein Profil:
- Idealerweise kaufmännische Ausbildung oder eine Ausbildung im Detailhandel
- Idealerweise mehrjährige Berufserfahrung in der Dienstleistungsbranche
- Idealerweise Erfahrung in einer Führungsposition
- Organisierte Arbeitsweise
Liechtensteinisches LandesMuseum Städtle 43 | Postfach 1216 | FL-9490
- Soziale Kompetenz und gepflegtes Auftreten
- Gute Computerkenntnisse
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Flexibel, kommunikativ und teamorientiert
- Bereitschaft zur Arbeit an Wochenenden und Feiertagen
- Interesse an Geschichte, Landeskunde, Kunst und Kultur
Unser Angebot:
- Abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit in einem internationalen Umfeld
- Arbeitsplatz im Zentrum von Vaduz
- Attraktive Arbeitsbedingungen
Bist du interessiert? Dann schicke deine Bewerbung an: Michael Büchel, Leiter Verwaltung und Finanzen (michael.buechel@llv.li) freut sich auf deine digitale Bewerbung bis zum 15. Februar 2025.
Bildung & Jugend
Rafael Ospelt befindet sich im zweiten Lehrjahr der Ausbildung zum Sanitärinstallateur bei der Ospelt Haustechnik AG in Vaduz. Er gibt uns einen kleinen Einblick in seinen interessanten und abwechslungsreichen Beruf.
Interview: Vera Oehri-Kindle
Warum hast du dich gerade für diesen Beruf entschieden?
Rafael Ospelt: Für mich war von Anfang an klar, dass ich einen technischen Beruf erlernen möchte. Ich habe darum in verschiedenen handwerklichen Tätigkeiten geschnuppert, und dabei hat mir der Beruf Sanitärinstallateur am besten zugesagt.
Welche Voraussetzungen sollte man für diesen Beruf mitbringen?
Wichtig sind sicherlich technisches und handwerkliches Geschick, aber auch ein gu-
tes räumliches Vorstellungsvermögen. Es ist auch von Vorteil, wetterfest zu sein, vor allem wenn wir im Rohbau arbeiten und das Wetter nicht immer schön ist und die Arbeiten trotzdem erledigt werden müssen. Die allerwichtigste Voraussetzung ist aber, dass einem der Beruf gefällt und man Spass an der Arbeit hat.
Wie sieht dein Tagesablauf als Sanitärinstallateur im zweiten Lehrjahr aus?
Arbeitsbeginn ist um 7 Uhr auf der Baustelle. Davor wird in der Firma das benötigte Material hergerichtet. Wenn ich auf der Baustelle angekommen bin und das Material abgeladen

ist, lege ich mein Werkzeug bereit und verschaffe mir eine Übersicht über die Arbeiten, die ich zu erledigen habe. Danach geht es mit dem Tagesgeschäft, bei dem ich mehrheitlich alles schon selbständig erledigen kann, los. Kurz vor Feierabend verstauen wir das Material und die Werkzeuge wieder und besprechen, was am nächsten Tag ansteht. Um 17 Uhr geht es dann ab nach Hause.


Unter dem Motto «Wirtschaft im Austausch» trafen sich Mitte Januar rund 85 ortsansässige Wirtschaftstreibende bei der Liconic AG in Schaanwald. Dieser erste Unternehmerstammtisch 2025 war für alle Beteiligten ein Riesenerfolg.
Text: Dominik Matt, Fotos: Pamela Bühler






Mit dem von der Maurer Wirtschaftskommission ins Leben gerufenen Unternehmerstammtisch wurde der Startschuss für regelmässig wiederkehrende Treffen der ortsansässigen Unternehmer gegeben. Gemeindevorsteher Peter Frick und der Vorsitzende der Wirtschaftskommission, Gemeinderat Dominik Matt, freuten sich sehr, dass dieser Unternehmerstammtisch eine grosse und positive Resonanz erfahren hat.
Vernetzungstreffen mit Besichtigung der Liconic AG
Neben dem persönlichen Austausch in ungezwungener und gemütlicher Atmosphäre stand besonders die Besichtigung der Liconic AG im Mittelpunkt des Vernetzungstreffens. Bei der Liconic AG handelt es sich um ein Unternehmen, das Geräte produziert, die der



Pharmaforschung und der Medikamentenproduktion vorgelagert sind. Der Gastgeber und CEO Cosmas Malin referierte über die Gründung und stetige Weiterentwicklung seines Unternehmens, das heute in Fachkreisen Weltruf geniesst und mit seiner Innovationsfähigkeit besticht.
Präsentation der strategischen Zukunftsvisionen der Gemeinde Die Wirtschaftskommission nutzte den Anlass, um sich und ihre strategischen Zukunftsvisionen für die Gemeinde zu präsentieren. Im Rahmen des Kurzworkshops «Businessplan für Mauren-Schaanwald» wurde zudem gemeinsam interaktiv gearbeitet. Mit der Linkedin-Plattform «Wirtschaft Mauren-Schaanwald» wurde den Unternehmern schliesslich eine neue Möglichkeit zur digitalen Vernetzung vorgestellt.

Projektpräsentation «Jugendtreff Bendern» Ein Jugendtreff, der Nutzer
wie

Der neue Jugendtreff mit dem Namen B28 beim Busterminal in Bendern beschreitet neue Wege.
Die Idee zur Umnutzung der ehemaligen Post zu einem Lerncafé und einem Jugendclub ist für Liechtenstein ein bisher einmaliges Projekt. Architektonisch besticht das Gebäude nun durch eine klare, einfache, dennoch optisch überaus ansprechende und auf die Nutzer zugeschnittene Gestaltung.
Text: Heribert Beck
Am Abend des 16. Januar 2025 fand in der ehemaligen Post in Bendern die offizielle Eröffnung der neuen Jugendbeiz mit dem Namen B28 statt. «In diesem Rahmen überbrachte Regierungsrätin Marok-Wachter den an der Planung beteiligten Personen sowie Vertreterinnen und Vertretern der ausführenden Firmen ihre Glückwünsche für das gelungene Projekt. Zudem nahmen an der Eröffnungsfeier des seit 1969 bestehenden und nun teilweise umgenutzten Gebäudes Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden und der Stiftung Sovort/Offene Jugendarbeit Liechtenstein (OJA) sowie Jugendliche teil», schrieb die Regierung vor
rund zwei Wochen in der entsprechenden Pressemitteilung. Die Jugendbeiz B28 ist seither ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der kreativen Entfaltung, an dem sich junge Menschen ab 16 Jahren aus ganz Liechtenstein und der Region in einer angenehmen Atmosphäre versammeln können. Wie das Projekt während der Planungs- und Bauphase entstanden ist, weiss der zuständige Architekt Beat Burgmaier.
Grosser Effekt mit kleinen Eingriffen Als feststand, dass die Benderer Post geschlossen wird, hat sich das Land Liechtenstein als Eigentümer der Liegenschaft entschieden, einen Teil des Gebäu-
des, also den Infrastrukturbereich mit dem LLB-Bankomaten und der öffentlichen WC-Anlage, stehenzulassen. «Auch das Untergeschoss sollte erhalten bleiben», sagt Beat Burgmaier. Rückgebaut wurden hingegen die Wohnung im Obergeschoss und der Teil des Erdgeschosses, in dem sich die Schalter- und Büroräumlichkeiten der Post befunden haben. «Schnell zeigte sich, dass auch die Heizungsanlage und damit der Kamin sowie das Treppenhaus zur Erschliessung des Untergeschosses bestehen bleiben.»
Als die OJA Liechtenstein im Frühjahr 2023 mit dem Wunsch an die Regierung gelangt ist, die Integration eines Jugendtreffs für 16- bis 22-Jährige in das Gebäu-
de zu prüfen, wurde schnell klar, dass dies einen doppelten Mehrwert schaffen würde. «Denn nur genutzte Räumlichkeiten können einem Objekt und dem Quartier einen Impuls geben», sagt Beat Burgmaier. Andererseits bot sich der Standort beim Busterminal Bendern – ausserhalb des Wohngebiets und vom öffentlichen Verkehr bestens erschlossen – geradezu an für eine Nutzung durch Jugendliche. Die meisten Liechtensteiner Gemeinden waren von dieser Lösung ebenfalls überzeugt und beteiligten sich als Träger der Stiftung Sovort an den Kosten.
Beat Burgmaier stand nun zusammen mit seiner Mitarbeiterin Tamara Mnich vor der Aufgabe, ein

Wir danken der Bauherrschaft für den geschätzten Auftrag und die angenehme Zusammenarbeit.
architektonisches Konzept auszuarbeiten, das auf die neue Nutzung zugeschnitten ist. «Durch den Teilabbruch spannten die erhaltenen Gebäudeteile – Treppenhaus, Kamin und Infrastrukturbereich – einen Zwischenraum auf. Dieser ermöglichte es, durch minimale Massnahmen einen grosszügigen Raum entstehen zu lassen.» Zwei Glasfronten in Holz und eine spezielle Dachkonstruktion, ebenfalls in Holz, schufen die Verbindung. «So entstand ein behaglicher Raum für das neue Jugend- beziehungsweise Lerncafé mit einer vorgelagerten Terrasse», sagt der Architekt. Die barrierefrei nutzbaren Räumlichkeiten, in deren Gestaltung die Jugendlichen mit einbezogen waren, verfügen nun über eine lichtdurchflutete Aufenthaltsfläche mit Küche und WC-Anlage im Zwischenbau.
Im Untergeschoss, inzwischen ebenfalls barrierefrei über eine Liftplattform zugänglich, in dem sich einst die Lagerräume der Post befanden, war die Raumgliederung sehr kleinteilig. «Für die Zwecke eines Jugendclubs, der dort entstehen sollte, war dies denkbar ungeeignet. Wir konnten dem durch den Rückbau von Innenwänden begegnen, was zwei grosszügige Räume entstehen
Projektpräsentation «Jugendtreff Bendern»
liess. Die Jugendlichen durften sie schliesslich nach ihren Bedürfnissen gestalten. In diesem Zusammenhang freut mich, dass sie für die Farbgebung ähnliche Töne gewählt haben wie wir für die Fassade, was ein Indiz dafür ist, dass wir ihren Geschmack getroffen haben.»
Biodiverse Umgebungsgestaltung folgt
Besonderes Augenmerk legte Beat Burgmaier auch auf die Umgebungsgestaltung. «Es ist uns bei all unseren Projekten stets ein Anliegen, versiegelte Flächen aufzubrechen, wo dies möglich und sinnvoll ist. So entsteht zusätzlicher Grünraum, und Meteorwasser kann auf natürliche Weise versickern. Dazu leistet auch das begrünte Flachdach einen Beitrag, welches dafür sorgt, dass Regenwasser dosiert in den nördlichen Aussenraum fliesst.» Begrünte Metallringe komplettieren die Umgebung im Bereich der Terrasse des Jugendtreffs. «Die Bäume, die dort gesetzt wurden, werden, sobald sie gewachsen sind, ausserdem für eine Beschattung und für ein angenehmes Mikroklima im Sommer sorgen.» Die Weitere Umgebung wird in den kommenden Monaten zusammen mit einer Landschaftsarchitektin und
den Jugendlichen Nutzern nach Gesichtspunkten der Biodiversitätsförderung fertiggestellt.
Wichtig für die räumliche Einbindung sind auch die Anordnung und Ausformulierung der Zugänge zum Gebäude. Durch die beiden Zu- beziehungsweise Eingänge beim Jugendtreff können das Lerncafé und der Jugendclub getrennt voneinander genutzt werden. Der Haupteingang mit grosszügigem Vordach ist südseitig zwischen Terrasse und Infrastrukturbau gelegen. Dort finden die Jugendlichen oder Pendler des Busterminals ebenfalls eine Trinkbrunnen. Westseitig befindet sich der bestehende Zugang zum Treppenhaus, welcher heute als Nebeneingang für den Jugendclub im Untergeschoss genutzt wird. Südseitig wird ein noch zu erstellender Fahrradunterstand mit verschliessbaren Ladeboxen für E-Bikes die Umgebung abschliessen.
Ein Ergebnis, das alle zufriedenstellt
Das Fazit von Beat Burgmaier zum neugestalteten Postgebäude fällt positiv und zufrieden aus. «Wir konnten im Rahmen des von Land und Gemeinden vorgegebenen Budgets eine wirtschaftliche
und nachhaltige Lösung finden, die sowohl den Ort als auch das Objekt aufwertet. Dabei kam uns entgegen, dass wir generell gerne und oft mit dem Bestand arbeiten und Erfahrung darin haben, wie sich Altes und Neues vereinen lässt – sowohl in Bezug auf die Nutzung als auch auf die Gestaltung.» Diese Mischung aus Altem und Neuem führte unter anderem dazu, dass die Fassade verschiedene Materialien und Texturen aufweist. Ein vollständig neuer Verputz hätte dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit jedoch widersprochen. «Damit das Gebäude dennoch als Einheit in Erscheinung treten kann, haben wir uns für einen Anstrich in Anthrazit entschieden. Gleichzeitig lässt sich aus der Nähe und durch die Haptik erkennen, welche Teile alt und welche neu sind. Das gilt zum Beispiel für ein zubetoniertes Fenster beim Treppenhaus oder für den oberen Abschluss des Kamins», sagt Beat Burgmaier. Hellgrau gestrichene Spotlights an der Fassade sind ein zusätzliches Gestaltungselement und weisen ausserdem darauf hin, dass das «B28» und der Infrastrukturbereich öffentlich genutzt werden.
Als Gestaltungselement dient ausserdem die durchdachte statische

Projektpräsentation «Jugendtreff Bendern»
Dachkonstruktion, die alle darunterliegenden Gebäudeteile verbindet und einen starken vertikalen Abschluss mit grosszügig gedeckten Vorbereichen bildet. «Die auf Kostenbasis optimierte Tragstruktur aus einheimischem Fichtenholz inklusive in die Decke integrierter Beleuchtung und Filzdämmung hat durch ihre Effizienz auch dazu beigetragen, dass die Arbeiten innerhalb von rund elf Monaten abgeschlossen werden konnten», sagt Architekt Burgmaier. Die Filzdämmung in der Deckenstruktur garantiert dabei trotz der harten Oberflächen mit dem Linoleumboden und den Glasfronten eine ausserordentlich gute Akustik. «Bei der offiziellen Er-
öffnung waren rund 70 Personen anwesend. Nach den Reden wurde die Akustik von den Gästen neben vielem anderen ausdrücklich gelobt. Solche Rückmeldungen, wie auch jene der Jugendlichen, die sich im ‹B28› wohlfühlen, bestätigen uns selbstverständlich in unserer Arbeit und freuen uns. Doch ohne die grossartige Zusammenarbeit aller Beteiligten aus Landesverwaltung, Stiftung Sovort, beauftragten Unternehmen und jugendlichen Nutzern wäre ein solches Ergebnis in so kurzer Zeit nicht möglich gewesen. Dafür und für das uns entgegengebrachte Vertrauen danke ich ihnen allen herzlich», sagt Beat Burgmaier.




Ansicht der Deckenkonstruktion

Verputze
Aussendämmungen
Trockenbau
Akustikputze
Renovationen
Innenisolationen


Bei Walser & Wohlwend kommt alles im richtigen Winkel.



Telefon +41 78 643 94 40 gipserei@tschuetscher-ag.li www.tschuetscher-ag.li zuverlässig spitzenmässig bewährt

Ihre Fachleute für Ingenieurarbeiten im Hoch- und Tiefbau
Büro Schaan
Feldkircher Strasse 9, FL-9494 Schaan
Tel. +423 237 50 80
Büro Ruggell
Noflerstrasse 12, FL-9491 Ruggell Tel. +423 370 18 90
www.bauingenieure.li, info@bauingenieure.li
WIR SUCHEN: - Bauingenieur/in Infrastrukturbau - Zeichner/in EFZ od. Techniker/in HF Infrastrukturbau


Wir konnten im Rahmen des Budgets eine wirtschaftliche und Nachhaltige Lösung finden, die sowohl für Nutzer, Ort und Objekt ein Mehrwert bildet. Dabei kam uns entgegen, dass wir generell gerne und oft mit dem Bestand arbeiten und Erfahrung darin haben, wie sich Altes und Neues vereinen lassen.

HerzlichenDankfürden geschätzten Auftrag!

Ansicht Haupteingang Lerncafé mit vorgelagerter Terrasse

Das Land Liechtenstein besitzt verschiedenste Gebäude, die betrieben, unterhalten und weiterentwickelt werden müssen. Dabei ist jede Liegenschaft ein Einzelstück. Faktoren wie Umgebung, Struktur, Substanz, Nutzung und sich verändernde Anforderungen müssen zusammenspielen. Jede Baute benötigt daher ein individuelles Konzept.
Das Postgebäude in Bendern nimmt im Gebäudeportfolio des Landes einen besonderen Platz ein. 1969 erbaut, liegt es an einem strategisch wichtigen Ort im Land, an einem Knotenpunkt von öffentlichem und individuellem Verkehr. Im Lauf der Zeit wurden beim Postgebäude in Bendern auch kleinere Angebote von einem Bancomaten über WCs bis hin zu einem Defibrillator geschaffen. Seit dem Auszug der Post im Jahr 2020 wurden verschiedene Möglichkeiten untersucht, mit dem Haus adäquat und zukunftsorientiert umzugehen – auch im Hinblick auf langfristige verkehrsbezogene und städtebauliche Planungen des Amtes für Tiefbau
und Geoinformation beziehungsweise der Gemeinde Gamprin-Bendern.
Dass mit der Stiftung Sovort/Offene Jugendarbeit Liechtenstein ein Partner gefunden wurde, der das Potenzial des Raumangebots erkannt hat, und dass das Objekt durch eine bauliche Ergänzung nun als Jugendtreffpunkt genutzt werden kann, ist ein Glücksfall. Das Gebäude ist in mehrfacher Hinsicht eine Investition in die Zukunft: in eine selbstverantwortliche Jugend, durch den Erhalt der Bausubstanz in die Nachhaltigkeit und mit der in diesem Jahr geplante Gestaltung des Aussenbereichs in die Biodiversität.
Die neue Nutzung als Jugendbeiz wird den Ort positiv verändern und aufwerten. Ich wünsche den Jugendlichen viel Freude in ihrem neuen Treffpunkt.
Graziella Marok-Wachter, Infrastrukturministerin
Projektpräsentation «Jugendtreff Bendern»


Ein langgehegter Wunsch ist in Erfüllung gegangen
Das Bedürfnis nach einem Treffpunkt für Jugendliche ab 16 Jahren wurde von dieser Zielgruppe seit Längerem an mehreren Beteiligungsformaten ausgesprochen. Vor rund fünf Jahren nahm sich die Stiftung Offene Jugendarbeit Liechtenstein, die heutige Stiftung Sovort, des Themas an. Lange wurden keine geeigneten Räumlichkeiten gefunden. Im Jahr 2023 wurden dann der Standort und die Räumlichkeiten der ehemaligen Post Bendern neu ins Spiel gebracht. Die Stiftung prüfte gemeinsam mit dem Land Liechtenstein und dem Architekten Beat Burgmaier Möglichkeiten für eine solche Nutzung als Treff. Für die Finanzierung des Um- und Neubaus konnte die Stiftung zehn der elf Liechtensteiner Gemeinden gewinnen. Nun sind tolle und flexible Räumlichkeiten entstanden, welche die Jugendlichen ganz unterschiedlich nutzen können.
Das Konzept ist so ausgelegt, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 16 bis 22 Jahren den Betrieb möglichst selbständig um-
setzen. Das heisst: Sie entscheiden über die Nutzung, die Öffnungszeiten und führen den Betrieb eigenständig mit Begleitung durch eine Fachperson der Offenen Jugendarbeit Liechtenstein. Weiter ist im Konzept definiert, dass leichter Alkohol ausgeschenkt wird und der Einlass strikt ab 16 Jahren gewährt wird. Zurzeit hat das «B28» jeweils am Samstag von 20 bis 2 Uhr geöffnet. Dann werden die Kellerräumlichkeiten als Club-Lokal genutzt. Am Freitag werden die Kellerräume für Privatpartys für Jugendliche von 16 bis 22 Jahren vermietet. Auch dies war und ist ein grosses Bedürfnis. Seit der Eröffnungsparty am 20. Dezember 2024 sind bis Ende Februar alle Freitage ausgebucht. Ausserdem öffnet die Betriebsgruppe am Freitagnachmittag die Räumlichkeiten im Erdgeschoss für den Café-Betrieb.
Die Stiftung Sovort Liechtenstein bedankt sich ganz herzlich bei allen Beteiligten für die gelungene Umsetzung.
Markus Büchel, Geschäftsleiter Stiftung Sovort Liechtenstein

Am Mittwoch, 8. Januar 2025, fanden am Institut für Energietechnik (IET) der Fachhochschule OST in Rapperswil die 16. «Expertinnen- und Expertengespräche Power-to-X» statt. Moderiert wurde die Veranstaltung mit sechs Referenten und rund 80 Teilnehmern von Prof. Dr. Markus Friedl, dem Leiter des IET. Die Tagung wurde als grosser Erfolg betrachtet, und es gab insbesondere reges Interesse an der von der LIGEN vorgestellten Energielösung unter Nutzung von Power-to-Hydrogen.
Text: Johannes Kaiser
Neben dem Projektleiter Wasserstoff des Schweizer Bundesamtes für Energie (BFE), welcher die im Dezember 2024 veröffentlichte neue Wasserstoffstrategie der Schweiz vorstellte, sprachen u. a. auch der Geschäftsführer des H2-Hub-Schweiz und ein Vertreter der Axpo, des grössten Schweizer Energieerzeugers. Aus
Liechtenstein wurde die «Liechtensteinische Initiativgruppe für Energienachhaltigkeit e.V.» (LIGEN) eingeladen, um über künftige Einsatzmöglichkeiten von Power-to-X in Liechtenstein zu sprechen. LIGEN wurde durch den Vorstand Dr. Nikolaus von Seemann vertreten, der über langjährige Erfahrungen mit Power-to-X verfügt.
Power-to-X-Technologien
Unter Power-to-X versteht man diejenigen Technologien, die es erlauben, überschüssigen Strom aus den intermittierenden erneuerbaren Energiequellen PV, Wind und Wasser in speicherbare Energieformen umzuwandeln. Der Ausgangspunkt ist in allen Fällen Wasserstoff, der durch Elektrolyse gewonnen wird,
und zwar dann, wenn gerade mehr Strom produziert wird als für die direkte Lastdeckung erforderlich ist. Der so gewonnene grüne Wasserstoff könnte dann unter Nutzung von CO₂, das sich bereits im atmosphärischen Umlauf befindet, zu synthetischem eMethan (entspricht Erdgas) oder eMethanol bzw. mit Stickstoff zu eAmmoniak weiter «veredelt» werden.
Machbarkeitsstudie «Marktautarke Energieversorgung Liechtenstein» bestätigt Konzept
Im Fall von Liechtenstein wurde im Rahmen der im vergangenen Sommer abgeschlossenen und auf der Homepage der Regierung publizierten Machbarkeitsstudie «Marktautarke Energieversorgung Liechtenstein» gezeigt, dass eine direkte Nutzung von Wasserstoff die einfachste und auch kostengünstigste Lösung wäre, um zu jedem Zeitpunkt über ausreichend und günstigen Strom verfügen zu können. Die Investition in die Elektrolyse und die Gasturbine würde zwar knapp unter 100 Mio. Franken kosten, aber auch eine Lebensdauer von etwa 20 bis 30 Jahren aufweisen und gut 10 Prozent des jährlichen Strombedarfs des Landes decken.
Wasserstoffpipeline – verbunden mit Speicherkavernen in Deutschland Heute wird Wasserstoff in Liechtenstein nur in vergleichsweise geringem Umfang genutzt, was aber auch durch die eingeschränkte Verfügbarkeit und die aktuell hohen Kosten zu erklären ist. Künftig könnte dies durch eine Pipeline anders aussehen. Nikolaus von Seemann zeigte in seinem Vortrag auf, dass die Wasserstoffpipeline, die unter anderem auch mit Speicherkavernen in Deutschland verbunden sein wird, vom ersten Tag an für die saisonale Speicherung von Energie verwendet werden könnte. «Wenn mehr Strom aus den eigenen Produktionsanlagen verfügbar ist, als aktuell im Land gebraucht wird, dann wird der nicht zu potenziell negativen Preisen ins Ausland verkauft, sondern für eine spätere Nutzung in speicherbares Gas umgewandelt.» Die zitierte Studie bestätigte, dass man einen Teil der anfallenden «Überschussenergie» mit Kurzfristspeichern (Pumpspeicherkraftwerk Samina, V2G) für eine zeitnahe Wiederverwendung bereithalten kann, aber dass es aus Kostengründen auch einer saisonalen Speicherung bedarf. Diese muss die letzten gut 10 Prozent des Stroms im Land liefern, was
durch eine Gasturbine geschehen soll. Diese verbrennt dann grünen Wasserstoff, der dem Wasserstoffnetz wieder entnommen würde, und wandelt ihn in Strom und Abwärme um, die in das Strom- und Wärmenetz eingespeist werden.
Eine wichtige noch zu schaffende Voraussetzung für die Umsetzung ist jedoch die Verlängerung der 2032 bis Lindau geplanten Deutschen Wasserstoffpipeline, die im vergangenen Oktober von der Deutschen Bundesnetzagentur als Bestandteil des Kernnetzes und des European Hydrogen Backbone bestätigt worden ist.
Schweizer Oberzolldirektion:
Grünes Licht für grünes Gas...? Ein hoffentlich noch zeitgerecht klärbares Nebenthema ist, dass die Schweizer Oberzolldirektion derzeit keinen Import von grünen Gasen über Mischpipelines zulässt, ohne die künftig empfindlich teurer werdende CO₂-Abgabe zu verrechnen. Da die Wasserstoffpipeline aber voraussichtlich nur grünes Gas enthalten wird, sollte dies regelbar sein.
Ebenso liesse sich das mittels Zertifikaten schaffen, die wie beim Import von Strom erlauben, einen grünen und grauen Ursprung zu differenzieren.
Und selbst wenn die Wasserstoffpipeline nicht zustande kommen sollte, so könnte als Plan B unter Nutzung der bestehenden Erdgasleitungen eine Power-to-Methan-Anlage gebaut werden, was aber etwas teurer und aufwendiger wäre. Hauptproblem dabei ist, dass beim Verbrennen des eMethans das zuvor «eingebaute» CO₂ wieder frei wird. Die so bei der Verbrennung entstehenden bis zu 13 to/h aus den Abgasen wieder herauszuwaschen, wäre bei den nur gut 700 Volllaststunden der Gasturbine sehr aufwändig. Bei der Verwendung von Wasserstoff würde dieses Problem gar nicht entstehen.
Die Tagung wurde als grosser Erfolg betrachtet, und es gab insbesondere reges Interesse an der von der LIGEN vorgestellten Energielösung unter Nutzung von Power-to-Hydrogen.

Projektpräsentation «Giessen Hotel & Coffeehouse, Vaduz»


Das frühere «Landhaus am Giessen» erstrahlt seit dem 1. Januar 2025 in neuem Glanz, besticht durch ein erweitertes Angebot und trägt nun den Namen «Giessen Hotel & Coffeehouse». Vorausgegangen waren eine umfassende Sanierung und ein teilweiser Neubau, die in rund neun Monaten zum Abschluss gebracht werden konnten. Die zuständige Architektin Sarah Hermann zieht ein positives Fazit.
Projektpräsentation «Giessen Hotel & Coffeehouse, Vaduz»

Im Jahr 2000 hat die Gemeinde Vaduz das «Landhaus am Giessen», als Hotel erbaut in den 1960er-Jahren, erworben. Im Jahr 2004 übernahm Hanni Sele die Pacht des Hotels. In der Zwischenzeit hat sie die Geschäfte an ihre Tochter Isabella übergeben. Die Auslastung der Zimmer war stets sehr hoch. Die Nachfrage nach dem Angebot besteht also zweifellos und soll durch den Neubau weiter gesteigert werden. Die Bausubstanz war aber in die Jahre gekommen. Daher hat sich der Vaduzer Gemeinderat im Mai 2022 dazu entschieden, eine Machbarkeitsstudie für eine Sanierung in Auftrag zu geben. Das Ergebnis war, dass ein Erweiterungsbau mit Frühstücksraum, der auch als Tagescafé genutzt werden
kann, sinnvoll wäre. Daraufhin wurde vom Gemeinderat ein Planungskredit gesprochen, der später im Sinn der Nachhaltigkeitsstrategie «Vaduz 2030» um den Punkt «Senkung von Energie- und Nebenkosten» ergänzt wurde. Den Auftrag erhielt schliesslich das Architekturbüro Hasler mit Sitz in Vaduz. Die Projektleitung übernahm Architektin Sarah Hermann.
Eine Decke als Gestaltungselement
«Unsere Projektstudie sah vor, dass wir das alte, ans Hotel angebaute Wohnhaus aus dem Jahr 1922 durch einen Neubau ersetzen, der als Coffeehouse und Speisesaal für das Frühstück genutzt wird. Durch die

Baut für‘s Leben franzhasler.li


Dank einer grossartigen Zusammenarbeit und viel
Flexibilität bei allen Beteiligten haben wir es geschafft, in einer lediglich zehnmonatigen Bauphase ein optimales Resultat zu erzielen.
Sarah Hermann, Architektin
Auflösung des Schwimmbads im Erdgeschoss des Hotels konnten wir ausserdem 70 Quadratmeter Raum gewinnen», sagt Sarah Hermann. Durch diese Massnahme liessen sich Lobby und Lounge im Empfangsbereich deutlich vergrössern. Die Gäste-WCs konnten aufgewertet und ein Sitzungs- beziehungsweise Seminarraum integriert werden. «Die Gebäudehülle haben wir komplett optimiert und energetisch genau wie die gesamte Haustechnik, die bereits 50 Jahre alt war, auf den neusten Stand gebracht. Zusammen mit der PV-Anlage auf dem Dach verfügt das Gebäude nun über deutlich mehr Energieeffizienz.» Die 22 Hotelzimmer wiederum haben eine umfassende Modernisierung erfahren. «Es ist uns


Ihre Fachleute für Ingenieurarbeiten im Hoch- und Tiefbau
Büro Schaan
Feldkircher Strasse 9, FL-9494 Schaan
Tel. +423 237 50 80
Büro Ruggell
Noflerstrasse 12, FL-9491 Ruggell
Tel. +423 370 18 90
www.bauingenieure.li, info@bauingenieure.li
WIR SUCHEN:
- Bauingenieur/in Infrastrukturbau
- Zeichner/in EFZ od. Techniker/in HF Infrastrukturbau
Projektpräsentation «Giessen Hotel & Coffeehouse, Vaduz»

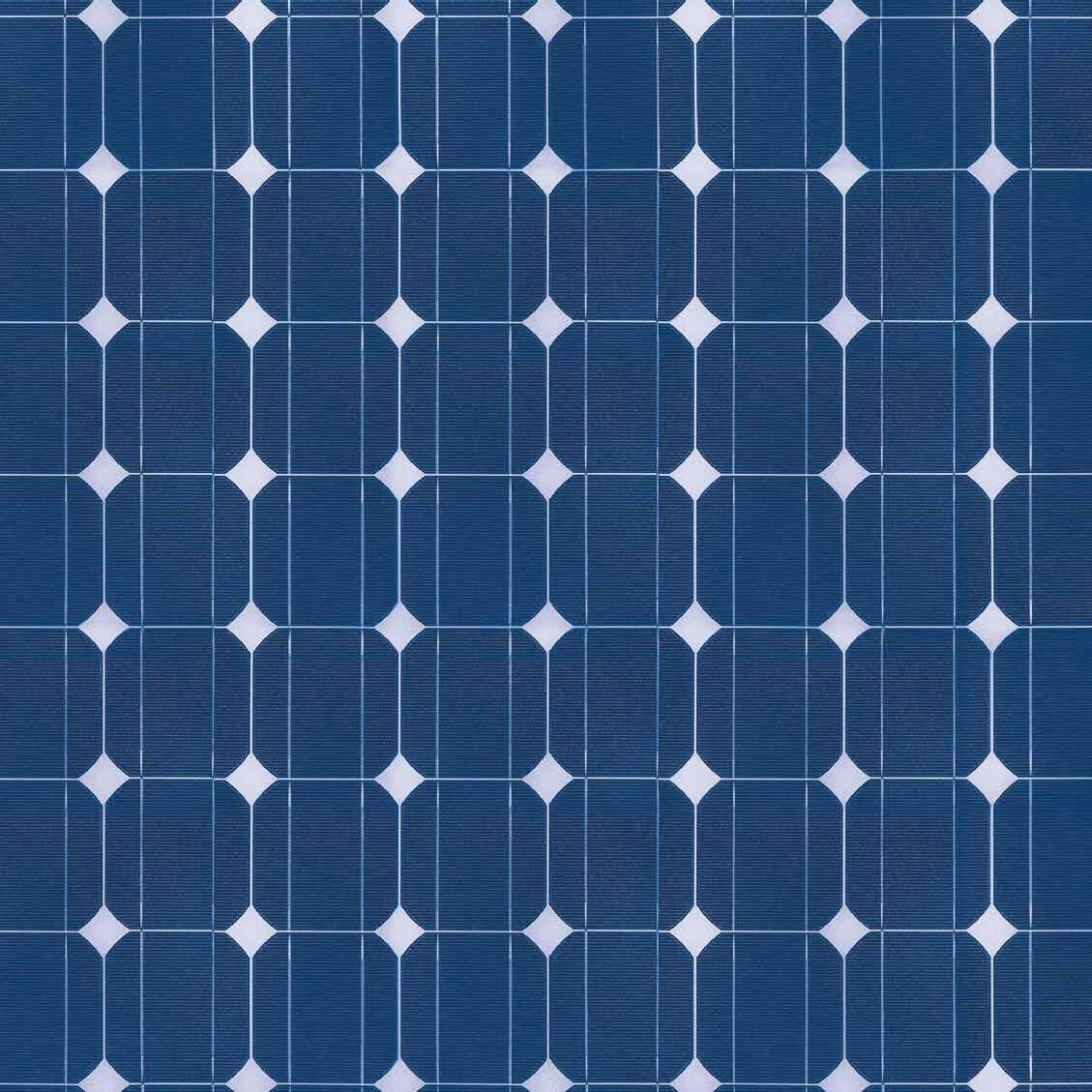
mit vergleichsweise kleinem Aufwand, wie beispielsweise einem neuen Anstrich, neuen Möbeln und einer Sanierung der Bäder, gelungen, den Zimmern eine frische Optik und deutlich mehr Komfort zu verleihen», sagt Sarah Hermann.
Bei der Materialisierung hat die Architektin grossen Wert auf Natürlichkeit gelegt. «Im Bestand war Beton der dominierende Baustoff. In Absprache mit der Pächterin haben wir hingegen beim Neubau viel mit Holz gearbeitet und mit der Decke eine Verbindung von innen nach aussen geschaffen. Sie zieht sich nun als Gestaltungselement von den Balken im Inneren bis
hin zu einem Fächer im Aussenbereich, der sich um das gesamte Gebäude erstreckt.» Verbunden sind die Gebäudeteile, Coffeehouse und Hotel, mittlerweile durch einen stufenlosen Zugangsbereich und einen Lift, die beide Gewähr dafür leisten, dass sowohl das Hotel als auch das Coffeehouse mit seiner grosszügigen Terrasse barrierefrei genutzt werden können.
Harmonie aus Funktionalität und Optik «Alt und Neu zusammenzubringen, dabei sowohl die Wünsche der Gemeinde als auch jene der Pächterin zu vereinbaren, Abläufe zu optimieren sowie Nutzung, Funktionalität und Optik zu kombinieren, war eine reizvolle



naheliegend designorientiert qualitätsbewusst
Herausforderung. Es freut mich rückblickend sehr, wie gut uns dies mit vereinten Kräften gelungen ist und dabei gleichzeitig den Geist des Ensembles so weit wie möglich zu erhalten», sagt Sarah Hermann.
Neu organisiert hat Sarah Hermann ebenfalls die Parkplatzsituation rund um die beiden Gebäudekörper. Dabei galt es, den Gewässerabstand zum Giessen genauso einzuhalten wie einen Mobilitätskorridor entlang der Zollstrasse. Sechs Parkplätze unterhalb des Coffeehouses, erreichbar über eine Rampe hinter dem Gebäude, und weitere elf rund um die beiden Gebäudekörper herum gewährleisten inzwischen die Einhaltung beider
Vorgaben. «Nun funktioniert die Parzelle auch diesbezüglich in sich selbst und ohne Abhängigkeit von externen Zufahrten.» Gleichzeitig konnten die Übersichtlichkeit und mit ihr die Ein- beziehungsweise Ausfahrtssituation verbessert werden.
Zusammenarbeit als Erfolgsgeheimnis
Mit dem Giessen Hotel & Coffeehouse hat Sarah Hermann erstmals ein Bauprojekt der öffentlichen Hand vom Entwurf bis zur Schlüsselübergabe geleitet. «Es war ein überaus spannender Auftrag, bei dem von der Gemeindebauverwaltung über die Fachplaner und die beauftragten Unternehmer


bis hin zur Pächterin zahlreiche Parteien beteiligt waren und bei dem ich viel über die Abläufe sowie die baulichen Notwendigkeiten in der Gastronomie und über die IT-Bedürfnisse eines rund um die Uhr geöffneten Hotels mit Self-Checkin lernen durfte», sagt die Architektin. «Dank einer grossartigen Zusammenarbeit und viel Flexibilität bei allen Beteiligten haben wir es geschafft, in einer lediglich zehnmonatigen Bauphase ein optimales Resultat zu erzielen. Nun das fertige, modernisierte Hotel und das moderne Coffeehouse, das seinem Namen wirklich gerecht wird, zu sehen, macht Freude – und ich bedanke mich herzlich bei allen, die ihren Beitrag zu diesem Projekt geleistet haben.»



Sicherheit. All-in-one
Alarmanlagen, Videoüberwachung, Leitsysteme, Brandmelde- und Zutrittssysteme. Bei Speedcom sind Sie immer sicher.
Projektpräsentation «Giessen Hotel & Coffeehouse, Vaduz»



141 × 124
141 × 124
141 × 124
CLAUDIO CAZZATO VADUZ
141 × 124
Gipser und Maler Arbeiten
Renovationen und Umbau
CLAUDIO CAZZATO VADUZ
Reparaturen und Sanierungen
Stucco Veneziano / Isolierung
Gipser und Maler Arbeiten
CLAUDIO CAZZATO VADUZ
Stuckaturen / Trockenbau
Renovationen und Umbau

Reparaturen und Sanierungen
CLAUDIO CAZZATO VADUZ
Gipser und Maler Arbeiten
Stucco Veneziano / Isolierung
www.gipserei-claudiocazzato.li
Renovationen und Umbau
Stuckaturen / Trockenbau
Gipser und Maler Arbeiten
+41 (0) 79 539 50 44 (Mobile)
Renovationen und Umbau
Reparaturen und Sanierungen
Reparaturen und Sanierungen
Stucco Veneziano / Isolierung
Stucco Veneziano / Isolierung
www.gipserei-claudiocazzato.li
Stuckaturen / Trockenbau
+41 (0) 79 539 50 44 (Mobile)
Stuckaturen / Trockenbau
www.gipserei-claudiocazzato.li
www.gipserei-claudiocazzato.li
+41 (0) 79 539 50 44 (Mobile)
+41 (0) 79 539 50 44 (Mobile)
Projektpräsentation «Giessen Hotel & Coffeehouse, Vaduz»

Z A H L E N & F A K T E N
«Giessen Hotel & Coffeehouse», Zollstrasse 16, Vaduz
Volumen
Neubau: 1460 Kubikmeter
Bestand: 3570 Kubikmeter
Geschossfläche
Neubau: 421 Quadratmeter
Bestand: 864 Quadratmeter
Parkplätze
Untergeschoss: 6
Aussen: 11

Das Landhaus am Giessen ist ein schönes Beispiel dafür, wie wir in Vaduz Tradition und Fortschritt miteinander verbinden. Seit dem Jahr 2000 im Eigentum der Gemeinde, hat sich das Hotel als willkommene Adresse etabliert und trägt aktiv zur Stärkung unseres touristischen und wirtschaftlichen Angebots bei.
Durch die kürzlich abgeschlossene Sanierung und Erweiterung sowie die Einrichtung eines Tagescafés ist es gelungen, einen weiteren Treffpunkt in Vaduz zu schaffen. Das Projekt zeigt, wie kommunale Verantwortung, wirtschaftliche Weitsicht und nachhaltige Entwicklung miteinander funktionieren.
Florian Meier, Bürgermeister von Vaduz


Die Gäste sind begeistert
Die Ergebnisse des Umbaus gefallen mir ausserordentlich gut. Unsere Gäste zeigen sich begeistert vom neuen Erscheinungsbild des Giessen Hotel & Coffeehouse. Die stilvolle Gestaltung der Zimmer und die liebevoll gestalteten Räumlichkeiten finden durchweg grossen Anklang. Es freut uns sehr, dass der Umbau so positiv wahrgenommen wird und unsere Gäste sich bei uns wohlfühlen.
Die ersten Wochen des operativen Betriebs waren und sind hingegen eine Zeit der Herausforderungen. Nicht alles hat von Anfang an reibungslos funktioniert, und die Nachwehen eines solch umfangreichen Projekts haben sich für mich als unerwartet zeit- und energieintensiv erwiesen. Dennoch zeigt sich nun, dass sich vieles langsam einspielt,
und ich blicke optimistisch nach vorne. Besonders glücklich bin ich über meine grossartigen Mitarbeiterinnen, die mit voller Motivation und Tatkraft dazu beitragen, meine Vision für das Giessen Hotel & Coffeehouses zu verwirklichen. Ihre Unterstützung war und ist für mich in dieser intensiven Zeit unverzichtbar und ein absoluter Glücksfall.
Für die Zukunft hoffe ich, dass wir an den bisherigen Erfolgen des Hotels anknüpfen und die Auslastung der Zimmer sogar noch steigern können. Zudem wünsche ich mir, dass unser Coffeehouse in Vaduz zu einem echten Anziehungspunkt wird, zu einem Ort, der Menschen zum Verweilen einlädt und durch sein einzigartiges Angebot zu einem beliebten Treffpunkt für Einheimische und Gäste gleichermassen wird.
Isabella Sele, Betreiberin des Giessen Hotel & Coffeehouse
Projektpräsentation «Giessen Hotel & Coffeehouse, Vaduz»

Bei Bauprojekten dieser Grössenordnung und Komplexität besteht stets die Herausforderung, dass sich während der Bauarbeiten unerwartet herausstellen kann, dass Gebäudeteile in einem schlechteren Zustand sind als ursprünglich angenommen. Auch bei diesem Bauvorhaben mit Fokus auf Energieeffizienz und optimale Nutzung der Räumlichkeiten mussten Baumassnahmen im laufenden Planungs- und Bauprozess aufgrund neuer Erkenntnisse angepasst werden.
Dank eines hervorragend funktionierenden Planungsteams konnte jedoch jederzeit schnell und flexibel auf sich verändernde Rahmenbedingungen reagiert werden. An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Beteiligten – insbesondere bei Architektin Sarah Hermann und Bauleiterin Lara Borghi sowie bei Pächterin Isabella Sele für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.
Gunnar Eberle, Projektleiter Hochbau der Gemeinde Vaduz

Das Projekt zur Sanierung und Erweiterung des «Hotels Landhaus am Giessen» in Vaduz war für mich persönlich nicht nur äusserst interessant, sondern auch lehrreich. Eine der grössten Herausforderungen, mit denen die Projekt- und Bauleitung konfrontiert ist, besteht darin, Kosten und Termine einzuhalten. Bei diesem Objekt stellte die Kosten- und Terminkontrolle eine besondere Herausforderung dar.
Einerseits mussten unvorhergesehene Baumassnahmen durchgeführt werden, die zusätzliche Kosten verursachten. Andererseits galt es, in den engen Platzverhältnissen alle Arbeiten im und um das Gebäude innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens zu realisieren. Die teilweise überschneidenden Arbeitsetappen zu koordinieren, war nicht immer einfach und erforderte eine präzise Abstimmung zwischen den verschiedenen Gewerken.
Die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Unternehmern und Fachplanern hat mir jedoch grossen Spass bereitet. Selbst in Phasen mit
hohem Zeitdruck war die Motivation spürbar und alle Beteiligten setzten sich dafür ein, die Zielvorgaben zur vollsten Zufriedenheit zu erreichen. Dafür möchte ich allen Beteiligten herzlich danken. Besonders bedanken möchte ich mich bei der Bauherrschaft Gemeinde Vaduz, sowie bei den Architekten für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit.
Mit dem Ergebnis der Sanierung und Erweiterung des Hotels bin ich äusserst zufrieden. Es strahlt eine einladende Atmosphäre aus, die den Aufenthalt im renovierten Hotel zu einem echten Genuss macht. Auch das Coffeehouse präsentiert sich stimmig und ansprechend. Die Sanierung und die Erweiterung harmonieren hervorragend miteinander.
Nun die Freude und Begeisterung der Leute zu spüren, ist sehr zufriedenstellend und letztlich das grösste Highlight für mich. Gerne sitze ich heute im Coffeehouse, bin stolz, was wir gemeinsam als Team erreicht haben und geniesse die Freude der Gäste und Nutzer zu sehen.
Lara Borghi, Bauleiterin
Projektpräsentation «Giessen Hotel & Coffeehouse, Vaduz»
Mit einem klaren Blick für zeitloses Design und Gemütlichkeit hat ALLURE als Spezialist für Inneneinrichtung, Maler- und Gipserarbeiten das neue Giessen Hotel & Coffeehouse erfolgreich mitgestaltet.
ALLURE hat es geschafft, Räume zu gestalten, die nicht nur schön aussehen, sondern in denen sich Touristen, Geschäftsreisende und Einheimische gleichermassen willkommen fühlen.
Malerarbeiten und stilvolle Akzente
ALLURE war verantwortlich für sämtliche Malerarbeiten im Innenbereich sowie die Gipserarbeiten – von fein abgestimmten Wandgestaltungen bis hin zu dekorativen Stuckprofilen. Durch die sorgfältige Wahl der Farben und Materialien wurde eine harmonische Atmosphäre geschaffen, die Naturtöne und Wohlgefühlfaktor vereint. Die Farbgestaltung wirkt zeitlos und schafft eine ruhige, angenehme Umgebung, die zum Verweilen einlädt.
Einladende Inneneinrichtung
Das Coffeehouse als Herzstück des Hauses bietet nicht nur hochwertigen Kaffee und kulinarische Genüsse, sondern auch Raum für Begegnung und Austausch. Die Lounge und Hotelzimmer kombinieren modernes Design mit Gemütlichkeit und bieten einen Rückzugsort, der den Bedürfnissen aller Gäste gerecht wird.
Ob jung oder alt, ob für einen kurzen Stopp oder längere Aufenthalte – das Giessen Hotel & Coffeehouse lädt zum Ankommen und Wohlfühlen ein.
Altes neu interpretiert
Hervorzuheben gilt der respektvolle Umgang mit der Vergangenheit des Hauses. ALLURE hat die Geschichte des Ortes aufgegriffen und mit modernen Akzenten in Einklang gebracht. Somit besticht das Treppenhaus z.B. noch mit alten Elementen und eine Galerie alter Fürstenbilder erinnert an vergangene Zeiten. So entsteht eine Brücke zwischen Tradition und zeitgenössischem Design.
ALLURE freut sich, mit dem Giessen Hotel & Coffeehouse einen Ort mitgestaltet zu haben, der Menschen zusammenbringt, Geschichten erzählt und gleichzeitig den Charme des Vergangenen bewahrt.
Über ALLURE
ALLURE ist Ihr Experte für Maler- und Gipserarbeiten und individuelles Interior Design. Mit Kreativität, Präzision und einem Gespür für zeitlose Designs schafft ALLURE Räume, die inspirieren, begeistern und zum Wohlfühlen einladen. Ob moderner Landhausstil oder modern – ALLURE bringt Ideen zum Leben und sorgt dafür, dass jeder Raum zu etwas Besonderem wird.
Besuchen Sie den Showroom von ALLURE in Buchs, wo Sie die moderne Handwerkskunst entdecken können oder das HOUSE of ALLURE in Vaduz, das Landhausstil und einen Concept Store vereint.
Mehr Infos unter: allure.li

Weitere Einrichtungsfotos in dieser Projektpräsentation.
An Weihnachten 2024 feierte der gebürtige Maurer Bürger Marius Kaiser in seiner Heimatgemeinde Mauren-Schaanwald sein 20-Jahre-Priesterjubiläum. Pfarrer Kaiser kann auf eine wechselvolle Lebensgeschichte zurückblicken, aus der er in einem Beitrag in der Dezember-Ausgabe 2024 mit der lie:zeit erzählt hat.
Text: Herbert Oehri
Marius Kaiser fühlte sich erst im Laufe seines Lebens als Diener Gottes berufen und zunächst zuerst als junger Lehrer in Schaan seine berufliche Laufbahn. Dort besuchte er einen Lehrerkatechetikkurs, da er zunehmendes Interesse für das Schulfach Religion verspürte. Nach drei Unterrichtsjahren erhielt er eine neue Anstellung in der Pfarrei St. Laurentius in Schaan. Als Seelsorgehelfer waren seine Arbeitsschwerpunkte neben Religionsunterricht in verschiedenen Schulklassen auch kirchliche Jugendarbeit sowie die Vorbereitung von Schüler- und Familiengottesdiensten. Dabei kristallisierte sich sein Wunsch immer klarer heraus: im Herzen der Kirche einen Dienst an der Gemeinschaft ausüben.
1987 gündete Marius Kaiser mit der Hilfe von Freunden und Bekannten das Indienhilfswerk «Hilfe zur Selbsthilfe», in dem er fünf Jahre mitwirkte, bevor er das Hilfswerk ONE WORLD ins Leben rief. Er bereiste viele Male Indien und sah das grosse Elend im bevölkerungsreichsten Land der Erde, das ihn stark berührte.

Im Jahr 1993 berief ihn der Diözesanbischof von Chur, Wolfgang Haas, an die Pfarrei in Hausen am Albis im Kanton Zürich. Im November 2004 empfing Marius Kaiser in Horgen, ebenfalls im Kanton Zürich, die Priesterweihe, und von 2008 bis im Sommer 2024 wirkte er in der Pfarrei St. Felix und Regula Thalwil.
Im August vergangenen Jahres vertraute ihm der Diözesanbischof von Chur, Joseph Maria Bonnemain, die Pfarreien St. Kolumban Wangen (und St. Margaretha Nuolen im Kanton Schwyz an. Eine grosse Aufgabe, die Marius Kaiser mit vollem Elan angenommen hat. Neben seinen priesterlichen Aufgaben und Verpflichtungen ist es Pfarrer Kaiser seit vielen Jahren ein grosses Anliegen, sich für die Ärmsten der Armen zu engagieren.
Er widmete sich stets «der Arbeit im Weinberg des Herrn», in deren Rahmen er nun auf 20 Jahre erfolgreichen Wirkens zurückblicken darf. Dieses Jubiläum wollte er in seiner Heimatgemeinde Mauren-Schaanwald feiern, wo er geboren wurde und aufgewachsen ist.
Die Pfarrgemeinde Mauren feierte am Sonntag, 22. Dezember 2024, mit Pfarrer Marius Kaiser sein 20-Jahre-Priesterjubiläum. Beim Gottesdienst stand ihm der Maurer Pfarrer Pater Anto zur Seite, der herzliche Worte für seinen Priesterkollegen fand. Am Schluss bat Pater Anto alle Kirchgänger für ein Gemeinschafts- und Erinnerungsbild zum Altar nach vorne.
Möge Pfarrer Marius Kaiser noch viele Jahre gesund bleiben und sich im kirchlichen Dienst als Priester und als Mitarbeiter des sozial-caritativen Netzwerkes ONE WORLD mit vielen anderen für die Anliegen Gottes engagieren. In seinen neuen Pfarreien St. Kolumban Wangen und St. Margaretha Nuolen wünschen wir ihm alles Gute und viel Freude.

Zelebrierten gemeinsam die Messe zum Priesterjubiläum von Marius Kaiser: der Maurer Gemeindepfarrer Pater Anto und Pfarrer Marius Kaiser.
Mag. Gregor Meier aus Feldkirch hat ein Jurastudium abgeschlossen und ist in Liechtenstein gelandet, wo er zuerst in einer Rechtsanwaltskanzlei arbeitete, bevor er sich nach dem «Volksblatt»-Aus dem Medienbereich zuwandte. Er gründete eine Plattform mit dem Namen «Landesspiegel» und führt sie seither. Seit der Entscheidung des Landtags in der Dezember-Sitzung des vergangenen Jahres, die Medienförderung abzuändern, ist es für den Landesspiegel nicht mehr möglich, die deutlich höheren Anforderungskriterien zu erfüllen, sodass Gregor Meier gezwungen ist, auf die Medienunterstützung des Staates zu verzichten.
Interview: Herbert Oehri
Herr Meier, Sie sind schon längere Zeit beruflich in Liechtenstein tätig. Bitte erzählen Sie etwas über Ihren Lebenslauf.
Gregor Meier: Mein erster Job war bei MSE in Eschen. Dort habe ich während der Schulzeit und während des Studiums über mehrere Jahre jeweils im Sommer gearbeitet. Angefangen habe ich mit einfachen Tätigkeiten, beispielsweise Zimmersuche für Mitarbeiter. In den Jahren darauf durfte ich immer mehr Verantwortung übernehmen.
Dabei habe ich auch erfahren, was die rechtlichen Rahmenbedingungen, die in einem Land herrschen, für ein Unternehmen bedeuten. MSE hatte zahlreiche Temporär-Mitarbeiter in Österreich und Liechtenstein. In der Schweiz war es zumindest damals sehr schwierig. Dort habe ich oft mitbekommen, dass gewisse administrative Sachen in Liechtenstein viel einfacher und damit für die Unternehmen günstiger sind als in den Nachbarländern.
Was haben Sie nach dem Studium gemacht?
Nach dem Studium durfte ich als Konzipient bei der Rechtsanwaltskanzlei Schwärzler in Schaan viel lernen. Im Anschluss daran habe ich das Gerichtspraktikum beim Fürstlichen Landgericht in Vaduz absolviert. Danach bin ich nach Winterthur gegangen. Dort habe ich bei einer Marketing-Agentur gearbeitet. Als Projektleiter war ich zuständig für die Kundenbetreuung und Konzeption der Marketing-Aktivitäten. Zudem war ich als Ausbilder für die Betreuung der Lehrlinge verantwortlich. Diese Agentur hat später ein Joint-Venture mit der Vaduzer Medienhaus AG lanciert. Für mich war das nach fünf Jahren in Winterthur die Gelegenheit, nach Liechtenstein zurückzukommen.
Zwei Jahre später habe ich mich entschlossen, selbständig zu werden. Einige Kunden haben mich ermutigt und mir die Entscheidung sehr leicht gemacht. So habe ich 2019 meine Marketing-Agentur gegründet. Medien haben mich immer schon interessiert. In meiner Jugend habe ich ein Praktikum bei einem Radiosender absolviert. Auch Politik hat mich immer sehr interessiert. Die Idee, in diesem Bereich etwas zu machen, hatte ich schon
länger. Die beiden grossen Medienhäuser hatten eine Bezahlschranke in ihren Online-Angeboten. In der Schweiz und in Österreich gibt es mehrere Online-Zeitungen, die ohne Bezahlung gelesen werden können. Ich war immer davon überzeugt, dass das eigentlich auch in Liechtenstein tragfähig sein müsste. Der Markt ist aber doch sehr überschaubar, und neben den beiden grossen Medienunternehmen habe ich nicht viel Platz für einen neuen Player gesehen.
Der Entschluss, eine Online-Zeitung zu gründen, ist bei mir aufgekommen, nachdem ich gelesen hatte, dass das «Volksblatt» den Betrieb einstellen wird. Das war für mich eine Gelegenheit, und ich dachte «jetzt oder nie». Es musste dann alles sehr schnell gehen, und an dem Tag, an dem die letzte Ausgabe des «Volksblatts» erschienen ist, am 4. März 2023, ist der «Landesspiegel» live gegangen. Ich habe schnell viel positives Feedback bekommen, und auch die ersten Werbebuchungen sind gekommen. So konnte ich immer mehr Zeit in das Projekt investieren.
Wie sind Sie gerade auf Liechtenstein gekommen und welche Gründe haben Sie bewogen, Liechtenstein als Berufsziel auszuwählen?
Ein Beweggrund war sicher die überschaubare Bürokratie. Ein Wettbewerbsvorteil, der in den letzten Jahren allerdings etwas nachgelassen hat. Zum einen haben die Nachbarländer in diesem Bereich aufgeholt, und Liechtenstein hat mit diesen Entwicklungen leider nicht immer eins zu eins mitgehalten.
Wie sind Sie mit dem aktuellen Geschäftsverlauf des «Landesspiegels» zufrieden?
Das Geschäftsjahr 2023 war sehr gut. Mit dem Geschäftsjahr 2024 bin ich sehr zufrieden. Auch wenn es ein schwieriges Umfeld war, konnte der Gewinn gesteigert werden. Der Ausblick für 2025 ist etwas eingetrübt.
Viele Unternehmen planen Einsparungen, und Werbung ist dann leider

oft einer der ersten Punkte, bei dem man glaubt, schnell Geld sparen zu können. Das ist natürlich kurzfristig gedacht. Aber viele denken eben so. Dazu kommt der Wegfall der Medienförderung, der ein zusätzliches Loch ins Budget reisst.
Der Landtag hat das Medienförderungsgesetz verabschiedet, das bestimmte Voraussetzungen für die Förderungsberechtigung vorschreibt. Wie sind Sie generell mit dem Medienförderungsgesetz zufrieden und wo sehen Sie allenfalls Verbesserungspotenzial?
Der Landtag hat im Dezember entschieden, die Medienförderung, wie von der Regierung vorgeschlagen, abzuändern. Für den Landesspiegel bedeutet diese Änderung, dass es nicht möglich ist, die nun deutlich höheren Kriterien zu erfüllen.
Selbstverständlich ist das eine demokratische Entscheidung, und sie ist zu akzeptieren. Dennoch möchte ich sagen, dass es aus meiner Sicht richtig gewesen wäre, wenigstens eine Übergangsfrist zu gewähren, in welcher die neuen Kriterien zu erfüllen sind. In drei Wochen hätte ein Mitarbeiter gefunden, eingestellt und dessen Finanzierung gesichert werden müssen. Und ob dann tatsächlich die Förderung zugesprochen worden wäre, ist mehr als unsicher. Niemand kann heute sagen, wie die Medienkommission demnächst zusammengesetzt sein wird, und auch die entsprechende Verordnung der Regierung ist noch nicht fertig. Daher hätte es mein Unternehmen wirtschaftlich überfordert, die Förderbedingungen zu erfüllen.
Es geht aber nicht nur ums Geld. Wenn die Mehrheit der Abgeordneten zum Ausdruck bringt, dass sie den «Landespiegel» nicht für förderungswürdig hält, ist das für mich ein schmerzhaftes Signal. Danke sagen möchte ich an dieser Stelle den Abgeordneten der VU, die noch engagiert versucht haben, mit einem Abänderungsantrag eine Möglichkeit zu schaffen, damit der «Landesspiegel» weiterhin eine Chance auf die Förderung hätte. Leider war dies nicht von Erfolg gekrönt.
Dann ist es natürlich etwas widersprüchlich, wenn die zuständige Ministerin auf der einen Seite sagt, sie will mehr Medienvielfalt, und auf der anderen Seite ändert man das Gesetz dann so, dass von vier bis 31. Dezember 2024 förderberechtigten Medien eines nicht mehr förderberechtigt ist. Wie das zur Medienvielfalt beitragen soll, mag verstehen wer will, ich tue es nicht.
Dazu kommt, dass die Mitbewerber nun sehr grosszügige Förderungen bekommen, was es sehr schwierig macht, ohne einen Franken öffentliche Unterstützung die gleiche Qualität und Quantität zu bieten.
Wie sind Ihre Zukunftspläne mit dem Online-Portal Landesspiegel und wie steht es mit der vor einem Jahr ins Auge gfeassten Printzeitung innerhalb Ihrer Online-Plattform?
Aktuell versuchen wir, die weggefallene Medienförderung mit einer Crowdfunding-Kampagne zu kompensieren. Wenn es gelingt, zumindest einen Grossteil aufzubringen, kann ich in der bisherigen Qualität und Quantität weiterarbeiten. Ansonsten wird es Einschnitte geben. Erfreulicherweise gibt es bereits Unterstützungszusagen. Darum bin ich zuversichtlich, dass dieses Ziel erreicht wird.
Was die Print-Ausgabe betrifft, war die Ansage klar: Um den Druck zu bezahlen, bräuchte es 500 Abonnenten. Im Aktionszeitraum haben aber nur 120 Leute unterschrieben. Damit ist das aktuell sicher nicht realisierbar. Ohne Medienförderung schon gar nicht. Es bleibt ein Problem, dass die Leser die höchste Qualität wollen, am besten noch alles werbefrei, aber die Bereitschaft dafür zu bezahlen, ist sehr gering.
Schliesslich bleibt zu hoffen, dass sich die politische Einschätzung ändern wird. Vielleicht gibt es in Zukunft einmal wieder eine Mehrheit im Landtag, die kleine und unabhängige Medien ebenfalls als förderungswürdig betrachtet. Auch die Werbeausgaben der Unternehmen werden sicher irgendwann wieder steigen. Von dem her bleibe ich zuversichtlich.

Der Mobilitätsverein Liechtenstein (MOVE-LI) setzt sich für eine Optimierung des Verkehrsflusses und für eine Entflechtung der verschiedenen Verkehrsmittel in Liechtenstein ein.
Text: Karlheinz Ospelt
Verkehr ist kein Selbstzweck, sondern stellt wichtige Verbindungen zwischen allen am Wirtschafts- und Gesellschaftsleben Beteiligten her. Der Transport von Personen, aber auch Rohmaterialien und Gütern vom Gewinnungsort bis zum Konsumenten ist eine zentrale Funktion unserer arbeitsteiligen Wirtschaft, die nicht durch bürokratische Vorschriften und ideologische Ansichten unsachlich beeinträchtigt werden darf. Der Mobilitätsverein Liechtenstein (MOVE-LI) ist fest davon überzeugt, dass ein funktionierender Verkehr und die damit zusammenhängende Raumplanung Wohlstand und Zukunft des Standortes Liechtenstein sichern und dazu beitragen, die Umwelt zu entlasten.
Zweck des Vereins ist u. a.:
• Die Förderung der Sicherheit durch geeignete Massnahmen wie Schaffung separater Bereiche für die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer.
• Der Schutz der Umwelt durch Massnahmen für sparsamen Energieverbrauch durch Vermeidung von Staus, Stopp-and-Go-Verkehr, unnötige bauliche Hindernisse etc.
• Die Förderung eines optimalen Verkehrsflusses auf den Land- und Gemeindestrassen des Fürstentums Liechtenstein sowie von kurzen, effizienten Verkehrswegen für alle Verkehrsteilnehmer.
• Die Förderung des Verständnisses für die unterschiedlichen Verkehrsmittel und deren Zusammenwirken unter Beachtung ökologischer und ökonomischer Parameter.
• Gespräche mit den Verantwortlichen in Politik, Verwaltung und Wirtschaft.
• Die konsequente Berücksichtigung von Verkehrsinfrastruktur bei Raumplanung und Verkehrsrichtplänen und Mitwirkung bei deren Erarbeitung.
• Frühzeitige Einflussnahme auf Gesetzgebung und Massnahmen.
• Wahrnehmung des Initiativ-, Referendumsund Beschwerderechts.
• Die Initiierung und Unterstützung von Massnahmen für eine zukunftsfähige Nutzung der bestehenden Verkehrswege und die Ergänzung derselben.
• Veröffentlichungen von Fach-, TV- und Radio-Beiträgen sowie von Leserbriefen und Mitgliederbeiträgen in Zeitungen, auf der Homepage, in den Sozialen Medien etc.
Anhand von zwei Beispielen soll unser Ansatz erläutert werden:
Kürzlich hat die Regierung eine Vernehmlassung zu einem neuen Radroutenkonzept lanciert. Dazu haben wir wie folgt Stellung genommen:
Wir müssen in Liechtenstein vermehrt ins Umsetzen kommen, Strategien und Konzepte wurden in den letzten Jahrzehnten mehr als genug erstellt.
Das Pferd wird am Schwanz aufgezäumt
Während mit einem Anteil von über 75 % der Grossteil der Verkehrsteilnehmer mittels motorisierten Individualverkehrs (MIV), rund 12 % mit dem ÖV, ca. 8 % zu Fuss und lediglich ca. 5 % mit dem Fahrrad unterwegs sind, soll mit grossem finanziellem Aufwand die Situation der anteilsmässig kleinen Gruppe der Radfahrer nicht nur verbessert, sondern maximal optimiert werden – ohne Rücksicht auf alle anderen Verkehrsteilnehmer.
Dieser Ansatz ist falsch. In unseren Augen sollte ein Konzept – auch wenn es nur als Teilkonzept konzipiert ist – allen Verkehrsteilnehmern gerecht werden. Das nun präsentierte Radroutenkonzept hat bei genauer Betrachtung genau den gegenteiligen Effekt, indem mit den darin vorgeschlagenen Massnahmen die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer sogar benachteiligt wird. Statt für alle Verkehrsteilnehmer Verbesserungen anzustreben, wird mit dem Radroutenkonzept erneut eine Behinderungspolitik verfolgt: Das Radroutenkonzept bezweckt eine radikale Verbesserung für weniger als 5 % der Verkehrsteilnehmer zulasten aller anderer, indem der MIV – aber teilweise auch der ÖV – zusätzlich behindert werden soll.
60 Millionen für Radwege?
Wenn man für die Verbesserung der Radinfrastruktur knapp 60 Millionen Franken investieren will, entspräche das einer äquivalenten Investitionssumme im Bereich des motorisierten Individualverkehrs von 1‘200 Millionen Franken! Von solchen Investitionsvorhaben im
Strassenverkehr ist Liechtenstein weit entfernt, seit Jahren werden kaum neue Strassen gebaut, vielmehr wurden bestehende Strassen rückgebaut und eingeengt, obwohl der Strassenverkehr seit 50 Jahren stetig zunimmt.
Umfahrungsstrassen sollen zu Radwegen degradiert werden Es werden sogar Gemeindeabstimmungen ignoriert und ins Gegenteil verdreht: So hat zum Beispiel die Gemeinde Vaduz mit der Abstimmung über die Umfahrung Rheindamm klar festgelegt, dass die Zufahrten zum Rheindamm über die Lochgass und die Schaanerstrasse führen sollen und diese somit als Teil der Umfahrungsstrasse zu dienen haben. Im Radroutenkonzept werden diese zu Radrouten degradiert und zu Tempo-30-Strassen herabqualifiziert! Damit nicht genug: Sammelstrassen der Gemeinden sollen durch sogenannte «Netzunterbrüche» gar durch bauliche Sperren nicht mehr durchgängig befahrbar sein. Dazu heisst es im Vernehmlassungsbericht lapidar: «Massnahmen zur MIV-Reduktion prüfen.»
Vor einigen Jahren wurde noch eine Schranke beim Industriezubringer Schaan (Volksabstimmung 2010) realisiert. Dass nunmehr für hohe Kosten lediglich für den Radverkehr eine Lösung gesucht wird, ist unverständlich. Dort ist eine Unter- oder Überführung anzudenken, welche alle Verkehrsteilnehmer unabhängig vom Bahnverkehr macht. Einzelmassnahmen mit Kosten von 4,5 Millionen Franken ausschliesslich für weniger als 5 % der Verkehrsteilnehmer führen zu ineffizienten Verkehrslösungen gegenüber einem Ansatz, der alle Verkehrsteilnehmer berücksichtigt.
Tempo 30 als neue Norm im Mischverkehr?
Bei 20 linearen Massnahmen wird ein Tempolimit von 30 km/h aufgeführt. Der Vorstand von MOVE-LI hat grösste Mühe damit, dass durch die Hintertüre ein Temporegime 30 («oder niedriger») eingeführt werden soll. Dies widerspricht dem mehrfach demokratisch geäusserten Willen der Stimmbevölkerung, die sich in jüngerer Vergangenheit klar gegen Tempo 30 ausgesprochen hat. Es kann nicht sein, dass nun in Form eines Radroutenkonzepts der demokratische Wille der Stimmberechtigten in den betreffenden Gemeinden durch Regierung und Verwaltung ignoriert wird. Selbst Vorschläge, die Landstrasse in Teilstücken auf Tempo 30 zu reduzieren finden Eingang in das Radrou-

tenkonzept. Hierzu wird als Ziel aufgeführt: «Sicherheit für den Radfahrer durch tiefe Geschwindigkeiten … zu verbessern.»
Separate Radwege, statt gefährliche gemeinsame Verkehrsachsen auf Sammelstrassen
Statt auf den bestehenden Radwegen Optimierungen vorzusehen, sollen ohne Rücksicht auf Umwelt und Lebensräume entlang des Kanals in Vaduz bedeutende Lebensräume versiegelt werden. Es ergibt keinen Sinn, den Neugutweg entlang des Binnenkanals weiterzuführen und bei der Brücke in der Lochgasse in die vom Volk beschlossene Umfahrungsstrasse an der Stelle einzuführen, an der am wenigsten Übersichtlichkeit besteht. Der heutige Neugutweg ist eine bestehende Radroute, welche allseits anerkannt ist. Nur um rund 50 Meter weniger Strecke fahren zu müssen, sollen dort und im Haberfeld landwirtschaftlich beste Böden und attraktive Lebensräume entlang von Bächen geopfert werden.
Ebenso sieht die Situation in Schaan aus. Der abseits von Gefahren bestehende Rüttileweg dient seit Jahren als Radweg zu den weiterführenden Schulen und zur Jugendherberge Schaan/Vaduz. Statt die Schüler auf die vielbefahrene Gapetschstrasse zu lenken, sollten bessere Verbindungen von den Quartieren zum Rüttileweg errichtet werden. Wir empfehlen daher dringend, die Verkehrsteilnehmer zu entflechten, statt diese in gefährliche gemeinsame Verkehrswege zu führen.
Aus unserer Sicht weist das Radroutenkonzept derartige Mängel und unverhältnismässige Massnahmen auf, dass es schlichtweg als Vorlage gesamtheitlich abzulehnen ist. Allenfalls kann es zu einem späteren Zeitpunkt in abgeänderter Form erneut bearbeitet werden, nämlich dann, wenn das Massnahmenkonzept für die Hauptverkehrsachsen in unserem Land geklärt ist (Umfahrungsstrassen, Busbuchten, Busspuren, Unter- und Überführungen bei Bahnübergängen und damit Ausbau der Bahnverbindungen, Klärung der Schnittstellen zwischen den Gemeinden etc.).
Bei einer geplanten Investition von 60 Millionen Franken sollten Radwege nicht entlang von dicht befahrenen Landes- und Gemeindestrassen angelegt werden, sondern in deren Nähe, aber als separate, sichere Wege, fern von
Abgasen, Lärm, LKW-, Bus- und Autoverkehr. Dazu eigenen sich auch wenig befahrene Quartierstrassen in den Gemeinden, die ohne Umbau problemlos für Fussgänger und Radfahrer mitgenutzt werden können.
Die Ergebnisse von Volksabstimmungen zeigen, dass die Mehrheit der Bevölkerung Tempo 30 ablehnt. Die Ergebnisse der Gemeindeabstimmungen in Schaan und Schellenberg sowie der Meinungsumfragen in Eschen und Ruggell sprechen eine klare Sprache. Dies aus gutem Grund.
Während der Bauphasen in Vaduz (Herrengasse) und Eschen (Kohlplatz) wurden auf
Umfahrungsstrassen vorübergehend Tempo-30-Beschränkungen eingeführt. Doch selbst nach Abschluss der Arbeiten wurden die provisorischen Schilder nicht entfernt.
In Vaduz wurde die Signalisation nach Öffnung der Herrengasse im Dezember bis Ende Mai verlängert, obwohl der Einbau des Belages erst in einigen Wochen erfolgt und nur wenige Tage benötigen wird. Ergo: fünf Monate fragwürdige Behinderung auf der von der Bevölkerung genehmigten Umfahrung!
Kosten von jährlich rund 100 Millionen Franken Tempo 30 bei wichtigen Verbindungen verlangsamt den Verkehr. Unnötig längere Fahrzeiten und stockender Verkehr sind die direkte Folge und damit mehr Frustration für alle. Bei nur 15 Minuten zusätzlicher Fahrzeit pro Tag bei 40’000 Arbeitnehmern entstehen Kosten von jährlich rund 100 Millionen, berechnet mit dem aktuellen Medianlohn!
Werden Sie Mitglied für nur CHF 25.- pro Jahr bzw. CHF 75.-, wenn es um ein Unternehmen geht, und melden Sie sich noch heute auf unserer Homepage move-li.li an, damit wir uns gemeinsam für eine sinnvolle und effiziente Verkehrspolitik Massnahmen setzen!
Mobilitätsverein Liechtenstein (MOVE-LI) | Bartlegroschstrasse 21 | 9490 Vaduz +423 233 23 88 | info@move-li.li | www.move-li.li
Der Vorstand

Karlheinz Ospelt Präsident des Vorstandes

Sascha Quaderer Vizepräsident des Vorstandes

Agathe Batliner Mitglied des Vorstandes

Realitätsferne Entscheidungen: Tempo 30 wird oft zulasten der gesamten Bevölkerung auch in Strassen durchgesetzt, in denen es keinen Sinn ergibt. Statt Strassen immer enger zu bauen und mit Tempo 30 zu beschildern, sollten diese wieder grosszügiger ausgestaltet sein und Platz für Busspuren ermöglichen. Engste Strassen mit hohen Randsteinen und Kreisel, die für LKW und Busse zu Problemen führen, unübersichtliche Verkehrsknoten, bauliche Hindernisse (Poller, überdimensionierte Verkehrsinseln, Einbuchtungen und Schwellen) sind Fehlentwicklungen. Ad absurdum wird dies geführt, wenn auf Feldwegen statt auf dicht befahrenen Strassen Kreisel geplant werden, so etwa bei Massnahme P209 in Eschen, gemäss der bei Schwarz Strässle und Escheweg mitten in der Natur ein Kreisel gebaut werden soll.
Unser Land braucht endlich eine effiziente, durchdachte Verkehrspolitik und keine Verkehrsverhinderungspolitik!
QR-Code scannen und Mitglied werden.

Volker Frommelt Mitglied des Vorstandes / Kassier


Nigg Mitglied des Vorstandes
1
2
3
MEHR ALS NUR EIN SPIEL.
MBPI. In Liechtenstein. Für Liechtenstein.

Landstrasse 11, Postfach 130, 9495 Triesen Telefon + 423 399 75 00, info @ mbpi.li, www.mbpi.li
Auf den Tag genau vier Monate lang war der FC Vaduz in der Challenge League ungeschlagen. Am 24. September 2024 kassierte das Team von Trainer Marc Schneider bei Etoile Carouge eine 0:1-Pleite, dann folgten zehn Spiele ohne Niederlage. Am vergangenen Freitag ging diese stolze Serie zu Ende. Zum Rückrundenauftakt verloren die Vaduzer beim Spitzenreiter FC Thun mit 1:3.
Text: Christoph Kindle
«Kein Beinbruch, es war eine ansprechende Leistung unserer Mannschaft, beim Leader darf man auch mal verlieren», sagte FCV-Sportchef Franz Burgmeier nach dem Auftritt in der Stockhorn-Arena. In den beiden nun folgenden Heimspielen gegen Stade Nyonnais und Wil kann der FC Vaduz die Auftaktpleite korrigieren.
Verdienter Erfolg des Gruppenfavoriten
Nach dem starken Verlauf der zweiten Hälfte der Herbstsaison hatte sich der FC Vaduz eine vielversprechende Ausgangslage für die Rückrunde geschaffen. Dementsprechend motiviert traten der Trainerstaff und die Mannschaft Anfang Januar die Vorbereitung an. Auf ein Trainingslager im Süden wurde verzichtet. In den heimischen Gefilden rund ums Rheinparkstadion fand man gute Bedingungen vor. Die letzten beiden Testspiele eine Woche vor dem Rückrundenstart gewannen die Vaduzer gegen Austria Lustenau (5:1) und gegen Brühl (1:0). So traten sie die Reise ins Berner Oberland mit Zuversicht an. Der FCV wollte die positive Serie beim Leader fortsetzen. Die Statistik sprach allerdings gegen einen Vaduzer Erfolg. In der Stockhorn Arena war in den letzten Jahren meistens nichts zu holen.
Auch diesmal kehrten die Vaduzer mit leeren Händen nach Hause zurück. Ein Doppelpack von Reichmuth kurz vor und kurz nach der Pause brachte Thun in eine komfortable Lage. Der Anschlusstreffer von FCV-Neuzugang Kaio Eduardo liess kurzzeitig nochmals Hoffnung aufkeimen, doch der Ex-Vaduzer Rastoder sorgte mit dem dritten Treffer für die Entscheidung zugunsten des überlegenen Leaders.

Winter-Neuzugang Kaio Eduardo im ersten Rückrundenspiel der Meisterschaft in Thun
FCV verstärkt sich mit zwei jungen Leihspielern
Der FC Vaduz ist in der Winterpause nochmals auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Der 19-jährige Brasilianer Kaio Eduardo, der in Thun seinen ersten Treffer im Vaduzer Dress erzielt hat, kommt leihweise vom FC Basel in die Liechtensteiner Residenz. Der Offensivspieler unterzeichnete einen Vertrag bis Ende der Saison. «Kaio ist ein sehr interessanter und talentierter Spieler. Mit seinem Speed und seiner Physis wird er sicherlich eine spannende Option für unser Offensivspiel sein», sagte FCV-Sportchef Franz Burgmeier. Eine weitere Basler Leihgabe ist der 18-jährige Adriano Onyegbule. Der gebürtige Würzburger und ehemalige U17-Nationalspieler Deutschlands durchlief die Ausbildungsstufen bei Hertha BSC sowie bei RB Leipzig. Im Sommer 2022 schaffte er dann den Sprung von der U17-Nachwuchsmannschaft aus Leipzig zum FC Basel und unterzeichnete seinen ersten Profivertrag. Nach zwei Jahren beim FCB und insgesamt vier Spielen für die erste Mannschaft wurde er im vergangenen Sommer in die Challenge League zum FC Schaffhausen vergeliehen. Für die Munotstädter stand er in der abgelaufenen Vorrunde während zwölf Pflichtspielen auf dem Platz.
Jetzt folgen zwei Heimspiele
Auf den FC Vaduz warten jetzt zwei Heimspiele in Folge. An diesem Samstag (18 Uhr) ist der Tabellenvorletzte Stade Nyonnais zu Gast im Rheinparkstadion. Am Sonntag, 9. Februar um 14.15 Uhr, steht dann das Ostderby gegen den FC Wil auf dem Programm. Der FC Vaduz will in diesen Partien gleich wieder auf die Siegerstrasse zurückkehren. Aktuell liegt das Team von Trainer Marc Schneider auf Tabellenrang



vier, der Abstand zum für die Teilnahme an der Barrage berechtigenden zweiten Platz beträgt nur vier Punkte. Dieses Ziel scheint für die Vaduzer durchaus realistisch zu sein. Die nächsten Spiele werden im
Übrigen auch zeigen, ob die Neuzugänge tatsächlich die erhofften Verstärkungen im Offensivbereich sind. Der Auftritt in Thun mit dem Treffer von Kaio Eduardo war jedenfalls bereits verheissungsvoll.





Der FC USV stärkt seine Marke und festigt die lokale Verbundenheit. Als Spieler der ersten Mannschaft leben Livio Meier und Willi Pizzi diese Werte. Auf und neben dem Platz sind sie als Botschafter und Vorbilder für den FC USV von zentraler Bedeutung. Im Rahmen ihrer neuen Botschafterrolle stellten sie sich gerne den Interviewfragen.
Interview: Philipp Meier
Was hat dich dazu motiviert, Botschafter für den FC USV zu werden?
Livio Meier: Ich komme aus Mauren und habe beim USV mit dem Fussballspielen begonnen. Mittlerweile spiele ich seit fast sieben Jahren für die erste Mannschaft und habe viele prägende Momente erlebt. Als Botschafter kann ich dem Verein etwas zurückgeben und dazu beitragen, unsere Werte und unsere Leidenschaft für den Fussball nach aussen zu tragen.
Willi Pizzi: Als der Verein mich darauf angesprochen hat, war ich sehr glücklich darüber. Ich schätze es sehr, dass der Verein mir diese verantwortungsvolle Rolle zutraut, und für mich ist es eine Ehre, den Verein zu repräsentieren. Mein Ziel ist es, das Vertrauen und die Wertschätzung des Vereins auf und neben dem Platz zu rechtfertigen. Für mich persönlich ist es ein nächster Schritt und eine Entwicklung in meiner Fussballkarriere.
Welche Werte oder Prinzipien sind dir als Sportler am wichtigsten?
Livio: Teamgeist, Leidenschaft und Durchhaltevermögen sind für mich persönlich die wichtigsten Werte beim Fussball.
Willi: Ich setze sehr auf den Willen zur Entwicklung, Disziplin, Einstellung, Engagement und Leidenschaft. Diese Werte gelten für mich aber auch im Privatleben.
Wer oder was hat dich in deiner fussballerischen Karriere am stärksten geprägt?
Livio: Rückschläge haben mir gezeigt, wie wichtig es ist, nie aufzugeben. Auch meine Zeit in der Juniorenabteilung des FC St. Gallen hat mich beeinflusst, weil ich dort oft auf mich allein gestellt war. Zusätzlich waren die Erfahrungen mit der Liechtensteiner Nationalmannschaft sehr wertvoll.
Willi: Meine Fussballerfahrungen im Ausland, vor allem im jungen Alter. Diese haben mir einiges auf meinem Weg mitgegeben. Zusätzlich auch die letzten zehn Jahren, da ich viel Geduld haben musste, leiden musste und nie die Einstellung, Disziplin und Motivation verlieren durfte. Alles für den Traum, in der Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Was Personen betrifft, sind es meine Eltern.
Auf welchem Tabellenplatz siehst du den FC USV am Ende der Saison?
Livio: Ich denke, dass ein einstelliger Tabellenplatz in der aktuellen Situation ein realistisches und gutes Ziel ist. Wenn wir uns weiterentwickeln, gut arbeiten und als Mannschaft zusammenstehen, bin ich zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt frühzeitig schaffen.
Willi: Ich glaube sehr an uns und daran, dass wir in der Lage sind, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Dafür werden wir alles tun und jeden Tag hart arbeiten.
Wie motivierst du dich, wenn es sportlich einmal nicht so rund läuft?
Livio: Ich versuche, geduldig zu bleiben und eine positive Einstellung beizubehalten. Schliesslich bieten schwierige Situationen auch eine Chance, aus ihnen zu lernen und stärker zurückzukommen.
Willi: Ich konnte diverse Situationen erleben, und mit der Zeit hatte ich das Glück, zu begreifen, dass man an den eigenen Plan und Prozess glauben muss und sich nicht von äusserlichen Faktoren ablenken lassen darf. Ich schaue immer meine Eltern an, und dann wird mir schnell klar, wieso ich die Pflicht habe, um mein Bestes zu geben.


Der FC USV Eschen-Mauren hat in der Winterpause den Trainer gewechselt. Was war der Grund für diesen Schritt?
Thomas Kugler: Wir haben uns im gegenseitigen Einvernehmen getrennt, nachdem wir in diversen Fragen unterschiedlicher Auffassung waren. An dieser Stelle bedanke ich mich bei Alttrainer Heris Stefanachi für seine geleisteten Dienste. Wir wollen nicht mehr zurückschauen, sondern nach vorne.
Wie schaut es mit den Spieler- und Trainer-Mutationen aus? Wer kommt, wer geht? Und sind die Transfers schon abgeschlossen?
Trainer und Staff um den neuen Cheftrainer Michele Poverino sind komplett. Ich denke, da sind wir gut aufgestellt. Mit der Verpflichtung von Gianfranco Manco und Alessandro Corvaglia als Co-Trainer haben wir zwei Assistenten geholt, die sehr gut zu uns passen. Uns war es wichtig, dass wir unser Trainerteam mit Personen aus dem direkten Umfeld des Vereins besetzen. Das schafft Nähe, Vertrauen und stärkt die Identifikation mit dem Verein.
Die neuen Spieler Leon Schulte, Erolind Sylaj, Felipe Becegate de Mella und Decio Ferreira da
Silva Neto haben die Abgänge von David Weber, Alen Coric und Nicola Vasic gut ersetzt. Zudem laufen noch Gespräche mit weiteren Spielern.
Wie sind die Zielsetzungen des Vereins für die 1.Liga-Mannschaft in der laufenden Saison?
Wir wollen so schnell wie möglich die Marke von 34 Punkten erreichen, damit es gegen Ende der Saison nicht mehr hektisch wird. Ich rechne damit, dass 34 Punkte zum Klassenerhalt reichen. Ideal wäre ein einstelliger Tabellenrang, der durchaus machbar ist.
Was strebt der Verein mit der 2. Mannschaft in der 4. Liga an?
Nach dem Abstieg aus der 3. Liga ist die neu formierte Mannschaft nur vier Punkte hinter dem Tabellenführer klassiert. Unser Ziel mit dem «Zwei» ist es, eine gut funktionierende Mannschaft aufzubauen, die genügend Spieler im Training und an den Spielen hat und die auch Spass hat, für den USV zu spielen. Dazu sind wir mit dem Trainerteam von Michi Marxer auf gutem Weg. Ein sofortiger Wiederaufstieg ist aktuell immer noch möglich, aber es ist auch in der 4. Liga nicht so einfach. Und
Druck aufs Team bringt sowieso nichts. So wie es aktuell mit der 2. Mannschaft bestellt ist, können wir durchaus zufrieden sein.
1. LIGA - GRUPPE 3
FC Kreuzlingen 16 34:18 36 2. FC Tuggen 16 39:30 28 3. FC Wettswil-Bonstetten 16 24:14 27 4. SC YF Juventus 15 31:19 26 5. FC Winterthur U-21 15 32:22 26 6. AC Taverne 15 17:23 25 7. FC St. Gallen 1879 U-21 15 28:18 24 8. SV Schaffhausen 15 25:27 21 9. FC Kosova 16 14:18 19
10. FC Freienbach 16 23:29 19
11. USV Eschen/Mauren 16 21:24 18
12. SV Höngg 15 15:18 17
13. FC Collina d'Oro 15 11:16 17
14. FC Linth 04 16 23:36 15
15. FC Mendrisio 16 12:22 12
16. FC Uzwil 15 20:35 11

Empfang des argentinischen Influencers Valentín Scarsini, genannt «El Scarso», durch die Vertreter des FC Balzers, Vereinspräsident Fredy Scherrer (links), Valentín Scarsini (Mitte) und FCB-Marketingleiter Sandro Wolfinger.
Der FC Balzers ist seit Silvester 2024 im internationalen Fussballgeschehen weltweit bekannt geworden. Ursache für diesen Hype ist der argentinische Social-Media-Star Valentín Scarsini, bekannt als «El Scarso», der mittels Künstlicher Intelligenz nach dem Klub mit den wenigstens Fans weltweit gesucht hatte. Die Verantwortlichen des FC Balzers haben den argentinischen Social-Media-Star nach Balzers eingeladen, und «El Scarso» ist dieser Einladung gerne gefolgt. Wir wollten mehr wissen und haben uns mit dem Marketingleiter des FC Balzers, Sandro Wolfinger, in Verbindung gesetzt.
Interview: Herbert Oehri
Sandro, wie kam die Verbindung mit dem argentinischen Social-Media-Influencer «El Scarso» zustande?
Sandro Wolfinger: Erst einmal durch reinen Zufall. Die Künstliche Intelligenz spuckte unter anderen Vereinen auch den FC Balzers aus, als der Influencer auf der Suche nach dem
Fussballverein mit den wenigsten Fans weltweit war. Dann waren es, so hat es mir Valentín verraten, die kleine, hübsche Tribüne, der perfekte Standort sowie der Klang des Namens, die ihn überzeugten, dass der FC Balzers die Herzen vieler Fans erobern könnte. Und so war es dann auch.
Wie hat der FC Balzers reagiert, als er vom
viralen Hype rund um den Verein gelesen hat?
Ich persönlich war zu diesem Zeitpunkt gerade im Urlaub und habe das Ganze in den ersten beiden Tagen mit einem Lächeln aus der Distanz beobachtet. Zurück in Liechtenstein, habe ich dann die Dimensionen dieses Hypes umrissen und um Silvester


Das Interesse an diesem wohl einmaligen Skyp war dermassen gross, dass der FC Balzers eine Medienkonferenz abgehalten hat.
Links der argentinische Medienstar, der einige Tage in Balzers geblieben ist, rechts Marketingleiter Sandro Wolfinger.
und Neujahr erste Massnahmen in die Wege geleitet. Das Lächeln im Gesicht habe ich nie verloren, da der Hype von einer enormen Positivität geprägt ist. Ich habe bis zum heutigen Tag keinen einzigen negativen Kommentar und keine einzige negative Nachricht erhalten.
Der FC Balzers hat innert kürzester Zeit mehr als 400’000 Instagram-Follower gewonnen. Wie geht es nun weiter?
Summiert mit der Anzahl Follower auf Facebook und unserem neuen TikTok-Kanal erreichen wir aktuell sogar über 600'000 Menschen. Wie es auf Social Media weiter geht, steht in den Sternen. Wir haben einmal mehr gesehen, wie unvorhersehbar und schnelllebig das Internet sein kann. Auf allen anderen Ebenen unseres Vereinslebens hat sich indes nichts geändert. Wir sind nach wie vor der Dorfverein FC Balzers, der mit Menschen und Partnern aus Balzers und der Region zusammenarbeiten möchte.
Wie steht es mit der Handhabung dieses Hypes und wie geht der FCB mit seinem neuen Bekanntheitsgrad um?
Ich denke, hierbei ist es wichtig, zwischen Menschen und Social Media-Profilen zu unterscheiden. Ein derartiger Online-Hype basiert auf einer grundsätzlich oberflächlichen Begeisterung ohne fundierten Hintergrund und ist in der Regel ein eher kurzzeitiger Trend. Zudem
ist uns bewusst, dass die grosse Mehrheit dieser Followers aus Lateinamerika kommt und kein direkter Bezug besteht. Trotzdem möchten wir den Hype im Rahmen unserer Möglichkeiten weiterhin positiv gestalten und geniessen. Wir erreichen auf Knopfdruck über eine halbe Million Menschen und haben es mit diversen Aktionen und kreativen Inhalten unsererseits mittler weile geschafft, den Hype nach Europa überschwappen zu lassen. Dies öffnet uns hochspannende Möglichkeiten mit Fussballvereinen, anderen Sportorganisationen, Marken, Unternehmen und Partnern.
Auch Printmedien sind auf den viralen Hit rund um Balzers eingegangen. Nimmt das Interesse zu oder ist eher das Gegenteil der Fall?
Das Interesse ist derzeit gleichbleibend hoch. Allerdings ist auffällig, wie es sich von Lateinamerika nach Europa, insbesondere in den deutschsprachigen Raum, und von den sozialen Medien hin zu den klassischen Medien bewegt. An unserer Pressekon ferenz vom 10. Januar haben wir fast 20 Medienvertreter aus Liechtenstein und der Schweiz begrüsst und Medienanfragen sowie Kollaborationsanfragen aus ganz Europa erreichen uns fast täglich.
Der FC Balzers hat den argentinischen Medienstar nach Balzers eingeladen. Kannst du uns über seinen Besuch Genaueres erzählen?
Auf Initiative des FC Balzers und mit Unterstützung von Liechtenstein Marketing sowie des Hotels Schatzmann in Triesen stand Valentín Scarsini gut eine Woche nach seinem ersten Video über den FC Balzers auf liechtensteinischem Boden. Wir haben ihm die Sehenswürdigkeiten unseres schönen Landes und den FC Balzers von seiner besten Seite präsentiert und ihn in die Pressekonferenz sowie in ein öffentliches Training mit der ersten Mannschaft integriert. Ausserdem haben wir diverse Ausflüge mit ihm gemacht, unter anderem auf dessen Einladung zum FC Basel.
Was ist für dich die wichtigste Erkenntnis aus dieser wohl einmaligen Verbindung mit dem 20-jährigen Argentinier?
Einerseits sicherlich, dass Social Media losgelöst von der realen Welt zu betrachten ist und man wegen eines Hypes nicht plötzlich grössenwahnsinnig werden sollte. Wir vom FC Balzers wissen nach wie vor, wo wir herkommen. Auf der anderen Seite haben wir eine einmalige Gelegenheit genutzt, den Fussballclub Balzers, die Gemeinde Balzers und unser Land für einen Moment auf der grossen, globalen Bühne in ein positives Licht zu stellen. Wir haben Massen begeistert, für positive Schlagzeilen gesorgt, wertvolle Kontakte geknüpft, unsere Wahrnehmung vervielfacht und wunderschöne Erfahrungen gesammelt.
«Wir
Vor 29 Jahren wurde in Nendeln die gemeinnützige Stiftung «Musik und Jugend» gegründet.
Diese hatte es sich, wie es der Name bereits vermuten lässt, zum Ziel gesetzt, junge musikalische Talente zu fördern. Die Ziele blieben dieselben, als 2010 die «Musikakademie in Liechtenstein» gegründet wurde. Heute ist sie eine der führenden musikalischen Talentschmieden in Europa.
Text: Christian Imhof

Das Ziel der Musikakademie ist einfach zusammengefasst: Sie will eine exzellente Ausbildung für junge Menschen anbieten. Eine Ausbildung, die mit ihrer Angebotsqualität und Breite nirgends im gleichen Stil zu finden ist. «Unser Alleinstellungsmerkmal ist die Exzellenz. Und wir verbinden diese mit dem ausschliesslichen Ziel, die uns anvertrauten Musikerinnen und Musiker bestmöglich zu fördern.» So steht es auf der Website. Dabei stehe die musikalische Bildung im Zentrum. Die Qualität des instrumentalen Unterrichts sei auf einem herausragenden Niveau, genau wie die Auswahl der Professorinnen und Professoren und der Studierenden.
Vielseitige Ausbildung
Erfolg auf dem Markt statt eines Diploms
Ein wichtiger Erfolgsfaktor sei, dass an der Musikakademie nicht nur
Auch wenn mit Einzelunterricht und dem Musizieren in Kleingruppen die musikalische Ausdrucksform der jungen Talente perfektioniert wird, können die Jugendlichen zusätzlich den Ernstfall erleben. Es besteht die Möglichkeit, sich in Orchestern und Ensembles auszuprobieren, professionell auf Wettbewerbe vorzubereiten und erste Erfahrungen in Entrepreneurship zu sammeln. Zudem erhalten sie die Gelegenheit, mit ihren Vorbildern zu musizieren und von deren Berufserfahrungen zu profitieren. Dass die Welt der Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker heute besondere Herausforderungen bereithält, weiss auch die Musikakademie. Aus diesem Grund setzt die international anerkannte Institution bewusst auf ein gesamtheitliches Lernangebot. Dabei lernen die Studierenden auch, sich zu präsentieren, mit Finanzen umzugehen, auf ihren Körper und ihre Gesundheit zu achten und Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Kurz: Sie werden umfassend auf ihre spätere Laufbahn als Musikerinnen und Musiker vorbereitet. Die Auswahl der Teilnehmenden für das Programm sei eine grosse Aufgabe, sagt Drazen Domjanić, Geschäftsleiter der Internationalen Musikakademie. «Der Bewerbungsprozess umfasst das Einreichen von Videos, Empfehlungsschreiben und vielem mehr.» Einheimische werden laut ihm in Nendeln bevorzugt behandelt. «Schliesslich prüfen wir in Liechtenstein, ob es in der Region jemanden gibt, der die Voraussetzungen erfüllt – solche Personen haben Priorität.» Die Zahl der Studierenden belaufe sich auf jährlich rund 120 musikalische Hoffnungsträger. «Wöchentlich nehmen wir etwa sechs Studierende auf, wobei einige mehrmals im Jahr kommen. Alle Teilnehmenden haben nach unserer Einschätzung reelle Chancen, auf dem Musikmarkt erfolgreich zu sein, und sie kommen aus rund 40 verschiedenen Ländern.» Dass das Angebot der Musikakademie einen Nerv trifft, zeigt die grosse Nachfrage. Domjanić erklärt, dass jährlich um die 1000 Anfragen ins Haus flattern. «Bisher war unsere Auswahl ausgezeichnet, und die Akademie kann auf eine beeindruckende Zahl von Alumni verweisen, die heute erfolgreiche Karrieren haben.»
Jugendliche, sondern auch Kinder schon ihre musikalischen Skills erweitern können, sagt Drazen Domjanić. «Da wir die Teilnehmenden bereits ab ihrem 10. Lebensjahr auswählen, können wir sie über einen längeren Zeitraum begleiten und ihnen alles bieten, was sie benötigen, um erfolgreich zu sein. Neben dem Instrumentalunterricht unterstützen wir sie umfassend, damit sie ihre Ziele erreichen können.» Weder Bachelor- noch Masterdiplome würden an der Musikakademie ausgestellt. Das sei die Aufgabe von Universitäten. Wenn Schülerinnen und Schüler an der Akademie an der Intensivwoche teilgenommen hätten, gebe es neben einem reichen Erfahrungsschatz auch noch ein Zertifikat. Dieses sei ein wichtiger erster Schritt in Richtung Profibereich. Domjanić, am Campus bei der Hofstätte Hagenhaus jährlich um die 150 Veranstaltungen auf die Beine stellt , weiss genau, wo die Stärken der Institution liegen. «Unser Ziel ist es, die Besten aus der ganzen Welt zusammenzubringen und sie auf ihre Berufung nach dem Studium vorzubereiten. Für diesen Weg ist kein Diplom erforderlich, sondern Erfolg auf dem Markt – etwas, das niemand und kein Diplom im Voraus garantieren kann.» Die unzähligen Erfolge sprechen für sich. Es erfülle ihn mit Stolz, wenn er sehe, dass das frühe Unterstützen Früchte trage. «Von Gewinnern der grössten Wettbewerbe der Welt über Professuren an führenden Hochschulen bis hin zu Konzertmeisterinnen und Konzertmeistern sowie Mitgliedern der bedeutendsten Orchester weltweit.» Wenn man alle aufzählen würde, bräuchte es schnell mal 50 Seiten voller Interviews, wie er lachend anfügt.
Pionierrolle im ganzheitlichen Denken
In mehreren Dokumentarfilmen wurde in den vergangenen Jahren darauf hingewiesen, wie hart und aufreibend für zarte Gemüter das Geschäft mit der klassischen Musik ist. Beim Schauen dieser Filme bleibt ein fader Beigeschmack hängen, und es ist gut möglich, dass so mancher Elternteil danach eher versucht, den Nachwuchs für Sport zu begeistern. Die mentale Gesundheit sei heute wichtiger denn je, weiss auch Domjanić. Niemand wolle in der Branche, dass der Nachwuchs die Freude an der Musik verliert. «Das ist für uns von entscheidender Bedeutung, und deshalb haben wir zwei Module, die wir jede Woche beziehungsweise einmal jährlich wiederholen.» Eines davon sei «Music & Performance», bei dem in
jeder Intensivwoche Themen wie beispielsweise «Exzellenz oder Scheitern – was ist der Unterschied?» durch Vorträge und individuelle Beratungen behandelt werden. Das zweite Modul sei dann ein Symposium, in dem alle wichtigen Themen für Musikerinnen und Musiker abdeckt werden, die nichts mit dem Spielen eines Instruments zu tun haben. «Dazu gehören mentale Gesundheit, ökonomische Werte, Karriereplanung, ein gesunder Lebensstil und alles, was damit verbunden ist.» Somit übernimmt die Musikakademie in Nendeln eine Pionierrolle, denn sie gehört zu den Ersten weltweit, die diese Themen aufgreifen und sie mit den bestmöglichen Expertinnen und Experten behandeln. So seien die Musikerinnen und Musiker optimal gerüstet, um in der heutigen schnelllebigen Zeit als Profi durchzustarten.
An sich selbst glauben
Die Branche verlange viel, sagt Domjanić. «Exzellentes Instrumentalspiel ist nur eine von vielen Komponenten, die junge Musikerinnen und Musiker heutzutage benötigen, wenn sie das Musizieren zu ihrer Lebensberufung machen möchten.» Diejenigen, die das verstehen, hätten grosse Chancen – wie beispielsweise Julia Hagen, Moritz Huemer, Kian Soltani, Sara Domjanić, Timothy Ridout und einige andere junge Talente, die auf ihrem bisherigen Weg gezeigt hätten, was alles möglich ist. «Es ist entscheidend, alle Komponenten zu berücksichtigen und eine ganzheitliche Denkweise zu fördern, denn dies ist wichtiger als nur das Spielen oder die Pflege des eigenen Egos.» Einige gute Tipps hat der Musikförderer Drazen Domjanić für jede und jeden bereit, der einmal mit Musik den Lebensunterhalt bestreiten möchte. «Sie müssen an sich selbst glauben, täglich sowohl Geld als auch Zeit in sich investieren und gut zwischen wohlwollenden Ratschlägen und solchen unterscheiden, die – vor allem in jungen Jahren – oft mit weniger guten Absichten erteilt werden.» Dabei sei es wichtig, auf das eigene Herz zu hören und für sich selbst statt für die grossen Ambitionen der Eltern an sich zu arbeiten. «Selbstvertrauen, höchste Qualität im Sinne von ‹Das Beste ist gerade gut genug› und ein langer Atem sind entscheidend.» Weitere Informationen zur Internationalen Musikakademie in Liechtenstein sowie zum Hagenhaus und zum Ensemble Esperanza finden sich im Internet unter www.musikakademie.li.

Hagenhaus LIe-Zeit 206x265 Feb-Mar_Layout 1 18/01/2025 13:40 Page 1
4. Feb
Kammermusikkonzert Klaviertrios freier Eintritt/Kollekte 19 Uhr
5. Feb
Residenzkonzert
Klasse von Prof. Pavel Gililov, Klavier freier Eintritt/Kollekte 19 Uhr
11. Feb
Kammermusikkonzert Klaviertrios freier Eintritt/Kollekte 19 Uhr
12. Feb
Residenzkonzert
Klasse von Prof. Claudio Martinez Mehner, Klavier freier Eintritt/Kollekte 19 Uhr

13. Feb
Donnerstag im Hagenhaus JAZZ
Frank Dupree Trio mit Simon Höfele, Trompete 45 CHF inkl. Getränk 19 Uhr
18. Feb
Kammermusikkonzert Klavierquintette freier Eintritt/Kollekte 19 Uhr
19. Feb
Residenzkonzert
Klasse von Prof. Dr. Milana Chernyavska, Klavier freier Eintritt/Kollekte 19 Uhr

20. Feb
Donnerstag im Hagenhaus Holz und Blech
Asya Fateyeva, Saxophon und Severin von Eckardstein, Klavier 65 CHF inkl. Getränk 19 Uhr
25. Feb
Kammermusikkonzert Streichquintette freier Eintritt/Kollekte 19 Uhr
26. Feb
Residenzkonzert


Klasse von Prof. Jens Peter Maintz, Violoncello freier Eintritt/Kollekte 19 Uhr
27. Feb
Donnerstag im Hagenhaus JAZZ
Marius Preda und Ratko Zjaca Evolution Trio 45 CHF inkl. Getränk 19 Uhr
4. Mär
Kammermusikkonzert Klavierquartette freier Eintritt/Kollekte 19 Uhr
5. Mär
Residenzkonzert Violine
Klasse von Prof. Tobias Feldmann freier Eintritt/Kollekte 19 Uhr
6. Mär
Donnerstag im Hagenhaus Tanzabend
Schlagzeuger Radu Buzac mit der Band Rowsekit 30 CHF19 Uhr
Erleben Sie erstklassige Veranstaltungen mit der Weltelite der Musik im exklusiven Ambiente des Peter Kaiser Konzertsaals im Hagenhaus in Nendeln. Tickets und/oder obligatorische Reservierung unter: T +423 262 63 52 oder hagenhaus@ticketing.li • Max. 100 Plätze bei freier Platzwahl • Feldkircherstrasse 18, FL-9485 Nendeln

Ziehung der Lotterie im Engländerbau, Mitte: Regierungssekretär Ferdinand Nigg und Polizist Strub; 1933, SgAV 17/001/104/002; Quelle: Liechtensteinisches Landesarchiv Vaduz
Nach dem Ersten Weltkrieg kämpfte Liechtenstein mit finanziellen Problemen. In der Not verlegte sich das Land darauf, mit zweifelhaften Unternehmungen möglichst rasch zu Geld zu kommen. Die gescheiterten Versuche mit der Klassenlotterie und dem Mutual-Club verursachten materiellen Schaden, aber auch eine Schädigung für das Ansehen des Landes.
Text: Günther Meier

Eigentlich hätte die Regierung gewarnt sein können, die Finger von Unternehmungen zu lassen, die ohne viel Arbeit grosse Gewinne versprachen. Lediglich ein paar Jahre vorher hatte ein Briefmarkenkonsortium die seriösen Geschäfte mit Postwertzeichen in den Keller gefahren. Trotzdem erteilte die Regierung im Jahr 1925 die Bewilligung für eine Klassenlotterie und ein Lotterieunternehmen für englische Pferderennen. Der Schaden liess nicht lange auf sich warten: Schon ein Jahr nach der Bewilligung zog die Regierung die Reissleine für die Klassenlotterie. Auf Druck der Schweiz musste 1934 auch der Mutual-Club im Engländerbau geschlossen werden.
Englische Lotterie zieht aus der Schweiz nach Liechtenstein
Landtagspräsident Wilhelm Beck reichte Anfang Februar 1925, also vor ziemlich genau 100 Jahren, ein Gesuch bei der Regierung ein. Bei der nach zusätzlichen Staatseinnahmen suchenden Exekutive stiess der Antrag auf grosse Zustimmung. Schon am 21. Februar
1925 erteilte die Regierung die «Konzession zum Betrieb von Geldlotterien auf englischen Sportveranstaltungen». Es ging vor allem um Wetten bei Pferderennen. Das Unternehmen unter dem Namen J. R. Duggan Ltd. war vorher im Kanton Uri in der Schweiz tätig gewesen, konnte aber aufgrund des Lotteriegesetzes von 1923 seine Tätigkeit nicht weiter ausüben. Obwohl Lotterien in vielen Ländern verboten waren, lief das Lotteriegeschäft in Liechtenstein gleich zu Beginn erfreulich. Lose für die erste Ziehung, die am 25. Mai 1925 stattfand, waren aus Südafrika, den USA, Burma, Indien, Frankreich, Irak, Kanada, Irland, Belgien, Holland, Jamaika, Malta, Griechenland und den Bermudas eingetroffen. Für Liechtenstein lohnte sich die Lotterie: Die Landeskasse erhielt Steuereinnahmen von rund 100'000 Franken, und das Unternehmen beschäftigte schon im ersten Jahr etwas über 50 Personen. Kein Wunder, dass die Konzession unter dem neuen Namen «Mutual-Club» bis 1930 verlängert wurde.
Auf die englischen Pferdewetten folgte eine Klassenlotterie
Praktisch parallel zum «Mutual-Club» reichten einige risikofreudige Unternehmer aus der Schweiz und Liechtenstein bei der Regierung ebenfalls ein Gesuch zum Betreiben einer Klassenlotterie ein. Die Regierung handelte auch bei diesem Antrag speditiv, weil befürchtet wurde, die Gesellschaft könnte in ein anderes Land ziehen. Obwohl nicht alle Details geklärt waren, erhielt die Gruppierung um die Schweizer Bank Sautier und die liechtensteinische «Vertriebsunion Triesenberg» die Berechtigung für eine Lotterie – vorerst für einen Zeitraum von sieben Jahren. Bei der Klassenlotterie handelte es sich um ein Glücksspiel, das in verschiedene Spielabschnitte – die sogenannten Klassen – aufgeteilt war. Die höchsten Gewinne konnten die Spieler dabei in der obersten Klasse erzielen.
Allerdings stand das Unternehmen unter einem schlechten Stern. Probleme ergaben sich bereits beim Versand des Werbematerials, denn ausländische Postanstalten verweigerten die Weiterbeförderung, sobald der Zusammenhang mit einer Lotterie ersichtlich wurde. Die Klassenlotterie versuchte dieses Problem mit dem Versand des Werbematerials über Deckadressen in der Schweiz zu umgehen, was Konflikte mit der Schweiz provozierte. Eine erste Ziehung der Klassenlotterie konnte noch 1925
durchgeführt werden, obwohl aufgrund des Boykotts der Postanstalten der Rückfluss von Spielergeldern erheblich geringer als erwartet ausfiel. Im Januar 1926 gab es nochmals eine Ziehung, dann war die Klassenlotterie bereits am Ende, das notwendige Geld für die Auszahlung der Gewinner fehlte. Die Regierung verfügte die Schliessung der Lotterie und leitete ein Gerichtsverfahren gegen die Gesellschaft ein.
Aus dem Desaster zog die Regierung jedoch nicht die richtigen Schlussfolgerungen. Aus den Gemeinden, in denen die Klassenlotterie rund 200 Personen beschäftigte, vor allem Frauen, gelangten Eingaben an die Regierung, die eine Fortsetzung verlangten. Die Regierung, auf der Suche nach attraktiven Einnahmen für die Staatskasse, beugte sich dem Druck und erteilte nur zwei Wochen später eine neue Konzession an eine amerikanische Firma. Auch die neuen Betreiber hielten aber nicht lange durch. Nach fünf Ziehungen war Schluss, kein Geld mehr zur Auszahlung vorhanden. Die Regierung entzog dem Unternehmen am 17. November 1926 die Konzession. Den Schaden konnte sie dadurch etwas in Grenzen halten, weil sie sich die von der Gesellschaft bei der Konzessionierung hinterlegte Kaution von 100'000 Franken sicherte, obwohl das Unternehmen die Herausgabe dieser Summe verlangte.
Die unseriöse Geschäftsführung der Klassenlotterie stand indirekt auch in einem Zusammenhang mit dem Sparkassen-Skandal, der 1928 beinahe zum Ruin der Liechtensteinischen Landesbank geführt hatte. Denn die Klassenlotterie wurde nach Rumänien ausgedehnt, das dafür notwendige Geld von der Landesbank durch Betrügereien beschafft. Letztlich resultierte aus der riskanten Geschäftserweiterung ein Verlust von 1,8 Millionen Franken, was mehr als dem damaligen Jahresbudget des Landes entsprach.
Die Schweiz zwingt Liechtenstein, den Stecker zu ziehen
Auch der Mutual-Club bekam wie die Klassenlotterie den Boykott ausländischer Postanstalten für die Weiterleitung des Werbematerials zu spüren. Die Betreiber wichen deshalb auf die Schweiz aus, verschicken von Schweizer Poststellen das Werbematerial in alle Welt und liessen die Lotteriesendungen auch dahin schicken. Der Regierung wurden diese Ausweichmanöver mitgeteilt, die das Unternehmen

ermahnte, die Schweiz dürfe in keiner Weise vom Lotteriebetrieb tangiert werden. Auch das Eidgenössische Politische Departement verfolgte die Angelegenheit mit Argusaugen und stellte fest, Lotterieteilnehmer aus vielen Ländern seien weiterhin über Poststellen in den Postkreisen St. Gallen, Chur, Zürich und Basel beliefert worden. Der Bundesrat beschloss, um dem Treiben ein Ende zu setzen, dass das Schweizer Lotterieverbot über den Zollvertrag auch für Liechtenstein gelte. Alle Bemühungen, den Beschluss rückgängig zu machen, blieben erfolglos. Auf einen Antrag des Landtags, mit dem Bundesrat zu verhandeln, um die Lotterie im Land behalten zu können, kam es zu Gesprächen zwischen Regierung und Bundesrat – ohne Erfolg. Die Schweiz liess durchblicken, wenn Liechtenstein nicht einlenke, könnte der Zollvertrag gekündigt werden. Auf diesen Druck hin beschloss der Landtag am 28. Dezember 1933 die Übernahme des Schweizer Lotteriegesetzes, womit das «Lotterie-Zeitalter» beendet war.
Der Engländerbau stammt noch aus der Lotteriezeit
Der Engländerbau in Vaduz ist heute noch ein sichtbares Zeichen aus der ruinösen Lotterie-Zeit Liechtensteins. Die englische Lotteriegesellschaft Mutual Life Insurance Company, kurz Mutual-Club genannt, die von der Zukunft ihrer Geschäftstätigkeit überzeugt war, erteilte 1933 dem Architekten Erwin Hinderer aus Schaan den Auftrag für die Planung einer repräsentativen Niederlassung. Das Gebäude wird im Buch «Die Kunstdenkmäler des Fürstentums Liechtenstein» von Cornelia Hermann als spezielles Bauwerk im Zentrum von Vaduz beschrieben: «Das klar gegliederte dreigeschossige Gebäude unter flachem Walmdach ist ein Beispiel der frühen Moderne. Der lang gestreckte, ostseitig gestuft an den Schlossfelsen angelehnte Stahlskelettbau ist mit Backsteinmauerwerk ausgefacht und mit senkrecht gestellten Travertinplatten verkleidet. Der wohlproportionierte Bau zeichnet sich an der Westseite im Erdgeschoss durch eine Gliede-
rung mit Schaufenstern, an den beiden Obergeschossen mit regelmässiger Fensterreihung aus.»
Der Mutual-Club konnte den Lotteriegeschäften wegen der oben beschriebenen staatlich verfügten Auflösung 1934 nicht lange in diesem Gebäude nachgehen. Bis heute diente der Engländerbau, der im Volksmund nach den englischen Bauherren so genannt wird, ganz verschiedenen Verwendungszwecken. Die Philatelie Liechtenstein und Tourismus Liechtenstein waren im Gebäude, das vom Land 1944 gekauft worden ist, schon einquartiert. Ebenso konnten dort Exponate der Fürstlichen Sammlung und der Staatlichen Kunstsammlung bestaunt werden. Nicht vergessen werden darf der legendäre Goldene Wagen, der bis zu seiner Überstellung nach Wien im Erdgeschoss neugierige Blicke von Einheimischen wie Touristen anzog. Heute steht das Gebäude den Ausstellungen des «Kunstraums Engländerbau» zur Verfügung.
Liechtensteins Arbeiter schlossen sich 1920 zu einem Arbeiterverein zusammen und suchten sich für die Gründung des Verbandes mit Maria Lichtmess ein besonderes Datum aus. Schon wenige Wochen später folgten die Arbeiterinnen den männlichen Kollegen mit der Gründung des Arbeiterinnenvereins. An der Vereinsgründung am 14. März 1920 in Triesen nahmen etwa 50 Frauen teil.
Text: Günther Meier

Inspiriert von den Arbeiterbewegungen und Gewerkschaften im Ausland trafen sich rund 200 Arbeiter im Adler-Saal in Vaduz zur Gründung des Liechtensteinischen Arbeitervereins. Zum ersten Präsidenten wurde Friedrich Kaufmann aus Schaan gewählt. Die nach lebhafter Diskussion genehmigten Statuten sicherten jedem Arbeiter die Mitgliedschaft zu, egal ob in Liechtenstein oder in der Schweiz tätig. Die Gründung des Arbeitervereins erfolgte nicht nur zur Durchsetzung der Rechte der in Fabriken angestellten Arbeiter. Es ging auch um Wertehaltungen. Als Hauptaufgabe wurde in den Statuten festgelegt, «die Mitglieder auf eine möglichst moralisch hohe Stufe zu bringen und ihnen dauernd einen menschenwürdigen Anteil an den Errungenschaften der Kultur zu sichern». Zusätzlich wollte der Verein die wirtschaftlichen Interessen der Arbeiterschaft zur Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen gegenüber Unternehmern und Behörden vertreten. Vorgesehen war ebenso der Aufbau eines Rechtsschutzes, sofern die damit verbundenen Kosten vom Verein getragen werden könnten. Im Gegenzug hatten die Arbeiter einen Beitrag von

Feger Alfons, Balzers (geb. 09.10.1889, gest. 06.02.1938), Hofkaplan in Vaduz 1917–1934, Rektor in Wien 1935 –1938, B 712/010/001
Quelle: Liechtensteinisches Landesarchiv Vaduz
einer österreichischen Krone, der damals offiziellen Währung in Liechtenstein, pro Woche zu entrichten.
Konfrontation zwischen katholischer Kirche und Sozialismus
Die Gründung des Arbeiterverbandes fällt in die wirtschaftlich schwierige Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, der auch Liechtenstein betroffen hatte, obwohl sich das Land als neutral erklärt und von kriegerischen Handlungen verschont geblieben war. Die Wirtschaft, die vor dem Weltkrieg einen leichten Aufschwung erlebt hatte, litt unter Rohstoffmangel und hatte in den traditionellen Absatzgebieten grosse Probleme, die produzierten Waren zu verkaufen. Gegen Ende 1917 mussten die Spinnerei in Vaduz und die Weberei in Triesen ihre Tätigkeit einstellen. Zur gleichen Zeit schloss die Bierbrauerei Quaderer in Schaan ihre Produktionsstätte, weil der Nachschub von Gerste und Malz aus Österreich ausblieb. Die unsichere Beschäftigungslage dauerte nach dem Ersten Weltkrieg noch einige Zeit an, da der Import von Rohstoffen nicht gesichert war.
Den Anstoss für die Gründung des Arbeitervereins gaben nicht die Arbeiternehmer im Land, sondern Arbeiter, die in der Schweiz eine Stelle gefunden hatten und mit den Forderungen der Arbeiterschaft nach mehr Rechten und Einfluss vertraut waren. Im damals noch stark landwirtschaftlich geprägten Liechtenstein erhoben sich gleich Vorbehalte gegen Arbeitervereinigungen oder Gewerkschaften, weil man Einflüsse des Sozialismus oder gar Kommunismus befürchtete. Insbesondere die Pfarrherren ermahnten die Arbeiter, sich nicht den sozialdemokratischen Ideen auszuliefern. Wenn es eine Arbeiterorganisation geben sollte, dann dürfe sich diese keinesfalls an den Leitlinien einer sozialdemokratischen Gewerkschaft orientieren. In Liechtenstein müsse vielmehr eine christliche Arbeiterbewegung aufgebaut werden. Die Geistlichen stützten sich auf ein Rundschreiben der Schweizer Bischöfe, das in jeder Kirche von der Kanzel verlesen wurde. Dort hiess es: «Wer zum Sozialismus als System, zu seinen Grundanschauungen und Hauptzielen sich offen bekennt, oder wer offen für die sozialistische Sache kämpft und wirbt, entbehrt, solange er in dieser Gesinnung unbelehrbar verharren will und verharrt, derjenigen Vorbedingung, welche zum würdigen Empfang eines Sakramentes unerlässlich ist.» Unterstützung erhielt die Kirche von konser-
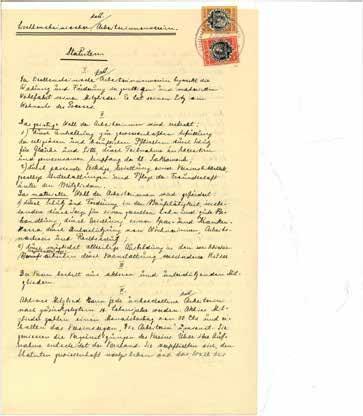

davor warnten, sich einer Schweizer Gewerkschaft anzuschliessen, denn dann müssten sie nach der Pfeife des «schweizerischen Bolschewikibundes» tanzen. Den liechtensteinischen Arbeitern wurde empfohlen, nicht den «roten Leithammeln» nachzulaufen, sondern den Ideen der «altbewährten Führerin, der katholischen Kirche» zu folgen.
Der Hofkaplan an der Spitze des Arbeiterinnenvereins
Auch bei der Gründung des Arbeiterinnenvereins hatte die Geistlichkeit ein wichtiges Wort mitgeredet. Die Initiative zu seiner Gründung ging von Hofkaplan Alfons Feger aus, der zur Informations- und Gründungsversammlung alle Fabrikarbeiterinnen, Heimarbeiterinnen und Dienstmädchen einlud. Die Arbeiterinnen genehmigten die Statuten, die in wesentlichen Teilen der Ausrichtung des wenige Wochen vorher gegründeten Arbeitervereins entsprachen: Schutz und Förderung der Frauen im Beruf, gerechter Lohn und gute Behandlung am Arbeitsplatz, Errichtung einer Spar- und Krankenkasse sowie Rechtsschutz. Zusätzlich versprach der neue Verein, sich für die Unterstützung der Wöchnerinnen einzusetzen. An die Spitze des Arbeiterinnenvereins wurde interessanterweise aber keine Arbeiterin gewählt. Den Vorsitz übernahm der Initiant, Hofkaplan Alfons Feger, in den Statuten «Präses» genannt.
Frauen als Arbeiterinnen, die in einer Fabrik oder einem gewerblichen Unternehmen einer Vollzeitbeschäftigung nachgingen, gab es 1920 nicht sehr viele. Prägend bis zum Ersten Weltkrieg war für die Wirtschaftsstruktur Liechtensteins die Landwirtschaft. Zur Zeit der Gründung des Arbeiterinnenvereins wurden rund 1300 Bauernhöfe gezählt, die überwiegend als Familienbetrieb organisiert waren, wie Claudia Heeb-Fleck im Buch «Inventur – zur Situation der Frauen in Liechtenstein» schreibt. Familienbetrieb bedeutete oft, dass die Frauen den Haushalt führten, die Kinder aufzogen und nebenher noch im Bauernbetrieb arbeiteten. Ihre Männer übten neben der Landwirtschaft noch ein Handwerk oder ein Gewerbe aus, andere gingen auch als Saisonarbeiter in die Schweiz. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts siedelten sich Textilbetriebe an, deren Belegschaft zum grösseren Teil aus Frauen bestand.


von Marina Thomann Geschäftsführerin
Zollstrasse 82, 9494 Schaan Tel +423 230 08 08 www.thomann-travel.li
Im Jahr 1912 wurden in diesen Unternehmen 470 Frauen und 207 Männer als Beschäftigte gezählt. Die Löhne seien tief gewesen und die Arbeitszeiten lang, schreibt Claudia HeebFleck, ebenso seien die Arbeitsbedingungen anstrengend und ungesund gewesen. Auf der anderen Seite ein positiver Aspekt: «Immerhin garantierte die Fabrik aber gesetzlich geregelte und behördlich kontrollierte Arbeitsverhältnisse und damit einen gewissen Schutz vor allzu grosser Ausbeutung. Die vor allem von jungen ledigen Frauen ausgeübte Fabrikarbeit stand in geringem Ansehen, die Bedeutung des Verdienstes, den die sogenannten Fabrikmädchen zu Hause ablieferten, kann jedoch kaum hoch genug eingeschätzt werden.»
Keine Angaben über die Wirkung des Arbeiterinnenvereins Zum Arbeiterinnenverein ist, ausser dem Pro-


tokoll und dem Bericht über die Gründungsversammlung, praktisch nichts überliefert. Möglicherweise hängt dies mit der Statutenänderung des Arbeitervereins zusammen, die kurz nach der Gründung des Arbeiterinnenvereins auch den weiblichen Erwerbstätigen die Möglichkeit bot, dem Arbeiterverein als Mitglied beizutreten. In der Jubiläumsbroschüre «75 Jahre Liechtensteiner Arbeitnehmerverband» äussert der Historiker Rupert Quaderer noch eine andere Vermutung: «Vermutlich war die Einflussmöglichkeit im Kampf um eine Besserstellung der Arbeiterinnen durch die sehr enge Bindung an kirchliche Organe eingegrenzt.» Ausserdem könnten sich nach seiner Einschätzung der Ausschluss der Frauen von politischen Entscheidungsmechanismen und die doppelte Belastung der Frauen in Erwerbstätigkeit und Haushalt nachteilig für die Durchsetzung ihrer Interessen ausgewirkt haben.

«Eine unvergessliche Safari Reise»

Und so macht ihr mit: E-Mail an vera.oehri@medienbuero.li Betreff: «Wettbewerb Reisetipp»
Einsendeschluss ist der 15. Februar 2025 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
