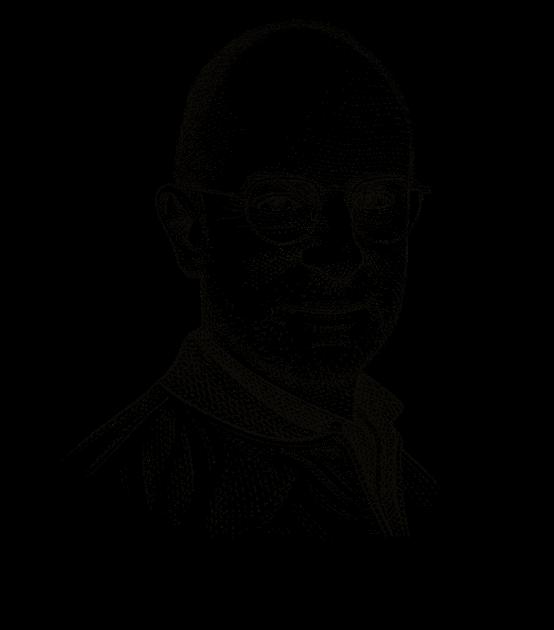3 minute read
Blumine
EINE LIEBESEPISODE
VON RAINER LEPUSCHITZ Gustav Mahler war in seinen zwei Jahren als 2. Kapellmeister am Hoftheater von Kassel nicht nur für das Dirigieren des Opernrepertoires zuständig, sondern musste darüber hinaus die Schauspielaufführungen musikalisch betreuen. Damit war auch das Arrangieren von Ouvertüren und Zwischenaktmusiken für die Sprechtheaterstücke und gelegentlich die Komposition von Schauspielmusik verbunden.
Als in Kassel eine dramatisierte Fassung von Joseph Victor von Scheffels Epos Der Trompeter von Säkkingen auf die Bühne kam, schuf Mahler eine 1884 mit dem Schauspiel uraufgeführte, vom Publikum positiv aufgenommene Begleitmusik. Ein Stück daraus bildet das Ständchen, das der Trompeter Werner der Angebeteten namens Margareta darbringt, «in der Mondnacht nach dem Schlosse, wo Margareta wohnt, über den Rhein hinüber geblasen», wie es in einer zeitgenössischen Schilderung heisst. Die serenadenhafte Melodie der Trompete korrespondiert im Verlauf des Stücks mit einem Oboen-Gesang, woraus sich die romantische Zusammenkunft von Werner und Margareta ableiten lässt. Mahler bezeichnete den Satz gegenüber seiner Vertrauten Natalie Bauer-Lechner einmal als «Liebesepisode».
In Kassel entstand aber nicht nur diese Begleitmusik, sondern auch Mahlers erste ernsthafte Komposition, die sich einen Platz im Konzertrepertoire erobern konnte: Die Lieder eines fahrenden Gesellen, deren Komposition auch mit einer Liebesaffäre des Musikers mit der in Kassel engagierten Sängerin Johanna Richter in Verbindung gebracht wird und deren musikalisches Material dann in seine 1888 komponierte 1. Sinfonie einfloss. Aber auch ein Stück leichterer Muse aus Kassel fand zunächst Platz in der Sinfonie: das dort als «Blumine» titulierte Ständchen aus dem Trompeter von Säkkingen. Mahler hatte die Sinfonie ursprünglich als «Tondichtung in Symphonieform» konzipiert. Nach der erfolglosen Uraufführung des Werks 1889 in Budapest wagte Mahler erst vier Jahre später eine neuerliche Aufführung, nunmehr in Hamburg, wo er inzwischen als erster Kapellmeister
Gustav Klimt, Schloss Kammer am Attersee (um 1908). Auch Mahler verbrachte zwischen 1893 und 1896 mehrere Sommer am Attersee.
am Stadttheater engagiert war. Das Autograf dieser revidierten Hamburger Version nennt das Werk nunmehr «Symphonie», gibt aber gleichzeitig immer noch ein «Programm» in Anlehnung an den Roman Der Titan des von Mahler bewunderten Dichters Jean Paul wieder. Der erste Teil Aus den Tagen der Jugend enthält drei Sätze: Frühling und kein Ende, Blumine und Mit vollen Segeln; der zweite Teil Commedia humana hat zwei Sätze: Todtenmarsch in Callots Manier und Dall’ Inferno al Paradiso. Der Erfolg der Hamburger Aufführung ermutigte Mahler, das Werk dem damals in Weimar als grossherzoglich-sächsischer Kapellmeister tätigen Richard Strauss für eine Aufführung anzubieten, die dann 1894 beimTonkünstlerfest Weimar erklang, erneut in fünfsätziger Form. Doch die Kritik reagierte grossteils mit Unverständnis, weniger auf die Musik, als auf das ihr beigegebene Programm. Der Blumine-Satz wurde in einer Kritik als «trivial» bezeichnet. Bei der nächsten Aufführung 1896 liess Mahler dann nicht nur das Programm weg, sondern auch die Blumine. Fortan war die 1. Sinfonie ein viersätziges Werk.
Die Blumine wurde erst 1967 durch eine Drucklegung in der US-amerikanischen Theodor Presser Company der Öffentlichkeit wieder zugänglich. Seither gab es zahlreiche Aufführungen des Satzes, aber nur selten innerhalb der 1. Sinfonie, da diese von Mahler in ihrer endgültigen Form als viersätzig festgelegt worden war. Interessant ist aber, dass sich das zweite Thema des Sinfonie-Finales auf den Blumine-Satz bezieht.
Auch sonst birgt der Satz, auch wenn er tatsächlich ziemlich einfach gestrickt ist, so manche wertvolle Mahler’sche Substanz: In der Instrumentierung kann man schon Vorwegnahmen von Passagen der 2. Sinfonie entdecken, und die Trompetenweise scheint in ihrer Stimmung schon ein wenig die Posthorn-Episode aus der 3. Sinfonie anzukündigen. In der einzigen expressiven Verstärkung des Satzes spürt man auch, dass sich Mahler als Student mit Bruckners Sinfonik beschäftigt hatte.
Neben der Trompete und der Oboe kommen auch noch dem Horn Soloaufgaben zu, während die Streicher und Harfen den Satz zart und mitunter nur schemenhaft begleiten. Die Blumine kann trotz ihrer Sentimentalität eine zauberhafte Wirkung entfalten.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich
Blumine
BESETZUNG 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, Trompete, Pauken, Harfe, Streicher
ENTSTEHUNG 1884
URAUFFÜHRUNG 23. Juni 1884 am Hoftheater von Kassel unter der Leitung des Komponisten