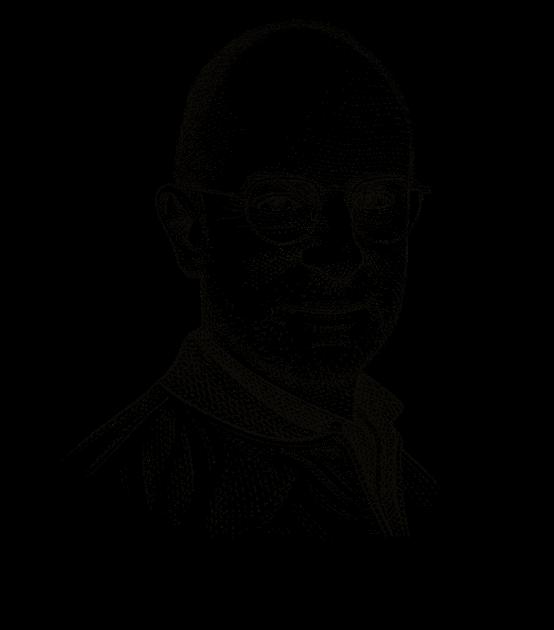2 minute read
von Sigfried Schibli
TÖNENDES SCHOTTLAND
VON SIGFRIED SCHIBLI Schottland, das heisst in der Musik: virtuose FiddleKaskaden, Harfengeklimper und Gitarrenakkorde, melancholische Flötenmelodien, nicht selten mit Ostinati unterlegt. Heute tragen Musikstars wie der Fiddler Ryan Young, die Folk-Sängerinnen Iona Fyfe und Josie Duncan oder die Band Project Smok schottische Folklore in alle Welt.
Aber Schottland war schon lange, bevor es Tonträger gab, ein Thema in der Musik. Nicht wenige Komponisten sogenannter klassischer Musik waren fasziniert von den dortigen Burgen und Schlössern, Landschaften und Küsten, von der Volksmusik. Die wenigsten Schottland-Liebhaber waren Schotten, und lange nicht alle haben das Land bereist. In den Salons des frühen 19. Jahrhunderts waren ‹Écossaisen› ausgesprochen beliebt, und die Komponisten kamen meist aus Deutschland, Österreich, Frankreich oder Tschechien. Ludwig van Beethoven schrieb solche Tanzsätze im Zweier- oder Dreiertakt, auch Franz Schubert liess sich vom schottischen Lokalkolorit anregen.
Die grösste Schottland-Begeisterung unter allen Tonkünstlern aber legte Felix Mendelssohn Bartholdy an den Tag. Als noch nicht Zwanzigjähriger schrieb er eine Fantasie für Klavier, die er Sonate écossaise nannte und seinem Kollegen IgnazMoscheles widmete. Diesem floss im selben Jahr 1828 ein Werk für Klavier und Orchester mit dem Titel Anklänge aus Schottland aus der Feder. Mendelssohn seinerseits legte zwei Jahre nach seiner schottischen Klaviersonate eine Orchester-Ouvertüre mit dem Titel Die Hebriden vor, so genannt nach der Inselgruppe vor der Nordwestküste Schottlands. Ein ähnliches Werk schrieb der dänische Komponist Niels Wilhelm Gade Ende der 1840er-Jahre. Es hiess Nachklänge von Ossian und weist auffällige Ähnlichkeiten mit der Mendelssohn-Ouvertüre auf.
Einige Jahre nach der Hebriden-Ouvertüre liess Mendelssohn seine Schottische Sinfonie in a-Moll folgen, bis heute eines der populärsten Werke des Meisters. Um dieses Werk rankt sich eine Geschichte, die mehr als nur eine Anekdote ist. Als Mendelssohns Freund und KomponistenKollege Robert Schumann dieses Werk hörte, pries er «jene alten im schönen Italien gesungenen Melodieen» (sic). Wie das? Schumann verwechselte die Schottische mit der noch gar nicht veröffentlichten Italienischen Sinfonie Mendelssohns! Woraus man füglich den Schluss ziehen darf, dass Programm-Musik nur bedingt Geschichten, Landschaften oder Kulturen ‹abbildet›, dass es auch bei programmatischer Musik immer einen Deutungsspielraum gibt und dass selbst erstrangige Musikkenner wie Schumann sich bei der Zuordnung von Musik zu einer Region täuschen können.
Im Unterschied zu vielen SchottlandLiebhabenden kannte Mendelssohn Schottland aus eigener Anschauung: Er bereiste es 1829 mit seinem Freund Karl Klingemann. Die beiden waren in Durham, Edinburgh, Staffa, Glasgow und machten sich kundig, was es mit dem Dudelsack auf sich hat. Ob sie dabei auch den schottischen Whisky mit gleicher Sorgfalt erkundet haben, wurde
Aufführung traditioneller schottischer Tänze vor Königin Victoria, 1868
von der musikhistorischen Forschung noch nicht abschliessend geklärt. Auf den Trennungsschmerz von ihrem geliebten Bruder reagierte Mendelssohns Schwester Fanny Hensel mit dem Lied Im Hochland, Bruder, da schweifst du umher aus ihrem Zyklus Liederkreis.
Walter Braunfels, dessen Schottische Fantasie für Viola und Orchester in diesem Konzert erklingt, war somit keineswegs der Erste, der sich musikalisch von Schottland inspirieren liess. Er komponierte neben seiner Schottischen Fantasie auch ein Werk mit dem Titel Hebridentänze für Klavier und Orchester. Schon dreissig Jahre vor Braunfels hatte ein aus New York gebürtiger Komponist mit einem schottisch inspirierten Klavierwerk von sich reden gemacht: Edward MacDowell schrieb 1901 eine Keltische Sonate in e-Moll. Im Unterschied zu Braunfels und Mendelssohn hatte MacDowell schottische und irische Vorfahren. Und die in Schottland populäre Volksweise Ca’ the Yowes toe the knowes (Treib die Schafe auf den Hügel) mit ihrem sanft wogenden Rhythmus wurde ausser von Braunfels auch von Benjamin Britten, Ralph Vaughan Williams und vom musizierenden Dichter Robert Louis Stevenson adaptiert.