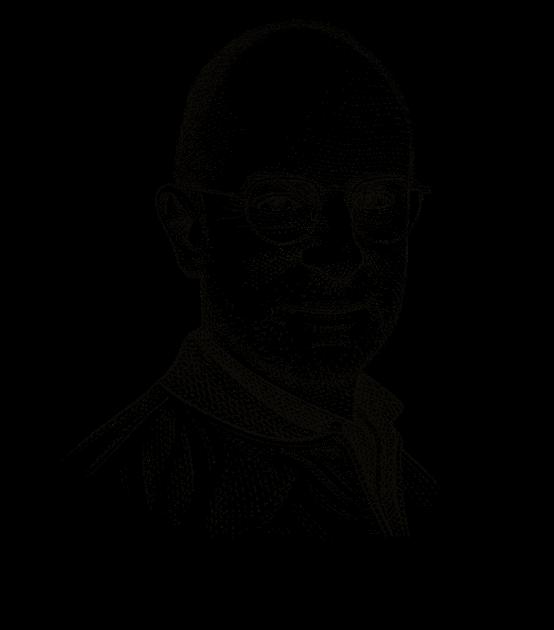4 minute read
Markus Poschner, Leitung
SINFONISCHES VERKLEIDUNGSSPIEL
VON FLORIAN HEURICH Ein Gespräch mit Markus Poschner über Mahler, Braunfels und den trügerischen Schein der Musik.
FH Beginnen wir am Ende. Der letzte
Satz von Mahlers 4. Sinfonie ist das
Lied Das himmlische Leben aus Des
Knaben Wunderhorn. Was hat es mit dieser kindlichen Jenseitsvision als
Finale einer Sinfonie auf sich? MP Das Doppelbödige, das Märchenhafte, das kindlich Naive und das Traumhafte sind in dieser Sinfonie die vorherrschenden Parameter. Nie kann man in diesem Werk dem Offensichtlichen vertrauen, es ist quasi überall eine grosse Maskerade. Adorno hat die Vierte sogar einmal als grosse «AlsOb-Sinfonie» bezeichnet.
Mir kommt es immer so vor, als ob Mahler im letzten Satz schliesslich aufklären will, wie diese Sinfonie eigentlich gemeint ist. In allen Sätzen finden sich immer wieder brutale Einbrüche aus einer anderen Welt, die die scheinbare Idylle in ihr Gegenteil verwandeln und die Hörer schockieren. Und plötzlich erklärt uns eine Sopranstimme den Sinn des Lebens und singt vom Paradies aus der naiven Sicht eines Kindes. Die Musik spricht dabei jedoch eine ganz andere Sprache: Die Erlösung, von der der
«Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen.»
Text erzählt, wird einem von der Musik verweigert und lässt einen ratlos zurück; das Orchester verklingt in einem einzigen Ton. Ich denke, das ist die Hauptaussage dieses Werks: Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Genau deshalb ist die 4. Sinfonie eine meiner Lieblingssinfonien, weil sie unendlich geheimnisvoll und von einer magischen und rätselhaften Tiefe beseelt ist.
FH Leben und Tod liegen bei Mahler eng beieinander. Der Ländler steht neben dem Trauermarsch. Wo steckt die
Tragik in der an der Oberfläche so heiter wirkenden 4. Sinfonie? MP Bei Mahler liegt das Wirtshaus immer direkt neben dem Friedhof. Dieses traumähnliche Bild hätte tatsächlich auch bestimmte Eindrücke aus seiner Kindheit in Böhmen widerspiegeln können: Seine Eltern waren ja Wirtsleute. Die Blaskapellen spielten zuerst auf einer Beerdigung und gleich darauf auf dem Tanzboden, während die Militärmusik in der Kaserne lautstark alles übertönte. So oder ähnlich beschrieb Mahler selbst seine tiefsten Empfindungen als Kind. Auch der frühe Tod seines geliebten Bruders prägte sein junges Leben zutiefst.
Im 2. Satz wird der groteske Totentanz eines Knochenmanns geschildert, symbolisiert durch die um einen Ton höher gestimmte Solovioline. Aber auch der Tod erscheint hier als ein Kinderbild, Furcht einflössend und makaber, in einer ganz unmittelbaren und doch rätselhaften Darstellung.
FH Mit Blumine springen wir ganz an den Anfang von Mahlers sinfonischem Schaffen. Ursprünglich war dieses Stück ein Satz der sinfonischen Dichtung Der Titan, woraus später die 1. Sinfonie wurde. Der Satz wurde dann von Mahler wieder aus dem Werk herausgenommen, sollte sogar vernichtet werden und galt daraufhin lange Zeit als verschollen.
Was hat Mahler an dem Stück missfallen? MP Das wird für immer sein Geheimnis bleiben, denn es ist ein ganz wunderbarer meditativer Satz. Natürlich gibt es viele Theorien, warum Mahler ihn wieder aus der 1. Sinfonie entfernt hat: die Tonart, die Länge, zu wenig sinfonischer Gestus, zu viel Sentimentalität... Vermutlich trifft alles und doch nichts von alledem zu.
FH Der Titel Blumine geht auf Jean Paul zurück, einer von Mahlers Lieblingsschriftstellern. Welches Programm verbirgt sich hinter diesem Titel? MP ‹Blumine› ist das deutsche Ersatzwort für die antike Göttin Flora. Allein durch seine Struktur wirkt dieses Stück fast wie eine implodierte Sinfonie. Es wird ein Thema exponiert, das aufblüht und auf das eine wunderschöne Gegenmelodie folgt. Am Ende hebt der ganze Satz ab und löst sich vom Irdischen. Alles verflüchtigt sich und mündet ins Ätherische. Es ist wie ein Erblühen und Absterben, fast wie die gesamte 4. Sinfonie, nur im Zeitraffer.
FH Wie soll man dieses Stück heute aufführen? Als eigenständiges Werk, als
Teil der 1. Sinfonie oder quasi als Anhang an diese Sinfonie? MP Ich habe schon fast alles Mögliche ausprobiert. Es passiert hier aber zum ersten Mal, dass ich ein Konzert mit Blumine eröffne. Das ist ein gewagtes Experiment, da sich sowohl die Musiker*innen als auch das Publikum ganz unvermittelt auf diese sehr besondere Stimmung des Werks einlassen müssen. Da es aber so feinstofflich und zerbrechlich ist, empfinde ich es als einen idealen Auftakt, der wunderbar zur Schottischen Fantasie von Braunfels hinführt.
FH Was verbindet Braunfels und Mahler? MP Natürlich dieser österreichisch-deutsche Gestus der Spätromantik als musikalische Grundlage, aber auch das sehr ähnliche Schicksal. Wie Mahlers Musik wurde die von Braunfels ab 1933 verboten und von den Nationalsozialisten als ‹entartet› abgestempelt. Der Schottischen Fantasie widerfuhr genau dies: Die in Deutschland geplante Uraufführung wurde abgesagt, und das Werk wurde später in der Schweiz zum ersten Mal gespielt.
FH Ist die Schottische Fantasie eher eine sinfonische Dichtung – Braunfels schwebte eine ‹landschaftliche Schau› vor – oder doch eher ein Bratschenkonzert? MP Keines von beiden oder beides zusammen. Es handelt sich um kein klassisches Konzert, sondern um eine sehr freie, sogar theatralische musikalische Erzählung. Man merkt, dass Braunfels ein Opernkomponist war, der ganz offen mit Assoziationen umging. Wir Interpreten können uns da sehr kreativ auf diese ungemein farbige Tonsprache einlassen. Eine wunderbare Aufgabe.