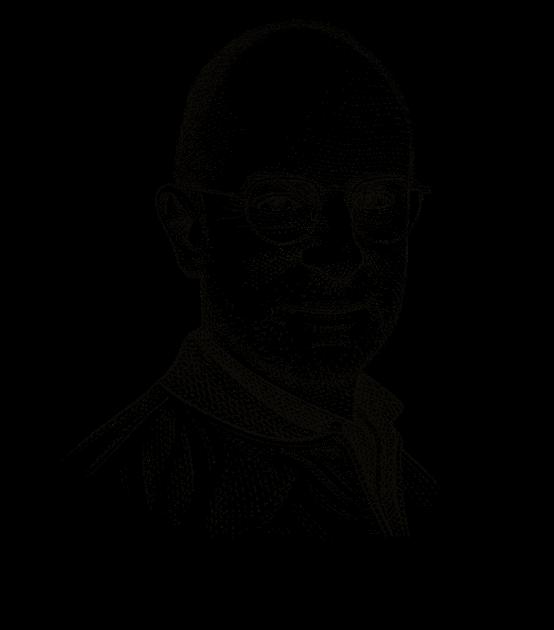3 minute read
Nils Mönkemeyer, Viola
DER RUF DES DUNKLEN KLANGES
VON BENJAMIN HERZOG Der Bratschist Nils Mönkemeyer spürt das Meer in Walter Braunfels’ Schottischer Fantasie. Ein überhaupt in vielerlei Hinsicht anspruchsvolles Werk, das aber gerade darum dankbar zu spielen sei.
BH Auf Ihrer Homepage steht: Nils
Mönkemeyer ist einer, der «mit, im und vom Enthusiasmus lebt.» Wie enthusiasmieren Sie sich jeden Tag? NM Das Schöne ist ja, wenn man etwas tut, das man liebt, dann trägt einen das. Dann muss man sich gar nicht motivieren, sondern die Motivation ist dann ein Teil von dem, was man tut. Und so geht mir das mit Musik. Jeden Tag. BH Sie spielen ein Repertoire vom 18.
Jahrhundert bis in die Gegenwart.
Ein bratschender Allrounder? NM Das Schöne daran, Bratschist zu sein, ist, dass wir aufgrund des etwas knappen Repertoires gezwungen sind, uns mit allen Epochen zu beschäftigen. Das erfordert für mich als Künstler eine grosse stilistische Bandbreite. Und daran kann man nur wachsen.
BH Sie geben auch Werke für Ihr Instrument in Auftrag. Was steckt gerade in der Pipeline? NM Als Nächstes ein Konzert von Isabel Mundry. Und im Dezember werde ich ein Werk von Peter Ruzicka in Zürich uraufführen. Das sind die zwei nächsten grösseren Stücke, die ich lernen werde. Ich versuche eigentlich, jedes Jahr etwas ganz Neues zu spielen, eine neue Tonsprache zu lernen. Das ist immer spannend.
BH Bei neuen Werken bleibt es häufig bei der Uraufführung und vielleicht ein paar Folgeterminen. Was tun Sie dafür, dass ein Stück länger lebt? NM Mehr als gut zu spielen, das Publikum und mein Umfeld für das Stück zu begeistern, kann ich eigentlich nicht tun. Am wichtigsten scheint mir, Komponist*innen anzufragen, die so schreiben, dass ein Stück auch nach der Uraufführung weiter gespielt werden kann.
BH Was ist in Braunfels’ Schottischer Fantasie die Herausforderung für den
Solisten? Muss er selbst besonders viel Fantasie haben? NM Ich fühle mich hier wie jemand auf der Opernbühne, der eine grosse Wagner- oder Strauss-Partie zu singen hat. Das ist alles sehr klangmalerisch. Meine Aufgabe sehe ich auch darin, eine Geschichte zu erzählen. Als Solist und in den grossen Dialogen mit den Solobläser*innen. Die Fantasie ist also ein Werk, das mich in vielerlei Hinsicht fordert.
BH Haben Sie Schottland vor Augen beim
Spielen? Macbeth, die Klippen, den
Wind, wie er um brüchige Schlossmauern pfeift? NM Es gibt zumindest Anklänge an keltische Musik, an schottisch klingende Tänze oder Melodien, die verwandt sind mit schottischen Volksliedern. Ob die nun original sind oder nicht, weiss ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach so ein Gefühl: Dass man auf der Heide steht, und das Meer öffnet sich vor einem. Es ist ja auch etwas Mystisches in der schottischen Landschaft. Das hört man definitiv in dieser Musik.
BH Einfach zu spielen ist Braunfels’ Fantasie nicht: Viele Doppelgriffe, alles eng verflochten mit dem Orchester.
Überhaupt eine dicke Partitur. Wo steht das Stück auf der Kniffligkeits
Skala für Bratschisten von 1 bis 10? NM Zwischen 8 und 9. Allerdings, wenn ich es dann spiele, so hoffe ich doch eher bei 5. Es soll ja nicht schwer wirken. Ich mag allerdings die Tatsache, dass es nicht einfach geschrieben ist. Denn die Arbeit und das physische Ringen bringen ja auch eine grosse musikalische Intensität mit sich, die im Konzert dann spürbar ist.
BH Sie unterrichten an der Musikhochschule München. Nehmen Sie diese
Fantasie auch mit Ihren Studierenden durch? Oder gilt es da erst mal die Basics abzuarbeiten? NM Gewöhnlich arbeitet man im Studium eher mit dem Standardrepertoire, ja. Da geht es um die Vorbereitung für den Beruf, für Orchesterstellen. Bei 95 Prozent meiner Student*innen ist das so. Aber in den BH Wie ist das eigentlich: Sogenannte
‹Edelbratscher*innen›, die also von
Anfang an Bratsche spielen und nicht zuerst Geige – sind die eher die Regel oder die Ausnahme? NM Sie sind eher die Ausnahme. Ich bin, so gesehen, auch kein ‹Edelbratscher›. Aber das ist auch egal. Irgendwann ruft einen dieser dunklere Klang, und ab da gehört man zum dunklen Register.
BH Ihr Kollege Antoine Tamestit beschreibt den Ton seiner Bratsche als verführerische Frauenstimme, die aber doch so tief singe, dass er sich frage, ob sie nicht etwa ein Mann sei.
Was ist die Bratsche für Sie? NM Wenn wir den Durchschnitt aller menschlichen Stimmen nehmen, dann ist das in etwa das Register der Bratsche. Dadurch ist die Bratsche sehr nah an unserer persönlichen, auch inneren Stimme. Männlich wie weiblich. Im Klang behält sie darüber hinaus immer einen geheimnisvollen Schleier. Das Unaussprechliche, was eben nur Musik sagen kann, da ist die Bratsche besonders gut aufgehoben.