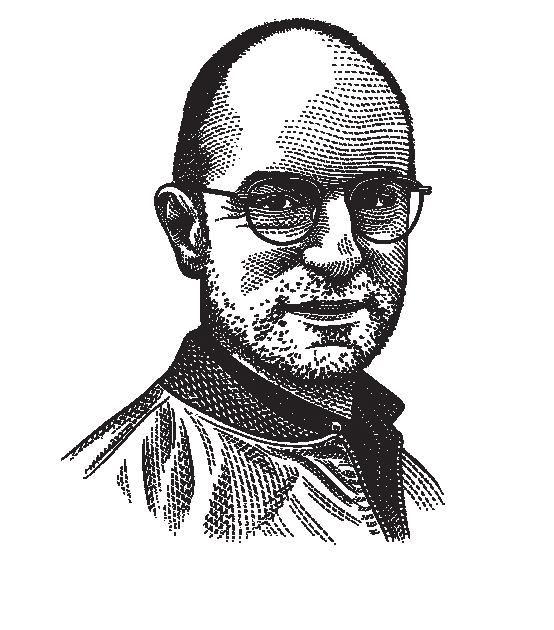
3 minute read
GWIE GEHÖR
VON BENJAMIN HERZOG
Mein Grossvater, vielleicht der musikbegeistertste Mensch in unserer Familie, hörte im Alter nicht mehr gut. Das Cello, das er einst in seinem ehrwürdigen AmateurQuartett gespielt hatte, verstaubte in einer Ecke. Über seine Schwerhörigkeit machten wir Enkel uns lustig. Der Rest der Familie war davon genervt. Später wurde auch meine Mutter schwerhörig. Sie war Pianistin. Ob es mich dereinst auch trifft? Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) empfiehlt Musiker*innen: «Immer mit!» Mit Gehörschutz. Zumindest wenn man mit seinem Instrument die empfohlene maximale Spieldauer überschreitet, gemessen in Stunden pro Woche. Bei einer Gitarre sind das vierzig. Auch der Kontrabass darf gemäss dieser Empfehlung so lange pro Woche gespielt werden. Vierzig Stunden sind hierzulande Normalarbeitszeit. Wer allerdings in eine Posaune bläst, sollte das, gemäss SUVA, nicht länger als fünf Stunden pro Woche tun. Für Profis unmöglich. Im gleichen Bereich rangieren Trompete, Horn und Schlagzeug. Für Geiger*innen lautet die Empfehlung: vierzehn Stunden.
Es gibt taube Komponisten (Beethoven, Smetana). Weltbekannt ist die fast gehörlose Schlagzeugerin Evelyn Glennie. Sie nimmt Musik über Vibrationen wahr. Schwerhörig zu sein im Sinfonieorchester aber, ist unmöglich. Und doch kann gerade das Musizieren in einem Orchester dazu führen. Das Gehör: ein grosses Thema. Es gibt Orchestermusiker*innen, die mit einem Tinnitus leben. Und es gibt solche, bei denen die Hörfähigkeit innerhalb von Jahren rapide abnimmt. Schon vor der Pensionierung. Mit Gehörschutz zu spielen, ist aber für viele unangenehm, da sie ihre Umgebung und sich selbst so nicht mehr richtig wahrnehmen. Andere sagen, Ohrstöpsel im Orchester zu benutzen, sei Übungssache.
Lärm ist subjektiv. Wenn er ausgeruht sei, so ein Posaunist, sei das Spiel im Orchester eine Wohltat. Sei er aber gestresst, so sei er auch viel lärmempfindlicher als normalerweise. Posaunen sind im Orchester zudem oft direkt vor dem Schlagzeug positioniert. Was tun, wenn man weiss, jetzt kommt bald ein lauter Schlag? Den Kopf etwas wegzudrehen, hilft angeblich. Auch schon, auf den kommenden Schlag vorbereitet zu sein. Das deutsche Verb ‹hören› hat seine Wurzeln unter anderem im lateinischen ‹cavere›, sich in Acht nehmen. Wer genau hinschaut, sieht auch immer wieder Musiker*innen, die sich vor lauten Stellen einen Gehörschutz in die Ohren drücken. Das sind passgenaue Anfertigungen, die mit den gelben OhropaxSchäumchen so viel zu tun haben wie eine Stradivari mit einer Fabrikgeige. Je nach Aufsatz kann man so zehn, fünfzehn oder fünfundzwanzig Dezibel Lautstärke herausfiltern. Zehn schon sind eine Menge. Eine Faustregel besagt, dass die gefühlte Wahrnehmung von Lautstärke sich pro zehn Dezibel verdoppelt (oder verringert). Aber, wie gesagt: Lärm ist subjektiv.
Schon ein steter Wassertropfen im Bad kann uns am Einschlafen hindern. Umgekehrt gibt es Menschen, die problemlos in einem lauten Flugzeug arbeiten können. Lärm ist nicht gleich Lärm. Und der Lärm der anderen stört immer mehr als der eigene. Das wissen Orchestermusiker*innen. «Wenn ich eine laute Stelle zu spielen habe», so ein Schlagzeuger, «warne ich die Kollegen vorher.» Aus Rücksicht würde er in den Proben auch kaum je in voller Lautstärke spielen. Er nennt das «soziales Spielen». Wenn der Mensch – jenseits der Orchesterwelt – sein Recht behaupten will, wird er in der Regel laut. Wir schreien uns an. Hören ist auch mit dem Verb ‹gehorchen› verwandt. Der Lautere gewinnt, denken wir. Aber im Orchester ist das Gehör kollektiv. Ich muss auf die anderen hören und sie auf mich. Verstehen Sie?
Das Philharmonische Orchester Helsinki nahm 1997 mit seinem damaligen Chefdirigenten Leif Segerstam das Album Earquake/Ohrenbeben auf mit der angeblich «lautesten klassischen Musik aller Zeiten».
Stücke sind da zu geniessen von Dmitri
Schostakowitsch (der zusammen mit Gustav Mahler und Richard Wagner als ‹lauter› Komponist gilt), Sergei Prokofjew, Aram Chatschaturjan. Oder vom isländischen Komponisten Jón Leifs. In Hekla beschrieb Leifs 1964 tonmalerisch den Ausbruch eines Vulkans auf Island. Es kommen Kanonen zum Einsatz, Schiffsketten und ‹musikalische Steine›, die für die Uraufführung in Helsinki aus Island importiert werden mussten. Die finnischen Steine hatten die Lärmkriterien des Komponisten nicht erfüllt. Die Kritik nach der Uraufführung sei vernichtend gewesen.
Man kann sich auch weigern. Vor einigen Jahren tat dies das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Die Uraufführung von Dror Feilers Stück Halat Hisar wurde abgesetzt, weil sich die Musiker*innen nicht dessen Lautstärke aussetzen wollten. Im Vergleich mit den Tönen einer elektrischen Gitarre sei sein Stück überhaupt nicht laut, das Verhalten des Orchesters sei «lächerlich», meinte Feiler uneinsichtig.
Was tun, wenn das Gehör beschädigt ist? Hörgeräte werden zwar immer besser, aber den menschlichen Hörsinn können sie bestenfalls imitieren. Er träume in Klängen, hat mir ein Komponist verraten. Und stehe dann manchmal mitten in der Nacht auf, um einen solchen Klang zu notieren. Eine ähnliche Geschichte, erzählt man auch über den Geiger Giuseppe Tartini, dem angeblich der Teufel die Noten seiner TeufelstrillerSonate eingeflüstert hat. Vielleicht hat ja auch mein schwerhöriger Grossvater von Musik geträumt. Gesprochen hat er darüber allerdings nie.
→ Das nächste Mal: H wie ‹H›







