Die Zeitschrift für Wissenschaft & universitäres Leben





Was es dazu braucht — 26
ausserdem: Desinformation bekämpfen — 10
Keime und Küsse — 20
Gott und das Universum — 60






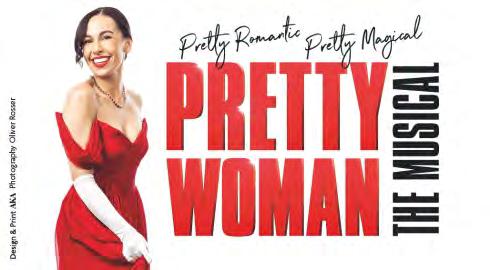
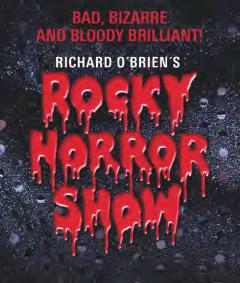







JeanJacques Rousseau hat mit seinem Buch «Emile oder über die Erziehung» (1762) die Kindheit neu erfunden, indem er sie als eigenständige Lebensphase definierte. Diese sollte geschützt werden, damit sich Kinder entfalten und positiv entwickeln können. Rosseaus Ideen hallen bis heute nach. In der Kindheit wird das Fundament gelegt für ein gutes Leben. Sie ist eine Zeit, in der Kinder und Jugendliche idealerweise die Welt und sich selbst entdecken können.
Gleichzeitig werden an sie hohe Erwartungen und Anforderungen gestellt. Im Dossier zeigen wir, was es braucht, um glücklich gross zu

werden. Das wird auch im aktuellen Buch «Kindheit. Eine Beruhigung» diskutiert, das in diesem Jahr erschienen ist. Herausgegeben von UZHEntwicklungspädiater Oskar Jenni, versammelt es die Expertise und die Einsichten von zahlreichen UZHForschenden.
An der UZH beschäftigen sich Wissenschaftler:innen aus verschiedensten Disziplinen mit der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und dem Umfeld, das sie prägt. Dazu gehören die Eltern und die Schule. Wie die aktuelle Forschung zeigt, gibt es essenzielle Voraussetzungen für eine positive Kindheit. Zentral sind vertrauensvolle Beziehungen zu den Eltern und anderen nahen Bezugspersonen. Diese geben dem Kind Selbstvertrauen und Sicherheit. Eltern sind Vorbilder – der Austausch mit ihnen ist zentral für die Entwicklung des Gehirns und der individuellen Persönlichkeit. Die Herausforderung für Eltern und andere Erziehende wie etwa Lehrpersonen besteht darin, ein Gleichgewicht zu finden zwischen
Freiräumen und Orientierung. Kinder brauchen beides, um wachsen zu können. Eltern sollten gemäss Oskar Jenni vertraut, verlässlich, verfügbar, verständnisvoll und voller Liebe sein. Diese fünf «V» sind die essenziellen Faktoren, die den emotionalen und sozialen Bedürfnissen von Kindern gerecht werden und ihnen Selbstvertrauen geben.
Eine entscheidende Rolle in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen spielt die Schule. Die Erwartungen der Gesellschaft sind entsprechend hoch. Manchmal zu hoch, wie das Interview mit der Erziehungswissenschaftlerin Katharina Maag Merki und dem Erziehungswissenschaftler Roland Reichenbach zeigt. Dabei vermittelt die Schule nicht nur Wissen, sondern auch soziale Fähigkeiten: «In der Schule lernt man Gemeinsinn», sagt Roland Reichenbach.
Zu den heutigen Herausforderungen in der Erziehung gehört der Umgang mit den sozialen Medien. Wie die Medienforschenden Sandra Cortesi und Daniel Süss zeigen, können Kinder und Jugendliche von den sozialen Medien profitieren, wenn sie sie als Spielwiese gebrauchen, um Ideen auszuprobieren: «Das kann Spass machen und überrascht mit neuen Impulsen», sagt Sandra Cortesi. Wichtig ist, dass die Eltern mit den Kindern darüber sprechen, wie sie die sozialen Medien nutzen.
Weiter in diesem Heft: Desinformation kann die Demokratie gefährden. Der Medienwissenschaftler Mark Eisenegger und der Jurist Florent Thouvenin haben deshalb zuhanden des Bundesamts für Kommunikation eine Reihe von Vorschlägen erarbeitet, wie der Staat mit dem Problem umgehen kann.
Religion und Weltraum: Der Blick aus dem All auf die Erde und die Aussicht auf ausserirdisches Leben beschäftigen die Theologie. Die beiden Theologen Andreas Losch und Matthias Wüthrich denken im Rahmen des UZH Space Hub darüber nach, was das bedeutet.
Wir wünschen Ihnen eine weitsichtige Lektüre, Ihre UZH Magazin-Redaktion
Thomas Gull & Roger Nickl
DOSSIER

16
POLITOLOGIE
entwurzeln — 16
Enzo Nussio erforscht die Gewalt in Lateinamerika und sucht nach Strategien, um Staaten und Gesellschaften friedlicher zu machen.
KOMMUNIKATION UND RECHT
Wenn die Erde flach ist — 10
Desinformation gefährdet die Demokratie. UZH-Forscher machen Vorschläge, wie Fake News eingedämmt werden können.
MIKROBIOLOGIE
Keime und Küsse — 20
Kampfansage an kleine Krankmacher: Adrian Egli rückt schädlichen Bakterien, Pilzen und Viren mit Hightech zu Leibe.
IM FELD — 25
Der Schatz von Cipirello

Was es dazu braucht — 26
Die Kindheit schafft das Fundament für ein gutes Leben. Im Dossier erklären wir, was es braucht, um gesund und glücklich gross zu werden.


UZH LIFE — Wissenschaftliche Sammlungen Schädel und Eisbären — 50
Die Sammlungen der UZH sind wichtig für die Forschung. Und sie sind ethisch eine Herausforderung, der sich die Universität stellt.
PORTRÄT — Marcelle Soares-Santos Kosmos auf der Wandtafel — 56
Mit neuen Messverfahren versucht die Astrophysikerin, das Rätsel der Dunklen Energie zu lüften.
INTERVIEW — Andreas Losch, Matthias Wüthrich Wir sind Teil des Himmels — 60
Was bedeutet die Erforschung und Nutzung des Weltalls für die Theologie und die Menschheit?
RÜCKSPIEGEL — 6
BUCH FÜRS LEBEN — 7
DAS UNIDING — 7
DREISPRUNG — 8
ERFUNDEN AN DER UZH — 9
IMPRESSUM — 65 NOYEAU — 66

RÜCKSPIEGEL — 1920
Die moderne Physik erhielt dank Koryphäen und Nobelpreisträgern wie Max von Laue, Albert Einstein, Hermann Weyl und Peter Debye ab den 1910erJahren einen Aufschwung. Zürich entwickelte sich zu einem internationalen
Zentrum, das bis nach dem Zweiten Weltkrieg bestehen blieb. Ausgehend von der Fotografie (links), die eine Physikerin und einen Physiker zu Beginn der 1920er-Jahre in einem Labor zeigt, lässt sich die Entwicklung des Fachs in Zürich gut nachzeichnen. Zu jener Zeit war das Physik-Institut an der Rämistrasse 69 untergebracht. Der Forscher auf dem Bild ist Richard Bär, der Sohn des Bankiers Julius Bär. Er studierte in Würzburg und Zürich Mathematik und war Assistent an der Universität Göttingen. Zur selben Zeit studierte dort auch Hildegard Stücklen, die später nach Zürich kam und sich schliesslich 1931 als dritte Frau an der damaligen Philosophischen Fakultät II habilitierte. Leider gibt es keine Fotografie von Hildegard Stücklen, daher lässt sich nicht verifizieren, ob es sich bei der abgebildeten Forscherin tatsächlich um sie handelt. Bär kam
1917 nach Zürich und begann seine Arbeiten in Experimentalphysik bei Edgar Meyer.
In Zürich wurden zu jener Zeit in der Physik wichtige Entdeckungen gemacht und wegweisende Debatten geführt. 1915 brach in der Physik der grosse Streit um die Existenz des Elektrons aus. Durch geschickte Versuche konnte Bär seine zweifelnden Fachkolleg:innen überzeugen und die atomistische Struktur der Elektrizität mit grosser Präzision nachweisen. Mit dieser Arbeit habilitierte sich Bär 1922 an der Universität Zürich. Während Richard Bär in Zürich blieb, ging Hildegard Stücklen 1934 in die USA. Sie war dort als Assistenzprofessorin und später als Associate Professor an verschiedenen Hochschulen tätig und forschte an der Seite von Atomphysikerin Hertha Sponer. Mit neuen Berufungen von Erwin Schrödinger und Gregor Wentzel an der UZH sowie Wolfgang Pauli an der ETH kamen weitere namhafte Persönlichkeiten nach Zürich, die dafür sorgten, dass Zürich der Ruf als ein Mekka für Physiker:innen erhalten blieb. Inge Moser, UZH-Archiv
ESSEN.TRINKEN. DISKUTIEREN.LERNEN.LESEN. TANZEN.SINGEN.







Als Marcel Hänggi an seinem Buch «Weil es Recht ist – Vorschläge für eine ökologische Bundesverfassung» schrieb, konnte er nicht ahnen, dass es in einer politisch brisanten Zeit erscheinen würde: Nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Schweiz für ihre mangelhafte Klimapolitik gerügt hat, plant sie den Aufstand im Europarat und sieht keinen Bedarf, das Urteil umzusetzen.
Gründe für einen besseren Klimaschutz gäbe es genug – nicht nur basierend auf den Menschenrechten. Hänggi spricht Klartext, wenn er im ersten Teil des Buchs die mangelnde Umsetzung des Verfassungsrechts anprangert. Die geltende Bundesverfassung würde es durchaus zulassen, die Umwelt, das Klima und die Biodiversität besser zu schützen –wenn man nur wollte. So weist er etwa darauf hin, dass Art. 84 Abs. 3 BV es verbietet, die Kapazität des alpenquerenden Güterverkehrs zu erhöhen. Trotzdem wird eine zweite GotthardautobahnTunnelröhre gebaut. Die Zersiedlung des Landes macht das Versagen in der Raumplanung deutlich. Er analysiert den Verfassungstext minutiös und stellt Bund und Kantonen kein gutes Zeugnis aus.
Hänggi belässt es aber nicht bei der Kritik. Er ist ein Macher. Davon zeugt auch sein Engagement bei der
Gletscherinitiative. Er weiss, wie schwierig es ist, einer Volksinitiative zum Erfolg zu verhelfen. Er ist auch ein kreativer Denker. Vorschläge für neue ökologisch ausgerichtete Verfassungsbestimmungen sprudeln nur so aus ihm heraus. Das Buch ist eine Handlungsanweisung für alle Entscheidungsträger, wie man Ökosysteme vom Abgaberecht über die Technologieförderung bis zum Widerstandsrecht besser schützen könnte.
Hänggi zeigt, dass man Verfassungsrecht auch als Laie verstehen und spannend vermitteln kann. Er bringt die Sache auf den Punkt und illustriert seine Vorschläge mit Beispielen. Wie breit er recherchiert hat, zeigt sich etwa, wenn er die kantonalen Verfassungsbestimmungen für Klima und Nachhaltigkeit zusammenträgt. Das kantonale Recht er weist sich als wahres verfassungsrechtliches Laboratorium. Als Leserin staunt man auch über die verschiedenen Ansätze in anderen Ländern, die den zukünftigen Generationen institutionell eine Stimme geben wollen.
Die Rubrik «Buch fürs Leben» passt gut zu dieser Besprechung: Hänggi zitiert den grünen Verfassungsentwurf von Alfred Kölz und Jörg Paul Müller aus dem Jahr 1984 prominent. Die Stellen haben mich an zahlreiche Gespräche mit meinem ersten Chef an der Uni erinnert – damals war ich Assistentin bei Alfred Kölz. 1993 habe ich zum Thema «Umwelt und Verfassung» promoviert. Gut dreissig Jahre später leite ich ein Forschungsprojekt zu «Climate Rights and Remedies». Der Kreis hat sich für mich mit dieser Lektüre in einem gewissen Sinne geschlossen, wird aber gewiss noch weitere Runden ziehen.
Helen Keller ist Professorin für öffentliches Recht, Europa- und Völkerrecht.
Marcel Hänggi, Weil es Recht ist – Vorschläge für eine ökologische Bundesverfassung. Rotpunktverlag 2024

Steht man auf dem GeorgBüchnerPlatz des IrchelCampus, hat man die Füsse nicht ganz auf dem Boden. Vielmehr steht man auf einer Art Himmel aus Tartan, mit dem die 40 mal 40 Meter grosse Fläche belegt ist. Verkehrte Welt also. Die Situation erinnert an die Hauptfigur aus Georg Büchners (1813–1837) Erzählung «Lenz», die manisch durchs Gebirge rast. «Müdigkeit spürte er keine, nur war es ihm manchmal unangenehm, dass er nicht auf dem Kopf gehen konnte», heisst es dort. Gestaltet wurde der 1995 eingeweihte GeorgBüchnerPlatz vom bekannten Schweizer Grafiker, Maler und Plastiker Gottfried Honegger (1917–2016). Das himmelblaue TartanQuadrat ist eingefasst von schroffen Betonklippen – dahinter erheben sich wie Felswände die Institutsgebäude der UZH und eine gelbe, 17 Meter hohe Stahlsäule. Auf einer Metallplakette wird zudem aus Büchners «Lenz» zitiert. Gottfried Honeggers Ziel war es, einen Platz zum Verweilen zu schaffen und zugleich einen Ort für die Phantasie und die Kreativität zu entwerfen. Vielleicht entstehen neue Ideen – der Treibstoff für Kunst und Wissenschaft – ja gerade dann, wenn wir versuchen, die Welt einmal ganz anders zu betrachten, zum Beispiel kopfüber.
Georg Büchner verband Kunst und Wissenschaft übrigens geradezu ideal. Er schrieb nicht nur grossartige literarische Texte, sondern war auch Naturforscher. Er promovierte 1836 an der Universität Zürich mit einer Abhandlung über das Nervensystem von Fischen und wurde anschliessend zum Privatdozenten ernannt. Kurz darauf erkrankte er an Typhus und starb erst 24jährig. Roger Nickl
Das Gefühl, dass «die Chemie stimmt», ist nicht nur ein menschliches Phänomen. Auch in der Tierwelt spielen komplexe chemische Signale eine entscheidende Rolle bei der Partnerwahl. Überall nutzen Tiere Pheromone, um Partner anzulocken, zu erkennen und zu bewerten. Die Zusammensetzung dieser Duftstoffe ist oft genetisch festgelegt und kann Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand eines Individuums geben. Dies unterstützt die Wahl von passenden Partnern.
Die Fähigkeit zur chemischen Kommunikation ist das Ergebnis einer langen evolutionären Entwicklung. Tiere, die effizienter Partner finden und sich erfolgreicher fortpflanzen konnten, hatten einen selektiven Vorteil und gaben ihre Gene häufiger an die nächste Generation weiter. In einem ständigen Wettlauf um die besten Partner haben sich sowohl die chemischen Signale als auch die entsprechenden Rezeptoren immer weiter spezialisiert. Die Chemie stimmt also, wenn die Signale und ihre Rezeptoren optimal aufeinander abgestimmt sind.
Stefan Lüpold ist Professor für Integrative organismische Biologie.
Es ist spannend, dass man von passender Chemie spricht, wenn man eine Person mag oder stark von ihr angezogen ist. Interessant ist auch, dass die Redewendung bereits im 18. Jahrhundert verwendet wurde, als die Chemie als Wissenschaft noch in den Kinderschuhen steckte. Dass biochemische Prozesse eine Rolle spielen, wenn man verliebt ist oder sich von jemandem körperlich angezogen fühlt, ist heute nachgewiesen. Dabei spielen chemische Botenstoffe wie Dopamin, Serotonin, Oxytocin und Adrenalin eine Rolle. Inwieweit Pheromone beim Menschen von Bedeutung sind, ist umstritten, auch wenn Düfte und Gerüche Sympathie oder Abneigung gegenüber anderen mitbestimmen.
Letztlich sind chemische Prozesse eine Begleiterscheinung psychischer Einschätzungen. So steht zu Beginn der Verliebtheit nicht die leidenschaftliche Liebe, sondern Pragmatismus. Man prüft, auf wen man sich einlässt und ob diese Person halten wird, was sie verspricht. Erst dann brechen die Dämme und wir lassen der Chemie freien Lauf.
Guy Bodenmann ist Professor für Klinische Psychologie Kinder/Jugendliche & Paare/Familien.
In der Chemie kann diese Redewendung verschiedene Bedeutungen haben: Zum einen stimmt die Chemie, wenn das geplante Syntheseprodukt erzeugt wird, es nicht zu viele Nebenprodukte gibt und der Aufwand für die Synthese insgesamt nicht zu gross und das Produkt daher nicht zu teuer ist. Ein Krebsmedikament, das lebensrettend ist, darf ruhig etwas teurer sein, eine Agrochemikalie nicht.
Die Chemie stimmt ebenfalls, wenn in der Synthese umweltbelastende Chemikalien vermieden werden. So versucht man, chlorierte Lösungsmittel (und insbesondere FCKW) sowie alle teratogenen Substanzen aus Synthesen zu verbannen. Manch gut funktionierender Syntheseweg ist in grossem Massstab aus ökologischen Gründen nicht akzeptabel.
Und letztendlich stimmt die Chemie, wenn der Nutzen die Risiken stark überwiegt. Leider ist der Einsatz von Stoffen in der Natur häufig mit anfangs unbekannten Folgen verbunden. Dies abzuschätzen, ist nicht immer einfach. Ein Ziel der modernen Chemie-Ausbildung ist, die Studierenden in dieser Hinsicht zu sensibilisieren, damit die Chemie am Ende auch wirklich stimmt. Oliver Zerbe ist Professor für Organische Chemie.

Moderne Computersysteme bestehen aus getrennten Rechen- und Speichereinheiten. Das bedeutet, dass Informationen nach Abschluss einer Berechnung vom Prozessor zum Speicher verschoben werden müssen. Diese Datenbewegung verbraucht viel Energie und ist zeitaufwändig. Fortschrittliche Technologien wie KI und 5G haben dieses Problem durch ihren drastisch erhöhten Rechenbedarf nochmals verschärft. Dies ist eine Herausforderung für Technologieunternehmen, die ihren Kunden innovative Lösungen in Bereichen wie Wearables, Internet der Dinge (IoT), Smart Sensing und Robotik anbieten möchten. Nun arbeitet das UZHStartup Synthara, das von den beiden Forschern Alessandro Aimar und Manu Nair gegründet wurde, an einem neuen revolutionären Speicher-IP, der bahnbrechende Leistung verspricht und sich nahtlos in alle gängigen Computerplattformen integrieren lässt. Ihr Flaggschiffprodukt namens ComputeRAM kann Berechnungen direkt im Speicher durchführen. Diese Technologie wird als In-Memory-Computing (IMC) bezeichnet und macht die Verschiebung von Informationen zwischen Speicher und Prozessor überflüssig, was zu einer über 100-mal schnelleren und energieeffizienteren Verarbeitung führt. ComputeRAM ermöglicht eine neue Generation von Mikrocontrollern (winzigen Computern) und modernste KI-Funktionen auf unzähligen Geräten wie Smartwatches, AR/VR-Brillen oder IoT-Geräten wie intelligenten Lautsprechern und Haushaltsgeräten. Die Entwicklungsarbeiten sind bereits weit fortgeschritten, das marktreife Produkt wird Anfang 2025 erwartet. Text: Thomas Gull, Bild Frank Brüderli

Wie soll der Staat mit Desinformation in digitalen Medien umgehen? Und was braucht es zum Schutz der Demokratie? Medienwissenschaftler
Mark Eisenegger und Jurist Florent Thouvenin von der UZH machen in einer interdisziplinären Studie Vorschläge dazu.

«Desinformation kann in der Schweiz potenziell grossen Schaden anrichten.»
Mark Eisenegger, Kommunikationswissenschaftler
Text: Tanja Wirz
Illustration: Cornelia Gann
Eine Demokratie kann nur funktionieren, wenn Bürgerinnen und Bürger sich zu wichtigen Themen sachgerecht informieren und eine Meinung bilden können. Doch fallen nicht immer mehr Menschen auf «Fake News» herein und wissen gar nicht mehr, was richtig und was falsch ist?
Die Entwicklungen der letzten Jahre mit Corona-Pandemie, US-Wahlen, russischer Kriegspropaganda und der zunehmend automatisierten Erzeugung von Text, Bild und Ton geben Anlass zur Sorge: Umfragen zeigen, dass fast die Hälfte der Schweizer:innen Desinformation als grosses Problem wahrnimmt. Und auch im Parlament gab es zahlreiche Vorstösse zum Thema, insbesondere zur Frage nach dem Einfluss ausländischer Propaganda. 2017 war die Schweizer Regierung noch der Ansicht, es brauche keine neuen Vorschriften und es reiche, die Entwicklung im Auge zu behalten. Doch das hat sich mittlerweile geändert: Um zu eruieren, welche Massnahmen der Staat ergreifen könnte, hat das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) 2022 Fördergelder für Forschungsprojekte gesprochen, die dieser Frage nachgehen.
Skeptische Schweiz
Eines dieser Projekte ist an der UZH unter Federführung von Kommunikationswissenschaftler Mark Eisenegger und Rechtswissenschaftler Florent Thouvenin entstanden. Rechtliche Aspekte sind in Studien für das Bakom bisher eher wenig untersucht worden. Deshalb ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit der beiden Forscher und der Anspruch, empirisch fundierte Aussagen zu wirksamen und rechtlich zulässigen Massnahmen gegen Desinformation zu machen, besonders interessant. Zur Lage in der Schweiz hat das Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög), dessen Direktor Eisenegger ist, bereits 2021 eine
repräsentative Umfrage gemacht. Dabei wurde festgestellt, dass die meisten Menschen hierzulande nach wie vor den traditionellen Medien und den Mitteilungen der Behörden vertrauen. Sie fühlen sich fähig, falsche Informationen zu erkennen, verbreiten diese wenig weiter und betreiben oft sogar Aufklärung im persönlichen Umfeld. Inhalte auf sozialen Medien, Messengerdiensten und Alternativmedien werden generell ziemlich skeptisch beurteilt. «Diese Resilienz hat auch mit der geringen Polarisierung und der Kleinräumigkeit zu tun», erklärt Eisenegger. «Wenn man hierzulande Desinformationen verbreitet, muss man mit Reputationsverlust rechnen.»
Zudem verfüge die Schweiz mit der SRG über einen guten Service public und über einen noch relativ vielfältigen Journalismus, der sich auch einem gemeinsamen Kodex verpflichtet hat. Dennoch macht sich die Hälfte der Befragten Sorgen über «Fake News» und dass andere Menschen darauf hereinfallen könnten. Vielleicht nicht zu Unrecht, denn das direktdemokratische System ist auf einen aufgeklärten Diskurs angewiesen: «Faktentreue, Transparenz und Fairness sind für die Aushandlung von politischen Entscheidungen unabdingbar. Desinformation kann in der Schweiz potenziell grossen Schaden anrichten», so Eisenegger. Wie verbreitet Desinformation tatsächlich ist, lässt sich allerdings schwer sagen, denn die digitalen Plattformen geben nur wenig Zugang zu den relevanten Daten. Ebenfalls offen bleibt, wie oft Desinformation überhaupt geglaubt wird. Immerhin weiss man, dass jene, die neben den sozialen Medien kaum noch journalistische Nachrichtenangebote nutzen, seltener abstimmen gehen. Eisenegger meint dazu: «Eine Gefahr ist, dass das Vertrauen in eine gemeinsame Faktenbasis schwindet.»
Dieser grundsätzliche Vertrauensverlust sei für das Funktionieren der Demokratie problematischer als wenn falsche Informationen zuweilen für richtig gehalten werden. Aber das Problem der Des-
information müsse man ernst nehmen, auch wenn es in der Schweiz im Vergleich mit anderen Ländern noch nicht so gross ist – insbesondere auch angesichts aktueller Entwicklungen im Bereich von KI und automatisierten Bot-Accounts.
Wer entscheidet über Richtig und Falsch?
Mögliche Massnahmen sehen Thouvenin und Eisenegger auf mehreren Ebenen: Der Staat kann rechtliche Vorgaben erlassen, im Rahmen einer Ko-Regulierung mit digitalen Plattformen gemeinsam Regeln entwickeln oder auf die Branchen- und Selbstregulierung der Plattformen vertrauen. Zudem sollten die Bürger:innen durch Bildung und Aufklärung befähigt werden, Desinformation zu erkennen. Sinnvoll wäre gemäss den beiden Forschern ein «Governance-Mix», der auf eine Kombination verschiedener Massnahmen setzt, die das Verfassen und Verbreiten von Desinformation eindämmen und die gesellschaftliche Resilienz gegen Falschinformationen insgesamt stärkt. (Siehe Kasten rechts) Ausgangspunkt sollte dabei der bestehende Rechtsrahmen sein. Im zweiten Teil der Studie findet sich deshalb ein Überblick über die Normen des geltenden Rechts, die genutzt werden können, um rechtlich unzulässige Formen von Desinformation zu erfassen. Thouvenin führt dazu aus: «Die schweizerische Rechtsordnung enthält eine Vielzahl unterschiedlicher Regeln, die dies erlauben, allerdings nicht aus der Desinformationsperspektive, sondern beispielsweise zum Schutz der Persönlichkeit oder der Ehre der betroffenen Personen.»
Bei der Anwendung der bestehenden und beim Erlass allfälliger weiterer Normen zur Bekämpfung von Desinformation sei allerdings stets zu bedenken, dass die Meinungsäusserungsfreiheit eines der wichtigsten Grundrechte in einer Demokratie ist: «Der Staat sollte deshalb in erster Linie durch prozedurale Regeln sicherstellen, dass der Meinungsbildungsprozess funktioniert. Beim Ver-
Desinformation bekämpfen
In ihrem Bericht für das Bundesamt für Kommunikation schlagen Mark Eisenegger und Florent Thouvenin eine Reihe von Massnahmen vor, wie mit dem Problem von Desinformation künftig umgegangen werden könnte. Dabei empfehlen sie die Konzentration auf die sozialen Medien und die Messengerdienste, da diese bei der Verbreitung von Desinformationen eine Schlüsselrolle spielen.
• Eine:n Desinformations(schutz)beauftragte:n einsetzen, der oder die die Lage kontinuierlich beobachtet, Anlaufstelle bei Fragen ist und zwischen den verschiedenen Akteuren vermittelt. Dazu bräuchte es Zugangsrechte zu (anonymisierten) Daten, was auch für weitere Forschung wichtig wäre.
• Einen Digitalrat analog zum Presserat schaffen: Vertreter:innen der Plattformen definieren gemeinsame Standards. Der Digitalrat könnte auch als Beschwerdeinstanz dienen.
• Gesetzliche Kennzeichnungspflicht von kommerzieller und politischer Werbung, so wie in traditionellen Medien üblich. Ergänzend dazu die Pflicht, die dahinterstehenden Personen oder Organisationen zu identifizieren. Ebenso Kennzeichnungspflicht von automatisierten Accounts (Bots).
• Ein Streitschlichtungsverfahren einrichten: In einem Rechtsstaat sollte die endgültige Entscheidung über Recht und Unrecht bei staatlichen Gerichten liegen und nicht bei privaten Firmen. Wegen der riesigen Zahl potenzieller Fälle wäre ein vom Staat angebotenes schnelles Verfahren wünschenswert.
• Vorgaben nach dem Modell des Digital Service Act der EU machen: Plattformen müssen ein internes Beschwerdemanagement einrichten, problematische Inhalte prüfen und allenfalls löschen, in Streitfällen ein externes Streitschlichtungsverfahren akzeptieren, das Ranking von Inhalten transparent machen und dürfen niemanden willkürlich ausschliessen.
• Spezifisch schweizerische Faktencheck-Angebote unterstützen.
• Die Medien- und Digitalkompetenz fördern und Bidungsangebote für verschiedene Zielgruppen entwickeln.
• Den Informationsjournalismus stärken: den Service public durch öffentlichen Rundfunk aufrechterhalten und online erweitern. Vergünstigte Abonnemente für jüngeres Publikum anbieten. Staat und/oder bestehende Medien, die sich den Richtlinien des Presserats verpflichten, könnten zudem gemeinsam eine Medienplattform mit qualitativ hochwertigen Informationen betreiben.
«Eine demokratische Gesellschaft muss auch unsinnige Meinungen bis zu einem gewissen Grad aushalten können.»
Florent Thouvenin, Rechtswissenschaftler
bot konkreter Aussagen ist äusserste Zurückhaltung geboten, weil der Staat kein ‹Ministry of Truth› (Ministerium der Wahrheit) betreiben sollte, das darüber entscheidet, was richtig und was falsch ist», sagt Thouvenin.
Eine demokratische Gesellschaft müsse auch unsinnige Meinungen bis zu einem gewissen Grad aushalten können: «Sie dürfen vertreten, dass die Erde flach ist. Das ist ausserhalb des Zugriffs des Rechts. Die Aufgabe der Rechtsordnung ist es, sicherzustellen, dass in der öffentlichen Debatte
unterschiedliche Positionen vertreten werden können. Wir brauchen einen offenen Diskurs, der sich auch weiterentwickelt, aber wir brauchen Leitplanken, dass dieser Diskurs funktioniert», sagt der Rechtswissenschaftler Gegenüber ausländischen Staaten ist der Spielraum laut Thouvenin allerdings grösser: «Die Meinungsäusserungsfreiheit schützt Bürger:innen gegenüber dem Staat, nicht ausländische Staaten gegenüber der Schweiz, da wäre rechtlich gesehen mehr möglich. Die Frage ist, wie man solche Ak-

teure identifizieren kann, wer das tun müsste und welche Massnahmen ergriffen werden können. Es wäre denkbar, digitale Plattformen zu zwingen, ausländische Propaganda zu löschen.»
Problematische Messengerdienste
Besonders problematisch sind derzeit Messengerdienste wie etwa Telegram, auf denen grosse Gruppen privat und verschlüsselt kommunizieren können. «Das ist zum Verbreiten von Desinformation natürlich interessant», sagt Eisenegger. Und Thouvenin meint: «Das Problem ist hier vor allem, dass ein Zugang zu den Inhalten technisch nicht möglich und mit dem Schutz der Privatsphäre nicht vereinbar ist. Sinnvoll könnte aber sein, die Grösse von Chat-Gruppen auf Messengerdiensten zu beschränken, um zu verhindern, dass gesellschaftlich relevante Diskurse innerhalb grosser Gruppen im Verborgenen geführt werden.»
Aus dem Gespräch mit den beiden Wissenschaftlern wird klar: Sowohl für die Forschung als auch für die politische Willensbildung der Einzelnen ist der Zugang zu guter Information essenziell. Deshalb müssen nicht nur digitale Medien in den Blick genommen werden, sondern es braucht auch guten Informationsjournalismus, so Mark Eisen-
egger. «Nicht Deformation ist in der Schweiz das grösste Problem, sondern dass immer mehr Menschen zu den sogenannten News-Deprivierten gehören, die kaum noch akkurate Informationen konsumieren.» Eine guten Medienförderung sei deshalb ebenfalls wichtig, um die Bevölkerung weiterhin resilient gegen Desinformation zu machen. Florent Thouvenin sieht sogar eine Chance in der wachsenden Skepsis gegenüber KI-generierten Inhalten und Bots: «Das fördert möglicherweise auch den Wunsch nach vertrauenswürdigen Nachrichtenquellen. Die Frage ist jetzt nur, ob und wie die traditionellen Medien diese Chance nutzen werden.»
Prof. Mark Eisenegger, m.eisenegger@ikmz.uzh.ch
Prof. Florent Thouvenin, florent.thouvenin@ius.uzh.ch
LITERATUR:
Florent Thouvenin, Mark Eisenegger et al.: Governance von Desinformation in digitalisierten Öffentlichkeiten. Bericht für das Bundesamt für Kommunikation (Bakom). Der Bericht ist online frei verfügbar.
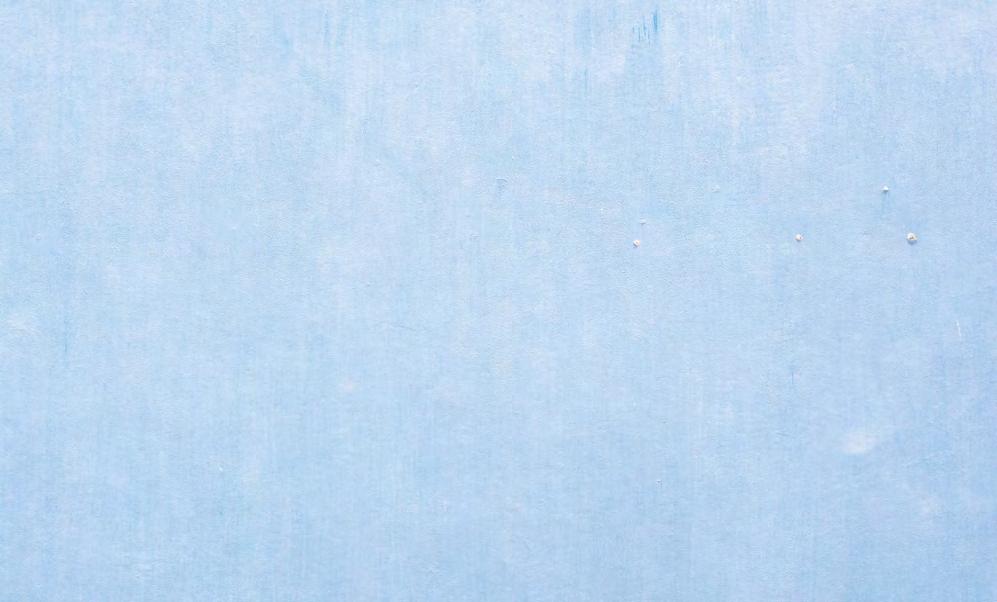
Deine Abschlussarbeit gedruckt und gebunden. Innert weniger Stunden abholbereit oder schon morgen per Post bei dir zu Hause!
Profitiere jetzt mit dem Rabatt-Code: UZH-12! von CHF 12.- Rabatt auf deine Bestellung.


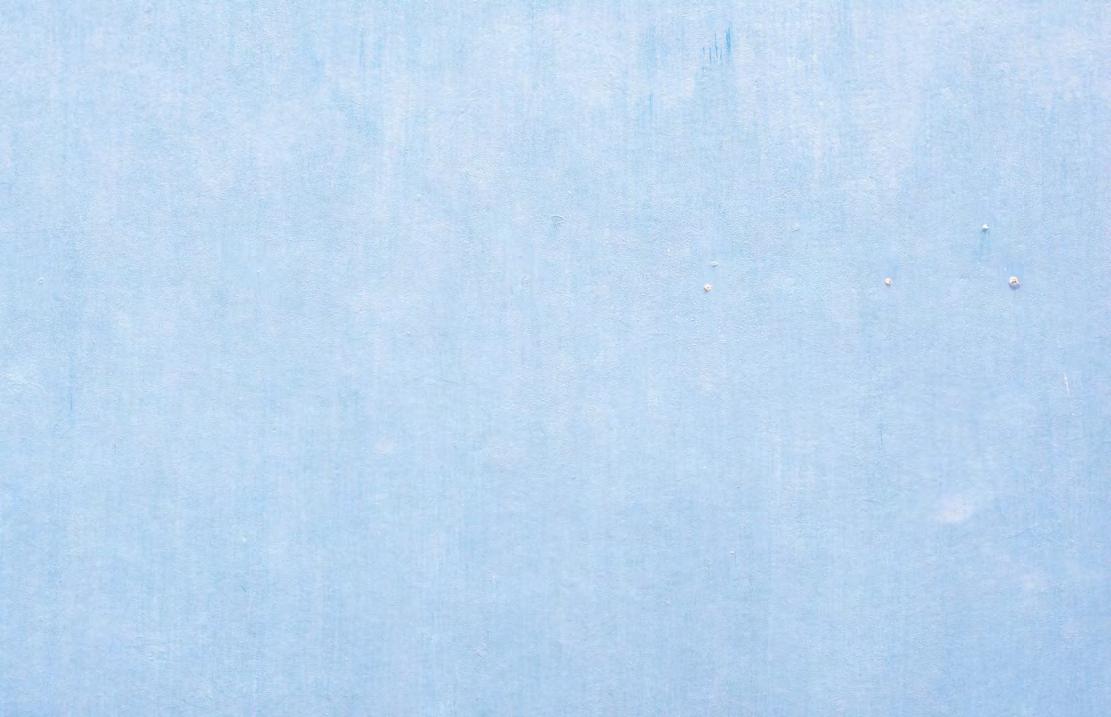
POLTIKWISSENSCHAFT
In manchen Weltregionen dominiert die Gewalt, während es anderswo vergleichsweise ruhig zu und her geht. Der Politologe Enzo Nussio erforscht, weshalb das so ist, und sucht in Lateinamerika nach Strategien, die Staaten friedlicher machen.
Text: Andres Eberhard
Plata o plomo» – Silber oder Blei. Das sagt der ehemalige kolumbianische Drogenboss Pablo Escobar in einer Szene der Netflix-Serie «Narcos». Soll heissen: Wer nicht kooperiert (und dafür mit Geld bedacht wird), wird umgebracht. So sterben Escobars Widersacher im Minutentakt. Und zwar nicht nur am Bildschirm: Angeblich soll der wirkliche Escobar in den 1970er- und 1980er-Jahren noch viel gewalttätiger gewesen sein als die Figur aus der Netflix-Doku.
Noch heute gehören Städte in Lateinamerika zu den gewalttätigsten der Welt – und dies, obwohl Escobar längst tot und die Zeit der übermächtigen Drogenbosse vorbei ist. Warum das so ist, darüber weiss man überraschend wenig. Es gibt mittlerweile einige Indizien dafür, dass nicht der Drogenhandel die Hauptursache der überbordenden Gewalt ist. «In den letzten Jahren nahm in Kolumbien der Drogenhandel zu, die Gewalt jedoch war rückläufig», sagt Enzo Nussio, der seit vielen Jahren erforscht, was die Gewaltspirale in Lateinamerika in Gang setzt. Zudem sei Kolumbien bereits vor Aufkommen des Drogenhandels vor etwa vier Jahrzehnten von Gewalt geprägt gewesen. «Und die Beispiele von Bolivien und Peru zeigen, dass es auch einen weitgehend gewaltfreien Drogenhandel gibt.»

Weniger Gewalt: In Kolumbiens Hauptstadt Bogotá werden heute sechsmal we
Warum dominiert in manchen Weltgegenden die Gewalt, während es anderswo vergleichsweise friedlich zu und her geht? Antworten auf diese Frage will Nussio in den nächsten fünf Jahren zusammen mit drei bis vier Mitarbeitenden finden. Der Forscher, derzeit noch am Center for Security Studies der ETH beschäftigt, wechselt per Anfang

niger Morde begangen als Anfang der 1990er-Jahre. (Bild: Polizeistreife in Bogotá)
2025 an die Universität Zürich. Für sein Projekt zum Thema «Gewaltreduktion» hat er einen SNF Consolidator Grant erhalten.
Sich die Köpfe einschlagen
Die mittlerweile zahlreichen Dokus und Serien im TV und auf Netflix machen zumindest implizit das
personalisierte Böse für die Gewalt verantwortlich: Sie zeigen beispielsweise, wie Pablo Escobar seinen Kontrahenten mit furchteinflössender Miene droht oder kaltblütig das Okay zum Mord an einstigen Verbündeten gibt. Doch Gewalt, da ist sich Nussio sicher, hat strukturelle Ursachen. In Kolumbien hat der 44-Jährige für seine Forschung Dutzende
Lateinamerika
In kaum einem Land der Welt ist die Gewalt ein derart konstanter Faktor wie in Kolumbien. Ab den 1950er-Jahren tobte viele Jahrzehnte lang ein blutiger Bürgerkrieg zwischen dem Staat, linken Guerillagruppen wie der Farc, rechtem Paramilitär und den berüchtigten Drogenkartellen. Im Jahr 2016 einigten sich die Regierung und die Farc auf einen Friedensvertrag.
Als sich die Farc dazu bereit erklärte, sich zu entwaffnen, schrieb der Politologe Enzo Nussio gemeinsam mit US-Professor Oliver Kaplan einen Beitrag in der «New York Times»: «Damit Kolumbien endgültig mit seiner Vergangenheit brechen kann, muss es eine kluge Strategie zur Wiedereingliederung der ehemaligen Kämpfer in die Gesellschaft verfolgen», hiess es darin. Nussio hatte zuvor mehrere Jahre lang in Kolumbien geforscht und dabei mit zahlreichen ehemaligen Kämpfern gesprochen.
Nussio und Kaplan schlugen einen Mix aus Bildungs- und Entwicklungsprogrammen sowie Massnahmen in der Familienpolitik vor, damit die Reintegration der Kämpfer gelingen würde. Sieben Jahre später betrachtet Nussio die Situation in Kolumbien zwiespältig. Ein Ende der Gewalt sei nicht in Sicht, viele Menschen seien unzufrieden. «Die Lage ist heute viel fragmentierter. Es gibt weniger grosse Kartelle oder Guerillagruppen, dafür viel mehr kleinere kriminelle Organisationen», sagt er. Anführer von Aufständischen oder Drogenkartellen würden schneller gefasst, jedoch genauso schnell durch neue ersetzt.
Dass Gewalt in Lateinamerika nicht nur wegen Bürgerkriegen ein schwer wiegendes Problem ist, zeigt das Beispiel der Lynchjustiz. Zu dieser besonders brutalen Form der Gewalt hat Nussio kürzlich ein Buch geschrieben. In Lateinamerika ist Lynchjustiz keine Seltenheit. Nussio identifizierte Tausende von Fällen, in denen gewalttätige Mobs zur Tat schritten. «Lynchgewalt kommt besonders oft dort vor, wo der Staat schwach und lokale Gemeinschaften stark sind», sagt Nussio. «Dann heisst es: Wir schaffen selber Gerechtigkeit.»
ehemalige Kämpfer aus dem Bürgerkrieg interviewt (siehe Kasten). «Wenn man sie davon überzeugt, die Waffen niederzulegen, dann stehen Tausende andere bereit.» Dasselbe dürfte für die Drogenbosse gelten: Hätte nicht Escobar die Macht an sich gerissen, hätte es ein anderer getan. Anders gesagt: Nicht einzelne Menschen, sondern gewisse Umstände führen zu Gewalt. Nur, welche Umstände?
Vor seinem Büro hat Nussio ein Poster im A3-Format aufgehängt. «Urban violence reduction: Bogotá as success and future test case» steht darauf. Und die Frage: Warum nimmt Gewalt in bestimmten Städten Lateinamerikas wie eben Bogotá ab? In der Hauptstadt Kolumbiens geschehen heute sechsmal weniger Morde als noch Anfang der 1990er-Jahre. Die zentrale Frage, die Nussio seit jeher umtreibt, formuliert er so: «Geschieht eine solche Entwicklung spontan oder kann man sie lenken?»
Die bisherigen Versuche der Wissenschaft, diese Frage zu beantworten, hält er für unzureichend. Einerseits gebe es eine ganze Menge an Erklärungsansätzen, wonach Gewalt durch bestimmte Entwicklungen auf der Makroebene minimiert wird. Auf diese Weise argumentieren beispielsweise Historiker:innen, wenn sie erklären, warum wir uns heute in der Schweiz nicht mehr gegenseitig die Köpfe einschlagen wie noch im Mittelalter: Staatsbildung, Modernisierung, Demokratisierung oder Reduktion der Ungleichheit sind einige Stichworte dazu.
«Die Erkenntnisse solcher Forschung sind aber meist deprimierend», sagt Nussio. «Schliesslich bedeuten sie, dass wir nicht viel tun können und dass es vielleicht noch Hunderte von Jahren dauert, bis die Gewalt zurückgeht.» Und Nussio ist auch skeptisch, ob sie zutreffen. Schliesslich seien die Staaten Lateinamerikas demokratischer und wirtschaftlich weiter entwickelt als viele andere auf der Welt.
Auf einer ganz anderen Ebene beschäftigt sich die kriminologische Forschung mit dem Thema Gewalt. Sie fragt etwa danach, was die Polizei tun muss,
«Menschen vor Gewalt zu schützen, ist eine der wichtigsten Aufgaben von Staaten.»
Enzo Nussio, Politologe
damit die Gewalt in der Stadt abnimmt. Nussio hat dazu Untersuchungen angestellt. Mit Erfolg: So konnte eine von ihm begleitete Kampagne der Polizei die Gewalt in Bogotá reduzieren. Die Polizei hatte in den 150 gefährlichsten Strassenzügen der Stadt Poster aufgehängt. Darauf zu lesen war, wie viele Kriminelle am jeweiligen Ort schon verhaftet wurden. Dass die Kampagne funktionierte, ist aus Sicht der lokalen Behörden ein Erfolg. Denn sie zeigt, dass es für die Polizei einfachere und günstigere Wege gibt, um die Gewalt zu reduzieren, als an jeder Ecke zu patrouilleren.
Dennoch sei er hinterher frustriert gewesen, erzählt Nussio. Denn was man auch beobachten konnte: Die Gewalt kam zurück, sobald die Poster nicht mehr hingen. Ihm wurde klar: Um nicht nur die Symptome, sondern den Kern des riesigen Gewaltproblems zu bekämpfen, genügen Poster nicht. Nun verfolgt Enzo Nussio eine neue Strategie. Er will die Struktur des Gemeinwesens in den Kommunen genauer unter die Lupe nehmen. «Die Beziehung zwischen lokalen und staatlichen Organisationen ist ein entscheidender Faktor», vermutet er. Was er damit meint, erläutert er am Beispiel der «Juntas de Acción Comunal» (JAC), von denen es in Kolumbien Tausende gibt. Dabei handelt es sich um organisierte zivile Gruppen auf kommunaler Ebene. Diese haben in gewissen Regionen Kolumbiens sehr viel Einfluss. Manche davon taten sich aus wirtschaftlichen Gründen zusammen. So traf Nussio in einem Dorf, das er zufällig bereist hat, auf Einwohner, die sich zu einer Vereinigung von Zwiebelbauern zusammengeschlossen hatten. Wer dieser Vereinigung vorsteht, hat vielleicht sogar mehr Macht als der lokale Bürgermeister, da praktisch alle Dorfbewohner arm und vom Zwiebelgeschäft abhängig sind.
Solche lokalen Organisationen arbeiten mal mehr, mal weniger mit den staatlichen Behörden zusammen. In manchen Gegenden sind zivile und staatliche Organisationen richtiggehend verfeindet. «Dort wünschen sich die Menschen nicht mehr, sondern weniger Staat», sagt Nussio. Es gebe aber auch Kommunen, in denen der Präsident der lokalen JAC mit dem Bürgermeister bespricht, wie
es mit der löchrigen Strasse weitergehen soll. Diese funktionierende Zusammenarbeit zwischen zivilen und staatlichen Organisationen könnte ein entscheidender Faktor sein, um die Gewalt langfristig zu reduzieren, glaubt Nussio.
Zeitungstexte durchforsten
Um diese These zu prüfen, braucht der Forscher zuallererst Daten zur Gewalt in Kolumbien. Und zwar sehr viele: Schliesslich möchte er das Auf und Ab von Gewalt zuerst lokal und über die letzten hundert Jahre hinweg dokumentieren. Manche Zahlen erhält er von den Behörden, mit Hilfe von Machine Learning will er zudem digitalisierte Zeitungstexte durchforsten. Auch sogenannte Oral History, also die Befragung von Zeitzeugen, soll mit einfliessen.
Liegen die Daten vor, können Vergleiche angestellt werden. Interessant sind dabei insbesondere jene Gegenden, in denen die Gewalt in einem bestimmten Zeitraum abgenommen hat. Dort kann Nussio mit weiteren Fragen ansetzen: Was waren die Gründe für den Rückgang? Gab es politische Entscheide oder herrschten bestimmte Strukturen vor? Bestenfalls lassen sich Strategien finden, mit denen Gewalt in der Vergangenheit erfolgreich reduziert werden konnte. Ob diese auch heute noch wirken, würde anschliessend in einem Feldexperiment getestet, sagt Nussio.
Aber selbst dann: Werden die politischen und zivilen Akteure vor Ort so handeln, wie es seine Forschung empfiehlt? Nussio zuckt mit den Schultern. «Menschen vor Gewalt zu schützen», sagt er, «ist eine der wichtigsten Aufgaben von Staaten. Erfüllen sie diese nicht, führt das zu grossen Enttäuschungen.» Bis 2030 nimmt sich Nussio nun Zeit, um die Gewaltspirale zu analysieren. «Aber», sagt er, «eigentlich ist das mein Lebensprojekt.»
Dr. Enzo Nussio, enzo.nussio@sipo.gess.ethz.ch
MIKROBIOLOGIE
Adrian Egli hat sich den Mikroben verschrieben –den Bakterien, Pilzen und Viren, die uns sowohl am Leben erhalten als auch töten können. Mit KI und Hightech rückt der umtriebige Wissenschaftler den Krankheitserregern zu Leibe.
Text: Stefan Stöcklin
Bild: Marc Latzel
Adrian Egli kommt gleich zur Sache. Beim Besuch in seinem Büro schreitet er als Erstes zielstrebig zu einem grossformatigen Foto, das unübersehbar in einer Ecke hängt. Darauf abgebildet sind Hunderte von kugel- und stäbchenförmigen Bakterien, bunt eingefärbt und tausendfach vergrössert. «Das Mikrobiom des Kusses meiner Frau – mein Lieblingsbild», schwärmt Egli. Die mit einem Rasterelektronenmikroskop gefertigte Aufnahme zeigt einen kleinen Ausschnitt der erstaunlichen Vielfalt von Mikroorganismen, die unsere Lippen besiedeln. «Allein das Mikrobiom eines Kusses besteht aus 60 Millionen Bakterien», erläutert der Professor für Medizinische Mikrobiologie. «Insgesamt tummeln sich auf unserer Haut mehrere Milliarden Keime, im Darm sind es sogar tausend Milliarden, ist das nicht fantastisch», sagt Egli – und mit jedem Wort ist seine Faszination für die mikroskopisch kleinen Mitbewohner zu spüren.
Die Billionen von Bakterien, Pilzen und Viren sind für uns überlebenswichtig, sie helfen bei der Verdauung, unterstützen unseren Stoffwechsel und das Immunsystem, stimulieren Nervenzellen und sorgen für unser Wohlgefühl. Aber Mikroorganismen haben auch eine dunkle und gefährliche Seite, sie sind Auslöser gefährlicher Krankheiten und können Menschen innert Tagen töten. Als Leiter des Instituts für Medizinische Mikrobiologie hat sich Egli dieser pathogenen Seite verschrieben und sorgt mit seinen Mitarbeitenden dafür, dass mikrobielle Infektionen möglichst rasch und genau diagnostiziert und behandelt werden können. Dass

Sechs Millionen Bakterien: Adrian Egli vor dem Bild, das das Mikrobiom eines
der umtriebige Forscher in der Mikrobiologie tätig ist, könnte auf den ersten Blick erstaunen. Das Fach hatte in der Vergangenheit eher den Ruf einer beschaulichen Wissenschaft. Das rührte daher, dass Proben von Patient:innen meist mehrere Tage kultiviert werden mussten, bevor sie unter dem Mikroskop und mit weiteren Tests bestimmt werden konnten. Dank technischer Fortschritte in der Diagnostik – allen voran die ultraschnelle Genomsequenzierung – ist von dieser Beschaulichkeit nichts mehr übriggeblieben. Heutzutage kann das Erbgut eines Bakteriums innert Stunden bis auf das letzte Bauteil seiner DNA sequenziert werden.
Gleichzeitig stehen Hightech-Methoden wie Massenspektroskopie und seit neustem auch KI-Verfahren zur Verfügung, um krank machende Mikroorganismen zu charakterisieren. Virtuos nutzt Adrian Egli mit seinem Team diese neuen technischen Möglichkeiten und entwickelt sie weiter. «Mir geht es um rasche und praxisnahe Lösungen», sagt der Wissenschaftler, der sowohl einen medi-
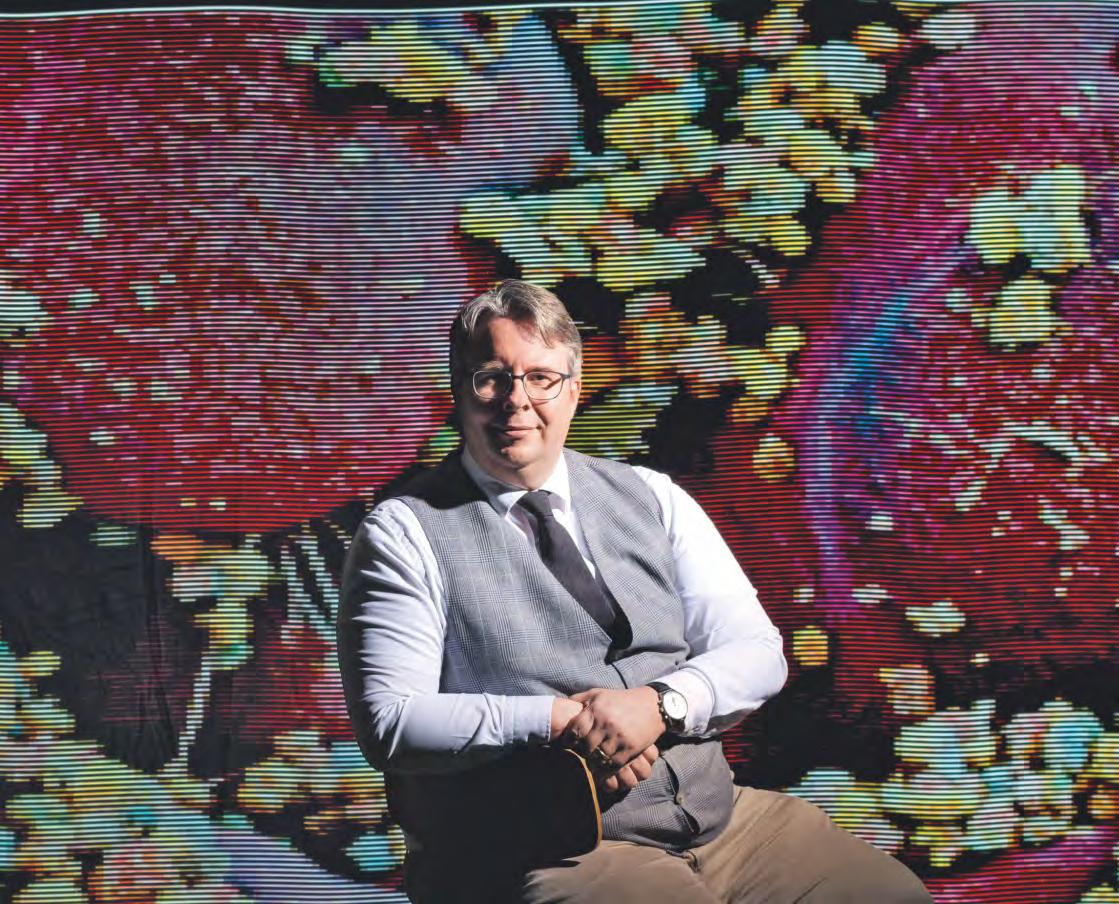
zinischen als auch einen naturwissenschaftlichen
Doktortitel trägt.
Ein Herz für Mikroorganismen
Ursprünglich träumte Adrian Egli von einer Karriere als Grundlagenforscher in der Molekularbiologie. Einer seiner Mentoren in Basel, wo er um die Jahrtausendwende studiert hat, inspirierte ihn für das Thema Medizin und Infektionskrankheiten. Er studierte Medizin und legte eine naturwissenschaftliche Forschungsarbeit über das Polyomavirus BK nach, mit der er den PhD-Titel erwarb. «Infektiöse Mikroorganismen und die Labormedizin sind eine Herzensangelegenheit geworden», sagt er. Das Gebiet sei «unglaublich breit und interessant» und erlaubt ihm, sein Flair für Mathematik und Computertechnologien einzubringen. Zum Beispiel im Problembereich antibiotikaresistenter Bakterien. Diese gefährlichen Keime sind weltweit auf dem Vormarsch, auch in der Schweiz. Mehrere hundert Menschen sterben hierzulande an Infek-
tionen multiresistenter Keime, weltweit sind es gut eine Million. Umso wichtiger ist die rasche Überprüfung im Labor, welche Antibiotika bei einem Krankheitserreger noch wirken, denn die Zeit bis zum Einsatz einer wirksamen Therapie kann über Leben und Tod entscheiden.
Vor kurzem hat Egli in Zusammenarbeit mit Kolleg:innen der ETH ein neuartiges Verfahren entwickelt, das Methoden der Massenspektrometrie mit Methoden der künstlichen Intelligenz verknüpft. Die Massenspektrometrie erstellt einen Fingerabdruck der bakteriellen Eiweissmoleküle eines Erregers. Eine speziell mit Daten resistenter Keime trainierte KI kann danach selbstständig erkennen, ob und welche Antibiotikaresistenzen bei diesem neuen Keim vorliegen. Dieses Verfahren ist deutlich schneller als bisherige Methoden.
Bei solchen disziplinenübergreifenden Projekten hilft Egli seine Begeisterungskraft, mit der er andere von seinen Ideen überzeugen kann. «Ich blicke gerne über den Tellerrand meiner Disziplin
hinaus und schätze Kooperationen mit anderen Kolleg:innen und Fachgebieten», sagt er. Dies praktiziert er auch in einem anderen grossen Forschungsvorhaben zum Thema Virulenz. Sie bezeichnet die Fähigkeit eines Mikroorganismus, Krankheiten zu verursachen – je virulenter ein Bakterium, desto gefährlicher ist es. Erstaunlicherweise werde die Virulenz in der Diagnostik bisher weitgehend ignoriert, dabei sei sie für die Prognose des Krankheitsverlaufs wichtig, sagt Egli. Mit seinem Team und Kooperationspartnern hat er sich nun daran gemacht, Virulenzfaktoren wie beispielsweise die Fähigkeit eines Keims, in das Gewebe einzudringen, zu definieren. Wiederum soll KI zum Einsatz kommen, um den Zusammenhang zwischen den Virulenzfaktoren und den Krankheitsverläufen anhand von Proteindatenbanken der Erreger in verschiedenen klinischen Zentren im Ausland zu bestimmen.
Geborener Netzwerker
Mit den Arbeiten zur Virulenz stösst Egli in neue Bereiche der medizinischen Mikrobiologie vor. «Das Fachgebiet erneuert sich gerade stark», freut er sich. Die «grossartigen Möglichkeiten» am Forschungsplatz Zürich waren denn auch einer der Gründe, weshalb er 2022 von Basel nach Zürich wechselte und die Leitung des Instituts übernahm. Als geborener Netzwerker ist er am neuen Arbeitsort in seinem Element. Diesen Frühling hat er dreissig Fachkolleg:innen zur ersten «paneuropäischen Konferenz über bakterielle Genomsequenzierungen» nach Engelberg geladen. Wie gesagt kann die DNA-Sequenz einer Bakterie innert Stunden eruiert werden, was die diagnostischen Möglichkeiten vervielfacht. Damit können zum Beispiel das Infektionsgeschehen und die Bildung von Resistenzen in nie gekannter Präzision abgebildet werden, vorausgesetzt, die Genomdaten werden möglichst breit ausgetauscht. Wie diese Zusammenarbeit auf europäischer Ebene beschleunigt werden kann, war das grosse Thema der Konferenz. Egli hat diese Zusammenkunft aufgrund seiner Erfahrungen mit Covid-19 initiiert. «Die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig Genomdaten von Krankheitserregern sind», sagt der Mikrobiologe. Auch damals war Egli an vorderster Front dabei, als es darum ging, die Sequenzdaten von Sars-CoV-2 in der Schweiz systematisch aufzubereiten. In der Folge wurde die Datenbank SPSP (Swiss Pathogen Surveillance Platform) aufgebaut, die allen Labors und dem BAG zur Verfügung steht. Adrian Egli kommt ins Schwärmen. «Die Datenbank ist ein Erfolgsmodell und wird laufend für neue Krankheitserreger ausgebaut», freut er sich und erläutert die neuen Möglichkeiten für die personalisierte Medizin. Und dann blitzt da noch
Vielfältige Darmflora
Für weltweite Schlagzeilen sorgte Adrian Egli vor einem Jahr mit dem Projekt für einen Tresor für Darmbakterien. Dabei geht es darum, die Diversität menschlicher Bakterien für die Nachwelt zu erhalten, ähnlich den Samen wichtiger Nahrungspflanzen, die in Biobanken konserviert werden. Unterdessen lagern in den Kühlkästen im Untergeschoss des Instituts für Medizinische Mikrobiologie rund 2000 Stuhlproben bei minus 80 Grad. Die Darm-Mikrobiome stammen aus Ländern der ganzen Welt, darunter Äthiopien, Brasilien, Thailand oder der Schweiz.
Hintergrund des Projekts «Microbiota Vault», die Egli zusammen mit Pascale Vonaesch von der Universität Lausanne und Nicholas Bokulich von der ETH Zürich lanciert hat, ist der Rückgang der mikrobiellen Vielfalt der Darmflora. Als eine der ersten hat die venezolanische Mikrobiologin Maria Gloria Dominguez-Bello entdeckt, dass die Diversität der Darmflora je nach Wohnort und Umgebung der Menschen unterschiedlich ist und beispielsweise bei den Indigenen im Amazonas höher ist als bei Bewohnern westlicher Industriestädte. «Wir müssen diese Vielfalt bewahren, denn es könnten Arten verschwinden, die uns in Zukunft noch nützlich sein dürften», sagt Mikrobiologe Egli.
eine weitere Eigenschaft auf: seine Begabung zur Kommunikation. Dank seiner überzeugenden und mitreissenden Art ist Egli der geborene Redner –was er auch nutzt, um die Welt der Mikroben breiteren Kreisen zu vermitteln. Zum Beispiel in einem Citizen-Science-Projekt mit Schülern aus Wattwil, bei dem Proben aus der Mundflora gesammelt werden, oder in seinen Vorlesungen für die Kinderuniversität der UZH. Gerne nimmt er sich auch die Zeit für aussergewöhnliche Projekte: So hat er zusammen mit Gymnasiast:innen ein Seminar über Infektionskrankheiten in der Literatur organisiert und erläuterte die medizinischen Hintergründe der «Ballade von der Typhoid Mary» von Jürg Federspiel. Und wenn Medizinstudierende anfragen, ob er zur Party auflegen könnte, sagt er selbstverständlich zu.
Adrian Egli, aegli@imm.uzh.ch
Was es dazu braucht

In der Kindheit wird das Fundament für ein gutes Leben geschaffen. Gleichzeitig sind Kinder und Jugendliche heute mit vielen Herausforderungen und Erwartungen konfrontiert. Was braucht es, um diese erfolgreich zu meistern und gesund und glücklich gross zu werden? Darüber diskutieren der Entwicklungspädiater Oskar Jenni und die Neuropsychologin Nora M. Raschle im Talk im Turm.
Es diskutieren:
Dienstag, 4. Februar 2025
18.15 bis 19.30 Uhr
Restaurant UniTurm, Rämistrasse 71, 8006 Zürich Türöffnung 1.45 Uhr
Der Talk im Turm ist eine Koproduktion von UZH Alumni und UZH Kommunikation.
Entwicklungspsychiater
Entwicklungspädiater
Prof. Oskar Jenni
Neuropsychologin
Prof. Nora M. Raschle
Moderation:
Thomas Gull und Rita Ziegler, UZH Kommunikation
Anmeldung unter: www.talkimturm.uzh.ch
Eintritt (inklusive Apéro): CHF 45
Mitglied bei UZH Alumni: CHF 30
Studierende: CHF 20
Platzzahl beschränkt, Anmeldung erforderlich
EVOLUTIONÄRE ANTHROPOLOGIE
Bei Weissbüschelaffen dauert die Entwicklung der Gehirnregionen, die soziale Interaktionen verarbeiten, unerwartet lange. Sie erstreckt sich – ähnlich wie beim Menschen – bis ins frühe Erwachsenenalter. Das Gehirn von Primaten wird durch verschiedene Einflüsse in der Entwicklung geprägt. Diese unterscheiden sich jedoch zwischen Menschenaffen und Affen mit gemeinschaftlicher Jungenaufzucht wie etwa den Weissbüschelaffen. Bei

Letzteren helfen von Geburt an andere Gruppenmitglieder massgeblich, die Jungen grosszuziehen, ganz wie bei Menschen. Wie sich solche sozialen Interaktionen auf die Gehirnentwicklung der Weissbüschelaffen auswirken, untersuchten internationale Forschende unter der Leitung von Paola Cerrito vom Institut für Evolutionäre Anthropologie der Universität Zürich.
Das Forschungsteam analysierte die Hirnentwicklung mit Magnetresonanztomografie-Daten und konnte zeigen, dass Gehirnregionen, die an der Verarbeitung sozialer Interaktionen beteiligt sind, bei Weissbüschelaffen ähnlich wie beim Menschen eine verlängerte Entwicklungszeit aufweisen. Sie erreichen ihre Reife erst im frühen Erwachsenenalter, was längere Phasen des Lernens aus sozialen Interaktionen ermöglicht. Aufgrund der Parallelen zur Gattung Homo sind Weissbüschelaffen wichtige Modelle für die Untersuchung der
Evolution von sozialer Kognition. «Unsere Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig soziale Erfahrungen für die Gestaltung der neuronalen und kognitiven Netzwerke sind, nicht nur bei Affen, sondern auch beim Menschen», erklärt Cerrito.
Verschiedene Theorien gehen davon aus, dass Menschen mit einem höheren Selbstwertgefühl in der Regel auch befriedigendere sexuelle Beziehungen haben und dass sich beides gegenseitig beeinflusst. Bisher wurde jedoch wenig untersucht, wie sich diese Wechselwirkung im Lauf der Zeit entwickelt. Eine neue Studie, die auf einer repräsentativen Stichprobe von über 11000 deutschen Erwachsenen basiert, liefert hierzu interessante Erkenntnisse. In dieser Studie haben Forschende der Universitäten Zürich und Utrecht Daten analysiert, die über einen Zeitraum von zwölf Jahren erhoben wurden. «Menschen mit einem höheren Selbstwertgefühl neigen dazu, nicht nur häufiger sexuell aktiv zu sein, sondern auch eine grössere Zufriedenheit mit ihren sexuellen Erlebnissen zu empfinden», erklären die Autorinnen Elisa Weber und Wiebke Bleidorn vom Psychologischen Institut der UZH.
Zudem zeigten sich signifikante Zusammenhänge über die Zeit: Veränderungen in der sexuellen Zufriedenheit führten zu Veränderungen im Selbstwertgefühl einer Person, und umgekehrt. Die Erkenntnisse über die dynamische Wechselwirkung zwischen Selbstwertgefühl und sexuellem Wohlbefinden werden durch Theorien gestützt, die den Selbstwert als eine Art soziales Messinstrument betrachten. Dieses Messinstrument gibt an, wie sehr wir uns in unseren Beziehungen zu anderen Menschen akzeptiert und wertgeschätzt fühlen. Positive Erfahrungen in sozialen und intimen Beziehungen können das Selbstwertgefühl steigern, während negative Erfahrungen als eine Art Warnsignal für soziale Ablehnung interpretiert werden und sich langfristig in einem niedrigeren Selbstwertgefühl niederschlagen. Gleichzeitig sind Menschen mit einem hohen Selbstwertgefühl möglicherweise besser in der Lage, ihre Wünsche und Präferenzen gegenüber intimen Partner:innen zu kommunizieren, was sich langfristig in einem höheren sexuellen Wohlbefinden niederschlägt.
Ausführliche Berichte und weitere Themen: www.media.uzh.ch
IM FELD — Archäologe Martin Mohr

Seit 53 Jahren wird auf dem Monte Iato südwestlich von Palermo gegraben und geforscht. Martin Mohr ist seit 25 Jahren mit dabei und mittlerweile Ausgrabungsleiter.
Letztes Jahr erhielt er die Ehrenbürgerschaft von San Cipirello.
Der Monte Iato ist ein geschichtsträchtiger Ort. Hier findet man die Hinterlassenschaften der lokalen Bevölkerung, die im Laufe der Jahrhunderte mit der griechischen, punischen (Karthago) und später mit der römischen Kultur in engem Kontakt stand. «Es ist faszinierend, anhand der archäologischen Funde dem Leben der auf dem Berg ansässigen Bevölkerung über rund 2000 Jahre nachspüren zu dürfen», erzählt Martin Mohr vom Institut für Archäologie der UZH.
Die Wochen der jährlichen Grabungs- und Forschungsarbeiten am Monte Iato sind sehr intensiv. Der Arbeitstag beginnt morgens um sieben. Gemeinsam fahren «gli Svizzeri» und die lokalen Arbeiter aus San Cipirello voller Tatendrang auf den Berg. «Die Studierenden können viel von den
routinierten Grabungsarbeitern lernen», sagt Mohr. Diese seien besonders stolz auf die Ausgrabungen, schliesslich helfen sie mit, die Geschichte ihrer Vorfahren freizulegen. Hand in Hand wird den ganzen Tag gearbeitet. Am Abend werden dann die Funde des Tages gereinigt, restauriert, bestimmt, dokumentiert und archiviert. Zurück in Zürich, erfolgt die wissenschaftliche Aufarbeitung der Funde. Diese spiegeln die Lokalgeschichte, die zugleich der Schauplatz von Weltgeschichte war. Wie die Kriege zwischen Rom und Karthago oder die Eroberung Siziliens durch die Araber.
Um das Puzzle des Lebens auf dem Monte Iato Stück für Stück zusammenzufügen, werden verschiedene wissenschaftliche Methoden eingesetzt. Neben den «traditionellen» archäologischen, wie etwa der Analyse von Keramik und Architektur, spielen auch naturwissenschaftliche Untersuchungen eine wichtige Rolle, etwa 3D-Rekonstruktionen oder die mit der ETH Zürich durchgeführte C14-Datierung von Tierknochen. Damit kann das Alter von organischen Materialien bestimmt werden.
Mittels biochemischer Untersuchungen von organischen Rückständen in Tongefässen können sogar Spuren von Lebensmitteln nachgewiesen werden. So konnte gezeigt werden, dass an Festen auf dem Monte Iato um 500 v. Chr. neben Wein auch bierähnliche Getränke konsumiert wurden. Dieser Nachweis von Bierkonsum wird durch einen Fund bestätigt, der rund 300 Jahre später datiert: Im Wandverputz einer Mauer sind «Graffiti» erhalten, darunter ein Mann mit einem Strohhalm im Mund. Mohr erklärt, dies sei ein bildlicher Hinweis auf Bierkonsum. Die literarische Überlieferung und ethnologische Untersuchungen belegen, dass in der Antike Bier mit einem Strohhalm getrunken wurde. Leider ist die weitere Finanzierung des Forschungsprojekts am Monte Iato nicht einfach. «Ich werde aber alles daransetzen, die Arbeit hier fortzuführen», betont Martin Mohr. Denn auch nach 53 Jahren ist erst ein Bruchteil dieser archäologischen Fundgrube erforscht. Seit zwei Generationen wird am Monte Iato gegraben. Doch es gibt noch viel zu entdecken. Der Berg auf Sizilien wird noch weitere Generationen beschäftigen. Mia Catarina Gull
Vertrauensvolle Eltern, digitale Spielwiesen, inspirierende Vorbilder, gerechtere Schulen, eine gewaltlose Zukunft und ab und zu Krummeluse-Pillen wie Pippi Langstrumpf: Im Dossier beleuchten wir mit UZH-Forschenden aus verschiedenen Disziplinen, was Kinder und Jugendliche benötigen, um gut aufzuwachsen.
Fischen, sich verkleiden, Freundinnen treffen: Fotografin Diana Ulrich hat Kinder und Jugendliche bei ihrer Lieblingsbeschäftigung porträtiert.

Ella (12) liebt es, eigene Fantasy-Masken zu kreieren. Ist eine Maske fertig, inszeniert sie sich damit in der Natur und macht ein Handyvideo für ihren Youtube-Kanal.
DOSSIER — Glücklich gross werden
Eltern können nur beschränkt beeinflussen, wie sich ihre Kinder entwickeln. Damit sie sich gut entfalten können, brauchen Kinder vor allem das Gefühl von Sicherheit und Vertrauen. Vieles andere machen sie von sich aus.
Text: Roger Nickl
Was brauchen Kinder, um glücklich gross zu werden? Moritz Daums Antwort auf diese grosse Frage ist kurz und prägnant: eine Schaufel und Schokolade. Die Schaufel steht sinnbildlich für das spielerische Lernen und die motorischen und kognitiven Werkzeuge, die sich Kinder aneignen müssen, um sich im Leben gut zurechtzufinden – zuallererst die Sprache, um sich verständlich zu machen, die Welt zu verstehen und Gefühle zu äussern. Dazu gehören aber auch die Fähigkeiten, sich selbst zu regulieren und aufmerksam zu sein, ohne sich ständig ablenken zu lassen. Die Schokolade steht dagegen für die guten Gefühle, die wichtig sind fürs zufriedene Aufwachsen. Wenn wir Schokolade essen, schüttet unser Körper Endorphine, Glückshormone, aus. «Im übertragenen Sinn heisst das, Kinder brauchen emotionale Sicherheit», sagt Moritz Daum, «sie sollten in guten Beziehungen gross werden, in denen ihnen Vertrauen geschenkt wird und in denen sie anderen vertrauen können.» Wird der Rucksack in der Kindheit grosszügig mit Vertrauen gepackt, so ist das eine gute Voraussetzung für eine schöne Reise durchs Leben.
Moritz Daum erforscht am Psychologischen Institut und am Jacobs Center for Productive Youth Development der UZH, das er als Direktor leitet, wie Kinder sich entwickeln und wie sie ihre Potenziale möglichst ausschöpfen können. Und er ist Mitautor des Buchs «Kindheit. Eine Beruhigung», das diesen
Frühling erschienen ist und es in kurzer Zeit auf die Sachbuch-Bestsellerliste des Nachrichtenmagazins «Der Spiegel» geschafft hat. Das Buch richtet sich an eine breite Leserschaft. Geschrieben hat es ein Autor:innenkollektiv, zu dem Forschende der UZH aus ganz verschiedenen Disziplinen gehören. Von Natur aus neugierig
Eltern haben einen grossen Bedarf an Wissen und es besteht viel Unsicherheit, hat Entwicklungspsychologe Daum festgestellt. Nach Vorträgen zur kindlichen Entwicklung, die er regelmässig hält, kommen immer wieder die gleichen besorgten Fragen: Welcher Erziehungsstil ist der richtige? Wie viel Freiheit braucht mein Kind? Und wie viel Förderung? «Kindheit. Eine Beruhigung» beleuchtet diese und viele andere
«Eltern können den Lebensweg ihrer Kinder weder kontrollieren noch bestimmen.» Oskar Jenni, Entwicklungspädiater
Fragen aus wissenschaftlicher Perspektive. In zwei Kapiteln thematisiert das Buch auch, was Kinder glücklich macht oder was gute Eltern auszeichnet. Allgemeingültige Rezepte dafür gibt es allerdings keine. «Wir wollten keine Ratgeberliteratur mit erhobenem Zeigefinger schreiben, sondern zum Nachdenken anregen, wie eine gute Kindheit gelingen könnte», sagt Moritz Daum. Das Beruhigende dabei: Eltern können sich da etwas zurücklehnen.
Denn ihr Einfluss auf die Entwicklung ihrer Kinder ist zwar nicht zu unterschätzen, er ist aber auch nicht so gross, wie sie zuweilen annehmen. Kinder sind intrinsisch motiviert und von Natur aus neugierig – vieles machen sie von sich aus. Studien haben gezeigt, dass Eltern nur zu rund 50 Prozent zum Lebenserfolg ihrer Kinder beitragen, die anderen 50 Prozent macht die Genetik aus. «Eltern können den Lebensweg ihrer Kinder weder kontrollieren noch bestimmen», sagt Entwicklungspädiater Oskar Jenni.
Und sie sollten sich auch nicht für alles verantwortlich fühlen. «Sie haben beispielsweise nicht die Aufgabe, mit ihren Kindern Schulstoff durchzuackern, dafür ist die Schule zuständig», sagt Jenni, «Eltern sollten vor allem auf der Beziehungsebene präsent sein.» Anders gesagt: Sie sind vor allem für die «Schokoladenseite» der kindlichen Entwicklung zuständig. Eine gute, vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern ist für ein Kind entscheidend, besonders wenn es an einer Entwicklungsstörung wie zum Beispiel ADHS oder Legasthenie leidet und deshalb Mühe in der Schule hat. Das weiss Oskar Jenni aus der Praxis.
WAS ES BRAUCHT
schende der ZLS dokumentieren und analysieren seit 1954 die Entwicklung von Menschen von der Kindheit bis ins Alter und arbeitet aktuell mit dem UZH-assoziierten Marie Meierhofer Institut für das Kind zusammen. In einer Untersuchung haben Wissenschaftler:innen des Instituts den Lebensverlauf von Menschen, die in den 1950er-Jahren in einem der Zürcher Säuglingsheime aufwuchsen, mit solchen der ZLS, die in einer Familie gross wurden, verglichen. Die Heimkinder wurden zwar angemessen körperlich gepflegt, sie erfuhren aber weniger emotionale Zuwendung als die Kinder der Vergleichsgruppe. Dieser Mangel hatte weitreichende Folgen. Sie führten im Durchschnitt ein schlechteres Leben: Sie waren weniger zufrieden, kämpften öfter mit psychischen Problemen und starben früher als die ehemaligen Familienkinder.
Eltern sollten für ihre Kinder wie ein Baugerüst sein. «Sie sollten ihnen Halt und Orientierung geben, ihnen gleichzeitig aber auch genug Freiräume lassen und sie nicht zu stark einengen, damit sie wachsen und gedeihen können», sagt Entwicklungspsychologe Moritz Daum.
Der Entwicklungspädiater hat das Buchprojekt «Kindheit. Eine Beruhigung» initiiert und beschäftigt sich als Forscher und Arzt am Kinderspital Zürich intensiv mit dem gesunden Aufwachsen, aber auch mit Problemen und Störungen in der Entwicklung von Kindern. Um gesund aufwachsen zu können, müssen zuerst die kindlichen Grundbedürfnisse gedeckt sein, sagt Jenni. Kinder sollen gut ernährt und körperlich gesund sein können, sie brauchen liebevolle Bezugspersonen, die Möglichkeit, im freien Spiel viele Erfahrungen zu sammeln und zu lernen, aber sie benötigen auch Orientierung und Struktur und nicht zuletzt stabile Gesellschaften, in denen sie leben und aufwachsen. «In kriegsgeplagten Regionen wie aktuell dem Nahen Osten oder der Ukraine können Kinder nicht glücklich gross werden», sagt Oskar Jenni. Die fünf «V»
Für den Entwicklungspädiater ist klar: Gute und vertrauensvolle Beziehungen in der Kindheit zu erfahren, ist auch für die Lebensqualität und -zufriedenheit im Erwachsenenalter das A und O. «Sie sind noch wichtiger als Intelligenz und Bildung», sagt Jenni. Eine Voraussetzung für das Wohlbefinden des Kindes sei auch die Beziehungsqualität zwischen den Eltern. Die Partner:innen sollten beispielsweise nicht nur darüber diskutieren, wie sie den Alltag organisieren – etwa wer die Kleinen von der Krippe abholt und wer das Nachtessen kocht –, sondern auch über ihre ganz eigenen Vorstellungen, Wünsche und Träume reden. «Sie sollten darauf schauen, dass es ihnen selbst gut geht», sagt Jenni, «das ist extrem wichtig.» Für die Paare selbst, aber auch für die Kinder. Wie entscheidend die Beziehungen zwischen Kindern und Eltern für die Biografie sind, zeigen auch Untersuchungen der Zürcher Longitudinalstudien (ZLS), die Jenni leitet. For-
Den Heimkindern fehlte eines oder mehrere der fünf «V», wie sie Oskar Jenni nennt – fünf essenzielle Faktoren, die die emotionalen und sozialen Bedürfnisse von Kindern decken und ihnen Selbstvertrauen geben. Eltern, Grosseltern oder andere wichtigen Menschen sollten gemäss den fünf «V» vertraut, verlässlich, verfügbar, verständnisvoll und voller Liebe sein. «Sie sollten präsent, dem Kind zugewandt und in ihren Handlungen voraussehbar sein – das gibt dem Kind das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit», sagt Jenni. Und eben verständnisvoll: Das heisst, sie sollten versuchen, die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes zu erkennen und zu verstehen. Und sie sollten versuchen, adäquat darauf zu reagieren. Dies bedeutet wiederum, dass sie ihre eigenen Vorstellungen und Erwartungen mit den Eigenschaften und Fähigkeiten der Kinder in Einklang bringen. «Nicht jedes Kind ist beispielsweise intellektuell begabt und schafft das Gymi», sagt Oskar Jenni, «es hat dafür vielleicht kreative oder soziale Stärken.»
Klettertürme und Baugerüste
Tatsache ist, dass sich Kinder von Natur aus sehr verschieden entwickeln – eine verbindliche Norm gibt es nicht. Dies haben die ZLS in den letzten Jahrzehnten deutlich gezeigt. Zufrieden und glücklich sind Kinder dann, wenn ihre ganz eigenen Fähigkeiten und Bedürfnisse mit den Anforderungen, die an sie gestellt werden, zusammenpassen. Wenn es zwischen Kind und Umwelt einen «Fit» gibt, wie dies Remo Largo, Oskar Jennis Vorgänger, genannt hat.
Die Forschung hat auch deutlich gemacht, dass Kinder am besten gross werden können, wenn sie bei Aufgaben, die sie noch nicht selbst lösen können, unterstützt und kontrolliert werden, aber dort Freiräume bekommen, wo sie bereits kompetent sind. «Nehmen wir zum Beispiel ein dreijähriges Kind, das einen Kletterturm besteigen will», sagt Oskar Jenni. Ob das Kind bis nach ganz oben kommt oder nicht, hängt von seinen individuellen Fähigkeiten ab. Während die einen kaum über die erste Sprosse hinauskommen, kraxeln andere relativ
DOSSIER — Glücklich gross werden
Eltern erziehen ihre Kinder weltweit unterschiedlich. Im «World Parenting Survey» untersuchen Forschende der UZH, wie sie dies tun.
Text: Roger Nickl
Wie Eltern ihre Kinder erziehen, hängt von ihnen selbst ab – und von der Kultur und der Gesellschaft, in der sie leben. Stehen dort beispielsweise Gehorsam und Pflichterfüllung an oberster Stelle und sind diese Tugenden auf dem Arbeitsmarkt gefragt, dann sind Eltern eher streng und autoritär. Sie bringen ihren Kindern bei, dass Gehorsam und Pflichterfüllung das Aller wichtigste sind und bereiten sie so bestmöglich auf das Leben als Erwachsene vor.
Ganz anders prägt die Kultur den Erziehungsstil etwa in den stark wettbewerbsorientierten USA, wo jeder seines eigenen Glückes Schmied ist. «Vor allem in Bildungskreisen umschwirren Eltern ihre Kinder dort permanent, kontrollieren und pushen sie», sagt Ulf Zölitz. In einer gross angelegten Studie,
dem World Parenting Survey, haben Zölitz und sein Team am Jacobs Center for Productive Youth Development der UZH von Oktober 2022 bis Februar 2023 die Erziehungsstile von rund 48000 Eltern in 42 Ländern weltweit analysiert und miteinander verglichen. Zölitz ist Ökonom und forscht am Jacobs Center und am Department of Economics der UZH zu Entwicklungsfragen von Kindern und Jugendlichen.
In ihrer Studie unterscheiden die Forschenden drei Erziehungsstile – autoritär, autoritativ und permissiv. Autoritär ist ein Erziehungsstil, der auf dem diktatorischen Prinzip von verbaler und physischer Bestrafung beruht. Der autoritative oder demokratische Erziehungsstil versucht Kindern dagegen zu erklären, weshalb sie etwas dürfen oder eben nicht. Er respektiert die Meinung und die Wünsche des Kindes, setzt aber auch begründete Grenzen. Eltern, die eine permissiven Erziehungsstil pflegen, sind nachgiebiger und haben generell Mühe damit, ein Kind zu disziplinieren. Wie die Wissenschaftler zeigen konnten, leben die meisten Eltern, die permissiv erziehen, in den Niederlanden und in Finnland. Der autoritative Erziehungsstil ist in Europa, aber auch in nord und südamerikanischen Ländern weit verbreitet. «Wohlfahrtstaaten, die Freiheiten zulassen und weniger kontrollieren,
mühelos zur Spitze hoch. «Auch wenn nicht ganz klar ist, ob es ihr Kind bis zur Kletterturmspitze schafft oder auf dem Weg das Gleichgewicht verliert, sollten Eltern nicht zu viel Kontrolle ausüben und Angst haben», sagt Oskar Jenni, «sie sollten das Kind machen lassen, aber da sein und helfen, wenn es herunterzufallen droht.» Die Psychologie spricht in diesem Zusammenhang auch vom «Scaffolding», das für eine positive Entwicklung wichtig ist. Eltern sollten wie ein Baugerüst (engl. Scaffold) für ihre Kinder sein. «Sie sollten ihnen Halt
begünstigen die beiden letzteren Erziehungsstile», sagt Ulf Zölitz. Besonders autoritär wird dagegen in Uganda, SaudiArabien, Indonesien und Indien erzogen. In Indien wird gemäss World Parenting Survey am meisten körperlich bestraft, gefolgt von Ländern Südostasiens und Afrikas.
Aber auch in der Schweiz werden Kinder körperlich gezüchtigt. In der Studie der UZHForschenden gaben 14 Prozent der befragten Eltern an, dies regelmässig zu tun. «Das ist eine erstaunlich hohe Zahl», sagt Ulf Zölitz. Verbreitet ist in der Schweiz die körperliche Gewalt in der Erziehung in allen Schichten. Das heisst, auch Akademikereltern rutscht ab und zu die Hand aus. Die Gründe dafür sieht Ulf Zölitz vor allem in Stress und Überforderung – vieles passiert im Affekt. «Nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit würden wir uns mehr ‹positive parenting› wünschen», sagt der Ökonom, «Eltern, die mit ihren Kindern reden, Freiheiten innerhalb von Grenzen ermöglichen und die zu verstehen versuchen, weshalb ihr Kind jetzt gerade ausrastet.»
Prof. Ulf Zölitz, ulf.zoelitz@jacobscenter.uzh.ch
und Orientierung geben, ihnen gleichzeitig aber auch genug Freiräume lassen und sie nicht zu stark einengen, damit sie wachsen und gedeihen können», sagt Entwicklungspsychologe Moritz Daum.
Dieses Gleichgewicht zwischen Freiheit und Kontrolle immer wieder neu zu finden, ist eine Kunst, in der sich Eltern während der ganzen Entwicklung ihrer Kinder üben können. Sind diese klein, geht es vielleicht darum, was man ihnen auf dem Spielplatz zutraut und was nicht, später dann im Teen

Lenny (8) hat das Fischen für sich entdeckt. Er mag alles daran: die Angelrute, die Köder, die Fische und den Kitzel, ob und wann etwas anbeisst.

July-Mae (14) ist zufrieden, wenn sie trainieren kann. Sie träumt davon, bei einem LeichtathletikWettbewerb in einem grossen Stadion als Erste über die Ziellinie zu laufen.
ageralter um die Frage, ob, wie lange und wohin sie in den Ausgang dürfen. Gelingt der Balanceakt, stärkt das das Selbstvertrauen und die Selbstsicherheit und damit wichtige Ressourcen für das spätere Leben. «Ich bin überzeugt, dass eine vertrauensvolle Erziehung Kinder und Jugendliche resilienter macht als ein rigider und autoritärer Erziehungsstil», sagt Moritz Daum (siehe Kasten Seite 30). Zu viel Kontrolle wirkt sich besonders bei Teenagern längerfristig negativ aus. «Sie verhindert die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, schwächt das Selbstwertgefühl der Jugendlichen und schränkt ihr Wohlbefinden ein», sagt Oskar Jenni. Zu wenig Kontrolle sei aber auch nicht gut.
Gerüstbauerinnen und Gleichgewichtskünstler zwischen erzieherischer Freiheit und Kontrolle – Eltern haben einen anspruchsvollen Job. «Sie müssen aber nicht perfekt sein – gut genug genügt», sagt Moritz Daum. Geprägt hat die Idee des «Good enough parenting» der englische Kinderarzt und Psychoanalytiker Donald Winnicott. «Gut genug bedeutet, Eltern
sollten für ihre Kinder da sein und ihnen Sicherheit geben – sie sollten ihnen aber auch verständlich machen, wo ihre eigenen Grenzen sind», sagt Moritz Daum. Und obwohl sie die grossen Vorbilder sind, dürfen Eltern manchmal auch Fehler machen. Das ist ein beruhigender Gedanke für die Grossen – und für die Kleinen entlastend, weil sie dann feststellen, dass niemand perfekt sein muss – zum Glück.
Prof. Moritz M. Daum, moritz.daum@uzh.ch
Prof. Oskar Jenni, oskar.jenni@kispi.uzh.ch
LITERATUR: Oskar Jenni (Hg.): Kindheit. Eine Beruhigung, Verlag Kein&Aber, Zürich 2024
DOSSIER — Glücklich gross werden
Jugendliche verbringen häufig viel Zeit auf Tiktok und Co. Doch die Medienforschenden
Sandra Cortesi und Daniel Süss sehen keinen Grund für Eltern, deswegen in Panik zu geraten: Social Media begleiten Jugendliche auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden und tragen oft zu ihrem Glück bei.
Text: Brigitte Blöchlinger
Vielen Eltern kennen die Szene nur zu gut: Der Teenager kommt nach Hause, verschwindet mit einem knappen «Hoi» im Zimmer und schliesst die Tür. Wenn der Vater zum Essen ruft, liegt der Nachwuchs auf dem Bett, die Augen auf das Handy fixiert, und knurrt, er komme gleich. Was er nicht tut. Seit den 2010er-Jahren spielen Social Media im Alltag von Jugendlichen eine bedeutende Rolle. Tiktok, Instagram,
Whatsapp, Youtube, Pinterest und Snapchat nehmen oft so viel Lebenszeit ein, dass es den Eltern bange wird. Sie fragen sich: Kann ein junger Mensch mit so viel Social Media überhaupt glücklich und zufrieden gross werden? Wie berechtigt sind die Sorgen derjenigen, die oft noch «offline» aufgewachsen sind und für die Plattformen wie Snapchat und Tiktok fremd und schwer zugänglich wirken? Oder positiv gefragt: Wie können Social Media dazu beitragen, dass aus Jugendlichen glückliche junge Erwachsene werden? Antworten darauf liefern die Medienwissenschaftlerin Sandra Cortesi und der Medienpsychologe Daniel Süss. Sie forschen seit vielen Jahren zur Social-Media-Nutzung von Jugendlichen und binden die jungen Menschen aktiv in Studien und Workshops ein. Aktiv gestalten und sich einbringen
Sandra Cortesi, Jahrgang 1983, hat Technologie von klein auf Spass gemacht. «Ich hatte das grosse Privileg, als eine der Ersten einen Internetzugang zu haben, mit dem ich aus der Ostschweiz in die Welt hinaus kommunizierte.» Sie ist eine weltweit vernetzte Forscherin, Faculty Associate am Berkman
Klein Center for Internet & Society der Harvard University und Oberassistentin am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der UZH. Dort untersucht sie unter anderem den Mediengebrauch von 12- bis 18-Jährigen –in der Schweiz, den USA, Südamerika, Afrika und Asien. In der Schweiz seien Social Media unter jungen Menschen auch deshalb so präsent, weil der Alltag stark digitalisiert ist, sagt Cortesi. Rund 95 Prozent der Schweizer Jugendlichen haben Zugang zum Internet und besitzen ein Smartphone. Trotz dieser allgegenwärtigen Digitalisierung sollten Eltern jedoch nicht den Eindruck gewinnen, dass ihr Einfluss schwindet. «Wenn Eltern möchten, dass ihr Kind beispielsweise freundlich, rücksichtsvoll und zuverlässig ist, sollen sie diese Werte auch weiterhin vermitteln», sagt Cortesi. Werte sind nicht nur im analogen Zusammenleben, sondern auch digital wichtige Leitplanken.
ChatGPT zwei Begriffe kombinieren lassen, die vordergründig nichts miteinander zu tun haben, wie beispielsweise Ordnung und Chaos. Das kann Spass machen und überrascht mit neuen Impulsen, sagt Sandra Cortesi.
WAS ES BRAUCHT
Für viele Jugendliche sind Social Media und Apps so attraktiv und wichtig, weil sie eine ideale Spielwiese bieten, um Ideen einfach mal auszuprobieren. Auch komplexe Konzepte wie divergentes Denken können sie hier unbeschwert erkunden. «Das kann Spass machen und überrascht mit neuen Impulsen», sagt Medienforscherin Sandra Cortesi.
Cortesi ist überzeugt, dass auch Jugendliche, die viele Stunden online verbringen, glücklich sein können. Ein gutes Lebensgefühl hängt für die Forscherin nicht primär von der Bildschirmzeit ab, sondern ist vielmehr das Resultat einer aktiven und bewussten Lebensgestaltung. «Sowohl in der Offline-Welt als auch in den Social Media ist es wichtig, sich aktiv einzubringen, etwa indem man Posts kommentiert, kreativ ist, neue Dinge lernt oder sich in einer Community engagiert.»
Divergentes Denken erproben
Wenn der Social-Media-Konsum ihrer Kinder überhandzunehmen droht, können Eltern entgegenwirken, indem sie das Thema offen ansprechen, so Cortesi. Sie können beispielsweise ihre Kinder dazu ermutigen, Social Media als Plattform für kreative Projekte zu nutzen, statt nur passiv Inhalte zu konsumieren. Viele Jugendliche interessieren sich für spezifische Themen oder möchten an gesellschaftlichen Debatten teilhaben. Eltern können Jugendliche dazu anregen, Social Media gezielt als Lern- und Diskussionsplattform zu brauchen. Sie können aber auch kritische Punkte einbringen und mit ihren Kindern über die Geschäftsmodelle und die von Meta, Alphabet und Co. entwickelten Algorithmen sprechen. Wenn Jugendliche verstehen, dass Plattformen wie Tiktok, Instagram, Youtube darauf ausgelegt sind, ihre Aufmerksamkeit möglichst lange zu binden, entwickeln sie eher Strategien, um sich davon abzugrenzen. Selbst als Vorbild zu agieren, sich mit Social Media auseinanderzusetzen und die Themen offen zu diskutieren – das ist laut Cortesi der beste Weg, um Jugendliche langfristig zu befähigen, ihre Social-Media-Nutzung eigenverantwortlich zu gestalten.
Für viele Jugendliche sind Social Media und andere digitale Technologien so attraktiv und wichtig, weil sie eine ideale Spielwiese sind, um Ideen einfach mal auszuprobieren. Auch komplexe Konzepte wie divergentes Denken können sie hier unbeschwert erkunden – etwa indem sie mithilfe von
Auf Online-Plattformen können junge Menschen das tun, was sie am liebsten tun, sagt auch der Medienpsychologe Daniel Süss: mit Freund:innen kommunizieren, sich vernetzen, Informationen zu ihren Fragen finden, gamen, mit Fotos und Videos kreativ sein und Musik hören. Social Media eröffnen Jugendlichen unzählige alternative Welten zu ihrem Daheim – «das macht es für die Eltern anstrengender, ihren Kindern die eigenen Werthaltungen näherzubringen», so Süss. Doch resignieren müssen sie deswegen nicht. In der Schweizer Langzeitstudie «JAMES», die Süss an der ZHAW mitleitet, haben die Jugendlichen angegeben, dass ihnen ihr direktes Umfeld – Freund:innen, die Familie, die Gemeinde – nach wie vor sehr wichtig ist. Auch verbinden sich Jugendliche in ihren sozialen Netzwerken vorwiegend mit Menschen, die sie auch im Alltag treffen.Daniel Süss ist wie Sandra Cortesi von Haus aus Psychologe; als UZH-Professor hat er sich auf Mediensozialisation und Medienkompetenz spezialisiert. Wie beantwortet er die Frage, welche Social-Media-Nutzung Jugendliche dabei unterstützt, zufriedene und glückliche junge Erwach-
«Ein gutes Lebensgefühl hängt von einer aktiven Lebensgestaltung ab, nicht von der Bildschirmzeit.»
Sandra Cortesi, Medienwissenschaftlerin
sene zu werden? «Jugendliche müssen sich von den Eltern lösen und eine eigene Identität und eine selbstgewählte Community ausserhalb der Familie finden – das sind wichtige Entwicklungsaufgaben», sagt Süss. Social Media haben da viel zu bieten.
Wer bin ich, wie möchte ich werden?
Weil sich in der Pubertät der Körper der Mädchen und Jungen stark verändert, sind das Körperselbstbild und verschiedene Rollenbilder zentrale Themen für Jugendliche, sagt Süss. Dabei werden die Jugendlichen mit vielen Herausforderungen konfrontiert, die sie nicht mehr mit den Eltern besprechen wollen.
Hier springen Social Media ein. Unzählige Posts behandeln zentrale Fragen der Jugend: Wer bin ich, welche Merkmale möchte ich betonen, was machen die anderen, was finde ich doof, wo gehöre ich dazu, welche Geschlechterrolle möchte ich wahrnehmen, was für eine intime Beziehung eingehen?
Social Media bieten auch viele Möglichkeiten für «das soziale Vergleichen und das Lernen am Modell», sagt Süss. Oft ahmen Jugendliche erfolgreiche Influencer:innen nach, meist vermitteln diese westliche, amerikanische Vorstellungen von Attraktivität. Junge Mädchen zeigen sich in der Folge sexy und lasziv, Jungs möglichst muskulös und sportlich, eventuell mit Statussymbolen wie einem Motorrad oder in Challenges, um mutig zu wirken. Für ein positives Selbstbild findet es Süss wichtig, dass Jugendliche lernen, die verschiedenen Posts auf Social Media kritisch zu hinterfragen.
Doch auf Social Media finden sie auch eine Vielzahl von Gegenbewegungen, wie Body Positivity, die Vielfalt und Unterschiedlichkeit als schön inszenieren. «Das sind zwar keine
«Jugendliche finden oft selbst, dass sie zu viel Social Media konsumieren und etwas dagegen tun müssen.»
Daniel Süss, Medienpsychologe
Mainstream-Influencer:innen, aber wenn Jugendliche dazu was suchen, finden sie auf Social Media einfacher als früher Alternativen», so Süss. Dass Eltern die freizügigen Posen im bauchfreien Top mit Ausschnitt nicht gut finden und sich darüber aufregen, ist Teil des Spiels: «Die Eltern erleichtern es dem Jugendlichen mit ihrem Widerstand, sich von ihnen abzugrenzen», sagt Süss. Eltern sollten diese Phase des Suchens und Ausprobierens einer eigenen Identität mit einer gewissen Gelassenheit und mit Wohlwollen begleiten und sich abwertende Kommentare verkneifen, empfiehlt er. «Digital Life Balance» finden
Um für die Macht der Bilder zu sensibilisieren, haben Daniel Süss und sein Forschungsteam an der ZHAW ein Übungsset für Zehn- bis Zwölfjährige entwickelt. Anhand von Fotos beliebter Influencer:innen werden den Jungen und Mädchen die verschiedenen Manipulationsmöglichkeiten gezeigt, die ein durchschnittliches Sujet in ein eindrückliches Bild verwandeln. Die Schulung im bewussten Umgang mit Bildern soll die Teenager befähigen, adäquate Bilder von sich oder ihren
Freund:innen auf Social Media zu teilen. Gleichzeitig geht es darum, dass sie sich überlegen, welche Bilder ihnen guttun und wie sie sich von verstörenden Bildern und Inhalten abgrenzen können. Das Übungsset wird derzeit in Schulklassen in der Deutschschweiz und in Baden-Württemberg erprobt. Im mittleren Jugendalter werden Teenager mit der Frage konfrontiert, ob sie eine Berufslehre oder eine weiterführende Schule machen sollen. In dieser Umbruchsphase suchen die Jugendlichen auf Social Media häufig auch nach Tipps, Unterstützung und Inspiration für die nächsten Schritte, sagt Süss. Doch egal, welche Themen gerade im Vordergrund stehen, es gilt für die Jugendlichen, einen positiven Umgang mit digitalen Medien zu finden, eine gute «Digital Life Balance». Und das versuchen sie auch, wie die Interviews im Forschungsprojekt «Generation Smartphone» gezeigt haben. «Jugendliche finden oft selbst, dass sie zu viel Social Media konsumieren und sie etwas dagegen tun müssen», sagt Süss. Dass Jugendliche ihren Konsum selbst zu regulieren versuchen und zum Beispiel vor Prüfungen bestimmte Profile stummschalten, ist ideal, sagt Süss. Mit zunehmender Erfahrung, wie man nach gelegentlichen «Exzessen» wieder zu einer gesunden Social-Media-Dosis gelangt, eignen sich die Jugendlichen ein resilientes Konsumverhalten an. Sie finden heraus, wie sie persönlich den Alltag verändern können, um wieder mehr Selbstkontrolle zu erlangen. Und wenn es mal nicht funktioniert, trainieren sie Toleranz im Umgang mit Misserfolgen oder Fehlern. «Diese Fähigkeit, sich nicht unterkriegen zu lassen, und zu wissen, es gibt Möglichkeiten und Schritte, wie man Krisen überwinden kann, ist eine sehr wichtige Ressource, um glücklich zu werden», sagt Süss.
Social Media werden bleiben
Auch Sandra Cortesi findet, dass junge Leute von Social Media fürs Leben profitieren können. Kompetenzen in siebzehn Bereichen hat sie herausgearbeitet, die Jugendliche bei der Nutzung von Social Media entwickeln. Hinzu kommen kritisches Denken, Zusammenarbeit, Kommunikation und Kreativität – Fähigkeiten, die sowohl in der digitalen als auch in der analogen Arbeitswelt gefragt sind. Für die Medienwissenschaftlerin ist klar: Social Media wandeln sich, aber sie werden nicht so schnell verschwinden.
Deshalb sollten die Erwachsenen Jugendliche aktiv in die Entwicklung von Leitlinien zur Social-Media-Nutzung einbeziehen. «Wir müssen junge Menschen auf eine ehrliche, qualitativ hochwertige und ernstzunehmende Weise in unsere digitalisierte Gesellschaft einbinden», betont Cortesi.
Dr. Sandra Cortesi, s.cortesi@ikmz.uzh.ch
Prof. Daniel Süss, d.suess@ikmz.uzh.ch
DOSSIER — Glücklich gross werden
Kinder brauchen Stimulation und Zuwendung, damit sich ihr Gehirn entwickelt. Wenn sie vernachlässigt werden, kann das gravierende Folgen haben für ihre Gesundheit, die Fähigkeit, zu lernen und Beziehungen aufzubauen.
Text: Thomas Gull
Bilder aus rumänischen Kinderheimen erschütterten 1989 die Welt. Sie zeigen Kinder in Gitterbetten, manche angebunden, offensichtlich vernachlässigt und mit apathischen Blicken. Die Heimkinder waren ein Spiegelbild der rumänischen Gesellschaft am Ende des kommunistischen Ceausescu-Regimes, das das Land ruiniert hatte. Sie landeten in staatlichen Heimen, weil ihre Familien sie nicht ernähren konnten. Die Heime waren schlecht ausgerüstet und hatten zu wenig Personal. «Diese Kinder sind ein Beispiel für extreme Vernachlässigung», sagt die Neuropsychologin Nora Raschle, «ihnen fehlte die Nähe, die Beziehung zu anderen Menschen und die Fürsorge, die so wichtig sind für kleine Kinder.» Wegen der extremen Bedingungen wurden die rumänischen Kinderheime zu einem interessanten Feld für die Forschung.
Ab dem Jahr 2000 begleitete eine Gruppe von US-Wissenschaftler:innen im Rahmen des Bucharest Early Intervention Project (BEIP) 136 dieser Kleinkinder aus sechs Heimen in Bukarest. Zuerst wurden die Kinder untersucht und dann Pflegefamilien zugewiesen. Später wurde ihre Entwicklung verglichen mit Kindern, die nicht in Pflegefamilien gekommen waren, und mit Kindern, die nie in einem Heim gewesen waren. «Die Bukarester Heimkinder zeigten Auffälligkeiten in ihren kognitiven und sozialen Fähigkeiten und ihrer psychischen Gesundheit», resümiert Raschle, «das belegte beispielhaft, wie sich extreme frühkindliche Vernachlässigung auf die Entwicklung auswirkt.» Nora Raschle ist Neurowissenschaftlerin am Jacobs Center for Productive Youth De-
velopment der Universität Zürich. Die Assistenzprofessorin erforscht die sozio-emotionale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Sie tut dies, indem sie untersucht, wie sich das Gehirn entwickelt. Dieses ist erst im Alter zwischen 22 und 25 Jahren ausgereift. «Das ist eine sehr lange Zeit, in der die Umwelt und unsere Erfahrungen dazu beitragen, das Gehirn zu formen», sagt Raschle. Diese Einflüsse können positiv sein, auf dem weiten Weg kann aber auch einiges schieflaufen. Raschle interessiert sich für beide Seiten, typische Entwick-
«Eltern sind als Vorbilder wichtig, etwa wie sie mit Stress umgehen oder wie sie positive Beziehungen pflegen.»
Nora Raschle, Neuropyschologin
lungsverläufe und solche, die mit entwicklungsbezogenen und psychiatrischen Störungen zusammenhängen. Sie betont allerdings: «Unser heutiges Wissen über eine positive Entwicklung basiert stark auf Studien, die extrem negative Umstände untersucht haben.» Wie etwa jene zu den Bukarester Heimkindern.
Lallen und gestikulieren
Eine wichtige Rolle spielt die frühe Entwicklung des Gehirns, weil da die Bausteine für die spätere Ausdifferenzierung und das Verhalten gelegt werden. Raschle vergleicht diese frühe Phase mit dem Fundament eines Turms. Wenn dieses nicht stabil ist, fällt der Turm später möglicherweise in sich zusammen. Doch was brauchen Kleinkinder, damit sich ihr Gehirn
gut und gesund entwickelt? Zuwendung und Anregung, lautet die Antwort der Forschung. Und Kinder brauchen Orientierung und Strukturen, an die sie sich halten können. Wobei es sich dabei um ein Geben und Nehmen zwischen dem Kind und den Personen handelt, die es betreuen. Dafür wurde der Begriff «Serve and Return» geprägt. Er stammt aus dem Tennisvokabular und kann mit «Aufschlag und Rückgabe» übersetzt werden. So initiieren Kleinkinder den Austausch durch Lallen, Mimik, Gesten und Worte, Erwachsene reagieren darauf ebenfalls mit Mimik und Worten. Mit diesem Hin und Her entwickeln und verifizieren die Kinder ihre kognitiven und emotionalen Fähigkeiten.
werden. Und der Dauerstress bringt den Cortisolhaushalt durcheinander, was zu Angststörungen, Depressionen und HerzKreislaufProblemen führen kann. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute ist: Je früher erkannt wird, dass Kinder vernachlässigt werden, desto grösser ist die Chance, dass schwere Langzeitfolgen vermieden werden können.
WAS ES BRAUCHT
Kleinkinder initiieren den Austausch mit Erwachsenen durch Lallen, Mimik, Gesten und Worte, Erwachsene reagieren darauf ebenfalls mit Mimik und Worten. Mit diesem Hin und Her entwickeln und verifizieren die Kinder ihre kognitiven und emotionalen Fähigkeiten. Das spiegelt sich im Gehirn, wo ständig neue Verbindungen zwischen den Hirnzellen geschaffen werden.
Das spiegelt sich im Gehirn, wo ständig Verbindungen zwischen den Hirnzellen neu geschaffen oder abgebaut werden. Wenn Kinder vernachlässigt werden, etwa indem sie keine Anregungen und keine Rückmeldungen von ihrer Umwelt erhalten, können sich diese Verbindungen weniger gut entwickeln. «Das kann zu psychischen Störungen und zu lebenslangen gesundheitlichen, kognitiven und emotionalen Problemen beitragen», sagt Raschle. So haben Erwachsene, die als Kinder stark vernachlässigt wurden, mit grösserer Wahrscheinlichkeit einen tieferen IQ oder können weniger gut Beziehungen aufbauen.
Defizite wettmachen
Wenn das Bedürfnis des Kindes nach Aufmerksamkeit und Stimulation enttäuscht wird, kann das im Extremfall toxisch sein, weil es eine übermässige Stressreaktion auslöst. Diese führt zu einer erhöhten Ausschüttung des Stresshormons Cortisol. Cortisol ist lebensnotwendig, weil es beispielsweise die Energie freisetzt, die wir brauchen, um einer Gefahr zu entfliehen. Am Morgen hilft uns die Ausschüttung von Cortisol, in die Gänge zu kommen.
Ganz anders sieht es aus, wenn wir unter Dauerstress stehen. «Wenn der Körper ständig in Alarmbereitschaft ist und das Gefühl hat, permanent ums Überleben kämpfen zu müssen, dann verändert das die Biologie», sagt Nora Raschle. So führt dieser toxische Stress dazu, dass im Gehirn neuronale Verbindungen nicht geknüpft oder bestehende gekappt
Eltern-Kind-Studie
Die SMILIESStudie des Jacobs Center for Productive Youth Development untersucht die Entwicklung der sozialen und kognitiven Fähigkeiten von Kindern und ihren Eltern. Dafür werden Familien mit Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren gesucht. jacobscenter.uzh.ch/smilies
Wie die BukarestStudie gezeigt hat, konnten Heimkinder, die früh in Pflegefamilien untergebracht wurden, die Veränderungen in der Gehirnfunktion und Defizite in der emotionalen Bindung, bei Sprache und Kognition zumindest teilweise wieder wettmachen. Die Autoren der Studie schreiben dazu: «Je früher ein Kind in einer Pflegefamilie untergebracht wurde, desto besser erholte es sich.»
Bei den Kindern der BukarestStudie handelt es sich um ein extremes Beispiel von Vernachlässigung. «Den meisten Kindern bleibt das zum Glück erspart», sagt Nora Raschle, «dank solchen Studien wissen wir aber, wie wichtig Bezugspersonen sind.» Das gilt besonders für die Eltern. Das Jacobs Center erforscht in der Langzeitstudie SMILIES deshalb die Entwicklung des Gehirns im Kontext der Familie (siehe Kasten unten). Dabei geht es um Fragen wie: «Wie ähnlich sind sich Kinder und Eltern bei der sozioemotionalen Verarbeitung?» oder «Wie entwickeln Kinder die Fähigkeit, Gefühle zu verarbeiten, zu regulieren und miteinander umzugehen?»
Für die Zukunft stärker machen
Die Eltern und andere nahe Bezugspersonen sind nicht nur zentral für die Entwicklung der kindlichen Gehirne, indem sie diese anregen. «Eltern sind auch als Vorbilder wichtig, etwa beim Umgang mit Stress oder wie man mit schwierigen Situationen fertigwird», erklärt Raschle, «und sie machen den Kindern vor, wie man positive Beziehungen lebt und Freundschaften pflegt.» So zeigen gute Vorbilder den Kindern, wie sie ihr Leben positiv gestalten können, und sie helfen ihnen, mit Widrigkeiten zurechtzukommen.
Und Eltern geben den Kindern, was sie vor allem brauchen: Liebe, Geborgenheit und Zuneigung. Das ist sehr wichtig für die sozioemotionale Entwicklung. «Positive Erlebnisse während der frühen Kindheit stärken uns für die Zukunft. Sie fördern unsere Fähigkeit, Freundschaften zu knüpfen und Partnerschaften einzugehen», sagt Raschle. Solche positiven sozialen Beziehungen sind ein wichtiges Element eines glücklichen Lebens.
Prof. Nora Raschle, nora.raschle@jacobscenter.uzh.ch

Obinna (11) hat Spass, wenn er mit dem Ball spielt. Und er hat ein Ziel vor Augen: den nächsten Korb zu werfen und Profibasketballer zu werden.
DOSSIER — Glücklich gross werden
Der Philosoph Jean-Jacques Rousseau sah im 18. Jahrhundert die Kindheit mit neuen Augen. Seine Ideen inspirierten das Denken und Schreiben von Generationen von Autorinnen und Autoren. Das kindliche Glück ist in der Literatur allerdings kaum zu finden.
Text: Roger Nickl
Vor gut 250 Jahren wurde die Kindheit neu erfunden. Verantwortlich dafür war Jean-Jacques Rousseau (1712–1778).) Der schweizerisch-französische Philosoph und Schriftsteller veröffentlichte 1762 ein Buch, das damals Furore machte und dessen Gedanken bis heute nachhallen. Rousseau richtete im 18. Jahrhundert einen völlig neuen Blick auf die erste Lebensphase eines Menschen. In «Emile oder über die Erziehung» – halb Roman, halb Sachbuch –beschreibt der Denker und Autor das Leben eines Jungen, der ohne gesellschaftliche Zwänge auf dem Land aufwächst. Er kann sich frei entfalten und lernt spielerisch ganz ohne Bevormundung und Bestrafung.
In «Emile oder über die Erziehung» (1762) –halb Roman, halb Sachbuch – beschreibt der Philosoph Jean-Jacques Rousseau das Leben eines Jungen, der ohne gesellschaftliche Zwänge auf dem Land aufwächst. Er kann sich frei entfalten und lernt spielerisch ganz ohne Bevormundung und Bestrafung. Rousseaus Ideen beflügelten Generationen von Pädagog:innen und Schriftsteller:innen.
Das Bild, das Rousseau zeichnete, stand in scharfem Kontrast zu den überlieferten Vorstellungen über Kinder und Erziehung. Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass es die Kindheit als Idee lange Zeit schlicht nicht gab. Im Mittelalter und bis in die Frühe Neuzeit galten Kinder als kleine Erwachsene, die schon früh hart arbeiten mussten. Mit der aufkommenden Aufklärung änderte sich dieses Bild allmählich: Für die Aufklärer waren Kinder zwar keine kleinen Erwachsenen mehr, sie betrachteten sie aber als unvernünftige Menschen, die durch strenge Erziehung und Belehrung zur Vernunft gebracht werden mussten – wenn nötig mit Prügel.
Kleine Genies
Rousseau sah dies anders. Er war der Erste, der die Kindheit als eigenständige Lebensphase betrachtete, die auch geschützt werden sollte, damit sich Kinder entfalten und positiv entwickeln können. Seine Ideen beflügelten fortan das Denken von Pädogoginnen und Pädagogen. Aber nicht nur das: Sie inspirierten auch viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller. «Nach
Rousseau entstand im späten 18. und 19. Jahrhundert eine ganze Flut von literarischen Texten, die sich mit der Kindheit und mit Fragen von Erziehung und Pädagogik auseinandersetzten», sagt Davide Giuriato, der sich in seiner Forschung intensiv mit dem Thema «Kindheit in der Literatur» beschäftigt hat. Noch bevor die moderne Wissenschaft Ende des 19. Jahrhunderts die Kindheit für sich entdeckt, wird die Literatur zu einer Art «Leitmedium», wo Fragen rund um das Kind gestellt und ganz unterschiedliche Ideen und Vorstellungen von Kindheit reflektiert und entwickelt werden. Diese literarische Ideenvielfalt zu beleuchten und zu analysieren, fasziniert den Wissenschaftler. «Kindheit ist eine grosse Projektionsfläche», sagt Giuriato, «wenn wir über sie sprechen, sprechen wir gleichzeitig auch über uns als Gesellschaft – das Kind ist eigentlich ein Medium der sozialen und kulturellen Selbstreflexion.» Welche Fähigkeiten brauchen wir, um ein gutes und erfolgreiches Leben zu führen? Welche Werte sind uns wichtig? Wie sollten wir die Schule einrichten? Und wie die Kinder erziehen? Das sind Fragen, die die Gesellschaft – denkt man an die allgegenwärtigen, kontroversen Diskussionen rund um Frühförderung und Schulreformen – heute noch beschäftigen. Sie widerspiegeln sich seit dem späten 18. Jahrhundert in immer neuen Facetten auch in der Literatur.
Besonders dankbar aufgenommen wurden Rousseaus Ideen im 18. und 19. Jahrhundert von Schriftstellerinnen und Schriftstellern der Romantik, etwa Novalis oder E.T.A. Hoffmann. Sie vergötterten das Kind. Für sie waren Kinder kleine Genies und der Inbegriff für spielerische Kreativität. Somit waren sie wohl auch ein Ideal für ihr eigenes schriftstellerisches Schaffen. Erziehung, nahmen die Romantiker mit Rousseau an, steht dieser natürlichen kreativen Begabung nur im Weg und verstellt sie. Nicht die Kinder sollten sich die Erwachsenen als Vorbild nehmen, sondern umgekehrt die Erwachsenen die Kinder. Dieses Denken führte in der Literatur des 19. Jahrhunderts zu einem regelrechten Kindheitskult.
Es inspirierte auch alternative Erziehungsprojekte wie die Reformpädagogik, die aus der romantischen Idee des selbsttätigen Kindes entsteht. Waldschulen und Erlebnispädagogik von heute haben dort ihre Wurzeln. «Schaut man sich die Literaturgeschichte an, stellt man fest, dass viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller Sympathien für reformpädagogische Ideen hegen», sagt Davide Giuriato. Dies zeigt sich
beispielsweise Anfang des 20. Jahrhunderts in verschiedenen berühmten Schulromanen wie Hermann Hesses «Unterm Rad» oder Robert Musils «Die Verwirrungen des Zöglings Törless». Sie thematisierten die damaligen Gymnasien als autoritäre, unheilvolle und geisttötende Disziplinierungsanstalten und kritisierten sie scharf.
Ab dem Ende des 18. Jahrhunderts entstehen auch zahlreiche autobiografische Texte, die sich mit der Kindheit beschäftigen. Und es werden Bildungsromane wie Goethes «Wilhelm Meisters Lehrjahre» oder «Anton Reiser» von Karl Philipp Moritz geschrieben, die vom Aufwachsen ihrer Hauptfiguren erzählen und diese auf dem kurvenreichen Weg ins mal mehr, mal weniger glückende Erwachsenenleben begleiten.
Karl Philipp Moritz war nicht nur Schriftsteller, sondern beschäftigte sich auch psychologisch mit der Kindheit. Genauer gesagt betrieb er «Erfahrungsseelenkunde», wie er es nannte, und gab dazu eigens eine Publikation heraus. Das «Magazin für Erfahrungsseelenkunde» war quasi die erste psychologische Zeitschrift Deutschlands – dies zu einer Zeit, als es die Psychologie als Fach noch gar nicht gab. Für das «Magazin» sammelte und dokumentierte Moritz Lebensgeschichten, darunter auch viele Geschichten von Kindern. «Die Erfahrungsseelenkunde interessierte sich fast schon wissenschaftlich für die Entwicklungsphase der Kindheit», sagt Davide Giuriato, «sie ging von der Vorstellung aus, dass Schwierigkeiten im Erwachsenenleben – psychische Probleme, Kriminalität, Gewalttätigkeit – dort ihren Ursprung haben.»
Dieser Gedanke war damals neu. Rund 100 Jahre später wurde er von der um 1900 entstehenden Psychologie und Psychoanalyse aufgenommen, weiter erforscht und auf ein modernes wissenschaftliches Fundament gestellt.
Kindheit und Kulturkritik
Irrungen und Wirrungen, Probleme mit den Eltern und in der Schule: Glücklich sind die wenigsten der Kindheiten, von denen die Literatur seit nunmehr 200 Jahren erzählt. Tragödien und Unglück scheinen literarisch einfach mehr herzugeben, hat man den Eindruck. «Kindheitsvorstellungen in der Literatur sind oft verknüpft mit einer dezidierten Kulturkritik, die das moderne Leben als defizitär ansieht», sagt Davide Giuriato. Auch in den Texten der Romantiker, die die Kindheit feierten, finde man das kindliche Glück kaum. Dafür aber ein Glücksversprechen – nämlich das Versprechen, den Weg in einen vermeintlich glücklichen Naturzustand mit Hilfe von Kindern wiederzufinden.
Von diesem Glücksversprechen ist in Romanen und Erzählungen, die im 20. Jahrhundert geschrieben werden, kaum noch etwas übriggeblieben. «Die bürgerliche Vorstellung, die die Kindheit als Schutz- und Schonraum sieht, erodiert zusehends», sagt Literaturwissenschaftler Giuriato, «dominierend ist dagegen der Blick auf beschädigte oder gar zerstörte Kindheiten.» Ganz deutlich zeigt sich dies nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs. So etwa im «Roman eines Schicksallosen» des ungarischen Schriftstellers und Literaturnobelpreis-Trägers Imre Kertesz. Kertesz beschreibt die Deportati-
on und den Lageralltag in den Konzentrationslagern Auschwitz und Buchenwald aus der Sicht eines 15-jährigen Jungen. Der Roman etablierte ein Erzählmuster, das in den 1980erund 1990er-Jahren von vielen Autorinnen und Autoren übernommen wurde, so Giuriato. Und auch in zeitgenössischen Texten wie etwa dem Roman «GRM. Brainfuck» der deutsch-schweizerischen Autorin Sibylle Berg ist die Kindheit von Gewalt und Sexualität geprägt. «Eine Geschichte, die von einer idyllischen Kindheit und von kindlichem Glück erzählt, käme heute wohl ziemlich anachronistisch daher», sagt Davide Giuriato.
Subversive Eigenlogik
Zu finden ist die kindliche Idylle vielleicht am ehesten noch in der Kinderliteratur – etwa in Astrid Lindgrens Geschichten von Pippi Langstrumpf. «In den Abenteuern der Titelheldin wird die Kindheit mit ihrer subversiven Eigenlogik grandios gefeiert und es gibt sicher auch Momente grossen Glücks», sagt Giuriato. Allerdings seien auch Astrid Lindgrens Texte nicht
«Eine Geschichte, die von kindlichem Glück erzählt, käme heute wohl ziemlich anachronistisch daher.»
Davide Giuriato, Literaturwissenschaftler
frei von einer gewissen Melancholie. So ist Pippi beispielsweise ständig davon bedroht, ins Heim gesteckt zu werden. Und dann gibt es noch die berühmte Episode mit den Krummeluse-Pillen. Die fantastischen Zaubererbsen sollen verhindern, dass Pippi und ihre beiden Freunde Annika und Thomas gross werden. «Es sind nicht nur die bösen Erwachsenen und ihre schlimmen Institutionen, die die Kindheit bedrohen», sagt Giuriato, «es ist auch der Lauf der Zeit.» Denn früher oder später hört man auf, Kind zu sein. Dann beginnt man von der Kindheit zu träumen und über sie zu schreiben.
Prof. Davide Giuriato, davide.giuratio@ds.uzh.ch
LITERATUR
Davide Giuriato: Grenzenlose Bestimmbarkeit, Kindheiten in der Literatur der Moderne; Verlag Diaphanes, 2020

Annatina (11)
machen Süssigkeiten ganz zappelig und für einen Moment überglücklich. Sie weiss aber auch Mass zu halten – ihre Grossmutter ist schliesslich Zahnärztin.
DOSSIER — Glücklich gross werden
Von der Schule wird viel erwartet. Was muss sie leisten, damit Kinder erfolgreich lernen und sich positiv entwickeln können? Ein Gespräch mit Erziehungswissenschaftlerin Katharina Maag Merki und Erziehungswissenschaftler Roland Reichenbach.
Interview: Thomas Gull
Frau Maag Merki, Herr Reichenbach, was sollte die Schule Kindern beibringen?
ROLAND REICHENBACH: Es gibt den Lehrplan. Doch was man lernt, geht weit über das Curriculum hinaus. In der Schule lernt man Gemeinsinn. Dieser ist unabdingbar für eine demokratische Gesellschaft, genauso wie ein zivilisierter Umgang mit anderen Menschen. Das sind Leistungen, die häufig gar nicht der Schule zugesprochen werden. Aber hier leistet sie sehr viel. Die moderne Gesellschaft ohne die Schule hätte ein echtes Problem – nicht unbedingt wegen der Inhalte, sondern weil man dort lernt, was es bedeutet, Teil einer Gesellschaft zu sein.
Die Schule vermittelt Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Tut sie das heute noch erfolgreich?
KATHARINA MAAG MERKI: Die Anforderungen sind gestiegen. Heute muss die Schule auch Wissen etwa zur Digitalisierung vermitteln, oder ökonomische Kompetenzen. Gleichzeitig verfügen in Mathematik etwa 20 Prozent der Schüler:innen und in der Muttersprache 25 Prozent nach elf Schuljahren nicht einmal über basale Kompetenzen.
REICHENBACH: Insbesondere die mangelhaften Sprachkompetenzen sind besorgniserregend. Wer sich nicht ausdrücken kann, wer nicht verstehen kann, wer schriftliche Dokumente nicht richtig nachvollziehen kann, der hat im Leben viele Hindernisse. Wenn ein bedeutender Teil der Gesellschaft sich nicht richtig entfalten kann, ist das für uns alle ein Problem. Deshalb glaube ich, dass es zumindest für einen Teil der Schüler:innen heissen müsste: weniger Lernstoff, dafür mehr Zeit für die Grundkompetenzen.
Liegt das am überfrachteten Lehrplan? Viele Schüler:innen kommen damit ja gut zurecht und eignen sich wertvolles Wissen an. Diesen würde eine Ausdünnung des Lehrplans eher schaden als nützen.
MAAG MERKI: Wir müssen den Fokus stark auf die Sprache legen, das unterstütze ich sehr. Doch was passiert, wenn man das andere weglässt? Und wird damit nicht die Ungleichheit verstärkt? Werden damit nicht die Möglichkeiten eingeschränkt, neue, anregende Dinge kennenzulernen?
REICHENBACH: Sobald der Anspruch besteht, dass alle Kinder und Jugendlichen ein bestimmtes Niveau erreichen müssen, stellt uns das vor die Wahl: Entweder das Niveau wird runtergeschraubt, das will man natürlich nicht, oder ein Teil
«Glück und Zufriedenheit im Leben sind nicht nur von Bildungsabschlüssen abhängig.»
Roland
Reichenbach, Erziehungswissenschaftler
der Schüler:innen genügt den Anforderungen nicht. Die Schule kann dieses Problem in Wirklichkeit gar nicht lösen, aber sie muss so tun, als ob sie es könnte. Es gibt gut gemeinte Ideen wie etwa die Inklusion. Dann stellt sich heraus, dass sie nicht funktionieren. Worauf es dann oft heisst: Wir brauchen mehr Ressourcen, mehr Humankapital, mehr finanzielle Mittel. Aber die Ideen werden nicht hinterfragt oder revidiert.
Frau Maag Merki, Sie kritisieren, die Schule selektioniere zu früh. Weshalb ist die Selektion aus Ihrer Sicht ein Problem?
MAAG MERKI: Die frühe Selektion führt dazu, dass Kinder mit vergleichbaren Fähigkeiten und der gleichen Mo-
tivation systematisch unterschiedlichen Leistungsniveaus zugeteilt werden, basierend auf ihrem familiären Hintergrund. Den einen wird empfohlen, ans Gymnasium zu gehen, den anderen, eine Berufslehre zu machen. Dasselbe passiert bei der Entscheidung, ob Kinder in die Sekundarschule A oder B eingeteilt werden. Das bedeutet: Die Türen für weiterführende Bildungsgänge sind für Kinder und Jugendliche aus Familien, die weniger bildungsnah sind, teilsweise geschlossen, obwohl sie leistungsfähig und motiviert wären. Die Schule reproduziert damit bestehende Ungleichheiten und verstärkt sie teilweise noch. In der Schweiz wird damit das meritokratische Prinzip stärker verletzt als in anderen Ländern.
genüber einem Abschluss auf Sekundarstufe C. Und dies trotz allenfalls vergleichbarer Fähigkeiten.
Herr Reichenbach, sind Sie einverstanden mit dieser Analyse?
REICHENBACH: Ja, die Selektion ist einfach zu früh.
Ein weiteres Problem, das Ihnen unter den Nägeln brennt, sind die Noten. Weshalb?
MAAG MERKI: Ich finde es viel sinnvoller, Feedback zu gegeben, als Noten zu verteilen, weil Kinder, die fundierte Rückmeldungen erhalten zu ihren Leistungen, ihre Lernziele besser erreichen. Gleichzeitig können Noten sehr frustrierend und demotivierend sein. Wenn ich permanent eine 2 oder 3 bekomme, dann habe ich keine Lust mehr zu lernen. Auch deshalb haben wir am Schluss Schüler:innen, die die Ziele nicht erreichen.
REICHENBACH: In der Schweiz ist diese Ungerechtigkeit nicht so dramatisch, weil die Kluft bei den Berufsaussichten nicht so gross ist. Die grosse Mehrheit der Jugendlichen macht eine Lehre. Wir haben deshalb gute Leute in den Berufen. Das heisst, unsere Wirtschaft profitiert von der im internationalen Vergleich tiefen Maturitätsquote. Deshalb kann man nicht sagen, dass das ungerechte Bildungssystem in der Schweiz zu einem wirtschaftlichen Problem führt. Man muss eher erklären, weshalb die Leute mit dem, was sie haben, zufrieden sind. Ob man jetzt ins Gymnasium geht oder nicht, für einen Teil der Bevölkerung ist das offenbar nicht entscheidend. Glück und Zufriedenheit im Leben sind nicht nur von der Bildung oder von formalen Bildungsabschlüssen abhängig. Und die Jugendarbeitslosigkeit ist tiefer als in vielen anderen Ländern.
Heute wird in der Schule zu früh selektioniert. Wenn die Weichen später gestellt würden, könnten Kinder länger individuell gefördert werden. Und die verschiedenen Bildungswege würden ihnen länger offenstehen.
MAAG MERKI: Wir haben ein System, bei dem nur ein geringer Teil der Jugendlichen tatsächlich durch die Maschen fällt. Gleichzeitig ist die soziale Mobilität in der Schweiz nicht sehr hoch – es braucht fünf Generationen, um von einer sozialen Schicht in die nächste aufzusteigen. In Dänemark beispielsweise dauert das nur zwei.
Frau Maag Merki, für Sie ist die zu frühe Selektion Teil eines Systems, das Jugendliche mit bildungsfernem familiärem Hintergrund benachteiligt. Wäre es gerechter, wenn später selektioniert würde?
MAAG MERKI: Später zu selektionieren, wäre ein wesentlicher Teil der Lösung. In Ländern mit geringerer sozialer Benachteiligung wie beispielsweise Kanada oder Finnland werden die neun Jahre der regulären Schulzeit genutzt, um die Kinder individuell zu fördern. Deshalb braucht es bei uns eine Strukturreform. Selektioniert werden sollte erst am Ende der Sekundarschule. Wenn später selektioniert wird, stehen die verschiedenen Bildungswege für alle länger offen. Das ist auch deshalb wichtig, weil die Kinder in den einzelnen Fächern sehr unterschiedliche Kompetenzniveaus haben. So sind 25 Prozent der Schüler:innen der Sekundarstufe C in gewissen Fächern besser als die schlechtesten im Gymnasium. Wenn man sich jetzt vergegenwärtigt, welche Wege einem offenstehen, wenn man eine Matura hat, dann sind es Welten ge
REICHENBACH: Noten sind Teil des Selektionssystems der Schule. Irgendwie muss sie selektionieren. Das bedeutet auch, es werden ungleiche Zukunftschancen geschaffen. Nicht alle sollen am Ende der obligatorischen Schule die gleichen Zugangsmöglichkeiten zu weiterführender Bildung haben, und das muss legitimiert werden. Gleichzeitig ist diese Selektion höchst problematisch, weil wir wissen, dass die Chancengleichheit nicht gegeben ist. Sie wird auch nie gegeben sein. Ergo kann man sagen, es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, fair zu selektionieren, mit oder ohne Noten. Doch gibt es eine bessere Alternative? Ich würde sagen: Sie wurde bisher nicht gefunden.
Müsste der Unterricht noch stärker individualisiert werden?
REICHENBACH: Das ist jetzt ein Punkt, in dem wir uns nicht einig sind. Denn eigentlich müssen die Leistungen der Schüler:innen verglichen werden, aber wenn alles individualisiert wird, geht das nicht. Das ist die Quadratur des Kreises und gehört zur Pädagogik der Privilegierten. Wenn man dem Kind individuell gerecht werden will, dann muss man bedenken, dass die Starken immer engagiert und leistungsorientiert arbeiten, während die Schwächeren oft Mühe haben, sich zu motivieren. Das ändert sich auch nicht, wenn der Unterricht noch individueller wird.
MAAG MERKI: Unter Individualisierung verstehe ich nicht, dass alle permanent für sich arbeiten. Meine Formel lautet: Ein Drittel wird gemeinsam gelernt und die Schüler:innen setzen sich in der Klasse mit bestimmten Inhalten auseinander. Ein Drittel wird in kleinen Gruppen gearbeitet, wo man gemeinsam etwas entwickelt und voneinander lernt. Im dritten Drittel wird ein Thema individuell vertieft, für das sich das Kind interessiert, wobei schwächere besondere Unterstützung brauchen. In einem Teil der Lernzeit sollten sich die Schüler:innen mit Dingen beschäftigen können, die sie intrinsisch interessieren.
Herr Reichenbach, Sie sind der Meinung, dass die Lehrpersonen einen Teil ihrer Autorität eingebüsst haben, dass diese aber wichtig ist, um erfolgreich eine Klasse zu führen und zu unterrichten. Plädieren Sie deshalb für eine «neue» Autorität?
REICHENBACH: Ich plädiere überhaupt nicht für Autorität, auch nicht für eine neue Autorität. Der Begriff Autorität ist negativ konnotiert, doch ohne sie gibt es keine Erziehung und auch keine Bildung. Autorität, wie ich sie verstehe, bedeutet: Jemand steht vorne und erzählt etwas und was er oder sie sagt, wird geglaubt. Das heisst, es ist ein Anerkennungsverhältnis. Das kann eine sehr limitierte Autorität sein. Die Klavierlehrerin kann mir nicht sagen, ob ich rauchen soll oder nicht, aber sie kann mir zeigen, wie man Klavier spielt. Wenn man dieses Vertrauen, diese Anerkennung nicht erhält, hat man als Lehrperson ein Problem. Oft reagieren Lehrpersonen darauf, indem sie autoritär werden, was meist nicht funktioniert.
Frau Maag Merki: Braucht es eine neue Autorität im Klassenzimmer?
MAAG MERKI: Wichtig ist für mich die Unterscheidung zwischen autoritär und autoritativ im Sinne von wertschätzend Strukturen vorgeben, Vertrauen bilden und Verbindlichkeiten herstellen. Das ist sehr wichtig.
Wir haben darüber diskutiert, was es für eine gute Schule braucht. Können Sie bitte kurz die ideale Schule skizzieren?
REICHENBACH: Was ich jetzt sage, klingt völlig altbacken. Aber ich glaube, alle Schülerinnen und Schüler können froh sein, wenn sie Lehrpersonen vor sich haben, die ihren Beruf lieben, die wollen, dass die Kinder etwas lernen und die sie dabei unterstützen. Mehr kann man nicht verlangen. MAAG MERKI: Ich stimme zu, dass die Lehrperson eine zentrale Rolle spielt. Doch es braucht für mich die ganze Schule. Das heisst, für mich steht die Lehrperson nicht allein da, sondern sie ist Teil eines hoffentlich funktionierenden Gesamtsystems Schule. Die ideale Schule wäre deshalb für mich eine Schule, wo sich alle austauschen, zusammenarbeiten und gemeinsam mit den Kindern die gesteckten Ziele erreichen.
DOSSIER — Glücklich gross werden
Die Schule sollte allen Kindern die gleichen Chancen bieten. Allerdings gelingt das oft nicht. Bildungsforscher Kaspar Burger untersucht, woran es liegt und was für mehr Chancengleichheit getan werden könnte.
Text: Thomas Gull
Zuerst die schlechte Nachricht: «Das Bildungssystem hat die beste Möglichkeit, Chancengleichheit umzusetzen. Tatsächlich reproduziert es aber soziale Unterschiede», sagt Bildungsforscher Kaspar Burger. Er leitet am Jacobs Center for Productive Youth Development das SNF-Forschungs-
projekt «Understanding social gradients in education», das sich mit dem sozialen Gefälle im Bildungswesen beschäftigt. Die Paradoxie, dass die Schule eigentlich für mehr Chancengleichheit sorgen könnte, ihr dies aber oft nicht gelingt, sei nur schwer aufzulösen, erklärt Burger. «Das liegt auch daran, dass das Bildungssystem Kompetenzen honoriert, die ausserhalb erworben werden.» Und es belohnt jene Fähigkeiten, die dem System am ähnlichsten sind.
Familienzulagen und Elternurlaube
Der Knackpunkt für die Schule ist: Sie fängt an, die Kinder zu bilden, wenn diese bereits sehr unterschiedliche Fähigkeiten erworben haben. Denn was Kinder können, wenn sie in die Schule kommen, hängt stark von ihrer Herkunft ab. Viele der sozialen und kognitiven Kompetenzen werden in den
ersten Lebensjahren erworben, fernab der Schule, vor allem in der Familie. «Die Schule schafft es dann, die Unterschiede stabil zu halten», sagt Burger. Mehr nicht. Was kann getan werden, um mehr Chancengleichheit zu schaffen? Kaspar Burgers Antwort: Es muss mehr in die qualitativ hochwertige frühe Bildung und Betreuung investiert werden. Und diese muss allen Kindern zugänglich sein, unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten.
terschiede in den Gymnasialquoten sowohl zwischen den Gemeinden wie auch zwischen den Kantonen.
Das bedeutet: Kinderkrippen müssten kostenlos sein. Wenn der Zugang zu solchen Angeboten (zu) teuer ist, passiert das, was meist geschieht: Sie werden von jenen Familien genutzt, die sie sich leisten können. Das sind oft aber gar nicht jene, die sie am nötigsten hätten. Diese Investition in die ersten Lebensjahre würde sich lohnen, wie Studien zeigen. Neben der besseren kindlichen Entwicklung gehören dazu positive Auswirkungen wie eine höhere Erwerbsquote der Frauen, Einsparungen bei den Sozialleistungen, bessere Schul- und Studienabschlüsse der Eltern oder eine bessere Lebensqualität.
Kinder kommen bereits mir sehr unterschiedlichen Fähigkeiten in die Schule. Um mehr Chancengleichheit zu schaffen, müsste deshalb in die frühe Bildung und Betreuung investiert werden. Und diese sollte allen Kindern zugänglich sein, unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern.
Interessant ist, wie sich die Erwartungen auf den Bildungserfolg auswirken. Grundsätzlich sind hoch gesteckte Ziele gut, weil sie tatsächlich zu mehr Erfolg führen. «Wenn man erwartet, dass man etwas erreichen kann, dann bleibt man hartnäckig und gibt auch bei Rückschlägen nicht gleich auf», erklärt Burger. Das zahlt sich oft aus. In diesem Sinne sind hohe Ambitionen gut, unabhängig von der Ausgangslage. Burger formuliert jedoch ein Aber: Das Bildungssystem muss auch die Möglichkeit bieten, diese Ziele zu erreichen. Das ist nicht immer der Fall. «Oft wird die Wirkung von positiven Zukunftserwartungen untergraben, weil das System Schleusen hat.» Konkret, indem etwa Kindern aufgrund ihres sozialen Hintergrunds empfohlen wird, eine Berufslehre zu machen statt zu studieren, obwohl sie die Fähigkeiten dazu mitbringen würden.
Mehr Chancengleichheit gibts nicht umsonst
Neben der öffentlich finanzierten frühkindlichen Bildung und Betreuung hat Kaspar Burger weitere Mechanismen untersucht, von denen man sich mehr Chancengleichheit verspricht, wie höhere staatliche Unterstützungsbeiträge für Familien und längerer bezahlter Elternurlaub. In der Studie wurden die Effekte von Familienzulagen und Elternurlaub auf die sozialen Ungleichheiten in den schulischen Leistungen von Kindern im Alter von zehn Jahren untersucht. Die Ergebnisse sind gemischt: So führen höhere Familienzulagen dazu, dass sich die Leistungsschere zwischen mehr und weniger privilegierten Kindern etwas schliesst. Das ist aus der Perspektive der Chancengleichheit positiv.
Längere Elternurlaube hingegen verstärken die Unterschiede zwischen den Leistungen der zehnjährigen Schüler:innen in Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen. Das lässt sich damit erklären, dass der längere Urlaub den Eltern mehr Gelegenheit gibt, sich um ihre Kinder zu kümmern und mit ihnen zu interagieren. Das wirkt sich positiv auf ihre Leistungen aus, verstärkt allerdings wiederum die Unterschiede.
Grosse Differenzen bei den Gymnasialquoten
Bildungsforscher Burger hat sich mit zwei weiteren Aspekten der sozialen Ungleichheit beschäftigt, die die Bildungskarrieren beeinflussen: die soziale Segregation und wie Zukunftserwartungen den Bildungserfolg beeinflussen. Zur sozialen Segregation gibt es in der Schweiz nur wenige Untersuchungen, die Daten stammen vor allem aus den USA. Das Problem sei in der Schweiz weniger akut, betont Burger, weil hier mehr in Bildung investiert wird und die Schulen weniger stark gekoppelt sind an die finanziellen Möglichkeiten der einzelnen Gemeinden. Trotzdem ist die Bildungssegregation in der Schweiz sehr ausgeprägt, das belegen etwa die grossen Un-
Das Schweizer Bildungssystem ist zwar grundsätzlich durchlässig, allerdings wechseln nur wenige später noch einmal die Spur, weil das oft mir sehr grossem Aufwand verbunden ist. Und auch bei den Bildungsambitionen gilt: Diese werden massgeblich von den Eltern geprägt und oft auch vorgelebt. Wie die Bildungsforschung zeigt, gibt es durchaus Strategien, um für mehr Chancengleichheit unter den Kindern zu sorgen. Gleichzeitig wird aber auch klar, dass die Schule allein das kaum stemmen kann, weil externe Faktoren wie das soziale Umfeld der Kinder sehr einflussreich sind. Und mehr Chancengleichheit gibts nicht umsonst. Um beispielsweise eine umfassende frühe Bildung und Betreuung für alle Kinder anbieten zu können, bräuchte es eine «massive Transformation» des Bildungssystems, so Burger.
Prof. Kaspar Burger, kaspar.burger@jacobscenter.uzh.ch
DOSSIER — Glücklich gross werden
Familienprobleme, fehlende Selbstkontrolle oder soziale Benachteiligung – die Ursachen für Jugendgewalt sind komplex. Ein Blick auf die Gründe und die Frage, was wirklich hilft, um den Weg in ein besseres Leben zu finden.
Text: Carole Scheidegger
Brian Keller hat unrühmliche Berühmtheit erlangt: Das Schweizer Publikum hat den heute 29-Jährigen unter dem Pseudonym «Carlos» kennengelernt. Er wurde mehrfach wegen Gewalttaten verurteilt und kommt nicht mehr aus den Schlagzeilen. Fälle wie dieser führen zum Eindruck, dass Jugendgewalt enorm zunehme. Doch wie sehen die Zahlen tatsächlich aus?
Verschiedene Quellen liefern Aufschluss: Die Zahlen aus dem sogenannten Hellfeld – die offizielle polizeiliche Kriminalstatistik – und jene aus dem Dunkelfeld. Das sind Angaben, die die Jugendlichen selbst machen. Sie sind normalerweise höher als die offiziellen Statistiken, da nicht jeder Vorfall angezeigt wird.
sexuelle Onlinebelästigung. Laut der Studie überlappen sich Täter- und Opferrollen stark. «Aus Opfern werden Täter und umgekehrt», sagt Ribeaud. Das nehme die Gesellschaft aufgrund von Alltagsstereotypen – hier die Opfer, da die Täter –häufig nicht wahr.
«Ein Delikt ist oft ein Ausdruck von Not und Unbeholfenheit», sagt Dorothea Stiefel. Die Psychiaterin arbeitet mit verurteilten Jugendlichen daran, eine Zukunft aufzubauen. Eine Schule mit passendem Niveau, eine Lehrstelle, eine geregelte Tagesstruktur: All das hilft, Selbstwert zu schöpfen, um den Ausstieg aus der Gewalt zu finden.
Ging die Jugendgewalt seit Mitte der 2000er- bis zur Mitte der 2010er-Jahre zurück, lässt sich seither wieder ein Wachstum feststellen. «Tatsächlich haben wir zwischen 2014 und 2021 einen Anstieg beobachtet. Fast jeder vierte Jugendliche gab an, bereits Opfer eines Gewaltdelikts geworden zu sein», sagt Denis Ribeaud vom Jacobs Center for Productive Youth Develpment der UZH. Der Kriminologe leitet seit 2006 die Zürcher Jugendbefragungen zu Gewalterfahrungen Jugendlicher (ZYS), die anhand grosser Stichproben Aufschluss über die längerfristige Entwicklung der Jugendgewalt im Dunkelfeld geben.
Die Gewalttoleranz sinkt
Die letzte Befragung ergab eine deutliche Zunahme der Opferraten bei sexueller Gewalt und bei instrumenteller Gewalt. Mit Letzterer sind Delikte wie Raub und Erpressung gemeint, bei denen Gewalt eingesetzt wird. Auch die Gewalt in den sozialen Medien nimmt zu, darunter Cybermobbing und
Dirk Baier, Professor für Kriminologie, beobachtet eine veränderte gesellschaftliche Toleranz gegenüber aggressivem Verhalten. «Die Gesellschaft ist heute weniger bereit, Gewalt zu akzeptieren. Und das ist eine positive Entwicklung», so Baier. In den Medien werde intensiv über Gewalttaten von Jugendlichen berichtet. «Man muss trotzdem die Relationen sehen: Über 90 Prozent der Jugendlichen begehen keine Gewalttaten. Diese will ich aber nicht kleinreden. Jeder Übergriff ist einer zu viel.» Gewalt prägt die Betroffenen manchmal ein Leben lang, mit Folgen wie posttraumatischen Belastungsstörungen. Doch was bringt Jugendliche dazu, gewalttätig zu werden? Für die letzte ZYS-Studie hat Ribeaud die zentralen Risiken herausdestilliert. Er sieht zum einen jene Faktoren, die sich direkt auf die Gewaltausübung auswirken. Dazu zählen Persönlichkeitsmerkmale und Einstellungen wie mangelnde Selbstkontrolle, gewaltbefürwortende Männlichkeitsnormen oder mangelnde Konfliktlösungskompetenzen. Zum anderen gibt es Faktoren, die sich indirekt auswirken, etwa der familiäre Kontext: Konflikte zwischen den Eltern, innerfamiliäre Auseinandersetzungen und elterliche Gewalt gegen Kinder.
Seltener im Ausgang
Auch die Biologie spielt eine Rolle: «Der präfrontale Cortex ist bei Jugendlichen noch nicht ausgereift. Sie sind deshalb noch gar nicht fähig, ihre Impulse im gleichen Ausmass zu kontrollieren wie Erwachsene», sagt Dorothea Stiefel. Die Psychiaterin ist Co-Leiterin des Zentrums für Kinder- und Jugendforensik der Psychiatrischen Universitätklinik Zürich. Ihr Team schreibt pro Jahr rund fünfzig Gutachten für die Jugendanwaltschaft Zürich und therapiert jugendliche Straftäter:innen. Stiefel beobachtet bei vielen der behandelten Jugendlichen, dass sie in der Kindheit emotionalen und körperlichen Missbrauch erlebt haben. Bei vielen kommt als weiterer Risikofaktor eine psychische Störung dazu, zum Beispiel ein

Aymo (10)
hat das Alphorn in den Bündner Bergen entdeckt und darf seit kurzem Unterricht nehmen. Er findet es cool, dass das Instrument so gross ist und dass es nicht alle kennen.

Paula (17) Kira (17) Lina (18) Alina (18) sind schon lange beste Freundinnen. Sie treffen sich oft im Irchelpark, um zu picknicken, Uno zu spielen oder einfach zusammen zu reden.
ADHS, eine Störung des Sozialverhaltens, Autismus oder – viel seltener – eine Schizophrenie.
Verhängnisvoll können Situationen mit hohem Konfliktpotenzial sein: unübersichtliche Menschenansammlungen, rivalisierende Gruppen oder wenn Alkohol- und Drogeneinfluss mitspielen. Laut der ZYS-Studie gehen Jugendliche heute aber seltener in den Ausgang als früher. Auch der Substanzkonsum hat abgenommen. Dafür verbringen sie mehr Zeit online. Dort kann es ebenfalls zu Gewaltvorfällen kommen, zum Beispiel Cybermobbing.
Höhere Strafen helfen wenig
Jugendliche mit nichtschweizerischer Staatsbürgerschaft sind als Gewalttäter in der Kriminalstatistik übervertreten. «Die Frage nach der Nationalität wird in diesem Kontext immer gestellt», sagt Baier. «Wenn man sich die Hintergründe anschaut, sieht man aber andere Zusammenhänge: zum Beispiel sozioökonomische Benachteiligung oder niedrige Bildung von Jugendlichen nichtschweizerischer Herkunft. Hier müssen wir ansetzen, um passende Massnahmen zu finden.»
Was schützt Jugendliche davor, gewalttätig zu werden? «Social Skills» wie Empathiefähigkeit oder Konfliktlösungskompetenz seien zentral für ein gewaltfreies Leben, sagt Ribeaud. Zum Aufbau solcher Kompetenzen trage die Unterstützung durch erwachsene Bezugspersonen entscheidend bei. Manchmal sind das die Eltern, zuweilen aber auch Lehrpersonen.
Höhere Strafen hingegen helfen wenig gegen Jugendgewalt. «Darüber ist sich die Wissenschaft grundsätzlich einig», sagt Baier. «Gerade bei jungen Menschen hat das keine abschreckende Wirkung. Die denken nicht darüber nach, ob auf ein Delikt drei oder fünf Jahre Haft stehen, wenn sie es begehen.» Dass trotzdem ab und zu die Gesetze verschärft werden, erklärt er mit den wenigen Handlungsmöglichkeiten der Politik: Strafen verschärfen oder Geld für Prävention sprechen. «Und Geld ausgeben ist meistens unpopulär.»
Baier sieht in der Prävention den erfolgversprechenderen Weg. «Man kann nie früh genug damit anfangen, und es ist nie zu spät», sagt er. Kindern sollten so früh wie möglich soziale Kompetenzen vermittelt werden. Sie müssen lernen, sich in andere hineinzuversetzen und erkennen, was ihr eigenes Handeln bei anderen bewirkt. «Man kann Kindern zeigen, wie man Konflikte nicht aggressiv löst. Je älter Menschen werden, desto schwieriger wird das, aber es ist trotzdem möglich», sagt Baier. Bei älteren Jugendlichen brauche es Unterstützung von mehreren Seiten und eine Perspektive, zum Beispiel eine Ausbildung. «Viele Jugendliche kommen von selbst wieder aus problematischen Situationen heraus, weil sich ihre Lebenssituation verändert und ihre Einsicht wächst, dass es mit Gewalt nicht geht», sagt Baier. «Bei anderen ist es aber durchaus auch einmal nötig, dass sie in den Massnahmenvollzug kommen.»
Prävention solle langfristig angelegt sein, betont Ribeaud: «Über die ganze Schulzeit müssen dieselben Kompetenzen und Werte vermittelt werden. Eine punktuelle Intervention mag zwar kurzfristig etwas bewirken, aber die Effekte ver-
puffen mit der Zeit wieder.» Wichtig sei es auch, dass den Jugendlichen eine umfassende Medienkompetenz beigebracht werde.
Wenn die Prävention nicht gefruchtet hat und Jugendliche gewalttätig werden, dann wird in sehr schwerwiegenden Fällen die Kinder- und Jugendforensik hinzugezogen. Stiefel und ihr Team analysieren in ihren Gutachten die Delikte, um die deliktrelevanten Mechanismen dahinter zu verstehen. Das Gleiche wird von den Jugendlichen verlangt. «Ein Delikt ist oft ein Ausdruck von Not und Unbeholfenheit», sagt Stiefel. Ihr Ziel ist unter anderem, dass die Jugendlichen verstehen, wieso sie ihre Tat begangen haben. Sie müssen die Risikofaktoren erkennen und verstehen, was sie künftig besser unterlassen oder welche alternativen Bewältigungsstrategien sie anwenden müssten. «Das kann bedeuten, dass sich ein Jugendlicher sagt: Im Sommer gehe ich freitagabends nicht mehr zu den ‹Hot Spots› am Zürcher Stadelhofen, wo die Gefahr hoch ist, dass ich auf andere treffe, die auf Krawall aus sind», so die Psychiaterin. «Aber die Jugendlichen sollten auch unbedingt ihre Stärken kennenlernen, damit diese gezielt gefördert werden können.»
Der Weg zurück zum Glück
Die Kinder- und Jugendforensik arbeitet mit den verurteilten Jugendlichen daran, eine Zukunft aufzubauen. «Sie müssen ein Alternativprogramm haben. Wenn sie bis anhin Anerkennung in ihrer delinquenten Peer Group hatten, dann lässt sich eine andere Form der Anerkennung mit Förderung ihrer Stärken finden, vielleicht in einem Sportklub», sagt Stiefel. Eine Schule mit passendem Niveau, eine Lehrstelle, eine geregelte Tagesstruktur: All das hilft, Selbstwert zu schöpfen, um den Ausstieg aus der Gewalt zu finden. Die Familien der Jugendlichen werden ebenfalls eingebunden, selbst wenn dort die Situation schwierig ist. «Trotzdem ist es die Familie, und mit ihr muss der Jugendliche klarkommen – das kann manchmal auf eine temporäre Trennung hinauslaufen», sagt Stiefel. Der Weg zurück zum Glück führt für gewalttätige Jugendliche über harte Arbeit. «Natürlich haben viele Widerstände gegen diese Zwangsmassnahmen von Therapie und Fremdunterbringung», sagt Stiefel. «Ich versuche ihnen jeweils zu erklären, dass dies auch eine Chance ist, einen Beruf im geschützten Rahmen zu erlernen und gewaltfrei zu werden.»
Kommt es zu Gewaltvorfällen, ruft die Gesellschaft oft nach schnellen Lösungen und klaren Schuldigen. So einfach ist es aber nicht. «Es gibt nicht das eine Zahnrad, an dem wir drehen können», sagt Baier. Und unterstreicht, dass ganz viele Jugendliche gewaltfrei durchs Leben kommen.
Prof. Dirk Baier, dirk.baier@ius.uzh.ch
Dr. Denis Ribeaud, denis.ribeaud@jacobscenter.uzh.ch
Dr. Dorothea Stiefel, dorothea.stiefel@pukzh.ch
UZH LIFE
Primatenschädel, Pflanzenbelege, Grabbeigaben – die UZH unterhält zahlreiche Sammlungen, die wichtige Informationen für die Forschung liefern. Zentral ist, dass die Herkunft von Sammlungsobjekten geklärt ist, und mit ihnen respektvoll umgegangen wird.

Die Schädel von südamerikanischen Totenkopfäffchen. Die Primatensammlung der UZH gehört zu den bedeutendsten weltweit.


Text: Theo von Däniken
Bilder: Ursula Meisser
Es ist ein ungewöhnliches Ensemble: ein rund drei Meter hohes Kultobjekt aus farbigen, bedruckten Stoffwimpeln, Holzstangen und Schnüren, daneben der grüne Stahltank einer Eisernen Lunge. Im Gestell dahinter sind Abgüsse von antiken Säulenkapitellen erkennbar und mittendrin liegt auf mehreren Paletten ein wuchtiger Finnwalschädel. «Unser grösstes Objekt», erklärt Wibke Kolbmann, Geschäftsführerin Museen & Sammlungen der UZH.
Wir stehen im Lagerraum für die Grossobjekte im Sammlungszentrum der UZH in Buchs im Zürcher Furttal. Der Raum vereinigt unter anderem Gegenstände aus der zoologischen, der archäologischen, völkerkundlichen und medizinischen Sammlung der UZH, die in den fünf Stockwerken des Gebäudes untergebracht sind. Zwischen Spenglereibetrieb, Logistikzentrum und einer ehemaligen Tennishalle lagern hier Kulturschätze von nationalem Wert. «Die Sammlungen der
UZH sind Teil des Schweizerischen Kulturgüterinventars», so Kolbmann. Sie sind nicht nur für die UZH, sondern auch für das ganze Land als erhaltens- und schützenswert eingestuft. Zahnschmelz analysieren
Im Lagerraum der Anthropologischen Sammlung zieht Michael Krützen, Direktor des Instituts für Evolutionäre Anthropologie, einen Behälter mit Primatenschädeln aus einem der vielen Rollregale. Sieben Schädel von Halsbandmangaben sind darin aufbewahrt, geschützt und stabilisiert mit Schaumstoffelementen. «Die Primatensammlung an der Universität Zürich ist eine der bedeutendsten weltweit», sagt er. Zusammengetragen wurde sie hauptsächlich ab den 1940er-Jahren unter anderem vom damaligen Institutsvorsteher und Anthropologen Adolf Hans Schulz.
«Früher wurden in der anthropologischen Forschung die Schädel und Knochen ausgemessen und miteinander verglichen», erklärt Krützen. Dieses Vermessen und Vergleichen ist jedoch nicht mehr zeitgemäss. Heute befasst sich die An-
thropologie viel stärker mit Fragen des Verhaltens und der evolutionären Entwicklung. «Die Forschung hat sich von den Knochen wegentwickelt», so Krützen, der selbst vor allem das Verhalten von Delfinen erforscht.
Dennoch ist die Sammlung wegen ihres Umfangs und ihrer Qualität auch für aktuelle Forschungsfragen noch immer «unheimlich wertvoll», wie Krützen betont. Die etwa 11 000 Objekte – meist Schädel und Knochen – dokumentieren rund 90 Prozent der bekannten Primatenarten. «Eine vergleichbare Sammlung könnte heute nicht mehr aufgebaut werden», sagt Krützen. Die Zeiten, in denen auf Expeditionen Tiere abgeschossen und in zoologische Sammlungen verfrachtet wurden, sind längst vorbei. Neuzugänge stammen heute vereinzelt aus Zoos oder von privaten Sammlern.
Der historische Schatz, so Krützen, sollte erhalten bleiben. «Gerade weil wir nicht wissen, welche Art von Forschung in Zukunft möglich ist.» So kann heute beispielsweise der Zahnschmelz analysiert werden. Das ermöglicht Rückschlüsse darauf, wie sich die Primaten ernährt haben. Ohne die Sammlungen wäre diese Forschung nicht möglich. Denn es gäbe gar keine Proben, die untersucht werden können.
Skelette, Knochen, Mumien
In den Rollregalen gegenüber der Primatensammlung stehen graue Kartonschachteln dicht an dicht. Vor Blicken geschützt werden dort menschliche Überreste – grösstenteils Schädel –aufbewahrt. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts wurden sie für die heute wissenschaftlich überholte Rassenforschung verwendet. «Als die Sammlung damals zusammengestellt wurde, fragte niemand danach, woher die Objekte kommen», sagt Krützen. Das ist heute anders. Die Frage, aus welchem kulturellen Kontext die Überreste stammen und auf welche Weise sie in die Sammlung gelangten, ist relevant. Sie hat einen Einfluss darauf, ob und auf welche Art die Sammlung für Forschungszwecke genutzt werden kann.
Für Krützen ist klar, dass kulturelle und religiöse Gebote und Traditionen aus den Herkunftskulturen der menschlichen Überreste bei Forschungsvorhaben berücksichtigt werden müssen. «Für mich sind in diesen Fällen ethische Überlegungen wichtiger als mögliche wissenschaftliche Erkenntnisse.» Beispielsweise könnten sämtliche menschlichen Schädel der Sammlung digitalisiert werden. So wären sie für die Forschung verfügbar, ohne dass man dazu das physische Objekt noch benötigt. «Doch in einigen Kulturen ist es nicht gewünscht, dass Digitalisate von den Überresten gemacht werden. Das müssen wir respektieren.»
Ein respektvoller Umgang mit menschlichen Überresten ist auch für Frank Rühli, Dekan der Medizinischen Fakultät und Leiter des Instituts für Evolutionäre Medizin (IEM), zentral. Vor knapp zehn Jahren wurden mehrere tausend Präparate menschlichen Ursprungs aus der damaligen Medizinhistorischen Sammlung der UZH in eine eigene Sammlung für Human Remains am IEM überführt und von der Medizinischen Sammlung getrennt.
Unter den menschlichen Überresten befinden sich Skelette, Knochen, medizinische Präparate von menschlichen Or-
ganen aus der Pathologie des Universitätsspitals oder aus der Rechtsmedizin, sowie eine kleine Gruppe von Mumien. «Die Sammlung ist sowohl für die Lehre wie für die Forschung relevant», erklärt Rühli. Insbesondere Beispiele seltener Krankheiten oder Verletzungen werden anhand der Präparate in Lehrveranstaltungen veranschaulicht. Dabei sei ihm wichtig, die Überreste mit dem gleichen Respekt zu behandeln «wie Patient:innen», erklärt Rühli. Er und sein Team haben dazu einen «Code of Ethics» entwickelt und auch wissenschaftlich zur Thematik publiziert.
Sich der Vergangenheit stellen
Zum respektvollen Umgang gehört auch die Frage, woher die Objekte stammen. Kommen sie aus Spitälern oder archäologischen Grabungen, so ist dies meist unproblematisch. In den Regalen der Anthropologischen Sammlung stehen aber auch Schachteln, die mit «Herero» angeschrieben sind. Zu Beginn
«Es ist wichtig, dass sich die Universitätssammlungen vernetzen – auch mit Universitäten in der Schweiz und im Ausland.»
Wibke
Kolbmann, Geschäftsführerin Museen & Sammlungen der UZH
des 20. Jahrhunderts kamen bei militärischen Vergeltungsaktionen und in Konzentrationslagern der deutschen Kolonialmacht in Namibia Zehntausende Mitglieder des Herero-Stamms um. Dies gilt als der erste Völkermord im 20. Jahrhundert. «Die Herkunft dieser Schädel ist problematisch», erklärt Michael Krützen, «aber wir müssen uns der Vergangenheit stellen.» Er tritt für einen offenen Umgang mit Fragen der Herkunft ein. Im vergangenen Jahr wurde die Provenienz der Herero-Schädel in Schweizer Sammlungen in einer Masterarbeit der Universität Basel untersucht. Aktuell bearbeitet das Institut zudem Anfragen der Regierungen von Australien und Neuseeland für die Rückführung von menschlichen Überresten, damit diese in heimischer Erde bestattet werden können. Zwar lässt sich meist nachvollziehen, über welche Wege die Schädel in die Sammlung kamen, doch ist es kaum mehr zurückzuverfolgen, aus welcher Region oder gar welcher Familie die einzelnen Individuen stammen, geschweige denn, wer sie waren. «Sobald wir geklärt haben, welche Schädel in der Sammlung tatsächlich aus Australien sind, werden wir uns mit der Regierung für das weitere Vorgehen in Verbindung setzen.» Die Anthroplogische Sammlung ist nicht die einzige,
die mit Fragen der Restitution, also der Rückgabe von sensiblen Objekten, konfrontiert ist. Als sensibel werden nicht nur menschliche Überreste bezeichnet, sondern auch Sakral-, Ritual- und Zeremonialgegenstände oder Grabbeigaben sowie Objekte, die allenfalls unrechtmässig erworben wurden, etwa gestohlene Gegenstände.
«Benin verpflichtet»
Wie man damit umgehen kann, zeigt aktuell das Völkerkundemuseum der UZH in der Ausstellung «Benin verpflichtet». Gemeinsam mit sieben anderen Schweizer Museen beteiligt es sich an der Benin-Initiative Schweiz. Sie hat in den vergangenen drei Jahren in enger Kooperation mit Partnern aus Nigeria die Herkunft der knapp hundert Objekte aus dem Königreich Benin in Nigeria untersucht, die sich in Schweizer Sammlungen befinden.
Das Resultat: Über die Hälfte der Objekte – Kunst- und Kultobjekte aus Messing, Elfenbein und Holz – stammen sicher oder mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der Plünderung des Königspalasts im Jahr 1897. Dazu gehören auch 14 der 18 Objekte im Besitz des Völkerkundemuseums. Die Bereitschaft, Rückgabeforderungen zu entsprechen, sei sehr hoch, erklärte der Kurator Alexis Malefakis vergangenes Jahr in einem Interview auf der Website der UZH. Oft sei allerdings nicht ganz klar, woher die Objekte im Einzelnen stammen. Das Museum prüft nun die nächsten Schritte für eine mögliche Rückgabe nach Nigeria. «Wir sollten für die ganze Universität einen einheitlichen Umgang mit Fragen zu Dekolonialisierung, Provenienzforschung und Restitution haben», sagt Krützen. Im Rahmen der Konferenz der Institute mit Sammlungen
UZH-Sammlungszentrum
Von den dreizehn Sammlungen an der UZH haben zehn ihre Objekte in den vergangenen zwei Jahren ins Sammlungszentrum der UZH im zürcherischen Buchs gezügelt. Über eine Millionen Objekte sind dort gelagert, von den kleinsten Schneckenhäusern bis zum Finnwalschädel. In Rahmen der geplanten Sanierung des Botanischen Gartens werden in den kommenden Jahren auch die rund vier Millionen Pflanzen-, Pilzund Algenbelege der Vereinigten Herbarien der UZH und der ETH Zürich dorthin umziehen. Acht Sammlungen, etwa die Paläontologische oder die Medizinische Sammlung, sind im Inventar der schützenswerten Kulturgüter der Schweiz erfasst und müssen vor Naturkatastrophen oder Kriegsereignissen besonders geschützt werden.
Weitere Informationen zu Museen und Sammlungen der UZH: www.uzh.ch/explore/museums
(KIMS) der UZH, die er gemeinsam mit Mareile Flitsch, der Direktorin des Völkerkundemuseums, leitet, wird derzeit ein entsprechender Leitfaden erarbeitet. «Es ist wichtig, dass sich die Universitätssammlungen vernetzen», sagt auch Wibke Kolbmann. «Nicht nur innerhalb der Universität, sondern ebenso unter den Universitäten in der Schweiz und im Aus-
«Wir sollten für die ganze Universität einen einheitlichen Umgang mit Fragen zu Dekolonialisierung, Provenienzforschung und Restitution haben.»
Michael Krützen, Anthropologe
land.» Um diese Vernetzung anzustossen, organisierten UZH und ETH dieses Jahr gemeinsam die Jahrestagung für Universitätssammlungen, die erstmals in der Schweiz durchgeführt wurde. Sie bot nicht nur Gelegenheit, sich über Fragen zu Restitution, Digitalisierung oder Outreach auszutauschen, sondern auch, die Sammlungen der UZH den Fachkolleginnen und -kollegen aus dem Ausland näherzubringen. Fischflossen putzen
Durch die gemeinsame Unterbringung in Buchs sind die Sammlungen bereits örtlich zusammengerückt und profitieren dort von den idealen Lagerbedingungen. «Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit sind die grössten Gefahren für den Erhalt der Sammlung», erklärt Sirpa Kurz, zoologische Präparatorin am Naturhistorischen Museum der UZH. In Buchs wird beides konstant kontrolliert. Zudem sind in den Sammlungsräumen mit den zoologischen Präparaten Schädlingsfallen aufgestellt, die regelmässig überprüft werden. Mit den Massnahmen wird verhindert, dass die zum Teil sehr alten und angeschlagenen Objekte weiter Schaden nehmen. Kurz ist verantwortlich für die Präparate der Zoologischen Sammlung, die seit Sommer in fünf Räumen untergebracht sind. In langen Reihen von Rollregalen sind hier Löwen, Eisbären, Steinböcke, aber auch Enten, Möwen oder Tiefseefische dicht an dicht gemäss ihrer zoologischen Klassifizierung eingereiht. Auf Paletten in der Raummitte stehen ein Elch, ein Bison und zwei Elefantenbabys beieinander, die zu gross sind für die Regale. Sie waren zuvor sieben Jahre in einer Tiefgarage im Irchel untergebracht, keine idealen Bedingungen für die zum Teil

heiklen Präparate. Sirpa Kurz zeigt auf eine weisse Schneeziege im Rollregal: «Vor dem Umzug war sie ganz grau, jetzt ist sie wieder eine echte Schneeziege.» Sie ist nur eines von rund 8500 Präparaten und Lehrmodellen, die vor dem Umzug nach Buchs aufwendig gereinigt werden mussten. Ein halbes Jahr lang arbeiteten insgesamt 25 Personen daran, bliesen mit Druckluft Staub und Dreck aus den Fellen der Elche und Eisbären, wischten Glasaugen ab, holten mit Eulenfedern Verunreinigungen aus den Kolibri-Präparaten, putzten mit Tüchern, Schwämmen und Wattestäbchen die zerbrechlichen Flossen der Fische.
Das Reinigungsteam musste dabei Schutzanzüge und Atemschutzhauben tragen, der Zugang zu den einzelnen Teilen der im alten Lager installierten Reinigungsstrasse war nur durch Schleusen möglich. «Ein Grossteil der Präparate stammt aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert», erklärt Kurz. «Damals wurden sie mit diversen Chemikalien behandelt, um mögliche Schädlinge abzutöten, und enthalten darum entsprechende Giftstoffe.» Heute ist dies verboten. Bevor neue Präparate in
die Sammlung kommen, werden sie mit Kälte oder Stickstoff behandelt, um Schädlinge abzutöten. So wird verhindert, dass diese ins Depot eingeschleppt werden. In Buchs steht dazu eine Stickstoffkammer, wo die Präparate vier bis acht Wochen behandelt werden, bevor sie in die eigentlichen Depoträume kommen.
Museales Schaufenster
Das Sammlungszentrum ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Ein kleiner Teil der Schätze, die die Sammlungen beherbergen, ist jedoch in den Museen der Universität zu sehen. Rund 1000 Präparate aus der Zoologischen Sammlung sind zum Beispiel im Naturhistorischen Museum ausgestellt. «Damit erfüllen die Sammlungen auch einen wichtigen Zweck in der Wissenschaftsvermittlung», sagt Kolbmann. Und auch wenn in den Museen nur die Spitze des Eisbergs zu sehen ist: Mehr als 200000 Besucherinnen und Besucher in den universitären Museen 2023 zeigen, dass die Faszination der Sammlungen weit über Forschung und Lehre hinauswirkt.

PORTRÄT — Marcelle Soares-Santos
Die geheimnisvolle Dunkle Energie treibt das Universum stetig auseinander und ist kaum zu fassen. Knackpunkt ist ihre Unsichtbarkeit. Mit neuen Messverfahren versucht die Astrophysikerin Marcelle Soares-Santos Licht ins Dunkel zu bringen.

«Dunkle Energie lässt sich nur indirekt nachweisen –kosmische Ereignisse wie etwa die Kollision von zwei Sternen geben Hinweise darauf.»
Text: Simona Ryser
Bilder: Marc Latzel
An der langen Wandtafel im sonst eher kargen Büro reihen sich Zahlen und Zeichen, Striche, Pfeile, Klammern aneinander – verwischt, überschrieben, korrigiert. Der ganze Schiefer ist voll mit Kreide geschriebener Formeln. Hier wird offenbar geknobelt. Gut vorstellbar, dass Marcelle Soares-Santos einen Moment an der Tafel verweilt und etwas ergänzt oder kommentiert, wenn sie ihr Büro betritt. Und damit die Superformel weiter gedeihen lässt, die dem Geheimnis des Kosmos näher rückt.
Marcelle Soares dos Santos ist Professorin für Astrophysik und beschäftigt sich mit der Dunklen Energie. «Richtiger wäre es, zu sagen: mit unsichtbarer Energie», sagt Soares-Santos. Genau das nämlich sei das Problem der Dunklen Energie: ihre Unsichtbarkeit. «Dunkle Energie lässt sich nur indirekt nachweisen», sagt die Physikerin. «Kosmische Ereignisse wie etwa die Kollision von zwei Sternen, besser gesagt das Licht und die Wellen, die diese auslöst, geben Hinweise darauf.» Was diese mysteriöse Kraft aber ausmacht, nach welchen Gesetzen sie funktioniert, weiss man kaum.
Gefallen am Schnee gefunden
Die Astrophysikerin beschäftigt sich schon lange mit dem Geheimnis der Dunklen Energie, seit bald einem Jahr forscht sie nun an der Universität Zürich. Sie lächelt. Sie habe sich schnell eingelebt. Der Campus Irchel liegt am Waldrand und Soares-Santos mag die Natur. Auch am hiesigen Klima hat sie Gefallen gefunden. Die Professorin schmunzelt. Eigentlich kommt sie aus einem Land, wo das ganze Jahr hindurch Sommer und Sonne sind, aus Brasilien. «Dort muss man nie auf den Wetterbericht schauen», lacht sie. Die vier Jahreszeiten hätten aber durchaus auch ihren Reiz. Als sie in die USA ge-

kommen war, sei der Winter eine Herausforderung gewesen. Dort war Schnee für sie immer etwas Unangenehmes. Letzten Winter in der Schweiz hat sie dann das Skifahren entdeckt und dabei doch noch Gefallen am Schnee gefunden.
Über dem Campus Irchel hängt ein blauer Bilderbuch-Herbsthimmel und kaschiert das unendliche Universum, das sich dahinter verbirgt. Der Kosmos ist nach wie vor ein grosses, ungelöstes Rätsel. Marcelle Soares-Santos nickt zustimmend. Tatsächlich bestehen nur gerade etwa 5 Prozent aus identifizierter Materie – Sterne, Galaxien, Planeten – aus nach Standardphysik bekannten Elementarteilchen, Elektronen und Kernteilchen, erklärt sie. Ein gutes Drittel der Galaxienmasse ist nicht identifizierte Dunkle Materie. Ganze 70 Prozent sind Dunkle Energie. Und die verhält sich schwindelerregend unfassbar. Sie hält den Raum nicht etwa zusammen, wie es von Energie zu erwarten wäre, sondern im Gegenteil. Sie treibt ihn auseinander, und dies auch noch beschleunigt. Vor rund 14 Milliarden Jahren, beim Urknall, sind Raum und Zeit entstanden. Seither dehnt sich das Universum unaufhörlich aus.
Was für eine Kraft ist hier am Werk, die den Raum auseinandertreibt? Warum tut sie das und unter welchen
Die Dark Energy Cam, die Marcelle Soares-Santos mitentwickelt hat, macht Ereignisse im Kosmos sichtbar und hilft, diesen systematisch zu untersuchen.
Bedingungen? Darüber zerbricht sich Soares-Santos wie viele andere Astrophysikerinnen und Astrophysiker auf der ganzen Welt den Kopf. Einige Hypothesen gebe es, sagt die Professorin. Heute rechnet man wieder mit der kosmologischen Konstante, die Albert Einstein zuerst als zusätzlichen Term seinen Gleichungen in der Allgemeinen Relativitätstheorie hinzugefügt und dann wieder verworfen hat. Einige Forschende berufen sich auf die Vakuumenergie des Raums. Oder vielleicht verhält sich die Dunkle Energie nach gänzlich fremden, uns unbekannten physikalischen Gesetzen. Schlussendlich bleibt es dabei: Die wunderliche Energie bleibt rätselhaft – weil noch immer zu wenig Daten vorhanden sind.
Kosmische Ereignisse kartieren
Genau das will Soares-Santos ändern, und zwar mit der Formel, die auf der Wandtafel in ihrem Büro steht. Sie und ihr Team sind nämlich daran, eine ausgeklügelte Untersuchungsmethode zu entwickeln, die Forschenden helfen soll, mehr über kosmische Ereignisse zu erfahren. Dabei erarbeiten sie eine Art 3D-Karte, die die Distanzen, die Leuchtdichten, Helligkeitsgrade und Farben von kosmologischen Objekten und Phänomenen simuliert. Dafür werden viele kleine Informationshappen – all die Vibrationen, Signale, Bilder und Wellen, die aus dem Universum empfangen werden wie Puzzleteile zusammengefügt, um daraus die besagte dreidimensionale Karte zu generieren. Soares-Santos wirft einen Blick auf die Wandtafel. «So ein Verfahren ist enorm aufwendig und braucht Zeit», sagt sie. Man muss rechnen, überarbeiten, dann testen, experimentieren, optimieren und verifizieren. «Erst wenn es im Kleinen funktioniert, kann man die Realisierung im Grossen überhaupt angehen»,
sagt die Astrophysikerin. Im Moment muss das Team noch an der Wandtafel knobeln.
Marcelle SoaresSantos reist mit ihren kühnen Berechnungen nicht nur durch die unendlichen Galaxien, sie reist auch durch die Kontinente. Sie ist im Südosten Brasiliens aufgewachsen, in Vitória, der Bundeshauptstadt von Espírito Santo, wo sie auch die Hochschule besuchte. Nachdem sie den PhD an der University of São Paulo gemacht hatte, ging die junge Akademikerin in die USA, ans Fermilab, unweit Chicago. Es sei eine tolle Erfahrung gewesen, erzählt sie. Die Menschen seien aus der ganzen Welt gekommen. Geeint habe sie das Interesse an Physik, erzählt SoaresSantos mit strahlenden Augen. Dort hat sie auch ihren Mann, einen deutschen Astrophysiker, kennengelernt – mit dem sie unterdessen einen vierjährigen Sohn hat und der gleich im Büro nebenann am PhysikInstitut zu Dunkler Materie forscht.
Schon am Fermilab war SoaresSantos klar gewesen: Wenn man Galaxien, Sternexplosionen und Sternhaufen untersuchen will, die Milliarden von Lichtjahren entfernt sind, muss man in die Entwicklung der Messinstrumente investieren. So war die Astrophysikerin im Rahmen der Dark Energy Survey Collaboration (DES) federführend bei der Entwicklung der Dark Energy Cam (DECam). Dabei handelt es sich um riesiges Teleskop, das kosmische Ereignisse und Objekte sichtbar macht und hilft, den Kosmos systematisch zu untersuchen. Das immense Fernrohr – allein die Kamera wiegt gut 1,7 Tonnen – steht in den chilenischen Anden und fängt dort Ereignisse im Universum ein.
Explosiver Anfang
Von draussen dringen die Sonnenstrahlen durch die Storen. SoaresSantos’ Schreibtisch leuchtet beinahe etwas galaktisch auf. Unterdessen sind wir mit den Gedanken weit draussen im All angekommen. Wenn wir die Reise zurückmachen, wie hat das alles angefangen? Tatsächlich erinnert sich die Astrophysikerin an ein Ereignis in ihrer Kindheit in Brasilien, das prägend war und sie vielleicht gar auf die Physik gebracht hat. Damals hatte ihr Vater für ein Bergbauunternehmen gearbeitet. Eines Tages unternahm die Schule einen Ausflug zu dieser Mine. Zur Demonstration des Eisenerzabbaus wurde – in gebührendem Abstand zur Schulklasse – eine Explosion ausgelöst. «Ich habe die Explosion gesehen, aber zuerst nichts gehört, erst mit etwas Verzögerung ist der Schall bei meinen Ohren angekommen», erzählt SoaresSantos. Das sei für sie als kleines Mädchen ein Überraschungsmoment gewesen. «Wow! Wie kann so etwas sein?» Der Lehrer habe ihr dann erklärt, dass sich Schall langsamer bewegt als Licht. Das habe sie unglaublich fasziniert – und ist vielleicht tatsächlich irgendwo hängen geblieben, erforscht sie doch auch heute Schall und Licht, wenn auch auf einem ganz anderen Gebiet. Es klopft. der Ehemann streckt den Kopf durch die Tür, ob sie auch zum Lunch komme. Die Astrophysikerin wirft einen kurzen Blick zur Wandtafel und schüttelt dann den Kopf. Sie hat noch viel zu tun.
Berg oder Strand?
Welches ist die grösste Entdeckung Ihres Fachs?
1998 wurde festgestellt, dass das Universum beschleunigt expandiert. Das ist wahrscheinlich eine der grössten Entdeckungen der Physik in neuerer Zeit. Denn eine solche Beschleunigung erfordert eine unsichtbare Kraft. Die Physik dieser so genannten Dunklen Energie zu verstehen, ist eine der grössten Herausforderungen auf meinem Forschungsgebiet.
Wo sind Sie am kreativsten?
Ich bin am kreativsten in kleinen Gruppen, wo Ideen schnell hin und her springen und zum Beispiel auf einer Wandtafel skizziert werden können.
Was tun Sie, um den Kopf auszulüften und auf neue Gedanken zu kommen?
Ich mag es, in Gedanken eine Diskussion mit einem Kollegen oder einer Kollegin über ein Problem durchzuspielen. Das hilft mir, das Problem besser zu fassen und eine Lösung zu finden.
Mit welcher berühmten Persönlichkeit würden Sie gerne abendessen und weshalb?
Wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, würde ich mit Albert Einstein abendessen gehen. So vieles in unserem Fachgebiet wurde durch seine Ideen beeinflusst, es wäre wunderbar, mit ihm persönlich darüber zu sprechen.
Drei Bücher, die Sie auf eine einsame Insel mitnehmen würden?
«Hundert Jahre Einsamkeit» von Gabriel García Marques und «Fiktionen» von Jorge Luis Borges sind zwei Bücher, die ich seit Jahrzehnten nicht mehr gelesen habe und die ich gerne wieder lesen würde, während ich irgendwo am Strand Kokoswasser trinke. Ich würde auch «A Boy, a Dog, and a Frog» von Mercer Mayer mitnehmen, das Lieblingsbuch meines Sohnes, seit er ein Baby war.
Kugelschreiber oder Laptop?
Ich gebe zu, dass physische Notizbücher im alten Stil einen Reiz haben, aber es gibt immer eine gewisse Doppelarbeit, wenn ich diese Ideen in eine Forschungsarbeit, einen Vorschlag oder einen Bericht einbringen muss. Daher ist der Laptop für mich also definitiv die effizienteste Option.
Berg oder Strand?
Strand. Ein sonniger Tag am Strand gibt mir das Gefühl, meiner Heimatstadt Vitória in Brasilien näher zu sein.
INTERVIEW — Theologie und Weltraum
Andreas Losch und Matthias Wüthrich beschäftigen sich mit der Frage, was die Erforschung und Nutzung des Weltalls für die Theologie und die Menschheit bedeutet. Dabei geht es auch um praktische Fragen wie jene, ob es auch für das All Nachhaltigkeitsziele braucht.

Beschäftigen sich mit dem Weltraum und mit der Frage nach ausserirdischem Leben: die beiden Theologen
Andreas Losch, Matthias Wüthrich, Sie sind Teil des UZH Space Hub, wo vor allem Forschende der Naturwissenschaften zu Fragen der Fernerkundung, der Luftfahrt und des Kosmos arbeiten. Was interessiert Sie als Theologen am Weltraum?
MATTHIAS WÜTHRICH: Mich interessiert aus theologischer Perspektive beispielsweise die Frage, was Leben ist, und in diesem Zusammenhang auch die astrobiologische Frage nach extraterrestrischem Leben. Dazu

habe ich zusammen mit UZH-Space-Hub-Direktor Oliver Ullrich schon Lehrveranstaltungen gemacht. Was sucht man eigentlich, wenn man nach Leben im Universum sucht? Diese Frage ist zirkulär. Man hat schon ein Verständnis von Leben, um überhaupt Leben entdecken zu können. Da besteht Reflexionsbedarf. Ich
beschäftige mich aber auch mit der Frage, was eigentlich der Himmel ist.
Ist das denn nicht klar?
WÜTHRICH: Nicht unbedingt. Der religiöse Himmel (Heaven) und der naturphilosophische oder
naturwissenschaftliche Himmel (Sky) wurden bis in die Frühe Neuzeit immer zusammen gedacht. Dann beginnen sie langsam auseinanderzubrechen. Der religiöse Himmel wurde von den Naturwissenschaften an den Rand gedrängt. Für die Theologie ist er aber essenziell. Die Frage ist nun, wie sich unter modernen Bedingungen Heaven und Sky zusammendenken lassen.
Herr Losch, weshalb sind Sie Teil des UZH Space Hub?
ANDREAS LOSCH: Ich bin 2014 in die Schweiz gekommen und habe zuerst als Theologe am Center for Space and Habitability der Universität Bern geforscht. Dort habe ich an einem Projekt mitgearbeitet, das sich aus astrobiologischer Perspektive mit möglichem Leben jenseits unseres Planeten beschäftigte. Später habe ich mich dann mit einer Arbeit zum Thema «Der gestirnte Himmel über uns. Theologie, Naturwissenschaft und Ethik» an der UZH habilitiert. Und ich habe ein eigenes Projekt zur planetaren Nachhaltigkeit, wie ich das genannt habe, lanciert – zu Nachhaltigkeitsfragen auf der Erde und im erdnahen Weltraum. Seit ich in der Schweiz bin, ist der Weltraum also ein wichtiges Thema in meiner Agenda.
Sie interessieren sich beide für Fragen nach extraterrestrischem Leben. Inwiefern sind diese theologisch relevant?
WÜTHRICH: Ich möchte zuerst einen Schlenker machen: Als 1968 die Sonde «Apollo 8» vom Mond aus die Erde ablichtete, ist unser blauer Planet das erste Mal so richtig ins Bewusstsein der Menschheit gedrungen. Das Bild der fragilen blauen Murmel hat viele Emotionen ausgelöst und hatte einen grossen Einfluss etwa auf die Öko-Bewegung. Es ist für mich auch ein Sinnbild für die Frage, wie ich mit diesem Thema umgehe. Denn das Ausgreifen in den Kosmos löst einen Rückblick auf uns selber aus, auf unser Selbst- und Weltverständnis. Was
Andreas Losch ist evangelischer Theologe. Er hat sich auf den Dialog mit Naturwissenschaften und Philosophie spezialisiert. Losch war Managing Editor der Martin-Buber-Werkausgabe, Koordinator des Projekts «Life beyond our planet?» am Center for Space and Habitability (CSH) der Universität Bern. Aktuell lehrt er als Privatdozent an der Universität Zürich und forscht zu einer «Ethik der Planetaren Nachhaltigkeit» in Bern. andreas.losch@uzh.ch
Matthias Wüthrich ist ordentlicher Professor für Systematische Theologie, insbesondere Religionsphilosophie an der UZH. Er ist Co-Leiter des Instituts für Hermeneutik und Religionsphilosophie. Neben Forschungen zur Theologie Karl Barths befasst er sich mit Raumtheorien, dem Dialog «Science and Religion», Digital Religions sowie dem Theodizeeproblem. matthias.wuethrich@theol.uzh.ch
immer wir im Universum entdecken werden, hat Einfluss auf uns und muss interpretiert und verstanden werden. Wenn wir jetzt nach Leben dort draussen suchen, dann hat das eben auch einen Einfluss auf das, was uns hier auf der Erde umtreibt. Meine Rolle als Theologe ist nicht nur, danach zu fragen, wie denn Leben mit Gott zusammenhängt, sondern zunächst mal einfach bei der Klärung zu helfen, was wir denn machen, wenn wir nach Leben fragen. Ist das beispielsweise überhaupt ein naturwissenschaftlicher Begriff?
Und, ist es einer?
WÜTHRICH: Ich würde sagen, nein. Naturwissenschaften können Lebensphänomene beschreiben, sie können Eigenschaftslisten und Biosignaturen von Leben erheben. Und sie können auflisten und umkreisen, was funktional zum Leben gehört. Aber sobald wir zu einer prinzipiellen Definition ausholen und sagen «Leben ist – », haben wir die Ebene naturwissenschaftlicher Methodik verlassen und sind auf einer weltanschaulichen Ebene. Sich damit zu befassen, ist eine wichtige Aufgabe der Theologie und der Ethik.
Welche Fragen können die Naturwissenschaften denn nicht beantworten, Theologie und Ethik aber schon?
LOSCH: Wir brauchen Werte, um zu handeln und um zu entscheiden, was gut ist und was nicht. Solche Wertefragen sind nicht Thema der Naturwissenschaften. Theologie und Ethik sind dagegen Disziplinen, die darüber intensiv nachdenken.
Herr Wüthrich, Sie haben gesagt, das Erforschen des Kosmos habe auch Rückwirkungen auf das Leben und unser Selbstverständnis auf der Erde. Wie würde denn extraterrestrisches Leben den Blick auf uns selbst verändern?
WÜTHRICH: Es wäre eine weitere Dezentrierung des Menschen, eine weitere «Kränkung», wie es Sigmund Freud genannt hat. Nach Kopernikus sind die Erde und der Mensch nicht mehr Mittelpunkt des Universums, nach Darwin stammt der Mensch vom Affen ab, nach Freud ist er nicht mehr «Herr im eigenen Haus», weil es unbewusste Tiefenschichten in ihm gibt, die ihn bestimmen. Heute – das ist der nächste Schritt – denken viele, wir würden von Maschinen mit KI überholt. Wenn nun irgendwann vielleicht sogar intelligentes ausserirdisches Leben entdeckt würde, wäre das eine weitere Relativierung des anthropozentrischen Weltbildes, das die westliche Geschichte geprägt hat.
LOSCH: In einer Vorlesung habe ich einmal versucht, die Frage, was die Existenz von ausserirdischen Leben für die Theologie bedeuten würde, fundamental durchzubuchstabieren – für die Schöpfungs-, Offenbarungs- und Erlösungstheologie.
Mit welchem Ergebnis?
LOSCH: Nehmen wir zum Beispiel die Schöpfungstheologie. Dort ist die Argumentation am einfachs-
«George Lemaître hat mit der Big-Bang-Theorie, inspiriert von der biblischen Schöpfungsgeschichte, eine bis heute anerkannte wissenschaftliche Theorie für den Ursprung des Universums formuliert.»
Andreas Losch, Theologe

ten. Nimmt man die Existenz von ausserirdischem Leben an, dann gibt es irgendwo im Universum noch eine zweite Schöpfung, einen zweiten Anfang von Leben. «The more the merrier» könnte man dazu sagen – es ist schön und gereicht Gott zur Ehre, dass es mehr Leben ausserhalb der Erde gibt. Bereits im 18. Jahrhundert konnten die Menschen viel mit dem Gedanken anfangen, dass es Leben jenseits der Erde gibt. Damals waren das noch keine «Aliens», wie man heute sagen würde, sondern man sprach von «Bewohnern fremder Welten».
In der Vergangenheit hat man auch angenommen, dass Gott im Himmel wohnt. Heute schauen wir dagegen in ein gottloses Universum. Wann ist der natur wissenschaftlichen Betrachtung des Kosmos Gott abhandengekommen?
WÜTHRICH: Das war ein sukzessiver Prozess. Oft wird Newtons mechanisches Weltbild als Wendepunkt genannt. Für Newton selbst waren Glaube und Naturwissenschaft aber noch eine Einheit. Er ging noch von einer göttlichen Vorsehung aus, die den ganzen kosmischen Raum zusammenhält. In der Rezeption von Newton wird dieses Weltbild dann aber immer mechanistischer, Gott geht sozusagen allmählich verloren. Diese Entwicklung kann man nicht an einem bestimmten Punkt festmachen.
Der Himmel wird allmählich entzaubert?
LOSCH: Vielleicht kann man auch sagen, dass Gottes Wirken zuerst überall gedacht wurde. Und weil das so war, konnte man den Kosmos auch mal genauso gut ohne Gott denken. Wenn man Gott weglässt, funk
tionieren die Naturgesetze immer noch – auch ohne den Gesetzgeber sozusagen.
WÜTHRICH: Die Folgen dieser Entwicklung waren für die Theologie schon einschneidend. Sowohl die katholische als auch die protestantische Tradition gingen davon aus, dass Gott im Himmel wohnt, inklusive der Seligen, der Engel und Christus, der nach der Himmelfahrt zur Rechten Gottes ist. Wenn diese Vorstellung wegfällt, dann fragt man sich, wo Gott denn nun sei. Der kritische Theologe David Friedrich Strauss (1808–1874) hat dann etwa amüsiert gesagt: «Gott geriet in Wohnungsnot.» Die Theologie hatte in der Moderne die Aufgabe, diesen Ausfall zu kompensieren. Sie haben sich in Ihrer Habilitation mit einer Theologie des Raums beschäftigt. Kann sie eine Lösung für die Wohnungsnot Gottes anbieten?
WÜTHRICH: Ich denke zumindest, dass wir Raum in der Theologie neu, das heisst relationaler denken sollten. Man muss unterscheiden zwischen einem Containermodell und einem relationalen Modell des Raumes. In der Vergangenheit wurde Gott in einem containerartig vorgestellten, hellglänzenden, unbeweglichen, transzendenten Ort jenseits der äussersten Fixsternsphäre lokalisiert. Wenn wir heute Raum relational denken, ermöglicht das eine neue Konfiguration auch des religiösen Himmels. Der Himmel ist dann dort, wo Gott ist, und nicht umgekehrt Gott dort, wo der Himmel ist. Der religiöse Himmel wird potenziell «irdischer». Eigentlich wurde auch durch die naturwissenschaftliche Forschung deutlich, dass wir auf der Erde schon im Himmel sind. Wir sind ein winziger Teil dieses Universums.

«Wenn irgendwann intelligentes ausserirdisches Leben entdeckt würde, wäre das eine weitere Relativierung des anthropozentrischen Weltbildes, das die westliche Geschichte geprägt hat.»
Matthias Wüthrich, Theologe
Astrophysiker:innen unter anderen erforschen am UZH Space Hub dieses Universum. Sie beschäftigen sich beispielsweise mit Dunkler Materie oder dem Big Bang. Gibt es da Berührungspunkte mit der Theologie, wo man gegenseitig voneinander profitieren kann?
WÜTHRICH: Der Himmel hat immer schon so etwas wie Transzendenzvorstellungen ausgelöst und er tut das immer noch, wie Umfragen bei Jugendlichen zeigen. Ein Beitrag der Theologie zum Space Hub könnte zum Beispiel sein, bei der Aufklärung von historischen Voraussetzungen solcher Vorstellungen oder von Modellen und Metaphern in der Astronomie zu helfen. Andreas, hast du nicht einmal erwähnt, dass das theologische Konzept der Creatio ex nihilo, der Schöpfung aus dem Nichts, eine Vorlage gewesen ist für die Theorie des Big Bang?
LOSCH: Ich habe mich immer gefragt, ob die Theologie den Naturwissenschaften etwas beibringen kann. Dann habe ich ein historisches Beispiel dafür gefunden, die Big-Bang-Theorie. Ihr Erfinder war George Lemaître (1894–1966). Der Belgier war Priester und Astrophysiker. Er hat die Idee formuliert, dass das Universum einen Anfang gehabt haben könnte. Bis zu diesem Zeitpunkt ging man mit Aristoteles’ Weltewigkeitslehre davon aus, es habe die Welt und das Universum immer gegeben und es werde sie immer geben. Lemaître hat mit der Big-Bang-Theorie, inspiriert von der biblischen Schöpfungsgeschichte, eine bis heute anerkannte wissenschaftliche Theorie für den Ursprung des Universums formuliert.
WÜTHRICH: Als Ergänzung: Die Creatio ex nihilo ist eigentlich gar nicht biblisch, sondern eine spätere Reformulierung einer althebräischen Vorstellung von Schöpfung, die so etwas wie Materie schon vorausgesetzt
hat und in diesem Sinn gar nicht eine Schöpfung aus dem Nichts war. Das Beispiel zeigt aber, wie die Geistesgeschichte immer wieder Vorstellungen produziert hat, die dann subkutan eingeflossen sind in naturwissenschaftliche Konzepte und den öffentlichen Diskurs. Das gilt beispielsweise auch für den theologisch geprägten Begriff der Bewahrung der Schöpfung, der sich selbst im säkularen Kontext durchgesetzt hat.
LOSCH: Für Naturwissenschaftler könnte es interessant sein, ihr Vorverständnis noch einmal neu im Licht bestehender geisteswissenschaftlicher Konzepte zu reflektieren. Wie das Beispiel des Big Bang zeigt, könnte das zu wissenschaftlichen Durchbrüchen beitragen.
Sie haben gesagt, Naturwissenschaften könnten keinen Sinn produzieren. Ihre Erkenntnisse müssen in einen grösseren Zusammenhang gestellt und interpretiert werden. Was können Sie als Theologen da leisten?
WÜTHRICH: Es ist auch unsere Aufgabe, wissenschaftliche Erkenntnisse zu verbinden mit den Sinnfragen, die uns bewegen. Die Theologie tut das immer auch vor dem Hintergrund biblisch geprägter Narrative und ihrer breiten Wirkungsgeschichte. Diese untersuchen wir und wir schreiben sie weiter.
Können Sie das erklären?
WÜTHRICH: Es gibt tradierte religiöse Narrative. Religion lebt davon, dass man diese sinnstiftenden Erzählungen bewohnt, dass man sein eigenes Leben in sie einzeichnet und das Leben deutet im Horizont dieser Geschichten. Theologie versucht, diese Narrative zu verstehen, zu deuten und für die Gegenwart fruchtbar zu
machen, aber auch zu kritisieren. Innerhalb dieser Narrative gibt es Sinnpotenziale, die sich auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse anwenden lassen. Das moderne Diskursfeld, wo solche Anwendungen wissenschaftlich reflektiert werden, nennt sich «Science and Religion».
Herr Losch, Sie beschäftigen sich mit der planetaren Nachhaltigkeit. In diesem Kontext plädieren sie für ein achtzehntes Nachhaltigkeitsziel der UNO für den Weltraum. Können Sie erklären, worum es dabei geht?
LOSCH: Der englische Begriff für «nachhaltig», also «sustainable», kommt ursprünglich aus dem Weltrat der Kirchen. Er wurde dann für den Bericht «Unsere gemeinsame Zukunft» der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung übernommen, der 1987 veröffentlicht wurde. Seitdem ist er ein fester Bestandteil öffentlicher Diskussionen. Ich war der Meinung, Nachhaltigkeit müsse auch im Weltraum eine Rolle spielen. Als ich mir dann die Nachhaltigkeitsziele der UNO angeschaut habe, habe ich mich gefragt, wo ist der Weltraum? Wir haben die planetaren Grenzen, von denen wir sagen, sie dürften nicht überschritten werden. Vielleicht sollten wir solche auch für den Weltraum definieren.
Welche Nachhaltigkeitsprobleme sehen Sie im Weltraum?
LOSCH: Da sind die Satelliten, die in immer grösserer Zahl um die Erde kreisen. Was geschieht mit dem Mond, wenn wir dort Weltraumbergbau betreiben? Oder: Wie beeinflussen die menschlichen Aktivitäten im All den Nachthimmel? Wenn wir immer mehr Satelliten in den Erdorbit schiessen, müssen wir uns auch über deren spätere Entsorgung Gedanken machen. Lange Zeit dachte man, das Problem mit den ausgemusterten Satelliten löse sich dadurch, dass sie langsam zur Erde gleiten und dann verglühen. Doch damit sind sie natürlich nicht einfach weg, sondern sie hinterlassen Partikel in den sensiblen Schichten der Atmosphäre. Wie das die Atmosphäre beeinflusst und verändert, ist noch nicht erforscht.
Ist Nachhaltigkeit für die Weltraum-Enthusiasten überhaupt ein Thema?
LOSCH: Durchaus. Doch sie steht halt nicht zuoberst auf der Prioritätenliste. 2018 wurde ich zum
UZH Space Hub
Weltraumkongress der Vereinten Nationen eingeladen, weil damals kaum jemand an diesem Thema gearbeitet hat. Heute sehe ich meine Aufgabe darin, diesen Aspekt in Projekte und Tagungen einzubringen, auch am UZH Space Hub.
Ist es vorstellbar, dass die UNO ein 18. Nachhaltigkeitsziel formuliert?
LOSCH: Das wurde mehrfach dem Committee on the Peaceful Uses of Outer Space der UNO vorgeschlagen. Die Frage ist, was 2030 mit den Nachhaltigkeitszielen passiert, ob diese neu aufgelegt werden oder ob es ein Nachfolgemodell gibt, die Nachhaltigkeitsziele sind ja selbst Nachfolger der Millenniumziele der Vereinten Nationen. Ich glaube, der Weltraum wird auf jeden Fall eine Rolle spielen, offen ist, ob für ihn ein eigenes Ziel definiert wird.
UZH Magazin — 29. Jahrgang, Nr. 4 — Dezember 2024 — www.magazin.uzh.ch
Herausgeberin: Universitätsleitung der Universität Zürich durch die Abteilung Kommunikation Leiter Storytelling & Inhouse Media: David Werner, david.werner@uzh.ch Verantwortliche Redaktion: Thomas Gull, thomas.gull@uzh.ch; Roger Nickl, roger.nickl@uzh.ch
Autorinnen und Autoren: Brigitte Blöchlinger, brigitte.bloechlinger@uzh.ch; Andres Eberhard, mail@anderseberhard.ch; Mia Catarina Gull, miacatarinagull@gmail.com; Simona Ryser, simona.ryser@bluewin.ch; Carole Scheidegger, carole.scheidegger@uzh.ch; Stefan Stöcklin, stefan.stoecklin@uzh.ch; Theo von Däniken, theo.vondaeniken@uzh.ch; Dr. Tanja Wirz, tanja.wirz@gmx.ch Fotografinnen und Fotografen: Frank Brüderli, Marc Latzel, Ursula Meisser, Diana Ulrich, Stefan Walter — Illustrationen: Cornelia Gann, Noyau
Gestaltung: HinderSchlatterFeuz, Zürich — Lithos und Druck: AVD Goldach AG, Sulzstrasse 10–12, 9403 Goldach, www.avd.ch Inserate: print-ad kretz gmbh, 8646 Wagen, Telefon 044 924 20 70, info@kretzgmbh.ch
Abonnenten: Das UZH-Magazin kann kostenlos abonniert werden: publishing@kommunikation.uzh.ch — Adresse: Universität Zürich, Kommunikation, Redaktion UZH Magazin, Seilergraben 49, 8001 Zürich — Sekretariat: Fabiola Thomann, Tel. 044 634 44 30, Fax 044 634 42 84, office@kommunikation.uzh.ch
Auflage: 20000 Exemplare; erscheint viermal jährlich — Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck von Arti keln mit Genehmigung der Redaktion ISSN 2235-2805 — Dieses Produkt wurde klimaneutral produziert.
Der UZH Space Hub ist ein Scharnier zwischen der Wissenschaft und der aufstrebenden New Space Economy. Er vereint Forschungsaktivitäten der UZH in den Bereichen Space und Aviation. Schwerpunkte sind Biotechnologie, Medizin, Erdbeobachtung, Fernerkundung, Astrophysik sowie autonomes Fliegen und Navigieren. Der UZH Space Hub wurde 2018 gegründet und als Innovationscluster mit Unterstützung durch den UZH Innovation Hub weiterentwickelt. Inzwischen hat er internationale Bedeutung erlangt. Der Space Hub umfasst heute 35 hochklassige Forschungsgruppen und ein eigenes Flugprogramm. Der neue Standort im Innovationspark Zürich bietet hervorragende Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Unternehmen und unterstreicht das integrative Konzept des Space Hub. www.spacehub.uzh.ch Drucksache
Glücklich gross werden, gemalt von Noyau

Das nächste UZH Magazin erscheint im März
Empowering Board Leaders

Erfahren Sie mehr über unsere Programme
Buchen Sie ein Beratungsgespräch
→ VR-Zertifikats-Programme / VR CAS (DE, EN)
→ VR-Diplom-Programme (DE, EN, FR)
→ VR-Kurse zu verschiedenen Fokusthemen (DE, EN, FR, IT)
→ VR-Masterclasses (DE, EN, FR)
Mehr Informationen unter → boardschool.org
→ info@boardschool.org
→ +41 71 224 23 72

