UZH magazin
Die Zeitschrift für Wissenschaft & universitäres Leben



erfolgreich — 28
ausserdem:
Vielsprachige Schweiz — 10
Natürlicher Ersatz für Pestizide — 16
Die zweite Quantenrevolution — 60
SONDERAUSGABEinKooperationmit:

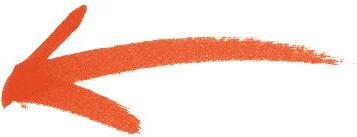
Als Absolventin oder Absolvent der UZH gehören Sie zum grossen Netzwerk der UZH-Alumni und tragen den guten Ruf unserer Alma Mater in die Gesellscha . Erzählen Sie Ihren Studienkolleg:innen von uns und helfen Sie mit, unsere Gemeinscha zu erweitern.
Erfahren Sie, wie Sie mitwirken können.
Die Welt wird gerade neu geordnet. Europa scheint von allen Seiten unter Druck: Ein aggressives Russland bedroht die europäische Sicherheit und missachtet mit dem Krieg in der Ukraine die internationale Ordnung. Der neue USPräsident unterminiert die transatlantische Partnerschaft und China macht Europa auch bei der Hochtechnologie und den Autos

«Europa muss strategisch unabhängig werden», sagt Politikwissenschaftlerin Stefanie Walter.
Konkurrenz. Hinzu kommt, dass in vielen europäischen Ländern autoritäre populistische Parteien Demokratie und Rechtsstaat aushebeln wollen.
Wie steht es um Europa, was kann der alte Kontinent tun, um sich zu behaupten im neuen Spiel der Mächte? Was kann er tun, um den Wohlstand und die Sicherheit seiner Bürger:innen zu bewahren? Wir haben diese Fragen mit Expert:innen der UZH diskutiert und versuchen, sie aus historischer, politischer, juristischer, ökonomischer und ökologischer Perspektive zu beantworten. Das Fazit: Europa ist nach wie vor eine ökonomische Macht. Doch dieses Potenzial wird zu wenig genutzt, um geopolitisch eine gewichtige Rolle zu spielen. Und man hat sich allzu lange in der nun offensichtlich falschen Sicherheit gewiegt, unter dem Schutz der USA und der Nato zu stehen.
Nun muss Europa schnell umdenken und politisch und militärisch auf eigenen Beinen stehen. «Europa muss strategisch unabhängig werden», sagt die Politikwissenschaftlerin Stefanie Walter. Dazu gehört, dass es die allenthalben angekündigte Aufrüstung koordiniert und eine europäische Sicherheits und Verteidi
gungspolitik entwickelt, betont Politikwissenschaftler Jonathan Slapin. Und Europa muss sich auch ökonomisch zusammenraufen und seinen grossen Binnenmarkt besser nutzen, da sind sich der Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann und der Ökonom Mathias Hoffmann einig. Dazu gehören ein vereinheitlichter Kapitalmarkt und Bankenfusionen, damit sich Unternehmen einfacher finanzieren können.
Was sich deutlich zeigt: Europa ist nur stark, wenn es geeint auftritt und man sich darauf einigen kann, wie es in Zukunft weitergehen soll. In eine ganz andere Richtung gehen wollen die autoritären Populisten und die neuen Nationalisten. Sie wollen kein geeintes Europa, sondern ein fragmentiertes, wo jeder für sich selber schaut, zum Schaden aller. Die Zukunft Europas hängt davon ab, welche der beiden politischen Visionen sich schlussendlich durchsetzt.
Weiter in diesem Heft: 2025 ist das UNOJahr der Quantenphysik. Im Interview erklärt der UZHPhysiker Titus Neupert, wie die Quantenphysik die Welt verändert hat, wie sie die technologische Entwicklung vorantreibt und welche Rolle die UZH dabei spielt.
Die Rechtsanwältin und UZHAlumna Cordelia Bähr ist der juristische Kopf hinter der erfolgreichen Klage der Schweizer Klimaseniorinnen am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg. Im Porträt stellen wir die erfolgreiche Juristin vor.
Lange Zeit galt die Schweiz als viersprachiges Land. Das hat sich grundlegend verändert, wie das neue Buch «Sprachenräume der Schweiz» zeigt, das von UZHLinguist:innen herausgegeben wurde.
Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre Ihre UZH-Magazin-Redaktion Thomas Gull und Roger Nickl

16
PFLANZENBIOLOGIE
16
Der Pflanzenphysiologe Cyril Zipfel erforscht, wie das Immunsystem von Pflanzen widerstandsfähig gemacht werden kann gegen Krankheiten und Schädlinge.
LINGUISTIK
Vielsprachige Schweiz — 10
In der Schweiz sind heute weit mehr als vier Sprachen zu Hause. Das zeigt das Buch «Sprachenräume der Schweiz» das von UZH-Linguist:innen herausgegeben wurde.
MEDIZIN
20
Seltene Krankheiten betreffen oft den Stoffwechsel. Der Universitäre Forschungsschwerpunkt ITINERARE entwickelt neue Therapien für solche Leiden.
IM FELD — 25
Gewitzte Meeressäuger

Europa ist gefordert: geopolitisch, militärisch, ökonomisch und ökologisch. Forschende der UZH analysieren in diesem Heft, wie es um den alten Kontinent steht und was getan werden muss, um die Herausfoderungen zu meistern.


UZH LIFE — Data Stewards
im
— 50
An der UZH sorgen Data Stewards dafür, dass Forschungsdaten vielfältig genutzt werden können.
PORTRÄT — Cordelia Bähr
— 56
Cordelia Bähr setzt sich für den Klimaschutz ein und wurde von der Zeitschrift «Nature» ausgezeichnet.
INTERVIEW — Physiker Titus Neupert
Zweite
— 60
Titus Neupert erklärt, wie die Quantenphysik vor 100 Jahren die Welt veränderte und wie sie heute eingesetzt wird.
RÜCKSPIEGEL — 6
BUCH FÜRS LEBEN — 7
DAS UNIDING — 7
DREISPRUNG — 8
ERFUNDEN AN DER UZH — 9
IMPRESSUM — 65
NOYEAU — 66
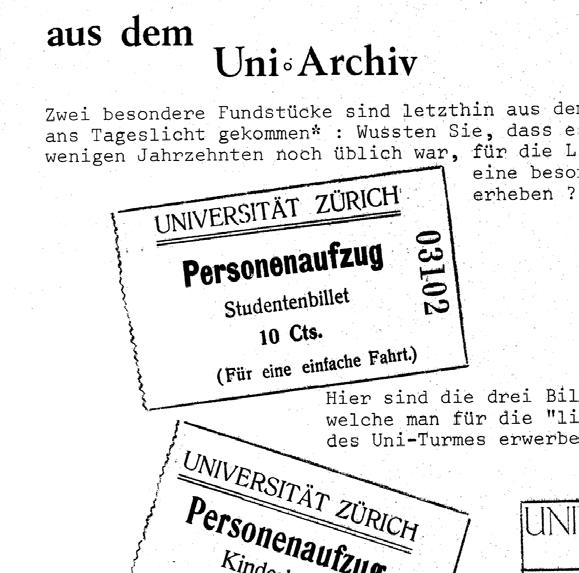
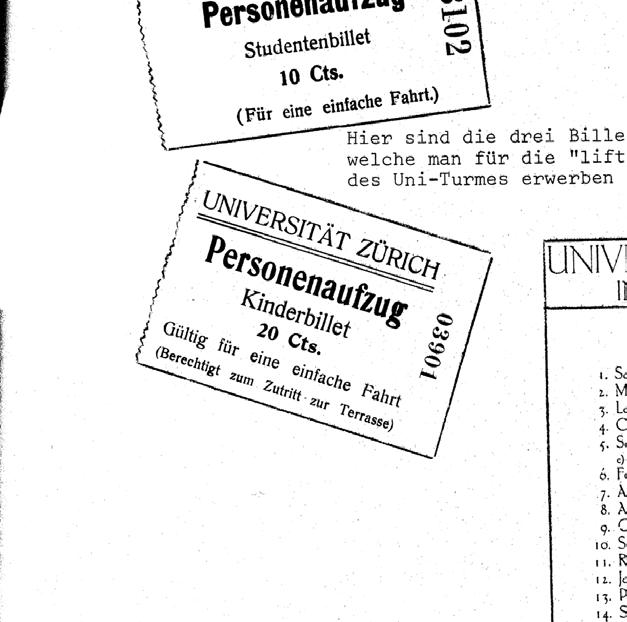
auf einen elektrischen Knopf» einfach zu bedienen. Die Herstellerfirma, «die
Beamten des Universitätsbureaus und weitere Fachpersonen» empfahlen jedoch aus Sicherheitsgründen einen bedienten Betrieb. Dieser musste entsprechend finanziert werden. Das Architekturbüro Curjel & Moser berechnete, dass eine Fahrt 4 Rappen Betriebskosten in Form von «elektrischer Kraft» verursachen werde. Hinzu kamen die Kosten des «Liftiers». Gesucht wurde «ein zuverlässiger, gewissenhafter, nicht zu junger Mann». Zwischen den Vorlesungen könne die angestellte Person andere Arbeiten erledigen, hiess es im Antrag an die Erziehungsdirektion – etwa im in der Nähe liegenden Archäologischen Museum oder in der Lesehalle im Turm-
Mittels Klingel am Lift konnte der Liftier gerufen werden. Veranschlagt wurde eine monatliche Besoldung von 150 bis 180 Franken. Die Fahrtkosten betrugen 30 Rappen für eine einzelne Fahrt und eine Semesterkarte kostete 2 Franken. Dozierende, «kränkliche und gebrechliche Studenten», Regierungsräte und Beamte der Bau- und Erziehungsdirektion fuhren kostenlos.
Tatsächlich hatten dann aber im Wechsel Heizer, Hauswart und Gärtner
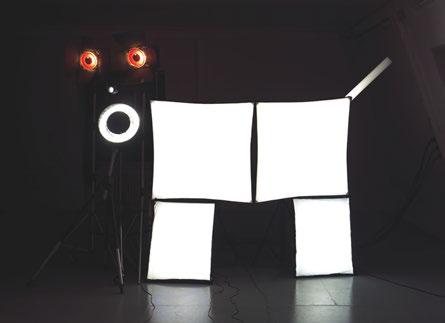
Mit unserer Weiterbildung gewinnen
Sie vertiefte Kenntnisse der Theorie und globalen Geschichte der Fotografie aus kunst, kultur und medienhistorischer Perspektive. Melden Sie sich jetzt an und profitieren Sie von einem facettenreichen und praxisorientierten Studium des Bildmediums Fotografie und seinen vielfältigen Kontexten! Dauer:
die Aufgabe inne. In den ersten Wochen wurde der Lift rege genutzt und generierte Tageseinnahmen von 9 bis 35 Franken. Auch Touristen, die die Aussicht vom Turm geniessen wollten, gehörten zu den Kunden. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs gingen die Einnahmen zurück und erreichten keine 500 Franken pro Semester mehr.
Ab 1916 wurde der Lift nur noch auf terminliche Absprache mit den Dozierenden bedient und Auswärtige nutzten die Klingel, um auf sich aufmerksam zu machen. Später wurde auf ein Schlüsselsystem umgestellt. Mit dem Wachstum der UZH nahmen die Probleme zu. Der Lift war dauernd besetzt und die Schlösser konnten «mit Drähten» und «jedem beliebigen Flachschlüssel» manipuliert werden.
Auf den Wunsch des Hauswarts 1959, bessere Schlösser anzubringen, entgegnete der Rektor, dass er beabsichtige, einen zweiten Lift bauen zu lassen. Doch bis diese Idee umgesetzt wurde, dauerte es einige Zeit. 1969 schliesslich sprach der Kantonsrat den Kredit und ein paar Jahre später wurde der zweite Lift in Betrieb genommen. Martin Akeret, UZH Archiv

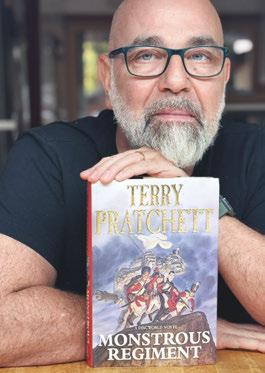
Sir Terry Pratchett (1948–2015) war ein englischer Autor und Satiriker, dessen Werk vor allem die Absurditäten und Ungerechtigkeiten unserer Welt mit Scharfsinn und Humor beleuchtet hat. Im Jahr 2007 wurde bei ihm eine aggressive Form von Alzheimer diagnostiziert. Fortan widmete sich Pratchett in seinen letzten Lebensjahren den Themen Sterbehilfe und Würde im Angesicht des Todes, unter anderem in einem bewegenden Dokumentarfilm über Dignitas. Sein Tod im März 2015 bedeutete für die Literatur welt den Verlust eines der originellsten Geister unserer Zeit. Als ich eingeladen wurde, einen Beitrag für die Rubrik «Buch fürs Leben» zu schreiben, überlegte ich zunächst, ein Werk zu wählen, das intellektuell anspruchsvoll und literarisch erhaben wirkt – vielleicht etwas von Schlink, Süsskind, Benioff oder einem anderen «richtigen» Schriftsteller. Doch ich entschied mich stattdessen für «Monstrous Regiment» (dt. «Weiberregiment») von Terry Pratchett, das ich meinen Kindern (zu dem Zeitpunkt bereits Jugendliche) auf einem Campingtrip am Lagerfeuer vorgelesen hatte. Ich bekenne mich dazu, nicht nur dieses Buch, sondern die gesamte «Scheibenwelt»Reihe immer und
immer wieder zu lesen. «Weiberregiment» erzählt die Geschichte von Polly Perks, die sich als Mann verkleidet, um in die Armee ihres kriegsgebeutelten Heimatlands Borograwia einzutreten und ihren verschollenen Bruder zu finden. Während sie und ihre Kameraden – ein kurioser Trupp von Aussenseitern – sich in den Krieg stürzen, entwirft Pratchett eine bitterkomische und gleichzeitig berührende Parabel über Geschlechterrollen, Identität, Macht und die Absurdität des Krieges. Mit seiner typischen Mischung aus scharfsinniger Satire und liebevollem Verständnis für menschliche Schwächen beleuchtet Pratchett nicht nur gesellschaftliche Normen, sondern vor allem auch die stillen Helden, die sich gegen sie auflehnen. Seine Figuren – weder durchwegs tugendhaft noch vollständig verdorben – verkörpern die Komplexität des Menschlichen, und sein Witz ist ebenso zärtlich wie gnadenlos. Die «Bösen» sind selten klassisch diabolisch, sondern meist schlicht engstirnig, kleinlich oder von Macht korrumpiert, während die «Guten» mit Fehlern und Zweifeln ringen. Kein Werk von Pratchett erhebt den Anspruch, grosse Literatur zu sein, doch in seiner eigenen, unverwechselbaren Art schafft er Geschichten, die unter die Haut gehen.
Wenn ich zwischen den ehrwürdigen Regalen der Hochliteratur und Pratchetts farbenprächtiger, ironischer und zutiefst menschlicher Scheibenwelt wählen müsste, fiele meine Wahl ohne Zögern auf Letztere. Denn Pratchetts Fantasiewelt ist weit mehr als blosse Unterhaltung – sie ist eine Einladung, unsere eigene Welt mit scharfem Blick, einem Lächeln und manchmal auch durch Tränen zu betrachten. Für mich verkörpert sie genau das, was ein «Buch fürs Leben» ausmacht: die Fähigkeit, uns tief zu berühren, zum Nachdenken anzuregen und dabei dennoch zu unterhalten.
Prof. Burkhard Becher ist Professor für Experimentelle Immunologie an der UZH.

Schlank, sechseckig und tiefblau ist der Bleistift. An seinem oberen Ende prangt in grossen weissen Lettern das Hoheitszeichen: UZH. Das unscheinbare Schreibgerät ist nicht nur eines von zahlreichen Produkten im UZHMechandiseShop, sondern auch der Spross einer langen Geschichte. Schon die Ägypter sollen vor 5000 Jahren Schilf, Bambus oder Papyrusrohre mit flüssigem Blei ausgegossen und zum Schreiben verwendet haben. Seine Wurzeln hat der Bleistift, wie wir ihn heute kennen, im England des 17. Jahrhunderts. Damals wurden in Borrowdale nördlich von Manchester grosse Graphitvorkommen entdeckt. Aus dem dunklen, mattglänzenden Stoff, den man zuerst für Bleierz hielt, wurden später Minen hergestellt, die mit Holz ummantelt wurden. So verbreitete sich das Schreibgerät von den Britischen Inseln aus in ganz Europa.
Die damals neuen Graphitminen veränderten zwar das Schreiben, am alten Namen änderten sie allerdings nichts. Der blieb: Bleistift. Seit dem 19. Jahrhundert werden Bleistiftminen aus einem GraphitTonGemisch gebrannt. Je nach Mischungsverhältnis lassen sich so verschiedene Härtegrade der Mine herstellen. Der UZHBleistift ist mittelhart und eignet sich besonders zum Schreiben und Zeichnen. Heute einen Bleistift zu benutzen, mag angesichts modernster digitaler Schreibtechnologien antiquiert erscheinen, er hat aber immer noch seine Vorzüge. Will man eine kurze Notiz machen, eine Skizze anfertigen oder an einer langweiligen Sitzung etwas kritzeln, ist er schnell und unkompliziert zur Hand. Und er funktioniert im Gegensatz zu einem Kugelschreiber ganz zukunftstauglich auch im Weltraum. Roger Nickl www.shop.uzh.ch
In meinem Ökonomiestudium habe ich anfangs gelernt, dass mehr immer besser ist und höheren Nutzen bringt. Später wurde diese Annahme relativiert. Es gibt Güter, bei denen mehr den Nutzen reduziert (Schadstoffe), und es gibt auch solche, von denen eine ganz bestimmte Menge optimal ist (beispielsweise Sahnetorte – irgendwann wird einem übel).
Sobald man sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, rücken die Wechselwirkungen zwischen Gütern in den Blick. Der Flug in mein Lieblingsland Indien ist nur zu haben, wenn ich gleichzeitig CO2-Emissionen in Kauf nehme. Ich weiss aber, dass diese zur Klimaveränderung beitragen, zu Hitzewellen, Dürreperioden, Überschwemmungen und Gletscherschwund.
Dann muss ich abwägen, mir bewusst machen, was mir wichtiger ist. Man sagt, der Kampf gegen die Erderwärmung sei durch Konsumverzicht nicht zu gewinnen. Aber vielleicht gibt es auch Menschen, die auf Gletscher nicht verzichten wollen, sondern doch lieber mal auf einen Flug? Dann ist weniger mehr.
Katharina Michaelowa ist Professorin für Entwicklungspolitik und Dekanin der Philosophischen Fakultät.
Im Klassenzimmer oder Seminarraum neigen Lehrpersonen manchmal dazu, alles kontrollieren zu wollen: Jede Minute wird strukturiert, die Anzahl der Aufgaben genau vorgegeben und die Lösungen ausgiebig besprochen. Diese Art der Kontrolle vermittelt einem das Gefühl, alles fest im Griff zu haben. Doch wäre weniger hier nicht mehr?
Wenn Lehrende den Mut haben, sich zurückzunehmen und Freiräume zu gewähren, kann etwas Überraschendes entstehen. Die Lernenden beginnen, Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess zu übernehmen. Wer mitbestimmen und mitgestalten darf, ist motiviert. Die Lernenden entwickeln zudem Strategien, um ihren Lernprozess zu planen, zu überwachen und zu evaluieren. Freiräume fördern also die Eigeninitiative und die Selbstregulation. Das ist nicht immer einfach. Weniger Kontrolle bedeutet nämlich auch, mit Unsicherheiten umgehen zu können – sowohl bei den Lernenden als auch bei den Lehrenden selbst. Doch keine Angst, diese Unsicherheiten sind Teil des Prozesses. Gerade in diesem Rahmen entstehen neue Erkenntnisse.
Yves Karlen ist Professor für Gymnasialpädagogik sowie Lehr- und Lernforschung.
Datenqualität ist entscheidend
Man könnte meinen, dass diese Frage in Bezug auf Daten ganz klar mit Nein beantwortet werden sollte; es scheint immer besser zu sein, mehr Daten zu erheben, um eine Fragestellung genauer zu untersuchen. Als Statistiker muss ich jedoch mit unserer Standardantwort aufwarten: es kommt darauf an! Mehr Datenpunkte machen es tatsächlich einfacher, zur vielbegehrten statistischen Signifikanz zu kommen. Das kann aber relativ häufig dazu führen, dass man diese erreicht, obwohl der praktische Nutzen viel zu klein ist, um relevant zu sein. Für die Statistik wäre es auch oft wichtiger, qualitativ hochstehende Daten zur Verfügung zu haben als sehr viele, aber schlechte Daten. Dazu ist die Entwicklung von Large Language Models (LLMs) ein aktuelles Beispiel. Diese Modelle benötigen enorme Datenmengen für ihr Training, weshalb oft auf alle verfügbaren Daten zurückgegriffen wird. Diese Vorgehensweise kann jedoch gerade durch die suboptimale Datenqualität zu Verzerrungen in den Modellen führen, die gravierende Folgen haben können. Quantität kompensiert also nicht zwangsläufig Qualität. Analog zum Tierschutzprinzip der 3R (Reduce, Refine, Replace) und dem dortigen Motto «So wenig wie möglich, so viel wie nötig» gilt auch in der Datenanalyse: Die Qualität der Daten ist oft entscheidender als ihre reine Menge. Reinhard Furrer ist Professor für Angewandte Statistik.
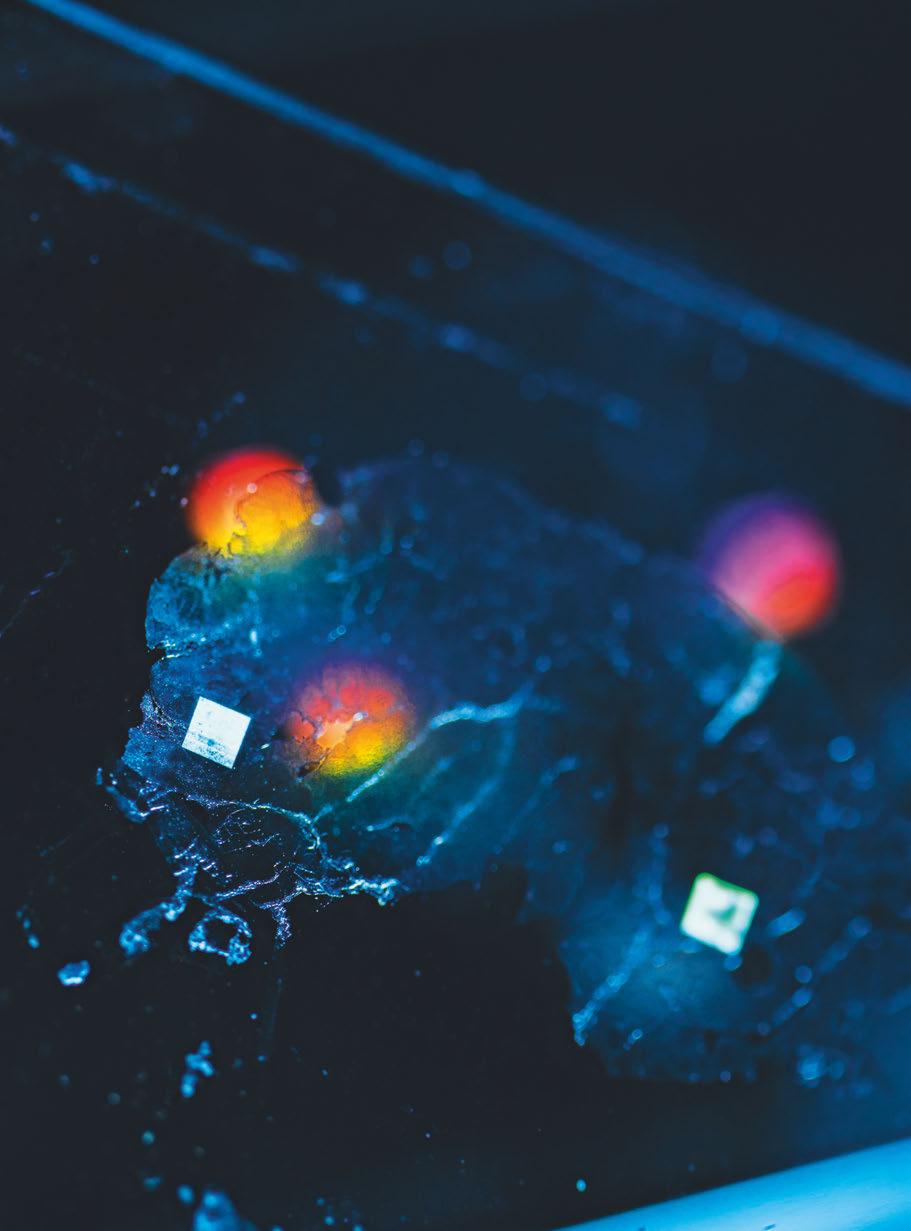
ERFUNDEN
Die Behandlung von Krebs verbessert sich rasant. Ständig werden neue Therapien entwickelt und diese werden immer stärker personalisiert. Die meisten Krebstherapien nehmen Proteine der Tumorzellen ins Visier oder sie versuchen zu beeinflussen, wie Immunzellen auf Tumorzellen reagieren. Für die Behandlung müssen die Ärzte deshalb wissen, welche Proteine sich auf den Tumorzellen befinden und wo. Der UZHSpinoff Navignostics liefert genau diese Informationen mit der Methode der räumlichen Einzelzellproteomik. Damit können in einem einzelnen Tumorschnitt bis zu 50 Proteine nachgewiesen und sichtbar gemacht werden. Diese hochauflösenden Bilder werden dann analysiert. So entsteht ein individualisiertes Profil der Tumorzellen. Dieses bildet die Grundlage für eine massgeschneiderte Therapie. «So lassen sich jene Medikamente identifizieren, auf die die Tumorzellen am besten ansprechen», erklärt UZHProfessor Bernd Bodenmiller, einer der Gründer von Navigonstics, «damit werden die Behandlungen erfolgreicher und die Nebenwirkungen können reduziert werden.»
Navignostics wurde 2022 gegründet als Spinoff des Bodenmiller Lab an der UZH. www.navignostics.com
Text: Thomas Gull, Bild Frank Brüderli

Die Schweiz ist längst kein viersprachiges Land mehr, sondern ein vielsprachiges. Das neu erschienene Buch «Sprachenräume der Schweiz» analysiert diesen Wandel und beleuchtet die Sprachenvielfalt der Schweiz.

«Sprache ist Ausdruck von vielfältigen Geschichten, Kulturen und Identitätsvorstellungen.»
Johannes Kabatek, Romanist
Text: Simona Ryser
Illustration: Cornelia Gann
Die Jungs drängen sich im Tram am Mittag, der Hunger will gestillt werden. Schmunzelnd schaue ich zum Fenster hinaus, während ich der Jugendsprache lausche: «Gömmer Migros Poulet?» Der sogenannte Balkan-Slang, bei dem Präpositionen, Artikel und Pronomen weggelassen werden und der das lässige Staccato der jungen Leute rhythmisiert, ist schon seit einiger Zeit Mode. Einst von den Migrationssprachen aus Ex-Jugoslawien inspiriert, ist er längst als Idiom in die Jugendsprache eingegangen. Doch spitze ich die Ohren noch etwas länger, höre ich eine ganze vielsprachige Stimmensinfonie: Zwei junge Girls reden englisch, zwei Damen hochdeutsch, Businessleute unterhalten sich spanisch, andere sprechen serbokroatisch, eine Mutter plaudert mit ihrem Kindergartenkind ukrainisch, hinter mir erklärt jemand in breitem Berndeutsch das bevorstehende Mittagsmenü und eine weibliche Stimme kontert in schnoddrigem Zürichdeutsch.
Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit – es ist unüberhörbar: Die Schweiz hat sich vom Vier- zum Vielsprachenland gewandelt. Einst war «Die Viersprachige Schweiz» von 1982 das Standardwerk zur Mehrsprachigkeit des Landes. Jetzt gibt es ein umfangreiches Update: das Buch «Sprachenräume der Schweiz», herausgegeben von der Germanistin Elvira Glaser, dem Romanisten Johannes Kabatek und der Slavistin Barbara Sonnenhauser. Der gut 500 Seiten starke Wälzer, der sich beim genaueren Hinsehen als kurzweiliges Nachschlagewerk entpuppt, versammelt Artikel zu den vier Landessprachen und zu den am häufigsten gesprochenen Migrationssprachen Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Albanisch und der Sprache der Nachfolge-
staaten Jugoslawiens: Bosnisch-Kroatisch-Montenegrinisch-Serbisch (BKMS), wie sie im Buch differenziert genannt wird.
Darüber hinaus werden auch einige Besonderheiten erörtert. Beispielsweise weshalb in Samnaun auch Südbairischer und Tiroler Dialekt gesprochen wird; wie das nur noch selten gesprochene Jiddisch nach Zürich-Wollishofen kam oder welche Sprachen die Schweizer Täufer in Nordamerika gesprochen haben. Und es gibt einen Beitrag über die Unterschiede der drei verschiedenen Gebärdensprachen in der Schweiz. Weltweit sind gar 159 dokumentiert.
Gelebte Mehrsprachigkeit
Die Schweiz ist ein sprachenfreudiges Land. Tatsächlich spricht die grosse Mehrheit der Bevölkerung laut dem Bundesamt für Statistik (BFS 2021) mindestens zwei Sprachen. Zudem sprechen viele Menschen neben den vier Landessprachen regelmässig weitere Sprachen. Allen voran Englisch, danach folgen Spanisch, Portugiesisch, Albanisch und BKMS. Allerdings können Statistiken einen vereinfachenden Eindruck vermitteln. «Es spricht nicht das Land, sondern es sprechen die Menschen», sagt der Romanist Johannes Kabatek. Die Sprache ist ein vielfältiges Phänomen. Menschen sprechen zuhause zuweilen eine andere Sprache als in der Öffentlichkeit. Kann sein, dass man den Dialekt wechselt, wenn man das Daheim verlässt. Wenn die Eltern zum Beispiel aus dem Bernbiet kommen, ist Berner Dialekt vielleicht die Familiensprache, selbst wenn man in Zürich lebt. Oder stammen die Eltern aus dem Kosovo, sprechen die erwachsenen Kinder vielleicht zuhause albanisch, bei der Arbeit aber perfektes Zürichdeutsch. Die Herkunftssprache, die über Generationen weitergegeben wird, entspricht nicht zwingend der
In der Schweiz sprechen viele Menschen (rund 40%) neben den vier Landessprachen regelmässig weitere Sprachen. Allerdings muss dabei unterschieden werden zwischen Hauptsprache (nicht zwingend die Muttersprache, sondern die Sprache, in der man denkt und die man am besten beherrscht), Arbeitssprache, Herkunftssprache und erlernter Fremdsprache. Eine Auswahl:
Englisch 44,8%
Neben den vier Landessprachen ist nach statistischer Häufigkeit Englisch diejenige Sprache, die von einer Mehrzahl Personen regelmässig gesprochen wird. Die Sprache wird nicht nur bei der Arbeit oft gebraucht. Englisch scheint auch im Trend zu liegen. So sprechen zuweilen Jugendliche auf dem Pausenhof Englisch weil es cool ist, ohne einen familiären Bezug zur Sprache zu haben.
Spanisch 6,3%
Spanisch ist die am fünfthäufigsten gesprochene Sprache in der Schweiz und wird sowohl als Muttersprache als auch als Fremdsprache gesprochen. In keinem anderen europäischen Land ausserhalb Spaniens ist der relative Anteil der Muttersprachler so hoch wie in der Schweiz. Spanisch wird am meisten im französischen Sprachgebiet gesprochen.
Portugiesisch 4,8%
Das Portugiesische ist vor allem in der Westschweiz, im Kanton Graubünden und auch im Kanton Zürich weit verbreitet. Die Sprache wird vor allem zuhause und bei der Arbeit gesprochen.
Bosnisch-Kroatisch-Montenegrinisch-Serbisch (BKMS) 3,2%
BKMS ist eine der am häufigsten gesprochenen Migrationssprachen, wobei viele der Sprecher bereits der zweiten und dritten Generation angehören und die Sprache vor allem in der Familie gesprochen wird.
Albanisch 3,1%
Albanisch ist nach Englisch und Portugiesisch die dritthäufigste Nichtlandessprache, die zuhause gesprochen wird.
Gehörlosensprache
In der Schweiz sind etwa 10000 Personen von Geburt an gehörlos oder schwerhörig. Hierzulande existieren drei verschiedene Gehörlosensprachen: die Deutschschweizerische Gebärdensprache, die Langue des signes française Suisse romande und die Lingua di segni Svizzera italiana.
Quelle: BFS 2021 / Sprachenräume der Schweiz, Hg: E. Glaser, J. Kabatek, B. Sonnenhauser
Hauptsprache, die man im Alltag meistens spricht. Doch wie wird diese Mehrsprachigkeit konkret gelebt? «Sprachen sind nicht statische, sondern dynamische, sich ständig den Kommunikationsbedürfnissen anpassende Phänomene», heisst es im Buch. Entsprechend wandelbar und flexibel ist der Umgang im Alltag. Zuweilen mischen sich die Sprachvarianten auf wundersame Weise. Etwa als ich neulich abends im Café mit Freunden war: Während der Kellner uns auf Englisch begrüsste und die Bestellung entgegennahm, blieben alle bei ihren angestammten Sprachen. Jemand redete Hochdeutsch, jemand Basler Dialekt, jemand Zürcher Dialekt gespickt mit italienischen Vokabeln. Natürlich brachte der Kellner die richtigen Getränke.
Pluralität und Eigenständigkeit
Tatsächlich hat die Schweiz als viersprachige Nation eine gewisse Übung. «Im Gegensatz zu den umliegenden Ländern ist man sich zumindest in der Deutschschweiz die asymmetrische Kommunikation gewohnt», erklärt der Linguist Kabatek. Jede und jeder spricht in seiner/ihrer Sprache. «So bleiben etwa Zürcher und Berner ganz selbstverständlich beim eigenen Dialekt, wenn sie miteinander sprechen.» In Deutschland hingegen, so Kabatek, wird der eigene Dialekt nur im privaten, zumindest sehr lokalen Kontext gesprochen, in der Öffentlichkeit spricht man Hochdeutsch. Die Schweiz könne gerade angesichts der Präsenz neuer Sprachen immer noch als Modell für die Verbindung von Pluralität und Eigenständigkeit dienen, schreiben die Autoren in der Einleitung.
Allerdings kommt es auch hierzulande vor, dass man ins Stottern gerät, wenn die Bedienung an der Theke in charmantem Englisch mit spanischem Akzent nach unserem Kaffeewunsch fragt, während wir rätseln, in welcher Sprache wir nun antworten sollen. Englisch? Deutsch? «Wir kommunizieren auf zwei Ebenen», so Johannes Kabatek. Zum einen haben wir ein klares Ziel, wir wollen einfach unseren Kaffee. Andererseits setzen wir uns gleichzeitig mit den Sprachen auseinander, wenn wir überlegen, welches in dieser Situation die angemessene Sprache ist.
Wandert man entlang des Röstigrabens, blitzt die Sprachenvielfalt immer wieder auf, wenn die Wandersleute zwischen Bonjour und Grüessech und Guetetag schwanken. Diesem mal lockerheiteren, mal griesgrämigrivalisierenden Umgang geht der Beitrag mit dem Titel «Sprachbeziehungen und Sprachregelungen in der mehrsprachigen Schweiz» unter anderem nach.
«Sprache ist immer Ausdruck von vielfältigen Geschichten, Kulturen und Identitätsvorstellungen», sagt Kabatek. Auch die Verbreitung der vier Landes
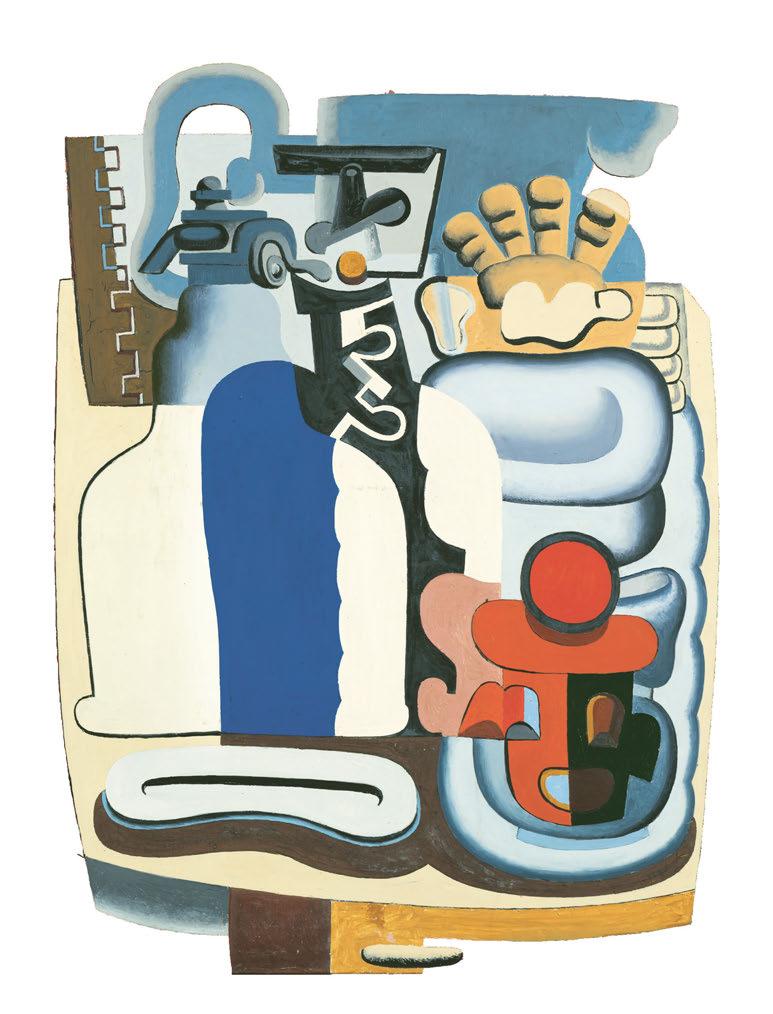
Gegründet von: In Zusammenarbeit mit:Mit Unterstützung von:
Die sprachlich einst viergeteilte Schweizer Landkarte weicht vor unserem inneren Auge einem bunten Flickenteppich.
sprachen sind das Ergebnis historischer Entwicklungen, wie das Beispiel der Walser Mundart zeigt, die aufgrund von Migrationsbewegungen im Spätmittelalter nach Graubünden und ins Tessiner Bosco Gurin gelangte.
Unterschiedlich beliebt
Auch hinter den jüngeren Migrationssprachen lassen sich historische Zäsuren und Entwicklungen ablesen, wie man etwa in den Beiträgen über Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und BKMS nachlesen kann. So folgte im Zuge des JugoslawienKriegs in den 1990erJahren eine grössere Migrationswelle aus den Nachfolgestaaten Bosnien, Kroatien, Montenegro und Serbien, deren Sprachen heute in der Schweiz zu den am stärksten vertretenen Migrationssprachen zählen.
In den 1950erJahren wanderten aus wirtschaftlichen Gründen italienische Gastarbeiter ein, in den 1960erJahren kamen solche aus Spanien dazu, in den 1970ern, nach der SalazarDiktatur, fanden viele Portugies:innen Arbeit in die Schweiz. Die spanischen Gastarbeiter zogen in die Industrien von Zürich, Genf und Basel, die Portugiesen und Portugiesinnen fanden Arbeit in der Hotellerie der Westschweiz und den Tourismusorten in den Bergen. So stammt heute ein grosser Teil der Wohnbevölkerung in der Umgebung Zermatts ursprünglich aus Portugal.
Unter den Nichtlandessprachen haben nicht alle das gleich hohe Ansehen. So scheinen osteuropäische Migrationssprachen etwas weniger beliebt zu sein. Im Beitrag über «Albanisch» ist zu lesen, dass diese Sprache wenig bekannt ist und in der Öffentlichkeit auch seltener gesprochen wird – trotz einiger prominenter Persönlichkeiten wie etwa des Zürcher Nationalrats Islam Alijaj. Albanisch gehört allerdings, nach Englisch und Portugiesisch, zu den dritthäufigsten zuhause gesprochenen Nichtlandessprachen (BFS 2024).
Der neuen Sprachenvielfalt sind allerdings längst nicht alle zugetan. Manche bangen um die eigene Sprache und nerven sich über den global
palavernden Barista, wenn sie doch einfach nur einen Café Crème bestellen möchten. Könnte es denn sein, dass die Schweizer Dialekte eines Tages von den Weltsprachen Englisch oder Spanisch verdrängt werden? Kabatek wägt ab. Englisch ist schon sehr gebräuchlich als Arbeitssprache, zunehmend auch als Schulsprache, auch Spanisch ist im Vormarsch. Zugleich wird die Mundart auch von Migrantinnen und Migranten gelernt und ist äusserst stabil. Letztlich lassen sich kaum Prognosen stellen. Die Realitäten sind dann doch zu individuell, wie das Buch aufzeigt.
Mit den Beiträgen im Buch «Sprachenräume der Schweiz» ist es den Herausgeber:innen gelungen, die lebendige Sprachenvielfalt im Land detailreich und differenziert zu beleuchten. Die sprachlich einst viergeteilte Schweizer Landkarte weicht vor unserem inneren Auge einem bunten Flickenteppich mit viel Überraschungspotenzial im Detail.
Johannes Kabatek erwähnt die Schweizer Fussballnationalmannschaft. Auf dem Foto schauen die jungen Männer gebannt in die Kamera, darunter sind einige, deren Eltern oder Grosseltern immigrierten, unter anderem aus Spanien, Portugal, Albanien, Nordmazedonien, aus dem Kosovo, der Türkei, Nigeria, Kamerun, dem Senegal. Fangen die Fussballer an zu schwatzen mit all ihrem Sprachenvermögen, spiegeln sie perfekt die sprachlustige Schweiz.
Prof.
Johannes Kabatek, kabatek@rom.uzh.ch
PFLANZENPHYSIOLOGIE
Bisher garantierten Pestizide hohe landwirtschaftliche Erträge. Doch die chemischen Mittel verlieren zunehmend ihre Wirkung. Pflanzenimmunologen der UZH sind nun einer Alternative auf der Spur. Das Beste daran: Sie stammt aus dem natürlichen Abwehrsystem der Pflanzen selbst.

Erforscht Peptide, die Pflanzen resistenter gegen Krankheiten und Schädlinge machen könnten: der Pflanzenphysiologe Cyril Zipfel.
Text: Santina Russo Bild: Marc Latzel
Pestizide waren bisher zweifellos sehr nützlich. Sie bewahren unsere Nutzpflanzen vor allerlei Schädlingen und lassen sie besser gedeihen. Dass Pestizide auch schädlich sind, ist längst bekannt: Sie übersäuern Böden und Gewässer und bedrohen die Biodiversität einheimischer
Pflanzen und Tiere. Dennoch, die chemischen Mittel sorgen für hohe Erträge in der Landwirtschaft, was ihren Gebrauch bisher für viele rechtfertigte. Allerdings: So allmächtig sind die Pflanzenschutzmittel gar nicht. Bereits heute gehen trotz Pestiziden und spezialisierten Züchtungen weltweit bis zu 40 Prozent der Nahrungsmittelpflanzen durch Schädlinge und Krankheitserreger verloren. Das hat die Er-

nährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO ermittelt. In Zukunft dürfte sich dieses Problem deutlich verschärfen. «In den nächsten zehn Jahren wird ein Grossteil der heutigen Pflanzenschutzmittel nicht mehr nutzbar sein», sagt Cyril Zipfel, Professor und Leiter des Labors für molekulare und zelluläre Pflanzenphysiologie an der Universität Zürich. Denn einerseits werden immer mehr Pestizide verboten oder
ihr Einsatz strenger reguliert, weil sie der natürlichen Pflanzen- und Tierwelt schaden können. Andererseits entwickeln sich bei den Krankheitserregern, gegen die die Mittel schützen sollten, zunehmend Resistenzen – sodass das Spritzen nicht mehr hilft. Beispielsweise sind die parasitären Erreger des Kartoffelmehltaus teilweise resistent geworden, ebenso wie Pilzerreger, die Sojabohnen und weitere Pflanzen befallen. «Darum brauchen wir dringend Alternativen, und zwar am besten solche, die die Natur nicht belasten», sagt Zipfel.
Gestresste Pflanzen
Der Pflanzenimmunologe untersucht eine solche mögliche Alternative: Signalisierungspeptide aus dem pflanzeneigenen Immunsystem. Auf diese ist er gestossen, als mit seinem Team untersuchte, wie Pflanzen auf Stress reagieren, etwa auf Erreger wie Bakterien und Pilze oder auf Hitze und Wassermangel. Konkret analysierten die Forschenden, welche pflanzlichen Gene in bestimmten Stresssituationen hochreguliert werden. Dabei erkannten sie, dass unter den Tausenden aktivierter Gene besonders viele als DNA-Vorlage für solche Signalisierungspeptide dienen.
Zwar kannte man die Peptide bereits als wichtige Pflanzenhormone. Doch Zipfels Arbeit zeigt nun, dass diese Moleküle viel zahlreicher und vielfältiger sind als zuvor angenommen. Und dass sie in unterschiedlichen Pflanzen eine ganze Reihe von Prozessen steuern. «Inzwischen wissen wir, dass die Signalisierungspeptide jeden Aspekt des Pflanzenlebens regulieren: von der Samenentwicklung über die Keimung, das Wachstum und die Fortpflanzung bis zu den Reaktionen auf die Umwelt», sagt Zipfel.
Der Clou daran: Die Peptide bilden eine Auswahl an möglichen Schaltern, über die sich Pflanzen steuern lassen – unter anderem könnte man sie resistenter gegen Krankheiten und Schädlinge machen. Und dies ganz ohne Pestizide, sondern rein mit den natürlichen Mitteln der Pflanzen selbst. «Dazu müssen wir die Signalisierungspeptide aber erst einmal besser verstehen lernen», sagt Zipfel.
Ein komplexes Unterfangen: Schon beim Versuch, möglichst viele dieser Peptide in verschiedenen Pflanzenarten zu identifizieren, stossen die Forschenden auf Herausforderungen, weil die Peptide derart vielfältig aufgebaut sind. Einerseits können sie unterschiedlich gross sein: Manche bestehen aus über hundert Aminosäuren, andere nur aus deren fünf. Andererseits ist in den Peptiden jeweils nur ein Teil relevant für ihre biologische Funktion, manchmal ist das nur ein Bruchteil der ganzen Peptidkette. Das bedeutet auch, dass sich auf der Ebene der DNA nur ein Teil ihres Gens

Pflanzenphysiologie
Pflanzen sind nicht blind: Sie erkennen etwa, wie sauer die Erde um sie herum ist, ob diese genügend Nährstoffe enthält oder ein gefährlicher Organismus in der Nähe lauert. Um solche essenziellen Dinge zu erkennen und an ihr inneres Informationsnetz weiterzugeben – und allenfalls eine Reaktion auszulösen – haben Pflanzen eine Vielzahl verschiedener Rezeptoren in ihren Zellmembranen. Manche davon lassen unter bestimmten Umständen bestimmte Moleküle oder Ionen in die Zellen hinein, andere erkennen spezifische Moleküle und lösen Signalkaskaden aus, die zu einer Antwort führen. So erkennen Immunrezeptoren beispielsweise Krankheitserreger und lösen die Immunantwort aus, um diese zu bekämpfen. Solche Vorgänge – etwa wie Rezeptoren Bakterien erkennen – untersucht Cyril Zipfel mit seinem Team. Die Forschenden haben zum Beispiel herausgefunden, dass bestimmte Rezeptoren einen Teil von Bakterien erkennen und andere Rezeptoren andere Teile identifizieren. Auf diese Weise können Pflanzen zuverlässig Fremdkörper ausmachen, die ihnen gefährlich werden könnten.
überhaupt als Muster unter den Tausenden anderen Pflanzengenen erkennen lässt. Darum muss Zipfels Team teilweise neue computergestützte Methoden entwickeln, um die Signalisierungspeptide zu identifizieren. Dazu kommt die schiere Menge dieser Schaltermoleküle: «Schaut man sich das Erbgut der Pflanzen an, hat jede einzelne davon das Potenzial, Hunderte bis Tausende Signalisierungspeptide zu produzieren», sagt Zipfel. Nun arbeiten die Forschenden daran, die Vielfalt der Signalisierungspeptide zu dokumen 21.3.-17.8.25
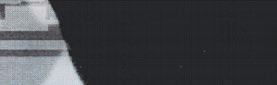


«In den nächsten zehn Jahren wird ein
Grossteil der heutigen Pflanzenschutzmittel nicht mehr nutzbar sein.»
Cyril Zipfel, Pflanzenphysiologe
interagieren. So ermittelt das Team beispielsweise, welche Peptide an welche Rezeptoren in den Zellmembranen binden. Diese Rezeptoren sind essenziell für das Informationssystem der Pflanzen und können Antworten auf verschiedene Reize auslösen (siehe Kasten, Seite 18). Die Forschenden haben bereits einige Rezeptor-Peptid-Paarungen identifiziert, die zusammenspielen, um eine bestimmte Stressantwort auszulösen. Unter anderem nutzen sie dazu auch künstliche Intelligenz (KI). Genauer: KI-gestützte Modellierung, um die Struktur der Peptide zu bestimmen und Hinweise darauf zu erhalten, an welchen Rezeptor sie binden. Diese Vorhersage bestätigen sie dann im Labor.
Ein riesiges Puzzle
Zudem hat Zipfels Team beobachtet, dass die meisten untersuchten Peptide zu Beginn ihrer Wirkungskette ähnliche charakteristische Antworten in der Zelle auslösen, und zwar innerhalb von wenigen Millisekunden. Sie aktivieren Kinasen, also Enzyme, die wiederum andere Proteine mit einer Phosphatgruppe versehen und so weitere Signale innerhalb der Zellen auslösen. Und sie schalten an den Zellmembranen den Transport bestimmter
UZH Foundation
Das Projekt von Cyril Zipfel zielt darauf ab, über sogenannte Signalpeptide das pflanzliche Immunsystem zu stärken. So könnten Ernteausfälle aufgrund von Schädlingen oder Dürren minimiert werden. Dank der pflanzlichen Peptide kann weitgehend auf Pestizide verzichtet und so die Gesundheit der Nutzpflanzen verbessert werden. Die UZH Foundation macht das Fundraising, um die Entwicklung dieser zukunftsweisenden Alternative zu Antibiotika und Pestiziden zu unterstützen.
Linda Schweizer-Thong, linda.schweizer@uzhfoundation.ch www.uzhfoundation.ch/pflanzlichepeptide
Ionen ein, beispielsweise von Calcium-Ionen in die Zellen hinein. «Normalerweise ist die Calciumkonzentration in Pflanzenzellen sehr niedrig», erklärt Zipfel. «Dadurch, dass diese plötzlich steigt, wird ein Signal gesendet, das seinerseits weitere Signalprozesse anstösst.» Auf diese Weise lösen die Peptide Kaskaden von Regulierungssignalen aus.
Mehr noch: Manche der Peptidfamilien besitzen zudem eine direkte antimikrobielle Wirkung – und sind theoretisch als Ersatz für Antibiotika denkbar, die aufgrund von Resistenzen immer weniger wirken. Dazu brauche es aber noch ordentlich Forschungsarbeit, sagt Zipfel. «Das Ganze ist ein riesiges Puzzle, das wir zusammenzusetzen versuchen. Inzwischen kennen wir schon einige Puzzleteile und arbeiten daran, herauszufinden, wie sie zusammenpassen. Daneben gibt es Teile, die wir erst noch identifizieren müssen.»
Künftig will das Team noch mehr von typischen Labormodellpflanzen wie der Acker-Schmalwand (Arabidopsis thaliana) wegkommen und sich auf Nutzpflanzen konzentrieren. Bereits laufen Projekte zu Kartoffel, Tomate und Gerste. Offenbar, so die Erkenntnis des Teams, haben sich die Signalisierungspeptide entlang der Pflanzenstammbäume auseinanderentwickelt. So gibt es Peptide, die nur in Tomaten und ihnen verwandten Arten vorkommen, andere gibt es nur in Getreide.
Eine nächste Herausforderung wird darin bestehen, herauszufinden, wie sich die Peptide in der landwirtschaftlichen Praxis einsetzen lassen. «Dazu braucht es eine enge Zusammenarbeit mit Chemikern und Agronomen», sagt Zipfel. «Besonders spannend wird es, wenn wir für verschiedene Nutzpflanzen jene Peptidfamilien inklusive deren Wirkung kennen, die an der Stressreaktion beteiligt sind.» Genau diese könnten Pflanzen gegen allerlei Gefahren widerstandsfähiger machen – ein natürlicher Ersatz für Pestizide.
Prof. Cyril
Zipfel, cyril.zipfel@botinst.uzh.ch
MEDIZIN
Viele seltene Krankheiten betreffen den Stoffwechsel im Körper. Für die Betroffenen und für die Wissenschaft sind sie eine Herausforderung. Der Universitäre Forschungsschwerpunkt ITINERARE untersucht solche Leiden und entwickelt neue Therapien.
Text: Adrian Ritter
Frida war eineinhalb Jahre alt, als das Leiden begann. Eines Tages erbrach sie sich plötzlich und verlor auf dem Weg zum Kinderarzt das Bewusstsein. Auf der Intensivstation konnte ihr Leben im letzten Moment gerettet werden. Die Diagnose: Frida leidet an einer Krankheit, die den sperrigen Namen Methylmalonazidurie (MMA) trägt. Es ist eine seltene, genetisch bedingte Stoffwechselkrankheit. Ihrem Körper fehlt ein Enzym, um bestimmte Proteine abzubauen. In der Folge sammeln sich giftige Stoffe im Körper an, die insbesondere das Gehirn und langfristig die Nieren schädigen. Entsprechend zeigten sich auch bei Frida in den Jahren nach der Diagnose die typischen Symptome. Sie litt an einer verzögerten körperlichen Entwicklung, lernte später sprechen und ist auf Rollstuhl und Rollator angewiesen.
Schweizweit haben nur etwa 30 Personen dieselbe Diagnose wie Frida – deshalb gehört Methylmalonazidurie zu den seltenen Krankheiten. Rund 8000 solche «rare diseases» sind heute bekannt. Es sind dies Leiden, von denen weniger als eine von 2000 Personen betroffen sind. Die meisten dieser Krankheiten sind durch einen vererbten Defekt in einem einzelnen Gen verursacht. Sie machen sich zwar nicht immer, aber oft schon im Kindesalter bemerkbar. In der Schweiz gibt es rund eine halbe Million Menschen mit einer seltenen Krankheit. Insgesamt sind sie also gar nicht so selten, auf jede einzelne Krankheit bezogen allerdings schon. Entsprechend begegnen Ärztinnen und Ärzte diesen Leiden kaum. So ist es kein Wunder, dass der Weg zur Diagnose für viele Betroffene oft einer Odyssee gleicht. «Im Durchschnitt dauert es fünf Jahre, bis eine Person mit einer seltenen Krankheit die richti-

ge Diagnose erhält», sagt Olivier Devuyst. Der UZH-Physiologe ist Spezialist für Nierenkrankheiten und Co-Leiter des Universitären Forschungsschwerpunkts ITINERARE der Universität Zürich, der sich mit seltenen Krankheiten auseinandersetzt und nach neuen Behandlungen sucht (siehe Kasten Seite 22).
Schwierige Forschungsfinanzierung
Die Methylmalonazidurie ist eine typische und untypische seltene Krankheit zugleich. Untypisch, weil sich die Krankheit über einen Blut- und Urintest schnell und einfach diagnostizieren lässt – wie das auch bei Frida der Fall war. Die jahrelange Odyssee bleibt den meisten Betroffenen erspart. Typisch ist MMA insofern, als sie wie viele seltene Krankheiten den Stoffwechsel betrifft und zu einer langsamen Vergiftung des Körpers führt. «Seltene

Eine Ernährungsberatung spielt bei der Behandlung eine wichtige Rolle.
Krankheiten sind extreme Ausprägungen von häufigeren Krankheiten», sagt Devuyst. So gibt es seltene Nierenkrankheiten, seltene Formen von Diabetes oder Bluthochdruck. Extrem sind sie, weil die Krankheiten oft stärker ausgeprägt sind und früher im Leben auftreten als andere Krankheiten. Die Forschung zu seltenen Krankheiten hilft deshalb auch, mehr über häufige Krankheiten zu lernen – und umgekehrt. Dabei stehen die Forschenden vor speziellen Herausforderungen: Weil die Krankheiten eben selten sind, gibt es nur sehr wenige Betroffene, aber auch wenige Expertinnen und Experten zur jeweiligen Erkrankung. Internationale Zusammenarbeit ist deshalb unabdingbar, aufgrund unterschiedlicher Gesundheitssysteme aber kompliziert. Auch die Finanzierung ist ein grosses Problem: Für Pharmafirmen sind seltene
Krankheiten wegen der kleinen Anzahl Behandlungen wenig interessant. Entsprechend unterfinanziert ist die Forschung. «Deshalb gibt es für rund 90 Prozent der seltenen Krankheiten bis heute keine Therapie, die an den Ursachen ansetzt», sagt Matthias Baumgartner, Abteilungsleiter Stoffwechselkrankheiten am UniversitätsKinderspital Zürich. Meist liessen sich aber die Symptome behandeln. «Je nachdem, wie gut das möglich ist, ist auch die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten mehr oder weniger hoch.»
In Europa einzigartig
Baumgartner bildet gemeinsam mit Olivier Devuyst und der Genetikerin Janine Reichenbach das Direktorat von ITINERARE. Der Forschungsschwerpunkt umfasst 21 Forschungsgruppen. Diese gehen
nicht nur medizinischen, sondern auch ökonomischen, ethischen und sozialen Fragestellungen im Zusammenhang mit seltenen Krankheiten nach. Fachrichtungen wie Medizin, Informatik, Pharmakologie, Psychologie, Ethik, Recht arbeiten dabei zusammen. «Mit diesem breiten interdisziplinären Ansatz sind wir in Europa vermutlich einzigartig», sagt Baumgartner.
Der Forschungsverbund fokussiert auf Krankheiten, zu denen auf dem Platz Zürich schon Expertise vorhanden ist. Je nach Krankheit bestehen dabei sogar jahrzehntelange Traditionen – so wurden gewisse seltene Krankheiten am Universitäts-Kinderspital Zürich entdeckt. Die räumliche Nähe der Spitäler, der UZH und der ETH ist für den interdisziplinären Ansatz von ITINERARE ein grosser Vorteil. Das Ziel des Verbundes: Zürich soll zum weltweit bekannten Zentrum in der Forschung und Behandlung von seltenen Krankheiten werden, auch für Patientinnen und Patienten aus dem Ausland.
«Die Forschung hat in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte beim Verständnis seltener Krankheiten gemacht», sagt Olivier Devuyst. Möglich wurde dies insbesondere dank Weiterentwicklungen in der Genomanalyse. So ist heute bei den meisten seltenen Krankheiten die zugrundeliegende Erbgutveränderung bekannt. Jetzt geht es darum, die Mechanismen zu verstehen, die dadurch ausgelöst werden, und anschliessend passende Therapien zu entwickeln.
Wirkstoffsuche beschleunigen
Dazu kann auch künstliche Intelligenz beitragen. «Mit KI können wir die Wirkstoffsuche beschleunigen und noch präzisere Krankheitsmodelle entwickeln», sagt Devuyst. Dabei hätten «rare diseases» auch einen Vorteil: «Im Gegensatz zu häufigen Krankheiten löst in der Regel nur ein einziges Gen eine seltene Krankheit aus, deshalb ist die Chance höher, eine wirksame Behandlung zu finden.»
Bei der Suche nach neuen Therapien gibt es grundsätzlich zwei Ansätze. Entweder es gelingt, den genetischen Defekt mittels Gentherapie zu reparieren, oder man kann dessen Auswirkungen minimieren. In diesem letzteren Zusammenhang hoffen die Forschenden, dass sich bereits existierende Medikamente auch als wirksam gegen seltene Krankheiten erweisen. Denn bei diesem «repurposing» von Medikamenten ist die Zulassung stark vereinfacht.
Vermehrt wollen die Zürcher Forschenden auch Ernährungstherapien entwickeln, die den Stoffwechsel beeinflussen. Auch bei Methylmalonazidurie sind diese zentral. So muss Frida ein Leben lang eine eiweissarme Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Die Ernährungs-
UFSP ITINERARE
Der Universitäre Forschungsschwerpunkt (UFSP) ITINERARE widmet sich seit 2021 der Erforschung seltener Krankheiten. Sein Ziel ist es, die Mechanismen bestimmter seltener Krankheiten besser zu verstehen und neue Therapien zu entwickeln. Parallel dazu forschen die Beteiligten aus fünf Fakultäten der UZH sowie des Universitätsspitals und des Universitäts-Kinderspitals Zürich an ethischen, rechtlichen, psychologischen, sozialen und ökonomischen Fragen rund um seltene Krankheiten.
Der UFSP ITINERARE engagiert sich auch in Lehre und Weiterbildung: Neben dem jährlichen Symposium vermittelt die «Rare Disease Summer School» Nachwuchsforschenden neueste Erkenntnisse zu seltenen Krankheiten. Das Certificate of Advanced Studies (CAS) «Rare Disease» bietet als berufsbegleitender Studiengang einen kompakten interdisziplinären Überblick über die relevanten Bereiche seltener Krankheiten. Ein wichtiger Teil von ITINERARE besteht auch darin, Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit über seltene Krankheiten zu informieren –etwa im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen. www.itinerare.ch
beratung spielt deshalb bei ihrer Betreuung eine wichtige Rolle. In Zukunft könnten aber auch Medikamente die toxischen Stoffe im Körper abbauen helfen oder eine Gentherapie den Erbgutdefekt korrigieren, hoffen Baumgartner und Devuyst. Engagierte Betroffene
Der Universitäre Forschungsschwerpunkt ITINERARE ist 2021 gestartet. Bereits jetzt laufen drei klinische Studien – in den nächsten Jahren sollen weitere hinzukommen. Die Patientinnen und Patienten mit seltenen Krankheiten sind hoch motiviert, sich daran zu beteiligen. «Weil es für jede Krankheit so wenig Betroffene gibt, sind diese umso besser vernetzt und sehr engagiert», so die Erfahrung von Baumgartner. Gerade bei seltenen Krankheiten werden die Patientinnen und Patienten besonders stark eingebunden, etwa wenn es darum geht, welchen Fragestellungen die Forschung nachgehen soll oder welche Art von Behandlung für sie nützlich ist.
Psychologische und ethische Fragestellungen nehmen am UFSP ITINERARE ebenfalls eine wichtige Rolle ein. Patientinnen und Patienten mit seltenen Krankheiten sind dabei in einer besonderen Situation, weil ihre Krankheit sie oft ein Leben lang begleitet. Dank verbesserter Behandlungen konn-
te die Lebenserwartung vieler Betroffener in den letzten Jahrzehnten zum Teil deutlich gesteigert werden. Umso mehr gilt es jetzt, auch den Blick auf die Situationen dieser Menschen im Erwachsenenalter und im höheren Alter zu richten.
Am Forschungsschwerpunkt gehen Psycholog:innen etwa den Fragen nach, mit welchen Einschränkungen Betroffene leben oder welche Unterstützung sie benötigen. Dabei zeigte sich, dass Kinder oft erstaunlich gut mit ihrer Krankheit zurechtkommen – besser als ihre nächsten Angehörigen. Für die Eltern sind die Diagnose-Odyssee und fehlende Heilungsaussichten sehr belastend. Bisweilen werden sie auch von Schuldgefühlen geplagt, weil sie ihrem Kind eine Krankheit vererbt haben. Entsprechend wird an den Behandlungszentren vermehrt auch psychologische Unterstützung angeboten.
Verbesserte Lebensaussichten
Die Behandlung seltener Krankheiten hat strukturell grosse Fortschritte gemacht. So sind aufgrund eines nationalen Aktionsplans schweizweit neun Diagnosezentren an grossen Spitälern entstanden. Eines davon ist das Zentrum für seltene Krankheiten Zürich, das gemeinsam vom Universitäts-Kinderspital Zürich, dem Universitätsspital Zürich, der Universitätsklinik Balgrist und dem Institut für medizinische Genetik der UZH geführt wird. Ist die Diagnose gestellt, erfolgt die Behandlung anschliessend an einem von schweizweit 36 Referenzzentren für seltene Krankheiten. Diese sind derzeit im Aufbau. Ebenfalls am Entstehen ist ein Register für seltene Krankheiten. Ein wichtiger Schritt nach vorn ist gemäss Baumgartner und Devuyst, dass es bald eine gesetzliche Grundlage geben wird, um seltene Krankheiten meldepflichtig zu machen. Die beiden Forscher würden es zudem begrüssen, wenn in der Schweiz der Zugang zur genetischen Diagnostik vereinfacht würde. «Es wären wichtige Schritte, damit Betroffene in Zukunft früher eine Diagnose und damit auch schneller eine passende Behandlung erhalten können», sagt Baumgartner. Der Universitäre Forschungsschwerpunkt ITINERARE will massgeblich dazu beitragen, dass dies Realität wird und sich damit die Lebensaussichten von Betroffenen wie Frida weiter verbessern.
Ändert nicht
die Art, damit umzugehen.


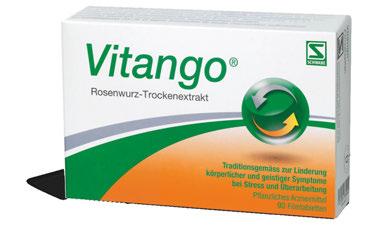
Zur Linderung körperlicher und geistiger Symptome bei Stress und Überarbeitung.
Bei Müdigkeit, Erschöpfung, Reizbarkeit und Anspannung.
Bewährte
Anwendung mit langjähriger Tradition

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage. Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi
Seit dem Jahr 2000 verlieren die Gletscher weltweit durchschnittlich 273 Milliarden Tonnen Eis pro Jahr. Diese Gletscherschmelze hat sich von der ersten (2000–2011) zur zweiten Hälfte des Zeitraums (2012–2023) um 36 Prozent erhöht. Das Abschmelzen beschleunigt den Verlust regionaler Süsswasserressourcen und lässt den Meeresspiegel immer

schneller ansteigen, so die Ergebnisse einer internationalen Gruppe von Forschenden. Die Studie wurde unter der Leitung des World Glacier Monitoring Service (WGMS), der an der UZH angesiedelt ist, durchgeführt.
Gletscher sind nach der Erwärmung der Ozeane der zweitgrösste Verursacher für den weltweit steigenden Meeresspiegel. «Die 273 Milliarden Tonnen Eis, die in einem einzigen Jahr verloren gehen, entsprechen dem Wasserverbrauch der gesamten Weltbevölkerung während 30 Jahren, wenn man von drei Litern pro Person und Tag ausgeht», sagt Studienleiter Michael Zemp, Professor am Geographischen Institut der UZH. Damit verlieren viele lokalen Gemeinschaften insbesondere in Zentralasien und den Zentralanden ihre Wasserreserven. Die vorliegende Studie ist ein Weckruf im Internationalen Jahr zum Schutz der Gletscher
2025. Die Beobachtungen und die jüngsten Modellstudien deuten darauf hin, dass sich der Massenverlust der Gletscher bis zum Ende dieses Jahrhunderts fortsetzen und möglicherweise beschleunigen wird.
KOMMUNIKATION
Eine Umfrage in 68 Ländern zeigt: Das Vertrauen in die Wissenschaft ist weltweit auf einem moderat hohen Niveau. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Team von 241 Forschenden unter der Leitung von Niels Mede von der Universität Zürich (UZH) und Viktoria Cologna von der ETH Zürich. Eine Mehrheit der Befragten wünscht sich ein Engagement der Forschenden in Politik und Gesellschaft. 83 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit der breiten Öffentlichkeit kommunizieren sollten. Für die oft kolportierte Krise des Vertrauens in die Wissenschaft findet die Studie also keine Belege. Befragt wurden 71 922 Personen in 68 Ländern, darunter viele im «globalen Süden». Zentraler Befund: In allen Ländern vertraut eine Mehrheit der Bevölkerung den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern: Sie hält sie mehrheitlich für qualifiziert (78 Prozent), ehrlich (57 Prozent) und um das Wohl der Gesellschaft besorgt (56 Prozent). Im weltweiten Vergleich liegt die Schweiz mit Rang 47 im unteren Mittelfeld: Zwar ist das Vertrauen in die Wissenschaft auch hierzulande moderat hoch, doch liegt der Durchschnittswert knapp unter dem Mittelwert und damit unter dem vieler afrikanischer und nordeuropäischer Länder – aber noch vor Russland und einigen ehemaligen Sowjetrepubliken. Die Autorinnen und Autoren der Studie stellen nicht nur Unterschiede zwischen den Staaten, sondern auch zwischen Bevölkerungsgruppen fest: «In vielen Ländern, so auch in der Schweiz, bringen Personen mit einer rechtsgerichteten und konservativen politischen Einstellung den Forschenden weniger Vertrauen entgegen», sagt Niels Mede. Dies deutet auf eine Polarisierung der Einstellungen zur Wissenschaft entlang politischer Positionen hin.
Ausführliche Berichte und weitere Themen: www.media.uzh.ch
IM FELD — Michael Krützen

Feldforschung mit dem Boot: Michael Krützen in Australien.
Delfine sind sehr intelligente Tiere und bekannt für ihr komplexes Sozialverhalten. Der Anthropologe
Michael Krützen erforscht die Meeressäuger in der Shark Bay in Westaustralien.
Arbeitet man mit Delfinen auf dem offenen Meer, spielt das Wetter eine wichtige Rolle. Deshalb konsultieren wir an einem normalen Arbeitstag als Erstes unsere Wetter-Apps bevor wir die UZH-Forschungsstation in Monkey Mia mit unseren Booten verlassen. Sieht das Wetter für zwei Stunden gut aus, fahren wir in Teams von drei bis vier Leuten zu den Delfinen hinaus. An einem schönen Tag sind wir von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf dem Wasser. Momentan arbeiten wir an vielen unterschiedlichen Studien zum Verhalten der Delfine und untersuchen beispielsweise den Gebrauch von Werkzeugen wie Schwämmen oder Muscheln bei der Nahrungsbeschaffung, analysieren die Auswirkungen der Hitzewellen auf die Meeressäuger oder nehmen DNA-Proben von den Tieren und ihrer Umwelt, die wir dann in Zürich untersuchen. Um an diesen Projekten zu arbeiten, füllen wir auf den Booten sogenannte Surveys aus, in
denen wir das Verhalten der Tiere festhalten. Dabei halten wir fest, ob sie beispielsweise nach Nahrung suchen, miteinander Freundschaften pflegen oder sich einfach ausruhen. Schwimmen zwei Delfine nahe nebeneinander und berühren sich dabei, ist das ein Zeichen dafür, dass die zwei besonders gut miteinander auskommen.
Durch Fotos, die wir ebenfalls vom Boot aus von den Tieren machen, können wir die Delfine anhand ihrer Rückenflosse eindeutig identifizieren und so mehr über ihre komplexen Gruppenstrukturen erfahren. Unsere Forschung ist eine der längsten Feldstudien an marinen Säugetieren – in über vierzig Jahren haben wir die Sozialstruktur von mehr als tausend Delfinen erforscht. Neben den Surveys und den Fotos machen wir auf den Booten je nach Projekt auch Drohnenaufnahmen von den Tieren oder entnehmen den Delfinen Gewebeproben für DNA-Analysen.
Wieder an Land, muss zuerst alles vom schädlichen Salzwasser gereinigt werden, zudem werden die Fotos – das können schnell 500 pro Survey sein –gesichert. Danach lassen wir beim selbstgekochten Abendessen in gemütlicher Stimmung den Tag Revue passieren. Für die Studierenden ist die Feldforschung immer ein grosses Abenteuer. Auch mir wird es nie langweilig. So musste ich auch schon mehr als 2000 Kilometer fahren, um einen Schiffsmotor flicken zu lassen.
Was mich an meiner Feldforschung immer wieder fasziniert, sind die Momente, in denen die einzelnen Beobachtungen, Daten und Ergebnisse plötzlich ein grösseres Bild ergeben. Als wir herausfanden, weshalb die Tiere grosse, leere Rüsselschneckenhäuser in den Schnauzen mit sich trugen, war das so ein Moment. Wir konnten beobachten, wie die Delfine Fische in die Schneckenhäuser jagten und damit an die Wasseroberfläche schwammen, wo sie die Gehäuse kurz schüttelten. Dadurch rutschten die Fische aus den Schneckenhäusern ins Maul der Delfine. An diesem Beispiel konnten wir zum ersten Mal nachweisen, dass erwachsene Tiere diesen Werkzeuggebrauch voneinander erlernen – was bis dahin nur bei Menschenaffen beschrieben worden war. Solche Momente machen die Wissenschaft und die Feldforschung spannend. Aufgezeichnet von Nicole Bruggmann
UZH-Alumna Claudia Rütsche ist Direktorin des Kulturama Museum des Menschen und Vorstandsmitglied bei UZH Alumni.

«Das naheliegendste
für Studienabgänger:innen ist das Netzwerk der eigenen
Claudia Rütsche, Sie leiten das Kulturama seit Ihrem 25. Lebensjahr. Wie wird man Museumsdirektorin?
Meine Verbindung zum Kulturama begann früh, mit 13 Jahren, um genau zu sein. Ich nahm mit solch grosser Begeisterung an einer Fossilienexkursion teil, dass ich gefragt wurde, ob ich als Freiwillige im Museum mithelfen möchte. Dieses Engagement wurde über die Jahre immer intensiver, während des Gymnasiums und auch während meines Studiums.
Letztlich beeinflusste das Kulturama meine Studienwahl massgeblich: Da ich mich nicht zwischen Natur- und Geisteswissenschaften entscheiden konnte oder wollte, kombinierte ich Geschichte als Hauptfach mit Paläontologie, Ur- und Frühgeschichte sowie Anthropologie. Diese interdisziplinäre Ausrichtung erwies sich als perfekte Grundlage für meinen Weg in die Museumswelt.
Mit erst 25 Jahren wurde ich Direktorin des Kulturama –damals als jüngste Museumsdirektorin der Schweiz. Rückblickend könnte man meinen, ich hätte bei der Studienwahl schon meine Karriere strategisch geplant. Doch tatsächlich folgte ich einfach meiner Begeisterung für die verschiedenen Themen und Disziplinen.
Welche Erfahrungen haben Ihnen auf diesem Weg geholfen?
Praktische Erfahrungen und persönliche Kontakte sind sehr wichtig. Ich rate Studierenden oder jungen Alumni, die in die Kulturvermittlung oder Wissenschaftskommunikation einsteigen möchten, bereits während des Studiums Praxiserfahrung zu sammeln, sei es durch Praktika, ehrenamtliches Engagement oder Nebenjobs.
Natürlich sind Uni-Absolvent:innen gefragt, das zeigt sich auch in unserem Team: Wir beschäftigen heute sechs wissenschaftliche Mitarbeitende aus verschiedenen Disziplinen, fünf davon haben an der Universität Zürich studiert. Gleichzeitig ist es jedoch illusorisch, zu denken, dass einem nach dem Bachelor oder Master einfach alle Türen offen-
stehen. Gerade in einer vergleichsweise überschaubaren Branche wie der Kultur- und Wissenschaftsvermittlung spielen Praxiserfahrung und Kontakte neben Können und Begeisterung eine wesentliche Rolle.
Was zeichnet das Kulturama aus?
Unser Museum stellt den Menschen in den Mittelpunkt, und zwar aus einer ganzheitlichen Perspektive. Diese interdisziplinäre Herangehensweise hat mich schon als Jugendliche fasziniert. Zudem wurde das Kulturama als private Stiftung mit einem klaren Bildungsauftrag gegründet. Das Kuratieren und Vermitteln gehen bei uns Hand in Hand. Unsere Angebote richten sich an alle Altersgruppen, von Kindergartenkindern bis zu Erwachsenen. Besonders am Herzen liegt mir, dass wir auch Menschen mit spezifischen Bedürfnissen oder Sprachbarrieren erreichen. Diese Vielfalt macht das Kulturama einzigartig.
Persönlich bin ich mit dem Museum gewachsen: Aus einer privaten Initiative mit einem kleinen Team ist eines der zehn meistbesuchten Museen Zürichs geworden. Diese Entwicklung macht mich stolz und das Kulturama zu meiner Lebensaufgabe.
Gibt es eine Ausstellung oder ein Projekt, auf das Sie besonders stolz sind?
Eines meiner Herzensprojekte ist die Ausstellung «Wie wir lernen». Die Idee dazu hatte ich in meinem Nachdiplomstudium in Kommunikationspsychologie (Counseling) an der UZH. Ursprünglich als Sonderausstellung konzipiert, haben wir diese aufgrund des positiven Feedbacks aus dem Bildungsbereich zu einer Dauerausstellung erweitert und das Kulturama in die Nachbarliegenschaft expandiert. Viele Besucher:innen, vor allem Kinder, kommen mit der Vorstellung, dass Lernen nur mit Schule zu tun hat. Doch in der Ausstellung entdecken sie, dass Lernen
viel mehr umfasst und wir alle ständig und überall lernen. Dieses «Aha-Erlebnis» der Besucher:innen begeistert mich immer wieder.
Inwiefern sehen Sie Parallelen zwischen Ihrer Arbeit im Kulturama und Ihrem Engagement im Vorstand von UZH Alumni?
Sowohl im Kulturama als auch im Alumni-Netzwerk geht es darum, Menschen zusammenzubringen und den Austausch zwischen unterschiedlichen Perspektiven zu fördern. Das gefällt mir. Networking nicht im engen Sinn von Karriereförderung, sondern um Gespräche mit Menschen aus anderen Studienfächern zu führen, finde ich enorm bereichernd. Die Alumni-Community bietet genau diesen Austausch – und das ist ein unschätzbarer Mehrwert, den wir noch stärker betonen sollten.
Welche Bedeutung haben Alumni Ihrer Meinung nach für die Universität?
Eine riesige! Absolvent:innen sind weltweit in den verschiedensten Berufen tätig, oft in Entscheidungspositionen, und können die Universität auf vielfältige Weise unterstützen – sei es mit Ideen, Kontakten oder finanziellen Beiträgen. Jede Form der Unterstützung zählt.
Ich persönlich empfinde eine grosse Dankbarkeit, dass ich studieren durfte. Denn meine heutige Tätigkeit wäre ohne Studium gar nicht möglich. Mein Engagement bei UZH Alumni ist darum meine Art, etwas zurückzugeben.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Alumni-Netzwerks?
Ich wünsche mir, dass die Mitgliedschaft im Alumni-Netzwerk für Absolvent:innen keine Frage mehr ist, sondern eine Selbstverständlichkeit. Nach dem Studium bemühen sich viele, ein berufliches Netzwerk aufzubauen, dabei ist das naheliegendste Netzwerk als Studienabgänger:in doch das Netzwerk der eigenen Universität.
Besonders schätze ich die thematische Vielfalt der Alumni-Veranstaltungen. Oft erhält man Einblicke in Themen, mit denen man sonst nicht in Berührung käme. Dieser Blick über den Tellerrand bereichert ungemein und hilft uns, eine interessierte und offene Haltung gegenüber der Welt und den Menschen beizubehalten. Interview: Anna-Julia Lingg, UZH-Alumni
Die Alumni-Organisationen der UZH schaffen ein starkes Netzwerk, das Menschen miteinander verbindet, wissenschaftliche Neugier fördert und die tiefe Verbundenheit zur Alma Mater lebendig hält. Sie wecken gute Erinnerungen an die Studienzeit, bieten spannende Veranstaltungen und halten ihre Mitglieder über Neuigkeiten an der Universität Zürich auf dem Laufenden. Alumnus oder Alumna ist man ein Leben lang – bleiben Sie Teil dieser Gemeinschaft! uzhalumni.ch
Profitieren Sie von einem erstklassigen Leistungspaket und Bonusprogramm. Beantragen Sie jetzt Ihre UZH Alumni Card Exclusive: 1. Jahresbeitrag + CHF 50 Gutschein im UZH-Shop geschenkt
Details und Kartenantrag: bonuscard.ch/uzhalumni



Was braucht Europa für eine erfolgreiche Zukunft? Im Dossier analysieren UZH-Forschende aus unterschiedlichen Disziplinen die aktuelle Situation und skizzieren, was getan werden müsste. Deutlich wird: Europa muss sich zusammenraufen, um sich zu behaupten und Lösungen für die grossen globalen Probleme zu finden. Dazu gehören: den Binnenmarkt besser nutzen, ideologische Gräben überwinden, um nachhaltiger zu werden, strategische Unabhängigkeit und verstärkte wissenschaftliche Zusammenarbeit.
DOSSIER — Europas Zukunft
Europa ist gefordert: im Innern durch den Populismus, von aussen durch China und die USA, die unter Trump vom Partner zum Rivalen werden könnten. Wie kann Europa diesen Herausforderungen begegnen? Eine Analyse mit der Politologin Stefanie Walter, dem Politologen Jonathan Slapin und dem Rechtswissenschaftler Daniel Moeckli.
Text: Thomas Gull
Drehen wir die Zeit dreissig Jahre zurück: In den 1990er-Jahren verkündete der US-Politikwissenschaftler Francis Fukuyama nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Fall des Eisernen Vorhangs in seinem Buch «Das Ende der Geschichte» den endgültigen Sieg des Liberalismus und der liberalen Demokratie. Tatsächlich gaben sich die osteuropäischen Staaten demokratische Verfassungen, nachdem sie sich vom Diktat der Sowjetunion befreit hatten, und die USA standen im Zenit ihrer Macht. Die Pax Americana, die sich nun auch über den Osten Europas erstreckte, bescherte dem Kontinent Jahrzehnte mit Frieden, Prosperität und tiefen Kosten für die Verteidigung, dank den USA und der Nato. Mittlerweile sind die Gewissheiten von einst verflogen. Europa findet sich in einer Welt wieder, die unsicher und instabil geworden ist. Der Krieg in der Ukraine und die imperialen Ambitionen Russlands fordern Europa politisch, militärisch und finanziell. Mit Donald Trump im Weissen Haus könnten die USA vom verlässlichen Partner zum Gegner werden. China macht Europa wirtschaftlich Konkurrenz, neuerdings auch bei den Autos und der Hochtechnologie. Gleichzeitig haben in vielen Staaten populistische Parteien grossen Zulauf. In einigen greifen sie nach der Macht, in anderen haben sie diese bereits erobert.
Welches sind die Ursachen dieser Probleme und wie kann Europa ihnen begegnen?
Der autoritäre Populismus untergräbt die Demokratie
Der autoritäre Populismus ist ein globales Phänomen. Es gibt ihn in einer linken wie in einer rechten Ausprägung. Aktuelle Beispiele für von autoritären Linkspopulisten regierte Staaten sind Venezuela oder die Slowakei. Von Rechtspopulisten regiert werden etwa die USA, Ungarn und Italien. Bis zum Regierungswechsel vor gut einem Jahr war auch in Polen mit «Recht und Gerechtigkeit» eine rechtspopulistische Partei an der Macht.
Der Populismus wird als Gefahr für die liberale Demokratie und den Rechtsstaat wahrgenommen. Tatsächlich haben beispielsweise Viktor Orban in Ungarn und «Recht und Gerechtigkeit» in Polen den Rechtsstaat und die Demokratie systematisch ausgehöhlt. Auch in den USA versucht die Trump-Regierung, die Kontrolle ihres Tuns durch das Parlament und die Gerichte auszuhebeln.
Weshalb vertragen sich Demokratie und Populismus nicht? «Populisten verstehen sich als Vertreter des Volkswillens, den es gegen alle Widerstände durchzusetzen gilt», erklärt UZH-Rechtswissenschaftler Daniel Moeckli. Deshalb sehen sie den Rechtsstaat, der gerade dazu dient, politische Macht zu bändigen und Minderheiten zu schützen, als Hindernis, das es zu beseitigen gilt. «Doch das Volk als geschlossene Einheit mit einem vorgegebenen Willen gibt es nicht», sagt Moeckli. Die Meinungen der Menschen sind vielfältig, politische Mehrheiten wandelbar. Deshalb besteht die fundamentale Aufgabe der Demokratie darin, zu ermöglichen, dass die Minderheit jederzeit zur Mehrheit werden kann –durch offene und faire Wahlen oder Abstimmungen.
Genau das versuchen autoritäre Populisten zu verhindern. Sie gelangen durch demokratische Wahlen an die Macht und nutzen diese dann, um den Staat so umzubauen, dass ein Machtwechsel nicht mehr oder nur noch schwer möglich ist. Attackiert wird dabei vor allem die Justiz, weil sie eine Bastion des Rechtsstaates ist. Ohne unabhängige Gerichte können auch andere rechtsstaatliche Institutionen
einfacher untergraben werden. So wurden etwa in Polen die Gerichte gleichgeschaltet, indem sie mit Loyalisten besetzt wurden. Nach dem Machtwechsel versucht nun die liberale Regierung unter Donald Tusk, das wieder rückgängig zu machen. Das sei aber schwierig, so Moeckli, vor allem wenn man sich dabei an rechtsstaatliche Prinzipien halten wolle.
Neben der Justiz sind die Medien eine weitere Instanz, die den Mächtigen auf die Finger schaut und sie kritisiert. Deshalb werden auch diese gleichgeschaltet, etwa indem sie von Freunden des Regierungschefs aufgekauft werden, wie das in Ungarn der Fall war. Oder sie werden so lange drangsaliert, bis sie aufgeben. Das Gleiche geschieht mit zivilgesellschaftlichen Organisationen oder Hochschulen, aus denen Kritik an den herrschenden Verhältnissen geäussert wird. So musste die von US-Milliardär George Soros gegründete Central European University in Budapest auf Druck der Regierung das Land verlassen.
Gemeinsam erfolgreich
sagt Slapin: «Nur weil ein Land eine demokratische Verfassung hat und die eine oder andere freie und faire Wahl abgehalten wurde, ist es noch keine stabile Demokratie. Dazu braucht es mehrere freie und faire Wahlen. Solche Prozesse dauern Jahrzehnte.» Deshalb sei es nicht überraschend, dass es in Osteuropa zu Rückfällen in den Autoritarismus komme, findet Slapin. «Es wäre eher erstaunlich, wenn alle Länder demokratisch bleiben würden.»
Angesichts der aktuellen geopolitischen Lage muss Europa zusammenstehen, auch wenn dies wegen der internen Differenzen nicht immer einfach ist. Das würde auch bedeuten, «mehr Souveränität nach Brüssel abzugeben», sagt Politologin Stefanie Walter.
Schliesslich können auch Grundrechte eingeschränkt und die Wahlgesetze geändert werden, wenn die Regierungspartei über die dazu notwendigen Mehrheiten verfügt. «Nach und nach werden alle Mechanismen abgeschafft, die faire demokratische Prozesse ermöglichen», sagt Moeckli. Die Wissenschaft nennt das «democratic backsliding», die schrittweise Demontage demokratischer Institutionen. Gibt es einen Kipppunkt, ab dem es unmöglich wird, die demokratische Ordnung wiederherzustellen? «Wenn die Demokratie schon so stark unterminiert ist wie in Ungarn, wird jede Änderung schwierig», sagt Daniel Moeckli, «doch letztlich kommt es auf die Bürgerinnen und Bürger und
Stabilität verleiht einem Land neben lange eingeübten und allgemein akzeptierten politischen Prozessen auch der Wohlstand: «Je reicher ein Land ist, desto unwahrscheinlicher ist, dass die Demokratie in Frage gestellt wird», so Slapin. Ob dieses Paradigma wirklich standhält, wird die weitere Entwicklung in den USA zeigen. Aktuell manifestiert sich dort ein anderes Problem: Demokratie hängt von der Haltung der Eliten ab, sagt Slapin. Sie funktioniert, solange sich diese an die demokratischen Normen hält. «In den USA ist das nicht mehr der Fall. Dort hat die Republikanische Partei akzeptiert, dass Trump die demokratischen Normen erodiert.»
Was hilft gegen die Erosion der Demokratie? Daniel Moeckli hat darauf zwei Antworten: Die EU hat seit 2021 einen neuen Rechtsstaatsmechanismus, der es erlaubt, Mitgliedstaaten die EU-Mittel zu kürzen, wenn sie gegen die Rechtsstaatlichkeit verstossen. Gegenüber Ungarn wird dieser Mechanismus bereits angewendet, indem Milliarden aus dem Kohäsionsfonds zurückgehalten werden. Einen Teil der Gelder hat die EU sogar endgültig gestrichen. Aus der Sicht von Moeckli ist das ein starker Hebel, um Regierungen unter Druck zu setzen: «Für Ungarns Staatshaushalt
«Die Demokratie muss ermöglichen, dass die Minderheit jederzeit zur Mehrheit werden kann.»
Daniel Moeckli, Rechtswissenschaftler
ihren Willen zur Demokratie an. Wird der Widerstand stark genug, kann auch ein autoritäres Regime stürzen.»
Weshalb kommen autoritäre populistische Parteien an die Macht, die dann die Demokratie auszuhebeln versuchen? UZH-Politologe Jonathan Slapin nennt dafür drei Gründe: die Enttäuschung über die bestehenden Verhältnisse, wie die weit verbreitete Korruption, wie das in Ungarn der Fall war, bevor Victor Orban mit seiner Fidesz-Partei an die Macht kam. Mittlerweile hat Orban selbst ein hochgradig korruptes Regime installiert.
Ein weiterer Grund für die Rückschritte sei, dass die Demokratien in Osteuropa noch nicht konsolidiert sind,
sind die EU-Mittel von zentraler Bedeutung.» Es muss sich allerdings erst noch weisen, ob der Druck ausreicht, um Orban dazu zu bewegen, die Rechtsstaatsprobleme ernsthaft anzugehen.
Gestärkt werden kann die Demokratie auch durch direktdemokratische Elemente. Das zeigt das von Daniel Moeckli geleitete Forschungsprojekt «Popular Sovereignty vs. the Rule of Law? Defining the Limits of Direct Democracy», das vom European Research Council (ERC) finanziert wurde. Das Projekt hat untersucht, welche direktdemokratischen Instrumente in den 46 Staaten des Europarats existieren, wie diese reguliert sind und wie sie genutzt werden. Ent-
scheidend sei dabei, so Moeckli, dass die direktdemokratische Mitsprache in rechtsstaatlich geregelten Bahnen verlaufe und von den Bürgerinnen und Bürgern selbst ausgelöst werden könne, wie dies etwa mit der Volksinitiative in der Schweiz der Fall ist. Würden hingegen Volksabstimmungen von oben angeordnet, sei die Gefahr des populistischen Missbrauchs gross, wie beispielsweise das Brexit-Referendum in Grossbritannien oder das ungarische Referendum über EU-Flüchtlingsquoten gezeigt hätten. «Wenn direktdemokratische Instrumente es tatsächlich erlauben, Probleme auf den Tisch zu bringen, die der Bevölkerung unter den Nägeln brennen, können sie eine wichtige Ventilfunktion haben», sagt Moeckli. Sie sorgen dafür, dass sich der Ärger nicht anstaut und von populistischen Bewegungen genutzt werden kann.
Der neue Nationalismus gefährdet den Zusammenhalt der EU
Die rechts- und die linkspopulistischen Parteien vertreten einen neuen Nationalismus, der die Interessen des jeweiligen Landes über die gemeinsamen Interessen der EU stellt und auch einen Gegensatz zwischen den beiden konstruiert. Die Befürworter des Brexit waren mit dieser Strategie erfolgreich. Gleichzeitig sind der Brexit und seine Folgen für Grossbritannien heute ein Mahnmal für jene, die mit dem Gedanken spielen, die EU zu verlassen. «Er hat gezeigt, wie schwierig und vor allem teuer es ist, die
Koalitionspartner in einer Regierung werden. Das würde aber nicht bedeuten, dass Deutschland die EU verlassen oder den Euro zerstören würde.» In Frankreich mit seinem Präsidialsystem sind die Aussichten ungewisser, weil Marine Le Pen durchaus Chancen hat, die nächsten Präsidentschaftswahlen zu gewinnen. Die Frage wird sein, ob die Front gegen Rechts hält, die bei den letzten Parlamentswahlen den Sieg des Front National verhinderte.
Die zersplitterte Parteienlandschaft macht es schwerer, Regierungen zu bilden
Jonathan Slapin verweist auf eine Entwicklung, die für viele europäische Staaten zu einem Problem geworden ist: die zersplitterte Parteienlandschaft. So gab es in Deutschland in den 1970er- und 1980er-Jahren zwei grosse (CDU/CSU und SPD) und eine kleine Partei (FDP), die sich bei der Regierungsbildung ablösten. Heute sind im Bundestag sieben Parteien vertreten. Vergleichbare Entwicklungen gibt es in Frankreich, den Niederlanden oder Österreich. «Das macht es schwierig, tragfähige Regierungen zu bilden, wie wir gerade in Frankreich und Holland sehen», sagt Slapin. Interessant ist, dass sich die politischen Standpunkte der Wähler:innen gar nicht so stark verschoben haben, wie es aufgrund der neuen Vielfalt der Parteien erscheint. «Die grundlegenden Präferenzen etwa in Bezug auf die Migration oder die EU haben sich in den letzten Jahren nicht stark gewandelt, sie sind sehr stabil, wie Umfragen zeigen»,
«Wir verlieren mit der transatlantischen Kooperation zwischen den USA und Europa gerade etwas sehr Wertvolles.»
Stefanie Walter, Politologin
EU zu verlassen, selbst für ein grosses europäisches Land, das stets ein Aussenseiter war und auch den Euro nicht übernommen hat», sagt Jonathan Slapin.
Ausserdem ist es für die nationalistischen Populisten schwierig, zusammenzuarbeiten, weil sie eben nur auf die Interessen ihres Landes schauen. «Wenn jeder versucht, für sich allein alles zu maximieren, ist schnell Schluss mit der Zusammenarbeit», sagt UZH-Politikwissenschaftlerin Stefanie Walter dazu. «Das zeigt sich zum Beispiel an der distanzierten Haltung von Marine Le Pen zu Donald Trump –‹America First›-Politik hat negative Folgen für Länder wie Frankreich. Das erschwert eine Zusammenarbeit auch zwischen nationalistischen Politikern.»
Die Frage ist, was passieren würde, wenn die radikale Rechte in den beiden wichtigsten EU-Ländern Deutschland oder Frankreich an die Macht käme. Zumindest im Fall von Deutschland hält Politikwissenschaftler Slapin das für unwahrscheinlich. «Die AfD wird es kaum auf 30 Prozent oder mehr Wähleranteil bringen. Sie könnte vielleicht
sagt Stefanie Walter, «Aber die Leute mit migrations- oder EU-kritischen Meinungen hatten lange kein starkes politisches Sprachrohr.» Das hat sich mit den neuen Parteien verändert und damit auch das Wahlverhalten.
Die USA werden vom Partner zum Rivalen
Seit dem Zweiten Weltkrieg stand (West-)Europa unter dem militärischen Schutz der USA. Die Vereinigten Staaten waren politisch und ökonomisch ein verlässlicher Partner. Mit der Trump-Administration, für die es nur noch Konkurrenten und Feinde gibt, ist das vorbei. «Die Forschung zeigt, dass es für Staaten grundsätzlich gut ist, wenn sie zusammenarbeiten», sagt Stefanie Walter dazu, «deshalb verlieren wir mit der transatlantischen Kooperation zwischen den USA und Europa gerade etwas sehr Wertvolles.» Walter bezweifelt, dass selbst nach dem Ende von Trumps Regierungszeit das alte freundschaftliche Verhältnis rasch wiederhergestellt
werden kann. «Deshalb tut Europa gut daran, sich abzunabeln und strategisch unabhängig zu werden.»
Das gilt besonders für die Verteidigung. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist Europa ein ökonomischer Gigant –das BIP der 27 EU-Staaten entspricht etwa jenem Chinas –, aber militärisch ein Leichtgewicht. Unter dem Schirm der von den USA angeführten Nato konnten die europäischen Staaten ihr Geld in den Wohlfahrtsstaat statt in die militärische Aufrüstung investieren. Das muss sich nun ändern, was schwierig und teuer wird. Vor allem müssten die europäischen Staaten viel enger zusammenarbeiten, sagt Jonathan Slapin: «Die EU-Staaten müssten ihre Ressourcen zusammenlegen und eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik entwickeln.» Allerdings gibt es da verschiedene Hindernisse. Dazu gehört, dass die Länder einen Teil ihrer Souveränität abgeben müssten. Ob sie bereit dazu sind? Slapin bezweifelt das. «Frankreich beispielsweise wünscht sich europäische Streitkräfte. Aber solche nach französischen Vorstellungen und unter französischer Führung. Und würde Frankreich die Kontrolle über seine Nuklearwaffen einem militärischen Kommando überlassen, das nicht französisch ist? Wohl kaum.»
Die Nationalismen zu überwinden, dürfte bei der Verteidigung noch schwieriger sein als bei der Wirtschaft oder der Migration. Immerhin investieren mittlerweile Polen, Finnland, Schweden und die baltischen Staaten stark in die militärische Aufrüstung. «Und zum ersten Mal werden deutsche Soldaten permanent in Litauen stationiert», sagt Slapin. «Die Dinge verändern sich langsam. Doch der grosse Schock, den die USA mit ihrer Ukraine-Politik und ihrer offensichtlichen Abkehr von der transatlantischen Freundschaft in den letzten Wochen ausgelöst haben, könnte nun dazu führen, dass sich wirklich etwas bewegt.»
5. Russland bedroht Europas Sicherheit
Russland hat mit dem Angriff auf die Ukraine die europäische Friedensordnung, die seit dem Zweiten Weltkrieg Bestand hatte, umgestossen. Paradoxerweise hat sich Russland damit selbst geschwächt. «Mit dem Krieg ist Russland definitiv zum Juniorpartner Chinas geworden», urteilt Stefanie Walter, «China hat mittlerweile Russland nicht nur ökonomisch, sondern auch militärisch überholt.» Ohne die Unterstützung Chinas hätte sich Russland vermutlich nicht so lange halten können.
Ökonomisch ist Russland schon lange keine Supermacht mehr, sein BIP entspricht etwa jenem Spaniens. Trotzdem sei Russland eine massive Bedrohung für Europa, insbesondere für Staaten an der Grenze zu Russland, wie die baltischen Staaten, sagt Stefanie Walter. Das Putin-Regime habe gezeigt, dass es bereit sei, massive Kosten in Kauf zu nehmen, um Territorium zu gewinnen, auf das es Anspruch zu haben glaubt. «Das ist dank den politischen Strukturen in Russland möglich, während sich die europäischen Demokratien schwer damit tun, auf Kriegswirtschaft umzustellen.» Schon jetzt zerstört Russland mit Sabotageakten etwa in der Ostsee wichtige Infrastrukturen
innerhalb Europas. Der Ukraine-Krieg habe die Europäer hier jedoch stärker zusammengeschweisst, so Walter. «Sie reden jetzt auch im militärischen Bereich über Dinge wie gemeinsame Beschaffungen von militärischen Gütern oder sogar eine europäische Armee, die vor ein paar Jahren noch undenkbar waren.» Schwer zu verdauen ist für Europa die Haltung der Trump-Administration gegenüber der Ukraine. Trump übernimmt hier zunehmend Positionen Russlands und fordert ein Ende des Kriegs in der Ukraine, ohne dass die Ukraine selbst oder die Europäer bei den Verhandlungen mit am Tisch sitzen sollen. Zudem stellt sich für die EU-Staaten die Frage, ob die Ukraine in die EU aufgenommen werden soll. «Aus meiner Sicht gibt es einen grundsätzlichen Konsens, dass die Ukraine Teil der EU werden soll», sagt Stefanie Walter. Aber der Weg dorthin ist nicht einfach. Um das zu ermöglichen, müssten die EU-Verträge angepasst werden, damit die EU nicht irgendwann entscheidungsunfähig wird. Gleichzeitig bräuchte es wichtige Reformen, zum Beispiel beim Thema EU-Agrarsubventionen, die nach der aktuellen Regelung quasi komplett in die Ukraine fliessen würden.
Was ist zu tun?
Angesichts der aktuellen geopolitischen Lage muss Europa zusammenstehen, auch wenn dies wegen der internen Differenzen nicht einfach ist. Die EU nimmt hier eine wichtige Rolle ein, doch es gibt zunehmend Formate, in die auch Nicht-EU-Staaten wie Grossbritannien oder Norwegen eingebunden sind. Zusammenstehen würde auch bedeuten, «mehr Souveränität nach Brüssel abzugeben», wie es Stefanie Walter formuliert. Das gilt insbesondere für die Aussen- und die Sicherheitspolitik. Vielleicht gelingt das doch, gerade weil der Druck so gross ist. «Die EU hat es in der Vergangenheit immer wieder geschafft, doch noch die Kurve zu kriegen, auch wenn dies oft auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner geschah», sagt Stefanie Walter.
Jonathan Slapin schlägt noch etwas anderes vor: «Die europäischen Staaten sollten nicht nur auf das Wirtschaftswachstum fokussieren, sondern sich mehr um die Arbeiterklasse kümmern. Und die EU sollte vielleicht auf bestimmten Gebieten mehr staatliche Subventionen zulassen.» Das könnte die Unzufriedenheit von Bevölkerungsgruppen dämpfen, die heute mit Erfolg von den populistischen Parteien angesprochen werden. Es wäre allerdings eine Abkehr vom wirtschaftsliberalen Modell, das zusammen mit der Globalisierung für sehr günstige Konsumgüter gesorgt hat.
Prof.
Prof.
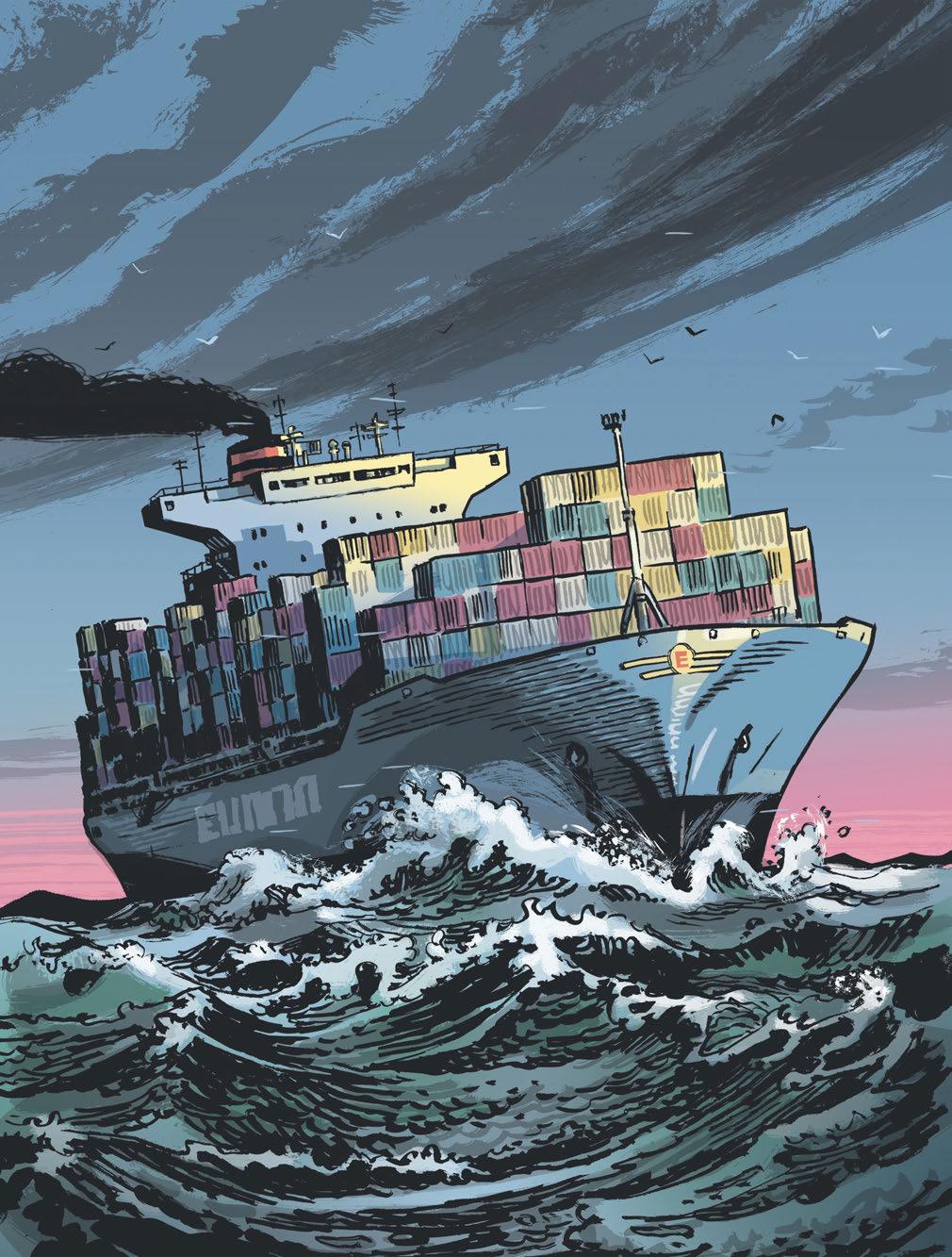
DOSSIER — Europas Zukunft
Europa soll gezielt Hindernisse im Binnenmarkt beseitigen und nicht versuchen, alles bis ins Kleinste zu regulieren. Dann wird es seine wirtschaftliche Stärke gegenüber China und den USA ausspielen können, sagen der Ökonom Mathias Hoffmann und der Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann.
Interview: Theo von Däniken, Roger Nickl Mathias Hoffmann, Tobias Straumann, die Zeichen für Europa stehen aktuell nicht gut: Deutschland als wirtschaftlicher Motor der EU schwächelt, der Anschluss an Zukunftstechnologien wie KI oder Elektromobilität wurde verschlafen, ein Handelskrieg mit den USA droht. Wie ist Ihre Einschätzung, droht Europa seine Stellung als globale Wirtschaftsmacht zu verlieren?
Mathias Hoffmann: Wenn Europa sich auf seine Stärken besinnt und an den entscheidenden Stellschrauben dreht, kann es seine Stellung in der Welt behaupten. Denn welche Alternative gibt es zu Europa?
Das Modell der chinesischen Wirtschaft und Gesellschaft ist langfristig untragbar und kommt zunehmend unter Druck. Das ausschliesslich durch Export getriebene Wachstum stösst an Grenzen und es zeichnet sich zunehmend eine langfristige Stagnation ab. In den USA boomt im Moment zwar die Wirtschaft, aber wie die Zukunft unter der jetzigen politischen Führung aussieht, ist ungewiss. Europa hat noch immer ein vergleichsweise gut funktionierendes Gesellschaftsmodell. Die wirtschaftliche Performance ist zwar nicht toll, aber man kann auf ihr aufbauen. Ich bin gar nicht so pessimistisch. Tobias Straumann: Ich teile diese Meinung. Es ist ja nicht so, dass Europa KI oder die Elektromobilität verschlafen hätte. Was aber fehlt, sind Firmengründungen in diesen Bereichen. Die Innovationen entstehen in Europa zum Beispiel im Umfeld von Forschungsinstitutionen wie den
Gemeinsam erfolgreich
Max-Planck-Zentren in Deutschland. Aber weil der europäische Binnenmarkt noch nicht optimal ausgebildet ist, ist es schwieriger, eine Idee zu skalieren. Deshalb wandern die Leute in die USA ab, wo es einfacher ist, die Umsetzung von Innnovationen in Produkte zu finanzieren. Die Rahmenbedingungen in Europa so zu verbessern, dass der Binnenmarkt wirklich funktioniert, ist aber nicht einfach.
Hoffmann: Ich glaube auch, dass Europa das gigantische Potenzial seines Binnenmarkts besser nutzen muss. Hier sind aber noch viele Hausaufgaben nicht gemacht. Ob bei den Berufslehren, der Steuergesetzgebung, den Migrationsmöglichkeiten von Arbeitnehmenden, der Integration in die Sozialversicherungssysteme oder den Regulierungen, die in jedem Land anders sind: Da ist vieles noch Stückwerk. Gerade für Startups oder die grossen Industrien, die hohe Kapitalkosten haben, um neue Technologien zu entwickeln, wäre ein einheitlicher Markt mit 500 Millionen relativ kaufkräftigen Kunden ein Gamechanger.
Was braucht es denn konkret, um die Rahmenbedingungen für den Binnenmarkt zu verbessern?
Europa muss seinen Binnenmarkt besser nutzen, wenn es wirtschaftlich dynamischer werden will. Ein vereinheitlichter Kapitalmarkt und internationale Bankenzusammenschlüsse würden es Unternehmen einfacher machen, sich zu finanzieren.
Hoffmann: Ganz viel Innovation entsteht in den relativ technologielastigen mittelständischen Unternehmen. Sie stehen kaum im Fokus, sind aber das eigentliche Rückgrat der Wirtschaft. Diesen Mittelständlern muss Europa eine Perspektive bieten. Hier ist meines Erachtens die Kapitalmarkt- und Bankenunion ganz wichtig. Es braucht grenzüberschreitende Zusammenschlüsse von Banken, die gerade auch kleine und mittlere Unternehmen bedienen. Ein mittelständisches Unternehmen auf der Schwäbischen Alb kann nicht zwischen zwanzig Banken auswählen, die ihm Kredite gewähren. Es hat eine lokale Bank, zu der es gehen kann, und die diktiert ihm die Bedingungen. Ob diese Bank dann versteht, was das Unternehmen macht und wohin es in Europa expandieren will, ist fraglich. Eine Bankenunion wäre dafür eine deutliche bessere Grundlage.
Momentan hat man jedoch den Eindruck, dass vor allem die nationalen Fliehkräfte stärker werden. Ist es realistisch, dass sich Europa zusammenrauft, um diese Aufgaben anzugehen?
immer, dass man Dinge zugelassen hat, die die Welt verändern.»
Tobias Straumann, Wirtschaftshistoriker
Straumann: Ich glaube, ein durchgehender europäischer Binnenmarkt ist eine Utopie. Steuersysteme, Sozialversicherungen, Berufsbildung zu vereinheitlichen, ist schwierig. Aber vielleicht ist das auch nicht nötig, um die Hürden für die Innovation wegzuräumen. Europa sollte sich auf die strategisch wichtigen Themen konzentrieren, wie die genannte Vereinheitlichung im Finanzbereich. Daneben könnte man gewisse Bereiche ohne grossen Widerstand liberalisieren. Zum Beispiel könnten Startups privilegierten Zugang zu allen Märkten erhalten. Oder man könnte Hürden für bestimmte zukunftsweisende Branchen wie Kommunikation oder digitale Technologien abbauen. Wenn sich Europa klug auf wesentliche Bereiche fokussiert, dann halte ich es für durchaus möglich, dass es in den nächsten fünf Jahren vorwärtsgeht.
Hoffmann: Die Kapitalmarkt- und Bankenunion zu realisieren, ist nicht einfach, aber meines Erachtens machbar. Das wäre ein entscheidendes Signal und würde Euro-
pa nach innen sehr viel stärker machen. Bei den Steuersystemen kann man zumindest ein paar Weichen stellen. Bei den sozialen Systemen sehe ich allerdings nicht, dass sich die Staaten in den nächsten Jahren aufeinander zubewegen. Das ist zu kompliziert und hier fehlt tatsächlich der politische Wille.
Sie sagen, Europa muss Regulierungen abbauen. Nun dienen diese zum Teil ja auch dazu, ökologische, gesundheitliche oder soziale Standards aufrechtzuerhalten, die zu dem gut funktionierenden Gesellschaftsmodell beitragen, das Sie eingangs ansprachen. Muss man diese Errungenschaften aufgeben?
Hoffmann: Das kann man nicht generell sagen, sondern muss es im Einzelfall anschauen. Nehmen wir das Beispiel gentechnisch veränderter Lebensmittel. Natürlich muss man bei den Produkten genau ausweisen, ob sie verändert wurden. Aber soll man sie und die Forschung dazu verbie-
Weiterbildung

Objekt der euklidischen
Geometrie
U=2 π r
Äusserst schmackhafte
Mischung von Kohlenhydraten
Mögliches Objekt eines Haftpflichtfalles
Articulatio temporomandibularis
Wichtiges künstlerisches
Stilmittel im Impressionismus
Weiterbildung mit Biss: weiterbildung.uzh.ch
ten? Wenn Europa das macht, der Rest der Welt aber nicht, dann verliert es auch den Einfluss auf Sicherheitsstandards, weil das Know-how dazu verloren geht. Mit der künstlichen Intelligenz macht Europa gerade den gleichen Fehler. Wenn man KI zu Tode reguliert und die Forschung dann in China oder den USA gemacht wird, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn man irgendwann nicht mehr mitspielt. Ich würde hier viel mehr dem Markt überlassen.
Straumann: Die grosse Stärke Europas war immer, dass man Dinge zugelassen hat, die die Welt verändern können. Zum Beispiel hat die Erfindung des Buchdrucks letztlich zur Reformation geführt. Das war eine relativ blutige Sache und man hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Aber es ist auch die grosse zivilisatorische Leistung des spätmittelalterlichen, frühneuzeitlichen Europa. Wenn man jetzt sagt, Europa steht für Standards und Regulierung, dann widerspricht dies eigentlich der europäischen Geschichte. Das kann nicht die Zukunft sein. Die Europäer müssen auch wieder mehr Zukunftsvertrauen entwickeln. Die Menschen sind zu pessimistisch auf diesem Kontinent.
Dazu passt, dass in vielen Ländern die europaskeptischen und sogar europafeindlichen Kräfte stärker werden. Hat Europa den Glauben an sich verloren – woher kommt dieser Pessimismus?
Straumann: Das hat einerseits mit der Veränderung der Altersstruktur zu tun. Wenn es wenig junge Menschen gibt, beeinflusst das die Zukunftserwartungen. Zudem ist Europa relativ gesehen ein absteigender Kontinent. Es wird an seine frühere geopolitische Rolle nicht mehr anknüpfen können. Insbesondere in Grossbritannien und Frankreich war die Dekolonialisierung ein schmerzhafter Prozess. Das ist sicherlich auch ein Faktor. Ich glaube aber, es hat auch sehr viel mit dem übermässigen Bemühen der EU zu tun, alles auf europäischer Ebene regeln zu wollen.
Hoffmann: Das ist ein wichtiger Punkt. Was zentral und was dezentral geregelt wird, ist immer eine Frage des Aushandelns. Hier sollte sich die EU auf Bereiche konzentrieren, die zentral geregelt werden müssen, und nicht versuchen, alles bis ins kleinste Detail zu regeln. Gelingt dies, dann fällt ein grosser Teil des Euroskeptizismus weg.
Blicken wir in die unmittelbare Zukunft:
Seit dem Amtsantritt von Donald Trump steht das Gespenst eines Handelskriegs mit den USA im Raum. Was würde ein solcher für Europa bedeuten?
Straumann: Es ist aktuell schwierig zu sagen, wie sich das Verhältnis zu den USA entwickeln wird. Aber es gibt sicher Bereiche, in denen Europa nachgeben muss. Beispielsweise erhebt Europa Zölle auf US-Autos. Wenn Trump nun Zölle auf europäische Autos schlägt, dann hat das eine gewisse Berechtigung und Europa muss sich flexibel zeigen. Wenn ich auf die erste Trump-Administration zurückschaue, dann sind die Handelskonflikte am Ende ja glimpflich verlaufen. Ob es in der zweiten Trump-Administration anders sein wird, kann im Moment niemand sagen. Aber ich glaube, man muss sich nicht so grosse Sorgen machen.
Hoffmann: Trump geht vielleicht undiplomatisch vor, aber er setzt Punkte auf die Tagesordnung, denen sich Europa stellen muss. Zum Beispiel geht es ihm um den grossen Handelsbilanzüberschuss, den Europa gegenüber den USA aufweist. Die Deutschen sind nach wie vor stolz auf ihre Exportüberschüsse. Wirtschaftlich machen diese aber keinen Sinn. Denn sie bedeuten auch, dass die heimische Nachfrage zu klein ist und zu wenig in Deutschland investiert wird. Was heisst das konkret?
Hoffmann: Seit der globalen Finanzkrise transferieren die deutschen Unternehmen ihre Nettoersparnisse ins Ausland, statt sie im Inland zu investieren. Wenn Trump nun fordert, dass die Europäer mehr für die Rüstung ausgeben sollen, dann kann Europa dieses Geld auch in europäische Unternehmen investieren. Dennoch ist es illusorisch, zu glauben, dass sich Europa in den nächsten fünfzehn oder zwanzig Jahren in der Verteidigung von den USA emanzipieren könnte. Also kann man hier auf Trump zugehen und einen Teil der Waffen auch in den USA kaufen. Beides trägt zum Ausgleich der Handelsbilanzdefizite bei.
Wenn Sie weiter in die Zukunft schauen?
Kann sich Europa als wichtiger Player in der globalen Wirtschaft behaupten?
Straumann: Ich weiss nicht, ob man in fünf Jahren schon sagen kann, jetzt hat Europa die Wende geschafft, aber in zehn Jahren vermutlich schon.
Hoffmann: Ich glaube auch, wir werden ein Europa sehen, in dem viele der angesprochenen Hausaufgaben erledigt sind. Europa wird einen deutlich integrierteren Banken- und Kapitalmarkt haben, seine Binnennachfrage deutlich stärker nutzen und sich wie die anderen grossen Blöcke auch stärker nach innen orientieren. Für Europa heisst das eben, diesen Binnenmarkt zu schaffen, damit es interessant ist, hier zu produzieren. Dann kann man auch die Chinesen einladen, hier ihre Batteriefabriken oder Autos zu bauen. Ob die Menschen dann vollelektrisch oder hybrid fahren, ob BMW oder BYD, das soll dann der Markt entscheiden.
Mathias Hoffmann ist Professor für International Trade und Finance an der UZH. Er beschäftigt sich damit, wie sich Integrationsprozesse in Finanz märkten – beispielsweise die finanzielle Globali sierung oder die europäische Integration – auf die Realwirt schaft auswirken. mathias.hoffmann@econ.uzh.ch
Tobias Straumann ist Professor für Geschichte der Neuzeit und Wirtschaftsgeschichte an der UZH. Im Besonderen interessiert ihn das Zusammenspiel von Wirtschaftskrisen, Institutionen und Politik. tobias.straumann@uzh.ch
DOSSIER — Europas Zukunft
Die Schweiz und die EU wollen bis 2050 klimaneutral werden. Doch sind sie von diesem Ziel noch weit entfernt. Ein Grund dafür sind ideologische Gräben in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Diese müssen überwunden werden, wenn Europa nachhaltig werden soll.
Text: Roger Nickl
Wie stellen Sie sich ein gutes im Leben im Jahr 2040 vor? Dies wollte das deutsche Sinus-Institut für Markt- und Sozialforschung in einer Umfrage wissen. Herausgekommen ist dabei ein überraschend einheitliches Bild. Quer durch alle Gesellschaftsschichten wünschen sich die Menschen für die Zukunft grüne Landschaften, eine hohe Artenvielfalt und soziale Sicherheit. «Das sind alles Themen, die sich mit den von der UNO festgelegten globalen Nachhaltigkeitszielen decken», sagt Kai Niebert. Doch diesem Wunsch- und Leitbild der Menschen werde in der Politik zu wenig Rechnung getragen. Ein Grund dafür ist, dass die politische Landschaft in Nachhaltigkeitsfragen in vielen europäischen Ländern tief gespalten ist. Das sollte sich ändern, sagt Niebert. «Wir müssen es schaffen, die international vereinbarten und gesellschaftlich gewollten Zukunftswünsche stärker Politik werden zu lassen, damit Europa nachhaltig wird.» Denn obwohl viele von grünen Landschaften träumen, geht es mit der Transformation zu einer nachhaltigeren Wirtschaft und Gesellschaft in Europa zwar stetig, aber zu langsam voran. Die Weichen dafür sind eigentlich gestellt: Die UNO hat 17 Nachhaltigkeitsziele definiert, die alle Mitgliedstaaten bis 2030 erreichen sollten, die Schweiz hat das «Zielbild klimaneutrale Schweiz 2050» definiert und die EU den Green Deal lanciert, der Europa in den nächsten 25 Jahren zum weltweit ersten klimaneutralen Kontinent machen will. Doch von den gesetzten Zielen sind wir noch weit
entfernt und die Zeit läuft uns allmählich davon. Auch wenn es immer ambitionierter wird, müssten wir alles dafür tun, um die gesetzten Zeitvorgaben zu erreichen, sagt Niebert.
Politischer Kulturkampf
Kai Niebert hat mehrere Hüte auf. Er forscht und lehrt an der UZH, wo er Professor für Didaktik der Naturwissenschaften und der Nachhaltigkeit ist. Gleichzeitig ist er als wissenschaftlicher Berater Teil verschiedener Gremien der deutschen Bundesregierung, die sich mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen, und er ist Präsident des Deutschen Naturschutzrings, des Dachverbands der deutschen Umweltorganisationen.
erfolgreich
Die Menschen wünschen sich grüne Landschaften, Artenvielfalt und soziale Sicherheit. Um dies zu erreichen, muss Nachhaltigkeit als gemeinsames Ziel begriffen werden, unabhängig von politischen Positionen.
Eine Ursache dafür, dass Europa bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen zu zögerlich vorankommt, sieht Niebert in einem politischen Kulturkampf. «Klimawandel und Nachhaltigkeit werden von Teilen der Gesellschaft und der Politik als links-grüne Projekte definiert, von denen sie sich abgrenzen wollen», sagt er. Konservative und christliche Kreise hätten es verpasst, Nachhaltigkeit als eines ihrer eigenen Themen zu begreifen, obwohl es dies durchaus sein sollte. Denn es geht darum, Dinge zu erhalten und Natur und Schöpfung zu bewahren, sagt der Nachhaltigkeitsforscher. Doch ideologische Gräben erschweren die Suche nach einem gemeinsamen Weg in die Klimaneutralität.
Diese Gräben durchziehen nicht nur die Politik, sondern die Gesellschaft insgesamt. Eine Rolle spielt dabei, dass Nachhaltigkeitsthemen in der gesellschaftlichen Diskussion, aber auch in der Bildung häufig individualisiert werden. «Wir konnten in einer Studie nachweisen, dass Bildungsangebote Menschen eher dazu anleiten, das Licht auszumachen und darauf zu achten, was auf ihrem Teller liegt, anstatt die grossen und wichtigen Fragen zu stellen, wie wir als Gesellschaft Strukturen schaffen können, die nachhaltiges Verhalten ermöglichen und fördern», sagt Kai Niebert.
Der Fokus auf den individuellen Umgang mit Nachhaltigkeit führt eher zu einer Spaltung der Gesellschaft als zu einem konstruktiven Miteinander. Denn nachhaltiges
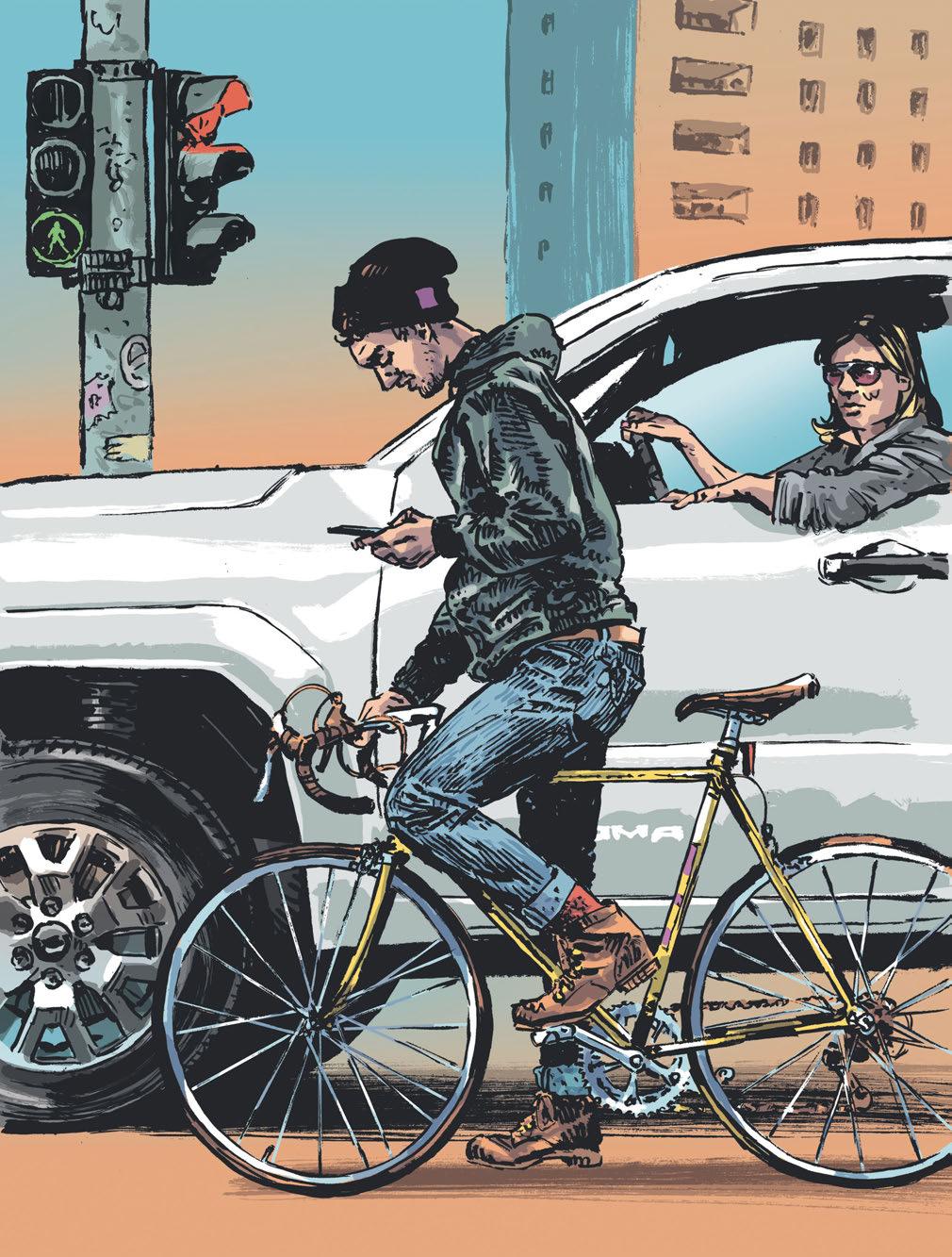
Verhalten wird so zu einer moralischen Frage. Es geht darum, dass ich mich als besserer Mensch fühle, wenn ich vegan lebe und nicht mehr in ein Flugzeug steige, sagt Niebert. «Künftig sollten wir deshalb das, was uns verbindet, mehr betonen und nach vorne stellen, das gilt nicht nur für die Politik, sondern auch für Wissenschaft und Gesellschaft.» Statt nachhaltiges Verhalten zu moralisieren, sollten wir Wege finden, wie dieses erleichtert wird. «Geht es um Nachhaltigkeit, stehen oft die Probleme im Vordergrund und nicht die Lösungen, die wir eigentlich brauchen», sagt Niebert, «mit Letzteren sollten wir uns mehr beschäftigen». Denn auf ein Auto können wir verzichten, wenn es dazu interessante Alternativen gibt. Dasselbe gilt für den Sonn-
engagieren und sich auf verschiedene Klimaszenarien vorbereiten. «Je länger wir warten, desto grösser werden die Schäden und die Verluste», sagt Sautner. Auch wenn der Trend aktuell in die Gegenrichtung geht, ist das Bewusstsein dafür bei den Investorinnen und Investoren gestiegen. Viele haben realisiert, dass das Thema Nachhaltigkeit fundamental ist, wenn Unternehmen langfristig erfolgreich sein wollen. Aber eben lange noch nicht alle.
Sautners Forschung zeigt, dass zahlreiche Unternehmen im grossen Stil Anti-Klima-Lobbying betreiben. «Vor allem CO2-intensive Firmen unternehmen viel, um striktere Regulierungen und etwa eine angemessene Steuer auf Kohledioxid-Emissionen zu verhindern», sagt der Sustai-
«Die Investitionen in nachhaltige Finanzprodukte sind in Europa unter Druck geraten und zum Teil zurückgegangen.» Zacharias Sautner, Sustainable Finance-Forscher
tagsbraten. Die Auswahl an nachhaltig produzierten Lebensmitteln bei Migros, Coop & Co. ist deutlich grösser und vor allem trendiger geworden, hat Kai Niebert festgestellt, das sei erfreulich. Denn nachhaltiges Verhalten über ein attraktives Angebot zu fördern, ist erfolgversprechender als das Predigen von Moral und Verzicht beim Essen. «Value» und «Values»
Geht es um eine nachhaltige Zukunft, spielt die Wirtschaft eine Schlüsselrolle. Allerdings tut auch sie sich zunehmend schwer mit der Nachhaltigkeit. Dies hat der Ökonom Zacharias Sautner festgestellt, der sich in seiner Forschung an der UZH mit Sustainable Finance beschäftigt. «Die Investitionen in ESG-Finanzprodukte sind in Europa unter Druck geraten und zum Teil zurückgegangen», sagt er. ESG steht englisch für Environmental, Social, Governance und bezeichnet Kriterien für ein nachhaltiges Engagement in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Ein Grund für das abnehmende Interesse an nachhaltigen Geldanlagen ist, dass ESG-Finanzprodukte verstärkt politisch wahrgenommen werden – als Ausdruck eines woken Kapitalismus, der vor allem moralische Prinzipien umsetzen will, aber zu wenig auf Gewinn und Risiko schaut. Verbreitet ist dieses Denken vor allem in Teilen der USA, aber zunehmend auch in Europa.
«Die Annahme, dass es bei nachhaltigen Finanzprodukten vor allem um moralische Werte (values) geht, ist aber falsch», sagt Zacharias Sautner, «im Zentrum stehen ganz ökonomische Interessen und finanzielle Werte (value).»
Denn die Forschung der letzten Jahre macht deutlich, dass finanzielle Risiken und klimabedingte Verluste für die Volkswirtschaft, aber auch für einzelne Unternehmen mit dem Klimawandel deutlich steigen. Die Wirtschaft sollte sich deshalb aus eigenem Interesse für mehr Klimaschutz
nable-Finance-Experte, «und sie tun das sehr erfolgreich.» Dies sei aber nicht nur aus moralischen, sondern vor allem auch aus ökonomischen Gründen für diese Unternehmen problematisch. Denn einerseits kann sich die Lobbyarbeit negativ auf ihre Reputation auswirken. Andererseits laufen die Unternehmen Gefahr, den Wandel zur Klimaneutralität zu verschlafen, da sie ihre Emissionen nicht schnell genug senken. Dies in der Hoffnung, dass ihr Lobbying erfolgreich ist. «Damit steigt auch das Risiko, dass sie künftig massiv an Wert verlieren», sagt Sautner.
Aus diesen Gründen sollten Investorinnen und Investoren sich stärker engagieren und von den Unternehmen einfordern, mehr für den Klimaschutz zu tun. «In der Schweiz besteht da beispielsweise bei finanzstarken Pensionskassen noch viel Potenzial», sagt Zacharias Sautner, «hier sind wir ja im Prinzip alle Investorinnen und Investoren und können aktiv einfordern, dass sie sich noch mehr für den Klimaschutz engagieren.» Das ist dann ein Engagement für nachhaltige Strukturen, das über das Alltagshandeln hinausgeht und auch aus Risiko- und Umweltgesichtspunkten eine gute Idee.
Weniger Details regulieren
Um der Wirtschaft neue Impulse in Richtung Nachhaltigkeit zu geben, braucht es auch eine neue Politik, ist Kai Niebert überzeugt. Im Green Deal der EU sei beispielsweise alles bis ins Detail geregelt. «Metaphorisch gesprochen: Während die USA sagen, wir spielen Fussball und schiessen ein Tor, heisst es in Europa, wir schiessen auch ein Tor, aber es muss ein Fallrückzieher in der 87. Minute ins rechte obere Lattenkreuz sein», sagt der Forscher, «das heisst, wir sollten von Detailregulierungen wegkommen und punkto Nachhaltigkeit mehr grosse Vorgaben machen.» Die Bürokratie müsse reduziert werden, ohne damit gleichzeitig Nachhal-
Herausforderungen und Chancen
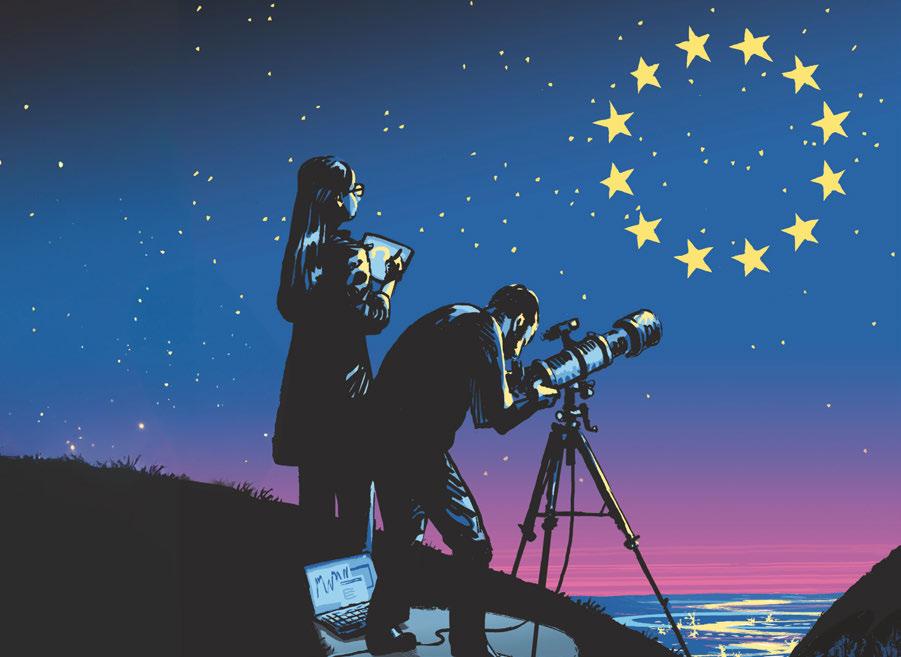
Europa ist gefordert: Der autoritäre Populismus gefährdet die Demokratie und der neue Nationalismus den Zusammenhalt der EU. Wirtschaftlich sollte Europa seine Stärken gegenüber China und den USA ausspielen. Was es zu tun gilt, um diese Herausforderungen zu meistern und den europäischen Platz in der globalen Ordnung zu behaupten, diskutieren im Talk im Turm der Politologe Jonathan Slapin und der Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann mit den beiden Moderatoren Rita Ziegler und Roger Nickl.
Es diskutieren:
Politologe
Prof. Jonathan Slapin
Wirtschaftshistoriker
Prof. Tobias Straumann
Moderation
Rita Ziegler und Roger Nickl, UZH Kommunikation
Montag, 4. April 2025
18.15 bis 19.30 Uhr
Restaurant UniTurm, Rämistrasse 71, 8006 Zürich
Türöffnung 17.45 Uhr
Der Talk im Turm ist eine Koproduktion von UZH Alumni und UZH Kommunikation.
Anmeldung unter: www.talkimturm.uzh.ch
Eintritt (inklusive Apéro): CHF 45
Mitglied bei UZH Alumni: CHF 30
Studierende: CHF 20
Platzzahl beschränkt, Anmeldung erforderlich
tigkeitsstandards abzubauen – dies sei eine grosse Herausforderung.
Ändern sollte sich auch die Entwicklungspolitik: Denn durch unseren Wohlstand lagern wir viele negative Effekte in den globalen Süden aus. Da müssten wir mehr Verantwortung übernehmen, sagt Kai Niebert. Der Norden habe im Süden gerade während der Corona-Pandemie viel an Glaubwürdigkeit verloren, weil er vor allem auf sich selbst geschaut und nach der Pandemie seine Wirtschaft mit massiven Investitionen abgefedert hat. Das habe global zu mehr Ungleichheit geführt.
Bei den Vereinten Nationen in New York, wo er einmal pro Jahr den Umsetzungsstand der Nachhaltigkeitsziele diskutiert, hat Niebert von Vertreter:innen afrikanischer Staaten den Vorwurf gehört: «Von China erhalten wir Geld und Infrastruktur, von Russland Waffen, und ihr Europäer kommt uns mit Menschenrechten.» Es sei Zeit, dass Europa seine Entwicklungspolitik neu ausrichte und wieder zu einem verlässlichen Kooperationspartner für den globalen Süden werde, sagt der Nachhaltigkeitsexperte, auch in Sachen Klimaschutz.
So oder so: Das 2015 im Pariser Klimaabkommen festgelegte Ziel einer Erderwärmung von höchstens 1,5 Grad wird auf allen diesen Wegen nicht mehr erreicht werden können. «Diese Marke haben wir bereits 2022 global gerissen», sagt der UZH-Professor, «wir sollten alles dafür tun, damit wir möglichst unter 2 Grad bleiben, uns aber auf 2 Grad einstellen.» Das halte er für verantwortungsvolle Politik. Zu erreichen ist dieses Ziel nur, wenn moralische Hürden und ideologische Gräben überwunden werden und möglichst viele Akteure am gleichen Strick ziehen.
Prof. Kai Niebert, kai.niebert@ife.uzh.ch
Prof. Zacharias Sautner, zacharias.sautner@df.uzh.ch
DOSSIER — Europas Zukunft
Schweizer Forschende werden international als Partner geschätzt. Doch um wettbewerbsfähig zu bleiben, sind sie auf die Assoziierung mit der EU angewiesen, sagt UZH-Rektor Michael Schaepman.
Interview: Stefan Stöcklin
Michael Schaepman, Wissenschaft ist global und entwickelt sich dynamisch. Gegenwärtig gewinnt China an Stärke und scheint im Bereich von Schlüsseltechnologien die USA einzuholen, wenn nicht gar zu überholen. Wie ist in diesem kompetitiven Umfeld die Forschung in Europa derzeit positioniert?
Michael Schaepman: Historisch betrachtet gab es nur selten Perioden, in denen eine bestimmte Wissenschaftsordnung längerfristig Bestand hatte. Ende des 19. und An-
fang des 20. Jahrhunderts wurden die Fundamentaltheorien in der Physik vornehmlich in Europa entwickelt. Heute sind die Forschung und der Wettbewerb in der Wissenschaft dagegen viel globaler und dynamischer, was sich ebenfalls am Beispiel der Physik zeigt. In Europa sehe ich heute riesiges Potenzial. So weist etwa der kürzlich erschienene Draghi-Bericht «The future of European competitiveness» Europa in den Bereichen Windenergie, Wasserstoff, Biotreibstoffe und grüner Transport eine weltweit führende Rolle zu. Im Hinblick auf eine klimaneutrale Zukunft erscheinen mir diese Themen mindestens genauso wichtig wie beispielsweise KI, die angesichts ihres Ressourcenverbrauchs nicht gerade nachhaltig ist. Wir sollten darauf achten, dass wir uns bei der Analyse der Wissenschaftslandschaft nicht zu stark von technologischen Hypes leiten lassen. Rückt man etwas vom Technologiefokus ab, so zeigt sich, dass Schwerpunkte bei Forschungsthemen wie etwa der Erweiterung der Lebensspanne oder kognitiven Verbesserungen (Cognitive Enhancement) nicht bei einzelnen Ländern liegen. Dies zeigt etwa ein Blick auf die Anticipated Scientfic Trends 2024, die der Geneva Science and Diplomacy Anticipator
(GESDA) ausgemacht hat. Forscherende sind heute weltweit vernetzt – und stehen gleichzeitig in einem kompetitiven Verhältnis zueinander.
Wo sehen Sie die Stärken der europäischen Forschung?
Schaepman: Europa hat sehr viele Stärken – zum Beispiel in der Forschung zu normativen Fragen oder in der interdisziplinären Forschung. Wir reflektieren aufbauend auf unseren Werten stark über Themen wie soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Demokratie oder Menschenrechte. Vielfalt und Interdisziplinarität sind Teil dieser Forschungskultur. Das sind zwei Schlüsselkriterien, die die Resilienz der Universitäten von morgen mitbestimmen werden. Es gibt aber auch Technologien, in denen Europa die Nase vorn hat: die Daten zu Klimaveränderungen bei-
aber beim Lesen in der Kristallkugel sind uns ja bekanntlich Grenzen gesetzt.
Man sollte meines Erachtens jedenfalls keine überhöhten Erwartungen in die angewandte Forschung setzen, sie allein wird die grossen Probleme der Welt nicht lösen können. Gegenüber solchen Verheissungen sollte man vorsichtig sein.
Wollen Sie damit sagen, dass die Grundlagenforschung gestärkt werden müsste, um Innovationen und Technologien zu fördern?
Schaepman: Ja, es ist zurzeit zwar unpopulär, mehr Geld für wertfreie Grundlagenforschung zu sprechen, und entsprechend ist sie unter Druck. Aber ich bin überzeugt, dass sich diese Investitionen rechnen. Je weniger inhaltliche
«Bei der Analyse der Wissenschaftslandschaft sollten wir uns nicht zu stark von technologischen Hypes leiten lassen.»
Michael Schaepman, Rektor UZH
spielsweise, die in Medienberichten zu den katastrophalen Bränden in Los Angeles verwendet wurden, stammen alle vom Erdbeobachtungsprogramm «Copernicus», das dank der Europäischen Weltraumorganisation ESA und der EU heute weltweit führend ist. In den 1990er und 2000er-Jahren war in diesem Bereich noch die NASA an der Spitze.
Ein interessantes Beispiel – denn oft wird gesagt, dass Europa Mühe habe, Erkenntnisse aus der Forschung technologisch und wirtschaftlich zu nutzen. Sollte hier die Forschungsförderung ansetzen und vermehrt thematische Schwerpunkte setzen, statt in freie Grundlagenforschung zu investieren?
und strukturelle Vorgaben an forschungsstarke Universitäten gemacht werden, desto beständiger und qualitativ besser ist auf Dauer ihr Forschungsoutput.
Gemeinsam erfolgreich Grundlagenforschung stärken
Für bahnbrechende Innovationen braucht es die Grundlagenforschung. Die dort gewonnenen Erkenntnisse müssen in Wirtschaft und Gesellschaft transferiert werden, dann lohnen sich die Investitionen in Wissenschaft und Forschung.
Schaepman: Wenn wir von Wertschöpfungsketten in der Forschung sprechen, steht am Anfang immer die Investition in die wertfreie Grundlagenforschung und nicht vorrangig in die angewandte Forschung oder in einen Hype. Für bahnbrechende Innovation ist die wertfreie Grundlagenforschung absolut zentral. Ein Wettbewerbsvorteil entsteht, wenn das in der interdisziplinären Grundlagenforschung gewonnene Wissen in Wirtschaft und Gesellschaft transferiert werden kann.
Es ist im Voraus oft nur schwer abschätzbar, ob und wann sich ein Forschungsthema und neue Erkenntnisse zu einer Schlüsseltechnologie oder -anwendung entwickeln. Wir alle würden dies gerne genauer vorhersagen können,
Wie steht es um die Förderung von Firmen, gerade in einem kleinen Land wie der Schweiz?
Schaepman: Es braucht strukturelle Unterstützung, damit auch in der Schweiz vermehrt globale Player entstehen können. Die Schweiz ist für viele Produkte ein kleiner Markt. Neun Millionen potenzielle Kund:innen sind eben doch sehr wenig im globalen Vergleich. Wir sollten die Standortvorteile der Schweiz nutzen und dafür sorgen, dass auch hierzulande grössere Investitionen um die 100 Millionen Franken in Startups getätigt werden, die sich global positionieren. Nur so können weitere internationale Firmen entstehen, die auch in der Schweiz bleiben. Initiativen wie Deep Tech Nation Switzerland richten sich genau an diese Wettbewerbsfähigkeit.
Welche weiteren Impulse sind zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit nötig?
Schaepman: Ein Impuls könnte sein, Interdisziplinarität stärker zu fördern. Mittlerweile gibt es Finanzierungsquellen für die Grundlagenforschung, die verlangen, dass Top-Forschende zusammenarbeiten – selbst wenn sie zuvor noch nie miteinander publiziert haben – beispielsweise das
und Una Europa
Die UZH pflegt mehrere enge Verbindungen mit europäischen Hochschulverbänden. Sie ist seit 2006 Mitglied der Liga europäischer Forschungsuniversitäten LERU (League of European Research Universities), und 2022 trat die UZH der Hochschulallianz Una Europa bei. Während sich die LERU, zu deren Vorstand UZH-Rektor Michael Schaepman gehört, auf forschungspolitische Themen fokussiert, setzt die Allianz Una Europa neben der Stärkung der Forschungszusammenarbeit auf die gemeinsame Entwicklung innovativer Bildungsformate und länderübergreifender Studienprogramme. «Unsere Mitarbeit in der LERU und bei Una Europa stärkt die Sichtbarkeit der UZH im europäischen Hochschulund Forschungsraum und fördert unsere Internationalisierung», sagt Elisabeth Stark, UZH-Prorektorin Forschung und Mitglied im Board of Directors von Una Europa. «Damit tragen sie entscheidend zum Erfolg unserer Universität bei.»
Una Europa und LERU setzen unterschiedliche Akzente. Das längerfristige Ziel der elf Partneruniversitäten von Una Europa ist eine europäische Universität der Zukunft mit gemeinsamer Lehre und Forschung und einer vertieften Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Una Europa verkörpert damit das Ideal einer gemeinsam betriebenen europäischen Hochschule. Sie umfasst die Entwicklung transnationaler Studiengänge, die Förderung der Mobilität der Studierenden und Mitarbeitenden sowie die Forschung in gesellschafts- und zukunftsrelevanten Themen. Konkrete Beispiele sind die JointBachelor-Programme in European Studies und Sustainability oder das Doktoratsprogramm UnaHerDoc im Bereich Cultural Heritage.
Die LERU funktioniert seit knapp zwei Jahrzehnten als gut etablierte Plattform für den Dialog zwischen Forschung, Politik und Gesellschaft. Ihre Positionspapiere zu aktuellen forschungspolitischen Themen gestalten die Rahmenbedingungen der Forschung in Europa mit und fördern den Austausch zwischen den 24 Partneruniversitäten beispielsweise auf dem Gebiet der KI. «Beide Organisationen helfen uns, die UZH im europäischen Forschungsraum noch fester zu verankern», sagt Elisabeth Stark. Die UZH kann so Einfluss nehmen und die europäische Bildungs- und Forschungslandschaft mitgestalten. Das ist nicht nur mit Blick auf die angestrebte vollständige Teilnahme an den europäischen Forschungsprogrammen wichtig, die für die Schweiz nach wie vor nicht gesichert ist. Vom Engagement der UZH und ihrer Exzellenz profitiert auf der anderen Seite auch der europäische Forschungs- und Bildungsraum, der sich im globalisierten Wettbewerb behaupten muss. (sts)
League of European Research Universities (LERU): www.leru.org Una Europa: www.una-europa.eu
Human Frontier Science Program. Das sind spannende Impulse.
Als kleines Land im Zentrum Europas sind wir auf Zusammenarbeit in der Forschung angewiesen. Wie wichtig ist für die Schweiz und die UZH die erneuerte volle Assoziierung an die Forschungsprogramme der EU?
Schaepman: Die volle Assoziierung ist unabdingbar und ich bin froh, dass wir seit Anfang Jahr an den meisten EU-Programmen wieder teilnehmen können. Das hat mit der simplen Tatsache zu tun, dass Forschung zwar global ausgerichtet ist, die Zusammenarbeit aber oft lokal stattfindet. Kulturell und inhaltlich sind uns die Forschungsprogramme der EU sehr nah. Natürlich arbeiten viele Länder auch gerne mit der Schweiz ausserhalb der EU-Programme zusammen. Dies aber nur, wenn es einen eindeutigen Vorteil für das Partnerland gibt. Strukturell ist es daher sinnvoll, die Programme der EU zu nutzen und somit die Innovationskraft der Schweiz hoch zu halten: Wir müssen als Forschungspartner attraktiv bleiben, denn verlören wir die Assoziierung mit der EU vollständig, würde unsere Forschung in der Bedeutungslosigkeit versinken. Der interne Forschungswettbewerb in der Schweiz ist zu klein, um global mithalten zu können.
Wie können wir, die Schweiz und die UZH, zur Stärkung des europäischen Forschungsraums beitragen? In welchen Bereichen haben wir Trümpfe?
Schaepman: Die sehr hohe Qualität unserer Forschung ist unser grösster Trumpf. Hinzu kommen noch andere Tugenden wie Zuverlässigkeit und Gradlinigkeit, die unsere Kolleg:innen in der Forschung weltweit schätzen. Wie schon erwähnt, listen der Draghi-Bericht und der GESDA Science Breakthrough Radar viele Themen auf, die an der UZH bereits mit Hochdruck verfolgt werden und in Zukunft einen ähnlichen Impact erreichen können wie heute KI oder andere aktuelle Themen.
Das heisst, Kooperation ist zentral?
Schaepman: Forschende der UZH arbeiten eigenständig und über ihre Netzwerke mit interessanten Partneri:nnen weltweit zusammen. Als europäisches Land hat die Schweiz ein grundsätzliches Interesse am freien Wissensund Ideenaustausch. Wir können viel zu einer offenen, interdisziplinären und globalen Forschungsgemeinschaft beitragen.
Michael Schaepman ist seit 2020 Rektor der UZH und Professor für Remote Sensing. michael.schaepman@uzh.ch
DOSSIER — Europas Zukunft
Während die EU auf Distanz zu China geht, nähert sich die Schweiz dem Land an, sagt Sinologin Simona Grano. Künftig werden Sicherheitsbedenken die Beziehungen Europas zum Reich der Mitte prägen.
Interview: Roger Nickl
Simona Grano, was verbinden Menschen in China heute mit Europa?
Simona Grano: Bis vor der Corona-Pandemie hatte man in China durchaus ein positives Bild von Europa. Für viele Chinesinnen und Chinesen ist es der Ursprungsort von Markenartikeln, an denen sie interessiert sind. Auf politischer und vor allem auf ökonomischer Ebene stand Europa für einen Kontinent, mit dem man gute Beziehungen hatte und ohne grosse Einschränkungen Geschäfte machen und Handelsbeziehungen aufbauen konnte. Das hat sich aber seit der Corona-Pandemie geändert. Während der Amtszeit von Joe Biden ist die transatlantische Allianz zwischen den USA, mit denen China einen erbitterten Handelskrieg geführt hat, und Europa stärker geworden. China sieht Europa deshalb heute ökonomisch und politisch als grösseres Problem als noch vor ein einigen Jahren. Länder wie zum Beispiel die Niederlande, die viel näher an die Vereinigten Staaten gerückt sind, haben auf ideologischer Ebene eine Wahl getroffen zwischen China und den Vereinigten Staaten.
Wie hat China auf diese verstärkte transatlantische Allianz reagiert?
Gemeinsam erfolgreich
Und sie will vermeiden, dass China den europäischen Markt mit Billigprodukten und Elektroautos überflutet. Letztlich werden Sicherheitsaspekte künftig wichtiger sein als die Handelsaspekte. So gesehen ist die goldene Phase der Beziehungen zwischen China und Europa jetzt vorbei. Man assoziiert China nicht mehr nur mit einem Land, mit dem man gute Handelsbeziehungen hat, sondern es wird auch als Gefahr gesehen – unter anderem aufgrund seiner Allianz mit Russland, der Taiwan-Frage, aber auch im Zusammenhang mit wissenschaftlicher Spionage.
Das heisst, die Beziehungen zwischen Europa und China sind wieder stärker ideologisch geprägt?
Grano: Ja, unterschiedliche Werte rücken wieder vermehrt in den Fokus. Man sieht, dass man China in bestimmten Bereichen nicht trauen kann und das Land Strategien verfolgt, die nicht mit Europa vereinbar sind. Diese Differenzen führen dazu, dass die EU und China auf politischer Ebene auf Distanz bleiben werden. Das schliesst jedoch nicht aus, dass in gewissen Bereichen bessere Handelsbedingungen etabliert werden können.
Das Verhältnis zwischen Europa und China hat sich eingetrübt. Europa begegnet China heute in vielen Bereichen mit Misstrauen. Trotzdem sind beide Seiten an einer Zusammenarbeit interessiert, etwa bei Klimafragen.
Unter US-Präsident Donald Trump wird die Allianz zwischen Europa und den USA möglicherweise geschwächt. Möglich ist auch ein erneuter Handelskrieg mit China. Was würde das für das europäische Verhältnis zu China bedeuten?
Grano: China hat versucht, sich Europa wieder anzunähern und die Beziehungen zur EU zu verbessern. In gewissen Bereichen ist das aber schwierig. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen koppelt in ihrer China-Strategie ökonomische Fragen mit Sicherheitsfragen.
Grano: Wie sich die Trump-Administration gegenüber Europa und China tatsächlich verhalten wird, wird sich erst noch zeigen. Sollte Trump jedoch seinen Handelskrieg mit Europa und China verschärfen, könnte dies zu Problemen für den Kontinent führen. Eine drastische Erhöhung der US-Zölle auf chinesische Produkte würde einen doppelten Schlag für Europa bedeuten. Denn ein Teil der chinesischen Exporte in die USA würde nach Europa umgeleitet, wo diese wahrscheinlich das Handelsdefizit der EU
mit China weiter erhöhen würden. Ein weiterer Teil würde auf andere Märkte gehen, wo die chinesischen mit europäischen Exporten konkurrieren würden.
In Ihrem Buch «China-US Strategic Competition: Impact on Small and Middle Powers in Europe and Asia», das vor zwei Jahren erschienen ist, monieren Sie, dass in Europa eine einheitliche China-Strategie fehlt. Hat sich das mittlerweile geändert?
Grano: Ja, ich denke, die EU tritt geeinter auf als noch vor zwei Jahren, zumindest auf der Handelsebene. Ein Indiz dafür sind die Strafzölle auf E-Autos, die letztes Jahr beschlossen wurden, um die heimische Industrie zu schützen. Auf der politischen Ebene ist es naturgemäss komplizierter – in der Aussenpolitik entscheiden die Staaten für sich. Und es gibt natürlich China-freundliche Stimmen beispielsweise der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban. Aber die Europäische Kommission hat durchaus eine geeinte
ersten westlichen Länder, mit denen man gute diplomatische Beziehungen pflegte und weitgehend Handel ohne ideologische Nebengeräusche treiben konnte. Das ist für China gerade jetzt, in der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Situation, wichtig. Man hofft, damit zu zeigen, dass man mit einem handels- und finanzorientierten Land gute Beziehungen pflegen und sogar ein bestehendes Freihandelsabkommen weiterentwickeln kann.
Wie werden sich die Beziehungen zwischen Europa und China weiterentwickeln und was sind dabei die Herausforderungen?
Grano: Ein Problem ist sicher die wirtschaftliche Überkapazität Chinas. Das Land produziert zu viel und muss entsprechend in grossem Stil günstige Produkte exportieren. Die Folge wird sein, dass Europa weitere Zölle erheben muss, was zu Spannungen führen wird. Eine weitere Herausforderung ist die Menschenrechtslage im Land,
«Die Schweiz geht auf Kuschelkurs mit China – aus ganz pragmatischen ökonomischen Gründen.»
Simona Grano, Sinologin
Position, die China zum Teil als geopolitische Bedrohung wahrnimmt. So hat sie sich etwa klar für Taiwan ausgesprochen und gesagt, nur eine von der taiwanesischen Bevölkerung gewählte Regierung könne die Insel regieren. Eine solch klare Haltung in der Taiwan-Frage wäre vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen. Sie hat China massiv irritiert.
Wo steht die Schweiz?
Grano: Das ist interessant. Die Schweiz hat sich in die Gegenrichtung entwickelt. Vor fünf Jahren hat Aussenminister Ignazio Cassis China wegen der prekären Menschenrechtssituation in Xinjiang, aber auch in Hongkong öffentlich kritisiert. Das hat zu einer Abkühlung der Beziehungen geführt. Mittlerweile hat sich das geändert. Mein Eindruck ist, dass die Schweiz seit eineinhalb Jahren, etwas zugespitzt formuliert, auf Kuschelkurs mit China geht – aus ganz pragmatischen ökonomischen Gründen. Man möchte als exportorientiertes Land mit möglichst vielen Partnern gute Handelsbeziehungen pflegen und im Grunde genommen keine Wahl treffen. Man möchte auch nicht überkritisch gegenüber China sein, weil man sich als neutrales, unparteiisches Land versteht. Allerdings ist das keine wirklich neutrale Haltung, sondern es ist eine prochinesische Neutralität.
Wie wichtig sind für China die Beziehungen zur Schweiz?
Grano: Ich denke, die Schweiz war für China immer wieder ein glücklicher Zufall. Die Schweiz war eines der
beispielsweise in Bezug auf die Uiguren und die Tibeter, sowie die angespannte Situation mit Taiwan und Hongkong. Ein dritter Punkt betrifft die Wissenschaft und in diesem Zusammenhang Sicherheitsfragen. Die wissenschaftliche Kooperation mit China ist wichtig, aber sie ist heikel in Forschungsbereichen, in denen Technologien entwickelt werden, die auch militärisch genutzt werden können.
Was sind die Folgen?
Grano: In der EU, aber auch in der Schweiz entstehen nun Guidelines, die die Forschungszusammenarbeit immer strikter regeln wollen. Es gibt aber auch Stimmen in Europa, die sagen, man verunmögliche so wichtige Kooperationen und verpasse eine grosse Chance. Das Problem ist nicht einfach zu lösen. Man muss vielleicht etwas weniger blauäugig und in jenen Forschungsbereichen kritischer sein, wo Fortschritte in militärisch nutzbaren Technologien zu erwarten sind. In vielen anderen Bereichen ist die wissenschaftliche Zusammenarbeit aber unproblematisch und wünschenswert.
In welchen Bereichen hat die Kooperation zwischen Europa und China künftig das grösste Potenzial?
Grano: Ein grosses Potenzial hat, neben dem wissenschaftlichen Austausch in unkritischen Bereichen, der gemeinsame Kampf gegen den Klimawandel. China ist führend in der Entwicklung von grüner Technologie, etwa Solarpanels. In diesem Bereich ist eine gute Zusammenarbeit zwischen China, Europa und den Vereinigten Staa-
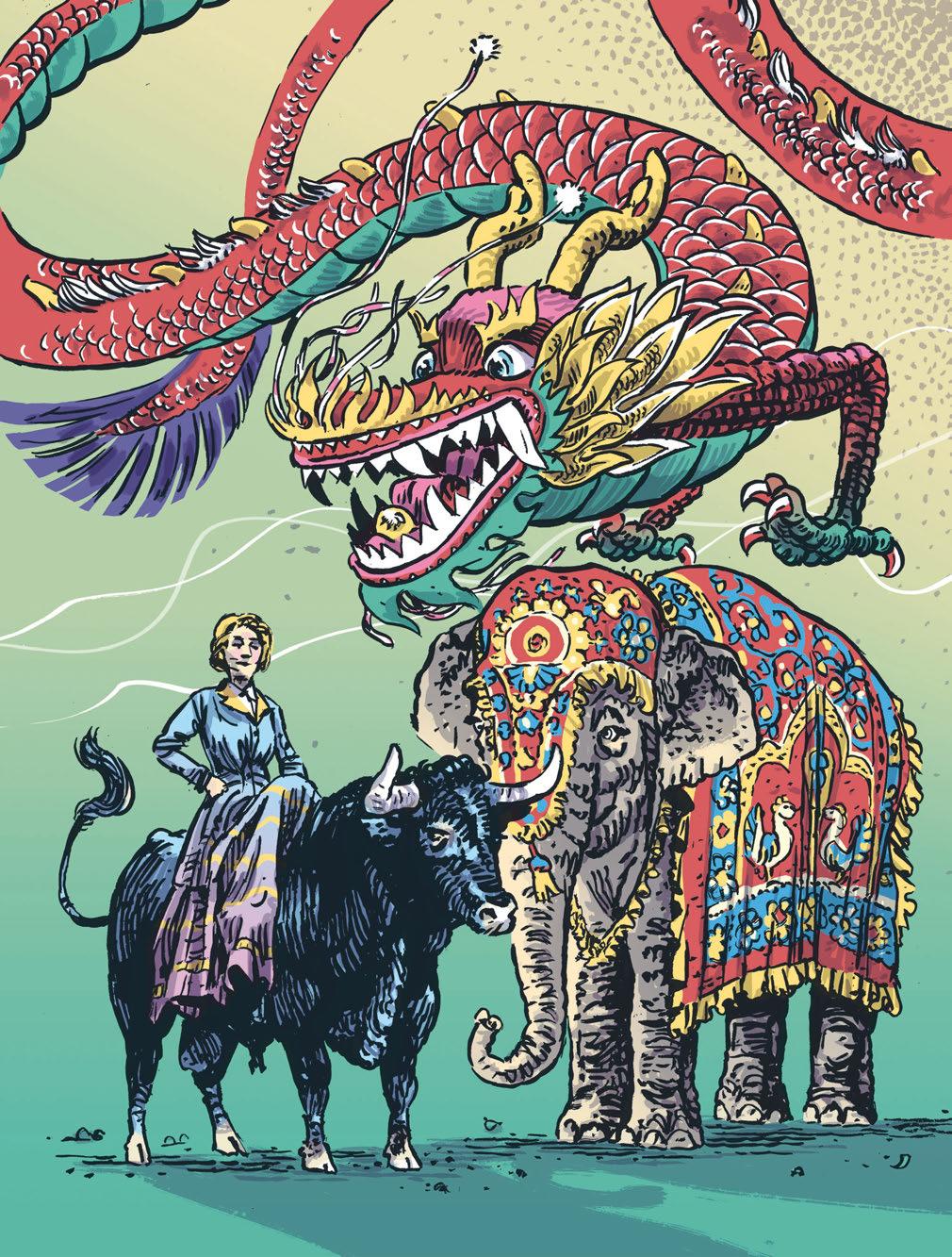
ten deshalb sehr wichtig. Nur so sind die aktuellen globalen Herausforderungen lösbar. Auch auf diplomatischer Ebene ist es wichtig, dass die Länder im Gespräch bleiben, denn nur so lassen sich Spannungen unter Kontrolle hatten.
Und die Schweiz?
Grano: Der Bundesrat wird auf seinem «Durchschlängel-Kurs» bleiben und die guten Beziehungen zu China weiter pflegen. Es sei denn, es gäbe China-kritische Vor-
stösse im Parlament oder aus der Zivilgesellschaft, etwa ein Referendum gegen das Freihandelsabkommen. Das könnte die guten Beziehungen etwas ramponieren.
Simona A. Grano ist Sinologin und Privatdozentin am Asien-Orient-Institut, Leiterin des Taiwan Studies Project und seit Februar 2025 Leiterin eines neuen Forschungsbereichs mit Schwerpunkt auf den Beziehungen zwischen China und Taiwan an der UZH. simona.grano@aoi.uzh.ch
DOSSIER — Europas Zukunft
Europa ist für Indien ein wichtiger Handelspartner. Aber man glaubt dort nicht, dass die Zukunft im alten Kontinent liegt, sagt der Indologe Nicolas Martin. Besonders empfindlich reagiert das Land auf Kritik aus dem Westen.
Interview: Roger Nickl
Nicolas Martin, wofür steht Europa heute in Indien?
Nicolas Martin: Europa steht für gut entwickelte Volkswirtschaften. Es wird als wichtiger Handelspartner mit grosser Kaufkraft gesehen. Hier möchte man seine Produkte verkaufen, und man ist an europäischen Investitionen in Indien interessiert. Mein Eindruck ist aber auch, dass man in Indien nicht daran glaubt, dass die Zukunft in Europa liegt. Das gilt übrigens auch für andere asiatische Länder. Die Menschen dort haben den grossen Wunsch, dass die Dinge besser werden. In Europa entwickeln sie sich aus indischer Perspektive eher zum Schlechteren. Eine grosse Anziehungskraft haben dagegen die USA. Viele gut ausgebildete IT-Leute wandern dorthin aus. Indien hat mit 35 Millionen Menschen übrigens die grösste Diaspora weltweit.
Gemeinsam erfolgreich
Aus indischer Perspektive liegt die Zukunft nicht in Europa, sagen Sie. Weshalb entsteht dieser Eindruck?
Martin: Zentral dafür ist, wie Grossbritannien wahrgenommen wird. Man sieht, dass der ehemalige Kolonialherr heute in grossen Schwierigkeiten steckt. Natürlich werden die Probleme in Grossbritannien nicht einfach mit Europa gleichgesetzt. Aber aus indischer Perspektiven ist Europa schon der alte Kontinent.
Welche Rolle spielt die koloniale Vergangenheit in den Beziehungen zwischen Indien und Europa?
Indien wird bald die drittgrösste Volkswirtschaft der Welt sein. Es braucht Partner, deshalb ist es an guten Handelsbeziehungen zu Europa interessiert. Gleichzeitig will es nicht Partei ergreifen, etwa gegen Russland.
Martin: Ich denke, sie wird als Werkzeug genutzt, um jegliche europäische Kritik etwa zu Indiens Umgang mit Muslimen und anderen Minoritäten oder zur Kooperation Indiens mit Russland abzuwehren. Indien reagiert sehr empfindlich, wenn es sich von Europa belehrt fühlt. Man stellt sich auf den Standpunkt, dass der europäische Kolonialismus in der Vergangenheit weltweit Kriege angezettelt, Länder erobert und Menschen ausgebeutet und versklavt hat. Deshalb fehlt aus indischer Sicht Europa heute jegliche Legitimation, moralisch über andere zu urteilen.
Eine neuere Studie des European Council on Foreign Relations zeigt, dass Indien – ganz im Gegensatz zu Europa – Russland als Verbündeten betrachtet und der
Präsidentschaft von Donald Trump optimistisch gegenübersteht. Wie ist das zu interpretieren?
Martin: Indien verfolgt schon lange eine blockfreie Politik und wird sich auch in Zukunft weder mit Europa noch mit den USA vermählen. Schon als das Land 1947 von den Briten unabhängig wurde, sagte der damalige Ministerpräsident Nehru, wir sind nicht mit der Sowjetunion und wir sind nicht mit dem kapitalistischen Amerika. Wir sind auf einem dritten Weg. Das sieht man heute auch in Bezug auf Russland. Indien kauft dort Rohöl, raffiniert es und verkauft es an uns weiter. Auch in diesem Zusammenhang reagiert Indien empfindlich, wenn dieses Verhalten aus Europa kritisiert wird. Es heisst dann: «Lasst die Belehrungen doch einfach sein, ihr kauft unser raffiniertes Öl ja sowieso.»
Wie kommt das in Europa an?
Martin: Für Europa ist das natürlich eine knifflige Angelegenheit. Denn es gibt von europäischer Seite den starken Wunsch, einen Freund in Asien zu haben, und es besteht die Hoffnung, dass Indien dieser Freund sein könnte. Gleichzeitig ist dies auch sehr schwierig, weil es seitens Europas eben viel Kritik am hindu-nationalistischen Kurs von Präsident Narendra Modi gibt. Ich kann mir vorstellen, dass Politikerinnen und Politiker in Europa aus strategischen Gründen zunehmend auf Kritik verzichten werden.
Wie sehen Sie das künftige Verhältnis Indiens zu Europa?
Martin: Ich denke, Indien ist auch künftig stark auf Europa und die USA angewiesen. Ein Grund dafür ist, dass das Land von feindlichen Nachbarn umgeben ist.
nieur:innen und IT-Fachleute. Da wird der Austausch definitiv zunehmen. Seitens Indiens gibt es die Hoffnung, dass das Land künftig auch vom Outsourcing europäischer Firmen profitieren kann, wie dies in den 1990er-Jahren in China geschehen ist. Indien wird wirtschaftlich immer wichtiger werden und das Potenzial für eine erfolgreiche Kooperation ist grundsätzlich gross. Man muss aber auch wissen, dass Indien seine Wirtschaft nie vollständig öffnen wird. Zum Beispiel können europäische oder amerikanische Unternehmen, die in Indien investieren, niemals eine Aktienmehrheit haben. Da wird es also immer gewisse Grenzen geben. Ein anderes potenzielles Hindernis für die Zusammenarbeit ist wie schon erwähnt eine zu grosse Kritik an der indischen Innen- und Aussenpolitik.
Wo sehen Sie die Chancen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Europa und Indien?
Martin: Die wissenschaftliche Kooperation mit Indien ist wichtig und wird weiter zunehmen, vor allem in den Natur- und Technikwissenschaften und der Medizin. Es gibt das Indian Institute of Technology, das die angesehenen Ingenieur:innen hervorbringt, die dann zur NASA oder zu Google & Co. gehen. Früher wurde das Abwandern dieser hochqualifizierten Arbeitskräfte in Indien negativ als Brain Drain, als Verlust, wahrgenommen. Diese Einstellung hat sich mittlerweile geändert: Heute versteht sich Indien als Brain Bank. Man ist zum Schluss gekommen, dass das Land vom internationalen Netzwerk, das durch die ausgewanderten Fachkräfte entsteht, letztlich profitieren wird, weil so auch wieder Aufträge zurückkommen.
«Aus indischer Sicht fehlt Europa jegliche Legitimation, moralisch über andere zu urteilen.»
Nicolas Martin, Indologe
Zum einen ist dies der historische Feind Pakistan, zu dem Indien eine der am stärksten militarisierten Grenzen weltweit unterhält. Pakistan blockiert damit aber auch Handelsrouten, etwa in den Iran. Das Verhältnis zu Bangladesch hat sich in letzter Zeit deutlich verschlechtert. China ist nach wie vor ein wichtiger Handelspartner für Indien, aber auch hier sind die Beziehungen alles andere als entspannt. Man muss schon sehen: Indien hat grosse Ambitionen. Es hat 2022 ökonomisch gesehen Grossbritannien überholt und wird bald eine der drei grössten Volkswirtschaften der Welt sein. Dafür braucht es aber auch gute Handelspartner. Aus diesem Grund werden Europa und die USA wichtig bleiben.
Wo sehen Sie die Potenziale der europäischen Beziehungen zu Indien und umgekehrt?
Martin: Ich denke, die Beziehungen werden sich auf jeden Fall vertiefen, unabhängig davon, was passiert. Europa braucht zum Beispiel gut ausgebildete indische Inge-
Wie sieht es punkto Kooperationen in den Geistes- und Sozialwissenschaften aus?
Martin: Dort ist es ein bisschen komplizierter, weil die Dinge schnell politisch werden. Die Regierung übt Druck auf Forschungsarbeiten aus, die dem hinduistischen Nationalismus und der Machtausübung der BJP kritisch gegenüberstehen. Dies betrifft aber alle Forschenden. Es gibt Anzeichen dafür, dass indische Wissenschaftler:innen um ihre Karriereaussichten fürchten und ausländische Wissenschaftler:innen befürchten, dass ihnen die Einreise in das Land verweigert werden könnte, um dort zu forschen.
Nicolas Martin ist Professor für Moderne Indologie und Südasienwissenschaft. Er setzt sich unter anderem kritisch mit der Frage auseinander, was Demokratie in der Praxis in der grössten Demokratie der Welt – Indien –bedeutet.
nicolas.martin@aoi.uzh.ch

Grosse Datenmengen zu verarbeiten, zu speichern und zugänglich zu machen, wird für viele Forschende immer wichtiger. Das Netzwerk der Data Stewards an der UZH hilft ihnen, sich im Datendschungel zurechtzufinden.

Engagieren sich an der UZH dafür, dass Forschungsdaten breit nutzbar sind:
Text: Theo von Däniken
Bilder: Diana Ulrich
Mega-, Giga- oder Terabytes haben sich im allgemeinen Sprachgebrauch eingebürgert und viele können sich darunter etwas vorstellen. Um die riesigen digitalen Datenmengen, die laufend entstehen und ausgetauscht werden, zu beschreiben, reichen diese Präfixe jedoch längst nicht mehr. Das Wachstum der Datenproduktion ist so rasant, dass vor zwei Jahren neue Vorsilben definiert werden mussten. Zetta als bisher grösstes Präfix bezeichnet eine Zahl mit 24 Nullen, die neu geschaffenen Ronna und Quetta Zahlen mit 27 beziehungsweise 30 Nullen. Gemäss der Website Statista dürfte die Menge an Daten, die global erzeugt, kopiert und genutzt werden, bereits in drei Jahren knapp 400 Zettabytes betragen, das sind 400 000 000 000 000 000 000 000 000 Bytes.
Diese Zahlen veranschaulichen, in welchem Mass Daten alle unsere Lebensbereiche immer stärker durchdringen. Die Forschung trägt selbst zur Datenschwemme bei: Allein der Large Hadron Collider am CERN produzierte 2018 40 Zettabytes an Rohdaten, von denen aber nur ein Bruchteil gespeichert und weiter ausgewertet wurde. Für die Wissenschaft sind aber nicht nur Daten, die primär zu Forschungszwecken gesammelt wurden, interessant. Denn auch die Möglichkeiten, Daten auszuwerten, nehmen rasant zu.
Daten nutzbar machen
«Daten», so bringt es die Open-Science-Verantwortliche der Universitätsbibliothek Zürich, Andrea Malits, auf den Punkt, «sind heute ein wertvoller Rohstoff.» Sie können auf unterschiedlichste Weise erhoben, analysiert oder miteinander kombiniert werden und sie sind die Grundlage für selbstlernende Systeme wie KI. Darum sind sie nicht mehr nur für diejenigen Forschenden interessant, die sie sammeln und auswerten, sondern sie können auch für andere Forschungs-

sible), bearbeitbar (Interoperable) und wiederverwendbar (Reusable) sein.
Jedes der vier Prinzipen stellt die Forschenden in der Praxis vor Herausforderungen. Die UZH hat deshalb im vergangenen Jahr ein Netzwerk von sogenannten Data Stewards ins Leben gerufen. Es verbindet Wissenschaftler:innen, die sich in ihrer Arbeit mit Fragen beschäftigen, wie Daten im Sinne der FAIR-Prinzipen aufbereitet und verfügbar gemacht werden können. Mit ihrem Wissen sollen sie anderen Forschenden helfen, sich besser im neuen Datendschungel zurechtzufinden. Oft ist bereits die Auffindbarkeit eine grosse Hürde: «Die Forschungsdaten, die wir an der UZH haben, sind von hohem Wert», erklärt Malits, «aber wir können sie nicht vollständig nutzen, weil wir nicht überblicken, wo welche Daten vorhanden sind.» Gerade für interdisziplinäre Forschungsprojekte wäre es jedoch wichtig, Daten aus verschiedenen Bereichen leicht auffindbar zu machen.
Anders als bei wissenschaftlichen Publikationen, wo die UZH mit ZORA (Zurich Open Repository and Archive) ein offenes Verzeichnis mit Angaben zu allen Publikationen von UZH-Forschenden hat, gibt es keine zentrale Ablage für Forschungsdaten. Dabei gehe es nicht darum, einen einheitlichen Speicherort für die Daten selber zu schaffen, betont Malits. Hingegen wäre ein gesamtuniversitäres Verzeichnis sinnvoll, das festhält, welche Daten wo in welcher Aufbereitung vorhanden sind. «Man sollte gute Anreize für die Forschenden schaffen, ihre Datenbestände in einem solchen Verzeichnis zu erfassen», so Malits. Denn es wäre ein zusätzlicher Aufwand, den die Forschenden leisten müssten und der ihnen oft keinen direkten Nutzen bringt. Ein Datenverzeichnis könnte auch dazu beitragen, die Forschungsleistung der UZH nach aussen zu kommunizieren.
Offenheit als Prinzip
Für die Epidemiologin Andrea Farnham vom Population Research Center der UZH sind offene Daten und die FAIR-Prinzipien eine Herzensangelegenheit. Deshalb setzt sie einen Teil
«Daten sind heute ein wertvoller Rohstoff.»
Andrea Malits, Open-Science-Verantwortliche der Universitätsbibliothek Zürich
fragen wertvoll sein. Sammeln Linguist:innen etwa Daten für Studien zur Dialektentwicklung, so könnten diese auch für Humangeograf:innen interessant sein, die Migrationsbewegungen erforschen.
Damit Daten für andere Forschende nützlich sind, müssen sie jedoch verfügbar sein und aufbereitet werden. Das Zauberwort dazu heisst: FAIR. Das Akronym steht für vier Anforderungen, die Daten erfüllen sollten, damit sie als offene Daten der Wissenschaft verwendet werden können. Das heisst, sie müssen auffindbar (Findable), zugänglich (Acces-
ihrer Zeit dafür ein, ihre Daten für andere Forschende aufzubereiten: «Es ist wichtig, dass unsere Daten zugänglich sind, denn sie wurden schliesslich mit öffentlichen Mitteln erhoben», sagt sie. In der Praxis jedoch ist die Einlösung der Prinzipien gerade in ihrem Fall mit hohen Hürden verbunden. Farnham ist wissenschaftliche Leiterin des Projekts SwissPrEPared, das zum Ziel hat, Ansteckungen mit dem HI-Virus und andere sexuell übertragbare Krankheiten einzudämmen. An dem Programm nehmen insgesamt 10000 Personen teil, die das Medikament PrEP erhalten, das einer
HIV-Ansteckung vorbeugt. Die Teilnehmenden werden in einer begleitenden Langzeitstudie regelmässig zu ihrem Gesundheitszustand, ihrem Sexualverhalten und ihrem Drogengebrauch befragt. Ziel der Studie ist es, die Bedürfnisse und das Verhalten der Risikogruppen besser zu verstehen und Präventionsmassnahmen und die Gesundheitsversorgung entsprechend zu gestalten.
Die Daten, die im Rahmen der Studie erhoben werden, sind höchst sensibel und müssen entsprechend geschützt werden. «Weil sie sehr detailliert sind, ist es sehr schwierig, sie vollständig zu anonymisieren», erklärt Farnham. Hinzu kommen Datenschutzbestimmungen und die Vorgabe, dass Studienteilnehmende jeder Datennutzung, die über die Studie hinausgeht, zustimmen müssen.
Privatsphäre schützen
Das heisst, die Möglichkeiten, die Daten zu teilen und anderen zur Verfügung zu stellen, sind sehr eingeschränkt. «In der Theorie sind die FAIR-Prinzipien ideal», so Farnham, «in der Praxis lassen sie sich aber nicht immer umsetzen. Denn die Verpflichtung gegenüber den Teilnehmenden, ihre Privat-

gitLab teilen kann. Das hat das gemeinsame Programmieren und die Qualität des Codes deutlich verbessert. «Zudem sind wir dadurch viel effizienter bei der Fehlersuche geworden», sagt sie. Das Wissen, das sie sich in ihrem eigenen Projekt angeeignet hat, gibt sie als Data Steward nun auch an andere weiter. «Viele wissen nicht, wo sie Hilfe und Unterstützung holen können bei diesen Fragen», sagt sie.
Die Vernetzung und das gegenseitige Lernen ist eines der Ziele, die die UZH mit den Data Stewards verfolgt. Dabei geht es auch darum, die Forschungs-Communities selbst zu aktivieren und die Forschenden für das Thema zu sensibilisieren. Denn viele Fragestellungen und die entsprechenden Lösungen sind spezifisch für die einzelnen Forschungsbereiche. Wie man Metadaten verfasst, grosse Datenmengen ablegt oder auf welchen Repositories man Daten publiziert – das kann je nach Disziplin sehr unterschiedlich sein. «Letztlich ist es eine Aufgabe der Forschenden, dafür Standards zu entwickeln», sagt Malits. Die Data Stewards können jedoch eine Scharnierfunktion einnehmen zwischen den spezifischen Bedürfnissen der jeweiligen Forschungsbereiche und den Ressourcen und Hilfsangeboten, die dafür an der UZH zur Verfügung stehen.
«Mit anderen über gemeinsame Strategien zu sprechen, hat mir sehr geholfen.»
Guanhao You, Linguist
sphäre zu schützen, wiegt schwerer.» Wer Zugang zu den Daten der Studie erhalten will, muss einen Antrag stellen, der von externen Expert:innen und einem wissenschaftlichen Ausschuss geprüft wird. Oft wird dann nur ein Teil der Daten herausgegeben. «Den ganzen Datensatz haben wir noch nie weitergegeben», erklärt Farnham.
Auch wenn der Zugang zu den Daten direkt nicht möglich ist, so ist es Farnham doch ein Anliegen, dass die Daten auffindbar sind. «Wir können zumindest die Metadaten publizieren, die beschreiben, welche Art von Daten wir haben», erklärt Farnham. Das aber bedeutet einen zusätzlichen Effort. Denn der Inhalt der Studie wird laufend aktuellen Entwicklungen angepasst. So wurde etwa beim Ausbruch der Affenpocken (Mpox) im vergangenen Jahr der Fragebogen entsprechend ergänzt. «Wir müssen die Metadaten mindestens einmal pro Jahr anpassen, damit sie aktuell sind.»
Auf den Gedanken, die Daten über die Publikation der Metadaten auffindbar zu machen, ist Farnham erst durch das Data-Stewards-Netzwerk gekommen. «Dort habe ich gelernt, dass es Best Practice im Sinne der FAIR-Prinzipien ist, die Metadaten zu veröffentlichen.» Sie erhielt durch die Kolleg:innen im Netzwerk auch Tipps, wie die Metadaten gestaltet sein müssen, damit die Daten tatsächlich auffindbar und interoperabel, also auch für andere Studien nutzbar sind.
Darüber hinaus lernte sie, wie sie den Programmiercode für die Auswertung ihrer Daten auf dem Code-Repository
Viel läuft dabei noch über das persönliche Engagement der Data Stewards, denen wie Farnham das Prinzip von Open Science wichtig ist. Mittlerweile umfasst das Netzwerk 30 Personen und wird von Susanna Weber von der Universitätsbibliothek koordiniert. «Auf die Dauer», so sagt Malits, «müssten die Aufgaben aber institutionalisiert und auch entsprechend finanziert werden.» Nur so könnten Daten nachhaltig gespeichert und verfügbar gemacht werden. Die Finanzierung ist aber ein Knackpunkt. Denn Forschungsprojekte haben stets eine begrenzte Dauer und damit auch eine begrenzte Finanzierung. «Für die einzelnen Forschenden gibt es wenig Anreiz, sich darüber hinaus dafür zu engagieren, dass die Daten erhalten und zugänglich bleiben», so Malits.
Aufwändige Harmonisierung
Einer, der spezifisch für das Datenmanagement zuständig ist, ist Guanghao You. Er arbeitet an der Linguistic Research Infrastructure (LiRI) der UZH für den Nationalen Forschungsschwerpunkt (NFS) Evolving Language als Datenspezialist und berät dabei die Forschenden des NFS in Fragen der Aggregierung, Auswertung und Aufbewahrung von Daten. «Meine Hauptaufgabe ist es, Daten aus unterschiedlichsten Quellen zusammenzuführen, damit wir sie im Rahmen des Projekts auswerten können», erklärt You. In seiner eigenen Forschung befasst sich You hauptsächlich mit der frühesten Sprachaneignung bei Kleinkindern. Dazu macht seine Forschungs-

«Es ist wichtig, dass unsere Daten für andere Forschende zugänglich sind.»
Andrea Farnham, Epidemiologin
gruppe Aufnahmen von alltäglichen Situationen, in denen Kleinkinder mit Eltern zusammen sind. Diese Aufnahmen werden für die Auswertung transkribiert, mit strukturierten Anmerkungen und mit Angaben zu den Sprechenden und der Aufnahmesituation zusammen abgelegt.
Daneben arbeitet You aber auch mit Datenquellen, die online frei zugänglich sind. «Häufig fehlen hier aber die Metadaten, oder sie sind unvollständig», sagt er. Das macht es schwierig, die Daten zu nutzen, wenn etwa aus Gründen der Anonymisierung Altersangaben zu den Sprechenden fehlen. Yous Gruppe befolgt zudem ein eigenes Protokoll, wie Anmerkungen, Beschreibungen und Glossare verfasst werden, und versucht dabei so nahe wie möglich an etablierten Standards aus der Linguistik zu bleiben. Manche Daten aus anderen Quellen sind jedoch gänzlich anders aufbereitet und beschrieben, sodass sie kaum direkt in die eigene Datenbasis integriert werden können. Das Beispiel zeigt: Die Anforderung, dass Daten interoperabel sind, also von verschiedenen Forschungsgruppen
genutzt werden können, ist eine hohe Hürde – selbst wenn sie auffindbar und zugänglich sind. Denn je nach Disziplin gibt es keine einheitlichen Standards, wie Daten beschrieben werden sollen, und jede Gruppe kann ihrem eigenen Protokoll folgen. «Da die Daten häufig von bereits abgeschlossenen Projekten stammen, können wir keinen Einfluss auf diese Protokolle nehmen», so You. Für sein Projekt bedeutet dies, dass er und seine Mitarbeitenden nochmals einen erheblichen Aufwand betreiben müssen, um die Daten nutzen zu können. In wenigen Fällen, wenn You die Forschenden kennt, kann er sich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Informationen aufbereiten können, damit er sie einfacher nutzen kann.
Dezentrale Datenablagen
Eine weitere Herausforderung für You ist die Speicherung der Daten, denn das Netzwerk des NFS umfasst viele unterschiedliche Forschungsbreiche. Die Art und die Menge der Daten, die anfallen, sind riesig und äusserst divers. «Wie eine Da
Empowering Board Leaders
Erfahren Sie mehr über unsere Programme
→ VR-Zertifikats-Programme | VR CAS (DE, EN)
→ VR-Diplom-Programme (DE, EN, FR)
→ VR-Masterclasses (DE, EN, FR)
→ VR-Kurse zu verschiedenen Fokusthemen (DE, EN, FR, IT)
Buchen Sie ein Beratungsgespräch
Mehr Informationen auf boardschool.org, info@boardschool.org und +41 71 224 23 72

tenablage all die unterschiedlichen Anforderungen abdecken kann, war für mich eine grosse Herausforderung», erklärt er. Die Lösung dazu fand er unter anderem im Austausch mit anderen Data Stewards. «Durch sie bin ich auf die Idee gekommen, dass es gar nicht unbedingt eine einheitliche Ablage braucht», so You. Vielmehr hat er nun einen zentralen Index eingerichtet, wo alle Datenablagen und die dort gelagerten Daten verzeichnet sind. Die Forschenden selbst können so ihre Daten in den für sie passenden Repositories ablegen. Die Treffen mit den anderen Data Stewards haben You gezeigt, dass er mit seinem Problem nicht allein ist. «Mit anderen über Strategien und gemeinsame Herausforderungen zu sprechen, hat mir sehr geholfen.»
Dass Forschende Daten in disziplinenspezifischen Repositorien ablegen, sei auch im Sinne der UZH, erklärt Malits. «Wenn man mit MRI-Daten aus der Medizin arbeitet, braucht es eine andere Kompetenz, als wenn man mit Textdaten forscht.» In der Linguistik hat die UZH schweizweit eine führende Rolle eingenommen und betreibt das Language Repository of Switzerland (LaRS). Forschende von Schweizer Universitäten können dort ihre linguistischen Forschungsdaten ablegen. Dabei erhalten sie Beratung und Unterstützung von Spezialist:innen der Universitätsbibliothek und des LiRI. Zudem ist das Repository in das Europäische Netzwerk für Linguistische Forschung CLARIN eingebettet.
«LaRS ist ein erfolgreiches Pilotprojekt», so Malits. «Es heisst aber nicht, dass man nun in jeder Disziplin solche Repositories aufbauen muss.» Denn in vielen Bereichen gibt es zum Teil schon lange internationale Datenablagen, die breit
genutzt werden. Dort würde es keinen Sinn machen, neue Infrastrukturen aufzubauen. «Das Modell muss sich nach den Bedürfnissen der Forschenden richten», ist Malits überzeugt.
Das Netzwerk der Data Stewards hilft mit, solche Bedürfnisse und Lösungsmöglichkeiten mit einem Bottom-up-Ansatz breiter bekannt zu machen. «Wir haben damit eine Form gefunden, mit der wir eine grosse Hebelwirkung erreichen können», ist Malits überzeugt. Anlässlich einer Themenwoche zum Datenschutz im Januar sei es gelungen, Know-how aus den einzelnen Communities zusammenzubringen. «Die Data Stewards haben Personen aus ihrem Umfeld aktiviert, die nicht nur an Workshops teilgenommen, sondern zum Teil auch gleich eigene Workshops organisiert haben.»
Auf gesamtuniversitärer Ebene befasst sich die Arbeitsgruppe Open Science unter der Leitung von Prorektor Christian Schwarzenegger und Prorektorin Elisabeth Stark mit den Fragestellungen rund um das Datenmanagement. Auch dort sind Vertreter:innen aller Fakultäten eingebunden, damit das Thema auch dort verankert werden kann. Das Ziel sei, so Malits, dass möglichst viele Forschende ihre Daten nach den FAIR-Prinzipien aufbereiten und zugänglich machen. Denn nur so kann der Datenschatz für möglichst viele auch Nutzen bringen.
Dr. Andrea Malits, andrea.malits@ub.uzh.ch
Dr. Andrea Farnham, andrea.farnham@uzh.ch, Dr. Guanhao You, guanghao.you@uzh.ch www.openscience.uzh.ch


PORTRÄT — Cordelia Bähr
Die Rechtsanwältin und UZH-Alumna Cordelia Bähr ist der juristische Kopf hinter der erfolgreichen Klage der Schweizer Klimaseniorinnen beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Sie wurde von der renommierten Wissenschaftszeitschrift «Nature» als eine der zehn einflussreichsten Personen in der Wissenschaft 2024 ausgezeichnet.

«Der Europäische Gerichtshof hat bestätigt, dass Klimaschutz ein Menschenrecht ist.»
Cordelia Bähr, Rechtsanwältin
Text: Simona Ryser
Bilder: Marc Latzel
Die Primarschullehrerin hatte ihr einst ins Freundschaftsbuch geschrieben: «hat ein starkes Durchsetzungsvermögen». Das ist auch noch im Erwachsenenleben so. Die Klimaanwältin Cordelia Bähr ist hartnäckig und erfolgreich. Dass sie ihren Willen durchsetzen kann, hat sie gerade wieder bewiesen. Sie ist der juristische Kopf hinter den Klimaseniorinnen Schweiz, die am Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gegen die Schweiz klagten, das Land tue zu wenig gegen den Klimawandel. Das EGMR hat die Klage mit einem wegweisenden Urteil gutgeheissen. Das hat weltweit für Wirbel gesorgt.
Die 44-jährige Anwältin wirkt gefasst. Sie sei kein extrovertierter Mensch, sagt Cordelia Bähr von sich. Der öffentliche Rummel nach dem Entscheid des EGMR war ihr schon fast zu viel gewesen, aber natürlich gehört das zum Job. Lieber arbeitet sie im Stillen und brütet über Gesetzesparagraphen, bis sie eine Lösung gefunden hat. Bähr ist eine ruhige Schafferin. Sie sei gut organisiert, ihre Rechtsschriften seien stets akkurat strukturiert. «Vielleicht habe ich das von meiner Oma», sagt sie mit einem Lächeln, «sie war Mathematikerin.»
Rechtsanwältin statt Managerin
Cordelia Bähr sitzt mit einem Cappuccino in einer ruhigen Ecke in einem Café. Das blonde Haar hochgesteckt, der Blick wach. Weshalb eigentlich Rechtswissenschaft?
«Als Kind habe ich Topmanagerin als Berufswunsch angegeben», erzählt Bähr mit ihrem etwas abgeschliffenen St. Galler Dialekt. Aber als sie dann mit der Matura im Sack ein Praktikum bei einer Bank machen wollte, kam sie schon nach dem Bewerbungsgespräch davon ab. Ihr wurde klar: Das Wirtschaftsbusiness passte nicht zu ihr. «Das Klima dort war eisig. Später, als ich bei einer Wirtschaftskanzlei arbeitete, merkte ich, dass es für mich zu wenig interessant ist, wenn es ‹nur› ums Geld geht», erzählt sie. Argumentieren konnte sie aber immer schon gut. Sie schmunzelt. Das habe sie beim Debattieren mit der Mutter gelernt. Bähr ist in der Stadt
St. Gallen aufgewachsen. Der Vater arbeitete im Bildungsbereich, die Mutter war Coiffeuse. Als Cordelia Bähr sieben Jahre alt war, liessen sich die Eltern scheiden. Sowohl die neue Lebenspartnerin des Vaters wie auch der Lebenspartner der Mutter waren Juristen. Die Rechtswissenschaft lag also durchaus schon in der Luft. Allmählich füllt sich das Café. Es könnten angehende Juristinnen und Juristen sein, die hierherkommen, um auf die nächste Prüfung zu büffeln, befindet sich das Lokal doch in unmittelbarer Nähe des Rechtswissenschaftlichen Instituts der Universität Zürich. Cordelia Bähr ging an diesem Institut einst ein und aus. 2006 hatte sie das Rechtsstudium in Zürich mit dem Lizentiat abgeschlossen. Für den Master of Laws L.L.M. hat sie es – nach einigen beruflichen Stationen bei der Jugendanwaltschaft Wil, am Bezirksgericht des Kantons Zürich und bei einer Zürcher Wirtschaftskanzlei – an die renommierte London School of Economics and Political Science (LSE) geschafft. «Das war eine prägende Zeit», erzählt Bähr begeistert. Die spannenden Inputs und Diskussionen hätten ihr «den Ärmel reingezogen», erinnert sie sich. Und ihr Herz begann so richtig für das Klimarecht zu schlagen.
Al Gores unbequeme Wahrheit
Es hatte allerdings schon früher Klick gemacht. «Das war 2006, als der Film des ehemaligen amerikanischen Vizepräsidenten Al Gore über die globale Erderwärmung, ‹An Inconvenient Truth› herausgekommen ist», sagt Bähr. Der Film habe ihr die Augen geöffnet. Ihr wurde klar, dass da einige grössere Probleme auf die Menschheit zukommen. Doch was tun? Cordelia Bähr hätte Klimaaktivistin werden können. Sie wurde Anwältin. Klimaschutz habe nichts mit Idealismus zu tun, sagt sie. «Angesichts der naturwissenschaftlichen Fakten ist es notwendig, dass man Klimaschutz betreibt.» Ihr Rechtsstudium gab ihr Werkzeuge in die Hände, mit denen sie aktiv werden konnte.
In der Klimarechtsszene wurde schon länger darüber nachgedacht, wie man sich mit rechtlichen Mitteln gegen Verfehlungen in der Klimapolitik wehren könnte. Mit der erfolgreichen Klage der Schweizer Klimaseniorinnen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ist Cordelia Bähr ein Coup gelungen, der zeigt, was möglich ist. Dafür wurde sie unlängst von der Wissenschaftszeitschrift «Nature» als eine von zehn Personen ausgezeichnet, die 2024 die Wissenschaft weltweit massgeblich mitgeprägt haben: «Die Anwältin, die die Schweiz wegen der globalen Erwärmung verklagte und gewann», titelte «Nature». Helen Keller, Professorin für Völkerrecht an der Universität Zürich und einst selbst Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, sagt im «Nature»Artikel über Bähr, sie habe den Fall derart perfekt vorbereitet, dass es für das Gericht schwierig gewesen wäre, gegen die Klimaseniorinnen zu entscheiden. Bähr nickt. Sie hat auch diesen Fall sehr durchdacht aufgezogen. Inspiriert war sie von einem Fall in den Niederlanden. Dort hatte die Umweltorgani
«Angesichts der naturwissenschaftlichen Fakten ist es notwendig, dass man Klimaschutz betreibt.»
Cordelia Bähr, Rechtsanwältin
sation Urgenda die Regierung erfolgreich verklagt mit dem Argument, sie sei wegen ihrer verfehlten Klimapolitik der Schutzpflicht gegenüber der Bevölkerung nicht nachgekommen.
Staatliche Schutzpflicht
Bähr nippt am Cappuccino und erzählt, wie es zur Klage der Klimaseniorinnen kam. Greenpeace kontaktierte ihre damalige Chefin mit der Anfrage, ob es einen Rechtsweg gebe, um die Schweiz zu einer verantwortungsvollen Klimapolitik zu bewegen. Darauf machte sich Bähr an die Arbeit. Bei ihrer Recherche stiess auf eine Studie zum Hitzesommer 2003, als in Europa 70000 Menschen wegen der Hitze starben. Überproportional betroffen waren ältere Frauen. «Da wurde mir klar: Ältere Frauen könnten die strengen Anforderungen, die an Klagen in der Schweiz gestellt werden, erfüllen», erzählt Bähr. Sie sind beim Klimawandel eine besonders vulnerable Gruppe, die die staatliche Schutzpflicht der Schweiz einfordern konnte. Denn der Staat ist verpflichtet, seine Bürgerinnen und Bürger vor Tod und Krankheit zu schützen. Im Fall des Klimawandels bedeutet dies, dass die Schweiz es versäumt hatte, die Gesetzgebung anzupassen, um die gesundheitsbedrohenden Folgen des Klimawandels zu verhindern. Damit hatte er seine Schutzpflicht verletzt. So lautete das juristische Argument von Bährs Anklageschrift. Die grösste juristische Herausforderung sei allerdings die fehlende Verfassungsgerichtsbarkeit gewesen. «In der Schweiz gibt es keine gerichtliche Instanz, die überprüft, ob Bundesgesetze verfassungswidrig sind», erklärt die Juristin. Der Rechtsweg der Klimaseniorinnen führte schliesslich zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und Strassburg gab ihnen recht. Die Schweiz wurde gerügt, weil sie zu wenig gegen den Klimawandel unternimmt und dem Pariser Klimaabkommen nicht nachgekommen ist, das sie ratifiziert hat. Das Urteil erregte weltweit grosses Aufsehen. Die Musterschülerin Schweiz hatte einen Rüffel erhalten.

Doch das Urteil des EGMR geht weit über die schweizerische Aufregung hinaus. Es ist ein Präzedenzfall. «Der Europäische Gerichtshof hat bestätigt, dass Klimaschutz ein Menschenrecht ist», betont die 44-jährige Juristin, «das kann nun in allen 46 Staaten des Europarats mit Rechtsmitteln eingefordert werden.»
In der Kanzlei in Zürich, wo Bähr Partnerin ist, gibt es auch kleinere Mandate. Die Juristin beschäftigt sich etwa mit Streitigkeiten beim Gewässerschutz und anderen Umweltrechtsfällen, oder sie schreibt Rechtsschriften für Initiativen und Gutachten. Ein grösserer Fall, mit dem sie sich gerade beschäftigt, ist eine Zivilklage gegen Holcim, wo sie Einwohner:innen der indonesischen Insel Pari vertritt, die den Baustoffkonzern für Klimaschäden in ihrem Lebensraum verantwortlich machen und dafür Entschädigung fordern.
Cordelia Bähr ist eine gefragte Klimaanwältin. Sie hat viel zu tun. Auch die Klage der Klimaseniorinnen ist noch nicht ausgestanden. Die Schweiz hat bei der Europäischen Menschenrechtskommission beantragt, den Fall zu schliessen, weil sie das Urteil als nicht gerechtfertigt und bereits umgesetzt erachtet. Bald tagt das Ministerkomitee des Europarats, das die Umsetzung
Berg oder Strand?
Welches ist die grösste Entdeckung Ihres Fachs?
Die Kodifizierung der Menschenrechte, besonders durch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die Europäische Menschenrechtskonvention, hat weltweit tiefgreifende Auswirkungen auf Gesetzgebung und Rechtsprechung – und auf das Leben der Menschen.
Wo sind Sie am kreativsten?
Überall, wo ich meinen Gedanken freien Lauf lassen kann.
Was tun Sie, um den Kopf auszulüften und auf neue Gedanken zu kommen?
Ich gehe mit meiner Familie raus aus der Stadt Zürich.
Mit welcher berühmten Persönlichkeit würden Sie gerne abendessen und weshalb?
Mit Bundesrat Albert Rösti. Für einen Einblick hinter die Kulissen der anhaltenden Nichtumsetzung des Klimaseniorinnen-Urteils – und des generellen «Abbruchs» des Umweltrechts.
Drei Bücher, die Sie auf eine einsame Insel mitnehmen würden?
«Radikal emotional. Wie Gefühle Politik machen» von Maren Urner; «Mit Ignoranten sprechen. Wer nur argumentiert, verliert» von Peter Modler; «Mitte des Lebens. Eine Philosophie der besten Jahre» von Barbara Bleisch und einen Stapel «Annabelle»-Hefte.
Kugelschreiber oder Laptop?
Laptop – meine Handschrift ist selbst für mich schwer zu entziffern.
Berg oder Strand?
Beides und beides zu jeder Jahreszeit.
des Urteils überwacht. Bähr hat die Stellungnahme der Klimaseniorinnen schon eingereicht.
Neben ihrer Arbeit als Klimaanwältin führe sie ein ganz normales Familienleben mit Mann und Kind, erzählt Bähr. Dazu gehören das gemeinsamem Nachtessen mit dem siebenjährigen Sohn oder der Ausflug am Wochenende, um auf andere Gedanken zu kommen. Bevor die Anwältin dann am Montagmorgen am Schreibtisch wieder mit spitzer Feder und scharfem Verstand die nächste Rechtsschrift verfasst.
INTERVIEW — 100 Jahre Quantenmechanik
«Wir sind in der zweiten
Vor 100 Jahren legte Erwin Schrödinger an der UZH die Basis für die Quantenmechanik. Diese veränderte das physikalische Weltbild fundamental und befeuerte neue Technologien. Physiker Titus Neupert zu Quantencomputern, neuen Sensoren und zur Stabilität von Tischen.

Interview: Thomas Gull und Roger Nickl
Bilder: Stefan Walter
Titus Neupert, 2025 ist von der UNO zum Jahr der Quantenwissenschaft und der Quantentechnologie ausgerufen worden. Was wird da gefeiert?
Titus Neupert: Historisch gesehen wird gefeiert, dass die Schrödinger-Gleichung vor genau 100 Jahren von Erwin Schrödinger hier an der Universität Zürich entdeckt oder viel mehr ersonnen wurde. Wir sind hier an der UZH an einem ganz besonderen Ort und, was das Jubiläum anbelangt, in einer speziellen Verantwortung. Deshalb planen wir dazu verschiedene Veranstaltungen (siehe Kasten, Seite 63). Die Schrödinger-Gleichung ist eine der tragenden Säulen der Quantenmechanik. Wenn man heute Physik studiert, macht man ab dem zweiten Studienjahr fast nur noch Quantenmechanik oder Dinge, die darauf aufbauen.
«Die Quantenmechanik entzieht sich völlig unserer Intuition und erscheint zuweilen fast magisch», sagt Physiker Titus Neupert.

Die Entdeckung der Quantenmechanik vor 100 Jahren wird als Revolution der Physik bezeichnet, worin bestand diese?
Neupert: Die Quantenmechanik beschreibt ganz neu, was Materie ist und wie sie mit Naturkräften wechselwirkt. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass Quantenobjekte – also etwa Elektronen oder Photonen – je nachdem, wie sie gemessen werden, sowohl als Wellen als auch als Teilchen interpretiert werden können. Erwin
Schrödinger ist es mit seiner Gleichung in den 1920erJahren gelungen, diesen so genannten WellenTeilchenDualismus mathematisch anschaulich zu beschreiben.
Was hat sich damit fundamental geändert?
Neupert: Für die damaligen Physiker:innnen erschreckend war, dass sie plötzlich vor philosophischen Problemen standen. Die physikalischen Theorien bis dahin waren komplett deterministisch. Nun merkte man,
dass Messergebnisse wie beim Lotto vom Zufall abhängig sind und dass man auch die Personen, die Messungen durchführen, nicht unabhängig vom System betrachten kann. Darauf war man konzeptionell nicht vorbereitet. Hinzu kommt, dass Längen-, Zeit- und Energieskalen, die wir aus unserem Alltag kennen, fast komplett irrelevant sind. Das heisst, die Quantenmechanik entzieht sich völlig unserer Intuition und erscheint zuweilen fast magisch.
Gezaubert wird aber nicht?
Neupert: Nein, natürlich nicht. Aber es gibt schon Dinge, die sehr überraschend sind, wie beispielsweise das Phänomen der Quantenverschränkung. Sie ermöglicht es, dass man etwa Photonen oder Atome über grosse Distanzen hinweg miteinander in ein und denselben Zustand bringen kann. Das ist heute über 1000 Kilometer möglich – beispielsweise von einem Satelliten zur Erde – und eröffnet ganz neue technologische Perspektiven wie zum Beispiel abhörsichere Kommunikation in einem zukünftigen Quanten-Internet.
Als Begriff geistern die «Quanten» durch Schulzimmer und die mediale Welt. Es gibt kaum jemanden, der noch nichts von Quantenphysik oder zumindest vom sprichwörtlichen «Quantensprung» gehört hat. Die wenigsten können sich aber etwas darunter vorstellen. Was sind Quanten?
Neupert: Um ein Beispiel zu machen: Schwingt ein Pendel, hat es kinetische Energie; wenn es auf einer bestimmten Höhe festgehalten wird, hat es potenzielle Energie. Diese Energie – wie auch viele andere physikalische Grössen – kann gemäss der klassischen Physik stufenlos beliebige Werte annehmen. Das heisst, ich kann das Pendel beliebig einstellen. Die Quantenmechanik sagt nun, dass das so nicht stimmt. Gemäss dieser Theorie gibt es Abstufungen, sodass nicht jeder Energiewert eingestellt werden kann. Diese diskreten Werte sind die Quanten. Auf der Skala eines Atoms ist das wirklich relevant, während wir für die praktische Beschreibung eines Pendels die sehr feinen Abstufungen vernachlässigen können.
Und der Quantensprung?
Neupert: Der Begriff des Quantensprungs benennt den Sprung von einem Energieniveau auf ein anderes. Die Energieunterschiede im Atom sind zwar klein, die Niveaus aber kategorisch unterscheidbar. Aus diesem
Titus Neupert ist Professor für Theoretische Physik und forscht an neuartigen Effekten in Quantenmaterialien. Er ist Mitglied im Direktorium der Digital Society Initiative und im Digital Strategy Board der UZH. titus.neupert@uzh.ch

zweiten Grund steht der Quantensprung für eine klare Veränderung.
Um beim Beispiel zu bleiben: Die Quantenmechanik beschreibt ein Pendel also völlig anders als die klassische Newtonsche Mechanik?
Neupert: Ja, das ist ein anderer Zugang, aber man kann die klassische Physik wieder daraus ableiten. Da besteht kein Widerspruch.
Dennoch hat die Quantenmechanik das physikalische Weltbild radikal verändert. Inwiefern hat sie das getan?
Neupert: Das war ein radikaler Wechsel der Perspektive, die die gesamte Physik betrifft. Im Prinzip steht fast alles, was Physiker:innen heute machen, auf quantenmechanischen Füssen. Die Quantenmechanik ermöglicht uns, fundamentale Dinge zu verstehen, etwa die Stabilität von Materie. Der Umstand, dass der Tisch, an dem wir gerade sitzen, stabil ist und nicht in sich zusammenfällt, lässt sich nur mit Hilfe der Quantenmechanik erklären. Was man auch sehen muss: Die Entwicklung der Teilchenphysik wäre ohne Quantenmechanik völlig unmöglich gewesen. Und sie hat ein riesiges Feld von technischen Möglichkeiten für die Halblei-
«Quantencomputing verspricht im Vergleich zu klassischen Computern eine exponentiell grössere Rechenpower.»
Titus Neupert, Physiker
terindustrie, die Pharmabranche, die Chemie und die Materialwissenschaft aufgetan. Momentan sind wir mitten in der zweiten Quantenrevolution.
Was bedeutet das?
Neupert: In der ersten Quantenrevolution ging es unter anderem mit Erwin Schrödinger darum, die Quantenmechanik als Naturphänomen möglichst gut zu beschreiben. In der zweiten Quantenrevolution steht nun die Nutzbarmachung dieser quantenmechanischen Systeme in der Technologie im Mittelpunkt. Es geht also um die Frage, wie man Quantenzustände gezielt manipuliert, wie man sie herstellt und wie man mit einzelnen Quantenobjekten arbeitet. Heute beschäftigen sich Wissenschaftler:innen und Ingenieur:innen mit Quantenkryptografie und damit, wie man Quantencomputer bauen und Quantensensoren entwickeln kann.
Was kann denn zum Beispiel die Quantenkryptografie, was herkömmliche Kryptografie nicht kann?
Neupert: Klassische Kryptografie-Methoden basieren auf Logik. Deshalb ist es prinzipiell möglich, einen Schlüssel zu knacken. Die Quantenkryptografie beruht dagegen auf physikalischen Prinzipien. Aufgrund der erwähnten Quantenverschränkung lassen sich Informationen so übertragen, dass sie eben absolut abhörsicher sind. Es gibt erste kommerzielle Produkte in diesem Bereich, aber wir sind sicher noch ein gutes Stück davon entfernt, dass diese breitere Anwendung finden.
Das grosse Thema in der Quantentechnologie ist die Entwicklung von Quantencomputern. Wo steht da die Entwicklung und was können solche Rechner besser als klassische Computer?
Neupert: Quantencomputing ist ein Konzept, das im Vergleich zu klassischen Computern eine exponentiell grössere Rechenpower verspricht. Es gibt heute
Veranstaltungen an der UZH
Der Physiker Erwin Schrödinger entwickelte vor 100 Jahren, im Winter 1925/26, die Wellengleichung für Elektronen, die heute als Schrödinger-Gleichung bekannt ist. Schrödinger, der damals Professor für Theoretische Physik an der UZH war, legte damit das Fundament für die Quantenmechanik. Für seine Leistung erhielt er 1933 den Nobelpreis für Physik. Die Quantenmechanik beschreibt physikalische Gesetzmässigkeiten im mikroskopisch Kleinen – bei Molekülen, Atomen, Atomkernen und Elementarteilchen –und hat die Entwicklung moderner Technologien massgeblich geprägt. Zum 100-JahrJubiläum hat die UNO 2025 zum «International Year of Quantum Science and Technology» ausgerufen. Die UZH feiert diesen Anlass mit verschiedenen Veranstaltungen.
Quantum Century Symposium 26. Juni, 16–18 Uhr auf dem Campus Irchel Öffentliche Vorträge zum Jubiläum der Quantenmechanik
Quantum Century Escape Esacpe-Room zum Thema im Science Pavilion UZH, Eröffnung im Frühsommer
Quantum Century Ausstellung Bibliothek Campus Irchel, Eröffnung im Frühsommer
Quantum Computing Summer School 21. bis 25. Juli
Aktuelle Infos und weitere Veranstaltungen zum Jubiläum: https://www.physik.uzh.ch/de/Quantum25.html
Weitere Informationen zu Erwin Schrödinger an der UZH: www.nobelpreis.uzh.ch
bereits Quantencomputer auf dem Markt. Das Problem ist aber, dass Quantencomputer eine gewisse Grösse haben müssen, damit exponentielles Wachstum in der Rechenleistung möglich wird und sie unsere herkömmlichen Computer übertrumpfen. Dies setzt voraus, dass die Computer zwei- bis dreimal grösser sind als die, die aktuell gebaut werden können.
Ist das in absehbarer Zukunft realistisch?
Neupert: Wir brauchen da sicherlich noch einen Quantensprung. Doch es wird so viel Forschung in diese
Richtung betrieben, dass ich eigentlich recht zuversichtlich bin, dass das möglich sein wird.
Was braucht es dazu?
Neupert: Viele Faktoren spielen da zusammen. Ein Quantencomputer besteht aus Quantenbits, die einzeln angesteuert und miteinander gekoppelt werden müssen. Woraus man die besten Quantenbits baut, ist dabei noch eine offene Frage – mehrere Konzepte konkurrieren miteinander. Hier kann auch die Materialforschung einen Beitrag leisten.
In welche Richtung könnte das gehen?
Neupert: Bei den klassischen Computerchips ist Silizium unschlagbar. Bei den Quantencomuptern gibt es noch nichts Vergleichbares. Momentan wird etwa mit kleinen, supraleitenden Bauelementen gearbeitet oder ultrakalten Atomen.
Wir haben über Quantencomputer und Quantenkryptografie gesprochen. Erwähnt haben Sie auch die Pharmabranche. Welche Perspektiven eröffnet die Quantentechnologie für die Medizin?
Neupert: Krankheiten wie beispielsweise Krebs manifestieren sich auch auf kleinster, chemischer Ebene in einzelnen Zellen. Fortschrittliche Quantensensoren können solche Veränderungen sehr genau messen, etwa die Bildung von Radikalen. Man kann so Krankheiten




«Dank stark verbesserter Sensorik und Datenverarbeitung könnte man künftig massgeschneiderte Medikamente herstellen.»
Titus Neupert, Physiker
nicht nur besser erkennen, sondern auch ihren Fortschritt und den Behandlungserfolg genauer einschätzen. Schliesslich kann man Quantencomputer nutzen, um Medikamente zielgerichtet zu entwickeln. Das knüpft an das grosse Thema der personalisierten Medizin an.
In welchen Bereichen wird aktuell an der UZH in der Quantenmechanik geforscht?
Neupert: Der eine Forschungsstrang ist die Teilchenphysik. Dort geht es darum, fundamentale Natur-


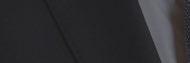


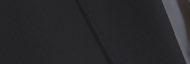



gesetze zu prüfen und zu erweitern, indem man sehr genaue Messungen bei extremen Bedingungen macht. Das zweite Gebiet sind die sogenannten Quantenmaterialien, dazu gehören die Supraleiter. Solche Supraleiter könnten dereinst auch in Quantencomputern eingesetzt werden. Diese Arbeiten sind sehr experimentell, hochkomplex und mit ungewissem Ausgang. Möglicherweise entsteht so etwas Neues, Unerwartetes.
Weshalb sind Supraleiter so wichtig?
Neupert: Die Supraleitung ist ein Phänomen, das nur dank der Quantenphysik besteht, aber dramatische, wahrnehmbare Konsequenzen hat. Im Zustand der Supraleitung verschwindet bei einer bestimmten Temperatur der elektrische Widerstand von Materialien komplett. Quantenmechanisch kann man das so beschreiben, dass die Elektronen in diesem Supraleiter in einen speziellen Wellenzustand treten und in diesem Wellenzustand völlig reibungslos durch das System gleiten können. Momentan kann man Supraleitung allerdings nur bei sehr tiefen Temperaturen erreichen.
Wir haben über verschiedene Anwendungen der Quantenphysik gesprochen. Deren Umsetzung reicht weit über die Physik hinaus. Was bedeutet das?
Neupert: Ein zentraler Wesenszug der zweiten Revolution in der Quantenphysik ist, dass sie nicht mehr allein die Domäne der Physiker:innen ist. Heute beschäftigen sich Ingenieur:innen damit, um etwa Geräte für das Quantencomputing zu entwickeln. Sie müssen verstehen, wie Quantenmechanik funktioniert, wenn sie leistungsfähige Computer bauen wollen.
Verfügen sie bereits über dieses Wissen?
Neupert: Bisher noch nicht genügend, weil es noch nicht zu ihrer Ausbildung gehört. Aber das ändert sich, etwa mit Vorlesungen für angehende Ingenieur:innen zur Quantenmechanik. Dasselbe gilt für die Informatiker:innen, denn irgendjemand muss die Quantencomputer programmieren. Google und Microsoft haben bereits entsprechende Programmierumgebungen entwickelt.
Wo sehen Sie das Potenzial der Quantentechnologie für die Zukunft?
Neupert: Eben beispielsweise in der Medizin, wo man dank stark verbesserter Sensorik und Datenverarbeitung künftig massgeschneiderte Medikamente herstellen könnte. Im Moment ist es allerdings noch nicht vorstellbar, sehr teure Medikamente individuell zu produzieren. Realistischer ist, bestehende Medikamente noch gezielter einzusetzen und damit die Wirkung zu verbessern und die Nebenwirkungen zu minimieren.
Die Medizin ist ein Einsatzgebiet, das für die Menschheit einen grossen Nutzen bringen könnte. Quantentechnologie kann aber auch in Bereichen eingesetzt werden, die potenziell sehr gefährlich sein können, beispielsweise für militärische Zwecke. Wie sehen Sie das?
Neupert: Die Quantentechnologie könnten die Militärtechnologie komplett revolutionieren. Etwa wenn man an Sensoren denkt, die bei Drohnen wichtig sind. Mit Quantensensoren, die viel genauer messen, könnte die Navigation verbessert werden.
Bei der Entwicklung von KI hat man den Eindruck, Europa sei im Hintertreffen gegenüber den USA und China. Ist das bei der Quantentechnologie auch der Fall?
Neupert: Aus meiner Sicht ist Europa hier mit dabei, und es wird auch viel Geld in dieses Forschungsgebiet investiert. Allerdings beginnen die grossen Tech-Konzerne, mehrheitlich aus den USA, mit wachsenden Forschungsprogrammen das Feld stark zu prägen.
Sie haben von der zweite Quantenrevolution gesprochen, in der wir uns jetzt gerade befinden. Weshalb hat es denn 100 Jahre gedauert bis zu dieser zweiten Phase?
Neupert: Um die Quantentechnologie vorantreiben zu können, mussten andere Technologien wie das klassische Computing weit genug entwickelt sein. Das hat einfach so lange gedauert. Doch jetzt stehen wir kurz davor, hier einen weiteren grossen Schritt zu machen. Ich bin optimistisch, dass das gelingt.
UZH Magazin — 30. Jahrgang, Nr. 1 — März 2025 — www.magazin.uzh.ch
Herausgeberin: Universitätsleitung der Universität Zürich durch die Abteilung Kommunikation Leiter Storytelling & Inhouse Media: David Werner, david.werner@uzh.ch Verantwortliche Redaktion: Thomas Gull, thomas.gull@uzh.ch; Roger Nickl, roger.nickl@uzh.ch
Autorinnen und Autoren: Nicole Bruggmann, nicole.bruggmann@kzu.ch; Adrian Ritter, adrianritter@gmx.ch; Santina Russo, info@santinarusso.ch; Simona Ryser, simona.ryser@bluewin.ch; Stefan Stöcklin, stefan.stoecklin@uzh.ch; Theo von Däniken, theo.vondaeniken@uzh.ch Fotografinnen und Fotografen: Frank Brüderli, Marc Latzel, Diana Ulrich, Stefan Walter — Illustrationen: Cornelia Gann, Benjamin Güdel, Noyau
Gestaltung: HinderSchlatterFeuz, Zürich — Lithos und Druck: AVD Goldach AG, Sulzstrasse 10–12, 9403 Goldach, www.avd.ch
Inserate: print-ad kretz gmbh, 8646 Wagen, Telefon 044 924 20 70, info@kretzgmbh.ch
Abonnenten: Das UZH-Magazin kann kostenlos abonniert werden: publishing@kommunikation.uzh.ch — Adresse: Universität Zürich, Kommunikation, Redaktion UZH Magazin, Pfingstweidstrasse 60b, 8005 Zürich — Sekretariat: Fabiola Thomann, Tel. 044 634 44 30, Fax 044 634 42 84, office@kommunikation.uzh.ch
Auflage: 58000 Exemplare; erscheint viermal jährlich — Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck von Arti keln mit Genehmigung der Redaktion ISSN 2235-2805 — Dieses Produkt wurde klimaneutral produziert.
Drucksache
Europas Zukunft, gemalt von Noyau
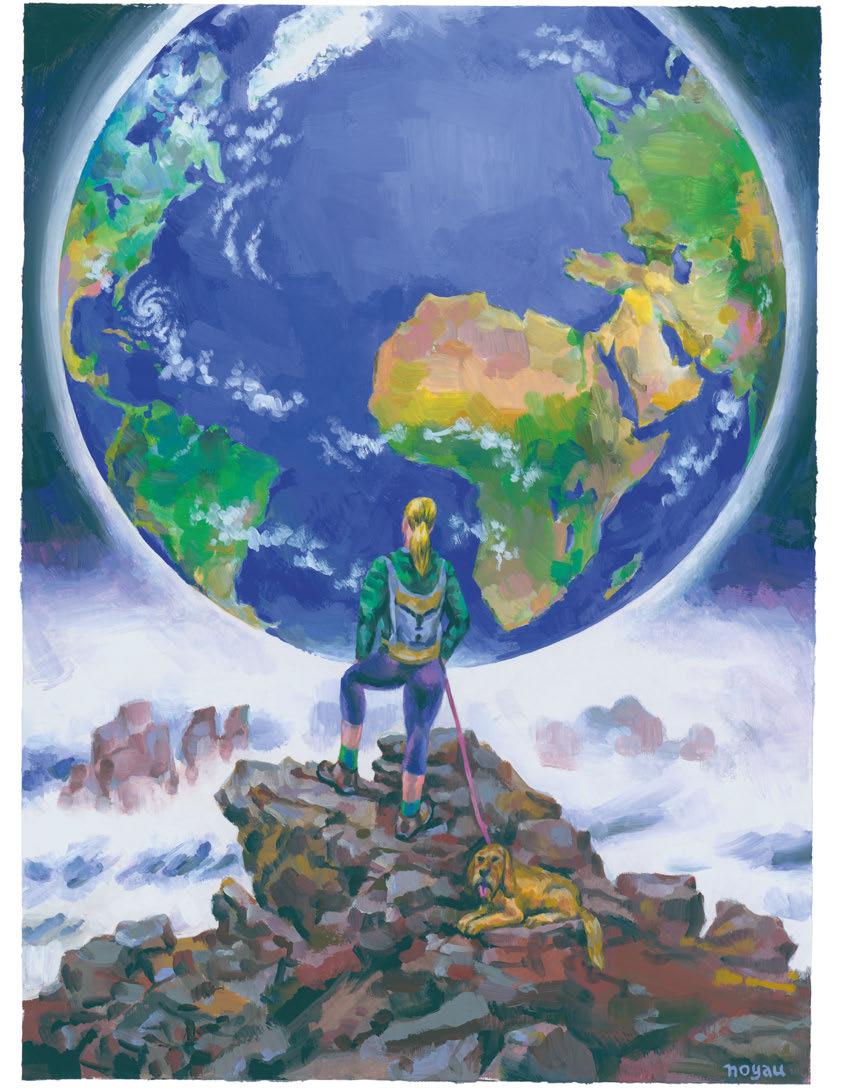
Das nächste UZH Magazin erscheint im Juni 2025.

JETZT 8 WOCHEN TESTEN FÜR NUR CHF 22.–

SonntagsZeit zum Hinschauen hinschauen.sonntagszeitung.ch
zkb.ch/young

Mehr Banking für Junge: Mit Konto, Karte und ZKB Nachtschwärmer für CHF 0.–
Jetzt eröffnen und profitieren