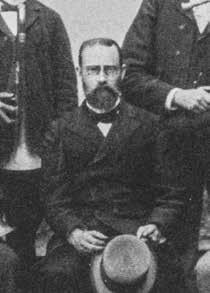1. Quellenkritischer Kommentar
1.1. Einleitung
Sommertage waren uns im Sommer 1914 beschieden wie selten zuvor. Die Rosen blühten, das Korn stand schwer in den Ähren. Friede lag auf Deutschen Landen, ein Gottesfriede auch auf unserm Dorfe, im schönen Wesertale.“1
Mit diesen Worten leitet die Wahmbecker Kriegschronik in die Geschehnisse des Ersten Weltkriegs (1914-1918) vor Ort ein. Die Einleitung verdeutlicht, dass die Menschen im Weserbergland im Sommer 1914 ihrem gewohnten Alltag nachgingen. Nichts deutete in der Bevölkerung darauf hin, dass ein Krieg bevorstand. Ein Krieg, der in seiner Form und Totalität das bisher Vorstellbare verändern sollte. Als Quelle liefert die Chronik interessante Einblicke in die Region am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Gleichzeitig verdeutlicht sie das Ende einer scheinbaren dörflichen Idylle und den alltäglichen Kriegszustand, den der Erste Weltkrieg einläutete. Der Kriegsalltag sowie die gesellschaftlichen Umbrüche während und nach dem Krieg spiegeln sich in dieser Quelle wider.
Der Schöpfer der Chronik ist Karl Baumann (1888-1951). Er war Lehrer an der Dorfschule in der Gemeinde Wahmbeck. Das Sollingdorf, welches heute zu Niedersachsen gehört, liegt direkt an der Weser, die seit dem Mittelalter die Grenze zwischen den hannoverischen und hessischen Territorien bildete. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges war Karl Baumann 25 Jahre alt. Er wurde am 1. Dezember 1888 in Eschershausen bei Uslar geboren. Seine Eltern waren der Lehrer Johann Baumann und dessen Ehefrau Louise geb. Guyat aus Eschershausen. Beruflich folgte der Sohn dem Vorbild seines Vaters und wurde ebenfalls Pädagoge. Er besuchte zunächst die Präparandenanstalt und das Seminar in Alfeld. Vom 1. April 1910 bis zum 30. September 1926 war Baumann Lehrer in der Volksschule im Ort Wahmbeck. Am 1. Oktober 1926 wurde er nach Niederscheden bei Hann. Münden versetzt, wo er bis 1951 lebte.
1915 wurde der Lehrer als Soldat in den Weltkrieg eingezogen. Die von Ihm zusammengestellte Chronik schildert die Zeit vor der Einberufung in den Krieg sowie die Zeit nach der Kriegsniederlage das Alltagsleben in seinem Wohn- und Wirkungsort. Die Chronik besteht aus zwei handgeschriebenen ledergebundenen Büchern. Der erste Band umfasst die eigentliche Chronik. Sie wurde von Baumann nicht selbst verfasst, sondern abgeschrieben. Dafür sprechen mehrere Indizien: So würde der Lehrer über sich in der dritten Person schreiben und es sind Hinweise vorhanden, welche die Urheberschaft stark bei Baumanns Lehrerkollegen und späteren Schwiegervater Heinrich Düvel (1853-1927) sehen. So weckt beispielsweise Düvels Tochter Elisabeth ihn hinsichtlich der Kunde über die Mobilmachung auf.2
1 Wahmbecker Kriegschronik (1914-1918), zusammengestellt von Karl Baumann, o. J. Die Chronik ist im Anhang ab S. 67 abgedruckt. Die Belegstellen im Text verweisen auf die Originalseitenzahlen der Chronik und sind mit Folium (fol.) gekennzeichnet. Im obigen Fall bezieht sich das Zitat auf die Kriegschronik, fol. 2.
2 Kriegschronik, fol. 3.
Der zweite Band ist eine Zusammenstellung der Wahmbecker Soldaten im Krieg und kann auf Baumann zurückgeführt werden, da sich die Handschriften der Texte vom ersten und zweiten Band größtenteils gleichen. Als Soldat der Reserve und Leutnant musste es Baumann gereizt haben, die Schicksale der Wahmbecker Kriegsteilnehmer festzuhalten. Dieser Teil der Chronik, der separat gebunden ist, beinhaltet Kurzbiographien und Kriegseinsätze von insgesamt 74 Wahmbecker Kriegsteilnehmern.
Die Chronik verdeutlicht anschaulich, wie Frauen und Männer eines ländlichen Dorfes, unabhängig von Alter und Stand in ihrem Alltag vom Krieg betroffen waren: Die alltäglichen Entbehrungen, das Leid durch den Tod und die Nöte durch die staatliche Zwangswirtschaft, trafen die Menschen besonders hart. Engpässe und Einschränkungen waren für die Menschen alltägliche Erfahrungen.
Die Baumannsche Kriegschronik ist in ihrer ursprünglichen Form transkribiert als Quellenedition in der zweiten Hälfte dieser Abhandlung abgedruckt. Zuerst die Beschreibung des Krieges in Wahmbeck, danach die Feldpostbriefe und Einzelschicksale einiger Wahmbecker Soldaten. Der vorliegende Quellenkommentar ordnet die Kriegschronik historisch ein und gibt Aufschlüsse über gesellschaftliche Entwicklungen vor Ort und in der Region. Das dörfliche Leben nimmt den Hauptteil der Chronik ein. So findet das in Wahmbeck während des Krieges errichtete Kriegsgefangenenlager Erwähnung und die Situation vor Ort. Auch Ereignisse aus der Zwischenkriegszeit, wie die Einweihung eines Denkmals für die im Felde gefallenen Dorfbewohner und die einhergehende Geldentwertung bzw. Teuerungen, werden thematisiert. Der behandelte Zeitraum erstreckt sich vom späten 19. Jahrhundert bis in die zweite Hälfte der 1920er Jahre und vermittelt Einblicke in die wirtschaftliche, soziale und politische Entwicklung der Gemeinde Wahmbeck.
Für die Forschung kann die Chronik eine wichtige Quelle zur lokalen Kriegsund Alltagsgeschichte dienen. Das Uslarer Heimatmuseum widmete dem Thema bereits 2014 eine Ausstellung mit dem Titel „Steckrüben und Stahlgewitter – die Sollinger im Ersten Weltkrieg“. Kleinere allgemein gehaltene Artikel und Zusammentragungen von hiesigen Heimatpflegern geben weitere Einblicke in die damalige Zeit.3 Im Bereich der Alltagsgeschichte können solche Quellen Aufschlüsse über die Mikroebene, das Dorfleben, geben. In der Literatur besteht hier bislang noch eine Forschungslücke.
Gerade das dörfliche Leben während des Krieges wird durch die Kriegschronik detailliert skizziert. Wo die Forschung vorwiegend den Kriegsalltag der Stadtbewohner und des Bürgertums thematisiert, kann anhand der Kriegschronik und ergänzenden Quellen wie Tageszeitungen die Sorgen der Landbevölkerung betrachtet werden. Anhand dieser Perspektiven wird das Bild von der sogenannten Heimatfront auf dem Land erfahrbar. Die Kriegschronik ist damit ein besonderes Zeitzeugendokument und Selbstzeugnis der hiesigen Lokalgeschichte, welches
3 Vgl. Junge, Walter: Bodenfelder Weihnacht 1914, in: Sollinger Heimatblätter (1/1985), S. 28-29. Des Weiteren Kellermann, Andreas: Uslar im November 1918, in: Sollinger Heimatblätter (3/1988), S. 24-28.
die Alltags- und Kriegsgeschichte miteinander verbindet. Zugleich finden sich, abseits der großen Städte und dem Fehlen eines größeren Bürgertums, Aspekte über das Leben der einfachen Menschen, der Landbevölkerung, ihre Bedarfe und Ängste in der Kriegszeit wieder.
Die biographische Betrachtung Baumanns offenbart weiterhin einen charakterlichen Wandel vom monarchiefreundlichen Sympathisanten vor und während des Krieges zum aktiven Anhänger der Republik und Liberalen nach dem Krieg. Dies stellt gleichzeitig ein Desiderat in der Forschung dar: Bürgerliche Angehörige der kaiserlichen Gesellschaft, die nicht dem linken Gesellschaftsspektrum entstammten und ihre persönliche Haltung zur neuen Demokratie erst finden mussten. Gerade die bürgerlich-konservativen und liberalen Gesellschaftsschichten, also Bildungsbürger wie Lehrer und Beamte, trugen durch ihre Akzeptanz der neuen demokratischen Nachkriegsordnung wesentlich zur Stabilität der frühen Weimarer Republik bei.
Zugleich werden in der Person Baumanns aber auch instabile politische Sozialisationen sichtbar, die die Gesellschaft in Kaiserreich, Demokratie und NSDiktatur durchlebt hat. Ihre Anpassung bzw. ihr Arrangement mit dem System und seinen Unterorganisationen. Dies geschah entweder aufgrund von staatlichem Druck, der Furcht vor Repressionen, einer gleichgültigen Einstellung oder sogar aus Sympathie gegenüber den neuen Machtverhältnissen.
Bei der vorliegenden Quelle ist zu beachten, dass Selbstzeugnisse wie (Kriegs-) Tagebücher, Briefe und Autobiografien immer eine Selektion von Darstellungen des jeweiligen Verfassers sind. Die in der Rückschau gemachten Erfahrungen des Schreibers fließen in die Veröffentlichung mit ein. Die dahinterstehenden Motive richten sich bewusst an eine Nachwelt und können Stilisierungen, Auslassungen oder Richtigstellungen enthalten. Die Verfasser und ihre Werke sind daher nicht entrückt vom Zeitgeschehen zu sehen, sie können ganz bewusst oder latent vom Kontext der Zeit kulturell geprägt sein.4
Die Edition beginnt mit einem Abriss der Historie des Weserdorfs Wahmbeck von seiner mittelalterlichen Erwähnung bis zur Weimarer Republik. Die gesellschaftlichen Verhältnisse der Menschen – ihre Arbeitsbedingungen, die politischen Ansichten und Wahlen – werden betrachtet. Dabei spielt die Kirche eine besondere Rolle, wie später im biographischen Werdegang Baumanns noch ersichtlich wird. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs wird verstärkt auf Baumanns Schrift eingegangen und der Bezug zu den sozialen Bedingungen im Dorf hergestellt. Spezielle Erwähnung finden auch ein in Wahmbeck errichtetes Kriegsgefangenenlager und die damit verbundenen Folgen für das Weserdorf. Zum Schluss ist der Originaltext der Kriegschronik abgedruckt.
4 Fussell, Paul: Der Einfluss kultureller Paradigmen auf die literarische Wiedergabe traumatischer Erfahrung, in: Klaus Vondung (Hg.): Kriegserlebnis. Der Erste Weltkrieg in der literarischen Gestaltung und symbolischen Deutung der Nationen, Göttingen 1980, S. 175-187, hier S. 175.
1.2. Beschreibung des Ortes Wahmbeck
Der kleine Ort Wahmbeck wird erstmals im Jahre 1031 in der „Vita Meinwerci Episcopi Patherbrunnensis“5, der Lebensbeschreibung des Bischofs Meinwerk von Paderborn (ca. 975 - 1036), urkundlich erwähnt. Konkret heißt es da im Kontext der kirchlichen Herrschaftsaufzählung: „De prediis autem cidem ecclesie collatis Withun, Rime, Merebeche, Goltbeke, Dotenhuson, Waltmanninchuson, Havergo, Wanbiche et bon in inferiori terra hereditario iure possederat“.6 Für den Ort existieren in den Überlieferungen verschiedene Schreibweisen wie „Wanbeche, Wanbeke, Wameke, Wanke, Wanebek“, die im Verlauf der Jahrhunderte wechselten.
Geographisch ist Wahmbeck Teil des Sollings und des Weserberglands. Letzteres erstreckt sich als hohe Mittelgebirgslandschaft beiderseits der Weser. Die Weser fließt von Hann. Münden nordwärts bis zum Kahlberg vor dem Solling. Hier knickt der Fluss scharf nach Westen ab, um in Schlangenlinien die Landzunge Bodenfelde-Wahmbeck bis zum hessischen Karlshafen zu umkreisen und anschließend über Höxter, Holzminden und Hameln gen Norden zu fließen. Die Wassertiefe beträgt bis zu drei Meter.
Die Nähe zur Weser bildete Segen wie Fluch für den Ort zugleich. Einerseits lieferte sie Nahrung für den täglichen Bedarf in Form von Fischen und bildete ein natürliches Bollwerk, andererseits ließen zahlreiche Hochwasser das Dorf überschwemmen und oftmals sprichwörtlich zur Insel werden.7
Die alle fünf Jahre stattfindenden Volkszählungen im deutschen Reich offenbaren kriegsbedingte Schwankungen in der Einwohneranzahl für Wahmbeck: Lebten 1910 ca. 698 Personen im Ort,8 betrug ihre Anzahl 1915 bereits 762 Personen.9 Davon waren allerdings 48 Militärangehörige und 132 Kriegsgefangene, sodass die Einwohnerzahl lediglich 582 Personen betrug. 15 Jahre später, in der Volkszählung 1925, lebten bereits wieder 740 Personen im Ort.10
5 Christoph Brouwer: Vita B. Meinwerci Ecclesiae Paderbornensis Episcopi, Neuhaus 1681, online verfügbar unter: https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/urn/urn:nbn:de:hbz:061:1-5538 [Letzter Aufruf am 24.06.2023].
6 MGH Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi (SS rer. Germ.) 59, S. 125: : "...und von den der Kirche gegebenen Gütern Withun, Rime, Merebeche, Goltbeke, Dotenhuson, Waltmanninchuson, Havergo, Wanbiche und weitere besaß er von Rechts...".
7 Bei Hochwasser konnte die Weser das Dorf über die Gemarkung „Oberes Feld“ mit einem Nebenarm bis zum Seefeld abschneiden. Dokumentierte Hochwasser vor 1945 sind für die Jahre 1841, 1881, 1909, 1940 und 1943 überliefert und wurden von Hermann Grote aufbereitet, vgl. zudem auch Bohn, Robert: Karlshafen 1699 – 1999. Wirtschafts- und Sozialgeschichte der hessischen Planstadt aus der Barockzeit (= Beiträge zur Geschichte der Stadt Karlshafen und des Weser-Diemel-Gebiets, Bd. 11), Bad Karlshafen 2000, S. 192ff.
8 Kaiserliches Statistisches Amt (Hg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 31. Jg. (1910), S. 63. Vgl. auch Schubert, Uli: Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900, Landkreis Uslar, Gemeinde Wahmbeck, URL: https://www.gemeindeverzeichnis.de/gem1900/ gem1900.htm?gem1900_2.html [Letzter Aufruf am 24.06.2023].
9 Sollinger Nachrichten, 14. Dezember 1915, 55. Jg., S. 2v.
10 Sollinger Nachrichten, 30. Juni 1925, Nr. 76, 65. Jg., S. 2v.
Abb. 1 – Wahmbeck eine Insel, 28.02.1940.
Auszug aus den Sollinger Nachrichten vom 17. Januar 1920: „Infolge der hiesigen Niederschläge in voriger Woche stieg das Wasser der Weser von Sonntag früh bis Dienstag spät abends andauernd, sodaß ungefähr der Stand des Hochwassers vom November 1890 erreicht wurde. Man sah mächtige Wassermengen an unserem Dorfe vorbeieilen und hie und da in den Ort selbst eindringen. Von Dienstagmittag ab bildete das eigentliche Wahmbeck eine förmliche Insel inmitten des ganz überschwemmten Tales. Für viele Ortsbewohner traten nun, wie immer bei solch hoher Flut, unangenehme stunden ein. Sie mußten die Kartoffeln aus dem Keller auf den Boden schaffen, das Vieh, vielfach sogar mittels Kahn, fremden Ställen zuführen und mancher gar sich selbst aus der warmen Stube zu ebener Erde in das erste Stockwerk des Hauses zurückziehen. So hat ein bedeutsames Hochwasser für uns immer etwas Unangenehmes. Indes wird der angerichtete Schaden erst beim fallen desselben ganz zu übersehen sein. Das Sinken der Fluten hat heute Morgen gut eingesetzt.“
Wahmbeck, 12. Dez. Das Ergebnis der am 1. Dezember d. Js. in hiesiger Gemeinde abgehaltenen Volkszählung ist folgendes: es fanden sich vor 427 männliche und 335 weibliche, also zusammen 762 Personen. In der Gesamtzahl sind 48 aktive Militärpersonen und 132 KriegsGefangene mit enthalten, sodaß für den Ort jetzt nur 582 Einwohner verbleiben.
Sollinger Nachrichten, 14. Dezember 1915, S. 2v.
Schon vor der Industrialisierung zeichnete sich die Region durch Armut und einem einfachen Leben seiner Bewohner aus. Der Solling zählte unter den Königen von Hannover zum „Armenhaus“ des Herrschaftsgebiets. Die Einwohner lebten in der Frühen Neuzeit vornehmlich von den kargen Erträgen der Landund Waldwirtschaft11 und von verschiedenen Tagelöhnertätigkeiten. Beim Bau der Carlsbahn zwischen Karlshafen und Grebenstein waren Wahmbecker zwischen 1846 und 1848 beteiligt. Industriebetriebe vor Ort gab es nicht oder entstanden erst später, da Verkehrsanbindungen fehlten. Viele Wahmbecker zog es daher an Orte, die ihnen Arbeit boten.
Durch die engen Verbindungen in die benachbarte hessische Landgrafschaft fürchteten die örtlichen Obrigkeiten während der Revolutionsjahre 1848/49, dass das abgelegene Wahmbeck zu einem Unruheherd werden könnte. So kursierten Gerüchte, dass Waffen aus dem geplünderten Kasseler Zeughaus in die Region gelangt seien. Die Obrigkeiten entsandten daher Soldaten nach Wahmbeck, um einen befürchteten Waffenschmuggel und Proteste in den übrigen Landgemeinden im Keim zu unterdrücken.12
Mit seiner Randlage am hannoverschen Territorium hat Wahmbeck zweifellos den Charakter eines Grenzdorfes, das allerdings durch die Abgeschiedenheit des Sollings keine Konsequenzen mit sich zog: Für die Einwohner bedeuteten die territorialen Grenzen keine Einschränkungen. Wanderarbeiter verdienten ihr Auskommen außerhalb des Dorfes, in den Steinbrüchen bei Karlshafen oder in den wenigen Manufakturen in Uslar, Northeim oder Göttingen. Die wenigen, hauptsächlich land- und forstwirtschaftlichen Arbeitsmöglichkeiten vor Ort ließen viele Jungen und Männer ihr Glück woanders suchen.
Dem 1834 gebildeten Zollverein blieb das Königreich Hannover knapp 19 Jahre fern. Erst 1853 fielen mit dem Beitritt Hannovers Zollschranken im innerdeutschen Binnenverkehr weg. Besonders der dicht bewaldete Solling bildete eine schwer kontrollierbare Zollgrenze. Diesen Umstand hatten sich Schleich-
11 Vgl. ausführlicher zum Thema: Althaus, Daniel [u.a.] (Hg.): Waldleben. Leben und Arbeiten im Solling, Holzminden 2017.
12 Schäfer, Wolfgang: Die Lust der Sollinger am Tumultieren. Die Revolution 1848/49 im Raum Uslar, in: Matthias Seeliger (Hg.): (K)eine Revolution an Weser und Leine, Bielefeld 1999, S. 116-135, hier S. 117.
Abb. 2 – Wahmbecker bei der Feldarbeit, undatiert.
händler in der Vergangenheit immer wieder zu Nutze gemacht, um Wilddieberei und Schmuggel mit den Nachbarstaaten zu betreiben. Vor allem Kolonialwaren, wie Zucker und Tabak sowie Salz bildeten lukrative Schmuggelwaren.13
Politisch schlugen sich die agrarischen Zwischenschichten aus Bauern und Wanderarbeiten in einer hohen Zustimmung für die SPD nieder. Besonders die (Wald-)Arbeiter organisierten sich gewerkschaftlich vor Ort, um bessere Arbeitsbedingungen in ihrem körperlich anstrengenden Arbeitsumfeld zu erreichen. Diese politischen Organisationen spiegeln sich in den verschiedenen Wahlen wieder, die später noch ausführlicher behandelt werden.
Die soziale und gesellschaftliche Struktur in den kleinen Dörfern und Gemeinden des Sollings war überwiegend durch kleine landwirtschaftliche Höfe geprägt. Sie dienten oft der Eigenversorgung. Ungefähr 30 bis 45 Prozent der landwirtschaftlichen Grünflächen wurden als Nutzflächen verwendet. Diese Bewirtschaftung sicherte jedoch nur das eigene Überleben. Profite konnten die Bauern mit der Viehhaltung nicht erzielen, die bis zu 60 bis 90 Prozent der landwirtschaftlichen Einnahmen ausmachten.14 Agrarische Mischexistenzen waren daher nicht selten.
Die Landwirtschaft erforderte stets hohe zeit- und personelle Ressourcen. Ganze Familien, ob jung und alt, waren an der Bestellung von Feldern in den Frühlingsmonaten und die anschließende Ernte im Sommer und im Herbst beteiligt. Moderne Zugmaschinen mit Verbrennermotoren oder gar Elektrizität waren z. B. im ländlichen Wahmbeck bis zum Ersten Weltkrieg kaum vorhanden. Erst die Einrichtung eines Kriegsgefangenenlagers trug maßgeblich zur Elektrifizierung des Orts bei, da eine Leitung vom benachbarten Lippoldsberg über Bodenfelde nach Wahmbeck verlegt wurde.15
In der Feldarbeit unterstützten Pferde und Ochsen die Bewirtschaftung. Den Frauen und Mädchen fiel dabei eine unterstützende Tätigkeit zu: Sie mussten hinter dem Pflug die Bestellung der Äcker vornehmen.16 Auch künstliche Dünger existierten noch nicht. Zur Düngung der Felder wurde der Mist des Viehs verwendet.
Die industrielle Entwicklung erleichterte die Arbeit in der Landwirtschaft stetig. Maschinen hielten Einzug in die Dörfer und übernahmen die Ernte. In Wahmbeck kam bereits im späten 19. Jahrhundert eine sogenannte Dreschmaschine zum Einsatz, die das Heu für das Vieh in den Höfen von den Feldern einfuhr. Die Maschine gehörte dem Wahmbecker Karl Bunzendahl und war bis
13 Althaus, Daniel: Wilderer im Solling und der Versuch ihrer Bekämpfung im 18. und 19. Jahrhundert, Holzminden 2006, S. 11, 33ff.
14 Quade, E.: Die betriebswirtschaftliche Beratung als Helfer für die Gesunderhaltung der Höfe, in: Baumgarten (Hg.): Landwirtschaft und Landwirtschaftsschule des Altkreises Uslar 1907-1957. Festschrift zum 50-jährigen Bestehen der Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle Uslar, Uslar 1957, S. 78-83, hier S. 79.
15 „In wenigen Tagen wird das (Wahmbecker) Lager auch noch mit elektrischem Lichte versehen werden, da von der Zentrale in Lippoldsberg aus eine ganze Leitung für ganz Wahmbeck gebaut wird.“ Vgl. Sollinger Nachrichten 19. Juni 1915, Nr. 71, Jg. 55, S. 2v.
16 Solljer, Hanshenderk: Engelchristine. Lebenserinnerungen einer Landfrau aus dem Solling, Holzminden 2014, S. 249.
in die Kriegszeit im Einsatz.17 Die Technisierung ermöglichte es, mit weniger Arbeitskräften höhere Erträge zu erzielen. Eine Verordnung aus dem Jahr 1919 gibt genau Kunde über das Vorgehen bei der Dresche: So musste die Ernte nach dem Dreschen unmittelbar gewogen werden. Drei Tage nach dem Dreschen hatte zudem die Ablieferung zu erfolgen.18
Der Einsatz der neuartigen Hilfsmittel wurde im Dorf jedoch nicht überall positiv aufgenommen. Besonders der konservativ geprägte Kirchenvorstand sah in der Maschine ein Ärgernis. So beantragte der Kirchenvorstand 1898 im Gemeindeausschuss die „Aufstellung der Dreschmaschine auf dem Thie zu verbieten“ und stattdessen den Einsatz „auf dem Bruch anzuordnen.“ Dies sollte den Einsatz des Gerätes von den ortsnahen Feldern verbannen. Der Kirchenvorstand befand weiterhin, dass auf jeden Fall aber eine „derartige Aufstellung der Dreschmaschine zu verbieten“ sei, da durch das Dreschen der Unterricht der Schule „gestört wird.“ Grundsätzlich sei „das nutzlose Pfeiffen der Maschine zu untersagen.“19
Eine auffällig hohe Zahl an Wahmbeckern verdiente im 19. und 20. Jahrhundert ihren Lohn als Steinbrucharbeiter. Vielen Steinbrüche befand sich westlich von Wahmbeck im Reinhardswald. Ein Beispiel weiter westlich gelegen, war ein Steinbruch am Kuhlenberg. Es handelte sich hierbei hauptsächlich um Tagebauten. Steinbrüche gab es im Weserbergland reichlich. Der hier gewonnene „Solling-Sandstein“ fand aufgrund seiner weichen Beschaffenheit als Fußböden, z. B. in Kirchen und Wohnhäusern, Verwendung.20 So sind Steinbrüche in den Ortschaften Lippoldsberg, Gewissenruh, Polier und Amelith nachgewiesen.21 Auch nahe Karlshafen florierte der Sandsteinabbruch mit den Warneckeschen Brüchen im Ferriesgrund und im Lug-ins-Land und bot mehreren Menschen ein Auskommen an.22
Der Abbau forderte von den Arbeitern hohe körperliche Kraft. Die Schwerstarbeit und die hohe Staubbelastung führten zu einer geringen Lebenserwartung unter den Arbeitern. Ein Grund war der Steinstaub, der bei der Bearbeitung der Steine entstand. Ein Einatmen führte zu Entzündungen der Atemwege. Andere Belastungen waren die Staublunge: Sie gefährdete die Gesundheit der Arbeiter mit Todesfolge. Darüber hinaus kam es immer wieder zu Unfällen mit Schwer-
17 Heimatglocken, 7 Jg., Nr. 12 (1914), S. 89-96, hier S. 95.
18 Sollinger Nachrichten, 10. Juli 1919, Nr. 79, 59 Jg., S. 2v.
19 Protokolle des Wahmbecker Kirchenvorstandes, 31. Juli 1898, S. 3. Maschinell geschriebene Kopie im Besitz des Ortsheimatpflegers Hermann Grote. Eine Kopie liegt dem Herausgeber vor.
20 Schäfer, Wolfgang: „Die Steinbrücher sind alle nicht alt geworden.“ Die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Arbeiter in den Sandsteinbrüchen des Wesertals im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, in: Museum und Werkstatt im Schäferhaus e.V. (Hg.): Bouen uppen Dörpe. Materialien zur Ausstellung über dörfliche Baugeschichte, Wahlsburg 1986, S. 60-66. Für touristische Zwecke wird von der hiesigen Tourismusbranche eine unbelegte Legende aufgeführt, dass Sandstein aus dem Solling im Sockel der amerikanischen Freiheitsstatue verbaut wurde, vgl. den Flyer: Zweckverband Naturpark Solling-Vogler (Hg.): Die Steinbrüche im Solling, Flyer o.O. o.J., S. 3.
21 Grimm, Arnulf: Die Natursteinvorkommen im Raum Wahlsburg, in: ders./Wolfgang Schäfer: Bouen uppen Dörpe. Materialien zur Ausstellung über dörfliche Baugeschichte, Wahlsburg 1986, S. 57-59.
22 Bohn (wie Anm. 7), S. 127.
Abb. 3 – Arbeiter in einem Steinbruch im Solling, undatiert.
verletzten und Todesopfern. So erlitt der Wahmbecker M. Spangenberg im Juni 1902 eine schwere Brustquetschung in Folge eines Unfalls im Steinbruch.23 Albert Rosenthal aus Lippoldsberg berichtete über seinen Vater, der im Steinbruch am Kuhlenberg, gearbeitet hatte: „Mein Vater ist 1862 geboren und hat sein ganzes Leben lang im Steinbruch gearbeitet. Mit 65 ist der gestorben. Die Steinbrücher sind alle nicht alt geworden. Vor allem diejenigen, die Pflastersteine gemacht haben. Die haben tiefgebeugt gesessen und die Steine vor sich gehabt.“24
Neben der Lunge war bei den Steinarbeitern auch die Leber einer starken Belastung ausgesetzt. Der Alkoholkonsum unter den Arbeitern war hoch. Nach den Berichten von Heinrich Sohnrey tranken die Steinbrecher einen halben Liter Branntwein pro Tag, um „den Steinstaub von der Brust zu spülen.“25
Im Steinbruch arbeiteten mehrere Generationen einer Familie für ihr Auskommen. Der Wahmbecker Karl Mordmüller Jr. war wie sein Vater im Steinbruch tätig, ehe er sich 1912 freiwillig zum 74. Infanterieregiment meldete. Den gleichen Weg wählte auch der Sohn des Steinbrucharbeiters Georg August Otte: Sein Sohn August trat 1913 in den Kriegsdienst ein.26 Insgesamt sieben Wahmbecker Kriegsteilnehmer weisen eine direkte Verbindung mit der Arbeit im Steinbruch auf.
23 Sollinger Nachrichten, 11. Juni 1902, Nr. 44, 42. Jg., S. 2v.
24 Schäfer (wie Anm. 20), S. 64.
25 Ebd., S. 65.
26 Kriegschronik, fol. 31f.
Zwischen den Steinbrucharbeitern herrschte eine enge Zusammenarbeit. Der Arbeitsablauf erforderte ein hohes Zusammenspiel zwischen den beteiligten Arbeitern. Unachtsamkeit oder Fehler konnten tödliche Konsequenzen haben. Auch gegenüber den Vorgesetzten waren die Arbeiter untereinander teilweise in Ablehnung bis Hass verbunden. Die Unternehmensgruppe Wegener, die einen Steinbruch auf der Bramburg betrieb, war bei ihrer Belegschaft besonders verhasst. Das lag u.a. daran, dass einige Steinbrecher vor den Augen des Verwaltungssekretärs den Inhalt ihrer Loren willkürlich auskippen oder Steinbrecher demonstrativ große Basaltblöcke zerschlugen mussten.27
Die Benachteiligung der Arbeiter spiegelte sich auch im Wahlrecht wider. 1866 wurde der Solling preußisch, nachdem das Königreich Hannover im Zuge des Deutschen Krieges von Preußen annektiert worden war. Damit galt auch im Solling das preußische Dreiklassenwahlrecht. In Preußen konnte die große Mehrheit der Dorfbewohner kaum Einfluss auf die Kommunalpolitik nehmen. Nach dem Dreiklassenwahlrecht erhielten alle Männer ab 25 Jahren das Wahlrecht in einer von drei Klassen. Die Zuteilung der Klasse orientierte sich an dem direkten Steueraufkommen, sodass eine kleine, höchst besteuerte Wählergruppe genauso viele Wahlmänner entsenden durfte, wie der Großteil der ärmeren Wahlberechtigten in der dritten Klasse. Dadurch erhielten Vermögende und Konservative eine starke Bevorzugung. Im Dreiklassenwahlrecht hatten alle Männer ein „allgemeines“ Wahlrecht bei den Reichstagswahlen.28
Diese politische Benachteiligung konnte langfristig ein Erstarken der SPD nicht verhindern. Doch zunächst mussten die Sozialdemokraten die Sympathie in der Bevölkerung gewinnen. Bei den Reichstagswahlen 1874 überwiegten allerdings noch die Stimmen für die Kandidaten der kaiserlichen Parteien. Von 9349 abgegebenen Stimmen im 11. Wahlkreis (Osterode-Northeim-EinbeckUslar) entfielen auf den Kandidaten von der nationalliberalen Partei (NLP), Siegfried Wilhelm Albrecht29, 5656 Stimmen. Der ehemalige Hauptmann von Lösecke, der für die welfische Partei kandierte, kam auf 3039 Stimmen. 623 erhielt der sozialdemokratische Kandidat Kirchner.30 Auf den Dörfern fiel die Stimmenverteilung zu Ungunsten der Sozialdemokraten aus. Hier erhielt Kirchner nur wenige Stimmen – 7 Stimmen in Allershausen und gar keine Stimme in Bodenfelde.31 Die Autoren der konservativen Lokalzeitung verbargen nicht ihre Sympathie für den Sieg des Kandidaten Albrecht: Sein Sieg sei „für jeden Reichs-
27 Schöneborn, Ingrid: Die Klipperer. Die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter im Basaltsteinbruch Bramburg / Adelebsen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in: Museum und Werkstatt im Schäferhaus e.V. (Hg.): Bouen uppen Dörpe. Materialien zur Ausstellung über dörfliche Baugeschichte, Wahlsburg 1986, S. 71-82, hier S. 79.
28 Vgl. zur Beurteilung des preußischen Wahlrechts Richter, Hedwig: Moderne Wahlen. Eine Geschichte der Demokratie in Preußen und den USA im 19. Jahrhundert, Hamburg 2017, S. 252ff.
29 Siegfried Wilhelm Albrecht (1826-1896) wechselte 1877 als Richter an das Preußische Oberverwaltungsgericht in Berlin.
30 Sollinger Nachrichten, 17. Januar 1874, Nr. 6, 14 Jg., S. 1h. Elf Stimmen verteilten sich auf andere Kandidaten.
31 Sollinger Nachrichten, 14. Januar 1874, Nr. 5, 14. Jg., S. 2v.
freund (eine) sehr erfreuliche Mittheilung“. 32 In Wahmbeck waren viele Wähler dem Urnengang scheinbar fern geblieben. So berichtet eine anonyme Zeitungszuschrift über die Wahlagitation eines „Welfenvertreters“ in Wahmbeck, der bei „Lampenscheine […] die Gemüter so in Verwirrung gebracht und in Zweifel versetzt“, dass diese der Wahl fernblieben.33
„Wahlagitation in Wahmbeck
Ein Welfenvertreter hat hier das Seine gethan; nur schade daß die Tage zu kurz waren, es mußte noch beim Lampenscheine gewirkt werden. Derselbe hatte die Gemüther so in Verwirrung gebracht und in Zweifel versetzt durch sein ‚mundus vult decipi‘ (Die Welt will betrogen sein), welches ihm von seinen Auftraggebern in die Fahne geschrieben war, daß zwei Drittheile der Wähler gar nicht an der Urne erschienen. Ein nach Gewürz klingender Name und etwa sieben seiner mit dem Hobel des Unverstandes zurechtgehobelten Standesgenossen eilten aber zur Wahlurne und wurden endlich gewahr, daß sie den Sieg davon getragen hatten – und an demselben Tage wurd [sic] Pilatus und [2v] tragen, und ist dieser zu diesem Behuf beeidigt worden. Es wird also auf diese Weise vielleicht ein neuer drohender Conflict vermieden werden.“
Sollinger Nachrichten, 17. Januar 1874, Nr. 6, 14 Jg., S. 1h-2v:
Die weiteren Reichstagswahlen fanden unter dem Zeichen der Sozialistengesetze statt. Das Gesetz wurde 1878 verabschiedet, nachdem zwei Attentäter versucht hatten, Kaiser Wilhelm I. zu ermorden. Zwar waren die beiden Attentäter keine Sozialdemokraten gewesen, doch der damalige Reichskanzler Bismarck instrumentalisierte das Attentat gegen die Sozialdemokratie. Die Sozialdemokraten wurden für zwölf Jahre verboten. Innerhalb der Gesellschaft verloren die Sozialdemokraten als Folge des Attentats massiv an Zustimmung.34 Bedingt durch das Sozialistengesetz blieben die Wähler der Partei den Wahlen fern. Die wenigen Sozialdemokraten, die als unabhängige Kandidaten antraten, konnten im Solling nicht viele Stimmen gewinnen. Aber die Kandidaten der Nationalliberalen und der Welfen profitierten vom Verbot der Sozialdemokraten nicht.35
Erst im letzten Jahrzehnt des ausgehenden 19. Jahrhunderts kam die Wende für die SPD im Solling: Nach dem Auslaufen des Sozialistengesetzes 1890 begann der (Wieder-)Aufbau der Ortsvereine. Infolge der Wahlerfolge der Partei entstanden in den Dörfern immer mehr Ortsvereine, die ihre Position auf dem Lande verbesserten und festigten.
32 Sollinger Nachrichten, 17. Januar 1874 (wie Anm. 30).
33 Ebd.
34 Walter, Franz: Die SPD. Biographie einer Partei, 2. Aufl., Berlin 2011, S. 16f.
35 Sollinger Nachrichten, 29. Oktober 1881, Nr. 86, 21. Jg., S. 1h. Sollinger Nachrichten, 29. Oktober 1884, Nr. 85., 24. Jg., S. 1h.
In Uslar und auf den Dörfern veranstalteten die Sozialdemokraten regelmäßige Versammlungen, die das örtliche Bürgertum weitestgehend ignorierte. Die Veranstaltungen der Arbeiterschaft wurden in den Polizeiberichten als friedlich beschrieben.36 Ein Problem der SPD bestand darin, Sympathien außerhalb der Arbeiterschaft zu gewinnen. Erfolge konnte die Partei in der Reichstagswahl 1898 zunächst auf den Dörfern erzielen. In Wahmbeck erhielt der sozialdemokratische Kandidat Gustav Adolf Fischer37 35 Stimmen. Nur der Kandidat vom Bund der Landwirte (BDL), Albert Harriehausen (1846-1936) aus Volpriehausen38, konnte mit 37 Stimmen mehr erzielen. In Bodenfelde wiederum belegte Fischer auch knapp den zweiten Platz mit insgesamt 50 Stimmen hinter dem Kandidaten von Hake (55).39 Es kam zu einer Stichwahl zwischen Fischer und Harriehausen, die eine Woche später, am 24. Juni 1898 erfolgte. Diese gewann Harriehausen. In Wahmbeck erhielten dabei Fischer wie Harriehausen je 52 Stimmen. In der Wesergemeinde waren Anhänger von Sozialdemokraten und bäuerlich-konservativen Parteien zu dieser Zeit stark vertreten.
Die Wahlergebnisse der Reichstagswahlen 1907 und 1912 in Wahmbeck bestätigen diese These. Bei der Reichstagswahl am 25. Januar 1907 erhielt der Kandidat der SPD Deichmann 48 Stimmen. Genauso viele Stimmen konnte der Kandidat Volger, der für den BDL antrat, für sich gewinnen. Im Gesamtresultat für den Kreis Uslar belegte Deichmann mit 1084 Stimmen den zweiten Platz hinter dem Kandidaten der Nationalen Liste mit 1240 erhaltenden Stimmen.40
Ähnliche Ergebnisse erzielte die SPD fünf Jahre später in der Reichstagswahl vom 12. Januar 1912. In Wahmbeck gewann Deichmann für die SPD in der Hauptwahl mit 54 Stimmen Vorsprung gegen seine Konkurrenten. In der darauffolgenden Stichwahl zehn Tage später landete Deichmann nur um zwei Stimmen hinter seinem konservativen Konkurrenten Machens. Insgesamt gewann aber Deichmann den Reichstagssitz im Wahlbezirk, was die lokale Zeitung dazu veranlasste, das „beklagenswerte Resultat der gestrigen Stichwahl“ zu kommentieren.41
Die Zustimmung für die SPD war besonders in der Arbeiterschaft stark ausgeprägt. Diese setzte sich aus Tagelöhnern, Handwerkern und Arbeitern in den zahlreichen Steinbrüchen und Wäldern in der Umgebung zusammen. Auch einige Kleinbauern sympathisierten mit der Partei. In den folgenden Jahren konnte sie aufgrund der gesellschaftlichen Lage und die Situation auf dem Arbeitsmarkt weiter an Attraktivität gewinnen.
36 Koch, Eberhard: Die Geschichte der SPD in Einbeck und Uslar, Göttingen 1976, S. 76f.
37 Biografie von Gustav Adolf Fischer, in: Heinrich Best: Datenbank der Abgeordneten der Reichstage des Kaiserreichs 1867/71 bis 1918 (Biorab – Kaiserreich), URL: http://www.bioparl.de/datenbanken/biorabkr/biorabkr-db/?id=636 [Letzter Aufruf am 17.05.2024].
38 Biografie von Albert Harriehausen, in: Heinrich Best: Datenbank der Abgeordneten der Reichstage des Kaiserreichs 1867/71 bis 1918 (Biorab – Kaiserreich), URL: http://zhsf.gesis. org/biorabkr_db/biorabkr_db.php?id=927 [Letzter Aufruf am 24.06.2023].
39 Sollinger Nachrichten, 18. Juni 1898, Nr. 47, 38. Jg., S. 1h.
40 Sollinger Nachrichten, 30. Januar 1907, Nr. 9, 47. Jg., S. 1h.
41 Sollinger Nachrichten, 23. Januar 1912, Nr. 10, 52. Jg., Nr. 3v.
Die Eisenbahn trug zum Aufschwung in der Region bei. Im Jahr 1873 wurde mit dem Bau der Strecke Ottbergen-Northeim begonnen und 1877 beendet. Der Fahrbetrieb wurde am 7. Januar 1878 aufgenommen. Zwischen 1908 und 1910 begann der Bau der Nebenstrecke zwischen Göttingen und Bodenfelde.42 Damit war die Region an den Fremdenverkehr für Reisende aus Göttingen angeschlossen. Die Züge fuhren im Drei-Stunden-Takt. Eine Weiterführung der Strecke von Uslar über Schönhagen nach Holzminden wurde im weiteren Verlauf nicht realisiert, da die Geländebedingungen mit einer Steigung von bis zu 1:40 Meter Bau und Betrieb erschwert hätten.43
Die neue Sollingbahn verband den westfälischen Industriebezirk mit Südhannover. Für die aufkommenden Industrie- und Manufakturbetriebe der Region gingen damit billigere Absatzwege einher. Arbeiter konnten mit der Bahn einfacher in den umliegenden Städten eine Tätigkeit finden und Bodenfelde erhielt für die Weserschifffahrt eine gewichtigere Rolle.44
Der Bau der Sollingbahn 1874-1878 bildete für die wirtschaftliche Entwicklung Wahmbecks und der Sollingregion eine Zäsur. Zwei Tunnel mussten für die Verbindung Ottbergen-Bodenfelde entlang der Weser gegraben werden. Anfang 1874 wurde mit dem zweiten Tunnel begonnen. Seine Gesamtlänge betrug 630 Meter und stellte für die Arbeiter eine Herausforderung dar. Während der Baumaßnahmen kam es immer wieder zu Todesfällen.45 Am 19. April 1876 konnte letztendlich gemeldet werden, dass der sogenannte Wahmbecker Tunnel „durchschlägig wurde“. 46 Viele Einwohner verdienten als Arbeiter ihren Lohn auf der Baustelle. Neben Wahmbeckern waren auch auswärtige Arbeitskräfte vor Ort beteiligt: „Reine Italiener, Welsch-Tyroler am Brenner zu Hause, deutsche und russische Polen, Kassuben aus Pommern mit langen Bärten.“47 Während der Bauperiode waren über 300 Arbeiter auf der Baustelle beschäftigt. Die auswärtigen Arbeitskräfte hausten mit ihren Familien „ums Dorf herum in Erdhütten“. Trunksucht und Spielsucht sollen unter den Arbeitern weit verbreitet gewesen sein. So konnten beim Kartenspiel „zwischen 50 und 80 Thaler auf dem Tisch“ liegen bleiben.48 Nicht selten ließen die Spielschulden die Betroffenen den Freitod wählen.49 Auch das Aufeinandertreffen der verschiedenen Nationali-
42 Vgl. ausführlicher zur Geschichte der Eisenbahn im Solling: Wenzlaff, Undine: Aufbruch ins Fabrikzeitalter - Die Industrialisierung des südlichen Sollings, Holzminden 2012, S. 43-77.
43 Vgl. Sollinger Nachrichten, 15. Januar 1898, Nr. 5, 38. Jg., S. 1h.
44 Vgl. ausführlicher: Busse, Gerd [u.a.]: Eisenbahn Göttingen - Bodenfelde, Bahnlinie - Lebenslinie, Nordhorn 1989. Aschoff, Gerd/Busse, Gerd/Meier, Gustav: Höchste Eisenbahn. Zur Geschichte und Gegenwart der Bundesbahn-Nebenstrecke Göttingen-Adelebsen-Bodenfelde, Göttingen o.J.
45 „Heute ist ein am Tunnelbau bei Wahmbeck beschäftigter Kippkarrenführer durch Verschütten zu Tode gekommen“ (Sollinger Nachrichten, 17. Juli 1875), Zitat nach: Wenzlaff (wie Anm. 42), S. 50.
46 Sollinger Nachrichten, 22. April 1876, 16. Jg.
47 Wahmbecker Schulchronik, S. 22. Die Schulchronik ist nicht mehr überliefert. Fragmente und Zusammenstellungen finden sich bei Hermann Grote wieder. Zitat nach: Wenzlaff (wie Anm. 42), S. 54.
48 Ebd.
49 Vgl. Sollinger Nachrichten, 15. Dezember 1875, 15. Jg. und Sollinger Nachrichten, 16. Februar 1876, 16. Jg.
täten entzündete Konflikte zwischen Einheimischen und Auswärtigen. Im Juni 1875 eskalierte ein Streit derart, dass ein 22-jähriger Pole in die Weser geworfen wurde und ertrank.50
Im Jahr 1905 erhielt Wahmbeck im Rahmen des Wegebaus auf der hessischen Weserseite eine neue Fähre. Für den Fremdenverkehr bildete Wahmbeck damit einen „Mittelpunkt“ in der Verbindung zwischen Uslar-Bodenfelde und Hofgeismar-Karlshafen in Hessen. Bereits früher hatte es in Wahmbeck eine Personenfähre gegeben, welche die hannoversche mit der hessischen Weserseite verband. In Folge eines Unglückes 1896 bei dem sechs Personen ertranken, wurde der Betrieb vorübergehend eingestellt.51 In der Zwischenzeit war die Fährverbindung zum Erliegen gekommen, da „niemand in Wahmbeck weder verpflichtet noch berechtigt war, die Ueberfahrt auszuführen.“52 Die Einweihung der neuen Fährverbindung wurde in den Sollinger Nachrichten im Januar 1905 begrüßt, da damit eine „neue, bequeme Verbindung zwischen Uslar (Solling) und Bodenfelde einerseits, und der Provinz Hessen und dem hessischen Wesertale andererseits geschaffen, deren Mittelpunkt Wahmbeck ist.“ Einige Kritiker im „Mittelpunkt“ selbst sahen in der erneuerten Fährverbindung keine Zukunft, da sie zu kostspielig sei.53

50 Sollinger Nachrichten, 18. Juni 1875, 15. Jg.
51 Vgl. Grote, Hermann: Fährunglück 1896 in Wahmbeck, in: Sollinger Heimatblätter (2/1990), S. 13-16.
52 Vgl. Sollinger Nachrichten, 28. Januar 1905, Nr. 8, 45. Jg., S. 2v.
53 Ebd.
Abb. 4 – Arbeiter am Wahmbecker Tunnel um 1950.
Abb. 5 – Wahmbecker Fähre um 1908.
1.3. Kirchengemeinde
Eine Kirche in Wahmbeck ist bereits für die Zeit vor der Reformation nachweisbar. Die Erhebung zur eigenständigen Kirchengemeinde ist nicht genau belegt. So ist das Jahr 1507 im Torbogen des Kirchenportals erkennbar, wo die Kirche (wieder-)erbaut oder ausgebessert wurde. Auch ein gotisches Fenster über dem Altar ist ein Beleg für das hohe Alter der Kirche. Frühe Recherchen gehen davon aus, dass Wahmbeck ein Kirchdorf des Klosters Helmarshausen gewesen war.54
Durch die Nähe zur Weser und die betriebene Flussschifffahrt wurde die Kirche dem christlichen Schutzpatron der Schiffer, Fähr- und Fuhrleute gewidmet. Es ist Beleg dafür, dass die Menschen des Ortes in einfachen Verhältnissen lebten. Die abgeschiedene Lage Wahmbecks im südlichen Teil der braunschweigisch-lüneburgischen Fürstentümer führte immer wieder zu Vakanzen innerhalb der Pfarrstelle, da nicht alle Pfarrer über die Versetzung in ihre neue Gemeinde zufrieden waren. Das Pfarrhaus war zu Beginn von Pastor Wodes 1867 Dienstantritt in Wahmbeck ca. 200 Jahre alt und entsprechend baufällig. Für den neuen Pfarrer musste die Versetzung von Elbingrode im Harz nach Wahmbeck wie eine Strafversetzung erschienen sein, da er über das Pfarrhaus entsetzt schrieb: „Ganz wie ein Bauernhaus.“55
Zwei Wahmbecker Pastoren, Heinrich August Emil Zisenis (1895 bis 1912) und Heinrich Wilhelm Ludwig Kleuker (1912 bis 1925), sind für den Untersuchungszeitraum von besonderem Interesse, da sie mit dem Ersteller der Kriegschronik Baumann direkt in Kontakt kamen. Pastor Zisenis wechselte 1895 von Schoningen nach Wahmbeck. Als Sohn eines Hauptlehrers wurde er nicht nur zum hiesigen Oberschulinspektor ernannt, er erteilte auch selbst Unterricht in der Schule der Wesergemeinde. Kleuker kam 1912 aus Vahlbruch nahe Holzminden nach Wahmbeck und unterrichte ebenfalls in der örtlichen Schule.56 1925 wurde er pensioniert, übernahm ehrenamtlich aber danach vorübergehend den Lektoren- und Organistendienst.57 Sein Nachfolger wurde 1928 Heinrich Christian Hermann August Woeckener aus Avendshausen bei Einbeck.
Die Kirchengemeinde Wahmbeck unterstand der Superintendentur in Uslar. Der dortige Superintendent Dr. August Wilhelm Hardeland (1855-1929) war bis 1926 im aktiven Dienst. Besonders mit dem liberal gesinnten Baumann geriet Hardeland in Konflikt. Auch Kleuker spielt noch eine entscheidende Rolle in Baumanns Lebensweg, von dem später noch die Rede sein wird.
54 Grote, Hermann: 500 Jahre St.-Christophorus-Kirche Wahmbeck 1507-2007, Wahmbeck 2007, S. 5f.
55 Maschinenschriftliche Kopie eines Reskripts des Pastors Wode aus dem Jahr 1872. Eine Kopie liegt dem Herausgeber vor.
56 Grote (wie Anm. 54), S. 46.
57 LKAH D 45a SpecB Wah 231, Schreiben vom 20. Dezember 1926, Uslarer Superintendenten Hardeland an das Konsistorium in Hannover, unpag. sowie Sollinger Nachrichten, 13. Oktober 1925, Nr. 121, 65. Jg., S. 1h.
Einige Kirchenvertreter vor Ort waren allzu progressiven Veränderungen grundsätzlich abgeneigt. Bereits mit der einsetzenden Industrialisierung und dem Bau der Sollingbahn beklagten viele Kirchenvertreter einen drohenden Verfall der Sitten.58 Für die größtenteils evangelisch-lutherische Bevölkerung sollte die kirchliche Sitte und Ordnung erhalten bleiben. So beklagte auch in Wahmbeck Pastor Zisenis wiederholt über die kirchlichen und sittlichen Verhältnisse vor Ort. Zisenis‘ Vorgänger, Friedrich Ludwig Karl Gustav Adolf Spreine (1880 bis 1894), führte regelmäßig Protokoll der Kirchenvorstandssitzungen. Sie geben Einblick in die strenge, ordnungsstiftende Funktion, welche die Kirche in der Gemeinde einnahm. Auch die Sichtweise der Pastoren über das dörfliche Leben wird hier erkennbar:
So wurde die ausstehende Taufe eines unehelich geborenen Kindes der Wahmbeckerin König streng ermahnt. Auch der Austrieb der Herde eines hiesigen, nicht namentlich genannten Schweinehirten am Sonntag kritisierte der Pastor scharf. Besonders der verderbliche „Einflüß [sic] der Gerkschen Wirtschaft“ auf die Jugend war Spreine ein Dorn im Auge. So werde „in den Alltagen oft bis in die Nacht getrunken und gelümmelt“, was zur „Gottlosigkeit Übermäßigkeit und Bescheidenheit“ unter den Jugendlichen führe.59 Pastor Zisenis sah in den lokalen Spinnstuben weiterhin eine „Gefahr (für) Leib und Seele“ für die Teilnehmer. Sie widersprächen „unbeaufsichtigt christlicher Ordnung und Sitte“. Mehrere Hausväter wurden aufgefordert mit ihrer Unterzeichnung eine Duldung solcher Stuben in ihren Häusern, noch eine
Abb. 6 - Links: Pastor Heinrich Zisenis (Dienstzeit 1895-1912), rechts: Pastor Heinrich Kleuker (Dienstzeit 1912-1925)
58 Wenzlaff (wie Anm. 42), S. 186ff.
59 Kirchenvorstandsprotokolle Wahmbeck (1888-1938), Eintrag vom 12. Januar 1893, S. 1. Eine maschinenschriftliche Kopie liegt dem Herausgeber vor.
Teilnahme von ihren „Kindern oder Gesinde“, zu gestatten.60 Zisenis setzte sich aber auch dafür ein, die Sonntagsarbeit in der Essigfabrik in Bodenfelde zu verhindern und die Schulverhältnisse vor Ort zu verbessern. Die Verteilung eines Armengeldes sollte die Situation finanziell Schwacher entspannen. Diese Maßnahmen sind auch im Kontext der Zustimmung der SPD im Ort zu sehen. Bis in die 1950er Jahre galt die SPD als eine laizistische Partei, welche die Religion zur Privatsache erklären wollte und für eine strikte Trennung von Kirche und Staat plädierte.61 So standen alle Parteien und ihre jeweiligen Vertreter, die nicht explizit eine kirchliche Weltanschauung vertraten, unter kritischer Beobachtung der Kirchen.
Während der Zeit des Ersten Weltkriegs wurde in der Gemeinde nur spärlich Protokoll geführt. Die Aufgaben der Seelsorge und der allgemeinen Förderung des Gemeinwohls gewannen in der Kriegszeit an Bedeutung. Die Überwachung der sittlichen Verhältnisse trat in den Hintergrund. So beteiligten sich die örtlichen kirchlichen Honoratioren mit dem Kirchenvermögen finanziell an der 3. (1915) und 7. (1917) Kriegsanleihe in Höhe von 12.000 Mark.62 Die Frau des Pastors versammelte einmal die Woche die Dorfmädchen, um Pakete mit nützlichen Gegenständen und Liebesgaben, wie Betttücher und Kopfkissen, für die Soldaten an der Front zu sammeln.63 Für das geistliche Wohl ließ Pastor Kleuker Ausgaben des christlichen Monatsblattes „Die Heimatglocken“ und des „Hannoverschen Sonntagsblattes“ an Wahmbecker Soldaten senden.64
In den Heimatglocken wurden die kirchlichen Kasualien für die einzelnen Ortschaften detailliert aufgelistet. Mit Kriegsausbruch wurden die Geistlichen und Lehrer in den Gemeinden aufgefordert, ein „genaues Verzeichnis aller Kriegsteilnehmer mit Angabe ihres Truppenteils aufzustellen“ und mit „Erlebnissen derselben, die sich irgendwie zur Veröffentlichung eignen, zu versorgen.“65 Neben diesen Angaben und den Spenden zur Kriegsfürsorge gehen die Heimatglocken kaum ausführlicher auf das Leben in der Wahmbecker Kirchengemeinde ein. Erst nach dem Krieg fanden wieder alltägliche Themen Eingang in die Zeitschrift, wie die Genehmigung des Konsistoriums der Landeskirche 1920 zur Anschaffung neuer Glocken. Des Weiteren findet die Einweihung eines Kriegerdenkmals vor der Wahmbecker Kirche am 14. August 1921 größere Betrachtung. Zahlreiche Teilnehmer und Gäste wohnten der Veranstaltung bei. Verschiedene Redner, darunter Karl Baumann, weihten das Kriegerdenkmal ein. Interessant ist auch eine Bemerkung, dass russische
60 Kirchenvorstandsprotokolle (wie Anm. 59), Eintrag vom 3. März 1895, S. 2. Eine maschinenschriftliche Kopie liegt dem Herausgeber vor.
61 Hering, Rainer: Die Kirchen als Schlüssel zur politischen Macht? Katholizismus, Protestantismus und Sozialdemokratie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in: Archiv für Sozialgeschichte, Bd. 51 (2011), S. 237-266, hier S. 238f.
62 Kirchenvorstandsprotokolle Wahmbeck (1888-1938), Einträge vom 12. September 1915 und 14. September 1917, S. 10. Eine maschinenschriftliche Kopie liegt dem Herausgeber vor.
63 Kriegschronik, fol. 14.
64 Kriegschronik, fol. 15.
65 Heimatglocken, 7 Jg., Nr. 8 (1914), S. 57-64, hier S. 63f.