natürlich

Zucker
Unsere liebste Droge 22
Liebe
Stadtgärtner
Komposterde vom eigenen Balkon 28
Wenn das Herz für mehrere schlägt 50


Zucker
Unsere liebste Droge 22
Liebe
Stadtgärtner
Komposterde vom eigenen Balkon 28
Wenn das Herz für mehrere schlägt 50
Chinesische Medizin mit europäischen Kräutern 10



In ei ne m We in be rg , de r na ch Deli na ts Ch ar ta fü r Bi odiv er si tä t ge pf le gt wi rd , fi nd en au ch vo m Au sst er be n



bedrohte Schmet te rlin gsar te n wi ed er Le be ns ra um un d schü tz en ihre rs ei ts da s Ökos yste m.
«S eh r em pf ehlen swer t»

Wein aus gesunder Natur
Ih r Gesc henk: Prof i-Korkenzieher
Listenpr eis CHF 27.S ch wei K


Im Pake t ent halten sind diese 12 Flas chen zu 75 cl und da s Korkenzieher-Se t. Sie spar en 38%. Angebotlimitier t auf ein 12er-Kennenlern-Paket pro Haushalt.
, bi tt e se nde n Si e mir da s Pa ke tm it
12 Fl as ch en un d Ko rken zie he r-Se t fü r CH F 120.(s ta tt CH F 19 4.70 in kl. CH F 9. 50 Por to). Das Porto übernimmt Delinat für mich
Name
Strasse/Nr
Bitte Coupon abtrennen und senden an: Delinat-Kundenservice
Ki rc hstr as se 10, 9326 Hor n oder bestellen Sie per Telefon: 071 227 63 00
An ge
Kein e Weinli ef er un g an Pe rs on en unt er 18 Ja hr en
Bit te ha be n Si e Ve rs tä nd ni s, da ss wir pr o Ha us hal t nu r 1 Ke nn en ler n- Pa ke t li efe rn .














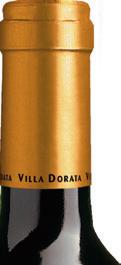
































Mein klang Zweige lt | Qualit ät swein Burgenland 20 08
Listenpr eis CHF 15 .80
Ch ât eau Ba rate t | Bord eaux Supérieur AC 20 08
Listenpr eis CHF 14 .5 0
Vi ny a La ia | Ca talunya DO 20 07
Listenpr eis CHF 14 .80 al r Az in ho | Vinho Re gional Alent ejano 20 08
Listenpr eis CHF 13 .80
Ch ât eau Coulon Sé le ct ion spéc ia le
Corbièr es AC 20 09 | Listenpr eis CHF 12.90
Osot i Ve nd im ia se le cc ionada | Rioja DO Ca 20 08
Listenpr eis CHF 17. 50























Ca nt a Ra si m | Vin de Pay s d‘ Oc 20 09
Listenpr eis CHF 11.5 0
Vi ll a Dorata | Sicilia IG T 20 09
Listenpr eis CHF 11.90
DELSECCO | Deut scher weißer Perlwein, Rheinhessen 2010
Listenpr eis CHF 13 .80
Pa sión De lin at | La Manc ha DO 20 08
Listenpr eis CHF 10 .90
Sa n Vito Ch ia nt i | Chiant i DO CG 20 09
Listenpr eis CHF 11.90
El Mol ino | La Manc ha DO 20 08
Listenpr eis CHF 8. 90






PADMA DIGESTIN® wird traditionell angewendet bei Neigung zu Verdauungsschwäche und Verdauungsstörungen mit Druck- und Völlegefühl in der Magengegend, Blähungen und Appetitmangel (z.B. in der Rekonvaleszenz).
Ungünstige Er nährungsgewohnheiten, Stress, Allergien oder Krankheiten können die Verdauung belasten. Die vielfältige Wirkungsweise der in PADMA DIGESTIN® enthaltenen Pflanzen wärmt und stärkt die Verdauung und bringt sie wieder ins Gleichgewicht. Lesen Sie die Packungsbeilage und lassen Sie sich in Ihrer Apotheke beraten.



Zucker
Unsere liebste Droge 22
Liebe
Stadtgärtner
Komposterde vom eigenen Balkon 28
Wenn das Herz für mehrere schlägt 50
Chinesische Medizin mit europäischen Kräutern 10



In ei ne m We in be rg , de r na ch Deli na ts Ch ar ta fü r Bi odiv er si tä t ge pf le gt wi rd , fi nd en au ch vo m Au sst er be n



bedrohte Schmet te rlin gsar te n wi ed er Le be ns ra um un d schü tz en ihre rs ei ts da s Ökos yste m.
«S eh r em pf ehlen swer t»

Wein aus gesunder Natur
Ih r Gesc henk: Prof i-Korkenzieher
Listenpr eis CHF 27.S ch wei K


Im Pake t ent halten sind diese 12 Flas chen zu 75 cl und da s Korkenzieher-Se t. Sie spar en 38%. Angebotlimitier t auf ein 12er-Kennenlern-Paket pro Haushalt.
, bi tt e se nde n Si e mir da s Pa ke tm it
12 Fl as ch en un d Ko rken zie he r-Se t fü r CH F 120.(s ta tt CH F 19 4.70 in kl. CH F 9. 50 Por to). Das Porto übernimmt Delinat für mich
Name
Strasse/Nr
Bitte Coupon abtrennen und senden an: Delinat-Kundenservice
Ki rc hstr as se 10, 9326 Hor n oder bestellen Sie per Telefon: 071 227 63 00
An ge
Kein e Weinli ef er un g an Pe rs on en unt er 18 Ja hr en
Bit te ha be n Si e Ve rs tä nd ni s, da ss wir pr o Ha us hal t nu r 1 Ke nn en ler n- Pa ke t li efe rn .














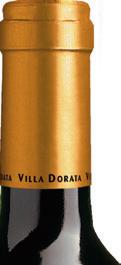
































Mein klang Zweige lt | Qualit ät swein Burgenland 20 08
Listenpr eis CHF 15 .80
Ch ât eau Ba rate t | Bord eaux Supérieur AC 20 08
Listenpr eis CHF 14 .5 0
Vi ny a La ia | Ca talunya DO 20 07
Listenpr eis CHF 14 .80 al r Az in ho | Vinho Re gional Alent ejano 20 08
Listenpr eis CHF 13 .80
Ch ât eau Coulon Sé le ct ion spéc ia le
Corbièr es AC 20 09 | Listenpr eis CHF 12.90
Osot i Ve nd im ia se le cc ionada | Rioja DO Ca 20 08
Listenpr eis CHF 17. 50























Ca nt a Ra si m | Vin de Pay s d‘ Oc 20 09
Listenpr eis CHF 11.5 0
Vi ll a Dorata | Sicilia IG T 20 09
Listenpr eis CHF 11.90
DELSECCO | Deut scher weißer Perlwein, Rheinhessen 2010
Listenpr eis CHF 13 .80
Pa sión De lin at | La Manc ha DO 20 08
Listenpr eis CHF 10 .90
Sa n Vito Ch ia nt i | Chiant i DO CG 20 09
Listenpr eis CHF 11.90
El Mol ino | La Manc ha DO 20 08
Listenpr eis CHF 8. 90






PADMA DIGESTIN® wird traditionell angewendet bei Neigung zu Verdauungsschwäche und Verdauungsstörungen mit Druck- und Völlegefühl in der Magengegend, Blähungen und Appetitmangel (z.B. in der Rekonvaleszenz).
Ungünstige Er nährungsgewohnheiten, Stress, Allergien oder Krankheiten können die Verdauung belasten. Die vielfältige Wirkungsweise der in PADMA DIGESTIN® enthaltenen Pflanzen wärmt und stärkt die Verdauung und bringt sie wieder ins Gleichgewicht. Lesen Sie die Packungsbeilage und lassen Sie sich in Ihrer Apotheke beraten.



Liebe Leserin, lieber Leser
Esgeht bestens ohne Gänseleber, Kaviar und Hummer: Vor mehr als 15 Jahren trat die Tessiner Köchin Meret Bissegger den Beweis an, dass man sich mit vegetarischen Gerichten und selbst gesuchten Wildpflanzen einen Platz in der Spitzengastronomie sichern kann. Heute vermittelt die ehemalige Wirtin des Restaurants Ponte dei Cavalli ihr Wissen an Kräuter- und Kochkursen und bewirtet Gäste in ihrem grossen Haus im Bleniotal. Weshalb ihr bio wichtig, aber nicht sakrosant ist, lesen Sie auf Seite 34.
so gut zu sorgen, wie für Ihr Haustier, dann können Sie schon bald erleben, wie auf dem Balkon Ihr Grünabfall zu Erde wird –und das ohne Gestank.
Sie können schon bald erleben, wie auf dem Balkon Ihr Grünabfall zu Erde wird.
Wer wie Meret Bissegger gerne kocht, tut das heutzutage oft mit eigenen Kräutern vom Fensterbrett und Salaten und Tomaten aus dem Tontopf. Die neue Lust, sein eigener Gemüsebauer zu sein, heisst Neudeutsch Urban Gardening, städtische Landwirtschaft. In Parks, auf brachliegenden Grundstücken und auf Hausdächern versuchen sich umweltbewusste, meist jüngere Menschen als Gemüseproduzenten im kleinen Rahmen. Was liegt da näher, als auch die Erde selbst zu produzieren? Wie Sie auf Seite 28 erfahren, braucht es dazu nur einen Balkon, einen Plastikkübel, Holzlatten und eine Gartenkralle. Wenn Sie zudem bereit sind, für die im Kompost wuselnden Würmer mindestens
Nicht um die kulinarische, sondern um die medizinische Verwendung von Kräutern und Pflanzen geht es im Artikel ab Seite 10. Die Idee, einheimische Heilpflanzen nach den Grundsätzen der chinesischen Medizin (TCM) anzuwenden, ist noch jung. Fachleute sind sich über die Wirksamkeit von West-TCM uneinig, nicht zuletzt, weil sich die beiden Kulturen fundamental unterscheiden. Auch sind die Kriterien für die Einteilung der Wirkkategorien nicht unumstritten. Autorin Isabelle Meier ist dem Thema auf den Grund gegangen und hat mit überzeugten Patienten und Kritikern gesprochen.
Und ja: Spätestens Mitte April sollten wir den Kuckuck wieder rufen hören. Der exzentrische Brutschmarotzer ist der Frühlingsbote schlechthin und überdies ein ausgesprochener Freigeist, wie Sie ab Seite 40 lesen können. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine erspriessliche Lektüre und beschwingte Frühlingstage.
Herzlich

Redaktorin
































Gesundheit
8 Rabiate Methoden: Wie Asthmatiker einst behandelt wurden
9 Risikofaktor Einsamkeit
10 Chinesische Medizin mit einheimischen Kräutern
14 Beissen hilft: Zahnende Babys mögen die Veilchenwurzel
22 Heinz Knieriemen über Drogenlust und -elend
Beratung
18 Sabine Hurni beantwortet Leserfragen
Haus & Garten
26 Heikler Fischkonsum
27 Biolandfläche wächst
28 Kompostieren auf dem Balkon
30 Remo Vetter: Die neuen Gärtner in der Stadt
34 Biologisch, aber nicht dogmatisch: Die Naturküche von Meret Bissegger
Natur
39 Die Sterne an Ostern
40 Dreist und doch beliebt: der Frühlingsbote Kuckuck
44 Idyllischer Kraftort: die Quelle der Areuse
Leben
48 Indianer und ihre Beziehung zu Tieren



49 Sprachferien im Naturpark
50 Wenn einer nicht genügt: Polyamory weckt Lust und Misstrauen
54 Unersetzlich: 2011 ist das europäische Freiwilligenjahr
Rätsel
58 Leserangebot
Agenda
Markt 65 Vorschau
66 Carte blanche
präsentiert im April-Newsletter den Öko-Anlagetipp

Abonnieren Sie jetzt kostenlos den Newsletter von «natürlich». Bitte geben Sie uns unter natuerlich-online.ch/newsletter Ihre E-Mail an. Und schon erhalten Sie regelmässig:
■ wertvolle Gesundheitstipps aus der Natur
■ nützliche Ratschläge bei Fragen zu Natur und Garten
■ exklusive Angebote zu Vorzugspreisen
■ immer wieder Neues aus der «natürlich»-Welt.


Werbung im «natürlich» «natürlich» 2-11
Herzlichen Dank für die sehr schönen Artikel zum Thema Polarlichter, Demeter-Landwirtschaft, Meister des Augenblicks und nicht zuletzt über die Amsoldinger Auenlandschaft. Anzumerken bleibt jedoch ein äusserst unpassendes Detail auf Seite 29 des Artikels über Demeter: Die Werbung ausgerechnet für einen Konzern wie Novartis hätte unpassender nicht platziert werden können. In Kenntnis des Gesamtkonzeptes dieser Firma nützt es auch nichts, wenn das beworbene Produkt (angeblich) natürlich sein soll. Es erscheint so oder so völlig unglaubwürdig, wenn sich dieser Konzern des Begriffs «natürlich» bedient…
Mit derartiger Werbung erweisen Sie der Glaubwürdigkeit Ihrer Zeitschrift einen absoluten Bärendienst. Werbung für Chemie-Konzerne oder ähnlich unnatürlich agierende Firmen hat im «natürlich» nichts, aber auch rein gar nichts zu suchen. Matthias Bacher, Bern
Schneeschuhwanderung «natürlich» 1-11
Da wird im Heft zu schöner Schneeschuhwanderung in intakter Landschaft im Appenzell angeregt. Allerdings passt das nicht so recht zu den Seiten zum Thema Wildtierkorridore. Natürlich sind das zwei verschiedene Dinge. Aber ich finde es trotzdem schade, dass mehr und mehr unberührte Landschaften mit immer neuem sogenannten Sport eben auch zerstört werden. Gerade weil man weiss, dass Wildtiere im Winter keine zusätzliche Strapazen ertragen und eben auch nicht durch Schneewanderer gestört werden sollten.
Heidi Berger, Biel
Briefe an «natürlich»
Fleischlos glücklich «natürlich» 1-11
Schon verschiedentlich habe ich gelesen, dass Vitamin B12 nur in tierischen Produkten vorkommt, so auch im «natürlich». Für mich kommt B12 – wenn auch nur wenig – in Panaktiv, flüssige Bierhefe, vor. Ich nehme das mit Orangen-/Zitronensaft sowie Muttersaft zum Frühstück ein. Weiter ist B12 auch in Quinoa und der alten Kulturpflanze Amaranth zu finden. Die richtige Ernährung ist sehr wichtig. Wir sind alle verschieden, deshalb ist nicht immer das selbe für alle gleich gut. Darum ist es wichtig, seine Krankheit nicht einfach beim Arzt «abzugeben», sondern sich selbst zu informieren und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Dorothea M. Raabe, Zürich
Die Antwort ist teilweise ungenau: Vitamin D stellen wir zum grössten Teil selber her, indem wir unsere Haut vom Tageslicht beleuchten lassen. In unseren Breitengraden genügen bereits 10 Minuten Tageslicht auf Hände und Gesicht. Zudem hat es in Avocado und Pilzen pflanzliches Vitamin D. Bezüglich der Vitamin-B-Verbindungen stellt sich bei Vegetariern kein Problem dar, da es davon reichlich in grünem Blattgemüse, Vollkornprodukten, Bohnensprossen, Bananen und Weinbeeren hat, um nur einige zu nennen. Auch Vitamin B12 kommt nicht ausschliesslich in tierischen Produkten vor, sondern an tierischen und pflanzlichen Produkten. Um es im Körper verwenden zu können, brauchen wir jedoch einen intakten Intrinsic-Faktor im Magen. Da sich Fleischesser diesen häufiger kaputt machen, haben gerade sie am meisten Vitamin-B12-Mangel vorzuweisen. Monika Beetschen, Sornetan
Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik sind willkommen. Die Leserbriefe müssen mit der vollständigen Adresse versehen sein. Die Redaktion behält sich vor, Briefe zu kürzen. Schicken Sie Ihren Brief per E-Mail, Post oder Fax an: leserbriefe@natuerlich-online.ch oder: «natürlich», Leserbriefe, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau, Fax 058 200 56 51

Wenn es einen Exper ten fü rz eitlose Schönheit gibt, da nn die Natur.
REGENERIERENDE PFLEGE FÜR DIE HAUT AB 40. Die Granatapfel Straffende Gesichtspflege mindert Falten und aktiviert die Hautregeneration. Ihre antioxidative Wirkung verbessert Elastizität und Spannkraft der Haut. Probieren Sie auch die regenerierende Körperpflege: Sie regt die Zellerneuerung an und beugt so vorzeitiger Hautalterung vor.Mehr Informationen unter www.weleda-granatapfel.ch


Mitfeiern und gewinnen auf weleda.ch

Asthmatiker litten anfangs des letzten Jahrhunderts nicht nur an Atemnot. Die damaligen Heilungsversuche muten aus heutiger Sicht kurios an und verlangten von Kranken grosse Leidensbereitschaft.
Längst nicht alles, was die heutige Medizin leistet, sollte kritiklos bejubelt werden. Blickt man jedoch in die Vergangenheit, überkommt einen das nackte Grauen. Während Asthmapatienten heute eine Palette von schmerzfreien Behandlungsmöglichkeiten haben, wurde anfangs des 20. Jahrhunderts mit der gleichen Diagnose gelitten – und experimentiert. So injizierten Ärzte in den 1930er-Jahren den Patienten schwefelhaltige Substanzen, worauf diese starkes Fieber bekamen, das Asthma aber keineswegs verschwand. Andere Ärzte spritzten Kokain in einen Nervenknoten beim Brustwirbel, wie die Fach-
zeitschrift Ars Medici berichtet. Als letzte Lösung wurden die Kranken mit Chloroform in Vollnarkose gesetzt; einer Chemikalie, die Krebs erzeugen kann, Gehirn, Leber, Herz und weitere Organe schädigt, damals aber erfolgreich als Narkotikum eingesetzt wurde. Eine Tortur war auch die Insulin-Schocktherapie: Dem Patienten wurden zwei Wochen lang täglich höher werdende Mengen von Insulin gespitzt, so lange bis die Atembeschwerden nachliessen. Was meist dann der Fall war, wenn die Kranken aufgrund der Überdosierung dem Tode nahe waren. Eine rasch verpasste Dosis Zuckersirup bewahrte sie davor. Nichts-
destotrotz war die Methode erfolgreich, weil die Asthmaschübe nach der Schocktherapie tatsächlich ausblieben. Weshalb, wussten die Mediziner aber selbst nicht genau. Später versuchte man der Krankheit auch mit dem Skalpell zu Leibe zu rücken: Je nach Fall wurden den Patienten in Lokalanästhesie unterschiedliche Nerven im Halsbereich entfernt. Als Kollateralschaden mussten diese einen chronischen Schnuppen sowie durch beschädigte Nerven Sehstörungen und das Herunterhängen des Augenlids in Kauf nehmen. tha
Blutdruck_ Einsamkeit tut nicht gut

Sind Menschen einsam, wirkt sich das ungünstig auf den Blutdruck aus. Dies haben Wissenschaftler in Chicago festgestellt. Anlässlich einer Studie über das Altern haben sie während vier Jahren Frauen und Männer zwischen 50 und 68 Jahren untersucht und sie auch ausführlich zu ihren sozialen Kontakten befragt. Dabei stellten sie fest, dass sich der Blutdruck derjenigen Probanden, die am einsamsten waren, am stärksten erhöhte. Die Forscher bezeichnen Einsamkeit als eigenständigen Risikofaktor für Bluthochdruck, wie focus.de schreibt. tha
Forschung_ Harte Tastatur – schlecht für Sehnen
Wer viel auf dem Computer schreiben muss, sollte auf eine gut eingestellte Tastatur mit weichem Anschlag achten. Grund: Ist der Widerstand beim Tippen zu gross, benötigt man zusätzliche Kraft im Unterarm, was zu chronischen Beschwerden führen kann. Forscher der ETH Zürich fanden heraus, dass mit zunehmendem Widerstand die Unterarmmuskulatur stärker beansprucht wird. Das betraf jedoch nicht wie erwartet die Beugemuskulatur der Hand, sondern vor allem die Streckmuskulatur. Vermutlich wird bei einer harten Tastatur mehr Kraft benötigt, um das Gelenk zu stabilisieren. Dies kann bei längeren Arbeiten zu Entzündungen wie etwa einem Tennisarm führen. MM


Medikamente_ Vorsicht bei Grapefruit
Ernährungsexperten machen darauf aufmerksam, dass sowohl der Saft als auch das Fruchtfleisch der Grapefruits die Wirksamkeit bestimmter Medikamente beeinflussen, und zwar verstärken als auch vermindern können. Wer also regelmässig Medikamente einnimmt und Grapefruits isst, sollte Informationen beim Arzt einholen. Und nicht vergessen: Zitrusfrüchte können den Zahnschmelz angreifen, deshalb nach dem Verzehr nicht gleich zur Zahnbürste greifen. rbe
Von Natur aus gesund

Braucht Ihre Verdauung Unterstützung?


8 sich ergänzende probiotische Bakterienstämme zur Unterstützung Ihrer Ve


nur 1x täglich
3 Milliarden probiotische Bifidobakterien und Laktobazillen Verdauung neu

hier abtrennen und einsenden










BactoSan® pro FOS ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Erhältlich in Apotheken und Drogerien.







Ja, ich möchte BactoSan® pro FOS testen. Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich ein Mustersachet mit detaillierten Informationen.
Name, Vorname:
Strasse, Nr.: PLZ, Ort: Gratismuster
Biotan AG •Blegistrasse 13 •6340 Baar •Telefon 041 760 33 70 •www.biotan.ch
Ihre Angaben werden ausschliesslich von Biotan AG bearbeitet und nicht an Dritte weitergegeben. (natürlich leben)

Was hat das Maiglöckchen mit der Chinesischen Medizin zu tun? Viel, sagen West-TCM-Heilpraktiker. Statt mit chinesischen Kräutern behandeln sie ihre Patienten mit heimischem Bohnenkraut, Fenchel und Enzian.
Text Isabelle Meier

Der Peterli wärmt das Yang, bewegt das Blut und vertreibt WindKälte. Pfefferminze tonisiert das Qi und reduziert das Feuer. Kamille reguliert das Qi, beruhigt den Geist und eliminiert Hitze. Was haben unsere vertrauten Kräuter hier zu suchen, fragt man sich im ersten Moment, wenn man im kürzlich erschienen «Praxisbuch Westliche Heilkräuter und Chinesische Medizin» blättert. Für die Autoren Ulrike von Blarer Zalokar und Peter von Blarer ist der Zusammenhang zwischen der Chinesischen Medizin (TCM) und den hiesigen Pflanzen aber ganz selbstverständlich. «Die Prinzipien der Traditionellen Chinesischen Medizin lassen sich problemlos auf unsere Kräuter übertragen», sagt Peter von Blarer.
Die beiden haben sich ganz der Therapie mit hiesigen Kräutern verschrieben, die sie nach TCM anwenden. Das funktioniert so: Kommt ein Patient, wird erst einmal eine TCM-Diagnose gestellt. Dabei wird der Patient befragt, sein Puls befühlt und die Zunge betrachtet. Die Diagnose klingt dann vielleicht so: Der Patient leidet an einem Nieren-Yang-Mangel. Oder an einem Lungen-Qi-Mangel. Oder an einer feuchten Hitze in der Gallenblase.
Klassische TCM-Therapeuten verschreiben dann eine Rezeptur aus chinesischen Kräutern. West-TCM-Heilpraktiker hingegen wählen westliche Kräuter aus, die zum Beispiel das Yang wärmen, das Qi regulieren oder Hitze eliminieren sollen.
Welches Kraut hat welche Eigenschaft?
Nach Traditioneller Chinesischer Medizin werden allen Kräutern eine Temperatur (heiss, warm, neutral, kühl, kalt), einen Geschmack (süss, sauer, scharf, salzig, bitter,
neutral), ein Organ, Eigenschaften (zum Beispiel schleimlösend, schweisstreibend, verdauungsfördernd) und Wirkungskategorien (Qi regulieren, Blut bewegen und so weiter) zugeteilt.
Nur: Wer bestimmt, welche Wirkungen und welche Eigenschaften die Pflanzen haben? Ulrike von Blarer Zalokar und Peter von Blarer stützen sich in ihrem Buch auf rund 50 Quellen von Phyto-WestTCM-Heilpraktikern auf der ganzen Welt sowie auf ihre eigenen Erfahrungen. Einig sind sich diese Quellen nicht immer. «Doch auch in China sind die Erfahrungen nicht so einheitlich, wie wir uns das gerne vorstellen», erklärt Peter von Blarer. West-TCM kam vor rund 15 Jahren in die Schweiz. Der Belgier Francois Ramakers erzählte an einer TCM-Weiterbildung in Aarau, wie er europäische Kräuter nach den Prinzipien der chinesischen Medizin anwendet. Seine Idee fiel auf fruchtbaren Boden, nicht zuletzt auch, weil es viel praktischer war, Kräuter einzusetzen, die hier wachsen. Der Import von chinesischen Kräutern war kompliziert, es gab Verunreinigungen und bei einigen Substanzen auch ethische Bedenken (zum Beispiel bei der Bärengalle, die heute in er Schweiz nicht mehr eingesetzt wird). Die westlichen Kräuter wachsen im Garten oder man findet sie beim Spaziergang. «Alle Kräuter sind nach den Kriterien der TCM einteilbar, ob sie nun in China wachsen oder in den Schweizer Alpen», sagt Peter von Blarer. «Jene aus der Schweiz sind uns einfach näher, viele von uns kennen die Pflanzen von Kindsbeinen an». Wenn hiesige Kräuter eingesetzt werden, stellt sich aber die Frage, wozu es dann die Traditionelle Chinesische Medizin noch braucht. Dass bei einer Erkältung

Was ist Phyto-West-TCM?
Phyto-West-TCM ist eine neue Richtung innerhalb der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Sie nutzt diejenigen Kräuter, die bei uns im Westen wachsen. Sie werden als Alternative zu den chinesischen Heilkräutern nach den TCM-Kriterien (Geschmack, Temperaturverhalten, Organbezug, Wirkungskategorien) betrachtet und in Form von Tinkturen und Tee eingesetzt. Die Phytotherapie-West-TCM wird oft mit Akupunktur, Ernährungsempfehlungen oder Shiatsu kombiniert. Sie kann aber auch als Einzeltherapie eingesetzt werden.
Anfangs wurde das West-TCM-Konzept von traditionellen TCM-Anhängern belächelt –und wird es teilweise noch immer. Heute arbeiten erst wenige TCM-Heilpraktiker mit westlichen Kräutern. An der Heilpraktikerschule Luzern, der führenden Ausbildungsstätte für West-TCM, wurden bis jetzt 72 Therapeuten in Phyto-West-TCM ausgebildet. Dieses Jahr erfolgt die erste europäische Verbandsprüfung, organisiert von der Schweizerischen Berufsorganisation für TCM.

Salbei hilft, sagt auch die westliche Kräutermedizin. Braucht es wirklich einen Befund wie «Wind-Kälte» oder «WindHitze»? «Die Diagnose nach Traditioneller Chinesischer Medizin ist differenzierter, entsprechend kann man die Tinktur besser auf die Beschwerden abstimmen», erklärt Cornelia Matter, TCM-Heilpraktikerin aus Seengen im Aargau. Seit sechs Jahren arbeitet sie mit westlichen Kräutern. Auch Peter von Blarer sagt: «Die chinesische Medizin hat ein ganz eigenes Verständnis davon, wie der Mensch funktioniert. So ist nicht bei jeder Erkältung Salbeitee angesagt.» Schnupfen ist nicht gleich Schnupfen: Die chinesische Medizin unterscheidet verschiedene Ursachen einer Erkältung, die sich unterschiedlich manifestieren. Eine laufende Nase mit klarem Schleim wird beispielsweise mit wärmenden Kräutern wie Zimt und Ingwer behandelt, ein Schnupfen mit dickerem, gelbem Schleim deutet eher auf «Wind-Hitze» hin und wird mit Minze und Rotem Sonnenhut behandelt.
Skepsis gegenüber den Wirkkategorien
Der Winterthurer Martin Koradi, Dozent für Phytotherapie, ist zwar von der Heilkraft der Pflanzen überzeugt. Doch er ist
skeptisch, was die Einteilung unserer Pflanzen in die chinesischen Wirkkategorien betrifft. «Die Frage ist, ob diese Zuschreibungen wirklich etwas mit der Pflanze und ihrer Wirkung zu tun haben. Oder ob die gesehene Qualität nicht viel eher von einer Person oder Kultur dort hineingelegt wird», sagt er. Zwischen chinesischem und westlichem Denken gebe es zudem fundamentale Unterschiede. «Je mehr ich glaube, von diesen Unterschieden verstanden zu haben, desto stärker wird mein Eindruck, dass die Schwierigkeiten dieses Transfers unterschätzt werden, auch in der Heilkunde», erklärt Koradi.
Der Wädenswiler TCM-Therapeut Simon Becker, langjähriger Präsident der Schweizerischen Berufsvereinigung TCM, ist Phyto-West-TCM gegenüber aufgeschlossen. Doch auch er gibt zu Bedenken: «Den chinesischen Kräutern liegen mehr Erfahrungen zugrunde und wir wissen etwas klarer, wo sie wirken und wo nicht. Diese Erfahrungen sind bei der West-TCM noch geringer und müssen in den kommenden Jahren noch gesammelt werden.» Er glaubt zwar, dass West-TCM in zehn Jahren relativ verbreitet praktiziert werden. «Die chinesische Arzneitherapie wird sie allerdings kaum ersetzen», meint er.
Für viele chinesische Kräuter gibt es ein westliches Gegenstück.
Auch Peter von Blarer räumt ein, dass die Erfahrungen noch begrenzt sind. Doch die Erfolge, die er erzielt, überzeugen ihn. «Meine Patienten und ich sind mit dem therapeutischen Erfolg immer wieder sehr zufrieden», meint er. Auch West-TCMHeilpraktikerin Cornelia Matter sagt: «Besonders Erkältungen, Heuschnupfen, gynäkologische Beschwerden und MagenDarm-Probleme habe ich erfolgreich behandeln können.»
Regula Campagnoli hat West-TCM ausprobiert. Ihr Leben lang litt die 41-Jährige an vereiterten Mandeln. Ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt erklärte ihr vor Jahren, dass sie wohl ständig daran leiden werde. Wenn sie die Mandeln entfernen liesse, verlagere sich das Problem, so der Arzt. Ausserdem litt sie an einem «Extremschlaf»: «Ich fiel dabei fast ins Koma», erzählt sie. Auch nach zehn Stunden schlafen, hörte sie den Wecker nicht. Der Heilpraktiker stellte bei ihr eine LungenQi-Schwäche mit feuchter Hitze in Leber und Gallenblase mit Feuer und Toxin-Belastung sowie Qi-Stagnation fest. Täglich nahm sie drei Mal eine Kräuter-Tinktur, bestehend aus Alant, Färberhülse, Berberitze, Kurkuma, Engelwurz, Schafgarbe und Süssholz. «Nach einer Woche hörte ich den Wecker wieder und nach zwei Wochen war ich am Morgen fit und munter», sagt sie. Etwas länger dauerte es, bis auch ihre Mandelprobleme verschwanden, wie sie erzählt. Nach einem Monat waren aber auch diese weg. «Ich hatte seither nie mehr Eiter auf den Mandeln». u
Ulrike von Blarer Zalokar und Peter von Blarer: «Praxisbuch Westliche Heilkräuer und Chinesische Medizin», Bacopa Verlag 2010.
Ulrike Zalokar: «Essenz aus der Küche, Kuhmilch- und Weizenfrei nach den 5 Elementen», Heilpraktikerschule
Peter Holmes: «The Energetics of Western Herbs», 1989, Band I und II
























NEU: NIVEA PURE & NATURAL FÜR KÖRPER UND HÄNDE



• Wertvolles Bio Argan Öl pflegt trockene Haut intensiv und schütz t sie vor dem Austrocknen
• Ohne Parabene, Silikone, Farbstoffe und Mineralöle
































































































Die Backen sind rot, der Mund ist voller Speichel und das Baby quengelig. So erleben Eltern ihre Kinder, wenn die ersten Zähne hervorbrechen. Sowohl für die Eltern wie auch für die Kinder ist dies eine anstrengende Zeit.
Text Sabine Hurni

Solange das Baby sich ausschliesslich von Muttermilch ernährt, braucht es keine Zähne. Im Gegenteil: Mithilfe der zahnlosen Zahnleisten presst der Säugling die Milch aus der Brust. Nach meistens sechs Monaten, mit dem Wechsel zur festen Nahrung, stossen dann die ersten Zähne durch. Ihr Fundament, die feinen Zahnknospen, bildet sich bereits im Mutterleib. Nach der Geburt werden diese
In der traditionellen Volksheilkunde ist die Veilchenwurzel ein bekanntes Beissmittel.
Zähnchen immer grösser, bis sie schliesslich aus dem Kiefer in die Mundhöhle vorstossen.
Zähne sind wichtig für die Verdauung. Dank ihnen sind wir in der Lage, die Nahrung mechanisch zu verkleinern. Der beim Kauen gebildete Speichel macht den Nahrungsbrei gleitfähig und bereitet ihn so für den Weitertransport in die Speiseröhre vor. Ein bis eineinhalb Liter Flüssigkeit produzieren die Speicheldrüsen täglich und geben sie in die Mundhöhle ab. In diesem Sekret sind bereits Verdauungsenzyme enthalten sogenannte Amylase, sie spalten Kohlenhydrate in ihre kleinsten Bausteine, die Oligosaccharide. Dieser Zuckerbaustein lässt Kohlenhydrate wie zum Beispiel Brot süsslich schmecken, wenn man sie längere Zeit kaut.

Zahnpflege bei Kindern
Bis es allerdings so weit ist, müssen bei den Säuglingen erst einmal 20 Milchzähne durch die Zahnleisten brechen. In der Regel bricht zuerst der untere, mittlere Schneidzahn durch. Ungefähr zwischen dem zehnten und zwölften Lebensmonat kommen dann die oberen Schneidezähne, bis im zweiten Lebensjahr meistens 16 Zähne aus dem Kindermund lachen. Sind bis ins Alter von zweieinhalb Jahren auch noch die Backenzähne durchgebrochen, ist das Milchzahngebiss komplett.
Beissen schafft Linderung
Für einen Teil der Kinder ist der Zahndurchbruch eine Leidenszeit: Das Zahnfleisch ist gerötet und geschwollen. Oft ist auch der Po wund. Die Kinder haben Schmerzen, sind unruhig, fiebern leicht und schlafen schlecht. Damit die Zahnungsphase, die mit keinem Mittel verkürzt oder beschleunigt werden kann, den Kindern etwas leichter fällt, können Eltern aber einiges tun. Nur schon eine leichte Massage des geschwollenen Zahnfleisches mit dem Finger wird von den Kindern oft als lindernd empfunden. Auch harte und kühlende Gegenstände nehmen die Kleinen in dieser Zeit gerne in den Mund.
In der traditionellen Volksheilkunde ist die Veilchenwurzel ein bekanntes Beissmittel. Die harte Wurzel stammt aus dem
Milchzähne sind besonders anfällig auf Karies, weil bei ihnen der harte Zahnzement fehlt. Sobald der erste Zahn da ist, muss dieser deshalb geputzt werden. Zudem sollte eine dauernde Einwirkung von zuckerhaltigen Nahrungsmitteln unbedingt vermieden werden. Das beständige Nuckeln am Fläschchen mit gezuckertem Tee, Säften oder Milch, die gerne zum Einschlafen gegeben werden, führen sonst zu schweren, kariösen Milchzahnstörungen. Karies an den Milchzähnen gehen oft auf die zweiten Zähne über. Obwohl sie ausfallen, brauchen auch die Milchzähne unbedingt eine sorgfältige Pflege.
«natürlich» im TV



Die Sendung «Gesundheit» mit «Erste Hilfe aus der Natur» auf Tele M1 und Tele 1. Montag, ab 18.20 Uhr, mit stündlicher Wiederholung und auf Tele 1 ab 18.40 Uhr. Montag bis Sonntag gemäss Wochenprogramm.
_ Weitere Infos und Video: www.natuerlich-online.ch

Anwendung
Wie beim Beissring oder beim Bernsteinkettchen ist es gut, wenn das zahnende Kind die Veilchenwurzel schnell zur Hand hat. Aus diesem Grund gibt es die Wurzel im Handel oft mit einem Loch oder einer Vertiefung zu kaufen. So können sie die Eltern an eine Schnur binden. Idealerweise ist die Veilchenwurzel aus kontrolliert biologischem Anbau, damit sie frei von Pestiziden ist. Bevor sie das Kind in den Mund nimmt, sollte die Wurzel etwa 10 Minuten in Wasser gekocht werden. Dies sollte ab und zu wiederholt werden, um Keime und Bakterien abzutöten. Ist die Wurzel stark abgenutzt, sehr verschmutzt oder beschädigt, sollte sie ersetzt werden.
Das erleichtert dem Kind das Zahnen Beissen: Kinder mögen feste Gegenstände, um darauf herumzubeissen. Das kann ein Beissring oder eine harte Brotrinde sein. Aber Achtung: die Gegenstände müssen ausreichend gross sein, damit sie nicht verschluckt werden können. Beissringe aus Gummi lagern die Eltern am besten im Kühlschrank. So kühlt er gleichzeitig das leicht entzündete Zahnfleisch.
Leicht betäuben: In der Drogerie und der Apotheke sind kühlende, schmerzlindernde Zahngels erhältlich. Sie enthalten Lidocain, ein sogenanntes Lokalanästhetikum, das an der Hautoberfläche die Schmerzempfindung hemmt.
Mit Homöopathie lindern: Bei akuten Beschwerden schwören viele Eltern auf homöopathische Heilmittel. Chamomilla zum Beispiel ist bei sehr schmerzhafter Zahnung angezeigt. Calcium fluoratum wird eingesetzt, wenn die Zähne nicht durchkommen und Magnesium phosphoricum hilft besonders gut, wenn die Zahnungsschmerzen mit Erschöpfung und grosser Erregung einhergehen. Weil oft
verschiedene Faktoren zusammenkommen, decken gerade Komplexmittel ein breites Spektrum ab.
Energetische Steine: Man sagt dem Bernstein eine beruhigende Wirkung nach. Er lindert bei den Kindern leichte Fieberschübe und beschleunigt das Abheilen von Halsweh, Asthma, Allergien und Ekzemen. Auch bei Erwachsenen wurden gute Erfolge bei Migräne, Gicht, Rheuma, Gelenkentzündungen und Allergien beobachtet. Wie auch alle anderen Heilsteine sollte man auch den Bernstein regelmässig entladen, indem man ihn für ein paar Sekunden unters fliessende Wasser hält und ihn anschliessend an der Luft trocknen lässt. Luft und Licht laden ihn langsam wieder auf.
Wickel: Fusssohlenwickel mit Zwiebeln wirken beruhigend und leiten überschüssige Energie aus dem Kopfbereich ab. Beruhigende Heilpflanzen: Die empfindliche Mundschleimhaut kann mit Kamillentee oder Salbeitee betupft werden. Die Notfalltropfen der Blütenessenzen nach Bach können die Wirkung des Tees noch verstärken.
Wurzelstock der Schwertlilie (Iris germanica). Die Schwertlilie ist eine mehrjährige Pflanze mit kräftigem, kriechendem und verzweigtem Wurzelstock. Die Blätter sind schwertförmig, was ihr zum Namen verholfen hat. Im Frühling erscheinen auf etwa 80 Zentimeter hohen Stängeln die typischen Blüten mit violetten Hängeblättern und lilafarbenen Domblättern. Wegen ihres Geruchs wurde die Droge offenbar bereits in der Antike geschätzt. Ursprünglich wurden sie als Zierpflanze aus dem Mittelmeerraum eingeführt. Da sie sich aber über die Wurzelstöcke vermehrt, ist sie in den Burgund Klostergärten verwildert. Heute wird die Veilchenwurzel vor allem aus Marokko und Italien importiert.
Die Wurzeln der Schwertlilie enthalten Isoflavone, ätherische Öle und aromatische Aldehyde. Der typische Veilchenduft kommt durch das ätherische Öl Iron zustande. Es entwickelt sich erst nach zwei bis drei Jahren Lagerungszeit des getrockneten Wurzelstocks. Die Veilchen oder Iriswurzlen enthalten zudem bis zu 50 Prozent Schleimstoffe. Deshalb dient die Veilchenwurzel seit eh und je auch als Expektorans, als schleimlösendes Hustenmittel. In der Regel wird das Heilmittel aber nicht als Einzeldroge verwendet, sondern ist Bestandteil in Hustentees. Das Pulver diente früher als Puder für Haare und Perücken. All das kümmert die zahnenden Kinder nicht: Sie kauen einfach gerne auf der harten Wurzel herum. Man geht davon aus, dass Veilchenwurzeln eine betäubende, schmerzstillende und entzündungshemmende Wirkung haben. Die Wirkstoffe gehen beim Kauen auf das Zahnfleisch über und entfalten dort ihre Wirkung. Viele Eltern geben ihren Kindern lieber ein solches Naturprodukt, als einen Beissring aus Plastik. Aus hygienischen Gründen sollte die Veilchenwurzel regelmässig abgekocht werden, dabei gehen aber auch Wirkstoffe verloren. u





































Haben Sie Fragen?
Sabine Hurni, Drogistin HF und Naturheilpraktikerin mit Fachrichtung Ayurveda und Phytotherapie, und das kompetente «natürlich»-Berater-Team beantworten Ihre Fragen zu Gesundheit, Ernährung, Ökologie, Garten oder Natur.
Senden Sie Ihre Fragen an: sabine.hurni@natuerlich-online.ch oder «natürlich», Leserberatung Neumattstrasse 1, 5001 Aarau
Rat & Tat per Internet Fragen können Sie auch auf unserer Website www.natuerlich-online.ch stellen. Das «natürlich»-Berater-Team ist unter der Rubrik «Berater» online für Sie da.
Nüsse unter der Lupe
Wir assen regelmässig Baumnüsse vom Bauer. Plötzlich stellten wir fest, dass ganz dünne Fäden an einzelnen Nüssen zu sehen waren und begannen, die Nüsse im Zweifelsfall mit der Lupe zu betrachten und wegzuwerfen. Wir kauften danach im Warenhaus abgepackte Nüsse aus Frankreich. Auch dort waren, in vermindertem Mass, diese Fäden sichtbar. Haben wir überreagiert? G. F., Teufen
Erst mühsam aufknacken und dann alles wieder wegwerfen ist schon ziemlich frustrierend. Aber es ist leider so, dass ein pelziger Überzug auf den Nüssen bedeutet, dass sich Schimmel gebildet hat. Insofern haben Sie richtig gehandelt. Das Bundesamt für Gesundheit muss uns warnen, wenn es eine gefährliche Substanz wie zum Beispiel die Aflatoxine der Schimmelpilze in einem Lebensmittel findet. Oft habe ich allerdings das Gefühl, ich müsste die Weisung für mich persönlich etwas relativieren. Ich darf mich selber entscheiden, welchen Risiken ich mich aussetze und welche ich bewusst meide. Ich möchte die Thematik mit den Schimmelsporen nicht herunterspielen. Die Schimmelfäden sind wirklich nicht gesund. Sie können, in grösseren Mengen eingenommen, das Krebsrisiko erhöhen. Das heisst aber

nicht, dass Sie bald nach dem Konsum von Aflatoxinen an Krebs sterben werden. Oft bildet sich der Schimmel aufgrund falscher Lagerung oder ungenügender Trocknung der Nüsse. Wenn Sie auch dieses Jahr wieder Nüsse beim Bauer beziehen, sollten Sie diese unbedingt in Holzkisten oder in einem Netz aufbewahren, damit genügend Sauerstoff dazukommt. Auf keinen Fall in Plastiksäcken oder Kunststoffdosen lagern, es sei denn, die Nüsse sind bereits geschält. Dann können sie in verschlossenen Gefässen gelagert und sollten innert drei Monaten konsumiert werden. Es ist manchmal ein Segen, dass wir in der heutigen Zeit so viele Möglichkeiten haben, die Dinge zu untersuchen und deren Folgen abzuschätzen. Früher hätte man die Nüsse einfach gegessen. Wir haben das Privileg, zu essen, worauf wir Lust haben. Wir können uns durch ausgewählte Speisen gesund halten – oder krank essen – und setzen uns gleichzeitig Stress, Umweltbelastungen und Nikotin aus. Sabine Hurni
Ich esse jeden Morgen VollkornBraunhirsemehl im Müesli. Nachdem ich den Artikel über Hirse im «natürlich» (10-2010) gelesen habe, war ich verunsichert. Kann man die in der Hirse enthaltene Oxalsäure unschädlich machen? J. Sch., Unterlunkhofen
Es ist immer etwas heikel, ein Lebensmittel auf einzelne Inhaltstoffe zu reduzieren. Ein Lebensmittel wirkt stets in seiner Ganzheit. Der Körper kann anders damit umgehen, als wenn Sie die Oxalsäure als Einzelsubstanz einnehmen würden. Oxalsäure kommt auch in der Rhabarber vor. Das Meiste davon in den Blättern, weshalb nur der Stiel nach dem Kochen zum Verzehr geeignet ist. Gleichzeitig enthält Rhabarber auch Zitronensäure, welche die Steinbildung in den Nieren verhindert. Zu finden ist die Oxal-



Gönnen Sie sich ein Jahr lang die Zeitschrift «Bioterra» für nur Fr.55.– statt Fr.70.–


GÄRTNERN GESTALTEN GENIESSEN GOURMET-GEMÜSE: 'ACHT-WOCHEN-NÜDELI' DELIKATE KNOLLEN REZEPTE: FIT MIT FRISCHEN SÄFTEN VON HILTL FRAUENPOWER GARTENWERKZEUGE FÜR SIE! NARZISSEN : FRÜHLINGSFREUDE PUR! Zu Besuch im Jardin de Berchigranges


•Porträts besonderer Gärten
• Know-how und Ideen für den Bio- und Naturgarten
•Kostenlose Gartenberatung
•Exklusive und saisonale Leserangebote
•Gartenkurse und Events
•Rezepte für genussvolle Bioküche
•Tipps für nachhaltigen Lebensstil
•Engagement für ein Bioland Schweiz
BESTELLEN SIE JETZT: Tel. 044 454 48 48 E-Mail: service@bioterra.ch

säure zudem in Sauerklee, Sauerampfer, Mangold, Spinat, Kakao und Schokolade. Einzig wenn sich jemand einer Eisentherapie unterzieht, sollte er mit den oxalsäurehaltigen Lebensmitteln etwas vorsichtig sein und diese nicht gleichzeitig mit dem Eisenpräparat einnehmen. Die Oxalsäure erschwert die Aufnahme von Eisen im Darm.
Ich nehme an, Sie geben das Braunhirsemehl bereits seit längerer Zeit ins Müesli. Solange Sie nach dem Verzehr des Müeslis keine Bauchschmerzen, starke Blähungen oder sonst ein Unwohlsein verspüren, sehe ich keinen Grund, auf die Braunhirse zu verzichten. Es sind so viele Mineralstoffe, Vitamine und Ballaststoffe darin enthalten, dass Sie Ihrem Körper damit nur Gutes tun. Falls Sie zudem Früchte ins Müesli geben, nehmen Sie gleichzeitig auch Zitronensäure auf, welche die Oxalsäure neutralisiert. Wenn Sie die Menge so beibehalten und das Hirsemehl als Ergänzung zur üblichen ausgewogenen Ernährung betrachten, dann brauchen Sie sich keine Sorgen um das Kalzium oder die Nierensteine zu machen. Sabine Hurni
Einweichen und sofort verwenden
Muss man eingeweichtes geschrotetes Dinkelkorn in den Kühlschrank stellen? E. L., St. Gallen
Grundsätzlich sollte man geschrotetes, eingeweichtes Getreide sofort verwenden und gar nicht erst aufbewahren, da sonst wertvolle Nährstoffe verloren gehen. Fertig eingeweichtes Korn ist zum sofortigen Verzehr oder zur Weiterverarbeitung (kochen, backen) gedacht. Sollte es jedoch einmal zu zeitlichen Verzögerungen kommen, ist es aus hygienischen Gründen sinnvoll, das bereits eingeweichte Getreide im Kühlschrank aufzubewahren – jedoch nur für kurze Zeit. Die Zubereitung von Vollgetreide gibt immer wieder Anlass für Fragen. Nicht zu Unrecht, denn unsachgemässe Zubereitung von Getreide kann zu Unverträglich-
keiten und Mangelerscheinung führen. Phytinsäure, ein Stoff in den Randschichten des Vollgetreides, schützt das Korn vor Schädlingen, verhindert jedoch die Aufnahme verschiedener Mineralstoffe im menschlichen Darm. Das Getreide enthält aber auch ein Enzym zum Abbau der Phytinsäure, die Phytase. Diese wird aktiv, sobald das Korn mit Wasser in Kontakt kommt. Bei Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad Celsius braucht dieser Vorgang beim ganzen Korn etwa 18 Stunden. Temperaturen unter 20 Grad Celsius verlangsamen diesen Prozess, Temperaturen über 30 Grad Celsius verhindern ihn sogar. Das vorherige Schroten oder Mahlen des Vollgetreides verkürzt den Vorgang. Bei der Weiterverarbeitung des Schrotes oder Vollkornmehls mit Sauerteig oder Hefe zu Brot wird die Phytinsäure vollständig abgebaut – sofern die Ruhezeiten, also das Aufgehenlassen des Teiges, eingehalten werden. So zubereitetes Vollkornbrot ist auch für Menschen mit empfindlichem Verdauungstrakt bekömmlich. In Grossbäckereien wird der Phytinsäureabbau mit Zugabe von Enzymen beschleunigt. Ich empfehle deshalb, die angegebenen Einweichzeiten immer einzuhalten, und zwar bei Zimmertemperatur.
Natascha Braid-Muff, ganzheitliche Ernährungsberaterin
Seit einigen Monaten habe ich rote Augenlider. Der Augenarzt hat mir ein Medikament verschrieben, das etwas geholfen hat. Nach einiger Zeit waren die Augenlider aber wieder gerötet.
E. Sch., St. Gallen

Hat ihr Arzt herausgefunden, ob es sich um eine Allergie, eine bakterielle Entzündung oder um ein Problem mit der Tränenflüssigkeit handelt? Eine der besten Heilpflanzen bei Augenentzündungen aller Art ist der Augentrost. Er ist noch spezifischer als die Kamille und ist besser verträglich. Weil die Entzündung bei Ihnen schon ziemlich lange besteht, würde ich empfehlen, in der Drogerie ein Spagyrikspray mit Augentrost (Euphrasia) zu kaufen. Es wirkt konzentrierter, als wenn Sie mit Augentrosttee Umschläge machen. Neben der innerlichen Anwendung können Sie zusätzlich jeweils zwei Sprühstösse auf einen Wattepad spritzen und direkt auflegen. Auch die Lidrandpflege mit einem milden Shampoo kann helfen. Wenn der Arzt nichts über die Ursache herausgefunden hat, dann können Sie auch für sich selber eine Liste machen mit allen möglichen Ursachen. Vielleicht die Augencreme wechseln, den Mascara weglassen, genau überlegen, wann es angefangen hat und was damals war. Waren Sie auf Reisen, haben Sie ihr Pflegeprodukt ausgewechselt, das Shampoo, die Kontaktlinsen? Sabine Hurni
Immer mehr Produkte mit Nanopartikeln
Dass es immer mehr Produkte mit Nanopartikeln auf dem Markt gibt, macht mir Sorgen. Inzwischen sind sie in meinem Haushalt vermutlich schon omnipräsent. So zum Beispiel Titandioxid in Zahnpasta und Kaugummi, Siliciumdioxid in Nahrungsergänzungsmitteln. A. N., St. Ursen
Nanopartikel werden so genannt, weil ihre Teilchengrösse unter 400 Nanometer (nm) liegt. Sie sind also nur noch im Elektronenmikroskop sichtbar. Die Nanotechnologie entwickelt sich in vielen Lebensbereichen rasant weiter. Der von

Ihnen angesprochene ist für mich am wenigsten heikel, denn da kann ich problemlos ausweichen. Als Zahnpasten kommen für mich nur unfluoridierte Produkte (Wala, Weleda, Ayurveda) infrage, auf Kaugummi kann ich verzichten und Nahrungsergänzung vermeide ich ohnehin. Wir leben im Überfluss und uns wird eingeredet, wir müssen unsere Nahrung ergänzen. Dabei verhungern täglich Kinder auf dieser Welt.
Einen äusserst kritischen Bereich möchte ich hier kurz ansprechen. Auf dem Markt sind bereits verschiedene PET-Flaschen für Saft, Bier und Wein, die mit Nanopartikeln beschichtet sind. Coca-Cola, Granini und Perrier nutzen bereits solche nanobeschichteten PET-Flaschen. Ein Trend liegt im Bereich von antibakteriell wirkenden Verpackungen mit Nano-Silberbeschichtung, Nano-Zinkoxid oder NanoTitandioxid. Sie sollen die Haltbarkeit der Lebensmittel verbessern. Es ist jedoch nicht geklärt, ob und wie Nanopartikel aus den Verpackungen in die Nahrungsmittel gelangen können. Bei der antibakteriellen Beschichtung ist ein Übergang der Nanopartikel auf die Lebensmittel sogar gewollt, um einen konservierenden Effekt zu erzielen.
Welche gesundheitlichen Risiken dies birgt, ist ungewiss, zumal Nano-Ver packungen für Konsumentinnen und Konsumenten nicht erkennbar sind.
Heinz Knieriemen
Immer wieder leide ich unter Scheidenpilz. Ich kenne die üblichen Ratschläge und befolge sie auch. Was können Sie mir ausserdem raten? Ebenfalls Mühe macht mir das starke Schwitzen an Händen, Füssen, Achseln bei Hitze und emotionaler Anspannung. N. E., Aarau
Nehmen Sie die Pille? Sie ist bei vielen Frauen ein Grund für Pilzinfektionen. Erstens bringt sie das natürliche Gleichgewicht der Scheidenflora durcheinander und schafft dadurch eine Anfälligkeit für Bakterien. Zweitens gibt sie einen Rhythmus vor, der vielleicht nicht unbedingt Ihr eigener ist. Wenn Sie auch nach Absetzen der Pille noch Beschwerden haben, können Sie auch mal Abklärungen machen bezüglich Schwermetallbelastung und Pilzinfektionen im Darm. Was sehr gut helfen soll, sind Salzspülungen. Sie können in der Apotheke oder in der Drogerie eine Blasenspritze kaufen (sieht aus wie ein Ballon) und mit einer Meersalzlösung die Scheide eine Woche lang täglich ausspülen. Oder einen Tampon mit Kapuzinerkressetinktur tränken und kurz einführen (20 Minuten). Die Kapuzinerkresse zusätzlich auch innerlich einnehmen. Mehr erfahren Sie auch unter: http://www. natuerlich-online.ch/magazin/einzelansicht/artikel/ausgabe///pilzfreie-zone/.
Was das Schwitzen betrifft, müssten Sie allenfalls auch mal die emotionale Anspannung unter die Lupe nehmen. Unterdrückte Gefühle können ein enormer Stress für den Körper sein.
Das Schwitzen kann aber auch mit dem Hormonhaushalt oder Ihrer Ernährung zusammenhängen. Meist will uns der Körper etwas zeigen, wenn er uns zum Schwitzen bringt oder wenn die Scheide juckt. Da gilt es manchmal auch, sehr kritisch die eigene Lebenssituation, die Beziehung und den Job zu analysieren. Quasi eine Standortbestimmung fürs eigene Leben machen. Allein oder mithilfe eines Coachs. Sabine Hurni

Was schon unsere Grossmütter wussten
Die heilbringende Wirkung der Arnika ist seit jeher bekannt. Die Pflanze ist ein wahres Multitalent und verfügt über entzündungshemmende, schmerzlindernde und antiseptische Inhaltsstoffe.
Die hochkonzentrierte Arnika Allzwecksalbe «Alltag & Sport» von Kneipp vereint die herausragenden Eigenschaften dieser Pflanze und wirkt intensiv regenerierend und tonisierend. Sie vermindert Spannungsgefühle und fördert die Durchblutung. Sie ist ideal nach körperlichen Aktivitäten, bei längerem Sitzen, Stehen oder auf Reisen. Besonders empfehlenswert auch bei Verstauchungen, Prellungen und Blutergüssen. Sie ist ein wahrer Geheimtipp und darf in keinem Haushalt fehlen.
Die richtige Wahl der Pflanzen und deren Extrakte, die hohen Qualitätsansprüche und die ausgefeilten Rezepturen nach pharmazeutischen Richtlinien sind für den Erfolg der Kneipp Produkte verantwortlich. Diese werden in Eigenproduktion in Bayern hergestellt, dort wo die Lehre von Pfarrer Sebastian Kneipp vor über 150 Jahren ihren Anfang nahm. Die Arnika Allzwecksalbe «Alltag & Sport» gibt’s für CHF 13.50 in der Migros. www.kneipp-schweiz.ch



Seit über 20 Jahren setzt sich Heinz Knieriemen für «natürlich» kritisch mit den Methoden und den Auswirkungen der Schulmedizin und der Laborwissenschaft auseinander. Im AT Verlag hat er mehrere Bücher herausgegeben, unter anderem über Vitamine, Mineralien und Spurenelemente oder Inhaltsstoffe in Lebensmitteln und Kosmetika.
Heinz Knieriemen über
Einst waren die heilkräftigen Stoffe von Drogen geschätzte und legale Hausmittel: Heute sind Mohn und Hanfgewächse kriminalisiert. Dass Zucker ein ungleich grösseres Übel für die Volksgesundheit darstellt, geht dabei vergessen.
Droge – ein Wort, das die unterschiedlichsten Assoziationen auslöst. Lust, Frust, Elend und Verbote, aber auch Heilwirkung und Hoffnung. Im Laufe der Zeiten und Kulturen hat sich nicht nur die Bedeutung des Wortes Droge gewandelt, sondern auch die Wahrnehmung und die Einstellung haben sich verändert. Drogen sind vielerorts nicht mehr die Hoffnungsträger auf dem Weg zur Heilung, sondern werden mit Sucht, Krankheit, körperlichem und geistigem Verfall und Kriminalität gleichgesetzt.
Drogen repräsentierten einst jenen Fundus an heilkräftigen Inhaltsstoffen, den das Reich der Pflanzen bietet. Sie wurden in Drogerien und Drugstores gehandelt. Die Menschen in den unterschiedlichsten Kulturen haben es in den vergangenen Jahrtausenden verstanden, das Geschenk der Drogen für sich zu nutzen und bei körperlichen und seelischen Erkrankungen einzusetzen. Dabei bedeutete das Wort Gift ursprünglich nichts anderes als eine Gabe, ein Geschenk, was im Englischen noch im Wortsinn erhalten geblieben ist.
Heute wird gern vergessen, dass Medizin und Pharmakologie in weiten Teilen auf der Wirkung von pflanzlichen Drogen beruhen. Die Herzglykoside gehen auf
Digitalis purpurea, den Fingerhut, Atropin auf die Tollkirsche, Belladonna, zurück. Morphine gewinnt man aus Schlafmohn und den Aspirin-Wirkstoff Acetylsalicylsäure zumindest ursprünglich aus einem Derivat der Weide. Die Wissenschaft schöpfte und schöpft aus dem reichen Schatz des überlieferten Heilwissens und grenzt diesen aus, sobald Präparate der Pharmaindustrie auf dem Markt sind.
Das verdrängte Drogenelend
Vor einiger Zeit habe ich an einem Kongress teilgenommen, der sich mit dem Thema beschäftigte: «Wie beeinflussen Drogen unseren Alltag.» Die Reaktion der meisten Menschen lautet sicher: gar nicht, in keiner Weise. Aber sind Sie sich da wirklich sicher?
Am Kongress wurde als Erstes die Frage aufgeworfen, welche Droge weltweit die grössten gesundheitlichen Schäden verursacht. Hanf, Kokain, Heroin, Opiate, Tabak oder Alkohol? Weit gefehlt. An erster Stelle steht mit weitem Abstand die Suchtdroge Zucker, zusammen mit versteckten Fetten und Bewegungsmangel der Hauptverursacher einer grossen Zahl von Zivilisationskrankheiten.
Die Fakten: Die Anzahl der übergewichtigen oder fettleibigen Menschen übersteigt derzeit weltweit die Anzahl der

unterernährten. Und es gibt laut der Zeitschrift «New Scientist» keine Anzeichen dafür, dass sich die Ausbreitung der Fettleibigkeit und der damit einhergehenden Krankheiten wie Diabetes, verursacht in erster Linie durch zu hohen Zuckerkonsum, verlangsamt. Die Anzahl der Übergewichtigen steigt in allen Industrieländern ungebremst weiter.
Die USA sind mit 50 Prozent der Gesamtbevölkerung das Land mit der höchsten Zahl an Übergewichtigen. Dies hat zur Folge, dass die direkten Gesundheitskosten (Ausgaben für medizinische Leistungen) auf über 100 Milliarden Dollar jährlich angestiegen sind. Die Folgekosten werden mindestens noch einmal so hoch beziffert. Fachleute sind sogar der Meinung, dass bei Einbezug aller sozialen Komponenten die Fettleibigkeit den gleichen Aufwand erfordert wie alle amerikanischen Kriegsschauplätze zusammen. Unbestritten ist dabei, dass das Zuviel der einen die Ursache für das Zuwenig der anderen ist. Während die mit dem Übergewicht zusammenhängenden Krankheiten im Überfluss begründet sind, sterben weltweit andererseits täglich mehr als 1000 Kinder hungers.
Das sagt die Statistik. Ihr gegenüber steht in den USA und Europa eine Entwicklung, die nur noch mit Kopfschütteln
wahrgenommen werden kann und aufzeigt, wohin die fatale Diskussion über erlaubte und verbotene Drogen führt. Schwer fettleibige Menschen sterben etwa 8 bis 10 Jahre früher als jene mit normalem Gewicht, und sie leiden mit hoher Wahrscheinlichkeit an Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs. Laut einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind die Krankheitskosten stark Übergewichtiger zu deren Lebzeiten zwar durchschnittlich 25 Prozent höher als die Normalgewichtiger. Die kürzere Lebenserwartung habe allerdings zur Folge, dass die Kosten für die Krankenkassen insgesamt sogar geringer ausfallen. Warum also handeln, wenn sich ein grosses Sparpotenzial auftut.
Drogenpolitik diente nie der Gesundheit
Die bekannten und verbotenen sogenannten Suchtdrogen spielen zwar in der Kriminalstatistik eine dominierende Rolle, als Ursache für Krankheit und Invalidität sind sie jedoch Peanuts im Vergleich mit den erlaubten Drogen des Alltags wie Zucker, Tabak und Alkohol. Deshalb schiessen auch alle Verbotsstrategien am proklamierten Ziel vorbei oder darüber hinaus.
Es hat weder in der Vergangenheit, noch in der Gegenwart erkennbare ernsthafte Bemühungen gegeben, mit den Drogenregulierungen dem Wohlbefinden der Menschen zu dienen. Zu erkennen sind vielmehr eine verlogene Machtpolitik, Lobbyismus und Realitätsfremdheit, gestern wie heute.
Werfen wir einen Blick zurück in die Vergangenheit: Grossbritannien brach im Jahre 1839 einen militärischen Konflikt vom Zaun und überzog das Kaiserreich China der Qing-Dynastie mit einem Krieg, der als Opiumkrieg in die Geschichte eingegangen ist. Als Ergebnis der Auseinandersetzungen wurde China zur Öffnung seiner Märkte und insbesondere zur Duldung des Opiumhandels gezwungen. Das Alkoholverbot der USA, die Prohibition, wurde am 16. Januar 1919 ratifiziert und als 18. Zusatz in die amerikanische Verfassung aufgenommen. Sie sollte den Alkoholkonsum eindämmen, öffnete jedoch lediglich der Mafia Tür und Tor. Gesoffen wurde weiter, nur eben heimlich. Vergleichbar damit ist der Verfassungszusatz der Schweiz, mit dem Absinth, die «Grüne Fee», verboten wurde. Erreicht wurde eine Verelendung weiter Teile des Val de Travers mit einer grossen Zahl arbeitsloser Kräuterbauern. Absinth war jedoch weiterhin auf dem Markt, allerdings teuer und nur für eine Elite.
Bis heute sind all die rigiden Verbotsstrategien, etwa das Hanfverbot in der Schweiz, den Beweis schuldig geblieben, dass sie in der Drogenproblematik im positiven Sinne etwas ändern. Hanf ist kriminalisiert und fördert so unnötigerweise die Kriminalität und wird wie andere Drogen über verbrecherische Strukturen gedealt. Gelöst ist kein Problem, es werden nur ständig neue geschaffen.
Das Elend auf dieser Welt begann mit der Entwicklung von Reindrogen wie Opium, Kokain, Morphium und Heroin. Die Drogen verloren damit den ursprüng-
Durch die kürzere Lebenserwartung verursachen Fettleibige tiefere Krankenkassenkosten. Warum also handeln?

lichen Bezug zur Pflanze; die Rituale, die Traditionen, die wichtigen Verknüpfungen mit volksheilkundlichen Anwendungen waren damit gebrochen. Hanf und Schlafmohn haben sich über Jahrtausende hinweg bei vielen Krankheiten und Alltagsproblemen als wirksam erwiesen, vor allem als Schmerz-, Entspannungs- und Beruhigungsmittel. Ich kenne eine ältere Frau, und das ist kein Einzelfall, die ihre Schmerzzustände bei multipler Sklerose mit einem Joint lindert. Sie muss sich den Hanf illegal beschaffen. Legal gibt es nur Arzneimittel, die ihr nicht helfen.
Die Befreiung von Schmerzen, euphorisches Wohlbefinden, das Entrücktsein in eine andere Welt durch einatmen betäubender Kräuterdämpfe, das Kauen von Pflanzen wie Kat, Betel oder Koka, die Einnahme von Bilsenkraut, Mandragora, Opium, Haschisch oder anderen Drogen aus Früchten, Blättern, Knollen oder Samen, die ganze Kenntnis dieser in der Pflanzenwelt schlummernden Kräfte – all das gehört zum Urwissen der Menschen.
Unter den Sorgenbrechern und Erweckern der aphrodisischen Lust spielt die Hanfpflanze seit alters her eine wichtige Rolle. Und die schon in prähistorischer
Apapagnato – entspannt einschlafen
Besonders eindrücklich sind Anwendungen, die in der Volksheilkunde über Jahrhunderte tief verwurzelt sind. In abgelegenen Dörfern der italienischen Abruzzen gibt es heute noch den Ausdruck apapagnato für schläfrig, entspannt einschlafen, der auf das Wort papagna für Mohn zurückgeht. Mütter haben ihren Kindern, wenn sie unruhig waren oder gehustet haben, einen Mohnaufguss bereitet, der sie entspannte und ins Reich der Träume entführte. Schlafmohn galt als wichtige Heilpflanze, die in jedem Garten einen Platz fand. Heute ist der Anbau verboten.
Dafür warteten Bayer und später andere Pharmakonzerne mit einer neuen Kreation auf: Es kam ein Hustensirup für Kinder auf den Markt, der als besonders wirkungsvoll und krampflindernd angepriesen wurde, da er die Reindroge Heroin enthielt.
Und auch noch heute findet sich das Opiat Codein in Hustensäften. Heroin als eine der berüchtigtsten Drogen der Gegenwart wurde am 21. August 1897 in einem Labor der Firma Bayer aus der Substanz Diacetylmorphin zusammengemischt. Ein neues Mittel gegen Husten und Schmerzen, das Bayer zunächst an Meerschweinchen und Katzen ausprobierte, danach an Teilen der eigenen Belegschaft. Kurze Zeit danach kam das neue «Medikament» als Pulver, Saft und Zäpfchen auf den Markt. Den Namen Heroin wählten die BayerChefs, weil sie ihre Neuentwicklung besonders heroisch fanden. Heroin etablierte sich als gängiges Mittel nicht nur gegen Husten, sondern auch gegen Schmerzen, Depressionen, sogar gegen Magenkrebs. Dies geschah über Jahrzehnte ohne kritische Begleittöne aus der Medizin und
Zeit als Nahrung, Gewürz und Heilmittel verwendete Mohnfrucht galt wegen ihrer Fülle von Samen als Symbol der Erde und der Fruchtbarkeit. Immer blieb der Symbolcharakter der Pflanzen bewahrt, wenn sie durch den Menschen zum Liebes- oder Zaubertrank, zum Rausch- oder Heiltrank umgewandelt wurden. Solche Wandlungsformen der Pflanze gelten im Gegensatz etwa zu Heroin im Hustensaft in unserem Kulturkreis von vornherein als suspekt. Das christliche Mittelalter mit Hexenverbrennungen und der Verteufelung von
Wissenschaft. Erst als sich kurz vor dem Ersten Weltkrieg herumsprach, dass geschnupftes oder gespritztes Heroin eine stärkere Wirkung als Morphium hat, kam es zu ersten Abhängigkeiten und Suchtproblemen. Heroin wurde ab 1930 international geächtet. Doch erst 40 Jahre später erregte Heroin wieder Aufsehen – als illegale Strassendroge. Das Buch «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo» beschrieb 1978 in eindrücklicher Weise das Leben der heroinsüchtigen 14jährigen Christiane F. Damit schloss sich der Teufelskreis, der als viel beworbenes Mittel im Kinderhustensaft begann und als ruinöse Suchtdroge endete. Ein typisches Kapitel in der Geschichte der Drogen.

Kräutern und Pflanzen machte aus Hanf, Mohn, Alraune und Bilsenkraut Mittel der Hurenwirte, schlimmer Mädchenverführer und frecher Wollüstlinge. Lust war von da an der Hölle zugeordnet und wurde damit zu einem Synonym für Sünde und Ausschweifung.
Die Wirkstoffe der Hanf- und Mohngewächse sind der Teufelsküche oder der standardisierten Pharmakologie zugeordnet. Der Natur ist wohl nur dann zu trauen, wenn sie in Pillen – oder Pulverform vorliegt. u

Tragen Sie der Umwelt Sorge: Recyclingpapier von Oecoplan ist umwelt- und ressourcenschonend, ohne dabei an Qualität einzubüssen. Überzeugen Sie sich selbst und entdecken Sie die grosse Oecoplan-Auswahl von Reinigungsmitteln über Papeterieartikel bis zu Wasser sparenden Produkten in grösseren Coop Supermärkten und in Ihrem Coop Bau+Hobby-Markt. www.coop.ch/oecoplan





Weltweit sind die Fischbestände bedroht. Alternativen wie Fische aus Zucht oder einheimischen Gewässern entpuppen sich je nach Situation jedoch auch als heikel. Vielleicht ist Mässigung ein guter Gedanke.
Von den weltweiten Fischbeständen sollen gemäss der Uno-Welternährungsorganisation über 80 Prozent bis an die Grenzen befischt, überfischt oder gar schon vom Aussterben bedroht sein. Das tönt alarmierend und man hört es wohl kaum zum ersten Mal. Doch neigt der Mensch gerne dazu, schlechte Nachrichten rasch wieder zu vergessen.
Allein in den vergangenen drei Jahren hat der Fischkonsum in der Schweiz um 25 Prozent zugenommen: über 9 Kilogramm werden pro Kopf und Jahr gegessen. Im Vergleich zu den 52 Kilogramm Fleisch, die jährlich verschlungen werden, mögen die 9 Kilo
nach wenig klingen. Doch der Konsum steigt weltweit und moderne Fangmethoden machen den Fischen in den Meeren das Überleben schwer. Der Griff zum Zuchtfisch ist auch nur bedingt eine Alternative. Räuberfische wie der Lachs brauchen tierisches Eiweiss. Damit die Zucht gute Erträge abwirft, werden die Lachse mit Fisch aus dem Meer gefüttert. Zudem belasten viele Aquakulturen durch Kot, Futterreste und Medikamenteneinsatz die Umwelt. Bedingt empfehlenswert sind solche aus Biozuchten, da dort nur Fischmehl und -öl aus Abfällen der Bio-Aquakultur oder der nachhaltigen Fischerei verwendet werden. Und wer sich für einheimischen
Fisch entscheidet, wird merken, dass Egli und Co. aus heimischen Gewässern mitnichten stets zum Kauf bereitliegen. Rund 95 Prozent des schweizerischen Fischbedarfs kommt aus dem Ausland. Die Organisation fair-fish stellt zudem die Frage, ob ein aus intensiver Zucht stammender Schweizer Fisch per se ökologischer ist, als ein Meerfisch aus nachhaltiger Fischerei. Hinter jedem Lösungsansatz lauert ein neues Problem. Hilfreich ist da vielleicht die Empfehlung von fair-fish, nur einmal pro Monat Fisch zu essen, und sollte dies nichts ausrichten gegen die weltweite Überfischung, dann bleibt wenigstens das Gefühl, etwas versucht zu haben. tha

Biolandbau_ Positive Entwicklung
Weltweit hat die Fläche biologisch bewirtschafteter Anbaufläche im Jahr 2009 um sechs Prozent zugenommen. Das grösste Flächenwachstum fand in Europa statt: Hier legte die Fläche um zwölf Prozent zu. Während ein grosser Teil der weltweit rund 1,8 Millionen Bioproduzenten aus Entwicklungsländern stammt, verzeichnen Dänemark und die Schweiz mit rund 130 Euro pro Jahr und Kopf den grössten Konsum. tha
Lesen_ Blockhäuser
Blockhäuser zählen zu den ältesten Bauweisen des Menschen. Vielleicht stillen die schlichten und massiven Bauten so etwas wie eine menschliche Ursehnsucht nach Sicherheit und Geborgenheit und gefallen deshalb auch heute noch. Das Buch «Blockhäuser» jedenfalls zeigt mit rund 300 Fotos und Plänen 35 Projekte rund um den Globus und erklärt, wie heute unter ökologischen und raumklimatischen Aspekten aus Holz gebaut wird. _ Marc Wilhelm Lennartz: «Blockhäuser», Callwey Verlag, 2010, Fr. 88.–.

Essen_ Das Gute aus dem Stil

Ein kalorienarmer Apéro-Snack sind auch Cashewnüsse nicht. Doch dafür, dass sie eigentlich eine Art Nebenprodukt des Cashewapfels sind, haben sie doch einiges zu bieten. Die Nuss befindet sich im Fruchtstiel des Apfels, sie ist eiweissreich, liefert viel Magnesium, Phosphor, Eisen und Zink sowie B-Vitamine und ungesättigte Fettsäuren. Der Apfel ist übrigens sehr saftig und fruchtig und wird vornehmlich in Brasilien und auch in Asien und Afrika angebaut. Da die Frucht nur sehr beschränkt lagerfähig ist, gibt es keinen Export. tha

«Ob Paris, Tokio oder London: Hüsler Nest ist immer dabei.»
Topmodell Patricia Schmid schläft aus Überzeugung im Hüsler Nest.
Seit ihrer Entdeckung beim Elite Model Look 2004 ist die Aargauerin Patricia Schmid ein international gefragtes Fashionmodel für renommierte Modelabels. Sie lebt in New York.







Auch Stadtmenschen und solche ohne Garten müssen nicht auf einen Kompost verzichten. Die Lösung: ein Balkonkompost. Text Veronica Bonilla
Wer schon mal erlebt hat, wie aus pflanzlichen Garten- und Küchenabfällen innert weniger Monate fruchtbar-krümeliger Humus wird, der wird organische Abfälle nur noch äusserst ungern in den Abfall werfen. Dass diese zusammen mit dem Haushaltkehricht verbrannt werden, ist Verschwendung. Doch was tun, wenn kein eigener Garten vorhanden ist? Wenn der Vermieter aus Furcht vor Gestank oder einer illegalen Mülldeponie das Kompostieren verbietet? Kein Problem. Auch Küchenabfälle von Stadtmenschen können den Weg alles Irdischen gehen. Voraussetzung: Ein Balkon, ein paar wenige Utensilien aus dem Hobbymarkt und die Freude, Naturvorgänge zu beobachten und zu unterstützen. Vorweg: Ein Balkonkompost funktioniert nicht anders als ein normaler Gartenkompost. Organisches Material
wird zerkleinert, gemischt, feucht gehalten und zugedeckt. Mikroorganismen und Kleinsttiere wandeln das Kompostgut in Kohlendioxid (CO2), Wasser und Humus um. «Ob im Garten oder auf dem Balkon kompostiert wird, spielt keine Rolle», erklärt der Basler Kompostberater Hans Balmer, «man kann einen Kompost sogar auf dem Estrich oder im Keller betreiben.» Benötigt wird ein Kübel oder eine Holzkiste (siehe Kasten), die etwa 70 bis 100 Liter fassen. Ein solcher Behälter reicht, um die Abfälle eines Kleinhaushaltes zu kompostieren. Regentonnen aus Metall eignen sich nicht, weil sie rosten und den Kompost vergiften. «Plastik ist relativ neutral und billig», so Balmer. Ein Plastikkübel, in dem kompostiert werde, habe eine Lebensdauer von vier bis fünf Jahren. Holz hält je nach Dicke rund zehn Jahre.
Schön vermengen, sonst stinkts «Kompost ist ein lebendiges System», erklärt der Experte, «einmal pro Woche müssen die Feuchtigkeit und die richtige Durchmischung geprüft werden.» Läuft etwas falsch, merkt man das schnell: Es stinkt. Abhilfe schaffen dann gründliches Vermengen und vermehrte Kontrollen. Ist die Rotte zu feucht, braucht sie mehr Trockenmaterial wie Häcksel oder dürre Blätter. Ist sie zu trocken, muss vorsichtig Wasser zugegeben werden. Es lohnt sich, das Kompostieren in einem Kurs zu erlernen; am lebendigen Beispiel wird nämlich am einfachsten klar, wie die optimale Rotte beschaffen sein sollte. Manche Gemeinden bieten mittlerweile auch entsprechende Beratungen an. Nicht nötig ist Kompostbeschleuniger, wie er zum Teil im Fachhandel oder im Internet angeboten wird. «Er nutzt vor allem dem Portemon-
naie des Herstellers», sagt Balmer. Im Winter lohnt es sich, den Kompost wie eine Kübelpflanze vor Kälte zu schützen, damit er nicht gefriert und die Würmer nicht absterben und verschleimen. Beim Gartenkompost ist dies nicht nötig, da sein Volumen grösser ist und im Innern kaum Minustemperaturen auftreten, ganz besonders wenn er regelmässig «Grünfutter» erhält.
Der klassische Kompost ist nicht die einzige Möglichkeit, organische Reststoffe in den Kreislauf der Natur zurückzuführen. Bewährt hat sich auch die Wurmkiste. Dabei werden die Küchenabfälle in einer Holzkiste gesammelt und von Mikroorganismen und einer grossen Zahl von Kompostwürmern zu Wurmhumus umgearbeitet. Bauanleitungen oder fertige Kisten sowie Wurmlieferanten finden sich im Internet. Wurmkompost ist sehr nährstoffreich und die Küchenabfälle verwandeln sich innert weniger Wochen in Humus. Die vielen Würmer, die bald in der Kiste herumwuseln, brauchen jedoch regelmässig Nahrung. «Für eine Wurmkiste trägt man Verantwortung wie für ein Haustier», sagt Balmer. Weil Tausende von gefrorenen Würmern eine ganze Menge Schleim ergeben, hält man die Wurmkiste am besten im Keller oder in der Garage, wo die Temperaturen auch im Winter im Plusbereich liegen.
Wen das Gruseln überkommt bei solchen Mengen von Würmern, kann es auch mit einem Bokashi-Eimer probieren. Dieser klinischsaubere Plastikkübel, der 17 Liter fasst, kann sogar in der Küche stehen. Im Bokashi-Eimer werden die Küchenabfälle fermentiert, also ohne Sauerstoff, aber unter Zugabe von sogenannten effektiven Mikroorgansimen gelagert. Das fermentierte Material sieht nach ein par Wochen zwar noch erkennbar nach Küchenabfällen aus, vergraben in der Erde wird es jedoch innert zehn bis zwölf Tagen zu Humus. Kompostberater Hans Balmer hat es ausprobiert: «Es funktioniert tipptopp.»
Surftipps _ www.natuerlich-online.ch
Für eine Wurmkiste trägt man eine Verantwortung wie für ein Haustier.

So funktioniert ein Balkonkompost
Zubehör
l 1 Plastikkübel mit Deckel, mindestens 75 Liter
l 2 Holzlattenstücke (Dachlatten)
l 1 Blumentopfuntersatz (unter Plastikkübel)
l 1 Kräuel (dreizinkige Gartenkralle)
l kleine Äste, Laub oder unbedruckten Karton
l Holzhäcksel
l Urgesteinsmehl
l Kastensieb mit 12 –14 mm Maschenweite für die Komposternte
Vorbereitung
l In den Boden des Kübels und in die untersten 15 cm je etwa 20 Löcher bohren.
l Dachlatten auf den Untersatz legen und Kübel daraufstellen.
l Eine Schicht klein geschnittene Zweige (zirka 15 cm) in den Kübel geben, danach eine Schicht Laub oder Kartonstücke, darauf eine Schicht Häckselgut (mindestens 20 cm).
Kompostieren
l Küchenabfälle oder Balkonabraum zerkleinern und in den Kübel streuen.
l Gleich viel Häckselgut hinzugeben und gut mischen, sodass keine Klumpen entstehen.
l Je nach Feuchtigkeit der Abfälle entweder mit einer Giesskanne Wasser zugeben oder bei zu nassem Kompost Häcksel oder trockene Blätter beifügen. Das Rottematerial muss so feucht sein wie ein ausgedrückter
Schwamm. Bei zu hoher Feuchtigkeit verfault das Material und es stinkt; bei zu trockenem Material findet kein Abbauprozess statt.
l 1-mal wöchentlich 2 Esslöffel Steinmehl hinzufügen und Kompost in der obersten Zone (zirka 20 cm) mit dem Kräuel gut mischen.
Ernten
l Nach 6 bis 12 Monaten oberstes, noch nicht verrottetes Material herausnehmen und beiseitelegen.
l Erde mit einem Kastensieb aussieben und für Balkonpflanzen verwenden.
l Wieder eine Schicht Zweige in den Kübel geben und das ausgesiebte und noch nicht verrottete Material darauflegen – dieses ist der beste Kompoststarter.
Wichtige Tipps
l Das gehört hinein: Rüstabfälle von Gemüse und Obst, pflanzliche Speisereste, Kaffeesatz, zerrissene Teebeutel, zerkrümelte Eierschalen, Tiermist von Pflanzenfressern, Balkonabraum, Schnittblumen,
l Das gehört nicht hinein: tierische Speisereste und Knochen, Katzen- und Hundekot, Staubsaugersäcke, Asche, behandeltes Holz.
l Material mit Gartenschere oder Messer klein schneiden (Fruchtsalatgrösse). So verrotten auch Bananenund Zitrusschalen problemlos.
l Im Winter den Balkonkomposter wie eine Kübelpflanze isolieren: mit Stroh, Papier oder Jutesäcken.
Wer keinen Garten hat, braucht nicht auf eigenes Gemüse zu verzichten. Auf ein paar Quadratmetern Balkon lassen sich nicht nur Küchenkräuter, sondern auch Schnittsalate, Tomaten und Peperoni anpflanzen.
Text Remo Vetter
Urbanes Gärtnern ist in und ich bin überzeugt, dass es sich bei dem Phänomen nicht bloss um einen kurzfristigen Trend handelt, sondern, dass immer mehr Stadtbewohner Lust auf Grünes vom eigenen Balkon haben. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wer keinen Garten besitzt, muss nicht auf sein eigenes Gemüse, Kräuter und Blumen verzichten. Mit ein paar Quadratmetern Balkon und ein wenig Kreativität lässt sich auch in der fünften Etage in Zürich Oerlikon oder Bern Bethlehem ein kleiner Nutzgarten anlegen.

Der Autor
Remo Vetter wurde 1956 in Basel geboren. 1982 stellte ihn der Heilpflanzenpionier Alfred Vogel ein. Seither ist Vetter im Gesundheitszentrum in Teufen (AR) tätig, wo er mithilfe seiner Familie den Schaukräutergarten von A. Vogel hegt.
Viele Küchenkräuter sowie Fruchtgemüse und Salate lassen sich auf dem Balkon kultivieren. Dabei geht es nicht nur um ihren Nutzen als Nahrungsspender, sondern auch darum, Auge und Nase durch Farben, Formen und Düfte zu erfreuen. Rote Tomaten, gelbe oder orange Peperoni und die bunte Blütenpracht von Schnittlauch, Kapuzinerkresse, Borretsch und Goldmelisse sind dekorativ und bereichern jede Küche. Balkongemüse könnte eine echte Alternative zum Gemüse aus dem Laden sein: Kürzer, schneller und ökologischer geht es nicht. Und Kinder lieben es ohnehin, auszusäen und den Pflanzen beim Wachsen zuzusehen.
Einige Dinge gilt es zu berücksichtigen: Ein sonniger und windgeschützter Balkon ist hervorragend geeignet für den Anbau Wärme liebender Fruchtgemüsearten wie Auberginen, Peperoni oder Tomaten. Für Salatliebhaber empfiehlt sich der Anbau von schnell wachsenden Pflücksalaten. Sicherlich sollten Küchenkräuter wie Basilikum, Schnittlauch, Dill, Thymian, Rosmarin und Minze nicht fehlen.
Eine Vielzahl von Pflanzgefässen kann man heute im Gartencenter kaufen. Vom einfachen Ton oder Plastiktopf über den Balkonkasten aus Holz bis zur kunstvoll ge


Immer mehr Stadtbewohner haben Lust auf Grünes vom eigenen Balkon.

Heute schon gesät?
Das Gärtnern gewinnt an Bedeutung. Es macht Spass, das Keimen und die Entwicklung der zarten Sprossen zu prächtigen Blumen zu verfolgen. Und für die Anzucht von Gemüsesorten, die nicht im Supermarkt erhältlich sind, lohnt es sich, ein Stück Rasen in einen Nutzgarten umzuwandeln. Sinnesfreuden können Sie jedoch auch für den kleinen «grünen Raum» auf Balkonien und dem Fensterbrett entdecken!
Kleine Samen ganz gross
Möchten Sie blühende Akzente setzen? Oder Ihren Gemüsegarten mit knackiger, unverschämt guter Pflanzenkost bereichern? Mit den kleinen Samen von Select kommt Ihr Garten gross heraus. Aber: «Was der Frühling nicht sät, kann im Sommer nicht blühen und im Herbst nicht reifen!»

Darum geht es schon im April los mit dem Säen! Ab in den Boden heisst es jetzt unter anderem für Schnittsalat, Karotten und Radieschen. Wichtig: Die zarten Pflänzchen müssen vor Frost geschützt werden. Vorkultivieren lassen sich nun beispielsweise Lattich, Stielmangold, Blumenkohl, Kohlrabi, Fenchel oder auch Blumen wie Tagetes, Leberbalsam, Amarant, Ringelblumen und vieles mehr.
Tipp: Wählen Sie geeignete Sorten und Anbauzeiten zum Säen. Achten Sie auf Fruchtfolge und Nachbarschaft sowie auf die Vorteile der Neuheiten mit den Resistenzen gegen Krankheiten.

Einfach und praktisch Saatbänder sind eine praktische Sähilfe, denn die Samen sind bereits im richtigen Abstand abgelegt. Sie sind einfach in der Handhabung
und gewähren eine erfolgreiche Kultur. Voraussetzung ist, dass der Boden richtig vorbereitet und das Saatband tüchtig bewässert wird.
_ Mehr Infos und grösste Auswahl in der Schweiz an Sämereien und Pflanzgut für Garten und Balkon: www.samen.ch




fertigten Schale aus Messing. Damit das Angepflanzte nicht vertrocknet oder verbrennt, würde ich auf schwarze Plastiktöpfe verzichten und solchen aus Ton den Vorzug geben. Kulturpflanzen wie Tomaten, Gurken, Peperoni und Auberginen brauchen grosse Töpfe, während für die meisten Kräuter kleinere Töpfe oder Balkonkisten ausreichen. Wärme liebende Kräuter wie Rosmarin oder Verveine pflanze ich einzeln in Tontöpfe, die ich im Herbst an die Wärme in die Küche, den Wintergarten und einige sogar in die Stube stelle, sodass die Pflanzen auch den Winter hindurch geerntet werden können. Als Pflanzenerde eignet sich gewöhnliche biologische Blumenerde, die ich mit etwas Kompost (siehe Stadtkompost, Seite 28) anreichere.
Um gute Ernten zu erhalten, ist das Wässern besonders wichtig, da viele Balkone überdacht sind und keinen oder nur wenig Regen erhalten. Ich gebe dem Giesswasser immer einige Blätter Beinwell als Düngemittel bei. Rankende Pflanzen wie Gurken, Tomaten oder Bohnen müssen hochgebunden werden. Dazu können entweder Stangen oder Gitter benutzt werden oder man befestigt Schnüre an der Balkondecke und lässt diese herunterhängen und befestigt die Kletterpflanzen daran. Ich verwende dieses System übrigens auch im offenen Garten, denn Pflanzen wie Kürbisse, Melonen, Rondini und Gurken, die normalerweise im Garten meterweit kriechen, brauchen bei der vertikalen Anbaumethode viel weniger Platz und sind leichter zu ernten.
Ein Tipp für Familien mit kleinen Kindern und Garten: Kletterbüsche lassen sich relativ leicht mit Weidenruten flechten. Einem kleinen Iglu gleich bieten sie den Kindern im Sommer ein grünes, blühendes Zelt und Gemüse wie Rondini und Co. genug Möglichkeiten, in die Höhe zu klettern. u
Jetzt im April ist die Versuchung, all die neuen Samentütchen aufzumachen und zu säen, fast unerträglich. Das ist bei uns auf 1000 Metern über Meer aber sehr heikel, und darum ist es oft besser, vorerst ein paar Samen in Töpfen oder Saatkästen auf der Fensterbank oder im beheizten Gewächshaus vorzuziehen.
l Beete vorbereiten und Sämlinge ziehen Sinnbildlich ist der April der Monat vor dem Sturm, vor der grossen und schönen Arbeit: Es gilt die Saatbeete vorzubereiten, den Boden zu harken, Erdklumpen zu zerkleinern, gründlich zu jäten, damit der Boden für die Samen und Jungpflanzen vorbereitet ist. Wenn die Sämlinge in den Anzuchtkästen oder Saatkästen ein paar Blätter gebildet haben, werden sie einzeln in grössere Töpfe oder Saatschalen gesetzt. Dabei gilt es aufzupassen, dass die Pflanzen mit einem Hölzchen behutsam verpflanzt werden, damit die feinen Wurzeln nicht beschädigt werden. Nach dem Pikieren bilden sie kräftige Wurzeln, weil sie jetzt genügend Platz zum Wachsen haben. Achten Sie auf Sämlinge in Einzeltöpfen. Es kann vorkommen, dass der Topf zu klein wird, ehe es Zeit zum Auspflanzen wird. Ich habe mir darum angewöhnt, die Pflanzen von vornherein in grössere Töpfe zu setzen und es ist auch schon vorgekommen, dass ich Kopfsalate direkt aus dem Topf geerntet habe, da die Zeit für das Umpflanzen fehlte. Im Treibhaus vorgezogene Sämlinge stelle ich an warmen Tagen ins Freie und hole sie am Abend wieder hinein. So gewöhne ich sie langsam an die Aussentemperaturen. Das ist je nach Menge der Aussaaten mit einem grösseren Arbeitsaufwand verbunden. Wenn es die Möglichkeit gibt, mit Frühbeeten und Folientunnel zu arbeiten, ist das eine energie und zeitsparende
Lösung, da man diese morgens öffnen und abends schliessen kann.
l Sämlinge pflanzen und kultivieren Frisch gepflanzte Sämlinge müssen regelmässig und vorsichtig gegossen werden. Die neuen Kartoffeln müssen angehäufelt werden, denn wenn sie Licht bekommen, werden sie grün und ungeniessbar. Die zeitig gesäten Erbsen haben bereits Halteranken entwickelt und brauchen Stützen, um in die Höhe zu wachsen. Ich verwende meist Hasel oder Birkenzweige, oder grobe Hühnerdrahtnetze, wenn kein Astmaterial vorhanden ist.
Auch Bohnenstangen sollen aufgestellt werden, solange die Pflanzen noch klein sind. Ich stelle die Haselstangen kegelförmig wie ein Tipi auf, damit die Bohnen gut klettern können. Wichtig ist, dass die Stangen stabil sind und gute Schnüre verwendet werden, sodass sie Wind und Wetter standhalten und das Gewicht der Pflanzen tragen können.
Im Kräuterbeet vermehren wir ältere Pflanzen wie Schnittlauch, Liebstöckel, Minze oder Majoran, indem wir die Wurzeln ausgraben und teilen. Die Goldmelisse sollte im zweiten Jahr an einen neuen Standort versetzt werden, da sie eingeht, wenn sie über mehrere Jahre am selben Standort steht.
Starkzehrer wie Paprika, Kohl oder Lauch sollten jedes Jahr an einen neuen Ort gepflanzt und eine Fruchtfolge eingehalten werden.
Junge Blätter von Pflücksalat, Feldsalat, Rucola und verschiedene asiatische Salatsorten im Tunnel vor Frost schützen und laufend ernten.
l Ernten früher Sorten
Wenn Sie früh im Haus gesät und im vorigen Monat ausgepflanzt haben, können Sie jetzt schon den ersten Spinat ernten. Junge Blätter, «Baby leaf», verwenden wir für Salate. Es ist eine Freude, wenn im April die ersten grünen Spargelstangen ans Licht drängen. Geschnitten werden sie, wenn sie etwa fingerdick sind. Rucola pflücken wir fortlaufend; er wächst den ganzen Sommer hindurch nach. Frühzwiebeln, die im vorigen Herbst gesät und im Beet überwintert haben, sind jetzt erntereif.

Spargeln sparsam ernten
Letzten Frühling habe ich ein Spargelbeet angelegt. Zu meiner Überraschung und Freude sind alle gewachsen. Ein Bekannter hat mir gesagt, ich sollte mich erst im Frühling freuen, wenn die Spargeln den Winter überlebt hätten. Ist das wirklich ein Problem? Ich wohne in Heiden (AR), das liegt etwa auf derselben Höhe wie Ihr Wohnort. Was raten Sie mir? Und kann man Ihren Garten besuchen? Claudia Laubscher, per Mail
Ärger mit dem Pächter

Schön, dass Ihre Spargeln so gedeihen. Auch wir haben vor Jahren 100 Spargelwurzeln gepflanzt und eine reiche Ernte genossen. Grundsätzlich gilt: Lassen Sie die Spargeln gut anwachsen, ernten Sie auch im zweiten Jahr ganz wenig, nur etwa einen Fünftel der Menge. Erst ab dem dritten Jahr kann zünftig geerntet werden. Wichtig ist auch, die Spargeln ab Juli gut zu düngen, am besten mit Kompost, und ins Kraut schiessen zu lassen. Im Herbst kann dann zurückgeschnitten werden. Zu überlegen ist – gerade in Höhenlagen wie ihrem Wohnort Heiden (800 Meter ü. M.) –, den Boden mit Ästen und Stroh abzudecken, um die Jungpflanzen am Anfang etwas zu schützen. Übrigens: Unser Garten ist immer offen und freut sich auf Ihren Besuch: Um es mit Oscar Wilde zu sagen: «I want my roses to meet you.»
Ich habe seit letztem Sommer eine SteviaPflanze in einem Topf vor meinem Wohnzimmerfenster. Im Winter war sie an einem kühlen Ort im Haus. Die grünen Blätter vom letzten Jahr sind eher eingetrocknet; jedoch schiessen grüne, neue Blätter an den Stängelenden. Soll ich die Stängel zurückschneiden oder soll ich den Neuwuchs gewähren lassen? Und noch eine Frage: Ist Liebstöckl im Topf eine winterharte Pflanze? Aurelia Strassmann, per Mail
Ihre Fragen kann ich kurz und bündig beantworten. Zur SteviaPflanze: Schneiden Sie die Stängel leicht zurück, sodass die Pflanze jetzt im Frühjahr neu austreiben kann. Und zum Liebstöckl: Er ist weitgehend winterhart, mehrjährig und wird auch wieder austreiben.
Ich wohne im Grünen in der Landwirtschaftszone. Unser Landwirtschaftsbetrieb ist seit zwölf Jahren verpachtet. Wir sind eine Erbengemeinschaft, mein Vater, mein Bruder und ich. Mein Vater wohnt im Bauernhaus und der Pächter bewirtschaftet das Land. Leider ist der Pächter kein Bio-Bauer, im Gegenteil er spritzt sehr viel. Für mich ist diese Art zu bauern sehr suspekt. Der junge Landwirt sagt mir, dass er aus ökologischer Sicht gleich nach dem Bio-Bauer kommt. Er erzählt mir auch, dass die Bodenlebewesen keinen Schaden nehmen und dass die Bio-Bauern die Kartoffeln mit Kupfer spritzen – und das sei sehr giftig. Nun habe ich ihn darauf aufmerksam gemacht, dass es zwischen der Bio- und seiner Methode sicher noch eine andere Art zu bewirtschaften gibt. Er hat kein Musikgehör. Wie gesagt, er ist Pächter und auf das Land angewiesen. Was soll oder kann ich tun? M. K., W.
Es ist immer sehr schwierig, Menschen zum Umdenken zu bewegen. Das gilt für Bauern ebenso wie für Manager. Denken Sie zum Beispiel an die langen Transportwege in der Nahrungsmittelproduktion oder an den Disput über die verschiedenen Energiequellen. Oft ist das auch ein Kampf David gegen Goliath. Vielleicht müsste man dem Bauern einmal Filme wie «We feed the world», «Oversize me», «Die 4. Generation», «Silent spring», «Welt ohne Bienen» zeigen, um bei ihm ein Umdenken anzuregen. Es gilt, klar Stellung zu beziehen, und das hätten Sie vermutlich beim Abschluss des Pachtvertrages bereits tun müssen. Die Aussagen des Pächters sind nämlich falsch. Wenn er viel Chemie einsetzt und vermutlich auch mehrmals nachspritzt, ist er weit weg von BioLandbau. Setzen Sie – falls das möglich ist – einen neuen Vertrag auf und beharren Sie auf die biologische Pflege Ihres Bodens. Als Eigentümer ist das Ihr Recht.

Hochwertige Erde von Wyss für prächtiges Gedeihen! In Ihrem Wyss GartenHaus finden Sie zu günstigen Preisen die Qualitätserde für: Balkonpflanzen, Moorbeetpflanzen, Rosen, Orchideen, Kakteen, Zimmerpflanzen, Kübelpflanzen, Tomaten, Rasen sowie Kräuter und Gemüse.
Wyss GartenHaus für Sie in: Aarau, Bern, Buttisholz (bis 30 06 2011), Muttenz, Oberwil, Volketswil, Zuchwil

Aktion « 3 für 2»
_ Haben Sie Fragen rund um Garten und Balkon? Remo Vetter gibt Ihnen die richtigen Tipps. Schreiben Sie an: «natürlich», Gartenberatung
Neumattstrasse 1, 5001 Aarau oder remo.vetter@natuerlich-online.ch
Leserangebot
Balkonpflanzenerde, 40 Liter, von Wyss. Profitieren Sie! Nehmen Sie 3 , bezahlen Sie nur 2 . Die Aktion ist gültig bis am 30 . April 2011.
Coupon ausschneiden und vor dem Bezahlen vorweisen. Keine Rabattkumulationen.



Menschen, Pfannen und Kräuter: Bei Meret Bissegger dreht sich alles um diese drei Zutaten. Ein Besuch bei der Tessiner Köchin, die soeben ihr erstes Buch veröffentlicht hat. Text Tertia Hager
Meret Bissegger steht in ihrer Küche, hantiert mit Messern und Pfannen, huscht durch die Tür, um ein Blech mit Grünerbs-BärlauchPüree an der Kühle zu versorgen, kommt zurück, schüttelt kurz eine Pfanne mit Gemüse und gibt Auskunft über Kräuter und Gewürze. Dazwischen steckt sie sich eine Gabel Salat in den Mund. Direkt aus der Schüssel. «Bitte entschuldige, dass ich so esse», sagt Meret, die sich mit dem Du wohler fühlt. Von frühmorgens bis spätabends steht sie für ihre Gäste in der Küche – ihr selbst bleibt da kaum Zeit, in Ruhe etwas zu essen.
Die Tessiner Köchin mit Deutschschweizer Wurzeln ist mitten in den Vorbereitungen zu einer sogenannten Tavolata: Dabei bewirtet sie vorangemeldete Gäste in ihrer Wohnküche. Wer mag, kann schon am Nachmittag bei ihr aufkreuzen und ihr beim Kochen über die Schulter gucken. Gegen 18 Uhr haben sich ein Dutzend Gäste um den freistehenden Herd, der zugleich Arbeitsfläche ist, versammelt. Alle schauen, wie Meret Zwiebeln hackt –eine wissbegierige Gruppe Feinschmecker voller Vorfreude auf ein grosses Schlemmermahl. Flink wechselt die ausgebildete
Kindergärtnerin zwischen Deutsch und Italienisch. An diesem Abend halten sich die Deutschweizer und Gäste aus dem Tessin und Italien die Waage. Viele Deutschschweizer kennen Meret schon seit der Zeit, als sie im Restaurant Ponte dei Cavalli im Centovalli wirkte. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge erinnert sich die Köchin an diese elf strengen Jahre im eigenen Restaurant: Mit 14 Gault Millau-Punkten wurde Meret Bisseggers «Cucina Naturale» geadelt. Journalisten waren von ihren Kochkünsten so verzaubert, dass sie damals Mitte der 90er-Jahre von Hexenküche schrieben und die mehrheitlich vegetarische Vollwert-Küche der passionierten Wildpflanzensammlerin in den höchsten Tönen lobten. Manchmal fehlt ihr diese Zeit, die Gäste, das tägliche Kochen und das Experimentieren. «Hier in Malvaglia habe ich ein schönes neues Zuhause gefunden», sagt Meret. Lange hat sie zusammen mit ihrem Partner nach einem passenden Haus gesucht.
Bio, aber nicht um jeden Preis
Ihre Sporen als Köchin verdiente sich die Autodidaktin mit Wirtefachpatent in der Buvette des Teatro Dimitri in Verscio ab. «Dort kam ich zum Vegetarischen», erzählt sie. Die Lust am Sammeln von wilden Kräutern und essbaren Pflanzen brachte sie von der Alp mit. Zwei Saison lang arbeitete sie als Älplerin und entdeckte dabei die Vielfalt der Wildpflanzen und deren kulinarischen Reize. «In der Buvette entstand der ‹Antipasto a modo mio›», erinnert sie sich. Diese meist vegetarischen Vorspeisehäppchen verzückten die Gäste. «Bald kamen immer mehr Leute und es war oft ziemlich stressig und chaotisch», erzählt Meret. Nach drei Jahren in der Buvette übernahm sie das Ponte dei Cavalli. «Das war dann der endgültige Schritt zu Bio- und Vollwert», sagt die 50-Jährige. «Für mich gab es damals kein Zurück mehr», erzählt sie.
Doch Meret ist keine Fundamentalistin, wie man vielleicht denken könnte. Ihr Credo: biologisch geht vor. Zur Religion wird es deshalb aber nicht erklärt. «Es ist doch auch eine Frage der Menge», findet sie. Braucht die Köchin viel von einer Zutat, achtet sie auf die Bioqualität. Sie handelt praktisch und nachsichtig zugleich: Einerseits im Sinne der Slowfood-Bewegung, bei der sie sich engagiert und wo es unter anderem darum geht, regionale Produkte zu fördern und umweltbewusst einzukaufen. Andererseits nach den Kriterien der Spitzengastronomie, wo das Beste in die Töpfe kommt. Aber eben: «Alle wollen immer die beste Qualität. Wer soll dann die zweitbeste essen?», fragt sie. Selbstverständlich ärgert sich auch eine grossmütige und improvisationsfreudige Köchin wie Meret über den im Innern faulen Trevisano, den sie für die Vorspeise Crêpes mit Schafsricotta, Kürbis und roten Zwiebeln hackt. «Aber es gehört doch zum Beruf», sagt Meret, «dass ich mit den Produkten,

Biologisch geht vor. Zur Religion wird es deshalb aber nicht erklärt.


Leserangebot
Unseren Leserinnen und Lesern bieten wir das neue Buch von Meret Bissegger und Hans-Peter Siffert: «Meine wilde Pflanzenküche», erschienen im AT-Verlag, zum Spezialpreis von Fr. 42.90 statt Fr. 49.90 an.
_ Bestellen Sie das Buch mit dem Talon auf Seite 58
die mir zur Verfügung stehen, etwas Gutes kochen kann.» Und gut ist, was sie ihren Gästen an diesem Freitagabend in Malvaglia auf den Tisch zaubert: Ein 5-GangMenü inklusive «Antipasto a modo mio» mit zehn kulinarischen Überraschungen von der Kürbisterrine mit Broccoli an Mandarinenöl bis zum arabischen Winterrettich-Salat. Schon die Farbenpracht beim Apéro löst Glücksgefühle aus: eine leuchtend gelbe Kürbistunke, ein tiefrotes Randenpüree, ein zart weisser Petersilienwurzel-Dip, serviert mit farbenfrohen Gemüseschnipseln. Die Zunge schmeckt Safran, Ingwer, Meerrettich und Baumnuss. Als Vorbote des Frühlings gibt es dazu eine kräftige Bärlauch-Crème auf Räbenscheibe.
Zusammen geht es besser
Der Bärlauch ist an diesem Abend Merets einzige Referenz an die Wildpflanzenküche. Nicht nur, weil die Wiesen und Böschungen anfangs März im Bleniotal noch nicht viel mehr hergeben. «Ich brauchte eine Pause», sagt die Köchin, die normalerweise mit dem Spriessen der ersten Pflanzen ihre Streifzüge startet. Mehr als ein Jahr lang arbeitete Meret mit dem Fotografen Hans-Peter Siffert an ihrem soeben erschienenen Buch «Meine wilde Pflanzenküche». Stunden verbrachten die beiden in der Natur, suchten essbare Pflanzen, fotografierten, kochten und kata-
logisierten sie. «Zuletzt hatte ich Berge von Rezepten auf Suddelpapier», erinnert sie sich. Und Tausende von Bildern, die gesichtet, ausgewählt und beschrieben werden mussten. «Mach doch ein Buch», sagten Freunde und Gäste schon seit Langem. «Sieben Anläufe fand ich im Computer.» Doch lange war sie mit dieser Idee alleine. Dann kam der Fotograf Hans-Peter Siffert und überzeugte sie, gemeinsam ein Buch zu machen. «Es hat sofort gepasst», sagt die Köchin. Als Pilzsammler brachte er die richtige Portion Neugier und Leidenschaft für das arbeitsintensive Projekt mit: rund 300 Seiten und über 400 Fotos sind zwischen den Buchdeckeln zusammengekommen. Die Frage nach weiteren Büchern lässt Meret Bissegger fast zusammenzucken. «Jetzt fahre ich zuerst einmal eine Woche nach Elba. Dort muss ich mich dann vielleicht ausheulen. Danach hab ich vermutlich eine Antwort.»
Ein paar Stunden später an diesem Tag sehen die Dinge schon ein wenig anders aus. Ein weiteres Kochbuch wäre schön, vielleicht nach Jahreszeiten gegliedert, sagt Meret. Nebst ihren Koch- und Kräuterkursen und den Tavolata-Abenden möchte sich die Köchin in Zukunft wieder vermehrt bei Slowfood engagieren. Und dann würde sie auch gerne etwas über Projekte lernen. «Damit ich mich nicht immer so fest reingebe und zuletzt fast am Boden bin», sagt sie. Es ist kurz vor Mitternacht. Morgen hat sie die nächste Tavolata. u
Am 14. April wird auf SF 1 der zweite Teil der vierteiligen NZZ-Format-Serie über die Saisonküche von Meret Bissegger ausgestrahlt, SF 1, 23 Uhr 20.
Buchpräsentation
Am Samstag, 16. April, sind Meret Bissegger und Fotograf Hans-Peter Siffert am Wildkräuterstand in der Zürcher Markthalle Viadukt (Haltestelle Dammweg) und präsentieren ihr Buch. www.im-viadukt.ch

Rezept für 4 Personen von Meret Bissegger
1 Prise Kräutermeersalz
1 EL Zitronensaft
1 EL Olivenöl
1 EL Zitronen-Olivenöl viel schwarzer Pfeffer
1 Handvoll halb offene Gierschblüten mit einem Stück Stängel gepflückt
1 schnittfester Frischkäse (z.B. Robiola)
Zubereitung
Öle, Zitronensaft und Gewürze in einer Schüssel zu einer Sauce mischen. Giersch im Dampf 5 Minuten garen und auskühlen lassen. Frischkäse in Scheiben schneiden und mit dem ausgekühlten Giersch schichtweise auftürmen. Alles mit der Sauce beträufeln und servieren.
Der Giersch (Aegopodium podagraria) kennt man auch unter dem Namen Baumtropf und Geissfuss. Er wächst in Gruppen und verbreitet sich über jedes kleinste Stück Wurzel rasch und hartnäckig. Bei Gartenbesitzern ist er entsprechend verhasst. Man pflückt die jungen, noch zarten Blätter, solange sie noch glänzend und leicht gefaltet sind, und zwar mitsamt dem ganzen Blattstiel. Man kann sie roh geschnitten dem Salat beigeben oder die ganzen Blätter im Dampf 3 bis 4 Minuten garen und dann zu einem Salat verarbeiten. In den letzten 5 Minuten Kochzeit einer Suppe oder einem Risotto beigegeben, sind die Blätter eine Delikatesse. Auf die gleiche Weise verwendet man die halboffenen Blüten mit einem zarten Stück Stängel daran.
Typisches Erkennungsmerkmal ist die Zahl drei beziehungsweise die dreieckige Form: Bevor sich die weissen Blüten zeigen, erkennt man den Giersch an den langen, dreieckigen Blattstielen, die sich oben in drei Teile und diese nochmals in zwei oder drei kleinere Abschnitte teilen. Die ganz jungen Blätter sind hellgrün. Ihr Geschmack erinnert an Sellerie, Karotten oder Fenchel, die alle mit dem Giersch verwandt sind.

Nächstes
Einführungsseminar:
20. – 21. Mai 2011
Telefonische Auskunft:
Di – Fr 9:30 – 12:00 Uhr
Ausbildung für Prozessorientierte Kunsttherapie APK
044 720 44 82 In Thalwil am Zürichsee maltherapie.ch








Schweizerischer Ve rband für Natürliches Heilen –Im Einsatz für die sanfte Medizin.

Institut für Klang-Massage-Therapie
Elisabeth Dierlich Peter Hess Akademie Schweiz
Zertifizierte Ausbildung in Peter Hess-Klangmassage
Zertifizierte Weiterbildung in Elisabeth Dierlich-Klangtherapie
Vertrieb von Therapieklangschalen und Gongs www.klang-massage-therapie.ch
5040 Schöftland Oberdorf 8 0041(0)62 892 05 58

Suchen Sie eine neue berufliche Herausforderung?
Jetzt nächste Ausbildungen planen:
Trad. Chinesische Medizin (TCM) Start: 30.04.2011
Klassische Massage Start: 20.08.2011
Fussreflexzonen Massage Start: 02.09.2011
Medizinisches Qi Gong Start: 14.09.2011
Thai Massage Start: 03.12.2011
Manuelle Lymphdrainage Start: 01.03.2012
Westliche Medizin Ausbildungen (150h/350h/60 0h) starten laufend.
Biomedica Zürich, Schule für westliche und fernöstliche Medizin Tel. 043 321 34 34, www.biomedica.ch
Kleidung aus Naturfaser n und Accessoires für Sie und Ihn
Luzer nstrasse 15
4950 Huttwil
+41 (0) 62 962 34 64 boutique-naturel.ch
2_Yoga_University_Lehrerin_90x64_2_Yoga_University_Lehrerin_90x64 11.1 1
2_Yoga_University_Lehrerin_90x64_2_Yoga_University_Lehrerin_90x64 11.1

Yoga University Villeret
Yoga University Villeret
Diplomausbildung des Schweizer Yogaverbandes zum/zur
Diplomausbildung des Schweizer Yogaverbandes zum/zur
Beginn: Oktober 2010
Beginn: Oktober 201
■ Mit Diplom des Schweizer Yogaverbandes.
■ Mit Diplom Yogaverbandes.
■ Mehr als zehn international bekannte DozentInnen öffnen dasTor in ein neues bereicherndes Berufsleben.
■ Mehr als zehn international bekannte DozentInnen öffnen dasTor in bereicherndes Berufsleben.
Yoga University Villeret, Rue de la Gare 5, CH-2613 Villeret
Yoga University Villeret, Rue de la Gare 5, CH-2613 Villeret
Tel. 032 941 50 40, Fax 032 941 50 41, www.yoga-university.ch
Tel. 032 941 50 40, Fax 032 941 50 41, www.yoga-university.ch
Therapeutische Weiterbildung Akupunktur Massage nach Radloff
ESB Energetisch statische Behandlung der Gelenke, zur Beeinflussung aller Körpersysteme
APM Akupunkturpunkte, verbunden zu Meridianen, behandelt mit einem Massagestäbchen, um Flussbedingungen und Ausgleich zu schaffen ORK Ohr-Reflexzonen Kontrolle ermöglicht eine differenzier te energetische Befunderhebung Symptome können dadurch ursächlich behandelt werden.

Die Methode findet Anwendung bei or thopädischen, neurologischen, internistischen und gynäkologischen Beschwerden. – Aufbauende Seminarien in kleinen Gruppen, Lernbegleitung individuelles Ausbildungstempo und prozessorientier tes Lernen. DIPL.-STUDIUM HOMÖOPATHIE staatlich anerkannt
HF-Bildungsgang
• Integrierte Praktika Vollzeit oder berufsbegleitend
• Fundierte Ausbildung in Medizin und Homöopathie
• Mitglied der Höheren Fachschule für Naturheilverfahren und Homöopathie hfnh
Homöopathie Schule


Forschung_ Sozial und treu
Ostern_ Fast ein Jahrhundertereignis
Dieses Jahr fällt der Ostersonntag auf den 24. April. Es ist der zweitspäteste Termin, der überhaupt möglich ist, und kommt erst im Jahr 2095 zum nächsten Mal vor. Im Gegensatz zum Weihnachtsfest, das jedes Jahr auf den 25. Dezember fällt, ist Ostern ein bewegliches Fest. Am 1. ökumenischen Konzil von Nicäa (325 n. Chr.) wurde festgelegt, dass das Osterfest jeweils nach dem ersten Frühlingsvollmond stattfinden soll. Der spätestmögliche Termin für Ostern ist der 25. April und kommt im 21. Jahrhundert nur 2038 vor.
ledermäuse sind soziale Tiere und leben in Verbänden, von denen sie sich aber auch immer wieder trennen, um sich einer neuen Gruppe anzuschliessen. Nichtsdestotrotz suchen die Tiere danach immer wieder die Nähe zu vertrauten Artgenossen. Sie bleiben über Jahre hinweg treue Freunde, haben Schweizer Forscher herausgefunden. tha

Sterngucker im April_ Extrem schmale Mondsichel


AAndreas Walker
m 3. April ist Neumond, und schon am Abend des 4. April kann bei klarem Wetter in der Dämmerung bereits die sehr schmale Mondsichel gesehen werden. Mit jedem Tag steigt der Mond am Abend höher und seine Sichelgestalt nimmt stetig zu. Im Frühling kann bei uns der Mond im besten Fall schon einen Tag nach Neumond am Abendhimmel beobachtet werden. Dies hängt mit der Lage der Ekliptik (Bahnebene der Erde um die Sonne) zusammen. Im Frühling steht die Ekliptik am Abend besonders hoch über dem Horizont. Somit kann man im Frühling die zunehmende Mondsichel am Abendhimmel besonders gut beobachten –vorausgesetzt, dass keine grossen Hügel oder Berge am westlichen Horizont emporragen. Im Herbst ist es genau umgekehrt: Zu dieser Zeit ist die abnehmende Mondsichel am Morgenhimmel gut sichtbar. Andreas Walker
Artenschutz_ Fisch des Jahres bedroht
Der wenig bekannte Strömer (Leuciscus souffia agassizi) gehört zur Familie der Karpfenfische, wird bis 18 Zentimeter lang und lebt nur in Fliessgewässern mit sauberen Kieslaichplätzen. Letztes Jahr wählte ihn der Schweizerische Fischerei-Verband (SFV) zum Fisch des Jahres. Das vom Verband durchgeführte Monitoring übertraf die schlimmsten Befürchtungen: Der Fisch ist vielerorts komplett verschwunden. Hauptgrund für den drastischen Rückgang ist die Zerstörung seines Lebensraums. Damit es den Störmer auch in Zukunft noch gibt, vordern die Fischer eine raschere Renaturierung der Gewässer. Hans-Peter Neukom


Alle freuen sich, wenn das Frühlingssignet, der neckische Doppelruf des Kuckucks, zum ersten Mal ertönt. Doch der Sonderling und Brutschmarotzer gerät zunehmend in Existenzschwierigkeiten.
Als Zugvogel überwintert der Kuckuck im südlichen Afrika. Von da wandert der gewandte Flieger im Frühling schnell und zielstrebig nordwärts, die Sahara und Nordafrika vielfach ohne Aufenthalt querend. Als ungeselliger Vogel zieht er einzeln und nachts. Seine Ankunft in Mitteleuropa ist jeweils Mitte April. Der Volksmund weiss es genau: «Am 18. kommt er, am 19. muss er kommen!» Und falls er schon vorher da ist, besagt dies lediglich, dass auch Bauernregeln nicht unfehlbar sind …
Eines ist aber sicher: Zuerst treffen die Männchen ein. Sie sind es auch, die den allbekannten, zweisilbigen Ruf erschallen lassen, der dem Vogel seinen klangmalenden Namen eintrug. Nur gerade ein Drittel des Jahres verweilt der Kuckuck bei uns, bevor er im Hochsommer schon wieder seine Rückreise antritt. Trotzdem hat er es geschafft, zu einem der populärsten Vögel zu werden, der uns beim erstmaligen Ertönen seines Rufes sogar zum bangen Griff nach dem Geldsäckel zwingt … Der Aberglaube verspricht beim Kuckucksruf Geld fürs ganze Jahr, vorausgesetzt man hat schon welches im Hosensack.
Freizügiges Liebesleben
Obschon der Kuckuck als ausgesprochener Brutparasit die elterlichen Pflichten grosszügig seinen Artgenossen delegiert, lässt er sich die Vorfreuden dazu nicht nehmen. «So brutfaul der Vogel, so verliebt ist er», fand schon der Zoologe und Tiervater Alfred Brehm und fuhr fort: «Er ist buchstäblich toll, solange die Paarungszeit währt, schreit unablässig so, dass die Stimme überschnappt, durchjagt unauf
hörlich sein Gebiet und vermutet überall einen Nebenbuhler, den hassenswertesten aller Gegner.» Mit der Ehe nimmt es der Kuckuck dann allerdings nicht so genau; denn zur Brutzeit vergesellschaften sich verschiedene Männchen mit einem Weibchen und umgekehrt. Solche Freizügigkeit scheint jedoch mit der nicht ausgesprochenen Territorialität zusammenzuhängen –ein für einen Schmarotzervogel offenbar taugliches Prinzip; denn so kann das Wirtsvogelangebot besser genutzt werden.
Vögel sind dann echte, fachsprachlich obligate Brutschmarotzer, wenn sie drei Bedingungen erfüllen: kein Nest herrichten, nie selbst Eier bebrüten und Jungvögel nicht selbst füttern. Das trifft auf den Kuckuck zu, und er ist notabene in Europa die einzige Vogelart, die Brutparasitismus betreibt. Zieheltern sind vorwiegend insektenfressende Singvögel. Trotz der stattlichen Grösse des Kuckucks sind es fast ausschliesslich Kleinvögel von Laubsänger bis Drosselgrösse, die er für seine Zwecke missbraucht. Allein in der Schweiz kennt man über dreissig Wirtsvogelarten, in Deutschland an die neunzig.
Wichtig ist, dass die Wirtsvögel eine hohe Siedlungsdichte aufweisen, gut erkennbare und für Kuckuckszwecke geeignete Nester bauen, wenig Abneigung gegen fremde Eier an den Tag legen, ähnliche Eigrössen besitzen sowie passendes Fütterungsverhalten zeigen. Dies trifft zu auf Stelzen, Pieper, Grasmücken, Heckenbraunelle, Rohrsänger, Rotschwänze, Rotkehlchen und Würger. Nicht infrage kommen reine Höhlenbrüter.
Die Wirtsvögel erkennen den Schmarotzer Kuckuck sehr wohl. Wo er auftaucht, fliegen sie unter Gezeter auf ihn los

Geniales Kuckucksei
Nicht nur der Vogel, auch das Ei ist an den Brutparasitismus angepasst: bruchfestere Schale, verhältnismässig kleine Eigrösse sowie enorme Vielfalt bezüglich Färbung und Zeichnung, das heisst farbliche Anpassung (Mimikry) an die Eier der Pflegeeltern. Während die Eier verschiedener Kuckucksweibchen – entsprechend ihren Hauptwirten – sehr unterschiedlich gefärbt sind, legt das einzelne Weibchen zeitlebens denselben Eitypus, und zwar in die Nester jener Vogelart, von der es selber grossgezogen wurde. Optisch-akustische Prägung im frühen Nestlingsalter, kombiniert mit einem genialen Vererbungsmechanismus steuert die Mimikry der Kuckuckseier. In jedes Wirtsnest legt das Kuckucksweibchen nur ein einziges Ei, allerdings – wegen der hohen Verlustrate – bei verschiedenen Pflegeeltern, was der doppelten Legeleistung anderer Vögel gleicher Grösse entspricht. Ausserordentlich ist auch die hormonelle Synchronisation des Eisprungs: Beim Kuckucksweibchen wird die Eiproduktion auf den Nestbaurhythmus und die Legeaktivität der Pflegeeltern abgestimmt.
Mit der Ehe nimmts der Kuckuck nicht so genau.
und attackieren ihn, wie sie das auch teilweise bei Greifvögeln und Katzen tun, sie hassen auf, wie es die Ornithologen sagen. Besonders energisch attackieren sie ihn in der Nähe ihres Nestes, wodurch sie dieses erst recht verraten. Doch kommt dieses Hassen dem Kuckuck gar nicht ungelegen; denn während das rufende Männchen die Hasser auf sich zieht, kann das Weibchen derweil unbemerkt sein Ei ins Nest der Wirtsvögel legen.
Zudem gibt die Sperberung, die quergestreifte Färbung der Brust, dem Kuckuck ein Stück weit das Aussehen eines Sperbers. Auch diese Greifvogelmaskerade ist nicht rein zufällig, denn die Nachahmung wehrhafter Tiere durch Brutschmarotzer ist ein von der Natur mehrfach angewandter Trick. Auch die Raffinesse, mit der die Kuckucksfrau den Wirtsvogeleltern ihr Ei unterjubelt, hört sich an wie im Krimi. Zuerst macht sie in Detektivmanier ihre Opfer ausfindig durch Beobachten vom Ansitz aus oder im Suchflug. Um der Attacke der Zieheltern bei der Eiablage zu entgehen, wählt sie nach Einbrecherart einen günstigen Moment aus, nämlich die allgemeine Ruhezeit in den frühen Nachmittagsstunden. Die Eiablage erfolgt meist in unvollständige Gelege und dauert nur wenige Sekunden. Oft trägt die Kuckucksfrau – zwecks täuschenden Ausgleichs – ein Ei des Wirtsvogels im Schnabel weg. Bevor die «beglückten» Eltern etwas merken, ist der Spuk schon vorbei.
Die Bebrütungsdauer des Kuckuckseis ist mit nur rund zwölf Tagen sehr kurz, was sicherstellt, dass das Schmarotzerjunge noch vor den Stiefgeschwistern schlüpft. Auch scheint der Kuckucksembryo weniger empfindlich auf Bebrütungsunterbrüche zu sein. Die Natur bevorteilt ihn in mancherlei Hinsicht. Einmal geschlüpft, ist er fast doppelt so gross wie seine Nestgenossen, jedoch ebenfalls blind und nackt. Aber schon nach wenigen Lebensstunden erwacht in dem kleinen Schmarotzerkind ein unheimlicher Trieb: Alles, was sich ausser ihm im Nest befindet, ob Eier, Stiefgeschwister oder seltenerweise
mal ein zweites Kuckucksei (wenn zufällig zwei verschiedene Mütter ins gleiche Wirtsnest gelegt haben), restlos alles wird über Bord geworfen. Und zwar vehement: Rückwärts strampelt das kleine Biest, dem Triebe gehorchend, die Konkurrenz auf dem Rücken stemmend, an der Nestwand empor und befördert sie mit einem letzten Ruck auf oder über den Nestrand hinaus. Auch die Wirtseltern funktionieren nach den knallharten Regeln der Natur: Was regungslos auf dem Nestrand liegt, und wenn es die eigenen Kinder sind, bedeutet für sie nichts anderes als wegzuräumende Fremdkörper, vergleichbar den wegzuschaffenden Kotballen.
Erst im Alter von einigen Tagen beginnen beim Jungkuckuck, schwarzen Stoppeln ähnlich, die Federn zu spriessen. Nun sieht er aus – Zitat Brehm – «als sässe eine Kröte im Neste». Der Rausschmeissertrieb erlischt. Aber hungrig ist der nestfüllende Wechselbalg. Sein übergrosser, orangerot leuchtender Sperrrachen löst bei den Eltern das angeborene Fütterungsverhalten aus. Bis zur Erschöpfung füttern sie diesen Nimmersatt, der kaum mehr Platz findet im Singvogelnestchen.
Wie eine Kröte im Nest
Wenn er dann im zarten Alter von rund drei Wochen flügge wird und das Nest verlässt, ist er gut und gerne bis zu fünfzig Mal schwerer als beim Schlüpfen. Selbstständig wird er aber erst weitere drei Wochen später. Inzwischen lässt sich das Riesenbaby nonstop füttern. Dies verlangt, aus Gründen des Grössenunterschieds, von den Pflegeeltern beinahe akrobatische Einlagen: Entweder setzen sie sich zum Füttern dem Mammutkind auf den Kopf oder sie verharren in der Luft rüttelnd vor ihm und stecken dabei ihren Kopf weit in seinen Sperrrachen.
Wer nun fürchtet, der Kuckuck könnte durch seinen Brutparasitismus gewisse Singvogelarten gefährden, da ja jedes Kuckucksei so viel wie eine verlorene Wirtsbrut bedeutet, der unterschätzt die genialen Regulationsmechanismen der Natur. Wenn sich nämlich regional bei einer Wirtsvogelart kuckucksbedingt tatsäch
lich ein Populationsengpass ergibt, dann ist auch der Kuckuck gezwungen, entweder einen Standort oder Pflegeelternwechsel vorzunehmen, worauf sich die bedrängte Wirtsvogelart wieder erholen kann. Gefahr lauert jedoch dem Kuckuck selber, und zwar durch den Menschen:

Grau ist üblicherweise die Farbe des Kuckucks – aber hin und wieder gibt es auch braune Exemplare.
Durch die fortschreitende Ausräumung der halb offenen Kulturlandschaft werden verschiedene Raupenarten, von denen sich Kuckucke ernähren, immer seltener. Nicht auszudenken, wie trist das wäre, wenn es eines Frühlings nicht mehr «kuckuck, kuckuck» aus dem Wald rufen würde. u


Imposante Brücken über die Areuseschlucht und ebensolche Ausblicke über die Felsenarena Creux du Van – still hingegen die Quelle der Areuse, die bei Saint-Sulpice aus dem Kalkstein austritt.



Trotz kleinen zivilisatorischen Makeln ist von der Schönheit des Val-de-Travers wie sie einst der Philosoph Jean-Jacques Rousseau beschrieb, nichts verloren gegangen. Ein Spaziergang zur Quelle der Areuse öffnet Geist und Herz. Text Pier Hänni, Tertia Hager

Nachdem der grosse Philosoph und Aufklärer Jean-Jacques Rousseau Paris verlassen musste, lebte er ab 1762 drei Jahre im Val-de-Travers. Dort erholte er sich beim Studium der Natur und entdeckte seine Liebe zur Botanik: «Ich verdanke mein Leben den Pflanzen nicht wirklich, aber sie haben es mir ermöglicht, im Strom des Lebens weiter zu schwimmen und nicht unterzugehen von Bitterkeit beschwert.» Es sollen die glücklichsten Jahre im unsteten Leben des Genfers gewesen sein. Sein damaliges Wohnhaus in Môtiers ist heute ein Museum, viele nach ihm benannte Strassen im Tal und nicht zuletzt die wilde Landschaft selbst erinnern an den Naturphilosophen.
Von Feen verzaubert
Heute wirbt das Val-de-Travers weniger mit dem Namen Rousseau oder der einst dominierenden Uhrenindustrie: Le Pays des Fées, das Land der Feen, heisst die Zauberlosung der Touristiker. Namen wie Rue des Fées oder Grotte aux Fées lassen vermuten, dass die Bewohner früher mit
diesen wunderbaren Wesen regen Kontakt pflegten. Kenner der Schweizer Sagenwelt weisen darauf hin, dass Fee in der französischen Schweiz als Bezeichnung für alle Naturgeister verwendet wurde, so wie etwa im Berner Oberland der Name Zwerg.
Nach den zahlreichen Sagen über die Jurafeen spielten diese im Leben der Menschen eine wichtige Rolle. Sie lebten vorzugsweise in Höhlen und halfen den Bewohnern der Umgebung bei der Arbeit, trösteten ihren Kummer, heilten sie von Krankheiten und jene, die sich dafür als würdig erwiesen, weihten sie auch in die magischen Geheimnisse der Natur ein. Meistens werden die stets als weibliche Gestalten auftretenden Feen als anmutige Schönheiten beschrieben, deren wohlgeformter Körper von langem, dichtem Haar umflossen wird. Wer einmal ihrem verzaubernden Gesang gelauscht habe, sei für den Rest des Lebens zu einem besseren Menschen geworden, sagt man. Und von den Augen der Wenigen, die sie in bestimmten Nächten auf idyllischen Wiesen
Lohnendes Ausflugsziel: der Chapeau de Napoléon, der früher auch Le Righi neuchâtelois hiess.
Die Sage von der Vuivre
Im 14. Jahrhundert lebte zuhinterst im Traverstal die Drachenschlange Vuivre, die nachts Kühe, Ziegen und manchmal auch Menschen jagte. Einwohner wie Reisende mussten täglich um ihr Leben fürchten. Da beschloss ein junger Mann namens Sulpy Raymond, das Ungeheuer zu töten. Er versteckte sich in der Nähe ihrer Höhle, und als die Vuivre von der Jagd zurückkehrte und mit vollem Magen einschlief, schlich er sich lautlos an und schoss ihr mehrere Pfeile in den Leib. Dadurch nur verletzt, stürzte sie sich auf den Mann. Aus dem erbitterten Kampf ging Sulpy schwer verwundet als Sieger hervor. Er schleppte sich ins Dorf zurück, wo er stolz den abgeschnittenen Kopf der Schlange vorzeigte. Bald starb auch Sulpy. Zum Dank schenkte der Graf von Neuenburg seiner Familie die Freiheit und ein Landgut. Die Geschichte nimmt das klassische Thema des Drachentöters auf, in dem sich die Unterwerfung und Verteufelung der Naturkräfte und damit des alten Glaubens spiegelt. Durch den symbolischen Tod der Vuivre sollte der Mythos in den Köpfen und Herzen der Menschen ausgelöscht und durch eine Gruselgeschichte ersetzt werden. Dabei diente die Natur als Vorbild, denn die idyllischen Flüsschen des Juras verwandeln sich nach starken Regenfällen in reissende Ungeheuer, die Wiesen, Gärten, Häuser und Strassen verwüsten. Sie sind aber auch die Lebensadern der Landschaft, ohne die nichts gedeihen würde. So lässt sich nachvollziehen, dass auch die Vuivre, wie der Mythos berichtet, zwei Seiten hat. Die beiden Aspekte der Flüsse beziehungsweise der Göttin in Gut und Böse zu trennen bedeutet, die Schöpfung nach unserem eigennützigen Massstab zu bewerten und zu richten. Das Dämonische steckt jedoch nicht in den Naturkräften selbst, sondern entsteht aus deren Trennung in Gut und Böse.

Le Pays des Fées, das Land der Feen, heisst die Zauberlosung der Touristiker.
tanzen sahen, soll noch Jahre danach ein helles Strahlen ausgegangen sein. Geologisch gesehen ist das Val-de-Travers ein von der Areuse geschaffenes Hochtal des Neuenburger Juras. Es ist wohl schon seit der Steinzeit eine wichtige Verbindung zwischen dem Neuenburgersee und dem Tal des Doubs. Römische Münzfunde lassen darauf schliessen, dass während der römischen Besetzung eine viel benutzte Strasse zwischen Helvetien und Gallien durch das Tal führte, das damals den Namen Vallis transversa trug. Nebst der spektakulären Felsenarena des Creux du Van gehört die AreuseSchlucht zu den touristischen Highlights des Val-de-Travers. Am Ziel des Spaziergangs dem Bachlauf entlang, der Quelle der Areuse, denkt der Wanderer: Schade, dass das Ende der wildromantischen Schlucht durch einen kleinen Damm verbaut ist. Doch wenn man eine Weile bei dem Seelein im kleinen Talkessel sitzt und beobachtet, wie das Wasser unter den urtümlich geformten Kalkfelsen hervorströmt, dringt die Kraft und Stimmung des Ortes bald in das Gemüt. Was durch den Damm gestört wurde, wird durch den Zauber des ruhigen Seeleins wettgemacht. Wir haben immer die Wahl, das Glas als halb voll oder als halb leer anzusehen. Auf jeden Fall ist die Schwingung bei der Areusequelle derart intensiv, dass sie auch mit Damm immer noch ein eindrücklicher Kraftort ist. Das Quellwasser stammt aus der grossen Geländesenke des Brévinetals und dem östlichen Teil des Verriertals.
Anreise
Bahn über Neuchâtel und Travers nach Fleurier, Bus nach Saint-Sulpice.
Wanderzeit
Zur Quelle der Areuse:
Saint-Sulpice – Quelle der Areuse –Saint-Sulpice, 1 Stunde.
Zum Aussichtsberg Chapeau de Napoléon: Fleurier– Chapeau Napoléon – Fleurier, 2 Stunden.
Route Beide Wanderungen sind gut ausgeschildert.
Quelle der Areuse: Wir folgen von der Bus-Endstation in Saint-Sulpice den Schildern Richtung Source de l’Areuse und erreichen bald das Dorfende und das am Flussufer stehende Ecomuseum. Nun sind es nur noch einige Schritte bis zum kleinen Stausee mit der Quelle.
Chapeau de Napoléon: Der Wanderweg, der von Fleurier durch den Wald auf den Hügel des Chapeau Napoléon führt, ist durchgehend beschildert.
Allgemeine Informationen www.val-de-travers.ch www.neuchateltourisme.ch www.chapeaudenapoleon.ch
Karte 1: 50 000 Val-de-Travers 241
Nach der Sage soll hier einst die Vuivre gewohnt haben. Sie ist in vielen Teilen des Juras in der Gestalt einer Drachenschlange überliefert, die mit Flüssen und Schluchten verbunden ist. Später als Naturdämon verteufelt, galt sie einst als eine strahlende Jungfrau, die sich allerdings gelegentlich in das Fabeltier verwandelte. Die Verbindung der Vuivre zur Schlange, dem Urbild der Quellgottheit, sowie die Tatsache, dass sie untrennbar mit Flüssen und Bächen verbunden ist, lässt auf die uralte Quellgöttin schliessen. Sie soll einen magischen Edelstein um den Hals tragen. Das strahlende Juwel ist wie die Kronen, welche die Zauberschlangen in anderen Sagengeschichten auf dem Kopf tragen, als Hinweis auf ihre magische Kraft zu verstehen. Wie die Fee von der Grotte bei Vallorbe erinnert auch die Vuivre an einen uralten
Mythos, nachdem die bei Quellen wohnenden Drachenschlangen sich auch als strahlend schöne Frauen manifestieren. Der Mythos wurde im Mittelalter von verschiedenen Dichtern aufgenommen und hat bis heute seine Anziehungskraft nicht verloren.
Kein Kraftort, aber nicht minder attraktiv ist der Aussichtsberg über Fleurier mit dem etwas sonderbaren Namen Chapeau de Napoléon, Hut des Napoléon. Seine runde Kappe gleicht wirklich etwas dem Hut von Bonaparte. Ältere Einwohner des Tals erinnern sich, dass der 980 Meter hohe Berg früher Le Righi neuchâtelois hiess. Tatsächlich geniesst man von oben, wo sich auch ein Ausflugsrestaurant befindet, eine herrliche Rundsicht auf die Jura-
Gewinnen Sie

Gewinnen Sie dreimal zwei Übernachtungen für zwei Personen im Hotel de l’Aigle. Das Hotel liegt im Grünen, im Zentrum des Dorfes Couvet. Ursprünglich eine Pferdewechselstation aus dem 13. Jahrhundert, bietet das Haus heute angenehmen Luxus in natürlicher Umgebung, die zum Wandern im Jura einlädt. Als Zusatzpreis gibt es dreimal zwei Paar Socken X-SOCKS Trekking Silver. Mehr Hotel-Infos unter www.gout-region.ch


Wettbewerbsfrage
Welcher grosse Philosoph lebte im Val-de-Travers?
u Gotthold Ephraim Lessing u Jean-Jacques Rousseau u George Berkeley
Richtige Antwort auf den Coupon übertragen und einsenden.
Die Gewinner werden unter den richtigen Einsendungen ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
höhen und über das Val-de-Travers, das Land der Feen. Und auch wenn die Landschaft mit Siedlungen durchsetzt und mit Strassen durchzogen ist, lässt sich nachvollziehen, weshalb die Feen gerne hier wohnen. u
Wir gratulieren!
Auflösung aus Heft 2-2011: Oberland
Je zwei Übernachtungen für zwei Personen im Hotel Eden in Spiez haben gewonnen:
• Stefanie Lienert, Luzern
• Barbara Gallonetto, St. Gallen
• Manuela Mora, Fulenbach
Das Buch «Quellen der Kraft» von Pier Hänni stellt über 20 lohnende und abwechslungsreiche Wanderungen zu von Wassern geprägten Kraftorten in der ganzen Schweiz vor. Alle Wanderungen sind exakt beschrieben, ebenso die Mythen und Märchen rund um die Kraftorte.
Bestellen Sie das Buch aus dem AT-Verlag zum Vorzugspreis von Fr. 32.90 statt Fr. 39.90..

Wettbewerbs- und Bestellcoupon
Senden Sie mir: «Quellen der Kraft», à Fr. 32.90, inkl. MwSt., plus Fr. 6.90 Versandkosten u Ich nehme nur am Wettbewerb teil
Wettbewerbslösung: u Gotthold Ephraim Lessing u Jean-Jacques Rousseau u George Berkeley
Name Vorname
Strasse, Nr. PLZ/Ort
Datum Unterschrift 4-2011
Falls ich gewinne, brauche ich folgende Sockengrösse u 35 – 38 u 39 – 41 u 42– 44 u 45 – 47
Das Leserangebot ist gültig bis 31. Mai 2011 und gilt nur für die Schweiz. Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 29. April 2011. Coupon einsenden an: AZ Fachverlage AG, Lesermarketing, « Quellen der Kraft», Postfach, 5001 Aarau, oder unter www.natuerlich-online.ch

Max’inux (Orca in der Sprache der Kwakiutl)
Künstler; Marcus Alfred, Alert Bay BC, Kanada 2010
Die Völker der Nordwestküste glaubten, dass die Orcas in einem grossen Haus im Meer lebten. Dort, in der Unterwasserwelt, nahmen sie menschliche Gestalt an und Max’inux, der Orca, war ein grosser Häuptling.
Tatanka, der Bison, ist das prägnanteste Beispiel für die vielfältigen Beziehungen, welche die (Prärie)Indianer zu den sie umgebenden Tieren pflegten. Praktisch alles, so demonstriert diese attraktive Ausstellung «Von Lebertran bis Totemtier» im Nordamerika Native Museum (Nonam) mittels Objekten und Texten, wird vom Präriebüffel verwertet: das Fleisch, das Fell, aber auch der Magen als Wasserbehälter sowie der Schädel zu rituellen Zwecken. Indianer besitzen ein unverkrampftes Verhältnis zu Tieren, die ihnen Nahrung sind und die sie in ihre Mythen miteinbeziehen. Da erfährt man, wie die Krähe
aus Langeweile als Weltschöpferin die Sonne an den Himmel geklatscht hat und dass der schlitzohrige Koyote als Vorbild gilt. Besonders amüsant die Beziehung zum Bären: Weil dieser schnell beleidigt ist, muss man ihn auch als Kadaver mit respektvollen Namen anreden, da er einen sonst im Bärenjenseits anschwärzt, was sich auf den Jagderfolg negativ auswirkt. Hans Keller
_ Weitere Infos: Nordamerika Native Museum, Seefeldstr. 317, 8008 Zürich, Sonderschau bis zum 13. November 2011. www.nonam.ch
Lernen_ Die Natur der Sprache
Neuerdings kann man einen Naturpark nicht nur wegen seiner Pflanzen- und Tierwelt besuchen: Unter dem Titel Lingua Natura bieten vier Schweizer und ein benachbarter italienischer Naturpark Sprachkurse in allen vier Landessprachen an. Nebst Sprachlektionen gibt es an den 5-tägigen Kursen auch Informationen zur Natur, Kultur und zu regionalen Besonderheiten. tha _ www.lingua-natura.com


Lötschental_ Wintertraum im Frühling
Blauer Himmel und milde Temperaturen kombiniert mit glitzernden Schneelandschaften und urchigen Holzmasken, das gibt es nur im Lötschental. Das abgeschiedenste und unverbrauchteste Wallisertal bietet im Frühling viel Natur – und für Wintersportler noch jede Menge Schnee, zum Beispiel auf der Lauchernalp. Skifahren, Winterwandern und Langlaufen sind hier bis Ende April möglich, und das mitten in der imposanten Kulisse des Unesco-Welterbes des Aletsch-Jungfrau-Bietschhorn-Gebietes _ Mehr Infos: www.loetschental.ch info@loetschental.ch

Einkaufen_ Fair und fein
Es müssen nicht immer Wasabi-Nüsschen sein: Gebana, die Pionierin des fairen Handels, setzt ein Zeichen für den biologischen Sojaanbau in Südbrasilien. Die gerösteten und mit Sojasauce gewürzten Soli-Bohnen schmecken als Apèro-Snack vorzüglich. Mit dem Kauf unterstützt man die brasilianischen Soja-Bauern im Kampf gegen die Verseuchung ihrer Ernte durch Pestizide benachbarter Produzenten. Informationen zur Aktion über www.chega.org tha _ 1 Beutel à Fr. 5.– über www.gebana.ch
Lesen_ Wozu Ausländer?
Ein provokanter und angesichts der Ereignisse in Nordafrika ein brandaktueller Titel. Autor Robert Dempfer geht in seinem Sachbuch «Wozu Ausländer?» den Chancen, aber auch den Schwierigkeiten, welche Einwanderer mit sich bringen, nach. Dabei stützt sich der Leiter der Abteilung Gesellschaftspolitik beim österreichischen Roten Kreuz auf empirische, statistische Fakten. Das Buch bietet einen umfassenden und realistischen Blick auf die Themen Zuwanderung und Integration und zeigt, dass Integration weit besser funktioniert, als in der Öffentlichkeit gemeinhin dargestellt. _ Robert Dempfer: «Wozu Ausländer? Eine Chance für unsere Gesellschaft», Verlag Carl Ueberreuter, 2011, Fr. 33.90

Essen_ Sein eigner Gemüsebauer
In Basel scheinen besonders viele Menschen mit dem neudeutschen «Urban gardening» zu sympathisieren. Die Idee: Lebensmittel so nahe wie möglich zu produzieren, im Garten, auf dem Hausdach oder auf einem brachliegenden Grundstück. So gibt es im Mai einen Umzug mit bepflanzten Einkaufswagen, aus einer Diplomarbeit resultierte das Projekt Nutzdach, das diesen Frühling mit der Umnutzung eines grossen Flachdachs beginnt und die Plattform Urban AgriCulture venetzt Ideen und Menschen, die davon überzeugt sind, dass es möglich und sinnvoll ist, Gemüse in der Stadt zu kultivieren. tha _ Aktionsumzug mit bepflanzten Einkaufswagen: 14. Mai, 16 Uhr, Kasernenplatz, Basel, 13 Uhr Pflanzaktion, www.keinkaufswagen.ch, www.nutzdach.ch, www.urbanagriculturebasel.ch



Sie finden diese Produkte in unserem Leserangebot auf Seite 58

















Schilter Lebensarena PETA

Schule für Individualpsychologie, Familienstellen, Kommunikationssysteme, Beraterpraxis

Naturärztin/Naturarzt
StudiumgemässE MR-Richtlinien mitden Fachrichtungen:
•KlassischeHomöopathie
•Chinesische Medizin
•EuropäischeNaturheilkunde
Studienbeginn: August 2011
Eulerstr asse 55 ,4051Basel Tel. 061560 30 60,w ww.anhk .ch

Durchatmen unD LosLaufen
Rumänien : «Karpaten und Donau-Delt a»: Trekking im Gebirge der Karpaten, Wandern im MacinNationalpark und gediegene Naturbeobachtungen im Donau-Delta. 18.–27. Juli 2011 Marokko «Nomaden im Hohen Atlas», Pionierre ise über Pfingsten. Trekking durch fruchtbare Bergtäler mit Berberdörfern und Terrassenfeldern Über karg eH och eb en en mi tN omade nz el te n, Schaf- und Ziegenherden. Durch unbewo hntes Hochgebi rge mit traumhaften Land schaften. 4.–18. Juni 2011
Maro kko «Herbs ti mH ohen Atlas» :A rc haische Bergwelten im Hohen Atlas: Berberdörfer,mächtige Nussbäume und Te rr assenfelder.Weite und Raum auf Pässen und auf kargen Hochebenen.
Fakultativ: Besteigung eines Vier tausender-Gipfels. 1.–15. Okt. 2011 Rickli Wanderreisen Nachhaltige Naturerlebnisse - sorgfältig, rücksichtsvoll Reisen - bewusst geniessen. Matthias Rickli, Biologe Tel. 071 330 03 30 www.ricklireisen.ch
Lehrgang zum psych. Gesundheitsberater in Olten SO mit Zertifikat
- Jeweils 1 Samstag monatlich, 1½ Jahre
Dieser Lehrgang beschäftigt sich mit den gedanklichen, gefühlsmässigen, spirituellen, genetisch verstrickten usw. Einflüsse in Bezug auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden und beinhaltet Psychosomatik, Organsprache und Kommunikation mit Körperenergien. Lehrgang zum psychologischen Lebensberater in RICHTERSWIL ZH mit Diplom
- jeweils 1 Wochenende monatl., 2 Jahre, berufsbegleitend
Der Ausbildungsinhalt ist auf der Basis der Individual-psychologie, Kommunikations-systeme, Vergangenheits-bewältigung, Selbsterfahrung und Alternativen aufgebaut.
PETA, die erfolgreiche Schule seit 1994
Detaillierte Kursprogramme anfordern, Auskunft und Anmeldung: Erwachsenenbildung Schilter
Lebensarena PETA
Postfach 23, 6422 Steinen
Telefon 041 832 17 34
Sekr. Telefon 044 881 36 16
Daniela Keller, 8302 Kloten www.lebensarena-peta.ch info@lebensarena-peta.ch
Reif für was Neues? Fusspflegeausbildung
20-tägige Intensivausbildung bei pédi-suisse, die führende Fusspflegeschule der Schweiz.
Ideal zur Eröffnung einer Fusspflegepraxis Mit Diplomabschluss
Zu verkaufen in Gwatt/Thun, an bester Lage, sehr schönes Geschäftshaus. Eignet sich bestens für Arztpraxis
Physio- und Massagepraxis Zahnarztpraxis
Notariats-/Advokaturbüro
Nutzfläche: 349 m2
Grundstückfläche: 1500 m2
Baujahr: 2002 Parkplätze vorhanden
Kaufpreis: 1,2 Mio. Franken
Verlangen Sie unser kostenloses Aus- und Weiterbildungsprogramm. Weitere Informationen unter:
www.dobi.ch 062 855 22 44 www.pedi-suisse.ch 044 780 88 48
2012 / 2013 in CH-9042 Speicher mit Paramapadma Dhiranandaji aus Indien und Karmananda JP. Wicht www.yogalehrerausbildung.ch
Yoga-Zentrum, Tel & Fax 056 222’98’56
E-Mail: info@yoga-zentrum.ch
Interessenten melden sich unter Telefon +41 (0)79 271 43 18 Frau Jenni info@immtop.ch www.immtop.ch





















Er sei eine Art Wegbereiter für ein anderes Naturverständnis, sagt Adrian Barmet. Der 44-Jährige ist als freiwillig tätiger Riverwatcher für den WWF im Einsatz: Er beobachtet den Waldibach im Einzugsgebiet der Reuss. Der selbstständige Elektroinstallateur aus dem Kanton Luzern sagt: «Ich bin an diesem Bach aufgewachsen, deshalb liegt es mir am Herzen, dass wenigstens ein Teil des Baches wieder natürlich fliessen kann.»
Für dieses Ziel setzt der 44-jährige Familienvater mit drei Kindern im Vorschulalter im Jahr rund 100 Stunden Freiwilligenarbeit pro Jahr ein. Zurzeit gehe es darum, mit den angrenzenden Landbesitzern zu reden. Danach soll der Bachlauf in einem Waldgebiet aus der Verbauung befreit und der Hochwasserschutz naturnaher gestaltet werden.
Unentbehrlich für die Gesellschaft
«Ohne freiwilliges Engagement würden alle modernen Gesellschaften sofort zusammenbrechen», sagt der deutsche Sozio-
2011 ist das europäische Freiwilligenjahr. Schweizer und Schweizerinnen leisten jährlich rund 700 Millionen Stunden Gratisarbeit – meist kaum beachtet von der Öffentlichkeit.
Text Rita Torcasso
Adrian Barmet, Riverwatcher beim WWF.
loge Ulrich Beck über den Stellenwert der Freiwilligenarbeit. In der Schweiz sind gemäss verschiedenen Statistiken knapp 40 Prozent der Bevölkerung freiwillig tätig. Dabei wird zwischen sogenannt formell freiwilligen Tätigkeiten und informellen Hilfeleistungen unterschieden. Zu ersteren gehört die Mitarbeit in Organisationen, Vereinen oder in politischen Gremien sowie Vereinsmitgliedschaften. Als informell werden Engagements bezeichnet, die ausserhalb von Institutionen geleistet werden, zum Beispiel der wöchentliche Einkauf für die betagte Schwiegermutter oder die Aufgabenhilfe für das Nachbarskind. Insgesamt werden jährlich so rund 700 Millionen Stunden unentgeltliche Arbeit geleistet. Die Erhebung des sogenannten Freiwilligen-Monitors 2010 stellt fest, dass das Engagement der formell Tätigen gegenüber den letzten Jahren leicht rückläufig ist. Bei der informellen Freiwilligenarbeit ist dieser negative Trend deutlich spürbar: Dort sank das Engagement um acht Prozent – jede fünfte Person ist informell tätig. Ein Grund für den
Rückgang könnte die mangelnde Wertschätzung für das unentgeltliche Tun sein. Anerkennung fehlt oft Laut Freiwilligen-Monitor arbeiten die informell Freiwilligen durchschnittlich 15 Stunden pro Monat. Elsbeth Fischer-Roth von Benevol Schweiz, dem Netz von professionellen Vermittlungsstellen für Freiwillige, sagt: «Diese stillen Helferinnen und Helfer wünschen sich, dass ihre Arbeit ebenso wie bezahlte geschätzt wird und dass sie ein minimales Unterstützungsangebot und Entlastungsmöglichkeiten erhalten.» Hilfreich sind vielleicht auch die von Benevol aufgestellten Richtlinien: maximal vier Stunden pro Woche; persönliche und öffentliche Anerkennung; Einführung und fachliche Begleitung sowie Mitbestimmung bei Umfang und Dauer des Einsatzes.
Über den Stellenanzeiger des Netzwerks werden zurzeit 550 Einsätze angeboten. «Für kurzfristige Einsätze oder aber für anspruchsvolle Aufgaben, die auch länger dauern dürfen, findet man am besten Leute», sagt Geschäftsführerin Elsbeth Fischer. Etwas schwieriger sei es, für Betreuungsaufgaben wie Besuchsdienste in Pflegeheimen oder im Spital Interessierte zu finden. Zwar hat für viele Menschen die Motivation «andern zu helfen» immer noch einen hohen Stellenwert, als ebenso wichtig wird jedoch auch «Spass an der Tätigkeit» gewichtet.
Anderen zu helfen, ist für die Pflegefachfrau Olga Tresch eine soziale Selbst-
Pensionierte Berufsleute stellen unentgeltlich Beratung und Begleitung für soziale Projekte zur Verfügung.
Freiwilligenarbeit hat viele Seiten.

verständlichkeit: Sie unterstützt nicht nur ihre 90-jährige Schwiegermutter im Haushalt, bei den Finanzen und begleitet sie an Termine, jeden Montag übernimmt sie zudem auch unbezahlt die Pflege eines befreundeten Tetraplegikers, um dessen Frau zu entlasten. Die 53-Jährige sagt: «Mir geht es gut, da kann ich auch etwas für die Gesellschaft tun; es kann ja nicht immer nur ums Geld gehen.» Auch sie ortet ein Manko an Anerkennung und Wertschätzung ihres Tuns: Eine gute Idee findet sie die sogenannten Zeitgutschriften, die man bei Bedarf später einlösen könnte. Mit anderen Worten: Helfe ich heute jemandem, werde ich dafür morgen von jemand anderem unterstützt, falls ich
Freiwilligenarbeit
Als Freiwilligenarbeit wird jede Aktivität verstanden, für die ohne Gegenleistung Zeit aufgewendet wird, um einer Person, einer Gruppe oder einer Organisation zu nützen. Freiwillige Arbeit wird in formelle, institutionalisierte und in informelle Arbeit unterteilt. Informelle Arbeit findet ohne Organisationen ausserhalb des eigenen Haushalts statt. Formelle Arbeit wird in Vereinen oder für Organisationen geleistet, als Basisarbeit oder in Form von ehrenamtlichen Tätigkeiten. 2011 ist das europäische Freiwilligenjahr. Informationen zu entsprechenden Veranstaltungen finden Sie unter den «Surftipps».
dies brauche. «Ich habe keine Kinder, die mich im Alter allenfalls pflegen können», erklärt sie. Im Kanton St. Gallen wird ab Herbst in einem Pilotprojekt ein System mit solchen Gutschriften erprobt.
Eine andere Form von Anerkennung hat das Forum für Freiwilligenarbeit vor acht Jahren mit dem Sozialzeitausweis geschaffen. Die Idee: Der Ausweis informiert über geleistete Freiwilligenarbeit und kann genauso wie Weiterbildungen oder Kursbescheinigungen zum Beispiel ein Bewerbungsdossier ergänzen. Bis heute wurden aber nur 230 000 Ausweise bestellt. «Mit einer Namensänderung soll er nun vom sozialen Image wegkommen, damit ihn auch Freiwillige in den Bereichen Umwelt, Kultur oder Gemeindearbeit einsetzen», erklärt Denise Moser.
Mehr Motivation dank Unterstützung
Freiwillige, die in einem organisierten Rahmen tätig sind, bekommen je nach Institution verschiedene Arten von Unterstützung. So bietet zum Beispiel der WWF seinen Riverwatchern eine viertägige Ausbildung an. Wer nach Abschluss eines Einsatzes einen Bericht schreibt, erhält ein Zertifikat, das man gegebenenfalls bei einer Ausbildung zum Umweltberater anrechnen lassen kann. Bisher hat der WWF rund 500 Riverwatcher ausgebildet, 60 stehen zurzeit aktiv im Einsatz. Attraktive Angebote führen dazu, dass sich die Freiwilligenarbeit zunehmend auf organisierte Tätigkeiten verlagert. Bei jungen
Erwachsenen ist der Anteil bei dieser Art von Freiwilligenarbeit in den letzten drei Jahren leicht angestiegen.
Während Junge auf bewährte Organisationen setzen, erproben Senioren neue Formen wie das selbst organisierte Beratungsnetzwerk Innovage. Pensionierte Berufsleute stellen unentgeltlich Beratung und Begleitung für soziale Projekte zur Verfügung: ein Dorfmarkt, der psychisch Behinderte beschäftigt, ein Chor für Langzeitarbeitslose oder Einsätze in einem Dritte-Welt-Land.
Absehbar ist, dass nicht organisierte Hilfs- und Betreuungsarbeit, wie sie Pflegefachfrau Olga Tresch leistet, zunehmend an Stellenwert verlieren wird. Laut Bundesamt für Statistik entsprach diese im Jahr 2007 einem Wert von 18 Milliarden Franken, was 180 000 Vollzeitstellen entsprechen würde. Eine nationale Strategie, um diese informell freiwillig tätigen Leute bei der Stange zu halten, gibt es nicht. Und bis jetzt wurden auch keine zusätzlichen Mittel gesprochen, um im Freiwilligenjahr mit Aktionen die immense Arbeit der Freiwilligen zu stärken. Die Diskussion einer Motion, die dafür einen Bundesbeitrag von 125 000 Franken forderte, wurde vom Nationalrat vertagt. u
_ www.natuerlich-online.ch/surftipps








Apotheke
Mit einem Klick in die Natur. www.naturefirst.ch


Exklusives Leserangebot für Abonnentinnen/Abonnenten


Nutrexin Basen-Aktiv, 300 g, für Fr. 39.– und gratis dazu einen Stoffwechseltee, 100 g, im Wert von Fr. 14.90
Das Nutrexin Basen-Aktiv enthält eine ausgewogene Kombination von basischen Mineralsalzen zur Harmonisierung des Säure-Basen-Haushaltes, verfeinert mit Zitronensaft und Kartoffelstärke. Angereichert mit dem prebiotischen Ballaststoff Inulin.
Coupon einsenden an: freiraum AG, Mühlezelgstrasse 53, 8047 Zürich
Das Angebot ist gültig bis zum 31. 5. 2011
Ich bestelle ______ (Anz.) Nutrexin Basen-Aktiv, 300 g, zu je Fr. 39.– (plus Fr. 7.– für P & VP) und erhalte gratis dazu je einen Stoffwechseltee, 100 g, im Wert von Fr. 14.90 Preise inkl. MwSt. Ja, ich habe «natürlich» abonniert Nein, ich habe «natürlich»
Ich abonniere «natürlich» zu Fr. 84.–/Jahr nicht abonniert
Name Vorname
Strasse PLZ/Ort
Unterschrift Telefon
Zu gewinnen gibt es:
Für eine samtweiche Haut 10-mal 900 g Basenbad im Wert

Bereits die Ägypter, Griechen und Römer haben ihre Körper mit basischen Körperpflegemitteln gereinigt und in verschiedenen Kulturen kennt man noch heute das stundenlange basische Baden. Das Nutrexin-Basenbad enthält Meersalz, Himalaya-Kristallsalz und Würenloser Gesteinspulver. Ihre Haut fühlt sich nach dem Vollbad geschmeidig, samtweich und gut an. Ein herrliches Körpergefühl umgibt Sie. Sportler geniessen dieses Bad nach dem Training und Wettkampf, der Körper fühlt sich danach entspannter, lockerer und geschmeidiger an. Die Erholungsphase wird mit dieser Massnahme deutlich verbessert und der nächste Einsatz macht dadurch mehr Spass! www.nutrexin.ch
Und so spielen Sie mit: Sprechen Sie das Lösungswort unter 0901 009 151 (1.– /Anruf) auf Band. Oder senden Sie eine Postkarte mit der Lösung und Ihrer Adresse an: freiraum Werbeagentur AG, Nutrexin-Basenbad-Wettbewerb, Mühlezelgstrasse 53, 8047 Zürich. Teilnahmeschluss ist der 22. 4. 2011.
Teilnahmebedingungen: Gleiche Gewinnchancen für telefonische oder schriftliche Teilnahme. Mitarbeiter der AZ Medien Gruppe AG und Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise werden nicht in bar ausbezahlt. Es wird keine Korrespondenz geführt.
Lösung des Rätsels aus dem Heft 3-2011
Gesucht war: Slowfood

Jetzt wirds wild
«Meine wilde Pflanzenküche» –Bestimmen, Sammeln und Kochen von Wildpflanzen.
Nach über 30 Jahren, während derer Meret Bissegger ihre Restaurantgäste mit Wildpflanzen-Gourmet-Menüs verwöhnt und Kochkurse geleitet hat, erscheint nun ihr erstes Buch zum Thema. Mehr als 60 Pflanzen werden beschrieben und in Bildern vorgestellt. Gezeigt werden Standorte, Erkennungsmerkmale, Verwechslungsgefahren, die richtige Art zu pflücken und die Verwendung in der Küche. Die porträtierten Pflanzen sind im Buch botanisch geordnet. Die wichtigsten Pflanzenfamilien werden in Zusatzkapiteln mit Beispielen vorgestellt.
Das Kochbuch enthält 120 einfach nachzukochende Rezepte: Dips zum Apéro, Vorspeisen, Salate, Suppen, Risotti, Pasta, Ofengerichte, köstliche Beilagen und wunderbare Desserts. 260 Seiten; über 100 Farbfotos.
Ihr Vorzugspreis: Fr. 42.90
Statt: Fr. 49.90
Porto: Inklusive



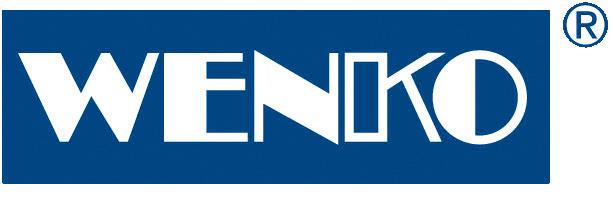
Wäschesammler / Shopper XL (38 3 55 3 64 cm).
Erhältlich in Stone, Pink, Lila.
Exklusivpreis Fr. 40.–
Porto Fr. 5.40
Staublos glücklich

Staubsauger EcoPower
Sparen Sie bis zu 50 Prozent Ihrer Stromkosten mit dem umweltfreundlichen und saugstarken Saugwunder von Trisa. Trotz geringem Stromverbrauch hat der EcoPower eine Saugleistung von 400 Watt. Er verfügt über eine elektronische Saugkraftregelung und ein Teleskoprohr mit professionellem Click-System an Griff und Düse. Der Hepafilter sorgt für hygienische und staubfreie Abluft und ist somit optimal für Allergiker! Zubehör: 4-lagiger Vlies-Staubbeutel, 3-teiliges Düsenset (Fugen-, Abstaub-, Polsterdüse); Aktionsradius von 11 m.
Vorzugspreis:
Statt: Fr. 349.–Porto: Inklusive


Design-Taschen von Wenko

Shopper (42 3 62 3 40 cm).
Erhältlich in Stone, Pink, Lila.
Exklusivpreis Fr. 39.–
Porto Fr. 5.40
Die trendigen Taschen in zwei verschiedenen Grössen sind vielseitig einsetzbar: zum gemütlichen Shoppen, in den Ferien als coole Strandtasche, perfekt zum Picknick im Grünen oder als Wäschesammler.
Die Taschen sind aus strapazierfähigem Kunststoff, handlich und wunderbar leicht. Sie sind in dezentem Stone, frechem Pink und stylischem Lila erhältlich. Ein modisches und zugleich praktisches Accessoire für die ganze Familie.
Raspelspass
Fresh Express
Bringen Sie Farbe in Ihre Küche mit dem Fresh Express von Moulinex! Ein kompaktes und einfach zu bedienendes Gerät, das innerhalb kürzester Zeit Gemüse und Obst raspelt und schneidet. Der Fresh Express verfügt über einen eingebauten Stauraum, um die Zubehörteile zu verstauen, damit Sie diese immer zur Hand haben. Im Lieferumfang enthalten sind 5 farbige Aufsätze: 2 Trommeln zum Gross- und Kleinreiben, 2 Trommeln zum Gross- und Kleinschneiden und 1 spezielle Parmesanreibe. Der Durchmesser der Öffnung beträgt 47 mm.
Leistung: 150 Watt.
Ihr Vorzugspreis: Fr. 89.90
Statt: Fr. 99.–
Porto: Inklusive

Eierkocher «Eggolino»


Wüstensandpeeling – Orientzauber mit Arganöl Frühjahrskur für Ihre Haut: Der Sand entfernt alte Hautschüppchen, das Salz wirkt reinigend und desinfizierend. Das Arganöl (7 Prozent) pflegt die Haut, macht sie weich und geschmeidig und verleiht ihr Glanz und einen Hauch von orientalischem Duft. Das wertvolle Arganöl wird im Südwesten von Marokko traditionell ausschliesslich von Frauen hergestellt, die in über 50 Kooperativen organisiert sind. Dies sichert ihnen ein regelmässiges Einkommen und erlaubt ihnen so, ihre Familien eigenständig zu ernähren und ihre Kinder zur Schule zu schicken.
Unterstützt werden die Frauenkooperativen von der GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit). Les Sens de Marrakech stellt aus dem Öl hochwertige Kosmetik her, die Produkte enthalten weder Farbstoffe noch Mineralöle, werden ohne Tierversuche hergestellt und sind dermatologisch getestet.
Perfekt gekochte Eier können Sie ab jetzt, wann immer Sie möchten, geniessen. Der «Eggolino» von Trisa bietet Platz für drei Eier und kocht diese in drei Stufen: weich, mittel, hart. Vor allem für den Kleinhaushalt geeignet. «Eggolino» glänzt durch sein platzsparendes, schmales Design und in der einfachen Gandhabung. Eier- und Wasserbehälter sind antihaftbeschichtet leicht zu reinigen. Das Gerät verfügt über einen Ein- und Ausschalter mit Kontrollleuchte und Endsignal, einen Dosierbecher mit einer Skala für weich, mittel und hart und einen Eierpicker. Ausserdem hat er eine Kabelaufwicklung. Leistung: 320 Watt; Kabellänge: 70 cm; Masse (L 3 B 3 H): 22,5 3 7 3 13,5 cm.
ACHTUNG: das Produkt ist erst ab KW 14/15 lieferbar.
Ihr Vorzugspreis: Fr. 29.90
Statt: Fr. 34.–
Porto: Inklusive
Die wunderschön ausgeschmückten Verpackungen mit einzigartigem Design werden in Handarbeit von Handwerkern und Künstlern in der Medina von Marrakesch hergestellt.
Das Körperpeeling von Les Sens de Marrakesch aus Arganöl, gemischt mit Wüstensand und marokkanischen Salzkristallen, ist in den Düften Ambre und Musc – reinigend, stärkend, sinnlich – und Verveine – erfrischend und belebend – erhältlich. Inhaltsstoffe: Salz, Sand, Arganöl, Inhalt: 200 Gramm.

Ihr Vorzugspreis: Fr. 55.–
Statt: Fr. 65.–
Porto inklusive




Anmeldung Erlebniskurs «Kräutergarten» mit Remo Vetter
Dienstag, 17. Mai 2011 Anzahl Personen
Donnerstag, 7. Juni 2011 Anzahl Personen
Donnerstag, 23. Juni 2011 Anzahl Personen
Kurskosten für Abonnenten Fr. 110.–, für Nichtabonnenten Fr. 150.–
Name / Vorname
Strasse
PLZ /Ort
Telefon
Datum, Unterschrift
Abonnent Nichtabonnent
Anmeldeschluss: 29. April 2011 (Datum des Poststempels)
Erlebniskurs «Kräutergarten»
«Learning by doing – learning by gardening » Nehmen Sie sich Zeit, lassen Sie den Alltag hinter sich und freuen Sie sich auf kreative Gartenideen. «natürlich»-Gartenkolumnist Remo Vetter und seine Frau Frances, Autoren des Buches «The Lazy Gardener», begleiten Sie durch den Tag, vermitteln Tipps und Tricks im Umgang mit den Pflanzen und führen Sie ein in die faszinierende, ganzheitliche Philosophie von A. Vogel.
Kursinhalt
l Vortrag: Die Gartenphilosophie des «Lazy Gardener» l aktive Mitarbeit im Kräutergarten l anlegen eines Kräuterbeetes für die Küche l bearbeiten eines Hügelbeetes l Bodenpflege und Bodenkosmetik l ansiedeln von Nützlingen l Tinkturenherstellung und Degustation von A. Vogel-Produkten l A. Vogel-Shop mit Spezialangeboten l gemeinsames Mittagessen l Überraschungsgeschenk
Kursdaten
Dienstag, 17. Mai 2011
Donnerstag, 07. Juni 2011
Donnerstag, 23. Juni 2011
Zeit
9.30 –16.30 Uhr
Kursort
A. Vogel GmbH, Teufen
Kurskosten für Abonnenten Fr. 110.–
Kurskosten für Nichtabonnenten Fr. 150.–
Einsenden an: AZ Fachverlage AG, natürlich-Kräutergarten, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau oder sich anmelden unter www.natuerlich-online.ch/Marktplatz
Seminare
Heilende Kraft der Klangschalen 20. 4. 2011
Menschen- und gengerechte Nahrung 27. 4. 2011
Kurhaus St. Otmar
Rigiblickstr. 98, 6353 Weggis Tel. 041 392 00 10 www.otmarsan.ch

Tag der Homöopathie Homöopathie hautnah
14. 5. 2011, 9 –16.30 Uhr
SHI Homöopathie Schule 6300 Zug Tel. 041 748 21 77 www.shi.ch
Psychologischer PatientenCoach IKP
Gratis Infoabend 13. 4. 2011 in Zürich, 18.30 –20.30 Uhr
IKP, Kanzleistrasse 17, 8004 Zürich Tel. 044 242 29 30 ikp-therapien.com
Shiatsu-Infoabend 19. 4. 2011, 19.30 –22 Uhr
Heilende Laute 10. 5. 2010
Ko Schule für Shiatsu Enzianweg 4, 8048 Zürich Tel. 044 942 18 11 www.ko-shiatsu.ch
Kraft der Klänge «Im Einklang mit der Seele sein» 8.–13. 5. 2011
Hotel Sass da Grüm
6575 San Nazarro Tel. 091 785 21 71 www.sassdagruem.ch www.kreative-klangpraxis.ch
Aus der Stille in den Tanz 29. 4. 2011
Tagungshaus Rügel Tel. 062 838 00 10 www.ruegel.ch
Kriya Yoga mit Kripababdamoyima
7./ 8. 5. und 3./4. 9. 2011
Zollikon (Zürich) 16.–23. 7. 2011 Naturns Südtirol
Sabine Schneider Tel. 044 350 21 89 www.kriya-ch
Ayurveda-Einführung für Ahnungslose 9. 4. 2011
EMR konformer Lehrgang ayurQuell, 4600 Olten Tel. 076 398 86 86 www.ayurquell.ch
Meditative Fastenferien 9.–16. 4., 16.–23. 4., 23.– 30. 4., 30. 4.–7. 5. 2011
Parkhotel Beatenberg Essenz-Institut
8260 Stein am Rhein
Tel. 052 741 46 00 www.fasten.ch
Lehmerlebnis-Lager Für Familien
25.–29. 7. 2011 bei Lieli AG
Tel. 079 434 85 78 www.eccoterra.ch
Wandern
Wildkräuter-Kochwanderkurs 6.– 8. 5. 2011 mit Erica Bänziger, Kochbuchautorin
Casa Santo Stefano Tel. 091 609 19 35 www.casa-santo-stefano.ch
Fastenwandern im Wunderland Schweiz 9.–16. 7. 2011, Davos 11.–18. 9. 2011, Mannebach 24. 9.–1.10. 2011, Gstaad 8.–15.10. 2011, Appenzell
Maya Hakios, Manzenweg 19 8269 Fruthwilen
Tel. 071 664 25 29 www.fastenwandern.ch
Fasten – Wandern – Wellness 9.–16. 4. und 30. 4.–7. 5. 2011 in Serpiano TI 14.– 21. 5. 2011 in St. Moritz
Ida Hofstetter, Neuhofstr. 11 8708 Männedorf
Tel. 044 921 18 09 www.fasten-wandern-wellness.ch
Heilkräuterwanderung 21. 5. und 23. 5. 2011
Brigitt Waser-Bürgi Herreneggstr. 1 6417 Sattel Tel. 041 835 19 25 www.heilpflanzenfrau.ch
Wildkräuter-Wanderwoche 14.– 21. 4. 2011, Mallorca Tel. 079 633 14 67 mirjam.maag@bluewin.ch
Quelle –Skulpturenausstellung 17. 4. 2011, 18 Uhr, Vernissage Seminar Kulturhotel Möschberg bei Grosshöchstetten www.hotelmoeschberg.ch
Sechseläuten 10.–11. 4. 2011 Sechseläutenwiese, Zürich www.sechselaeuten.ch
Vitrofestival
Glaskunstfestival 15.–17. 4. 2011
Château et alentours Romont FR www.vitromusee.ch

Im Reich der Zeichnung
Bis 25. 4. 2011, 10 –17 Uhr
Aargauer Kunsthaus Aargauerplatz, 5001 Aarau www.aargauerkunsthaus.ch
Theatre Marie 15. 4. 2011, 20 Uhr Kleintheater Luzern Bundesplatz 14, Luzern Tel. 041 210 33 55
Skulpturen in Beton
Bruno Weber und Heidi von Arx 24. 4. 2011, 14 –17 Uhr Singisenforum Pirmin Breu 5630 Muri Tel. 056 664 37 90 www.breuart.ch www.murikultur.ch
Weitere Veranstaltungen finden Sie auf _ www.natuerlich-online.ch /agenda
Lucerne Festival Klassik-Festival 9.–17. 4. 2011 www.lucernefestival.ch
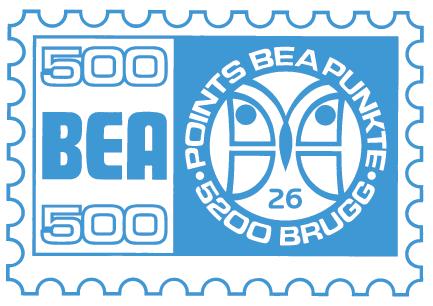
Sammeln+Prospekt verlangen, 056 4442222
BEA-Verlag, 5200 Brugg 056 444 22 22, bea-verlag.ch
BEA-Verlag 5200 Brugg 056 444 22 22 bea-verlag.ch
Ist es das,wonach Sie suchen?
Spirituelle Weisheit zu Gesundheit und Heilung
Bestellen Sie kostenlos: www.eckankar.ch

Es gibt Orte, von denen eine spürbare positive Kraft ausgeht. Hier können Sie Energie tanken und entspannen. Verlangen Sie kostenlos Unterlagen.
Hotel Sass da Grüm ,Tel. 091 785 21 71 CH-6575 San Nazzaro, www.sassdagruem.ch

leicht, frei, energievoll, reich, wohlig, glücklich, seelig, offen, vital, lustig, erholt, neu, frisch, fröhlich, fit, regeneriert, schön, jung... einfach fastinierend!
Erfahren Sie das Fasten! Wirbegleiten Sie persönlich, und das am schönsten Platz der Schweiz.
OTMARSAN AG, Kurhaus St. Otmar Familie Maya &Beat Bachmann-Krapf CH-6353 Weggis Telefon 041392 00 10 E-Mail kurhaus@otmarsan.ch Internet www.otmarsan.ch
Einführungskurse in die Meditationstechnik nach der Tradition von Babaji, Paramahansa Yogananda (Autorvon «Autobiographie eines Yogi») bis Paramapadma Dhiranandaj
Zürich/Zollikon: 7./8. Mai, 3./4. September Südtirol:16. -23. Juli Schwarzwald: 7. -14. Oktober www.kriya.ch
Kursleitung: Barbara Glauser-Rheingold, autorisierte Kriya Yoga Lehrerin
Information: Sabine Schneider, Tel. 044 350 21 89, sabine.schneider @ kriya.ch

Nägeli-Neff Margrit
certif ied Advanced Rolfer
Tel. 044 362 61 23
Die integrier te Str uktur, die im Rolf ing angestrebt wird, vermeidet die Fehlbelastung von Gelenken und Überlastung der Gewebe. Der Kör per bef indet sich wieder in Balance und Einklang mit der Schwerkraft. Tiefe manuelle Bindegewebsarbeit, verbunden mit sensitiver Bewegungsschulung, er möglicht eine differenziertere Selbstwahrnehmung. Arbeitsorte: ZH, Vella (GR), Schaan (FL)



Tipilager für7-11Jährige Sommerferien Tipilager für9-14Jährige Sommerferien www.naturschule-woniya.ch /081 6300618

(8) 9.–13.5. Klangschalen und Gongs* 28/29.5 Klangschalen 25/26.6. Gongs 17.9 bis 25.9 Intensiv-Ausbildung zum Klangtherapeuten nach Walter Häfner Ausbildung ideal in Kleingruppen, max. 6 Teilnehmer! Kurse in Birr/AG. * Kurs im Hotel Sass da Grüm/TI Fortlaufend Klangmeditationen!
Wolfgang Rogg, Klangtherapeut Hinterhofstrasse 25, CH-5242 Birr Telefon 056 444 95 43 und 076 375 95 43 www.kreative-klangpraxis.ch
Schulmedizin 150, 200, 600 Std. Für alle Ausbildungen der Komplementärmedizin
Traditionelle Chinesische Medizin Grundlagen, Akupunktur, Tui-Na
Traditionelle Europäische Naturheilkunde (TEN) - Ernährungsheilkunde
Reflexzonenmassage
SAKE BILDUNGSZENTRUM, 3014 BERN 031 352 35 44, www.sake.ch, info@sake.ch
ner giepr ojekte. ch 041 660 88 91 „Wir sind einTeilder Naturund die Natur istein Teil vonuns.“ Stalking Wolf Angebote füreinestärkereVerbindung zurNatur





Kräuterwoche in Unterbäch
Vom 10. bis 16. Juli bietet das Hotel Walliserhof in Unterbäch im Wallis eine Kräuterwoche an. Unter der Leitung von Anita Heynen, einer bestens ausgewiesenen Kräuterfachfrau, werden fünf mittlere und leichte Wanderungen in der Augstbordregion gemacht, um die Heilpflanzen an ihrem natürlichen Standort kennenzulernen. Dabei erfahren sie Interessantes über Mythologie, Heilkraft und Anwendung der Pflanzen. Auch die Herstellung einer Tinktur, einer Salbe, eines Lippenbalsams und eines Räucherstrausses gehört zum Programm.
_ Hotel Walliserhof, Unterbäch, Tel. 027 934 28 28. Arrangement mit sechs Übernachtungen und Halbpension, Fr. 930.–, www.rhone.ch/hotel-walliserhof

Die Feuerstellen von Toni Halter zelebrieren das Feuer als optisches Kunstwerk.Trotzdem muss man nicht auf das komfortable Grillieren oder das Kochen eines feinen Risottos verzichten. Die Feuerstellen gibt es in verschiedenen Ausführungen, zum Beispiel mit Kugelfüssen oder mit höheren Ständern. Das Zubehör besteht aus einem verschiebbaren Windschutz und einer schlichten Aufhängung für Grillrost und «Kessihalterung»
_ Weitere Infos: Toni Halter, Giswil Tel. 041 660 88 91, www.energieprojekte.ch
Ur-Dinkel gegen Schmerzen
Das reichhaltige Leony UrDinkelspreu umfasst unter anderem Ellenbogenstulpen gegen Epicondyliltis, im Volksmund Tennisarm. Die Kieselsäure Ausstrahlung verhilft zu besserer Durchblutung und Schmerzfreiheit ohne unerwünschte Nebenwirkungen. _ Informationen Albert Christen, Bettlach Tel. 032 645 12 87, www.leony-bettlach.ch

Intensive Pflege für die Haut ab fünfzig

Die Haut ab fünfzig benötigt mehr Unterstützung bei der Regeneration. Intensivierte Feuchtigkeitszufuhr ist nötig, damit sich die Faltenbildung verzögert und der Teint weiterhin gesund aussieht. Mit der neuen Pflegelinie Rich widmet sich Botarin speziell den veränderten Ansprüchen der reiferen Haut. Eine ausgeklügelte Textur mit reichhaltigen Wirkstoffkombinationen und Hyaluronsäure garantiert Premiumpflege mit Liftingeffekt auf höchstem Niveau. Erhältlich sind: Tages und Nachtcreme, Augenpflege und die Botarin Lifting Icemask.
_ Erhältlich in der Apotheke, im Onlineshop unter www.botarin.ch oder telefonisch unter 041 560 37 10
Mit täglichen YogaLektionen und geführten Wanderungen den Alltag hinter sich lassen und die Balance wieder finden. Die sanften Hügel, die Berge und die ruhige Umgebung im Appenzell bieten den idealen Platz dafür. Und dank der Appenzeller Ferienkarte geniessen Sie die touristischen Attraktionen zum Nulltarif. Dieses Angebot gilt im Mai, Juni und Oktober. Genaue Daten über Appenzellerland Tourismus. 4 oder 5 Nächte inklusive Halbpension, YogaLektionen und Wanderungen, Wellness sowie Appenzeller Ferienkarte ab Fr. 650.–. _ Mehr Infos und Buchung: www.appenzell.info info@appenzell.ch

Appenzellerland Tourismus AI, Hauptgasse 4, 9050 Appenzell Tel. 071 788 96 41
Einzigar tig im Geschmack. Einzigar tig im Gehalt. Neu auch mit Dinkel.
Erhältlich in Drogerien, Reformhäusern sowie im Bio- und Lebensmittelfachhandel.



Naturheilkundliches Therapiezentrum RUWASCA

Rücken- u.Gelenkprobleme
Raucherentwöhnung
Colon-Hydro-Therapie
Migräne u. Spannungskopfweh phone: 062 923 57 60 home: www.ruwasca.ch mail: info@ruwasca.ch










Fastenwandern
im WunderlandSchweiz mitMaya+Liselotte …fröhlich-gesundeWochen unter kundiger Leitung …entspannen, entschlacken, Gewicht verlieren, Vitalität gewinnen!
Gratis-Infobei: Maya Hakios, CH-8269 Fruthwilen
Tel. 071 664 25 29, www.fastenwandern.ch
ANDALUSIEN / SÜDSPANIEN Ferien auf der Biofinca El
Wellness, veget. Essen, 1,5 km vom Mittelmeer, familienfreundlich. www.fincaelmorisco.eu Telefon 0034 952 514 712
Fasten–Wandern–Wellness
Fasten schafft Platz, in vielerlei Hinsicht. Ida Hofstetter, Telefon 044 921 18 09 www.fasten-wandern-wellness.ch
Meditative Fastenferien
16.–23.4., 23.–30.4., 30.4.–7.5. +3.–10.10.,10.–16.10. im Parkhotel Beatenberg. Sommer am Bodensee. Mit Meditation, Energie-und Klangarbeit, Qi Gong, Tanz, Musik, Matrix Transformation, Massagen etc. Fr 970.– Einzelzimmer mit Bad, Kursangebote inkl. ✆ 052 741 46 00, www.fasten.ch


TOP HELLSEHERIN MAR Y
Te lefon 0901 555 503 ab Festnetz Fr 3.–/Min.


Visionar y Craniosacral Work GmbH

Hugh Milne – Visionäre CraniosacralThera pie, Weiterbildung
VCSW GmbH, Rainstr 241, 8706 Meilen, Tel./Fax 044 793 44 55, VisionaryCSW@hotmail.com 32140-01
Zeigt die Summe der Kräfte in Körper-Seele-Geist. Mehrfarbig, Kalenderform, Taschenformat, 12 Monate Fr. 36.–. Bitte Geburtsdaten an: Hermann Schönenberger, Churerstr. 92 B, 9470 Buchs SG Telefon 081 740 56 52, bioschoen@bluewin.ch


AG, CH-9642 Ebnat-Kappel www.morga.ch

•KräuterwanderninWald +Wiesen
•Kneippen am Grächer-See
•Bachblüten-Pfad begehen
•Edelsteine +ihreWirkungen erfahren
•Stille geniessen
1Woche: Kost, Logie +SeminarFr. 490.–

Infos +Anmeldungen: Rikie Hegglin Edelsteinladen te CoopSeewen-Center,Seewen/SZ Tel. 079600 04 20
TV-Film mit Expertin Bliklen und Dr. der Biologie über Gewürzheilkunde Altes Wissen, vonwestlicher Wissenschaft und Medizin neu entdeckt. Eine Fundgrube für arzneilich wirksame Substanzen! Film befindet sich in oben genannter Internetseite

Stephan Kuhn Planung und Realisation von natur nahen Gärten
Huenerwadelgasse14 Jurastrasse 23 5034 Suhr 3013 Bern Tel. 079530 61 38
ganzheitliches arbeiten mit naturfarben pflanzenlasuren lehmbau, tadelakt geomantie www.naturfarben-malerei.ch
Telefon 079 677 08 74 naturfarben-malerei weber GmbH www.zimt-produkte .ch www.zimt-produkte .de Telefon 071 277 36 16

Berufsbegleitende Ausbildung in körperzentrierter Beratung IKA Beginn: 8. Oktober 2011 www.integrativekoerperarbeit.ch Denise Weyermann 079 459 14 04
31. Jahrgang. ISSN 2234-9103
Erscheint monatlich.
www.natuerlich-online.ch
Leserzahlen: 159 000 (MACH Basic 2010-2)
Auflage: 50 000 Exemplare, verkaufte Auflage 39 222 Exemplare.
Kontakt: Alle Mitarbeiter erreichen Sie unter vorname.name@azmedien.ch
Herausgeberin
AZ Fachverlage AG
Neumattstrasse 1
CH-5001 Aarau
Tel. +41 (0)58 200 56 50
Fax +41 (0)58 200 56 44
Geschäftsführer
Dietrich Berg
Leiterin Zeitschriften
Ratna Irzan
Redaktion natürlich leben
Postfach
CH-5001 Aarau
Tel. +41 (0)58 200 56 50
Fax +41 (0)58 200 56 44
Chefredaktor
Markus Kellenberger
Redaktionsteam
Tertia Hager
Sabine Hurni (Leserberatung)
Autoren
Suleika Baumgartner, Veronica Bonilla, Pier Hänni, Susanne Hochuli, Heini Hofmann, Heinz Knieriemen, Isabelle Meier, Rita Torcasso, Remo Vetter, Andreas Walker
Copyright
Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung für eingesandtes Material. Die Wiedergabe von Artikeln und Bildern ist nur mit ausdrücklicher
Genehmigung des Verlages erlaubt.
Anzeigenleitung
Christian Becker
Tel. +41 (0)44 709 19 20
Rolf Ulrich
Tel. +41 (0)44 710 19 91
Webereistrasse 66
CH-8134 Adliswil
Fax +41 (0)44 709 19 25 cebeco@bluewin.ch
Anzeigentarife unter www.natuerlich-online.ch
Anzeigenadministration
Nicole Flückiger
Tel. +41 (0)58 200 56 16
Leiter Lesermarkt/Online
Valentin Kälin
Aboverwaltung abo@natuerlich-online.ch
Tel. +41 (0)58 200 55 62
Preise
Einzel-Verkaufspreis Fr. 8.–1-Jahres-Abonnement Fr. 84.–2-Jahres-Abonnement Fr. 148.– inkl. MwSt.
Layout/Produktion
Renata Brogioli, Fredi Frank Druck
Vogt-Schild Druck AG, CH-4552 Derendingen
Ein Produkt der Verleger: Peter Wanner
CEO: Christoph Bauer www.azmedien.ch
Namhafte Beteiligungen nach Art. 322 Abs. 2 StGB:
Aargauer Zeitung AG, AZ Anzeiger AG, AZ Crossmedia AG, AZ Fachverlage AG, AZ Management Services AG, AZ Vertriebs AG, Media Factory AG , Basellandschaftliche Zeitung AG, Berner Landbote AG, Mittelland Zeitungsdruck AG, Radio Argovia AG, Radio 32 AG, Radio 32 Werbe AG, Solothurner Zeitung AG, Tele M1 AG, TMT Productions AG, Vogt- Schild Anzeiger AG, Vogt-Schild Druck AG, Vogt-Schild Vertriebs GmbH, Weiss Medien AG

Wolf-Dieter Storl kennt die Pflanzen auf Wiesen und in Wäldern wie kein zweiter. Der Ethnobotaniker weiss genau, wie unsere Pflanzen wirken – und welch gewaltige spirituelle Kraft ihnen innewohnt.

Schluss mit Bohren und Ziehen. Ganzheitlich behandelnde Zahnmediziner gehen ihren Patienten weniger auf den Nerv.

Die Schweiz ist ein Land voller Naturschönheiten und Naturparks. Doch nicht überall sind geschützte Zonen willkommen.
l Süsskartoffeln: tolle Knollen l Tennisarm: weg mit dem Schmerz l Remo Vetter: im Gartenparadies l Wandern: wilde Bergnächte
«natürlich» 05-2011 erscheint am 28. April 2011
Kontakt /Aboservice: Telefon 058 200 55 64, Fax 058 200 55 63 oder abo@natuerlich-online.ch, www.natuerlich-online.ch

Susanne Hochuli steigt auf ihr Hausdach und ruft dort voller Inbrunst nach den Göttern – in der Regel kommt dann der Nachbar.
Besen in der Hand. Mit Todesverachtung kletterte ich hoch bis zum bekannten Kamin, band ein Seil darum, schlang mir das andere mit einem Samariterknopf um den Bauch, führte es um das Kaminseil und hielt das Ende als Sicherung in der Hand.
Wenn Sie zu meinen Stammleserinnen undlesern gehören, dann wissen Sie, wie das Leben einer Regierungsrätin aussieht: Sie muss sich Gedanken über ihre Garderobe machen, fährt im Staatswagen mit dem DvH (Departementsvorsteherinnenhund), übt am Apéro riche, nicht in Fettnäpfchen zu treten, sitzt stundenlang an Sitzungen und ebenso lang über Akten, darf vor nichts Angst haben, sucht im Militär nach Engeln und –regiert.
Was macht sie ausserdem?, mögen Sie sich vielleicht fragen. Das Regieren lässt nicht viel Zeit für Sonstiges. Die restliche Zeit wird genutzt mit Zähneputzen, Schlafen, Essen – Dinge eben, die alle tun und die zum Alltag gehören. Und so habe ich an einem sonnigen Sonntag im Februar den Blick in die Höhe gelenkt und erkannt: Das herbstliche Laub liegt noch auf dem Dach. Die Sonne versprach schon den Frühling und das alte Jahr war noch nicht weggeräumt. Deshalb entschloss ich mich, aufs Dach zu steigen. Zugegeben: Vor drei Jahren hatte ich denselben Gedanken und sass dann, von Höhenangst gelähmt, hinter dem Kamin. Damals rief und rief ich, bis meine Schreie erhört und ich vom Dach gerettet wurde. Als Regierungsrätin bin ich schlauer geworden. Erstens habe ich nun ein Handy. Und zweitens habe ich am Kaderseminar «No risk, no fun» der kantonalen Verwaltung gelernt: Vor jedem Risiko absichern! Also stellte ich die Leiter an und stieg aufs Dach: Das Handy in der Tasche, zwei Seile und ein
«Ich sitze auf dem Dach, kannst du mich herunterholen?»
Tapfer begann ich, das Laub in die Tiefe zu kehren. Es ging sehr tief hinunter. Manchmal rutschten die Schuhe auf den alten Ziegeln. Manchmal wollte der Besen mit dem Laub hinunterfallen. Manchmal ruckelte das Seil bedenklich. Und immer klopfte das Herz vor Angst. Der sichere Boden war weit entfernt, und das Dach wurde steiler und steiler. Irgendwann sass ich wieder schlotternd dort, wo ich vor drei Jahren gesessen hatte: hinter dem Kamin. Ich wusste schlagartig: Da komme ich nicht mehr alleine hinunter, Seilsicherung hin oder her. Ich schwor mir, nie, nie wieder auf das Dach zu steigen. Es kam mir Psalm 121 in den Sinn, vertont von Mendelssohn: «Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuss nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht.» Mit klammen Fingern klaubte ich das Handy aus der Tasche. Ich rief einen Nachbarn an, Sonntagabend um halb sechs, und sagte: «Ich sitze auf dem Dach, kannst du mich herunterholen?» Er konnte. Kaum sah ich sein vertrauenswürdiges Gesicht über der Dachrinne erscheinen, seilte ich mich professionell ab. Nächstes Jahr werde ich Nagelschuhe und eine Bergsteigerausrüstung tragen und einen Bergführer mitnehmen. Denn das alte Jahr muss weggeräumt werden, auch vom Dach. Die Ziegel sind jetzt laubfrei. u
Susanne Hochuli, erste grüne Regierungsrätin im Aargau, ist Mutter einer 16-jährigen Tochter und wohnt auf ihrem Biobauernhof in Reitnau, der vom besten Bauern der Welt bewirtschaftet wird.