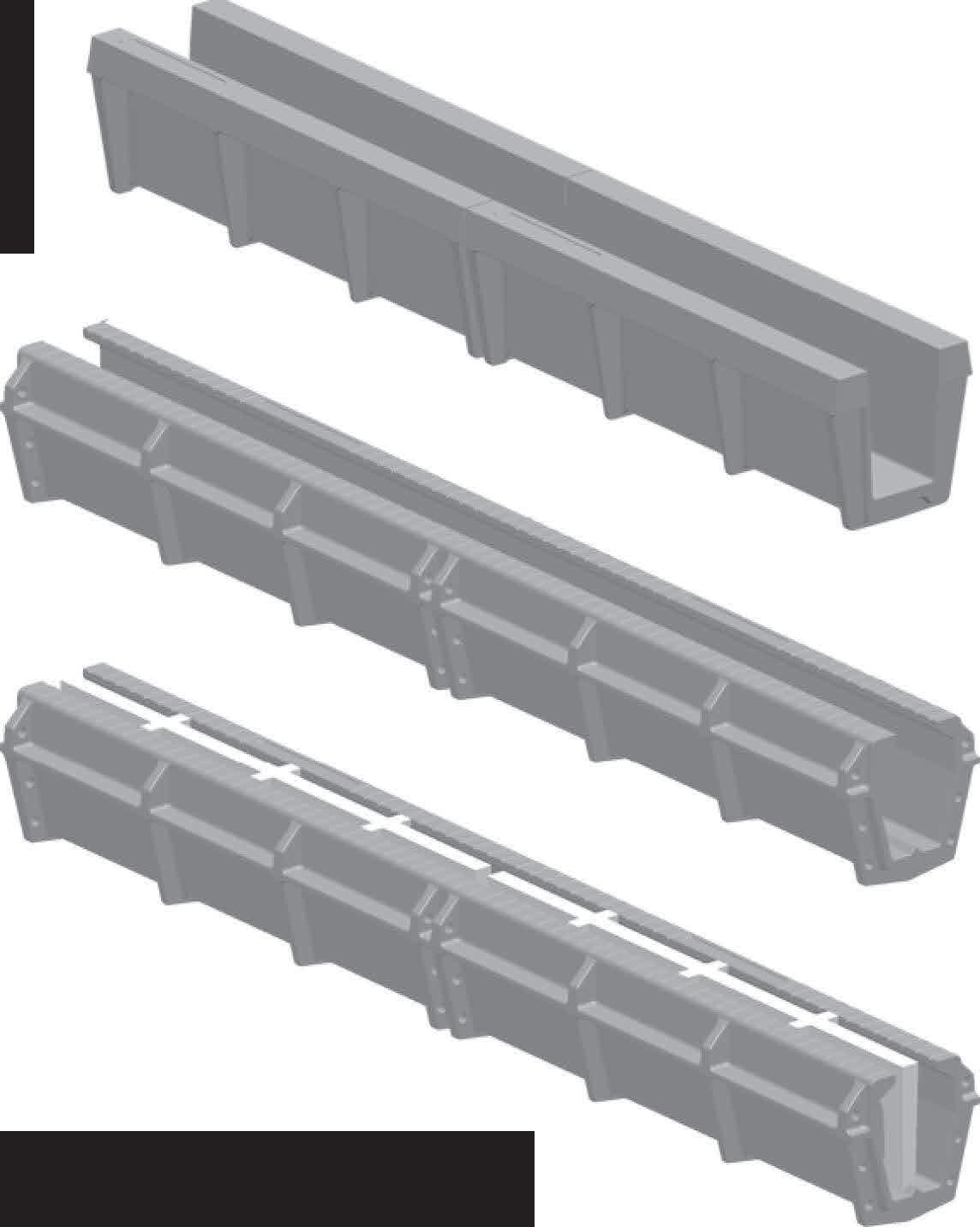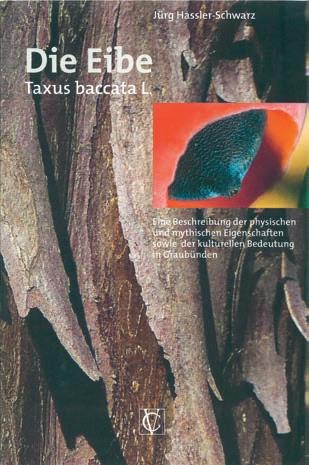Bündner Wald

Einheimische Föhren Jahrgang 76 | Februar 2023
Darüber hinaus bieten wir individuelle Lösungen für:
Verankerte Stützwände
Arbeiten am hängenden Seil
Felsräumungen
Sprengarbeiten
Hangsicherungen
Steinschlagverbauungen
Lawinenverbauungen er er a e sarbeite i r e it e a er
Inklinometer
Sondier- und Abtastbohrungen
Gunit- und Spritzbetonarbeiten
Ihr Partner für höchste Ansprüche: www.vetsch-klosters.ch

info@vetsch-klosters.ch
Telefon 081 422 14 48 ANZEIGE
Für jeden Einsatz haben wir die passende Maschine.
• Eco-log 590e mit Traktionswinde
• Eco-log 560e mit Mehrbaumaggregat
• John Deere 1510E mit Traktionswinde
• John Deere 1010E
• Eco Log 574 F mit 800er Bereifung
• Hacker Albach Diamant 2000

• Spezialschlepper mit 9+13t Seilwinde und starkem Kran mit Greifersäge
• Bobcat mit Seilwinde und Zubehör
Ihr Spezialist für die vollmechanisierte Holzernte am Hang!
Volktrans GmbH
www.volktrans.ch

ANZEIGE HOCHBAU TIEFBAU
KUNDENMAURERSERVICE
TRANSPORTE SCHWERTRANSPORTE
e serwe i ers e
ai info@volktrans.ch
Inhalt



Titelbild: Föhre beim Ellhorn in Fläsch. (Bild: Alain Schmid, SELVA)

Editorial 4 Ökologie der Waldföhrenwälder 8 Die Vielfalt der Waldföhrenwälder in Graubünden . . . . . . . 14 Ökologisches Porträt der Bergföhren im Nationalpark 18 Die Engadinerföhre: Mythos oder Rarität? 24 Schwarzföhre – Sonnenanbeterin mit Potenzial . . . . . . . . 26 Waldföhren im Forstgarten 30 Einheimisches Föhrenholz – Vergessene Handwerkskunst oder die Zukunft? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Die Kiefer als «Brotbaum des historischen Zeidler-Handwerks» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Kiefernharzung – ein vergangenes Kapitel Industriegeschichte 42 Föhren als Nahrungsquelle für das Auerhuhn 46 Herr der Ringe 48 Schmetterlinge an Föhren 50 Orchideenvielfalt in Bündner Waldföhrenwäldern 54 Buchrezension: «Wölfe in der Schweiz –Eine Rückkehr mit Folgen» 58 Die Eibe – interessant und verborgen 62 Vorschau «Bündner Wald» April 2023 . . . . . . . . . . . . . 63
34 38 18
Bergföhrenwälder wie hier im Drussetschawald Davos sind lichtdurchflutet und haben dementsprechend eine üppige Bodenvegetation. Je nach Standort ist diese durch Zwergsträucher oder Gräser dominiert. Die Bäume sind sehr schlank und vollholzig. Trotz ihres geringen Brusthöhendurchmessers können sie, je nach Standort, mehrere Hundert Jahre alt sein. (Bild: Jürg Hassler, AWN)




Die Föhre hat nicht nur viele Namen, darunter natürlich Kiefer, aber auch Pinus, Dähle, Dale, Forche, Kienbaum, Täla, Grasse, Mentlix und andere mehr. Sie hat auch ausserordentlich viele Gesichter. So ist sie eine äusserst anspruchslose Extremistin, die jedwelche klimatische Bedingungen akzeptiert und auch dort gedeiht, wo andere Baumarten keine Chancen haben. Allerdings ist sie gleichzeitig quasi Pazifistin und als solche unterliegt sie im Konkurrenzkampf mit anderen Arten, sobald der Kampf um Licht härter wird. Sie ist äusserst robust. An den steilsten Hängen im Nationalpark überlebt die Legföhre gar Steinschlag, Schneedecken und alljährliche Lawinen. Ebenso klaglos ertrug sie intensives Harzen, wie es etwa in der früheren DDR zur Versorgung der Industrie mit Terpentinöl und Kolophonium jahrzehntelang erfolgte. Ferner ist sie gastfreundlich und lässt ganze Bienenvölker in ihrem Stamm wohnen und arbeiten, sofern die Höhle fachkundig gemacht ist. Das historische Handwerk des Zeidlerwesens diente früher der Honigernte, heute wird es aus Biodiversitätsgründen vor dem Verschwinden gerettet.
Nicht ganz anspruchslos ist hingegen das Sammeln der Föhrensamen. Über die aufwendige Aufzucht der nächsten Föhren-Generationen liest man im Bericht des Kantonalen Forstgartens Rodels. Doch lohnt sich die Pflege der Föhrenwälder gerade in Graubünden. Denn im Föhrenwald finden andernorts zunehmend verdrängte Flora und Fauna den passenden Lebensraum. Orchideen, Kleinschmetterlinge, aber auch Auerwild, Spechte und andere rare Schönheiten profitieren vom lichten Waldhabitat. Hat die Föhre als Baum ausgedient, wird ihr Holz zunehmend gerne für witterungsbeständige, schöne Bauten im Aussenbereich verwertet. Die einheimischen Föhren verdienen unsere Hochachtung.
Die Arve wird ihren grossen Auftritt in der JuniAusgabe des Bündner Wald erhalten, sie steht in diesem Heft daher nicht im Fokus.
6
Editorial
Redaktorin Susi Schildknecht
Kraft Präzision Verlässlichkeit
Wir sind genau, effektiv und modern. Zudem zeichnet uns das spezielle Transportsystem, die Arbeitssicherheit sowie das umweltschonende Arbeiten aus.
AG

Industriestrasse 19 CH-7304 Maienfeld
Telefon +41 81 303 73 . r. e er@tabrec.swiss
Sie suchen Querabschläge aus Eisenbahnschienen?

Wir haben handelsübliche Längen sofort verfügbar / Spezial-Längen in kurzer Zeit
Spaeter AG
Raschärenstrasse 34
7001 Chur
Tel. 081 286 35 55
Bau@spaeter.ch

www.spaeter.ch

ANZEIGE
Tabrec Recycling
ANZEIGE
...von Profis für Profis…
Ökologie der Waldföhrenwälder
Die Waldföhre ist eine genügsame Pionierbaumart, in der Lage unterschiedlichste klimatische Bedingungen zu ertragen. Sie ist natürlicherweise nur auf Extremstandorten oder nach Störungen bestandsbildend anzutreffen. Die meist lockeren Bestände sind wichtiger Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen und entsprechend bestehen viele Interaktionen und Abhängigkeiten mit der Waldföhre. Dies gilt auch für viele Krankheiten und Schadorganismen, welche zwar meist natürliche Bestandteile der Waldföhrenwälder sind, in Kombination mit der zunehmenden Trockenheit aber zu grossen Schäden führen können.
Dr. Andreas Rigling, Dr. Frank Krumm, Dr. Arthur Gessler
Die Waldföhre – eine Überlebenskünstlerin
Die Waldföhre ist die Baumart mit dem grössten Verbreitungsgebiet in Eurasien (Abb. 1, a): Sie hat ihren Schwerpunkt in den borealen Gebieten Eurasiens und erstreckt sich vom äussersten Osten Russlands (140 ° O) bis Andalusien in Südspanien (5 ° W), vom nördlichsten Norwegen (70 ° N) bis in die Zentraltürkei (37 ° S). Waldföh-
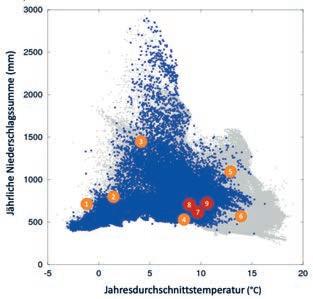
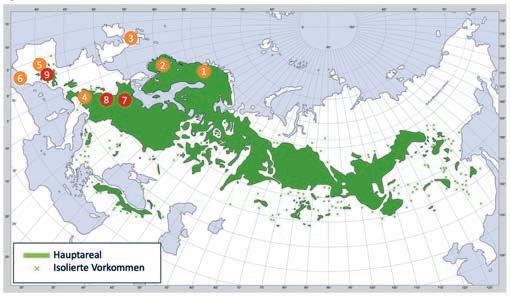
renwälder finden sich in beinahe allen europäischen Gebirgen, wie dem südlichen Ural, den Skanden, in den schottischen Highlands, im Pontischen Gebirge in der Türkei, in den Karpaten, der Tatra, den Alpen, den Pyrenäen bis in den Süden Spaniens in der Sierra Nevada mit entsprechender Ausbildung unterschiedlicher Provenienzen (Viszcaino-Palomar et al. 2019).
Abb. 1 links: Verbreitungsgebiet (Wikimedia 2023), rechts: klimatische Nische der Waldföhre (Pinus sylvestris L.) mit Jahresdurchschnittstemperatur (x-Achse) und jährlicher Niederschlagssumme (y-Achse) – Datengrundlage sind nationale Waldinventuren (Houston Durrant et al. 2016). Die grauen Punkte umreissen die gesamte Waldfläche Europas, die blauen Punkte die Waldföhrenwälder. Die Nummern markieren die Standorte von Abb. 2 und 3: Orange Punkte zeigen natürliche/naturnahe Waldföhrenwälder, rote Punkte zeigen Waldföhrenplantagen.
8
Dieses grosse Verbreitungsgebiet verdankt sie ihrer besonderen Fähigkeit, sowohl auf kalkhaltigen wie auch auf sauren Standorten zu wachsen, und zudem ist sie in der Lage ausserordentlich unterschiedliche klimatische Bedingungen zu ertragen: ihre Klimahülle (Abb. 1, b) geht von −4° bis 15°C Jahresdurchschnittstemperatur und von 400 bis gegen 3000 mm Jahresniederschlag und entsprechend unterschiedlich ist auch das Erscheinungsbild der verschiedenen Waldföhrenwälder (Abb.2). Dabei kontrastieren die feucht-nassen Waldföhrenmoorwälder mit den trockenen Osteuropäischen Waldföhren-Steppenwäldern und den inneralpinen Erika-Föhrenwäldern (Walentowski et al. 2007). In der Schweiz unterscheiden wir den Pfeiffengras-Föhrenwald auf wechseltrockenen Mergelstandorten (Molinio-Pinion), den Erika-Föhrenwald auf trockenwarmen Kalkstandorten (Erico-Pinion sylvestris), den Steppen-Föhrenwald auf flachgründigen Rohböden (Ononido-Pinion) und den Waldföhrenwald auf sandigen oder flachgründigen Silikatrohböden (Dicrano-Pinion) (Delarze und Gonseth 2008). All diesen Wäldern gemeinsam ist,
dass sie nur in den Randbereichen des Ökogrammes zu finden sind. Hier kann die Waldföhre natürlicherweise dominierend auftreten da andere Baumarten nicht mehr mithalten können. Im Zentrum des Ökogrammes, also auf den mittleren und wüchsigeren Standorten hingegen fehlt die Waldföhre in den Schlusswaldgesellschaften, da sie sich dort nicht gegen konkurrenzstärkere Baumarten behaupten kann. Hier ist sie als extreme Pionierbaumart natürlicherweise nur nach Störungen, wie z.B. Feuer, anzutreffen, an die sie gut angepasst ist.






Geschichte und Nutzung
Nach dem Höhepunkt der letzten Eiszeit, vor ca. 22 000 Jahren, zogen sich die Gletscher allmählich wieder aus dem Flachland zurück. Das Schweizer Mittelland wurde eisfrei und bedeckt von Tundra mit kältetoleranten, lichtliebenden Pflanzen. Im Zuge der fortschreitenden Erwärmung besiedelten anspruchslose Gehölze wie Wachholder oder verschiedene Weidenarten die kargen Weiten und es bildeten sich erste Birkenwälder, welche allmählich durch die Waldföhre ergänzt oder gar abgelöst wur-
9
Abb. 2: Beispiele von natürlichen Waldföhrenwäldern: 1: Region Abisko, Nordschweden: Granitischer Blockschutt, trocken, sauer; 2: Region Röros-Bergen, Norwegen: Moorrandwälder, nass, sauer; 3: Cairngorms, Highlands, Schottland: Kuppenlage, Podzolböden, feucht, sauer; 4: Salgesch, Zentralwallis, Schweiz: Rendzinen, trocken, kalkhaltig; 5: Sierra de Cebollera, Soria, Zentralspanien: Blockschutt, trocken, sauer; 6: Sierra de Baza, Andalusien, Spanien: Rendzinen, trocken, kalkhaltig.
den (Leuzinger 2016). Der wohl älteste Nachweis eines regelrechten Waldföhrenwaldes wurde 2013 im Stadtzürcher Quartier Binz, in einer Baugrube gemacht: Der spektakuläre Fund von 257 Waldföhrenstrünken, über Jahrtausende konserviert und bis heute fest verankert in den Lehmschichten, belegt, dass vor 14300 Jahren Föhrenwälder am Fusse des Uetlibergs wuchsen (Nievergelt 2023). Im Zuge fortschreitender Bodenentwicklung und der Einwanderung von konkurrenzstärkeren Baumarten ins Mittelland wurde die Waldföhre zunehmend auf die Grenzstandorte verdrängt, wo sie sich aufgrund ihrer Genügsamkeit bis heute gegenüber der Konkurrenz behaupten kann. Viele der heutigen Waldföhrenwälder sind als Folge grossflächiger Waldübernutzungen im 19. und zu Beginn des 20.Jahrhunderts entstanden. Bergbau, Glashütten oder Schmelzwerke und auch der Eisenbahnbau zeichneten sich durch einen enormen Holzbedarf aus. Neben der Holznutzung, Zeidlerei und Harzgewinnung waren vor allem die Waldweide und die Streunutzung von grosser Bedeutung, denn sie begünstigten die Waldföhrenverjüngung über lange Zeit: Die Waldföhre wurde in der Regel weniger stark vom Vieh verbissen als ihre Konkurrenzvegetation und durch die Streunutzung wurde wiederholt Rohboden freigelegt und damit ideale Ansamungsbedingungen für die Pionierart Waldföhre geschaffen. Heute erfüllen viele der Waldföhrenwälder der Tieflagen, meist auf Trockenstandorten, wichtige Waldleistungen wie Schutz vor Naturgefahren,
vornehmlich Steinschlag und Erosion. Sie sind zudem häufig Wintereinstandsgebiete für das Schalenwild. Aufgrund ihrer geringen Wüchsigkeit auf diesen trockenen Standorten sind sie für die Holzproduktion weniger interessant. Dies im Gegensatz zu den höheren Lagen ab ca. 1000 m ü.M., wo die Föhren natürlicherweise langschaftig sind, und feine, regelmässige Jahrringe ausbilden – hier wächst wertvolles Stammholz von bester Qualität. Waldföhrenholz ist aufgrund seiner guten technischen Eigenschaften sehr gefragt im Holzbau und in der Spanplatten- und Papierindustrie. Dieser breite Einsatzbereich und ihre Genügsamkeit bei gleichzeitig guter Wachstumsleistung auf besseren Standorten waren Gründe, weshalb die Föhre vielerorts in den Wirtschaftswäldern angebaut wurde. Während dies in der Schweiz meist kleinflächig praktiziert wurde, sind beispielsweise in Nordbayern/ Franken oder Brandenburg grossflächige Waldföhrenmonokulturen auf Standorten entstanden, auf denen die Föhre natürlicherweise nicht bestandsbildend wäre (Abb. 3). Diese Wälder zeigen sich nun zunehmend anfällig gegenüber Stressfaktoren und Störungen wie Trockenheit, Waldbrand, Insektenmassenvermehrungen und auch Schneebruch, weshalb diese traditionelle Plantagenwirtschaft zunehmend infrage gestellt wird.



Ökologie der Waldföhrenwälder
Die Waldföhre ist eine ausgeprägte Pionierbaumart. Sie zeigt keine klaren Mastjahre, d.h. sie produziert fast jährlich eine stattliche Menge an Samen und
10
7 8 9
Abb. 3: Waldföhrenplantagenwirtschaft hat in vielen Regionen Europas eine lange Tradition: 7: Nahe Eberswalde, Brandenburg, Deutschland; 8: Region Nürnberg, Bayern, Deutschland; 9: Pinar Grande, Soria, Zentralspanien.
führt nur selten extreme Massenproduktion durch. Die leichten beflügelten Samen können vom Wind über grosse Distanzen transportiert und neue Standorte schnell besiedelt werden (Nussbaumer et al. 2016). Sie ist eine Lichtbaumart, hat nur geringe Ansprüche an die Nährstoffverfügbarkeit und ist daher in der Lage, nach Störungen wie Windwurf oder Waldbrand erfolgreich Rohboden zu besiedeln. Ihre dicke schuppige Borke schützt die Altbäume vor Bodenfeuern. Kronenfeuer vermag sie jedoch kaum zu überleben, da die stark ölhaltigen und dadurch leicht entzündbaren Nadeln bei Feuer regelrecht explodieren, was z.B. der Waldbrand in Leuk im Sommer 2003 vor Augen führte: ausgedehnte Waldföhrenaltbestände fielen einem zerstörerischen Kronenfeuer zum Opfer.
Nach gelungener Besiedlung der Freiflächen und bei genügend Licht zeigt sie ein gutes Jugendwachstum. Mit zunehmendem Kronenschluss, im Stangen und jungen Baumholzalter, werden die Bestände instabil und die Kronen kurz (Abb. 3, Foto 7). Ohne waldbauliche Eingriffe verliert sie an Vitalität und die Anfälligkeit auf Schneebruch und Trockenheit nimmt zu. Andere Baumarten sind dann im Vorteil (Walentowski et al. 2007) und die natürliche Sukzession tritt ein.
Lebensraum für Flora und Fauna
Die natürlichen Waldföhrenwälder bilden in der Regel nur lockere Bestände, welche vielen lichtbedürftigen, in der Schweiz eher seltenen Pflanzenarten der Trockenrasen und Felsensteppen Lebensraum bieten (Abb. 4). Es sind dies Vertreter der Heidekraut und Wintergrüngewächse, sowie viele Orchideen und Schmetterlingsblütler (Delarze und Gonseth 2008).
Die Waldföhrenwälder sind überaus reich an Insektenarten und es bestehen viele Interaktionen mit der Waldföhre als Wirtsbaum. Viele pflanzenfressende Arten haben sich auf die Waldföhre spezialisiert und im Vergleich zu anderen Baumarten kommen an der Waldföhre sehr viele Borkenkäferarten
vor. Obwohl zur Gemeinschaft des Waldföhrenwaldes gehörend, können sie in ausgedehnten Waldgebieten, vor allem im Falle von Monokulturen und gleichaltrigen Beständen zu grossen Schäden führen. Für die Gattung Pinus (Föhren) sind es 59 Borkenkäferarten, für Picea (Fichte) sind es 38 und für Fagus (Buche) beispielsweise lediglich 10 Arten (Schmidt 2022). Dazu kommt noch eine Vielzahl von weiteren potenziellen Schadinsekten (siehe Schmidt und Lobinger 2007; NierhausWunderwald und Forster 2012).
Die Waldföhre bietet auch zahlreichen Pilzarten Lebensraum. Mykorrhizapilze spielen eine zentrale Rolle bei der Aufnahme von Wasser und Nährstoffen und einige von ihnen sind auch hervorragende Speisepilze wie beispielsweise der Kiefernsteinpilz (Boletus pinophilus), der Butterpilz (Suillus luteus) oder der Edelreizker (Lactarius deliciosus). Die Waldföhre bietet auch einer grossen Zahl von Nadel, Trieb und Rindenpilzen ein geeignetes Substrat und auch beim Absterben der Waldföhre sind oft pathogene Pilze mitbeteiligt (siehe Blaschke und Helfer 2007; Dubach et al. 2022). Und letztlich sind auch beim Abbau des Holzes nach dem Tod verschiedene parasitische Pilze, wie die Krauseglucke (Sparassis crispa), ein hervorragender Speisepilz, mitbeteiligt.
Für die Vögel sind weniger die Baumarten als vielmehr die vielfältigen horizontalen und vertikalen Waldstrukturen entscheidend (Lauterbach 2007). So sind auch in den Waldföhrenwäldern Strukturelemente wie ein geringer Deckungsgrad, Bestandeslücken, stehendes und liegendes Totholz, alte Bäume mit Mikrohabitaten entscheidend. Eine Studie aus den Kiefernforsten der Lüneburgerheide konnte zeigen, wie sich im Verlaufe der Bestandesentwicklung die Vogelgemeinschaften massgeblich ändern. So sind in jungen Altersphasen Vögel der offenen Fluren wie die Bachstelze (Motacilla alba) oder der Wiesenpieper (Anthus pratensis) anzutreffen. Mit zunehmender Baumhöhe und Bestandesschluss stellen sich Heckenbraunellen (Prunella modularis), Rotkehlchen (Erithacus rubecula), Am
11
Abb. 4: Lichtdurchflutete und strukturreiche Waldföhrenwälder, wie beispielsweise im Walliser Pfynwald, bieten Lebensraum für eine Vielzahl von licht- und wärmeliebenden Tier- und Pflanzenarten, wie z.B. (Abb. 4a) der Berberitze (Berberis vulgaris), (Abb. 4b) der Aspisviper (Vipera aspis aspis) und (Abb. 4c) der Mauereidechse (Podarcis muralis).
sel (Turdus merula) oder der Bluthänfling (Linaria cannabina) ein. Später kommen frei und höhlenbrütende Baumbrüter wie verschiedene Meisenarten (Paridae spec.) hinzu. In den Baumkronen der Altbäume ist dann auch die Misteldrossel (Turdus viscivorus) häufig zu sehen, welche sich u.a. von Mistelbeeren ernährt. In den ausgedehnten Waldföhrenwäldern im Pfynwald beispielsweise laufen Anstrengungen, um über künstlich angelegte grosse Bestandesöffnungen, regelrechten Kahlhieben, mit Bodenblössen neben reicher Baumverjüngung den bodenbrütenden und nachtaktiven Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus) wieder anzusiedeln und zu fördern.
Gefährdungen und Klimawandel
Wie erwähnt bestehen ausserordentlich viele Interaktionen und Abhängigkeiten zwischen der Waldföhre und verschiedensten Tier und Pflanzenarten. Dies gilt selbstverständlich auch für viele Krankheiten, Schadinsekten, Nematoden etc., welche zwar meist natürliche Bestandteile der Waldföhrenwälder sind, unter gewissen Bedingungen aber zu grossen Schäden führen können. Viele der einheimischen potenziellen Schadorganismen können direkt und indirekt vom Klimawandel profitieren, einerseits weil der Wirtsbaum durch die Zunahme von Hitze und Trockenjahren (Abb. 5a) sowie Störungen wie z.B. Stürme und Waldbrände zunehmend geschwächt wird und andererseits,
weil sie sich in wärmeren Bedingungen besser und schneller entwickeln können. Eingespielte, während Jahrzehnten unauffällig funktionierende Wechselbeziehungen können sich im Zuge des Klimawandels verändern. Als Konsequenz können grosse Kalamitäten auftreten. Im Folgenden gehen wir auf drei Beispiele von Interaktionen ein: Ein wichtiges Element der Waldföhrenwälder ist die wärmeliebende Föhrenmistel (Viscum album ssp. austriacum) (Abb. 5b), welche von den ansteigenden Temperaturen profitieren kann. Sie ist in vielen Gebieten der Schweiz und Europas auf dem Vormarsch und dringt in höhere und nördlichere Lagen vor. Sie ist ein Halbschmarotzer, welcher auf den Ästen der Waldföhre wächst und über sogenannte Senker dem Wirtsbaum Wasser und darin gelöste Nährsalze entzieht. Die Photosynthese führt sie hingegen selbst durch mit dem Blattgrün in ihren Blättern und Stengeln. Da die Mistel, im Gegensatz zur Waldföhre in Trockenzeiten ihre Spaltöffnungen kaum schliesst, erhöht sie bei Wasserknappheit den Trockenstress der Föhre, was zu einer nachhaltigen Schwächung des Wirtsbaumes und zu direkten Trockenschäden führen kann (Rigling et al. 2006).
In Südspanien, in den Sierras Nevada und de Baza, wird beobachtet, dass der Pinienprozessionsspinner (Thaumetopoea pityocampa), der üblicherweise Föhrenarten der tieferen Höhenlagen wie die Schwarzföhre (P. nigra), die Kalabrische Kiefer (P. brutia) und die AleppoKiefer (P. halepensis) be



12
a b c
fällt, nun in höhere Lagen und somit in die Waldföhrenwälder vorstösst und dort zu völlig neuen, grossflächigen Schädigungen führt (Abb. 5c) (Hodar et al. 2003).
Neben einheimischen Schädlingen und Krankheiten können vermehrt auch neu auftretende Organismen unsere Waldföhrenwälder gefährden. Ein eindrückliches Beispiel ist die Kiefernholznematode (Bursaphelenchus xylophilus), ein kleiner Fadenwurm, der 1999 in Portugal eingeschleppt wurde und dort die Föhrenwälder teilweise eliminiert hat (De la Fuente und Saura 2021). Dieser wärmeliebende Schädling könnte sich mittlerweile im Zuge des Klimawandels, falls eingeschleppt, auch in Zentraleuropa erfolgreich festsetzen, mit wohl dramatischen Konsequenzen für die grossflächigen Föhrenwaldgebiete auch in der Schweiz. Diese Beispiele, aber auch unsere Erfahrungen aus den Waldföhrenwäldern im Wallis, der Region Chur und weiteren Gebieten Europas mit grossflächigen Schädigungen durch Trockenheit, kombiniert mit verstärktem Auftreten von Schadinsekten und Krankheiten (Abb. 5a), zeigen, wie wichtig Struktur und Artenvielfalt sind, um stabile und resiliente Waldföhrenwälder zu erhalten. Dies gilt speziell auch für die Waldföhren auf wüchsigen
Standorten, wo sie natürlicherweise nicht bestandsbildend wäre – je grossflächiger und homogener die oft gleichaltrigen Monokulturen sind, desto grösser ist das Risiko von Waldschäden. Naturnähe und Vielfalt sind angesagt, um die wichtigen Ökosystemleistungen der Waldföhrenwälder für die Zukunft zu sichern.



Dr. Andreas Rigling ist Professor an der ETH Zürich und untersucht den Einfluss des Umweltwandels auf unsere Wälder und wie die Waldbewirtschaftung mit Blick in die Zukunft angepasst werden soll.
Dr. Frank Krumm ist Wissenschaftler an der WSL und erforscht Integrative Konzepte der Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der verschiedensten Ansprüche der Gesellschaft an den Wald.
Dr. Arthur Gessler leitet die langfristige Waldökosystemforschung an der WSL und ist Professor an der ETH Zürich. Er untersucht das Funktionieren von Bäumen unter extremen Klimabedingungen.
Literatur
Das vollständige Literaturverzeichnis finden Sie hier: www.buendnerwald.ch
Abb. 5: Die Waldföhrenwälder zeigten in den letzten Jahrzehnten in vielen Gebieten Europas zunehmend Schädigungen durch Trockenheit, wie hier bei Gampel, Wallis (Abb. 5a). Während die Flaumeichen (Quercus pubescens Willd.) im Hintergrund saftig grün erscheinen, sind die Waldföhren grossflächig abgestorben. Die Föhrenmistel ist in vielen Gebieten auf dem Vormarsch und sie stösst zunehmend in höhere und nördlichere Lagen vor ( Abb. 5b; Gliswald bei Visp). In Andalusien stösst der Pinienprozessionsspinner (Thaumetopoea pityocampa) in höhere Lagen vor und verursacht neuerdings grossflächige Schäden an der Waldföhre (Abb. 5c). Trockenheit, Mistel und Prozessionsspinner treten im Zuge des Klimawandels häufiger auf und gewinnen an Bedeutung für die Walddynamik.
(Bilder: Dr. Andreas Rigling)
13
a b c
Die Vielfalt der Waldföhrenwälder in Graubünden
Aufgrund der breiten Ökologie der Waldföhre kann global gesehen eine Vielzahl unterschiedlicher
Waldföhren-Waldstandorttypen beobachtet werden. Im Kanton Graubünden alleine werden 18 Waldföhren-Waldstandorttypen unterschieden.
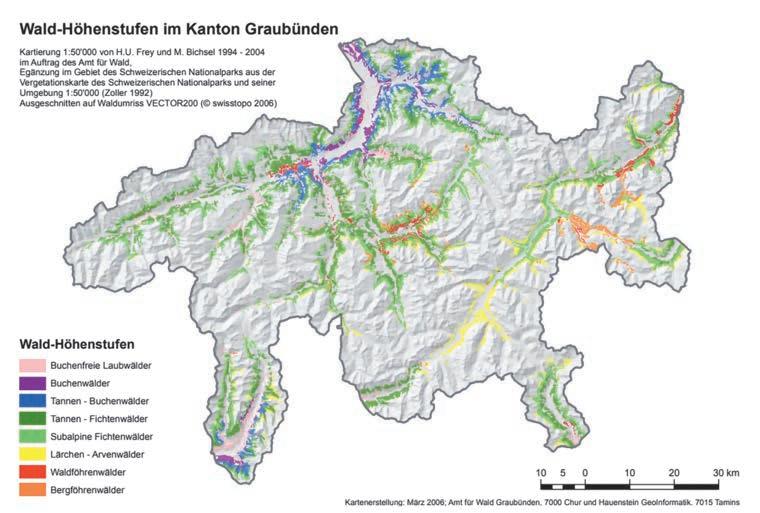 Gianna Könz
Gianna Könz
Die Standorte, wo natürlicherweise Waldföhrenwälder vorkommen, befinden sich am Rande des Ökogramms – entweder an extrem trockenen, flachgründigen Standorten (Fels und Schutt, auf basischen bis sauren Standorten) oder auf moorigen Standorten im nassen Bereich. Natürliche Waldföhrenwälder zeichnen sich durch eine geringere Oberhöhe der Waldföhre aus. Hier erreichen
die Waldföhren nur noch Höhen von maximal 15 bis 18 Meter. Waldföhrenwälder mit höheren Oberhöhen wurden waldbaulich gefördert oder sind das Resultat einer Pionierphase, beispielsweise nach Waldbränden. Bei genügend Licht kann die Waldföhre den offenen Boden schnell besiedeln, wird jedoch im Laufe der Sukzession von den Klimaxbaumarten verdrängt.
Abb. 1: Vorkommen der Waldföhrenwälder (rot) im Kanton Graubünden. In dieser Darstellung sind auch föhrenreiche Pionierphasen rot ausgewiesen da bei der zugrundliegenden Gegenhangbeurteilung die Oberhöhe nicht geschätzt werden konnte.
14
In älteren Werken wie beispielsweise Ellenberg und Klötzli (1972) wurden solche Pionierphasen auch als «Föhrenwälder» bezeichnet. In den aktuellen Beschreibungen der «Waldgesellschaften und Waldstandorte Graubündens» wurden nur Waldföhrenbestände als Waldföhrenwälder bezeichnet, die auch über Generationen föhrenreich bleiben und sich nicht beispielsweise in «Erika-Fichtenwälder» weiterentwickeln.
Der Kanton Graubünden ist neben dem Wallis einer der föhrenreichsten Kantone. Für die Einteilung der Waldstandorttypen wurde der Kanton Graubünden in acht Regionen unterteilt, welche sich aufgrund ihrer standörtlichen Gegebenheiten unterscheiden. So gibt es Regionen, in welchen keine Waldföhrenwälder vorkommen (Region 2), oder solche, wo acht unterschiedliche Ausprägungen von Waldföh-
renwäldern (Waldstandorttypen) definiert wurden (Region 6). Gewisse Waldföhrenwälder sind spezifisch für eine Standortregion, andere können in mehreren Standortregionen vorkommen (Tabelle 1). Mit Ausnahme der Region 2 «Prättigau» finden sich in allen Standortregionen natürliche Waldföhrenwälder (Abbildung 2). Im Prättigau kommt die Waldföhre höchstens eingestreut bis in die hochmontane Stufe vor. In den Regionen 1 «Churer Becken», 3 «Vorderrhein» und 8 «südliche Randalpen» bilden sich auf Extremstandorten an Südhängen Waldföhrenwälder bis an die obere Grenze der hochmontanen Höhenstufe. In der Region 4 «Hinterrhein» sind auf flachgründigen, zur Austrocknung neigenden Standorten selten sogar einzelne Waldföhren bis in die subalpine Stufe auf ca. 2000 m ü. M. vorzufinden. In den Regionen 5 «Al-
mit Traubeneiche
Tabelle 1: Waldföhren-Waldstandorttypen in Graubünden. Fett hervorgehoben die Waldföhren-Waldstandorttypen, welche genauer beschrieben werden. Region 1 = Churer Becken, Region 2 = Prättigau, Region 3 = Vorderrhein, Region 4 = Hinterrhein, Region 5 = Albula, Region 6 = Unterengadin, Region 7 = Oberengadin, Region 8 = südliche Randalpen
15
AbkürzungDeutsch Region 12345678 65 Typischer Erika-Föhrenwald ✕ ✕ ✕ 65+Hauhechel-Föhrenwald mit Niedriger Segge ✕ ✕✕ 65* Typischer Hauhechel-Föhrenwald ✕ 65AErika-Föhrenwald auf Schutt ✕ 65BErika-Föhrenwald mit Fiederzwenke ✕ ✕ 65CHauhechel-Föhrenwald mit Buntreitgras ✕ 65DErika-Föhrenwald mit Seidelbast ✕ 65HErika-Föhrenwald mit Etagenmoos ✕ ✕ ✕✕ 65LStrauchreicher Hauhechel-Föhrenwald ✕ ✕ 65PErika-Föhrenwald auf Fels ✕ 65RErika-Föhrenwald mit Steinrose ✕ ✕ 66 Auen-Föhrenwald ✕ ✕ 66PInneralpiner Auen-Föhrenwald ✕ 67* Zwergseggen-Föhrenwald ✕✕ 68Typischer Besenheide-Föhrenwald ✕✕ ✕ 68*Preiselbeer-Föhrenwald ✕✕ 68SDrahtschmielen-Föhrenwald mit Felsen-Leimkraut ✕ 68QDrahtschmielen-Föhrenwald
✕
bula», 6 «Unterengadin, Münstertal» und 7 «Oberengadin» bilden sich in der subalpinen Stufe sogar ganze Waldföhrenbestände aus. Die Region 7 «Oberengadin» weist die grösste Vielfalt an WaldföhrenWaldstandorttypen auf (Tabelle 1). Die Festlegung der Waldstandorttypen startete in den Regionen 1 und 6, wo aufgrund der Daten passende Einheiten gebildet wurden. Bei den anderen Regionen wurden zusätzliche Einheiten hinzugefügt, um präzise Ansprachen zu ermöglichen. Eine nötige Gesamtschau mit einer Priorisierung nach Abschluss der 8 Regionen war leider nicht möglich. Damit verblieb das System für die einzelnen Regionen präzise, aber für den ganzen Kanton eher komplex.

Die WaldföhrenWaldstandorttypen unterscheiden sich aufgrund von unterschiedlichen Standortfaktoren und durch das Vorkommen respektive Fehlen von einzelnen Zeigerpflanzen. Um die Vielfalt der WaldföhrenWaldstandorttypen im Kanton Graubünden aufzuzeigen, werden folgend vier WaldföhrenWaldstandorttypen beschrieben. Im typischen Erika-Föhrenwald (65) erreichen die Waldföhren eine maximale Höhe von 17 Metern.

In der lockeren Baumschicht finden sich neben Föhren vereinzelte Mehlbeeren, Vogelbeeren,
Traubeneichen und in höheren Lagen Bergföhren und schlechtwüchsige Fichten. In der Strauchschicht können Felsenbirnen (Amelanchier ovalis) und weitere Kalksträucher vorkommen. Die Krautschicht ist meist von einem dichten ErikaTeppich geprägt. Je nach Überschirmung, Feuchtigkeit und Basengehalt des Bodens kann auch ein lockerer Rasen aus Niedriger Segge (Carex humilis), Weisssegge (Carex alba), Buntreitgras (Calamagrostis varia) und Blaugras (Sesleria caerulea) aspektbildend sein. Im typischen ErikaFöhrenwald können zudem häufig Orchideen gefunden werden. Der Hauhechel-Föhrenwald (65*) kommt nur in den kontinentalen Lagen der inneralpinen Trockentäler vor. Dies an trockenen Hängen auf Kalk und seltener auf Bündnerschiefer oder Serpentin (z.B. bei Scuol). Die Waldföhre wird knapp 15 Meter hoch und kann von einzelnen Fichten oder Lärchen begleitet werden. Die Krautschicht ist nicht flächendeckend und besteht aus Rundblättrigem Hauhechel (Ononis rotundifolia), Französischem Tragant (Astragalus monspessulanus), Vogelwicke (Vicia cracca), Rotem Seifenkraut (Saponaria ocymoides) und treppigen Rasen der Niedrigen Segge (Carex humilis). In höheren Lagen kann auch die Bärentraube (Arctostaphylos uva-ursi) Teppiche


16
Abb.2: Typische Arten der Waldföhrenwälder (v.l.n.r). Erika (Erica carnea), Rundblättriger Hauhechel (Ononis rotundifolia), Niedrige Segge (Carex humilis), Berglaserkraut (Laserpitium siler).
(Fotos: 2018, Konrad Lauber – Flora Helvetica – Haupt Verlag)
bilden. In der Strauchschicht können Wachholderarten (Juniperus communis, Juniperus sabina) vorgefunden werden.
Der Zwergseggen-Föhrenwald (67*) kommt nur im Engadin auf flachgründigen Felsrippen über Dolomitgestein vor. Dabei ist die Engadinerföhre bestandesbildend. Die Engadinerföhre ist vermutlich eine Unterart der Waldföhre, welche maximal 18 Meter Höhe erreicht und in der subalpinen Stufe wächst. Neben der Engadinerföhre kommen beigemischt Bergföhren, Lärchen oder kümmerliche Fichten vor. Die Strauchschicht fehlt weitgehend und der Boden ist häufig vegetationslos. Typische Krautpflanzen sind die Niedrige Segge (Carex humilis) und das Berglaserkraut (Laserpitium siler).
Der Auen-Föhrenwald (66) ist eine seltene Föhrenwaldgesellschaft, welche auf wenig überschwemmten Flussterrassen von grossen Flüssen vorkommt. Damit die Waldgesellschaft sich dauerhaft halten kann, müssen die Flussterrassen aus sehr grobem, durchlässigem und stark austrocknendem Kies bestehen. Zwischen Sent und Martina im Unterengadin findet sich in der montanen Höhenstufe die Ausprägung mit Wintergrün (66P). Die Kraut und die Strauchschicht fehlen weitgehend und vereinzelt können Orchideen vorkommen. Eine Unterscheidung dieser zwei Einheiten fand statt, um die Waldgesellschaften in den einzelnen Regionen möglichst präzise zu beschreiben. Bei einem gesamtbündnerischen Überblick würde es genügen, einen einzigen «AuenFöhrenwald» zu beschreiben.
Waldföhrenwälder spielen eine grundlegende Rolle für die Biodiversität im Kanton Graubünden. Durch die lockeren und lichtdurchlässigen Baumkronen kann ausreichend Sonnenlicht und Wärme auf den Boden gelangen. Dadurch können Tierund Pflanzenarten, welche auf lichte Verhältnisse angewiesen sind, hier Zuflucht finden. Darunter finden sich beispielsweise seltene Orchideenarten, Tagfalter, Reptilien und Totholzkäferarten. An einem trockenen Südhang in Crap Ses im Surses
konnten beispielsweise auf einer Waldfläche von vier Hektaren 441 Käferarten nachgewiesen werden. Darunter einige Totholzkäferarten, welche auf der Roten Liste der Schweiz sind und als gefährdet oder potenziell gefährdet gelten.
Gianna Könz studierte Umweltnaturwissenschaften an der ETH Zürich mit der Vertiefung in Wald- und Landschaftsmanagement. Sie arbeitet selbstständig als Forstingenieurin und unterrichtet an der Försterschule in Maienfeld Waldstandortkunde.

Quellen
Das vollständige Literaturverzeichnis finden Sie hier: www.buendnerwald.ch
17
Abb. 3: Hauhechel-Föhrenwald mit Niedriger Segge in Untervaz in der Region 1. (Bild: Gianna Könz)
Ökologisches Porträt der Bergföhren im Nationalpark
Die aufrechte Bergföhre und die nah verwandte Legföhre sind die Spezialisten für das Wachstum auf kargen, trockenen und steilen Berghängen. Im Schweizerischen Nationalpark prägen sie das Waldbild, wo anderswo auf saurem Gestein der Lärchen-Arvenwald gedeiht. Verschiedene Naturereignisse und grossflächige menschliche Holznutzungen hielten die Sukzession zurück, wodurch auch nach Hunderten oder Tausenden von Jahren der Wurzelraum vom basischen Dolomitgestein geprägt bleibt. Nur wo sich Humus angehäuft hat, wird die Bergföhre durch andere Baumarten verdrängt.
Duri Bezzola
Für die Besuchenden des Schweizerischen Nationalparks prägen die Legföhre und die aufrechte Bergföhre auf gut drei Vierteln der Waldfläche das Waldbild. 44 Prozent sind praktisch reine Bergföhrenwälder. Die beiden Unterarten derselben Art (Pinus mugo Turra ) wachsen in reinen Beständen, wo andere Gehölze nicht gedeihen können, sei es wegen grosser Höhenlage, kurzer Vegetationszeit, ausgeprägter Trockenheit im Sommer, basischem Kalk- oder Dolomitgestein oder wegen fehlender oder geringer Bodenbildung auf Geröll und Fels. Ihre Samen verfügen über einen Flügel und werden vom Wind verfrachtet. Die schweren Samen der Arve werden hingegen durch den Tannenhäher aktiv verbreitet. Wo an steilen Hängen der Schneedruck, Lawinen, Bewegungen der Erdoberfläche und Steinschlag keinen aufrechten Baumwuchs zulassen, wächst von den Nadelgehölzen dauerhaft nur die Legföhre (Abbildung 1). Der niederliegende, strauchartige Baum wächst bis zu fünf Metern hoch. In dichten, oft schwer durchdringlichen Beständen übersteht er Steinschlag, die vollständige Überdeckung mit Schnee und auch alljährliche Lawinenabgänge.
Die Bergföhre – ein Extremist Auf ruhigeren Flächen wachsen unter diesen sehr kargen Lebensbedingungen zwischen 1600 und
ca.2400 m ü. M. die aufrechte Bergföhre mit Baumhöhen bis 25 m (Abbildung 2). Sie bildet im Nationalpark und im angrenzenden Spöltal sowie in Mittelbünden (Albulatal, Landwassertal) die grössten Bestände der Schweiz (LFI). Unter den schlanken Bäumen wachsen südexponiert die Erika, Niedrige Segge und Preiselbeere (Erika-Bergföhrenwald) oder in anderen Expositionen Preisel-, Heidel- und Moosbeeren, die bewimperte Alpenrose sowie die Bärentraube und Moose (Steinrosen-Bergföhrenwald). Die aufrechte Bergföhre besiedelt als Pionierin sehr schnell frisch entstandene, basenreiche Schotterflächen an Bachrändern und auf Ablagerungen von Rüfen (Abbildung 3). Der Bergföhrenwald geht im Nationalpark mit abnehmender Extremheit der Standortbedingungen in andere Nadelwaldbestände über: Zur Waldföhre, wo die Höhenlage abnimmt und damit die Temperatur und die Vegetationszeit zunehmen, zur Arve, wo die Bodenbildung mit einer sauren Rohhumusauflage auf Fels und Geröll weiter fortgeschritten ist und zur Fichte, wo der Boden auf etwas geringerer Höhenlage im Sommer weniger austrocknet. Die Lärche gesellt sich da und dort einzeln zur Bergföhre, oder auch in grösserer Zahl, wo die Kargheit weniger ausgeprägt ist. Die Lärche ist in den Bergföhrenwäldern die zweithäufigste Baumart.
18
Die Bergföhre (Pinus mugo Turra ) verfügt über eine graubraune Rinde und zwei Nadeln pro Nadelbüschel, im Gegensatz zur fünfnadeligen Arve. Sie kommt in zwei Unterarten vor (Infoflora):

– Legföhre oder Latsche, romanisch zuonder, wissenschaftlich Pinus mugo Turra subsp. mugo. Meist niederliegender, strauchartiger Baum, bis 5 m hoch. Die Schuppenschilder der Zapfen sind ziemlich flach, nicht hakig.
– Aufrechte Bergföhre oder Hakenkiefer oder Spirke, romanisch agnieu oder tieu da muntogna, wissenschaftlich Pinus mugo subsp. uncinata (DC.) Domin. Meist aufrechter, bis 25 m hoher Baum. Die Schuppenschilder der Zapfen sind aufgewölbt, hakig gekrümmt oder abgerundet.
19
Abb.1: Einzelne Legföhren im Vordergrund, Legföhrenbestand im Hintergrund am Steilhang. (Foto: SNP)
Zwischen aufrechter Bergföhre und Legföhre bestehen lokale Zwischenformen und Hybriden, wodurch die Zuordnung des einzelnen Baumes nicht immer gelingen kann. Neben der genetischen Fixierung des unterschiedlichen Wachstumsverhaltens zwischen aufrecht und niederliegend beeinflussen auch die Ausseneinflüsse wie Schneedruck und Schäden aller Art die Wuchsform der einzelnen Pflanze (Abbildung 4). Auch Hybriden zwischen der Bergföhre und der Waldföhre wurden im Nationalpark nachgewiesen. Kommen im Nationalpark beide Formen der Bergföhre vorwiegend auf trockenem bis sehr trockenem, basischem Boden vor, so wächst die Bergföhre andernorts auch auf einem anderen Extremstandort, nämlich auf sehr saurem Hochmoor (TorfmoosBergföhrenwald). Kurz, die Bergföhre ist ein Extremist in Sachen Anspruchslosigkeit und wächst, wo andere Gehölze nicht wachsen oder zumindest nicht erfolgreich konkurrenzieren können.


20
Abb.3: Die aufrechte Bergföhre besiedelt frischen, rohen Schotter sehr schnell und flächendeckend.
(Foto: Duri Bezzola)
Abb.2: Bestand der aufrechten Bergföhre mit Totholz im Schweizerischen Nationalpark. (Foto: SNP)
Echt wild?
Wie sind nun diese Bergföhrenwälder entstanden? Alle Nadelwälder im Nationalpark haben sich natürlich verjüngt. Das heisst, dass alle heute vorhandenen Bergföhren, Lärchen und Fichten aus Samen gewachsen sind, die vom Wind von an Baumzweigen hängenden Zapfen (vgl. Abb. 5) hergebracht wurden. Die grossen Samen der Arve erntete hingegen der Tannenhäher aus Arvenzapfen und versteckte sie in der Vegetationsschicht. Die ältesten Bäume keimten vor bis zu 1000 Jahren. Am Ende der Eiszeit vor ca. 15 0 00 Jahren war das ganze Gebiet des Nationalparks mit Ausnahme der höchsten Gipfel von Gletscherbewegungen geprägt (UTäler) und vegetationsfrei. Wärmere und kältere Phasen wechselten sich ab. Sobald die Gletscher abschmolzen, wanderten gleichzeitig zunehmend Pflanzen und Tierarten ins Gebiet ein, die einen Arten schneller, die anderen auch erst Tausende
von Jahren später. Die Legföhre ist von Osten, die aufrechte Bergföhre von Westen her eingewandert. Hier im Nationalpark überlappen sich die Verbreitungsgebiete der beiden Unterarten. Seit etwa 10 0 00 Jahren sind die tieferen Lagen des Gebiets weitgehend von Wald bedeckt, ausser entlang der Bäche, in Lawinenzügen und auf barem Fels. Verwitterung des Gesteins, Niederschläge, Erosion durch Wasser und Bäche, Erdrutsche, Steinschlag, Rüfen, Lawinen und Überschwemmungen beanspruchten die Erdoberfläche und führten über die Jahrtausende zur heutigen Form der stärker eingeschnittenen Täler und Berge. Die Bodenbildung und die Vegetationsentwicklung ringen seit der Eiszeit mit den Einflüssen der Schwerkraft. Sie kann in letzter Konsequenz durch die Vegetation nicht aufgehalten werden. So kam es auf praktisch jeder Waldfläche des Nationalparks in Abständen von einigen, Hunderten oder Tausenden von Jahren zu diesen erwähn


21
Abb.4: Wuchsformen der Bergföhre bei unterschiedlichen Ausseneinflüssen: Links die Legföhre, rechts die aufrechte Bergföhre. (Grafik: SNP/Richard Keller)
ten Naturereignissen sowie zu vorwiegend natürlichen Waldbränden. Damit erfolgt immer wieder ein vollständiger Rückfall «auf Feld 1» oder auf ein früheres Stadium der Sukzession, der Entwicklung der Vegetation und der Erdschicht. Das Vorkommen oder das Fehlen der Bergföhren an einer bestimmten Stelle im Nationalpark wird stets durch diese Prozesse bestimmt. Dieses Wechselspiel, aber auch unumkehrbare Entwicklungen wie der allmähliche Abtrag des Gebirges, werden in Zukunft weiter gehen. 15 000 Jahre seit der Eiszeit sind in erdgeschichtlichen Dimensionen erst eine kurze Zeitspanne.
Prozessschutz
Ein zentraler Wert und Grundsatz im Management des Schweizerischen Nationalparks ist heute der strenge Prozessschutz. Er bedeutet das NichtEingreifen oder das strikte Zulassen der oben beschriebenen, natürlichen und dynamischen Prozesse. Er führt fortlaufend zu neuen, nicht genau vorhersehbaren Zuständen des Ökosystems. Der

Prozessschutz steht im Gegensatz zur Erhaltung bestimmter aktueller bzw. zur Einleitung von wünschenswerten Zuständen (z.B. Wasserabfluss, Artenzusammensetzung, Vegetationsstruktur u. a.). Dank ihm werden die kommenden Generationen noch genaueres über die natürlichen Entwicklungsprozesse lernen können.
Menschlicher Einfluss
Menschen traten im Gebiet vor gut 10000 Jahren erstmals auf. Sie schlugen im Einzugsgebiet des Inns erst seit 3000 bis 4000 Jahren in verschiedenen Epochen spürbar Holz. Seit dem Mittelalter begannen diese menschlichen Einflüsse das Gebiet des Nationalparks in seinem oberflächlichen Erscheinungsbild zu prägen, sei es für die Schaffung von Weidefläche, für die lokalen Bedürfnisse des Bergbaus (Val Trupchun, La Drossa, Il Fuorn, Stabelchod, Buffalora, Val Mingèr), der Holzkohleproduktion und der Kalkbrennerei. Hinzu kamen grossflächige Kahlschläge für die Versorgung der
22
Zweig mit Zapfen der Bergföhre und Alpenmeise Parus montanus. (Foto: SNP)
Saline in Hall bei Innsbruck mit Bau und Brennmaterial. Die Holzstämme wurden dafür auf dem Spöl und auf dem Inn geflösst. Die verschiedenen kulturellen Einflüsse gesellten sich zu den erwähnten Naturereignissen, waren aber aus Sicht der Sukzession meist weniger tiefgreifend, da die Bodenauflage weitgehend erhalten blieb. Das heutige Vorkommen der Bergföhre ist somit durch die Summe der kargen Standortbedingungen, der Sukzession sowie der natürlichen und menschlichen Störungen des Standortes zu erklären.
Die Zukunft der Bergföhrenwälder
Modellartig geht man davon aus, dass sich aufrechter Bergföhrenwald, der über Hunderte oder Tausende von Jahren von Rückschlägen der Sukzession verschont bleibt, aus initialem Pionierwald in einen gemischten Bestand von Bergföhren mit Arve und Lärche entwickelt. Als Endstadium entsteht daraus nach über 1000 Jahren ein LärchenArvenWald, in welchem die Bergföhre weitgehend verdrängt wird. Die Vorstellungen gehen auch so weit, dass die mittelalterlichen und neuzeitlichen Kahlschläge die bereits gemischten Wälder auf ein früheres Entwicklungsstadium mit nur Bergföhren zurückwarfen. Diese Tendenz lässt sich an heutigen Waldbildern und an den durch die Wissenschaft überblickbaren Waldentwicklungen bestätigen. Vielen Besuchern des Nationalparks sind reine Bergföhrenbestände entlang der Ofenpassstrasse bekannt, die vorwiegend aus gleichaltrigen Bäumen bestehen. Sie gelangen bereits 150 bis 200 Jahre nach ihrer Entstehung altersbedingt in die Zerfallsphase (viel früher als zum Beispiel die Fichte nach 400 bis 600 Jahren). Bäume sterben ab und fallen teilweise um. In den entstehenden Lücken entwickeln sich junge Bergföhren, aber immer häufiger auch einzelne Arven.
Ausgedehnter LärchenArvenwald findet sich im Ofenpassgebiet heute fast nur an den unteren Hängen des Munt La Schera. Hier besteht der Untergrund aus sauren Sandsteinen und die Bodenbil
dung ist offenbar über sehr lange Zeiträume ungestört bereits bis zur sauren Braunerde vorangekommen. In der Val Trupchun hingegen ist am oberen Waldrand der LärchenArvenwald der Normalfall, weil hier der Untergrund aus Kalkschiefern und nicht aus basischem Dolomitgestein besteht. Die Erwärmung des Klimas liess die obere Waldgrenze in den letzten Jahrzehnten bereits ansteigen, sowohl im Bergföhren wie auch im LärchenArvenwald. Wie sich die weitere Klimaerwärmung auswirken wird, ist noch wenig absehbar. Es kann vermutet werden, dass sich die ökologisch elastischen Bergföhren besser als anspruchsvollere Arten mit den Veränderungen arrangieren werden. Es ist nicht anzunehmen, dass die Entwicklung vom BergföhrenInitialwald zum LärchenArvenSchlusswald in für den Menschen überschaubaren Zeiträumen allgemein gelingen wird. Voraussetzung wäre unter anderem die Ausbildung eines reifen, sauren Bodens über Hunderte bis Tausende von Jahren. Die Trockenheit und die verschiedenen zum Teil heftigen Naturereignisse werden, wie weiter oben aufgeführt, diese Entwicklung in den meisten Fällen jedoch stark verzögern, ja immer wieder da oder dort vollständig rückgängig machen. Die für den Schweizerischen Nationalpark typischen Bergföhrenwälder dürften deshalb auch beim hier herrschenden Prozessschutz nicht verschwinden.
Duri Bezzola ist dipl. Forstingenieur ETH, Präsident Pro Lej da Segl sowie Natur- und Kulturvermittler.
Quellen
Campell, Eduard, 1964: Die Waldungen des schweizerischen Nationalparks
Haller, Heinrich et al. (Hrsg.), 2013: Atlas des schweizerischen Nationalparks
Infoflora: www.infoflora.ch, 29.11.2022
LFI: www.lfi.ch, 29.11.2022
Ott, Ernst, 1997: Gebirgsnadelwälder
SNP: www.nationalpark.ch, 29.11.2022
23
Die Engadinerföhre: Mythos oder Rarität?
In den inneralpinen Trockentälern gibt es Föhren, die nicht wie gewöhnliche Waldföhren aussehen. Was wissen wir eigentlich über diese Engadinerföhren?
Ayla Strozzega
Waldföhren sind fester Bestandteil der Landschaft im Val Müstair. Bei genauerer Betrachtung fällt auf: Einige davon sehen anders aus. Sie sind weniger hoch und ihre Krone reicht bis weit hinunter. Möglicherweise ist das Spiegelperiderm im oberen Stammbereich feiner und von intensiverem Orange. Diese Bäume sind als Engadinerföhren bekannt. Sie sind eine Besonderheit der inneralpinen Trockentäler. Bekannte Vorkommen gibt es bei Samedan, im Stazerwald, bei Tantermozza am Flüelapass, Taglieda und Champsech am Ofenpass und bei Tschierv im Val Müstair. Auch im Tirol und im Donautal kommen sie vermutlich vor. Für einige Menschen haben sie grossen kulturellen Wert. Doch erstaunlich wenig ist über diese Bäume bekannt. Woran genau erkennt man sie? Sind sie Hybriden von Berg- und Waldföhren? Oder sind sie nicht das Ergebnis genetischer Kreuzung, sondern eine standörtliche Varietät der Waldföhre? Taucht man tiefer in die Literatur ein, drängt sich die Frage auf: Gibt es die Engadinerföhre überhaupt?
Sag mir, wie du aussiehst und ich sag dir, wer du bist!
Bereits Mitte des 19.Jahrhunderts wurde in botanischen Kreisen über die Systematik der Föhren diskutiert. Seither haben diverse Autoren die Engadinerföhre beschrieben. Damals wie heute werden dafür morphologische Merkmale untersucht. Dazu gehören bei der Engadinerföhre nebst der auffälligen Wuchsform Besonderheiten der Nadeln und der Zapfen. Die Nadeln bleiben bis zu sechs Jahre am Trieb, nicht drei bis vier Jahre wie bei der Waldföhre. Sie sind mit bis 4 cm Länge und bis 2 mm
Breite kürzer und breiter. Es werden ausserdem die Harzkanäle im Querschnitt und die Wachsstreifen an der Unterseite gezählt. Die Zapfen werden als gelblich beschrieben und unterscheiden sich nicht nur in Form und Grösse, sondern auch in anderen Details.
Man könnte meinen, bei so vielen Merkmalen müsste die Unterscheidung leichtfallen und damit auch die Frage beantwortet sein, ob es sich um eine eigene Art handelt. So klar ist es nicht. Föhren sind evolutiv relativ jung. Unter anderem deshalb ist die Merkmalsausprägung oft graduell und nicht eindeutig. Wie ein Baum wächst, hängt bekanntermassen nicht nur von seinen Genen, sondern auch von seiner Umwelt ab. Das betrifft die Wuchshöhe und -form. Aber betrifft es auch die Nadelbreite, -länge und das Nadelalter? Schon da besteht Uneinigkeit bei Experten. Doch selbst wenn die Bäume zweifelsfrei unterschieden werden könnten, bliebe die Frage bestehen, ob es sich bei der Engadinerföhre tatsächlich um eine eigene Art oder lediglich um eine Varietät handelt.
Kreuzung oder Unterart?
Zur taxonomischen Einordnung der Engadinerföhre gibt es grundsätzlich zwei Hypothesen. Die eine besagt, dass die Engadinerföhre eine Kreuzung aus Wald- und Bergföhren ist. Die andere versteht Engadinerföhren als Ökotyp, Varietät oder lokale Unterart der Waldföhre.
Kreuzungsversuche mit Wald- und Bergföhren gibt es diverse. Die Hybriden werden Pinus rhaetica genannt. Sie sehen meist aus wie ein Gemisch der Eltern. Sind das die gleichen Bäume wie die Enga-
24
dinerföhren? Diese sehen Waldföhren schliesslich deutlich ähnlicher als Bergföhren. Und wie wahrscheinlich diese Hybride unter natürlichen Bedingungen vorkommen, ist unklar. Kreuzungen werden unter anderem dadurch erschwert, dass die Blütezeit von Berg- und Waldföhre verschoben ist. Im Val Müstair beispielsweise führt diese Verschiebung dazu, dass Hybridisierung sehr unwahrscheinlich erscheint.
Es lohnt sich also, die Ökotyp-Hypothese in Betracht zu ziehen: Engadinerföhren kommen nur auf den extrem trockenen Föhrenstandorten vor. Dort stehen sie in gemischten Beständen mit Waldföhren. Kleinräumig können die Standortsbedingungen natürlich stark schwanken. Ob diese Unterschiede zur Artbildung ausreichen, darf jedoch bezweifelt werden. Trotz der sichtbaren Unterschiede ist deutlich: Die Föhren im Val Müstair unterscheiden sich stärker von den Waldföhren im Mittelland als untereinander.
Kann nun der Schluss gezogen werden, dass Engadinerföhren gar nicht existieren? Um diese Frage abschliessend zu beantworten, müsste das Genmaterial dieser Bäume untersucht werden.
Und was nun?
Viel ist nicht bekannt über die Engadinerföhren. Doch klar ist, dass es in den inneralpinen Trockentälern Föhren gibt, die anders aussehen als gewöhnliche Waldföhren. Vielleicht nur auf morphologischer, vielleicht auch auf genetischer Ebene. Sie sorgen für Vielfalt und bereichern die Region mit ihrem kulturellen Wert. Schon diese zwei Dinge zu erhalten, lohnt sich.
Ayla Strozzega studiert Umweltnaturwissenschaften an der ETH Zürich mit der Vertiefung in Wald- und Landschaftsmanagement. Für ihre Bachelorarbeit untersuchte sie die Engadinerföhren im Val Müstair.

25
Engadinerföhre mit weit hinunterreichender Krone im Val Müstair. (Bild Ayla Strozzega)
Sonnenanbeterin mit Potenzial
Die Schwarzföhre (Pinus nigra Arnold) ist mehr als einfach ein weiterer forstlicher Exot. In der Schweiz ist sie durch Pflanzung in Gärten und Parks seit den 1850er-Jahren und im Wald vielerorts beigemischt und örtlich bestandesbildende Gastbaumart. Doch anders als forstliche Exoten aus Übersee gilt die Schwarzföhre aufgrund ihrer natürlichen Verbreitung bis ins österreichische Burgenland als eine in Mitteleuropa einheimische submediterrane Baumart. Die damit einhergehende ökologische Einbettung und ihre hohe Trockentoleranz machen die licht- und wärmeliebende Schwarzföhre angesichts des aktuellen Klimawandels zu einer wertvollen Option. Um Chancen und Risiken abwägen zu können, lohnt es sich, diese Baumart näher kennenzulernen.
Andreas Rudow
Namen und Systematik
Die Schwarzföhre (Pinus nigra Arnold) gehört zur Gattung der Kiefern (Pinus L.), die wir in der Schweiz als Föhren bezeichnen. Beide deutsche Gattungsnamen beziehen sich auf das harzreiche Holz, das sich besonders gut für Fackeln und Kienspäne eignet (Kien-Föhre, von mittelhochdeutsch kienvorhe). Traditionell wurde insbesondere die Schwarzföhre auch für die Terpentin-Herstellung genutzt.
Die Gattung der Föhren ist aufgrund ihres Artenreichtums namengebend für die ganze Familie der Föhrengewächse (Pinaceae L.) und darüber hinaus für die gesamte Ordnung der Koniferen (Pinales L.). Sie weist weltweit rund 100 Arten auf, mehrheitlich Baumarten sommertrockener mediterraner oder winterkalter borealer Gebiete der Nordhemisphäre. In Mitteleuropa kommen vier dieser Föhrenarten vor, drei davon sind in der Schweiz einheimisch. Die vierte mitteleuropäische Art ist die Schwarzföhre, die in der Schweiz nicht einheimisch ist. Sie wurde hier als Gartenexot seit den 1850er-Jahren häufig in Parks und Gärten sowie als forstlicher Exot im Wald angepflanzt. Die Schwarzföhre ist nahe mit der Waldföhre (Pinus sylvestris L.) und der Bergföhre (Pinus mugo Turra)
verwandt. Sie kann mit diesen hybridisieren, wobei aus Kontaktzonen der Arten keine bedeutenden Hybridpopulationen bekannt sind. Aufgrund ihrer submediterranen Verbreitung im durch Halbinseln untergegliederten Mittelmeerraum können vier räumlich getrennte Unterarten von Pinus nigra unterschieden werden (vgl. Verbreitung und Herkünfte): subsp. clusiana (Magreb, iberische Halbinsel, Südfrankreich), subsp. laricio (Korsika, Sizilien, Kalabrien), subsp. nigricans (Nordost-Italien, Österreich, Westbalkan, Griechenland), subsp. pallasiana (Ostbalkan, Krim, Kleinasien, Zypern). Im ganzen Verbreitungsgebiet lassen sich zudem regionale Varietäten unterscheiden, sodass auch schon Systeme von fünf und mehr Unterarten postuliert wurden. Umgekehrt könnten jeweils die zwei westlichen und die zwei östlichen Unterarten zusammengefasst werden (subsp. salzmannii, subsp. nigra).
Erkennungsmerkmale
Die Schwarzföhre ist ein immergrüner raschwüchsiger Nadelbaum, der auf mittleren Standorten Wuchshöhen von 35 bis 40 m erreicht, wobei das absolute Maximum bei 50 m Höhe liegt (subsp. laricio). Der Habitus ist anfangs kegelförmig und wird mit zunehmendem Alter schirmartig, wie wir
26 Schwarzföhre –
das auch von der Waldföhre kennen. Das Holz der Schwarzföhre ist leicht und weich, aber relativ dicht und aufgrund seines hohen Harzgehalts relativ witterungsbeständig. Es weist einen braunen Kern und einen relativ grossen hellen Splint auf. Die in der Jugend graubraune Rinde wird später durch eine graubraune grobe Streifenborke mit 5 bis 10 cm breiten und 20 bis 40 cm langen Borkenschuppen abgelöst. Von der Waldföhre lässt sich die Schwarzföhre aufgrund des fehlenden orangeroten Tons in Rinde und Borke sowie aufgrund der Grösse der Borkenschuppen deutlich unterscheiden. Die Verzweigung ist wie bei allen Föhrenarten quirlständig, wobei je Jahrestrieb nur ein endständiger Quirl ausgebildet wird. Dadurch entstehen lange Internodien zwischen den Quirlen. Deshalb können bei jüngeren Bäumen anhand der voneinander abgesetzten Quirle gut Wuchsverlauf und Alter abgelesen werden. Kahle Zweige erscheinen aufgrund der beim Nadelfall am Trieb verbleibenden NadelbüschelBasis sehr rau, ähnlich der Fichte. Die Knospen stehen gemäss der Verzweigung alle am Ende des Jahrestriebes, wobei die Endknospe mit 1 bis 2 cm Länge deutlich grösser ist als die darum herum quirlständig angeordneten Seitenknospen. Die Knospen sind auffällig zugespitzt, mit stark verharzten und an den Spitzen nach aussen umgebogenen Knospenschuppen. Die Nadeln der Schwarzföhre stehen wie bei der Wald und der Bergföhre zu zweit in Nadelbüscheln, die als stark reduzierte Kurztriebe interpretiert werden. Die Nadelbüschel sind am Grund durch eine Scheide zusammengefasst, die bei der Schwarzföhre mit 1 bis 2 cm Länge grösser und auffälliger ist als bei unseren anderen Föhrenarten. Die in der Regel 10 bis 15 cm langen Schwarzföhrennadeln sind deutlich länger und zudem kräftiger gebaut als bei den einheimischen Föhrenarten. Sie sind wie bei der Bergföhre im Querschnitt halbrund und zudem steif sowie in der Regel stechend zugespitzt. Die Steifheit ist durch mehrere Zellreihen stark verdickter Fasern in der Unterhaut be





gründet. Die längs verlaufenden Wachsstreifen mit den aufgereihten Spaltöffnungen sind über die ganze Nadeloberfläche verteilt, sie heben sich bei der Schwarzföhre aber farblich kaum vom Dunkel
Morphologische Merkmale: Grobe graubraune Streifenborke, steife lange dunkelgrüne Nadeln, sehr kurz gestielte Zapfen und Zapfenschuppen mit schwarzen Innenseiten, harzige zugespitzte Knospen und lange Nadelbüschelscheiden, wuchtige Erscheinung aufgrund langer, steif abstehender, dunkelgrüner Nadeln.
(Bilder: Andreas Rudow ETHZ)
27
grün der Nadeln ab. Aufgrund der Grösse, Dichte und des rundum dunklen Farbtons der Nadeln wirkt die Schwarzföhre üppiger und wuchtiger als die an sich ähnlich wuchskräftige, aber viel lichter erscheinende Waldföhre.
Die Zapfen der Schwarzföhre sind den rundlich ovalen Zapfen der Waldföhre ähnlich. Mit einer Länge von bis zu 8 cm sind sie aber deutlich grösser. Zudem sind die Innenseiten der Zapfenschuppen (am geöffneten Zapfen) schwarz gefärbt und die Zapfenstiele sehr kurz, weshalb die in Quirlen angeordneten Schwarzföhrenzapfen fast rechtwinklig von den Zweigen abstehen. Wegen der langen Samenreifezeit von zwei Jahren stehen die reifenden Zapfen an den Vorjahrestrieben und ältere reife oder bereits geöffnete Zapfen am dreijährigen oder älteren Holz.
Verbreitung und Herkünfte
Das natürliche Verbreitungsgebiet der Schwarzföhre ist geprägt durch submediterranes Klima. Der Verbreitungsschwerpunkt liegt in der montanen Stufe der Gebirgszüge des Mittelmeerraums. Durch die Untergliederung dieser Zone in vier Halbinseln ist auch das Verbreitungsgebiet entsprechend gegliedert und auf vier Unterarten aufgeteilt (vgl. Namen und Systematik). Die trockentolerante Schwarzföhre ist bezüglich Kontinentalität ambivalent und kommt in ozeanisch geprägten Gebieten ebenso vor wie in kontinental geprägten Gebieten. Dabei gibt es beträchtliche Unterschiede zwischen den regional angepassten Unterarten. Ganz generell gelten die beiden Unterarten der Iberischen und der Apenninen-Halbinsel (subsp. clusiana, subsp. laricio) als deutlich wuchskräftiger als diejenigen der Balkan- und der kleinasiatischen Halbinsel (subsp. nigricans, subsp. pallasiana). Die kleinasiatische Unterart subsp. pallasiana stellt mit mehr als 2,5 Millionen Hektar Schwarzföhrenwald in den westlichen Teilen des pontischen und des taurischen Gebirgszuges die mit Abstand grösste Population. Hier ist sie vielerorts bestandesbildend
und kann bis über 2000 m ü. M. aufsteigen, während in den Südost-Alpen die Obergrenze bei gut 1000 m ü. M. liegt.
Nebst dem natürlichen Verbreitungsgebiet kann die Schwarzföhre in ganz Mitteleuropa als Gastbaumart angetroffen werden. Einerseits wurde sie örtlich wohl schon im 17. Jahrhundert vereinzelt in Parks und Schlossgärten angepflanzt. Seit den 1850er-Jahren stieg ihre Beliebtheit und sie wurde als forstlicher Exot teils beigemischt, teils bestandesbildend eingesetzt. Dabei wurden anfangs mehrheitlich die raschwüchsigen westlichen Unterarten subsp. clusiana und vor allem subsp. laricio verwendet. Von einer wuchskräftigen kalabrischen Herkunft gibt es grössere Bestände in Belgien und Frankreich. Heute werden in Mitteleuropa und in der Schweiz vermehrt die weniger wuchskräftige, dafür aber noch trockentolerantere Unterart subsp. nigricans und Herkünfte aus dem österreichischen Burgenland oder vom südöstlichen Alpensüdfuss wie dem österreichischen Südkärnten oder dem norditalienischen Friaul eingesetzt. Leider fehlt oft eine zuverlässige Dokumentation und Rückverfolgbarkeit der verwendeten Provenienz oder von der ursprünglichen Provenienz bei Verwendung von Absaaten aus künstlichen Beständen ausserhalb des natürlichen Verbreitungsgebiets.
Die Schwarzföhre gilt in der Schweiz nicht als einheimisch, eingeführt ist sie aber in Tieflagen über fast das ganze Gebiet der Schweiz verteilt. Schwerpunkte bilden der Jurasüdfuss insbesondere im westlichen Teil und nach Osten hin abnehmend, im Mittelland insbesondere die Gebiete um grössere Städte, und im Alpenraum insbesondere die tieferen Lagen der Föhntäler. So gibt es im Kanton Graubünden vereinzelte Vorkommen im Rheintal von der Bündner Herrschaft, über das Churer Becken bis ins Domleschg.
Die heutige Schweizer Verbreitung dürfte mehrheitlich durch die erste Welle von Pflanzungen forstlicher Exoten zwischen 1880 und 1920 im
28
Zuge der systematischen Einführung der Hochwaldbewirtschaftung geprägt sein. Danach ist der Hype um die Schwarzföhre deutlich abgeflacht. Die Schwarzföhre war zwar weniger durch Misserfolge aufgrund von auftretenden Pathogenen betroffen, wie dies beispielsweise bei der verwandten Gastbaumart, der aus Übersee stammenden Strobe oder Weymouthsföhre (Pinus strobus L.) der Fall war. Aber es konnte sich keine stabile Nachfrage für das Holz dieser Baumart einstellen, was auf den hohen Harzgehalt des Holzes oder eine unzureichende Mindestmenge für einen stabilen Handel zurückgeführt werden kann.
In einer Umfrage aus dem Jahr 1986 zu Gastbaumarten im Schweizer Wald wurde die Schwarzföhre gut fünfmal seltener genannt als die Douglasie (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco). Gemäss Landesforstinventar ist die Schwarzföhre auch stammzahlmässig heute etwa fünfmal seltener. Der Vergleich zwischen dritter und vierter Aufnahme des Landesforstinventars zeigt in zehn Jahren eine Abnahme der Stammzahl um rund 15 Prozent. Die Häufigkeit liegt heute bei rund 185 000 Individuen ab BHD 12 cm (+/− 50 %).
Ökologie und Waldbau
Die Schwarzföhre weist erstaunliche ökologische Fähigkeiten auf. So gilt sie als extrem trockentolerant, wobei dies besonders auf die östlichen Unterarten zutrifft. Die Kältetoleranz ist nur mässig ausgeprägt, weshalb sich die forstliche Verwendung in der Schweiz auf kolline und submontane Lagen unter 800 m ü.M. beschränken sollte. Die Spätfrosttoleranz ist sehr hoch, sodass frühzeitig erwärmende, südexponierte Standorte kein Problem darstellen. Wie bei der Waldföhre sind die Ansprüche an die Nährstoffversorgung sehr gering. Die Schwarzföhre kommt auf verschiedenen Untergründen vor, wobei Unterschiede zwischen den Unterarten bestehen. Die aufgrund populationsbiologischer Überlegungen und aufgrund ihrer sehr grossen Trockentoleranz in der Schweiz unter Klimawandel
zu empfehlende Unterart subsp. nigricans bevorzugt Kalk-, Dolomit-, Mergel- oder Tonböden. Der Lichtbedarf der Schwarzföhre ist zwar hoch, aber weniger stark ausgeprägt als bei der Waldföhre. Das Jugendwachstum ist in der Startphase langsam, weshalb die Jungwaldpflege intensiviert werden sollte. Ab der Dickungsstufe weist die Schwarzföhre ein rasches Wachstum auf. Je nach Standort liegt die Umtriebszeit bei 80 bis 120 Jahren. Starke Eingriffe oder der Überhalt in die nächste Baumgeneration werden nicht empfohlen. Die Risiken aufgrund von Pathogenen wie dem Schwarzföhren-Triebsterben (Scleroderris lagerbergii Gremmen) sind moderat. Die Chancen und Risiken dieser Gastbaumart unter Klimawandel sind kontrovers. Nebst dem Plus der grossen Trockenheitstoleranz ist für Vitalität und Wachstum die standörtlich geeignete Herkunftswahl relevant. Aus populationsbiologischen Gesichtspunkten sollte in der Schweiz im Sinne einer moderaten Artverschiebung (assisted migration) die «naheliegendste» Unterart subsp. nigricans mit österreichischen Provenienzen verwendet werden. Risiken möglicher Invasivität werden als gering eingestuft.
Fazit
Die Schwarzföhre ist eine forstlich interessante Gastbaumart, die gerade auch im Hinblick auf den prognostizierten Klimawandel ein beträchtliches Potenzial aufweist. Aufgrund der begrenzten Erfahrungen für unser Gebiet gilt es, geeignete standörtliche Bedingungen und waldbauliche Behandlungsmethoden systematisch auszuloten und zu erproben.
Andreas Rudow ist Dipl. Forsting. ETH und arbeitet als Dendrologe und Dozent an der Professur für Waldökologie, Departement Umweltsystemwissenschaften, ETH Zürich.
Literaturverzeichnis und weiterführende Informationen auf www.buendnerwald.ch
29
Waldföhren im Forstgarten
Im Forstgarten Rodels werden verschiedene Föhrenarten produziert und verkauft, darunter vier einheimische: Waldföhre (Pinus sylvestris), Berg- und Legföhre (Pinus mugo) sowie Arve (Pinus cembra).

Neben dem Alpensymbol «Arve» ist die Waldföhre eine bestandesbildende Baumart, die immer mehr als klimaresistent betrachtet wird. Zu Recht? Diese Frage beschäftigt uns im Forstgarten nicht zuletzt, weil die zur Verfügung stehenden Pflanzen mindestens drei bis vier Jahre im Voraus mit der Saat festgelegt werden. Wenn sich die Waldföhre als klimafitte Baumart im Graubünden durchsetzt, müssen wir es schon mehrere Jahre im Voraus erkennen, um den Kunden genügend forstliches Vermehrungsgut anbieten zu können.
Beginnend mit den positiven Eigenschaften muss festgestellt werden, dass die Waldföhre eine Pionierbaumart ist, die auf offenen Stellen und felsigen, flachgründigen kargen Böden wachsen kann. Es handelt sich um eine trockenresistente Baumart (gegenüber Buche oder Fichte), die auf Südhängen auch einen sehr hohen Anteil am Bestand ausbilden kann. Die Holzqualität ist hoch. Nach der Fichte ist Waldföhre die wichtigste Wirtschaftsbaumart, die trotz ihrer Harzbildung auch interessant für Sägeund Industriesortimente ist. Als lichtbedürftige Pionierbaumart ist die Waldföhre nicht so konkurrenzstark wie die Fichte und die meisten Laubbaumarten, aber durch die beträchtliche Höhe von 35 bis 40 Meter und das schnelle Wachstum in der Jugend kann sie sich durchaus längere Zeit in der Oberschicht behaupten. Wenn waldbaulich gut bewirtschaftet, kann sie viel zur Waldbiodiversität beitragen. Dies, weil sie lichte Wälder bilden kann, wo dank viel Licht am Boden eine gute Vielfalt der Unterschicht möglich wird. Zudem kann sie oft als Überhälter im Bestand verbleiben.
Als negativ muss die Konkurrenzkraft der Waldföhre eingestuft werden. In den kleinen schattigen Löchern der Plenterung und Einzelbaumnutzung kann sie kaum mit den anderen Baumarten mithalten, und oft ist sie in schmalen, unstabilen schmalkronigen Stangenholz-Dimensionen anzutreffen. Auch im Stangenholz- und jungen Baumholzalter leidet sie sehr unter der Konkurrenz von Tanne, Buche oder Fichte, sodass sie sich nur mit gezielten frühen Eingriffen dominant in der Oberschicht etablieren kann. Die Waldföhre wird zudem gerne von Parasiten wie Pilzen oder Insekten spezifisch aufgesucht. Dies kann diese Baumart gefährden,
30
Francesco Bonavia und Alfio Caminada
Waldföhren lassen sich gut an der rötlichen Borke erkennen. (Bilder: Francesco Bonavia, Forstgarten Rodels)
vor allem weil es mit der Klimaveränderung wahrscheinlicher wird, dass Pilze und Insekten vermehrten Schaden anrichten können. Die Rotbandkrankheit beispielsweise gehört zu den wichtigsten Krankheiten an Föhrennadeln. Die verursachenden Pilze gelten als besonders gefährliche Schadorganismen und sind in der Schweiz und der EU als geregelte NichtQuarantäneorganismen (GNQO) eingestuft. Unmittelbar neben dem Forstgarten wurde im Jahr 2013 die Rotbandkrankheit angetroffen, und nach Funden in den Jungpflanzen im Forstgarten mussten im 2017 einige Föhren aus dem benachbarten Föhrenbestand und aus dem Forstgarten beseitigt werden. Seit 2018 wurde die Krankheit nicht mehr festgestellt, eine gewisse Gefahr bleibt diesbezüglich jedoch bestehen.
Schaden droht der Waldföhre zudem von einer grossen Anzahl Insekten, etwa Borkenkäfer, sowie von Raupenfrass, vor allem weil höhere Temperaturen die Anzahl Generationen pro Jahr vermehrt und die trockenere Witterung die Bäume zusätzlich schwächt. Andere bekannte Parasiten wie der Prozessionsspinner und die Mistel befallen ebenfalls oft die Waldföhre und können im Zuge der Klimaveränderung gegen die Etablierung oder Verbreitung der Föhre sprechen.
Bei der Talsohle in Visp im Wallis durchgeführte Studien der WSL haben gezeigt, dass die aufeinanderfolgenden Trockenjahre an extrem trockenen Standorten stark zum Föhrenwaldsterben beigetragen haben und dass die Föhren in tieferen Lagen eher keine guten Aussichten haben, da Eichen oder andere Laubbaumarten trockenheitsresistenter sind. In höheren Lagen der Alpen kann die Föhre in der Zukunft noch mit Erfolg als Biodiversitäts und Wertholzträger eingesetzt werden. Zu vermeiden sind Standorte, die heute schon von Trockenstress geprägt sind und wo die Föhre häufig eingesetzt wurde, weil die Fichte bereits nicht mehr am Standort angepasst war.
Aus Perspektive des Forstgartens wird trotz der Schwächen der Föhren deren Anteil zunehmen, wie
es sich in den letzten Jahren bereits gezeigt hat. Wie kommt es dazu? Werden mehr Föhren gepflanzt? Diese Frage ist nicht so eindeutig zu beantworten, und verschiedene Faktoren müssen in Betracht gezogen werden. Einerseits sind die Fichtenverkäufe so stark zurückgegangen, dass alle andere Baumarten proportional zugenommen haben. Weiter müssen wir feststellen, dass sich die meisten Forstbetriebe auf eine Naturverjüngung eingestellt haben: Gepflanzt wir nur dort, wo Mutterbäume fehlen oder wo die Verjüngung beschleunigt und gewisse waldbauliche Ziele erreicht werden sollen. Die Verkäufe im Forstgarten widerspiegeln daher nicht den Anteil der Verjüngung im Wald. Die Waldföhre hat das Potenzial, zukunftsfähige Bestände zu bilden. Sie ist sicher ein Biodiversitätsträger und kann in einer Mischung mit anderen Baumarten durchaus zur Walderhaltung beitragen. Gefragt ist aber ein aktiver Waldbau und etwas Baumartenkenntnis als notwendige Grundlage. Aus diesen Gründen wird in Zukunft im Forstgarten bestimmt auch auf die Waldföhre gesetzt werden. Das Suchen von geeigneten, gesunden Samenerntebeständen hat bereits begonnen, und die Techniken für die Aufzucht von neuen gesunden Pflanzen werden ständig den aktuellen Bedingungen angepasst.
Von der Blüte bis zur Zapfenbildung
Zwischen Mai und Anfang Juni werden die Blüten dieser windbestäubten einhäusigen Baumart gebildet. Aus der Blütenmenge können geschulte Augen schon ein mögliches Mastjahr erkennen, aber bis zur Samenernte braucht es auch eine gute Witterung. Wenig Regen und keine Spätfrostereignisse während der Blüte sowie ein nicht allzu trockener Sommer führen zu einem guten Zapfenbehang und reichlicher Samenbildung. Mastjahre sind bei der Föhre eher unregelmässig. Zapfenbehang gibt es zwar jedes Jahr, die Menge kann aber je nach Standort und Witterung sehr unterschiedlich sein. Grundsätzlich ist die Samenqualität in einem Mast
31
jahr besser, weil mehr befruchtete Samen und weniger Hohlkörner vorhanden sind. Die Zapfenernte der Wald-, Berg- und Legföhre fällt sehr spät an und beginnt ab Oktober, wobei geschlossene Zapfen auch im Januar noch geerntet werden können. Waldföhren können liegend oder stehend beerntet werden. Meistens ist eine stehende Ernte in einem Samenerntebestand erwünscht, aber ein Holzschlag zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist ebenfalls willkommen, weil die Zapfen sonst nur mit sehr grossem Aufwand zu ernten sind. Sie sind in der ganzen Krone verteilt, schwer zu erreichen und stehen einzeln auf den Ästen. Der Jutesack der fleissigen und frustrierten Sammler will sich nie so rasch füllen wie bei den grossen und schweren Fichten- und Tannenzapfen.
Das aufwendige Klengen der Föhrenzapfen Gesammelte Zapfen werden dann vor der Klenge in Holzharassen gelagert, sodass genügend Luft an die Zapfen gelangt und sie keinen Schimmel ansetzen. Bei einer Raumtemperatur von 18 bis 20 °C bleiben sie mindestens sechs Wochen liegen. Die Zapfen sollen langsam trocknen und nachreifen, wie es uns die Natur vormacht. Die Keimfähigkeit der Samen hat einen direkten Zusammenhang mit der Art der Trocknung, je langsamer, desto besser. Nach der ersten Trocknungsphase (Zapfen leicht geöffnet) werden die Zapfen in einen wärmeren Raum gebracht, wo eine Temperatur von 31 °C herrscht. Hier öffnen sich die Zapfen etwas mehr, aber leider nicht ganz. Es fallen im ersten Moment nur ein Drittel der Samen heraus! Danach müssen die Zapfen bei Raumtemperatur mit Wasser wieder angefeuchtet werden, sodass sich ihre Schuppen wieder schliessen. Die verschlossenen Zapfen gehen danach erneut in den wärmeren Raum, bis sie sich wieder öffnen. Dieser Vorgang wird so oft wiederholt bis die Zapfen ganz offen sind. Dieser aufwendige Arbeitsablauf, der in der Natur für eine andauernde Samenverteilung sorgt, muss nur bei Wald-, Berg- und Legföhren durchgeführt werden,
um den Ertrag von 1 Prozent auf 3 Prozent Samen pro Kilogramm Zapfen zu erhöhen. Da die Zapfenernte besonders aufwendig ist, lohnt sich dieser Mehraufwand jedoch. Die offenen Zapfen mit den Samen gehen dann ihren Weg durch die Klengtrommel und Siebe bis die gereinigten entflügelten Samen sauber abgepackt werden können. Für 100 kg Zapfen fallen nur 1 bis 3 kg Samen an, die aber 200000 bis 600000 Samen bedeuten können. Daraus liessen sich theoretisch rund 180 000 bis 500000 Sämlinge produzieren.
Bevor die Samen eingelagert werden können, müssen noch drei Dinge erledigt werden. Zunächst werden die Samen bis auf eine relative Feuchte von 6 bis 8 Prozent getrocknet. Danach kommt der Keimtest: 100 Samen werden auf einem Fliesspapier in den Keimschrank gelegt. Dieser bietet die idealen Bedingungen, damit die Samen keimen und ermittelt das Keimprozent, was wiederum die Arbeit bei der Saatplanung erleichtert. Als Letztes werden die Samen luftdicht abgepackt, vakuumiert und landen dann beschriftet im Kühlkeller bei −2 bis − 10 °C. Die Samen können dadurch für vergleichsweise lange Perioden (10 bis 20 Jahre) keimfähig gelagert werden.

32
Das Klengen von Waldföhrenzapfen verlangt aufwändige Arbeitsabläufe, wie sie auch die Natur vorsieht.
Der lange Weg bis zur Pflanzung
Im Mai wird die nötige Menge an Saatgut für die Saat vorbereitet. Hier werden die Samen in ganz fein gemahlenem Steinmehl gewendet, was eine feine mineralische Schicht um den Samen bildet. Dieses Verfahren hat zwei Vorteile: Mäuse mögen keine Steinmehlpanierten Samen zwischen den Zähnen, und Pilzkrankheiten kann man mit Steinmehl gut vorbeugen.

Damit es den Samen im Boden an nichts mangelt, wird im Vorjahr eine Gründüngung in den Boden eingearbeitet. Diese versorgt den Boden mit Luft, Nährstoffen und einem guten Wasserspeicher. Zusätzlich bekommt das Saatbeet 1 bis 2 kg/m² Spezialkompost, der oberflächlich eingearbeitet wird. Föhren werden im Saatbeet in 8 cm Rillenabständen gesät. Dies hat den Vorteil, dass die Pflanzen nicht zu eng stehen und genügend Platz haben, um zwei Jahre dort zu wachsen. Während dieser sehr heiklen Zeit werden die Keimlinge vor Unkraut und Pilzfäule geschützt. Durch das Jäten wird gewährleistet, dass die Pflanzen genügend Licht bekommen und immer abtrocknen können. Mit dem Komposttee werden die nötigen Bakterien eingebracht, die ein gesundes Pflanzenwachs
tum fördern. Die Sämlinge stehen eng, sodass sich Pilzkrankheiten sehr schnell über das ganze Beet verbreiten könnten. Deshalb muss täglich kontrolliert werden, um allenfalls die richtige Massnahme zur richtigen Zeit treffen zu können.
Nach zwei Jahren im Saatbeet werden die 5 bis 8 cm hohen Sämlinge wurzelnackt ausgefahren und nach Qualitätsansprüchen sortiert. Es wird noch ein Wurzelschnitt durchgeführt, um die Wurzelverzweigung anzuregen. Ein Teil dieser Sämlinge erreicht als verschulte Pflanze wieder das Feld, wo sie für weitere zwei Jahre in einem angemessenen Abstand von 10 bis 12 cm wachsen und gepflegt werden. Erst dann stehen sie als verkaufsfertige 40 bis 70 cm hohe Nacktwurzelpflanzen den Kunden zur Verfügung. Ein zweiter Teil der Sämlinge wird im März in QuickPotPlatten getopft. Diese sind als 15 bis 30 cm grosse Pflanzen schon im September des gleichen Jahres verkaufsfertig.

33
Francesco Bonavia ist Forstingenieur ETH und Leiter des Forstgartens Rodels. Alfio Caminada ist stellvertretender Leiter des Forstgartens Rodels.
Zwischensaatbeete und die Waldsamenklenge des Forstgartens werden von einer Gruppe Waldföhren überragt.
Einjährige Sämlinge bleiben noch eine Vegetationsperiode im Saatbeet des Forstgartens.
Vergessene Handwerkskunst oder die Zukunft?
Das anfallende Föhrenholz wird im Bündnerland hauptsächlich als Industrieholz ins nahe Ausland exportiert und findet wenig Nachfrage im eigenen Kanton. Der ökologische Wert dieser Baumart ist zwar hoch angesehen, aber das Holz der Föhre wird eher selten erwähnt. Die Holzart sei zu harzig, nicht gleich etherisch wertvoll und zudem wenig in Mode bei der Architektur. Auch sei der Splint sehr kurzlebig und gute Föhren von hoher Qualität gäbe es angeblich im Kanton Graubünden sowieso nicht. Doch eine Zimmerei im Unterengadin hat sich genau auf diese Holzart spezialisiert und schneidet die Stämme in der betriebseigenen Sägerei ein. Michi Beer, Geschäftsführer der Firma Marangunaria
Beer SA in Ramosch, gibt Auskunft über die Vor- und Nachteile von Föhrenholz und wagt eine Prognose zur Zukunft dieser einheimischen Holzart.

Das Interview führte Alain Schmid
Können Sie Ihren Betrieb kurz vorstellen?
Unser Betrieb ist eine Zimmerei & Sägerei mit Holzhandel in Ramosch im Unterengadin. Wir beschäftigen zehn Zimmerleute, zwei Zimmermannslehrlinge und drei Sägerei-Mitarbeiter. Die Marangunaria Beer SA haben meine Frau und ich im Jahr 2015 gegründet. Nach fünf Jahren reinen Zimmereibetriebs konnten wir die Räumlichkeiten mit der bestehenden Sägerei der Firma Resgia Koch in Ramosch übernehmen. Seither schneiden wir total ca. 1000 fm ein – und die Tendenz ist steigend.
Wie lange wird bei Ihnen schon mit Föhrenholz gearbeitet, und woher stammt die Idee?
Auf der Suche nach einer Alternative zum Arvenholz, vor allem im Aussenbereich, sind
34 Einheimisches
–
Föhrenholz
Michi Beer, Geschäftsführer der Marangunaria Beer SA:
«Den Wert der einheimischen Bäume erkennen und schätzen, dazu gehört sicher auch unser Föhrenholz.»
wir vor circa drei Jahren auf die Föhre gestossen.
Wo und wie verwenden Sie in Ihrem Betrieb Föhrenholz?
In erster Linie verbauen wir das Föhrenholz im Aussenbereich. Das Föhrenholz eignet sich vor allem sehr gut für Terrassenböden, Balkongeländer sowie für Fassaden. Wichtig dabei ist, splintfreie Föhrenbretter zu verwenden, da der Splint wenig beständig ist und durch spezielle Pilze blau wird. Diese Seitenware verarbeiten wir weiter zu Latten oder verleimen sie zu Ständerholz.

Sie schneiden in Ihrer Sägerei auch selbst Holz ein, darunter auch Föhrenholz. Wie verhält sich das Holz beim Einsägen und worauf muss geachtet werden?
Ca. ein Drittel unseres jährlichen Einschnitts ist Föhrenholz, welches wir anschliessend zu fast 100 Prozent in unserer eigenen Zimmerei verarbeiten. Weil die Föhre sehr harzhaltig ist, lässt sie sich am besten in gefrorenem Zustand schneiden. Im Gegensatz zur Fichte, die man auch gut im Sommer schneiden kann, verklebt beim Einschneiden der Föhre im Sommer das Sägeblatt. Das Einschneiden ist überaus angenehm, weil sie sehr gut duftet.
35
Die Zimmerei und Sägerei Beer SA in Ramosch im Unterengadin setzt voller Überzeugung auf einheimisches Föhrenholz.
Gibt es Unterschiede punkto Verwendung von Föhrenholz früher und heute?
Früher wurde das Föhrenholz insbesondere für Fenster sowie für «Billigmöbel» gebraucht. Dadurch erhielt es einen eher geringen Stellenwert in der Bevölkerung. Heute ist das etwas
anders: Föhrenholz wird immer mehr als «günstigerer» Ersatz für Arvenholz verwendet, auch wenn es oft noch ein wenig Überzeugungsarbeit braucht
Welches sind die Vor- und Nachteile von Föhrenholz in der Zimmerei?
Es ist eine einheimische Holzart, die sich bei unserem Klima im Engadin speziell gut für den Aussenbereich eignet. Selbstverständlich kann die Föhre nach Belieben auch im Innenbereich verwendet werden. Im Prinzip kann Föhrenholz auch für Tragkonstruktionen eingesetzt werden (dafür gibt es aber leider noch keine offiziellen Normen). Als Nachteil könnte man erwähnen, dass der Splint für den Aussenbereich nicht geeignet ist. Deshalb kommen für unseren Gebrauch nur Bäume mit grösserem Durchmesser infrage.
Welche Föhrenarten, Sortimente und Qualität brauchen Sie?
Wir verwenden ausschliesslich einheimische Föhre mit einem Mindestdurchmesser von ca. 30 cm (weil der aussenliegende Splintanteil abgeschnitten wird). Im Engadin wächst die Föhre sehr langsam und ist dadurch im Vergleich zur schwedischen Föhre viel feinjähriger und somit auch vielseitiger einsetzbar.
Wie sieht die Föhrenholz-Beschaffung im Kanton Graubünden aus, sind die Forstbetriebe bereit und könnten Föhrenholz bereitstellen?
Wie es generell im Kanton Graubünden ist, können wir nicht genau sagen. Im Unterengadin wird das Föhrenholz meist als Industrieholz ins Ausland verkauft. Es würde genügend Föhrenholz zur Verfügung stehen, das Potenzial wurde aber noch nicht erkannt, und somit ist die Nachfrage noch zu klein. Wir arbeiten sehr gut und eng mit dem Forstamt Valsot zusammen, welches uns immer mit schönen Föhren beliefert.
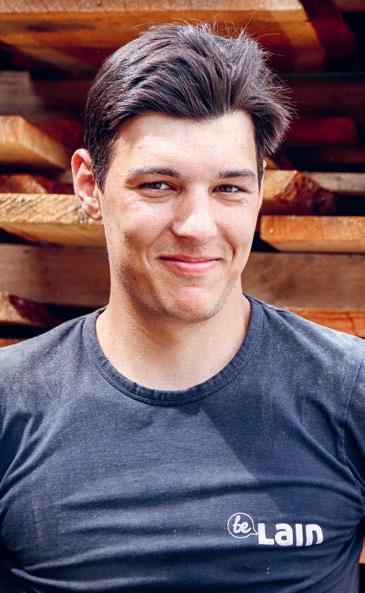
36
Severin Koch, Lernender im 4. Lehrjahr: «Ich arbeite gerne mit einheimischem Föhrenholz, es riecht gut und ist angenehm anzufassen.»
Arbeiten Ihre Angestellten gerne mit Föhrenholz?
Das Arbeiten mit Föhrenholz ist im Allgemeinen sehr angenehm, weil es sehr gut riecht und, da es eher weich ist, einfach zu bearbeiten ist.
Wird in der Ausbildung Föhrenholz thematisiert?
Nein – leider nicht. Auch hier wurde das Potenzial noch nicht erkannt!
Könnte die Verwendung von Föhrenholz gefördert werden?
Ja, unbedingt. Wir müssen vermehrt auf unsere Werte vor Ort zurückgreifen und mit dem arbeiten, was unsere Natur hergibt, anstatt
Holz aus verschiedenen Ländern zu uns zu transportieren. Holz ist ein Naturprodukt. Kein Brett, das wir verarbeiten, ist gleich wie das andere. Dies sollte nicht als Nachteil angesehen, sondern genau als das Besondere geschätzt werden.

Haben Sie noch ein Schlusswort zum Thema Föhrenholz?
Nachhaltigkeit, Klimaneutralität sowie Energiekrise sind in aller Munde. Mit der Wertschätzung von einheimischen Produkten kann konkret etwas bewirkt werden, um die Lage zu verbessern. Aber wollen das die Leute? Das Potenzial dafür ist da. Es gilt, die heimischen Werte zu erkennen und sie zu schätzen – dazu gehört sicher auch unser Föhrenholz.
37
Das ganze Team der Marangunaria Beer SA ist motiviert, auch weiterhin einheimisches Föhrenholz zu verarbeiten. (Bilder: Marangunaria Beer SA)
Die Kiefer als «Brotbaum des historischen Zeidler-Handwerks»
Die Zuverlässigkeit der Kiefer, Stürmen zu trotzen, und ihre hervorragenden Holzeigenschaften sind seit Jahrhunderten bekannt und führten bereits im Frühmittelalter die Zeidlerei zu ihrer Blüte. Auch heutzutage lassen sich wunderbare Bienenbehausungen aus diesem Material fertigen, sodass zunehmend Bienenschwärme ihren Weg zurück in die Wälder antreten.
Martin Grössel
Die Zeidlerei als Nebennutzungsform der Waldwirtschaft findet in unseren heutigen Beständen keine Anwendung mehr und ist nahezu in Vergessenheit geraten. Dabei verhalf sie im Frühmittelalter einigen Städten und Regionen zu beachtlichem Wohlstand und sicherte den Bedarf an Honig und Wachs, vor allem für die Klöster und Kirchen, dien-
te aber auch als Handelsware. Es wurden aktiv Höhlungen in Bäumen angelegt, um Bienenvölkern einen Lebensraum zu bieten und einen regelmässigen Ertrag an Honig und Wachs sammeln zu können. Diese Beuten wurden generationsübergreifend genutzt und das Wissen um die Techniken und das Handwerk der Zeidler von Alt an Jung weitergegeben.
Grundvoraussetzung für die Anlage einer Beute war ein dauerhafter und gut zu bearbeitender Rohstoff. Diesen fanden die Zeidler zumeist in der stabilen und omnipräsenten Kiefer. Der Waldbaum, welcher auch als Föhre, Forche, Dale und Kienbaum bekannt ist, erreicht meist eine Höhe von 25 bis 40 Metern mit einem hohen, astfreien Stamm und einer knorrigen Krone. Die Kiefer kommt überall in Mitteleuropa vor und ist vorherrschend in Russland, Polen und Skandinavien. Die slawischen Länder sind auch die Orte, an denen das Zeidlerhandwerk perfektioniert und intensiv betrieben wurde.
Nur in Shulgan Tash, heute ein Nationalpark in der Region Baschkortostan im russischen Uralgebirge, konnte das Handwerk überdauern und wird seit Jahrhunderten durchgängig betrieben. Dies ist auch der Ausgangspunkt heutiger Bemühungen, die Zeidlerei und vor allem die Biene wieder zurück in die mitteleuropäischen Wälder zu bringen. Besonders der polnische Staatsforstbetrieb versucht Klotzbeute

38
mit Brutraumöffnung.
seit nunmehr über zehn Jahren, die Zeidlerei wieder aktiv in den Wäldern zu betreiben. Die wichtigste Anforderung an einen geeigneten Zeidelbaum ist die Dimension, um ein geeignetes Volumen der Höhlung zu gewährleisten, aber auch um die Standsicherheit des Baumes nicht zu sehr zu beeinträchtigen. Die Beute wird mit Schlagwerkzeugen in den Stamm gehauen. Das gut mit der Hand zu bearbeitende Kiefernholz erleichtert dabei die schwere, zeitaufwendige Arbeit. Die optimale Höhe einer solchen Behausung befindet sich bei fünf bis sechs Metern des Baumes. Um diese Stellen zu erreichen, wurden teilweise Tritte in die Rinde geschlagen, und ein um den Stamm liegendes Seil diente der Sicherung. Die starke und widerstandsfähige Borke der Kiefer ist optimal geeignet, um solch einer Bearbeitung zu trotzen. Es wurden auch eine primitive Seilklettertechnik und Leitern benutzt, um die Bäume zu erklimmen und kleine Plattformen zu errichten. Durch ihre immense Pfahlwurzel ist die Kiefer sehr sturmsicher. Ein solcher Baum konnte von vielen Generationen genutzt werden, wodurch der Honigertrag den Rohstoffwert eines solchen Baumes bei Weitem übertraf.
Falls es doch vorkam, dass ein Zeidelbaum geworfen wurde, sägte man die Beute aus dem Stamm heraus, um sie wieder in einem anderen Baum aufzuhängen und weiter als Bienenbehausung nutzen zu können. Zum einen diente die erhöhte Position dazu, der Plünderung der Beuten durch Bären vorzubeugen, zum anderen war es aber auch der natürliche Lebensraum der Biene, die ursprünglich als Waldtier in hohlen Baumstämmen lebte. Somit ist die erhöhte Position dem Wesen und der Gesundheit der Bienen förderlich. Um aus diesem Vorgang heraus umgefallene Zeidlerbäume weiter zu nutzen, entwickelte sich die Technik, Beuten am Boden zu fertigen und diese sogenannten Klotzbeuten in Bäumen aufzuhängen.

Der Bau einer solchen Wohnstätte beginnt, indem ein Keil in den Stamm geschlagen wird. Dies er-
folgt heute mit moderner Motorsägentechnik. Danach wird der Brutraum mit verschiedenen Schlagwerkzeugen ausgebeitelt. Das mittelschwere und mässig harte Holz der Kiefer lässt sich so gut bearbeiten. Dabei sollte darauf geachtet werden, ein möglichst astfreies Stück zu nutzen. Das kurzfaserige Holz löst sich gut ab und es lässt sich eine glatte Oberfläche herstellen. Der aromatische Duft des frischen Kiefernholzes beflügelt die Arbeit und ist auch den Bienen bei der späteren Nutzung sehr angenehm.
Der Stamm sollte mindestens einen Meter hoch sein und einen Durchmesser von 50 cm nicht unterschreiten. Die Brutraumöffnung ist 80 cm lang und die Nisthöhle durchschnittlich 35 cm tief, woraus sich ein Volumen von rund 75 Litern ergibt. Die verbliebene Restwandstärke von 15 cm isoliert die Behausung optimal und schafft durch die Fähigkeit, Wasser aufzunehmen und abzugeben, ein
39
Beitel zum Aushöhlen der Klotzbeute.
optimales Raumklima für die Bienen. In dieser grossräumigen Behausung können die Honigsammler auf natürliche Weise bauen, ohne durch Rähmchen oder einen zu kleinen Brutraum beschränkt zu sein. Sowohl der Naturwabenbau als auch der grosse Hohlraum fördern die Vitalität der Bienen.

Der Zeidler machte sich die besondere Form der Klotzbeute zu Nutze. Dadurch, dass die Bienen im oberen Drittel der Beute Honig einlagern und sich in der Mitte das Brutnest befindet, können die Vorräte im unteren Drittel der Beute entnommen werden, ohne dass die Bienen im Winter hungern müssten. Seitlich von der Brutraumöffnung wird das Flugloch in den Baum geschlagen, in welchem die Bienen ein- und ausfliegen. Damit die Beute nicht von anderen Höhlenbrütern bewohnt wird, verschliesst man diese Öffnung mit einem
Fluglochkeil, welcher nur genug Platz für die Bienen lässt. Der Fluglochkeil ist konisch nach innen zulaufend und reicht bis in das Zentrum der Beute hinein. Die Brutraumöffnung wird mit einem zweiteiligen Verschlussbrett verriegelt, um die Möglichkeit zu haben, auch nur im unteren Teil der Beute Arbeiten durchzuführen. Um diesen Verschluss vor dem Räubern durch Baummarder oder Spechte zu schützen, wird dieser mit einem Reisigbündel geschützt, welcher davor verschnürt wird. Durch die hohe Lichtdurchlässigkeit der Baumkrone der Föhre entsteht in solchen Wäldern oft eine üppige Bodenvegetation, in denen die Bienen reichlich Nektar finden und somit die Zeidlerei in kieferndominierten Regionen besonders ertragreich macht. So konnte sich der Nürnberger Reichswald zum «Bienengarten Deutschlands» entwickeln.

40
Flugloch mit Fluglochkeil.
Fertige Beute. (Bilder: Martin Grössel)
Bei der Zeidlerei handelt es sich um eine sehr extensive Bewirtschaftung, bei der die Tiere ihre natürlichen Triebe ausleben können und der Zeidler unter optimalen Bedingungen nur wenige Arbeitsschritte im Jahr durchführen muss. Durch diese Tätigkeit entstanden bereits in der Vergangenheit lichte, artenreiche Bestände mit einer hohen Biodiversität, welche unter der heutigen Problematik des Insektensterbens wieder zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Auch das extensive Halten von Bienenvölkern in natürlichen, grossräumigen Baumhöhlen weckt das Interesse einiger Wissenschaftler und Vereine, die in der konventionellen Bienenhaltung und der
zunehmenden VarroaProblematik keine zukunftsfähige Haltung von Bienen sehen. Wenn es zu einer Renaissance der Zeidlerei kommen sollte, wird diese auf Grundlage der Kiefer geschehen, da das Holz und dessen begünstigende Umwelteinflüsse diese Haltungsform in hohem Masse fördern. Indem wieder neuer Lebensraum für Bienen geschaffen wird, entsteht mehr Biodiversität in unseren Wäldern, von der sowohl die Bestände als auch die Biene profitieren können.

Martin Grössel ist Waldarbeiter, Forstingenieur und passionierter Waldimker in Rosenbach, Deutschland.
NAULI AG HOLZHANDEL Via Spinatsch 11 7014 Trin

Wir empfehlen uns für den Kauf und Verkauf von Rundholz in jeglicher Form

41
ANZEIGE
Grischa-Brennholz.ch Grischa-Kastanienholz.ch Tel. 081 353 41 51 Fax 081 353 41 54 Handy 079 610 29 81 info@nauli-holz.ch www.nauli-holz.ch ANZEIGE
Kiefernharzung – ein vergangenes Kapitel Industriegeschichte
Die Kiefernharzung wurde in Deutschland im Mai 1990 im Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereinigung eingestellt. Damit endete sie 75 Jahre nach der Aufnahme im Ersten Weltkrieg 1916 und ihrem Höhepunkt in der Deutschen Demokratischen Republik. Unter den neuen Bedingungen konnte sie vor allem mit den Angeboten aus tropischen Ländern nicht mehr konkurrieren.
Dr. Gerhard Stephan
Kiefernharz ist eine Substanz von aromatischem Geruch, die aus Harzsäuren und Terpentinöl besteht und von lebenden Kiefern ausgeschieden wird, wenn ihr Holzkörper eine Verletzung erfährt. Das leicht gewinnbare Harz erregte wegen seines würzigen Geruchs, seiner klebenden Eigenschaft und weil es wegen seiner wasserabweisenden Wirkung als Dichtungsmaterial benutzt werden konnte, schon in sehr fernen Zeiten die Aufmerksamkeit des Menschen und hat auch in der Gegenwart Bedeutung als Industrierohstoff. Das aus verletzten Kiefernstämmen ausfliessende Harz kommt mit der Luft in Berührung, wobei die

in ihr enthaltene Feuchtigkeit bewirkt, dass das Harz zu kristallisieren beginnt und sich aus einer homogenen honigartigen Substanz in eine halbfeste Masse verwandelt. Unter dem Einfluss von Regenwasser verstärkt sich die Kristallisation, sodass eine grauweisse Masse entsteht, die durch Nadeln und Borkenteile verunreinigt ist. Dieses Rohharz wird, um es nutzbar zu machen, durch einen Destillationsprozess in seine Bestandteile Kolophonium und Terpentinöl zerlegt, die in der wirtschaftlichen Tätigkeit des Menschen zu den verschiedensten Zwecken verwendet wurden und werden.
Kiefernharz in der Geschichte
Abb. 1: Für die 1. Nutzung geröteter, 87-jähriger Kiefernbestand, wie er nach Einstellung der Harzung 1990 verblieben war. Die Lachten wurden nach Möglichkeit auf der Ost- oder Südostseite der Stämme angebracht, um den Einfluss der meist von Westen kommenden Niederschläge möglichst gering zu halten.
Die Bezeichnungen Kolophonium und Terpentinöl deuten darauf hin, dass diese Naturstoffe schon in der Antike bekannt waren. Die Bezeichnung «Terpentinöl» ist von der Pistazie, einem zu den Rautengewächsen gehörenden und im Mittelmeergebiet heimischen Baum – Pistacia therebinthus – abgeleitet worden. Der Name «Pistazie» ist auf die griechische Bezeichnung «pissa» für Harz oder Pech zurückzuführen (Heyse 1919). Die Bezeichnungen «Pech» und «Auspichen» lassen sich unschwer aus dem griechischen Wort ableiten, wobei unter «Auspichen» das Auskleiden von Fässern mit Pech verstanden wird, um sie undurchlässig für Flüssigkeiten zu machen. Die Bezeichnung «therebinthus» bringt zum Ausdruck, dass ein Vorgang betrachtet wird, der durch «anschneiden, dass Saft fliesst», charakterisiert ist (Schmeil & Seyboldt
42
1945). Die Pistazie lieferte ein Öl, das nach den Mitteilungen von Theophrast in seiner Naturgeschichte der Gewächse als cyprischer Terpentin in den Handel kam, welche Bezeichnung auf die Öle der Nadelhölzer übertragen wurde.
«Kolophonium» ist vermutlich nach der antiken griechischen Stadt Kolophon benannt worden, die an der heutigen türkischen Küste in der Nähe von Ephesos lag. Das griechische Wort «Kolophon» hat die Bedeutung von Gipfel oder Bergspitze, sodass man annehmen kann, dass die Stadt Kolophon auf einem Gebirgszug lag. In den Bergregionen des erwähnten Küstengebiets gab es neben zahlreichen Laubholzarten wie Eichen, Ulmen und Ahorn auch Kiefernarten, vor allem Schwarzkiefern, Pinus brutia und Pinien. Diese relativ harzreichen Kiefernarten konnten Pech und Teer liefern, die für den Bau seetüchtiger Schiffe gebraucht wurden.
Ausserhalb des Mittelmeergebiets im Verbreitungsgebiet der Gemeinen Kiefer (Pinus silvestris) wurde bis in das 20. Jahrhundert wegen des niedrigen Ertrages dieser Kiefernart kein Harz zur Herstellung von Kolophonium und Terpentinöl gewonnen. Wohl aber war die Teerschwelerei verbreitet, mit der man aus verkientem Kiefernholz Teer und Pech herstellte.

Holzteer entsteht, wenn verkientes Holz, vorzugsweise Stockholz, das nach dem Fällen der Kiefern einige Jahre im Boden verblieben war und einen Verkienungsprozess durchgemacht hatte, in einem Meiler oder in gemauerten Ringöfen erhitzt wird. Bei dieser trockenen Destillation entsteht zunächst eine dunkelbraune Mischung aus Terpentinöl, Bestandteilen des Kolophoniums und Produkten der Holzverkohlung wie Phenole und Teer. Ein Teil dieser Mischung verdampft infolge der zugeführten Wärme und wird, nachdem die Dämpfe in einem Kühler kondensierten, als Kienöl aufgefangen. Kienöl wurde in der Lackindustrie verwendet und Holzteer benutzte man zur Kalfaterung von Schiffen, als Anstrichmittel für Holz zum Zwecke seiner Konservierung und in der Veterinärmedizin.
Abb. 2: Kiefernbestand nach den ersten beiden Rissen. Normalerweise würde nun hier von Mai bis Anfang Oktober wöchentlich ein Riss hinzukommen. Diese Risspausen zwischen den Rissen waren wichtig für den Harzertrag. Sie erlaubten dem Baum, das Harz in den Harzkanälen nachzubilden, das ihm durch den vorherigen Riss entzogen worden war. Die entleerten Harzkanäle füllten sich in etwa einer Woche wieder.
In Deutschland wurde bis zum Ersten Weltkrieg kein Kiefernharz gewonnen.
Den Bedarf an Kolophonium und Terpentinöl deckten Importe, wobei insbesondere die Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreich diese Rohstoffe lieferten. Als während des Krieges die Lagerbestände verbraucht zu werden drohten, wurden Schritte unternommen, die als strategisch wichtige Rohstoffe geltenden Harzprodukte im eigenen Lande zu gewinnen.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Harzgewinnung aufgegeben, um im Zusammenhang mit der auf Autarkie gerichteten Wirtschaftspolitik wieder aufgenommen zu werden. In diese Zeit fielen die Bestrebungen, die Harzerträge durch die Behandlung der Schnittrillen mit Salzsäure zu erhöhen. Diese «Reizmittelharzung» wurde im Jahre 1943 auf etwa der Hälfte aller Harzungsflächen angewendet.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Gewinnung des Kiefernharzes in der Deutschen Demokratischen Republik neu organisiert, um den
43
Bedarf der Wirtschaft an Kolophonium und Terpentinöl zu decken.
Die Harzprodukte Terpentinöl und Kolophonium Das Rohharz, das im Walde gewonnen wird, kommt in die Destillationswerke und wird dort in seine Bestandteile zerlegt. Vor der Trennung ist das Rohharz zu reinigen, weil die in ihm enthaltenen Fremdbestandteile entfernt werden müssen, um saubere Produkte zu erhalten. Die Reinigung erfolgt durch Filter und durch Absetztanks, in denen Nadeln, Borketeile, Sand und andere Verunreinigungen abgetrennt werden. Die Aufspaltung des Rohharzes in seine Bestandteile erfolgt durch eine Erwärmung mit Wasserdampf bei einer Temperatur von 100 ° C. Der Dampfstrom treibt das Terpentinöl als wasserhelle Flüssigkeit aus dem Rohharz heraus und Kolophonium bleibt als Rückstand zurück.
Die Verwendung von Terpentinöl
Terpentinöl ist ein farbloses Gemisch verschiedener Kohlenwasserstoffe, die als Terpene bezeichnet werden und im Terpentinöl der verschiedenen Kiefernarten in wechselnder Zusammensetzung vorkommen. Der Gehalt des Harzes an Terpentinöl ist relativ hoch, solange es sich im Baum befindet. Beim Verlassen der Schnittrille enthält das Harz etwa 30 Prozent Terpentinöl, und auf dem Wege in das Auffanggefäss sinkt der Gehalt an Terpentinöl ab (Stephan 1957/58). Der Verlust im Auffanggefäss hängt von der Zeit ab, die bis zur Entleerung des Gefässes vergeht. Beträgt diese Zeit nur einen Tag, so kann mit einem auf wasserfreies Rohharz berechneten Gehalt an Terpentinöl von durchschnittlich 24 Prozent gerechnet werden (Kriegel 1975).


Terpentinöl wird als Lösungsmittel für Farben benutzt, es ist in Lederpflegemitteln enthalten und
Durchmesser erhielten eine Lachte. Ein Drittel des Stammumfanges blieb als sog. Lebendstreifen unversehrt. In ihm konnte der Stofftransport von der Krone in den Wurzelbereich und umgekehrt ungehindert erfolgen. Abb. 4: Vorbildlich geharzte Kiefer am Ende der 1. Nutzung. Abb. 5: Unterhalb der Brusthöhe, wie hier nach der 3. Nutzung, wurde ziehend gerissen.
Abb. 3: Lachte nach dem 2. Riss. Bäume bis

44
30 cm
Dazu stand der Harzer hinter dem Stamm und arbeitete zum Körper hin.
Bestandteil von Bohnerwachs. Die Verwendung als Lösungsmittel ist rückläufig, weil häufig Spezialbenzine die Stelle des Terpentinöls eingenommen haben. Das Δ3-Caren bewirkt bei manchen Personen Hautekzeme, eine Erscheinung, die zur Verdrängung des Terpentinöls beigetragen hat.
Die Verwendung von Kolophonium Kolophonium ist ein Gemisch verschiedener Harzsäuren, von denen die Abietinsäure, die Laevopimarsäure und die Dextropimarsäure hauptsächlich von Bedeutung sind. Der grösste Teil des auf der Welt erzeugten Kolophoniums wird in der Papierindustrie als Bestandteil des Papierleims verbraucht. Ungeleimtes Papier besteht aus Fasern mit einer grossen Saugfähigkeit, sodass es zum Beschreiben mit Tinte nicht geeignet ist. Geleimtes Papier besteht aus Fasern, deren Saugfähigkeit

durch einen Leimfilm soweit herabgesetzt ist, dass eine Beschreibung möglich wird.
Papierleim entsteht, wenn Kolophonium mit verdünnter Natronlauge oder Sodalösung gekocht wird. Die so entstehende Harzseife wird dem Holzschliff oder dem Halbzellstoff in einer Menge von einem Gewichtsprozent zugesetzt, wenn diese Materialien zur Papierherstellung zermahlen werden (Ömann 1927). Schliesslich hat die wissenschaftliche Durchdringung der Technologie der Leimung zu einem geringeren Bedarf an Papierleim geführt (Moore 1984).
Beträchtliche Mengen an Kolophonium werden bei der Herstellung von Synthesekautschuk benötigt. Für die Polymerisation von Butadien und Styrol zu Buna wird Kolophonium in chemisch veränderter Form als Emulgator verwendet. Der Kolophonium-Emulgator hat den früher verwendeten synthetischen Emulgator verdrängt, weil ersterer eine wesentliche Verbesserung der Autoreifen mit sich brachte. Die Entwicklung auf diesem Gebiet zeigt, dass Naturprodukte den Syntheseprodukten technisch und ökologisch überlegen sein können.
Prof. Dr. Gerhard Stephan (1929) ist Diplom-Forstingenieur. Er forschte an der Technischen Universität Dresden unter anderem zur Steigerung der Arbeitsproduktivität in der Harzung. Die im Wortlaut des Autors wiedergegebenen Abschnitte stammen aus seinem Buch «Die Gewinnung des Harzes der Kiefer», erschienen im Verlag Kessel, 1. Auflage 1968, 3. Auflage, 2012, www.forstbuch.de.
Zur Kiefernharzung wurden 1991, nach Einstellung der Harzung in der DDR im Mai 1990, noch einmal Fotos aufgenommen, die die Arbeitsabläufe bis in Einzelheiten authentisch zeigen. Der erfahrene Harzer Gerhard Girmann aus Letzlingen hat dazu noch einmal auf einer Probefläche südlich von Gardelegen in SachsenAnhalt eine Anzahl Kiefern geharzt.
(Bilder: Georg Linhardt, Erläuterungen Dr. Jürgen Hevers)
45
Abb. 6: Nach fünf Nutzungsjahren ausgeharzte Kiefer.
Föhren als Nahrungsquelle für das Auerhuhn
Das Auerhuhn ernährt sich im Winterhalbjahr vor allem von Koniferennadeln. Föhren, und damit sind alle Arten der Gattung Pinus gemeint, werden von den Hühnern gegenüber Fichten oft bevorzugt. Allerdings ist bis heute nicht abschliessend geklärt, ob Auerhühner wirklich Föhrennadeln als Nahrung bevorzugen oder ob sie sich wegen der starken horizontalen Äste gerne auf Föhren setzen.
 Pierre Mollet
Pierre Mollet
Ausgewachsene Raufusshühner sind Vegetarier, die grundsätzlich leicht verdauliche Kost wie Beeren und Samen bevorzugen, die sie in der niedrigen Vegetation am Boden finden. Besonders beliebt sind Zwergsträucher. Liegt in der kalten Jahreszeit viel Schnee, der die bodennahe Vegetation zudeckt, weichen die waldbewohnenden Arten wie Auerhuhn oder Haselhuhn auf Nahrung aus, die sie auf Sträuchern und Bäumen finden. Dabei unterscheidet sich die Winternahrung dieser beiden Arten stark. Das kleine und leichte Haselhuhn kann auf dünnen Zweigen von Ebereschen, Hasel- und anderen Sträuchern balancieren und erreicht so Beeren und Kätzchen, die reich an leicht
verdaulichen Bestandteilen sind. Das vergleichsweise grosse und schwere Auerhuhn dagegen kann sich nur auf grössere, stärkere Äste setzen. Dort muss es mit dem vorliebnehmen, was von dort aus erreichbar ist. Je nach Gegend sind das während eines grossen Teils des Winters fast ausschliesslich Koniferennadeln.
Die Frage nach der bevorzugten Winternahrung bei Auerhühnern treibt Forscherinnen und Forscher schon lange um. Auch für die Förderung des Auerhuhns ist das Thema von Bedeutung. Je nach standörtlichen Verhältnissen kann die Förderung der von den Hühnern bevorzugten Baumarten eine sinnvolle Massnahme sein.
In Wäldern, in denen Fichten und Föhren vorkommen, findet man Spuren des Auerhuhns auffallend häufig unter Föhren. (Bilder: Pierre Mollet)
Folgt man während mehrerer Jahre den Spuren, die das Auerhuhn im Winter hinterlässt, bekommt man den subjektiven Eindruck, dass sowohl Föhren als auch Weisstannen gegenüber der Fichte bevorzugt werden. Auffallend häufig sind jedenfalls jene Fälle, in denen man in einem fichten-dominierten Wald Hühnerkot unter den wenigen vorhandenen Föhren oder Weisstannen findet, kaum aber unter den viel häufigeren Fichten. Daraus kann man jedoch nicht den Schluss ziehen, Föhrennadeln würden der Nahrung wegen bevorzugt. Die Kothaufen weisen nur darauf hin, dass sich die Hühner auf die betreffenden Bäume gesetzt und eine gewisse Zeit dort verbracht haben. Möglicherweise taten sie das aus Gründen, die mit der Nahrung nichts zu tun haben, z.B. wegen des Vorhandenseins starker, horizontal ausgerichteter Äste. Die Erfahrung zeigt aber auch
46
deutlich, dass Waldföhren und Bergföhren für Auerhühner keine unverzichtbaren Baumarten sind. Häufig kommt das Auerhuhn in Wäldern vor, in denen die Fichte die einzige Nadelbaumart ist. Was sagt denn die Wissenschaft dazu? Über die Nahrungszusammensetzung beim Auerhuhn wurde früher viel geforscht, vor allem in Ländern, in denen das Auerhuhn gejagt wurde. Da war es einfach, Material für die Forschung zu bekommen. Die Analysen wurden meist mit dem Kropfinhalt erlegter Hühner durchgeführt, ab und zu auch mit dem Mageninhalt. Ungefähr zu Beginn der Siebzigerjahre des letzten Jahrhunderts entwickelten Forscher an der Universität Bern eine Methode, mit Winterkot von Raufusshühnern quantitative Nahrungsanalysen durchzuführen. Danach gab es solche Untersuchungen zunehmend auch in Ländern, in denen das Auerhuhn nicht jagdbar war. Die publizierten Resultate ergeben ein heterogenes Bild. Das Auerhuhn frisst im Winter Nadeln von Fichten, Weisstannen, Lärchen und verschiedenen Föhrenarten, also von allen Nadelbaumarten, die in Auerhuhn-Lebensräumen von Bedeutung sind. Mehrere Autoren, vor allem aus Frankreich, Skandinavien und Schottland, haben im Auerhuhn-Kot oder in den Kröpfen erlegter Vögel mehrheitlich Reste von Föhren gefunden (meist
von Waldföhren Pinus sylvestris, aber auch von aufrechten Bergföhren Pinus mugo subsp. uncinata, und in den Pyrenäen auch von Schwarzkiefern Pinus nigra). Dies, obwohl die Fichte in zumindest einigen der untersuchten Lebensräume keineswegs selten war. Andere Forscher, beispielsweise in den Karpaten, fanden vor allem Reste von Fichten. In der Regel äussern sich die meisten Autoren dieser Studien nicht zur Häufigkeit der jeweiligen Baumarten in den betreffenden Wäldern. Das verunmöglicht es, zu beurteilen, ob die Auerhühner einzelne Baumarten effektiv bevorzugen oder ob sie mehr oder weniger zufällig das fressen, was vorhanden ist.


Als Schlussfolgerung kann man sagen, dass Auerhühner Föhren als Nahrungsbäume nicht unbedingt brauchen. Doch gibt es gute Hinweise darauf, dass sie eine Präferenz für Föhren haben. Vielleicht fressen sie tatsächlich lieber die Nadeln von Föhren als diejenigen von Fichten. Vielleicht setzen sie sich aber auch nur lieber auf Föhren, weil deren Äste in vielen Fällen als Sitzwarten bequemer sind.
Pierre Mollet arbeitet bei der Schweizerischen Vogelwarte im Bereich Artenförderung und ist dort spezialisiert auf Raufusshühner und Waldschnepfen.
47
Kothaufen unter einer Bergföhre. Dieser Baum wurde von den Hühnern ausserordentlich häufig benutzt, vermutlich als Schlafbaum.
Von einem Auerhuhn abgefressene Bergföhrennadeln. Charakteristisch ist der mehr oder weniger glatte Schnitt, als ob die Nadeln mit einer Schere abgeschnitten worden wären.
Herr der Ringe
An Waldföhren und Fichten fallen manchmal Löcher auf, die sich wie eine Perlschnur in einem Ring um den Stamm legen. Verantwortlich für diese Muster sind Spechte, allen voran Buntspecht und Dreizehenspecht.
Claudia Wartmann
Rhythmischer Trommelwirbel hallt durch den Wald. Kein Zweifel, wenn es derart hämmert und klopft, kann ein Specht nicht weit sein. Mit ihrem starken Schnabel hacken die meisten Spechte auf die Rinde von Bäumen, um Nahrung zu suchen, ein Revier zu markieren oder eine Bruthöhle in den Stamm zu meisseln.
Neun Arten von Spechten leben in der Schweiz, ausser dem Mittelspecht kommen sie auch in Graubünden vor. Alle Arten sind auf Bäume angewiesen, um in Bruthöhlen ihre Jungen aufzuziehen. Verlassene Spechthöhlen werden gerne von Nachmietern genutzt, zum Beispiel von Sperlingskauz, Raufusskauz, Meisen, Kleibern, Fledermäusen oder Siebenschläfern.
Die Anwesenheit von Spechten im Wald ist nicht nur hörbar, sondern auch sichtbar, ohne dass sie selbst zu sehen wären. So fallen vor allem in stehendem Totholz die Löcher auf, die Spechte in die Rinde gehackt haben, um die sich dahinter befindenden Insektenlarven herauszuklauben. Mit ihrer klebrigen und mit Borsten besetzten Zungenspitze sind sie für diese Art der Nahrungssuche bestens ausgerüstet. Der kurze Schwanz mit den steifen Federn sorgt für eine gute Stütze am Stamm, die kräftigen, nach vorne und hinten gerichteten Krallen erlauben ein sicheres Auf- und Abklettern am Baum.
Eine besonders auffällige Art von Spechtlöchern sind jene, die wie ein Ring um den Baumstamm angeordnet sind. Fast alle einheimischen Spechtarten wurden schon beim sogenannten «Ringeln» beobachtet. Unangefochtener Spitzenreiter dieses Verhaltens ist jedoch der Dreizehenspecht, eine
Charakterart der naturnahen, montanen und subalpinen Nadelwälder mit stehendem Totholz. Graubünden zählt zum Hauptverbreitungsgebiet des Dreizehenspechts in der Schweiz. Ein weiterer eifriger Ringler ist der Buntspecht, der jedoch als Generalist nicht nur in Mischwäldern, sondern auch im Kulturland mit Feldgehölzen, Obstgärten und Hecken einen Lebensraum findet.
Anders als bei der Suche nach Insektenlarven schlagen die Spechte beim Ringeln Löcher in die Rinde lebender Bäume. Bei dickborkigen Stämmen wird zuerst mit seitlichen Hieben von links und rechts die Borke weggemeisselt. Dann werden nebeneinander mehrere Löcher in gleicher Stammeshöhe in die Rinde gehackt. Dadurch werden die Saftbahnen verletzt, der Saft tritt aus und wird von den Spechten mit der Zunge mit nippenden Schnabelbewegungen aufgenommen. Wobei Saft nicht gleich Saft ist: Die aufsteigende Flüssigkeit im Xylem enthält vor allem Wasser und Mineralien, die absteigende im Phloem Nährstoffe wie Zucker. Oft kehrt der Specht zu älteren Löchern zurück, um die Saftstelle in Gang zu halten und angefangene Ringe weiterzuschlagen. Besonders während der Frühlingsmonate, wenn der Saftdruck gross ist und die Flüssigkeit reichlich fliesst, verbringen Spechte eine beträchtliche Zeit mit Ringeln. So wenden sie im Frühling bis zu einem Drittel der Zeit, in der sie nach Nahrung suchen, für das Ringeln auf. Es wird deshalb angenommen, dass der Baumsaft im Leben der Spechte als Ergänzungsnahrung eine wichtige Rolle spielt. Einzelne Beobachtungen lassen sogar darauf schliessen, dass der Dreizehenspecht seinen Jungen Ringelsaft zuträgt.
48
Zu den Ringelbäumen zählen in den Nadelwäldern vor allem Waldföhren, Fichten und Arven, seltener auch Lärchen. In tieferen Lagen werden auch Laubbäume geringelt, vor allem vom Buntspecht. Die Bäume reagieren auf das Ringeln der Spechte, indem sie die Wunden überwallen, um das Eindringen von Pilzen und anderen Organismen zu verhindern. Da Spechte gerne auch ältere Löcher immer wieder aufpicken, entstehen mit der Zeit dicke, gut sichtbare Wülste am Stamm. Die betroffenen Bäume werden durch das Ringeln nicht wesentlich geschädigt – sie können über hundert Jahre lang von Spechten geringelt werden. So erweisen sich gefällte Ringelbäume meist als gesund, sie weisen aber durch die Überwallungen eine verworfene Maserung und damit einen Holzfehler auf.


Das Ringeln der Spechte ist keineswegs ein abschliessend geklärtes Verhalten. Vor zehn Jahren
erregte ein emeritierter Professor für Waldschutz und Entomologie Aufsehen mit seiner Interpretation des Ringelns: Er vertrat die Ansicht, dass die einheimischen Spechte keineswegs Bäume ringeln, um den austretenden Baumsaft aufzulecken, sondern dass es sich dabei um ein nutzlos gewordenes Verhalten aus der Entwicklung der Spechte handle. Es stellt sich bei dieser These allerdings die Frage, wie Spechte es sich leisten können, so viel Zeit mit einer zwecklosen Tätigkeit zu verbringen. Antworten auf die kontroversen Meinungen werden wohl nur weitere Untersuchungen liefern können. Den Spechten kann der wissenschaftliche Diskurs über ihr Verhalten egal sein – Hauptsache, der süsse Saft
49
schmeckt!
Claudia Wartmann ist Journalistin, Buchautorin und Verlegerin und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit Bäumen.
Abb. 1: Bei dieser Waldföhre sind die von einem Specht gehackten Ringe gut erkennbar.
Abb. 2: Diese alte Waldföhre wurde offenbar während Jahren immer wieder geringelt, weshalb sie die Wunden immer wieder überwallt hat. (Bilder: Claudia Wartmann)
Schmetterlinge an Föhren
Sowohl die Waldföhre (Pinus sylvestris) als auch die Bergföhre (Pinus mugo) bilden in Graubünden ausgedehnte Bestände, die aus weiten Teilen unserer Landschaft nicht wegzudenken sind. Weniger offensichtlich ist, dass es viele Schmetterlingsarten gibt, sogar einige Raritäten, die auf diese Bäume angewiesen sind und ihre Entwicklung auf ihnen durchlaufen. Zu beachten wäre aber auch der Unterwuchs der verschiedenen Föhrenwald-Typen als Hort einer bemerkenswerten Biodiversität!
 Dr. Jürg Schmid
Dr. Jürg Schmid
Die Föhre ist eine beliebte Nährpflanze für die Raupen einer ganzen Anzahl von zum Teil hochspezialisierten Schmetterlingen. Zwar gibt es keine Tagfalter, deren Raupen an Föhren leben, aber unter den grossen Nachtfaltern kennen wir den «Kiefernschwärmer» (Sphinx pinastri), den «Kiefernspinner»(Dendrolimus pini), den «Kiefernspanner» (Bupalus piniaria) und die «Kieferneule» (Panolis flammea). Die Raupen dieser Arten fressen die Nadeln der Föhren; einige von ihnen werden als Forstschädlinge gefürchtet und bekämpft. Zuallererst denkt man dabei natürlich an den PinienProzessionsspinner (Thaumetopoea pityocampa).
Seine weissen Raupengespinstnester in den Föhren fallen von Weitem auf, und auch die merkwürdige Gewohnheit seiner erwachsenen Raupen, als «Prozession» über Waldwege und Strassen zu wan
dern, ist ebenso bemerkenswert wie die Tatsache, dass die Raupenhaare bei Mensch und Tier ernsthafte Haut und Schleimhautirritationen herbeiführen können; man lässt sie also am besten in Ruhe! In Graubünden kommt diese Art aus klimatischen Gründen bisher nur in den Südtälern vor und ist dort auch höchstens lokal schädlich. Der Klimawandel wird zeigen, ob wir in den kommenden Jahren auch in den warmen inneralpinen Tälern plötzlich mit diesem doch eher unwillkommenen Gast werden rechnen müssen.
Viel zahlreicher und in ihren Ansprüchen wählerischer hingegen sind die über zwei Dutzend Kleinschmetterlingsarten, die sich die Föhre als ausschliessliche Raupennahrung ausgesucht haben. Man kann sie nach dem Aufenthalt der Raupe in verschiedene Gruppen einteilen:

50
Abb.1: Raupennester in einer Waldföhre im Puschlav; Abb.2: «Prozession» der Raupen. (Bilder: Jürg Schmid)
In den Knospen
Die Weibchen dieser «Knospenwickler» genannten Arten legen ihre Eier im Sommer an die Knospen der nächstjährigen Triebe ab. Die Raupe bohrt sich nach dem Schlupf in den Trieb, den sie innen ausfrisst. Sie überwintert in dieser Triebhöhle, verpuppt sich darin und schlüpft aus dem jetzt im Wachstum stark zurückgebliebenen, «verkrüppelt» aussehenden Trieb. Je nach Art erfolgt der Schlupf gegen die Triebspitze oder die Triebbasis hin.




In dünnen Zweigen
Die Raupe des KiefernHarzgallenwicklers bohrt sich nach dem Schlupf aus dem Ei in einen jungen Föhrenzweig. Die Pflanze wehrt sich gegen diesen ungebetenen Eindringling mit der Bildung einer Zweiganschwellung, einer Zweiggalle. Diese Galle wird nun zur festen Wohnung der Raupe, die darin ihr ganzes zweijähriges Leben verbringt. Gegen
den stark vermehrten Harzfluss wehrt sie sich mit der Bildung einer feinen, isolierenden Seidenkammer als Wohnung und lebt dabei vom stets nachfliessenden Harz. Die Puppe schiebt sich vor dem Falterschlupf aus einem vorbereiteten Seidengang nach aussen, damit der schlüpfende Falter nicht vom Harz verklebt wird.
In dürren Trieben und Zweigen
Eine ganz besonders schöne und seltene Art aus der Familie der Faulholzmotten (Oecophoridae) lebt in dürren Zweigen und Trieben der Föhre, manchmal auch dort, wo im vergangenen Frühling eine Knospenmotte den Trieb zum Absterben gebracht hat. Sie hat keinen deutschen Namen, heisst wissenschaftlich zungenbrecherisch Goidanichiana jourdheuillella und ist nur an extrem warmen und trockenen Stellen zu Hause; in der Schweiz wurde sie nur ganz lokal im Wallis und im Puschlav festgestellt.
51
Abb.1: Befallener Föhrentrieb, Abb.2: Raupe in der ausgefressenen Triebhöhle, Abb.3: Puppe; Abb.4: Falter des Kiefern-Knospentriebwicklers (Rhyacionia buoliana).
Abb.5: Zweiggalle, Abb.6: geöffnete Galle mit Raupe, Abb.7: Puppe in der geöffneten Galle; Abb.8: Falter des Kiefern-Harzgallenwicklers (Retinia resinella).
Unter der Rinde
Der recht weit verbreitete KiefernHarzzünsler (Dioryctria sylvestrella) lebt, wie sein Name sagt, als Raupe in Harzknollen am Stamm von Föhren.
In/an Nadeln
Einige Arten von besonders kleinen Kleinschmetterlingen aus der Familie der Gespinstmotten leben als Jungraupen in den Nadeln von Föhren und Arven, wo sie einen Gang im Nadelinnern ausfressen. Erst wenn sie grösser geworden sind, fressen sie die Nadeln von aussen. Sie verpuppen sich auch zwischen einzelnen, zusammengesponnenen Nadeln.
In Zapfen
Die Raupen des Kiefernzapfenwicklers (Cydia conicolana) leben in den Zapfen, wo sie die Samen fressen. Vor der Verpuppung im Zapfen fertigen sie einen Schlupfgang an, der in einer einzelnen Zapfenschuppe nach aussen führt. Weil man den befal
lenen Zapfen von aussen nicht ansieht, dass sie eine Raupe beherbergen, ist der Nachweis dieser recht seltenen Art nur über den kleinen Falter möglich. Wenn man über das Verhältnis FöhreSchmetterlinge spricht, sollte man sich aber hüten, nur jene Falter zu erwähnen, deren Raupen Teile von Föhren fressen und somit unmittelbar auf diese Bäume angewiesen sind. Föhrenstandorte, ob auf Kalk oder Silikat, ob in den tiefen Tallagen oder an den Berghängen, sind umfassende, komplexe Ökosysteme mit ihrer jeweiligen charakteristischen Begleitflora. Diese Pflanzendecke als Unterwuchs des Föhrenwaldes ermöglicht wiederum zahlreichen Schmetterlingsarten ihr Überleben.
Die lockeren subalpinen Bergföhrenbestände in Mittelbünden und im Unterengadin beherbergen, um nur ein Beispiel zu nennen, das gestreifte Steinröschen (Daphne striata), eine Seidelbastart, die ausschliessliche Raupennährpflanze dreier seltener Kleinschmetterlinge, des SteinröschenMinierfalters




52
(Phyllobrostis hartmanni), von Anchinia grisescens und Anchinia laureolella.
Im Unterwuchs des wärmeliebenden Waldföhrenwaldes finden wir die ziemlich seltene Rundblättrige Hauhechel (Ononis rotundifolia), einzige Raupennährpflanze der Federmotte Marasmarcha oxydactylus, und nur in den Samenschoten dieser Pflanze lebt die Raupe des Walliser Wicklers (Cydia vallesiaca).
Der Erica-Föhrenwald, in Graubünden weit verbreitet, ist Lebensraum von zahlreichen, ausschliesslich an Erica lebenden Kleinschmetterlingen, zum Beispiel des Erica-Sackträgers (Coleophora ericarnella), dessen einzige bisher in der Schweiz bekannt gewordene Population in der Vorderrheinschlucht lebt!





Jürg Schmid ist Amateur-Schmetterlingskundler und lebt in Ilanz.

53
Abb.9: Heisstrockener Föhrenstandort im Puschlav, Abb.10: Raupe, Abb.11: Puppe, Abb.12: Falter (Goidanichiana jourdheuillella).
Abb.13: Puppengespinst zwischen Nadeln, Abb.14: Ocnersotoma friesei.
Orchideenvielfalt in Bündner Waldföhrenwäldern
Wärmeliebende Föhrenwälder finden sich natürlicherweise nur an Extremstandorten, wo andere Baumarten kaum Fuss fassen können. Hier wächst die Föhre kaum über 20 m hoch und bildet nur lockere Bestände. Somit erreicht viel Licht den Boden und begünstigt im Unterwuchs lichtbedürftige Pflanzen, darunter auch Orchideen. Eine beachtliche Anzahl von 20 Orchideenarten finden in den Waldföhrenwäldern Graubündens einen geeigneten Lebensraum.
Dr. Beat A. Wartmann
In «Lebensräume der Schweiz» beschreiben Delarze et al. die wärmeliebenden Föhrenwälder als Lebensraum für konkurrenzschwache Lichtpflanzen, die wegen der extremen Standortbedingungen hier gedeihen können. Einige Pflanzenfamilien sind dank geeigneten Wurzelsymbiosen an solch karge Böden speziell angepasst, etwa Heidekrautgewächse, Wintergrüngewächse, Schmetterlingsblütler und eben auch Orchideen.
Die spezielle Biologie der Orchideen Orchideen bilden mit gegen 30000 Arten die grösste Pflanzenfamilie der Welt. In der Schweiz sind knapp 80 Arten verbreitet, von denen gut 50 auch in Graubünden vorkommen. Wenn wir den Blick auf die Föhrenwälder richten, bleiben noch etwa 20 Arten übrig. Alle Orchideen in der Schweiz sind Erdwurzler und müssen als mehrjährige Kräuter die ungünstige Jahreszeit in unterirdischen Knollen und Rhizomen überdauern. Viele Arten weisen eine Doppelknolle auf, woher auch der Name kommt (orchis bedeutet griechisch Hoden). Die in den Speicherknollen eingelagerte Stärke ermöglicht im Frühjahr ein schnelles Austreiben, entweder zuerst als Blattrosette oder sogar als Blätter und Blütenstand gleichzeitig. Alle Orchideenblüten folgen dem gleichen Muster: Die sechs Blütenblätter sind aus zwei konzentrischen Kreisen zu je dreien aufgebaut; aussen drei Kelchblätter (Sepalen), innen zwei Kronblätter (Petalen) und ein zur Lippe
umgewandeltes Kronblatt. Staubblätter, Griffel und Narbe sind zu einem säulenartigen Gebilde verwachsen. Die meisten Arten sind auf Insekten als Bestäuber angewiesen. Diese werden mittels Dufts, Farbe und Nektar angelockt. Viele Arten sind jedoch Täuschblumen und bieten keinen Nektar an. Speziell «fies» sind die Ragwurzarten, welche die Sexuallockstoffe von Wildbienenweibchen nachahmen und so die Männchen auf die «pelzigen» Lippen zur Pseudokopulation locken. Nach erfolgter Bestäubung bilden Orchideen eine Unzahl winziger Samen, welche durch den Wind verbreitet werden. Da Orchideensamen kein Nährgewebe haben, sind sie zum Keimen auf Wurzelpilze angewiesen. Diese sogenannten Mykorrhizapilze dringen in den Samen ein und bilden mit diesem und dem entsprechenden Baumpartner ein Nährstoffdreieck. Orchideen können somit nur dort keimen, wo diese Wurzelpilze im Boden vorhanden sind. Gerade die Waldföhre ist ein wichtiger Mykorrhizapartner für viele Arten. Orchideen sind langlebig, brauchen aber mindestens drei Jahre bis zum ersten Blühen. Gegenüber schnellwachsenden Pflanzen (z.B. Gräsern) sind sie unterlegen und werden verdrängt. Damit können die konkurrenzschwachen Orchideen nur auf mageren, stickstoffarmen Böden gedeihen, viele Arten brauchen auch Kalk. Die meisten Orchideen brauchen viel Licht, nur wenige Arten leben ohne Chlorophyll in vollständiger Abhängigkeit vom Wurzelpilz auch in dunklen Wäldern.
54
Orchideen in Bündner Waldföhrenwäldern
Nachdem die Orchideen aus der Intensiv-Kulturlandschaft verdrängt worden sind, bleiben ihnen Magerwiesen und Wälder als Haupt-Lebensräume. In den tieferen Lagen Graubündens bilden die Waldföhrenwälder für 20 Arten das wichtigste Habitat. Je nachdem, wie licht diese Wälder sind, können auch Arten, die eigentlich auf Magerwiesen zu Hause sind, in die Wälder eindringen. Zu beachten gilt, dass Orchideen mit ihren Knollen auf eine mindestens 5 cm tiefe Humusschicht angewiesen sind, daher sind felsige Extremstandorte kaum orchideenfähig, zumal die Wasserversorgung für den Austrieb im Frühjahr oftmals nicht garantiert ist. In der Tabelle sind die 20 Orchideenarten der Bündner Waldföhrenwälder mit ihrer Verbreitung und Biotopansprüchen aufgelistet. Als eigentliche Charakterarten des Föhrenwaldes kann man sieben

Orchideenarten bezeichnen, weil diese fast in jedem Föhrenwald anzutreffen sind: Rotes Waldvögelein, Braunrote Stendelwurz, Entferntblättrige Stendelwurz (nur in heissen Lagen), Moosorchis, Wohlriechende Handwurz, Fliegen-Ragwurz und Weisses Breitkölbchen. Auch der bekannte Frauenschuh ist in vielen Föhrenwäldern vorhanden, kommt aber auch in anderen Waldtypen vor. Der Dingel ist in Graubünden selten und nur an xerothermen, d.h. trockenheissen Standorten zu erwarten. Im Gegensatz zu diesem bevorzugen Bleiches und Langblättriges Waldvögelein, Fuchs’ Fingerwurz, Breitblättrige Stendelwurz, Nestwurz und Grosses Zweiblatt eher schattige und frische (d.h. gut mit Wasser versorgte) Waldpartien. In den grasigen Unterwuchs im lichten Wald wandern einige Wiesenarten ein wie Spitzorchis, Langspornige Handwurz, Männliches und Helm-Knabenkraut sowie Grünliches Breitkölbchen.







55
Von links nach rechts: Rotes Waldvögelein, Braunrote Stendelwurz, Entferntblättrige Stendelwurz, Moosorchis, Wohlriechende Handwurz, Fliegen-Ragwurz, Weisses Breitkölbchen und Frauenschuh. (Fotos: Beat und Claudia Wartmann)
Orchideen schützen
Orchideen reagieren sehr empfindlich auf Umweltveränderungen. Auch die Lichtverhältnisse können Orchideenvorkommen begünstigen oder zum Verschwinden bringen. Wenn der Wald zu dicht wird, hört der Frauenschuh auf zu blühen, kann aber jahrelang steril (nur mit Blättern) überleben, bis der Wald wieder lichter wird. Kahlschläge sind für viele Orchideenarten problematisch, weil die Blätter plötzlich zu viel Sonneneinstrahlung bekommen, verdorren und die Pflanzen eingehen, z.B. Frauenschuh, Moosorchis und alle Schattenarten. Die Moosorchis ist zudem immergrün und überlebt nur dort, wo kein Laubfall die Blätter zudeckt. Waldstrassenböschungen bieten vielen Orchideen, aber auch anderen seltenen Pflanzen und Insekten, ei-
Arten Verbreitung
Spitzorchis
Anacamptis pyramidalis
BleichesWaldvögelein
Cephalanthera damasonium
LangblättrigesWaldvögelein
Cephalanthera longifolia
RotesWaldvögelein Cephalanthera rubra
Frauenschuh
Cypripedium calceolus
Fuchs’Fingerwurz
Dactylorhiza fuchsii
BraunroteStendelwurz Epipactis atrorubens
BreitblättrigeStendelwurz Epipactis helleborine
Entferntblättrige
Stendelwurz Epipactis distans
Moosorchis
Goodyera repens
nen geeigneten Lebensraum. Im Sinne eines umfassenden Biodiversitätsschutzes muss das vielerorts noch praktizierte viel zu frühe Mähen dieser Böschungen überdacht werden. Dem Orchideenschutz wäre viel geholfen, wenn das Mähen der Böschungen auf den Spätsommer verschoben würde. Denn Orchideen brauchen nach der Blütezeit etwa einen Monat, bis die Fruchtkapseln reif sind und die Samen abgegeben werden.
Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung kann viel zum Orchideenschutz beitragen. Im «Bündner Wald» vom Juni 2010 habe ich bereits die wichtigsten Massnahmen zusammengefasst:
– Holzernte bevorzugt bei gefrorenem Boden
– Schlagdepots gezielt anlegen
Churer Rheintal (am Calanda), Ruinaulta bis Laax, lokal im Albulatal bei Vaz/Obervaz
Selten im Churer Rheintal, Prättigau, Schanfigg, Ruinaulta, Domleschg, Albulatal bis Filisur
Viel häufiger als damasonium in Nordbünden, dringt weit in Alpentäler ein, Lugnez, Domleschg, Albulatal, Unterengadin
Charakterart der Föhrenwälder Nordbündens, auch im Misox, Puschlav, Engadin und Münstertal
Zerstreut in Nord- und Mittelbünden, Schwerpunkte in Ruinaulta, Albulatal, Landwassertal, Unterengadin
Ansprüche
Hauptsächlich auf Magerwiesen, dringt in lichte Föhrenwälder ein, gern auf Kalk
An schattigeren Standorten als die anderen Cephalanthera-Arten, braucht Kalk
In lichten bis dichten Laub- und Nadelwäldern auch auf kalkarmen Böden
In sonnigen und warmen Lagen auf trockenen, kalkhaltigen Böden
Lichtbedürftig, daher im Halbschatten, geschützt vor praller Mittagssonne, auf humusreichen Kalk- und Dolomitböden
In ganz Graubünden verbreitet und häufigBraucht eine gewisse permanente Bodenfeuchtigkeit, daher kaum auf Extremstandorten
Charakterart der Föhrenwälder in ganz Graubünden, in höheren Lagen auch im Bergföhrenwald
In Nadel-, Laub- und Mischwäldern in ganz Graubünden verbreitet und häufig
Charakterart der Föhrenwälder inneralpiner Trockengebiete, im Unterengadin und Münstertal auch in Lärchenwäldern
Charakterart schattiger moosiger Föhrenwälder, seltener in Fichtenwäldern, häufig im Flimser Bergsturzgebiet, Albula- und Landwassertal, Engadin bis La Punt hinauf
Auf Kalkböden warmer, sonniger Lagen, kann als Pionierpflanze Kalkschutthalden und Strassenböschungen schnell besiedeln
Bevorzugt auf trockenen, lockeren und kalkreichen Böden
Xerophile Art, bevorzugt trockene und heisse Lagen in lichten Wäldern
Bevorzugt schattige moosige Föhrenwälder (Wald- und Bergföhren), auf mässig trockenen, basenreichen bis sauren, nährstoffarmen Böden
56
– Stammholz nicht in Waldlichtungen oder an Waldrändern lagern
– Bei Waldwegverbreiterungen Orchideenvorkommen abklären
Bei grösseren Schlägen sollten die Äste nach Möglichkeit zu Haufen zusammengetragen werden, weil sonst die Orchideen unter den Ästen ersticken.
Eine gute Kenntnis der Orchideenvorkommen hilft mit, bestehende Orchideenbestände bei Waldarbeiten zu schonen. Jede Gemeinde und jeder Forstdienst kann beim Autor die Daten pro Gemeinde anfordern. Diese stammen aus der Datenbank der Arbeitsgruppe Einheimische Orchideen (AGEO) und werden ständig aktualisiert.
Dr.Beat A.Wartmann ist Präsident der AGEO und Buchautor zum Thema Orchideen.
Literatur
Delarze, Raymond et al.: Lebensräume der Schweiz, Ökologie, Gefährdung, Kennarten.
3. Aufl. Ott Verlag 2015.
Wartmann, Beat: Praxishilfe Orchideen im Bündner Wald. «Bündner Wald» Juni 2010, Seiten 27 – 31
Wartmann, Beat A.: Die Orchideen der Schweiz –Der Feldführer. 3. Aufl. Haupt Verlag, 2020.
Arten Verbreitung Ansprüche
LangspornigeHandwurz
Gymnadenia conopsea
Wohlriechende Handwurz
Gymnadenia odoratissima
Dingel Limodorum abortivum
Nestwurz Neottia nidus-avis
GrossesZweiblatt Neottia ovata
Fliegen-Ragwurz
Ophrys insectifera
MännlichesKnabenkraut
Orchis mascula
Helm-Knabenkraut
Orchis militaris
WeissesBreitkölbchen
Platanthera bifolia
GrünlichesBreitkölbchen
Platanthera chlorantha
Charakterart von Feucht- und Magerwiesen, dringt auch in lichte Wälder ein, in ganz Graubünden verbreitet
Ausser in Silikatgebieten in ganz Graubünden verbreitet und häufig, speziell in den inneralpinen Trockengebieten
In Nordbünden nur vereinzelt in Hecken oder an Waldrändern, im Mittelmeerraum häufig in Föhrenwäldern
In Nordbünden ausser in Silikatgebieten verbreitet, auch im Unterengadin
Eine der häufigsten Orchideenarten, in ganz Graubünden verbreitet und stellenweise in grösseren Gruppen
In lichten Föhrenwäldern im ganzen Kanton verbreitet, aber nicht häufig. Fehlt in den Silikatgebieten
Verbreitet im ganzen Kanton auf Wiesen, dringt auch in lichte Föhrenwälder ein
Verbreitet in Nordbünden im Churer Rheintal, Surselva bis Schlans und Domschleg, vereinzelt im Prättigau, Schanfigg, Albulatal, Engadin.
Charakterart lichter Föhrenwälder, in ganz Graubünden verbreitet
In Nordbünden deutlich seltener als bifolia, im Engadin und den Südtälern nur vereinzelt
Auf mässig trockenen bis nassen Böden, sowohl auf basischem wie saurem Substrat
Auf Magerwiesen und in lichten Föhrenwäldern (Wald- und Bergföhren), nur auf Kalk
Charakterart von Hitzestandorten auf tiefgründigen Kalkböden
An Schattenstandorten auf frischen, nährstoff- und basenreichen Kalkböden
Anspruchslose Art der Magerwiesen und Laubmischwälder, in Föhrenwäldern bevorzugt an feuchten und schattigen Stellen
Auf sommerwarmen, wechseltrockenen, kalkreichen, lockeren Lehm- und Tonböden
Charakterart von Magerwiesen entlang Hecken und Waldrändern, in Wäldern nur an besonnten Stellen
Charakterart von Magerwiesen entlang Hecken und Waldrändern, in Wäldern nur an besonnten Stellen
Auf mässig trockenen bis nassen Böden, sowohl auf basischem wie saurem Substrat
Auf mässig trockenen bis nassen Böden, sowohl auf basischem wie saurem Substrat
57
Buchrezension: «Wölfe in der Schweiz – Eine Rückkehr mit Folgen»
Kaum ein Thema in der Schweiz polarisierte in den vergangenen Jahren mehr als die Rückkehr des Wolfes. Das Sachbuch «Wölfe in der Schweiz – Eine Rückkehr mit Folgen» von Elisa Frank, Nikolaus Heinzer mit Beiträgen von Lukas Denzler und Bernhard Tschofen sowie einem literarischen Text von Gianna Molinari scheint auf den ersten Blick eines der x-beliebigen Bücher zu sein, die sich diesem aktuellen Thema widmen. Doch das ist keineswegs der Fall.
 Johannes Jakob
Johannes Jakob
Die beiden Dissertationen der Kulturwissenschaftler Elisa Frank und Nikolaus Heinzer, die im Rahmen des Forschungsprojekts «Wölfe: Wissen und Praxis» entstanden sind, bilden die Grundlage für das Buch. Die beiden Hauptautoren Elisa Frank und Nikolaus Heinz beginnen das erste Kapitel des Bu
ches mit der Chronologie von den ersten Wolfrissen 1994 im Val Ferret im Unterwallis bis zur Gründung des ersten Wolfsrudels 2012 am Calanda. Anschliessend zeigen sie auf, was die Rückkehr des Wolfes für die Gesellschaft bedeutet. Dies tun sie am Beispiel der Schwarznasenschafe im Oberwallis. Historisch bedingt hat sich dort eine kleinstrukturierte Schafhaltung im Nebenerwerb entwickelt. Jene Kleinviehhaltung dient kaum noch der Produktion von Fleisch oder Wolle. Wichtiger sind der Erhalt und die Pflege der Kulturlandschaft sowie die Freude an der Tierhaltung und an der Zucht besonderer Rassen. Auf diese Strukturen trifft nun der Wolf und stellt Nebenerwerbslandwirte vor neue Herausforderungen. Beispiele wie diese helfen zu verstehen, wieso es gerade im Wallis grossen Widerstand gegen die Einwanderung des Wolfes gibt. Im zweiten Kapitel wird Wildhüter Rolf Wildhaber interviewt, der für das St.Galler Oberland und das Taminatal zuständig ist. Er war einer der Ersten, der das neu gebildete Rudel am Calanda beobachtete. Von ihm erfahren wir, wie sich das Wolfsrudel etablierte und wie die Bevölkerung darauf reagierte. Es wird auch klar, in welchem Spannungsfeld Wildhüter und Angestellte der kantonalen Jagdbehörden stehen. Wolfsgegner zweifeln die Objektivität von Monitoringdaten und Informationen an, die die Wolfspräsenz legitimeren sollen. Wolfsbefürworter hingegen behaupten, die kantonalen
58
Behörden würden zu restriktiv und voreilig mit dem Abschuss von Tieren reagieren. Die Schafalp Ramuz liegt im Taminatal und im Revier des Calandawolfsrudels. 2013 verzeichnete sie viele Risse, sodass Herdenschutzmassnahmen nötig waren. Im dritten und letzten grossen Kapitel ist einer der Autoren zu Gast auf der Alp. Die Südtiroler Hirtin Silvia hütet dort 400 Schafe und wird durch Herdenschutzhunde unterstützt. Einerseits beschreibt der Text, wie gut Schafe, Herdenschutzhunde sowie Hirtin eingespielt sind. Der Herdenschutz scheint auf der Alp Ramuz zu funktionieren. Anderseits werden Rahmenbedingungen erläutert, die den Herdenschutz erschweren oder gar verunmöglichen.

Elisa Frank und Nikolaus Heinzer zeigen anhand von Aussagen verschiedener Politikerinnen und Politiker auf, wie die Rückkehr des Wolfes zu einer weiteren, politischen Polarisierung zwischen Stadt und Berggebiet führt. Die Bewohner der Berggebiete fühlen sich von den Städtern übergangen und bevormundet, die sich den Wolf zurückwünschen.
Lukas Denzler, Forstingenieur und auch Teil des Autorenteams, macht zu Anfang eine historische Zusammenfassung von der Ausrottung des Wolfes in der Schweiz bis zu seinem heutigen Status als streng geschützte Art in der Berner Konvention. Zur Wiederansiedelung des Luchses und der Rückkehr des Bären finden sich ebenfalls Beiträge von ihm zwischen den grossen Kapiteln.
Am Schluss des Buches befasst sich Gianna Molinari auf künstlerisch literarische Weise mit der Rückkehr des Wolfes.
Ergänzt wird das Buch von schlicht gehaltenen Schwarz-Weiss- und Farbaufnahmen, die einen dokumentarischen Charakter besitzen und gleichzeitig den Lesenden helfen, sich die beschriebenen Szenen vorzustellen.
«Wölfe in der Schweiz – Eine Rückkehr mit Folgen» ist ein Sachbuch, das jedoch gut zu lesen und verständlich ist. Die Sprache ist einfach, und Fachbegriffe sind gut erläutert. Wer konkrete Vorschlä-
ge zur Lösung des Konflikts erwartet, wird enttäuscht sein. Dies ist jedoch die Stärke des Buches. Die Autoren beschreiben objektiv die Folgen der Rückkehr. Dazu beschreiben sie zum einen konkrete Beispiele und zum anderen beziehen sie die Schweiz, die politische Landschaft und ihren Umgang mit den Wölfen mit ein. Das Buch bereitet mithilfe von aktuellen Daten ein komplexes und vielschichtiges Thema lesenswert auf.
59
Johannes Jakob ist Forstingenieur und war während seines Praxissemesters im Nationalpark Bayerischer Wald am Luchs- und Wolfsmonitoring beteiligt.
ANZEIGE
Querrinnen für Waldund Güterwege
Neubau
- optimale Verankerung
-flexible Längenanpassung
- bewährter Werkstoff
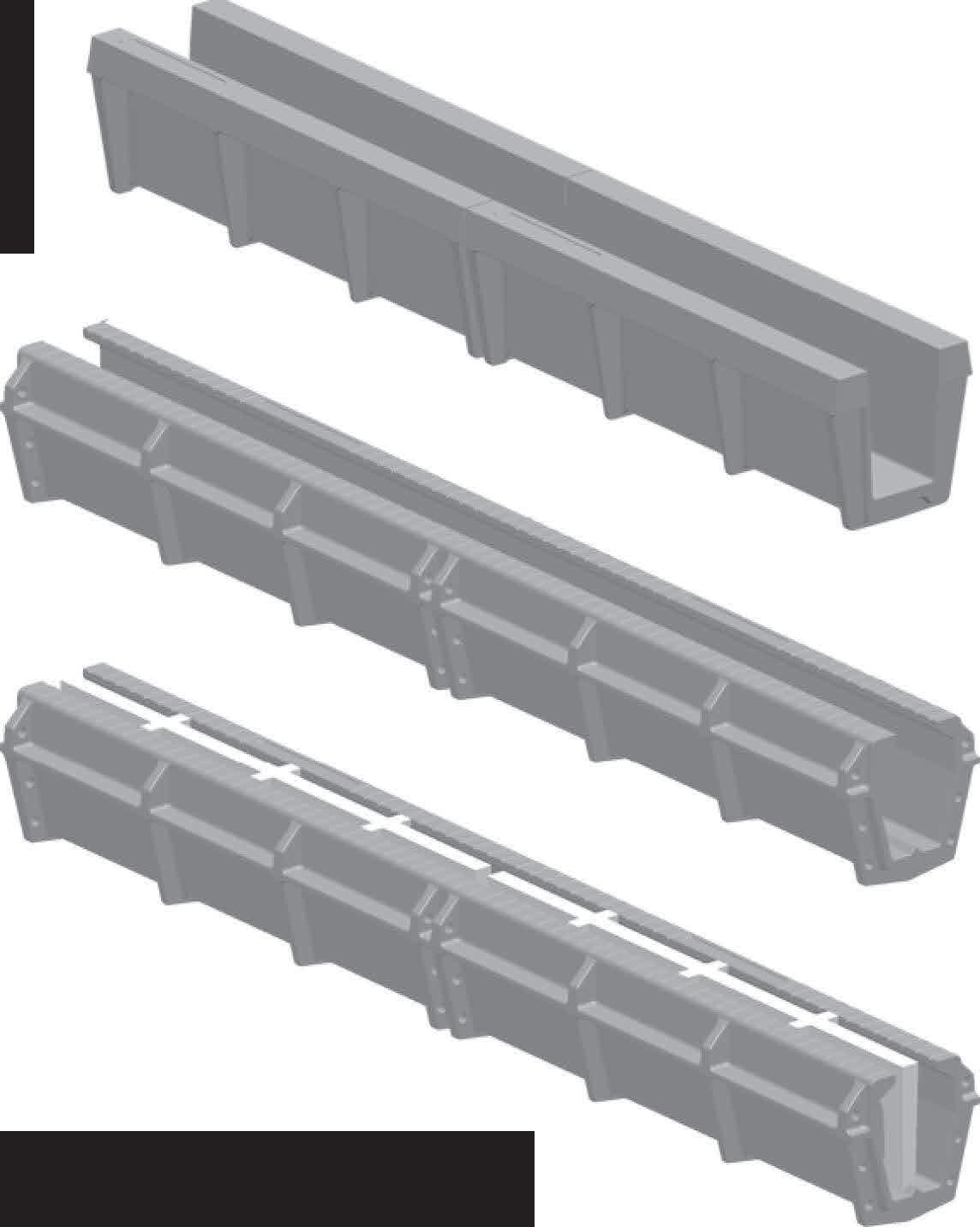

Unterhalt
- problemlose Reinigung mit Pickel

- keine losen Verschleissteile wie Roste, Balken usw.
- auf Wunsch mit Mittelsteg für Parkplätze, Fussgängerzonen
ANZEIGE ANZEIGE
Eisengiesserei Modellbau Tel. 081 286 90 50 Fax 081 286 90 59 E-Mail: info@giesserei-chur.ch
Giesserei Chur AG










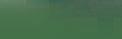












ANZEIGE Ihr Partner für die professionelle Holzernte im Gebirgswald. ➢ Holzernte ➢ Transporte ➢ Holzhandel Ihr FSCund PEFCzertifizierter Partner vom Wald bis ins Sägewerk. ANZEIGE IHR PARTNER FÜR NATURSTRASSENUNTERHALT IN DER OSTSCHWEIZ! COTTI VEIAS SA |PIRMIN COTTI |C ALTGERA 5| 7456 SUR | 0797456121 | PIRMIN@ VEIAS.CH NATURSTRASSENUNTERHALT REKULTIVIERUNGEN HANGVERBAUUNGEN KIESAUFBEREITUNG & BAGGERARBEITEN STABILISIERUNGEN HOLZTRANSPORTE BÖSCHUNGSPFLEGE FORSTMULCHARBEITEN www.naturstrassen.ch
Die Eibe –interessant und verborgen
Ein Buch für Fachleute sowie Natur- und Baumliebhaberinnen und -liebhaber.
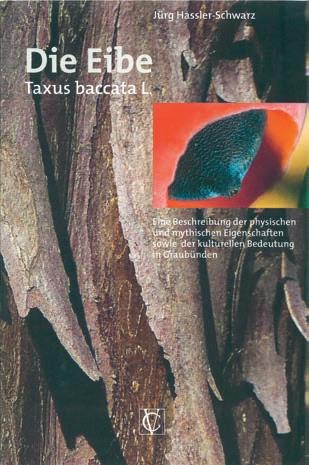
Die 2015 erschienene Monographie über die Eibe hat nichts an Aktualität verloren. Wer sich in die Eigenartigkeit dieser besonderen Baumart vertiefen möchte, ist mit dieser Publikation bestens bedient. Sie vermittelt umfassend das Wissen über die Biologie des Baumes und gibt Auskunft über die Holzeigenschaften und deren Verwendung oder über die dendrologischen Eckwerte. Im Inhalt werden zum Beispiel die kulturelle Bedeutung der Eibe wie auch die Intensität des Eibengifts und dessen Wirkung thematisiert. Eine detaillierte morphologische Beschreibung von Blüte und Frucht, über den Aufbau der Nadeln und die Holzanatomie bis hin zu Rinde, Stamm und Wurzelwerk schält die biologische Charakteristik heraus und erklärt auch die systematische Sonderstellung der Eibe im Vergleich zu den typischen Koniferenarten wie Fichte oder Föhre. Wer das kleine Buch aufmerksam durchgelesen hat, wird wohl zustimmen, dass die Eibe nicht nur als «Baum des Todes» sondern im ewigen Spiel von Werden, Sein und Vergehen ebenso auch als «Baum der Wandlung» verstanden werden kann.
Die Broschüre kann zum Preis von 25 Franken beim Autor bezogen werden: fam.hassler@bluewin.ch; 078 710 94 95

62
ANZEIGE
Vorschau «Bündner Wald» April 2023
Versammlung Graubünden Wald
Die Waldregion 5 unseres Kantons ist es aus vielerlei Hinsicht wert, sich das Versammlungsdatum vom 2./3. Juni 2023 für einen Besuch zu reservieren. Aus forstlicher Sicht dominieren zwei Hauptthemen: Das Sägewerk Resurses, welchem allgemein gute und realistische Chancen für eine erfolgreiche Zukunft zugesprochen werden und die Grossrutschung Brienz/Brinzauls mit einem Ausmass, welches im Kanton seinesgleichen sucht und entsprechende Massnahmen fordert. Beides sind Programmpunkte an jenem Wochenende anfangs Juni 2023.

Redaktion: Jörg Clavadetscher
Vorschau auf die nächsten Nummern:
Juni 2023: Arven und Lärchen im Avers
Redaktion: Susi Schildknecht
Redaktionsschluss: 17. April 2023
August 2023: Waldpflegemethoden und -massnahmen
Redaktionsschluss: 31. Mai 2023
Herausgegeben von Graubünden Wald und der SELVA
Verlag: © Somedia ProductionAG, CH-7007 Chur Sekretariat: SELVA, Bahnhofplatz1, CH-7302 Landquart, Telefon +41(0)813002244, buendnerwald @ selva-gr.ch Redaktoren: Redaktion: Susi Schildknecht, susi.schildknecht@bluewin.ch, Jörg Clavadetscher, forestal-muestair@bluewin.ch. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge in nicht verlangter Form ohne Rückfrage zu ändern. Herstellung: Viaduct AG, 7000 Chur. Erscheint sechsmal jährlich. Auflage: 1400 Exemplare Inserate: Somedia Promotion AG, Telefon +41(0)816500070, thusis @ somedia.ch Abonnementspreise: CHF 60.– (inkl. MwSt. für Mitglieder Verein Graubünden Wald)
Abonnemente/Adressänderungen: Telefon 0844226226, abo @ somedia.ch, www.buendnerwald.ch
Für Inseratetexte übernimmt die Redaktion keine Verantwortung, auch muss die Meinung der Beiträge nicht mit der Ansicht der Redaktion übereinstimmen. Schreibende, die zu obenstehenden Themen publizieren möchten, sind herzlich eingeladen, ihre Vorschläge der Redaktion einzureichen.
63









ANZEIGE casty outdoor & workwear ag Rossbodenstrasse 15 I 7000 Chur 081 635 14 38 I 078 635 14 38 info@casty-shop.ch I casty-passt.ch dein regionaler partner Kompetenzzentrum für Arbeitsbekleidung & Motorgeräte, mit Werkstatt ANZEIGE Wingertliweg 1 7204 Untervaz Via Igniu 6 7172 Rabius candinas.ch info@candinas.ch Der Partner für Wald, Transport, Fels Holzhandel Energieholz Projektlogistik Felstechnik Transport Forst

















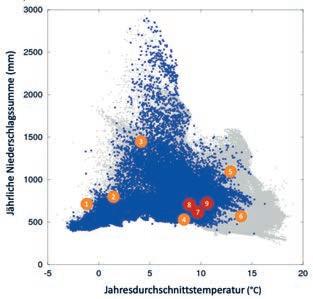
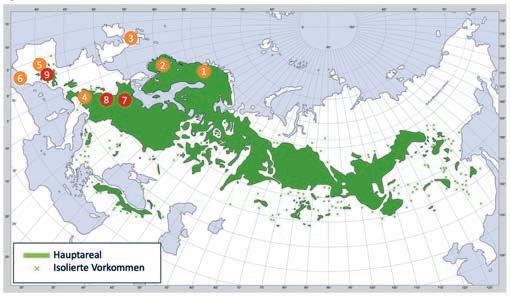















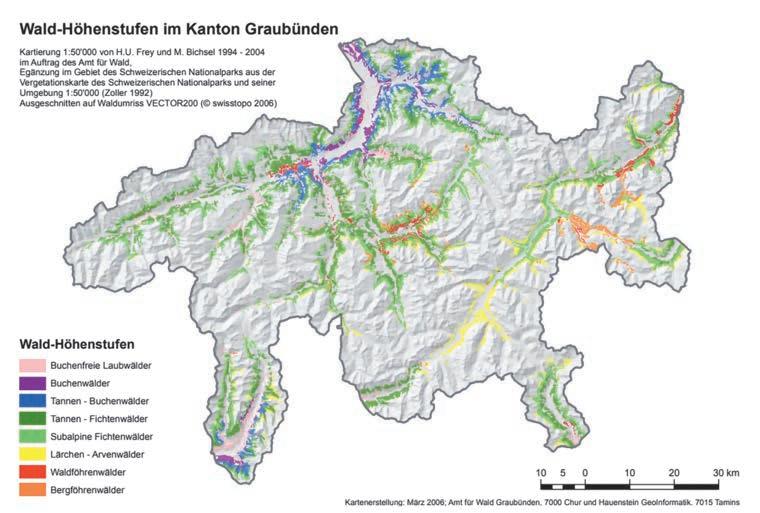 Gianna Könz
Gianna Könz























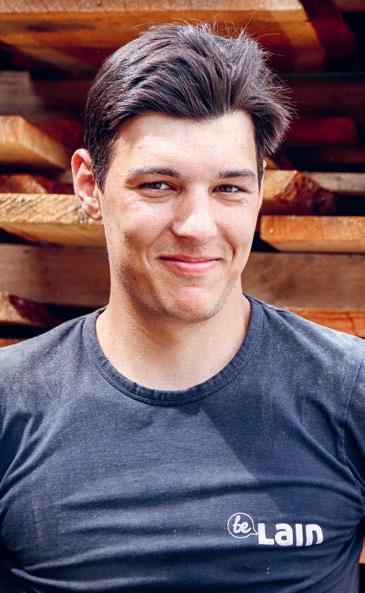














 Pierre Mollet
Pierre Mollet




 Dr. Jürg Schmid
Dr. Jürg Schmid























 Johannes Jakob
Johannes Jakob