Biotope von nationaler Bedeutung
Die fünf Biotopinventare Hoch- und Flachmoore, Auen, Amphibienlaichgebiete und Trockenwiesen/-weiden im Überblick


Die fünf Biotopinventare Hoch- und Flachmoore, Auen, Amphibienlaichgebiete und Trockenwiesen/-weiden im Überblick

Die fünf Biotopinventare Hoch- und Flachmoore, Auen, Amphibienlaichgebiete und Trockenwiesen/-weiden im Überblick
Herausgegeben vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) Bern, 2024
Herausgeber
Bundesamt für Umwelt (BAFU)
Das BAFU ist ein Amt des Eidg. Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK).
Autoren und Autorinnen
Gaby Volkart, Christian Hedinger, Leslie Bonnard, Lea Bauer, Regina Jöhl, Martin Urech (Info Habitat GmbH), Ursina Tobler (Beratungsstelle IANB, info fauna – karch)
Begleitgruppe
Philippe Grosvernier, Monika Martin, Célien Montavon, Michael Ryf (Info Habitat Gmbh), Ariel Bergamini (WSL), Stephan Lussi, Peter Staubli, Nathalie Widmer (BAFU)
Konzeption und Begleitung BAFU
Béatrice Werffeli
Redaktionelle Unterstützung
Gregor Klaus
Gestaltungskonzept
Cindy Aebischer (BAFU)
Layout und Grafik
Funke Lettershop AG
Titelbild
Vallon de l’Allondon © Jan Ryser/BAFU
PDF-Download www.bafu.admin.ch/uz-2404-d
Eine gedruckte Fassung kann nicht bestellt werden.
Diese Publikation ist auch in französischer Sprache verfügbar. Die Originalsprache ist Deutsch.
© BAFU 2024
National biotope inventories exist for five habitats: Raised bogs and transitional moors; fenland; alluvial zones; amphibian breeding areas; dry meadows and pastures. They play a central role in the conservation and promotion of biodiversity in Switzerland. This publication brings together current knowledge (as at 2023) on biotope inventories (habitat ecology, species diversity, area, distribution, status, endangerment, development, enforcement, conservation, restoration).
Für fünf Lebensräume sind nationale Biotopinventare in Kraft: Hoch- und Übergangsmoore, Flachmoore, Auengebiete, Amphibienlaichgebiete sowie Trockenwiesen und -weiden. Sie spielen eine zentrale Rolle bei der Erhaltung und Förderung der Biodiversität in der Schweiz Die vorliegende Publikation vereint das aktuelle Wissen (Stand 2023) zu den Biotopinventaren (Ökologie des Lebensraums, Artenvielfalt, Fläche, Verteilung, Zustand, Gefährdung, Entwicklung, Vollzug, Pflege, Sanierungen).
Cinq types de milieux naturels sont couverts par les inventaires de biotopes d’importance nationale : les hauts-marais et les marais de transition, les bas-marais, les zones alluviales, les sites de reproduction de batraciens ainsi que les prairies et pâturages secs. Ils revêtent une importance centrale pour le maintien et le développement de la biodiversité en Suisse. La présente publication réunit les connaissances actuelles (état 2023) sur les inventaires de biotopes (écologie du milieu naturel, diversité des espèces, surface, répartition, état, menace, évolution, exécution, gestion, assainissements).
In Svizzera esistono cinque inventari dei biotopi: Torbiere alte, Paludi, Zone golenali, Siti di riproduzione di anfibi, Prati e pascoli secchi. Tali biotopi sono fondamentali ai fini del mantenimento e della promozione della biodiversità in Svizzera. La presente pubblicazione riunisce le conoscenze attuali (stato: 2023) in materia di inventari dei biotopi (ecologia dello spazio vitale, diversità delle specie, superficie, distribuzione, stato, livello di minaccia, sviluppo, esecuzione, cura, risanamenti).
Keywords:
Biotope inventories, habitats, biodiversity, enforcement, enhancement and conservation, protected areas
Stichwörter:
Biotopinventare, Lebensräume, Biodiversität, Vollzug, Aufwertung und Pflege, Schutzgebiete
Mots-clés : inventaires de biotopes, milieux naturels, biodiversité, exécution, valorisation et entretien, zones protégées
Parole chiave: inventari dei biotopi, spazi vitali, biodiversità, esecuzione, valorizzazione e cura, zone protette
Wo findet man heute noch grössere bunte Blumenwiesen mit Orchideen und Enzianen? Wo gibt es noch Orte, an denen der hohe, glockenreine Ruf der Geburtshelferkröte an einem warmen Maiabend zu hören ist? Wo können Schulkinder eine der einheimischen fleischfressenden Pflanzenarten wie den Sonnentau in einem Hochmoor entdecken? Wo findet man noch attraktive und frei fliessende Flussabschnitte mit Auen und Kiesinseln? Die Antwort auf diese Fragen ist immer dieselbe: Auf Flächen, die als Biotop von nationaler Bedeutung ausgeschieden wurden. Bei diesen «Top of Switzerland» handelt es sich um die am besten erhaltenen Gebiete von einst weit verbreiteten und für die Schweiz charakteristischen Lebensräumen, verteilt in allen Regionen und Höhenlagen der Schweiz.
Der Bund hat – basierend auf Artikel 18a des Natur- und Heimatschutzgesetzes – zwischen 1991 und 2010 fünf Biotopinventare und die dazugehörigen Verordnungen in Kraft gesetzt: Hoch- und Übergangsmoore, Flachmoore, Auengebiete, Amphibienlaichgebiete sowie Trockenwiesen und -weiden. Die in den Inventaren aufgelisteten 7092 Objekte stehen unter Schutz und spielen eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Biodiversität in der Schweiz. Ein Drittel der gemeldeten Fundorte von gefährdeten Arten liegt in den Biotopen von nationaler Bedeutung, obwohl diese nur 2,27 % der Landesfläche ausmachen.
Die Biotope von nationaler Bedeutung bilden nicht nur einen unschätzbaren Hort der Biodiversität. Von hier aus ist auch die Wiederbesiedlung von neuen oder ökologisch aufgewerteten Lebensräumen möglich. Zudem fördern sie massgeblich die Landschaftsqualität und erbringen zahlreiche Leistungen zum Wohlergehen unseres Landes: Bunt blühende Trockenwiesen und Weiher voller Kaulquappen erfreuen beispielsweise Erholungssuchende, intakte Moore speichern Kohlenstoff und Auen schützen vor Hochwasser.
Doch trotz Schutz und Fördermassnahmen nimmt die ökologische Qualität vielerorts ab. Dies zeigt die Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz WBS. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Mit Unterstützung des Bundes haben die Kantone in den letzten Jahren viel Geld, Zeit und Herzblut in den Schutz und die Sanierung der Biotope von nationaler Bedeutung investiert. Dazu gehören Entbuschungsaktionen in Trockenwiesen und -weiden, die Neuanlage von Laichgewässern für Amphibien und das Schliessen von Entwässerungsgräben in Mooren. Die Wirksamkeit dieser Massnahmen lässt sich ebenfalls aus den Daten der WBS ablesen.
Die notwendigen Investitionen in die Qualität der Biotope leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der landschaftlichen und ökologischen Vielfalt in der Schweiz. Gleichzeitig lösen sie vielfältige positive Wirkungen für Wirtschaft und Gesellschaft aus.
Katrin Schneeberger, Direktorin Bundesamt für Umwelt (BAFU)
Die Schweiz gilt als Land mit einer grossen Vielfalt an Lebensräumen auf engem Raum und damit auch an Landschaften. Fünf Biotoptypen sind für die Schweiz besonders charakteristisch:
Hochmoore
Urwüchsige feuchte Lebensräume mit Torfmoosen und seltenen Spezialisten von Tieren, Pflanzen und Pilzen
Flachmoore
Schilfflächen an Seen, reich strukturierte Grossseggenrieder und bunt blühende Kleinseggenrieder
Auen
An Fliessgewässern und Seen zu finden und von einem dynamischen Wasserhaushalt geprägt (inkl. alpine Schwemmebenen und Gletschervorfelder)
Amphibienlaichgebiete
Fortpflanzungsgewässer und ihre Umgebung als zentrale Lebensräume der Frösche, Kröten und Molche
Trockenwiesen und -weiden
Artenreiche Grünlandlebensräume auf ungedüngten Böden mit unterschiedlich bunten Gesichtern
Die Schweiz hat die aussergewöhnlichsten und gefährdetsten Flächen dieser Biotoptypen in fünf Bundesinventaren verzeichnet und geschützt. Es handelt sich um die wertvollsten Reste dieser früher weit verbreiteten Biotoptypen. Es sind Spezialstandorte, die aus der Zivilisationslandschaft hervorstechen – sei es durch ihre Bindung an Wasser, ihre Nährstoffarmut, die natürliche Dynamik und vor allem durch das Vorkommen von seltenen und gefährdeten Arten.
Die Lebensräume der Bundesinventare mit ihren speziellen Artengemeinschaften tragen entscheidend zur Landschaftsqualität bei: Aussergewöhnliche Landschaften zur Naherholung und für den Tourismus enthalten fast immer Biotope von nationaler Bedeutung. Die einzelnen Objekte gewinnen zudem laufend an Bedeutung als Rückzugsorte für viele selten gewordene Tiere, Pflanzen und Pilze.
Die Bundesinventare der Biotope von nationaler Bedeutung haben eine noch junge Geschichte. Als Folge der Rothenthurm-Initiative (Abb. 1) ist der Schutz der Hochund Flachmoore seit 1987 in der Bundesverfassung festgeschrieben (Abb. 2). Gleichzeitig wurde mit dem Artikel 18a des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG) eine Grundlage für die nationalen Biotopinventare geschaffen. Der Artikel erlaubt es dem Bundesrat, Biotope von nationaler Bedeutung und deren Schutzziele zu bezeichnen. Seither hat sich eine neue Kultur des Natur- und Landschaftsschutzes entwickelt.
Jedes Bundesinventar verfügt über eine eigene Biotopschutzverordnung. Diese besteht jeweils aus dem Verordnungstext (unter anderem mit Schutzzielen, Massnahmen und administrativen Angaben) und dem Anhang 1 (Liste der Objekte). Für einige Biotope kommen weitere Anhänge hinzu, z. B. für die noch nicht definitiv bereinigten Objekte oder die speziellen Wanderobjekte bei den Amphibienlaichgebieten.
Die fünf besonders charakteristischen und wertvollen Lebensräume der Schweiz
Nebelverhangene Moore, wilde Auen und Deltas, poetische Weiher und grillenzirpende Blumenwiesen verleihen der Landschaft Abwechslung und viel Stimmung.
1
Hochmoor Glaubenberg OW
Foto: Philippe Grosvernier/LIN’eco

2
Flachmoor mit Wollgras Schüpfheim LU
Foto: Monika Martin/oekoskop

3
Rhäzünser Rheinauen
Kanton Graubünden
Foto: Andreas Gerth/BAFU



Die fünf Biotopinventare umfassen etwa die Hälfte der gefährdeten Lebensräume der Schweiz. Damit die Biodiversität langfristig gesichert werden kann, sind daher auch Massnahmen für andere Lebensraumtypen von grosser Bedeutung.
Inventarisierung und Revisionen
Die Auswahl von Flächen für die nationalen Biotopinventare erfolgte über ein komplexes wissenschaftliches Verfahren und in enger Zusammenarbeit des Bundes mit
Amphibienlaichgebiet
Kanton Waadt
Foto: Monika Martin/oekoskop
Trockenwiese mit Karthäusernelke Kanton Zürich
Foto: Monika Martin/oekoskop 4 5
den kantonalen Fachstellen. Zunächst wurden Biotope von potenziell nationaler Bedeutung anhand von Lokalkenntnissen, Luftbildern, kantonalen Inventaren und/oder weiteren Daten eruiert. Auf dieser Grundlage erhoben zahlreiche Fachleute vor Ort gemäss genauer Anleitungen die Vegetation, die vorkommenden Arten, die Nutzung und wo zweckmässig auch die natürliche Dynamik sowie bestehende Beeinträchtigungen. Anschliessend wurden die Objekte anhand Bewertungskriterien, welche für die ganze Schweiz angewendet wurden, beurteilt. Die qualitativ wertvollsten Objekte wurden für das Bundesinventar vorgeschlagen. Der Bundesrat hat schliesslich über die
Abb. 1: Abstimmungsflyer und Postkarte der Rothenthurm-Initiative zur Rettung der Moore
Die Zustimmung durch die Bevölkerung läutete am 6.12.1987 eine neue Ära des Biotopschutzes ein.


links Hug, Fritz/Sozarch_F_Pe-0410. Rechts: unbekannt/Sozarch_F_Ka-0001-650
nationale Bedeutung der Objekte beschlossen. Objekte mit einer weniger hohen Qualitätsstufe wurden den Kantonen für ihre kantonalen Inventare vorgeschlagen.
Die Biotopinventare entstanden über die letzten 30 Jahre. Als erstes wurden 1991 die Hochmoore und 1992 die Auengebiete in nationalen Inventaren festgehalten. Es folgten 1994 die Flachmoore, 2001 die Amphibienlaichgebiete (IANB) und 2010 die Trockenwiesen und -weiden (TWW).
Der Bund ist verpflichtet, seine Inventare regelmässig zu überprüfen und zu aktualisieren (Art. 16 Abs. 2 NHV) (Abb. 3). Jede solche Revision eines Biotopinventars durchläuft nach einer fachlichen Prüfung eine verwaltungsinterne und eine öffentliche Anhörung, bevor der Bundesrat neue oder geänderte Objekte in Kraft setzt.
Bundesinventar der Moorlandschaften
Datengrundlage zur Qualitätsbeurteilung
Die 2,27 % der Landesfläche, die als Biotope von nationaler Bedeutung bezeichnet wurden, sind gut dokumentiert. Die verfügbaren Datengrundlagen und Dokumente sind auf der BAFU Webseite «Biotope von nationaler Bedeutung»1 aufgeführt.
1 www.bafu.admin.ch > Themen > Thema Biodiversität > Fachinformationen > Ökologische Infrastruktur > Biotope von nationaler Bedeutung
Das Bundesinventar der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung ist nicht Gegenstand dieser Publikation. Es zählt 89 Objekte (87 499 ha). Im Fokus stehen Landschaftsräume, die von Mooren geprägt sind. So liegen 44 % der Hoch- und 33 % der Flachmoorobjekte von nationaler Bedeutung in Moorlandschaften, aber auch 8 % der Auen, 6 % der Amphibienlaichgebiete sowie 2 % der nationalen Trockenwiesen und -weiden. Insgesamt sind 27 % der Fläche der Moorlandschaften nationale Biotope. Die übrige Fläche besteht aus anderen Natur- und Kulturelementen (z. B. Heumatten, Bächen, Hecken, Wäldern und Gebäuden).
Abb. 2: Gesetzliche Grundlagen für die Inventare der Biotope von nationaler Bedeutung
Natur und Heimatschutz
Bundesgesetz über den Natur und Heimatschutz (N H G)
Abb. 3: Entwicklung der Fläche pro Biotopinventar
Die Biotopinventare wurden im Rahmen von Inventarrevisionen (Art. 16 Abs. 2 NHV) angepasst, was die Sprünge in der Grafik erklärt. So konnten fehlerhafte Perimeter korrigiert und national bedeutende Biotopflächen, die in den Erstaufnahmen übersehen wurden, ergänzt werden.
Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023
2.1 Zahlen und Fakten
Die fünf nationalen Biotopinventare der Schweiz umfassen insgesamt 93 608 ha (2,27 % der Landesfläche; Stand Biotopdaten BAFU 2023). Dies entspricht weniger als einem Drittel der Siedlungsfläche 1 der Schweiz.
Auen, Flachmoore, Trockenwiesen und -weiden (TWW) sowie Amphibienlaichgebiete (IANB) sind je mit ähnlichen Flächenanteilen vertreten (Abb. 4). Die Hochmoore bedecken deutlich weniger Fläche, weil sie nur unter ganz besonderen Standortverhältnissen entstehen und vielerorts zerstört wurden.
Im Gegensatz zur Fläche sind die Objektzahlen pro Inventar sehr unterschiedlich: Den fast 4000 TWW-Objekten stehen nur gerade 326 Auenobjekte gegenüber (Abb. 5).
1 Siedlungsfläche = 7,9 % der Fläche der Schweiz gemäss BFS, 2023; enthalten sind Industrie- und Gewerbeareal, Gebäude, Verkehrsflächen, besondere Siedlungsflächen sowie Erholungs- und Grünanlagen
Abb. 5: Anzahl Objekte pro Biotopinventar
Total 7092 Objekte
Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023 0
Abb. 4: Anzahl Objekte und Fläche der nationalen Biotopinventare sowie die Flächenanteile an der Gesamtbiotopfläche (Kuchendiagramm)
Hochmoore
Flachmoore
Auen
IANB
TWW
Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023 IANB Bereiche A und B der ortsfesten Objekte (Anh. 1 der Amphibienlaichge
biete-Verordnung) sowie Wanderobjekte (Anh. 2 der AlgV, Kreis mit Radius von 52,3 m). Hochmoore ohne Umfeld. Flächen mit Überlappungen in Tabelle; Flächenanteile im Kuchendiagramm ohne Überlappungen.
Abb. 6: Geografische Lage der Biotope von nationaler Bedeutung
Dargestellt sind Punktdaten (ausser Auen). Diese sind nicht massstäblich, d. h. visuell sind die Inventarflächen grösser als in Wirklichkeit.
Hochmoore
Flachmoore
Auen
IANB
TWW
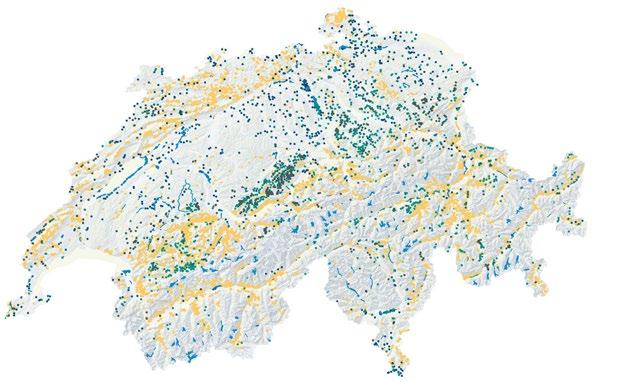
Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023
Lage der Biotope
Die fünf Biotopinventare haben sehr unterschiedliche geographische Schwerpunkte (Abb. 6). Für die hohe Biotopdichte in den östlichen Nordalpen sind vor allem die Flachmoore verantwortlich, weil sie von den geologischen Verhältnissen auf Flysch und den meteorologischen Staulagen profitieren. Auen konzentrieren sich auf das Mittelland (tiefgelegene Auen) und die Alpen (Gletschervorfelder und alpine Schwemmebenen). Amphibienlaichgebiete liegen im Mittelland, da nur wenige Amphibienarten höhere Lagen bewohnen. Die meisten und grössten Trockenwiesen und -weiden sind im Sömmerungsgebiet der Alpen und des Jurabogens zu finden.
Der Anteil Biotopfläche insgesamt ist in den Nordalpen am grössten, gefolgt vom Mittelland und den östlichen Zentralalpen (Abb. 7). Die Alpensüdflanke zeigt die kleinste Dichte an Biotopen, da dort die Nutzungsaufgabe von Trockenwiesen und -weiden und damit die Wiederbewaldung schon weiter fortgeschritten ist und die sehr steilen Hänge sowie die stark genutzten Tallagen relativ wenig Raum für grosse Biotopflächen bieten.
2 %

Fläche der Biotope von nationaler Bedeutung
98 % restliche Schweizer Fläche
Abb. 7: Flächenanteil der Biotopinventare nach biogeografischer Region und Biotoptyp
Lesebeispiel: 1,97 % der Fläche des Juras hat die Qualität eines Biotops von nationaler Bedeutung.
Hochmoore
Flachmoore
Anteil in Prozent
Auen
IANB
TWW
AlpensüdflankeSAöstlicheZentralalpenöZAAlpennordflankewestlicheZentralalpenwZA
Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023; Biographische Regionen nach BAFU, 2022
Abb. 8: Flächenanteil der Biotopinventare nach Höhenstufe und Biotoptyp
Verteilung nach Höhenstufen
Die fünf Inventare unterscheiden sich stark in Bezug auf den jeweiligen Anteil in den verschiedenen Höhenstufen (Abb. 8). Amphibienlaichgebiete und Auen an Fliessgewässern dominieren in der kollinen Stufe, Trockenwiesen, alpine Schwemmebenen und Gletschervorfelder in der subalpinen und alpinen Stufe. Die Hochmoore kommen vor allem in der montanen und subalpinen Stufe vor. Im Mittelland sind Moore und TWW weitgehend verschwunden, weil dort fast alle potenziellen Standorte einer intensiveren Nutzung unterworfen sind oder überbaut wurden. Über 60 % der TWW liegen im subalpinen Bereich.
Verteilung der Biotope auf die Kantone
Datenbasis:
Die grossen Kantone Bern, Graubünden, Waadt und Wallis beherbergen zusammen rund die Hälfte der gesamten Biotopfläche (52 557 ha; Abb. 9). Manche der kleineren Kantone haben allerdings überdurchschnittlich hohe Anteile an Biotopfläche (Abb. 10). An der Spitze liegt Genf mit rund 9 % Kantonsfläche in nationalen Inventaren (v. a. Amphibienlaichgebiete mit grossen Landlebensräumen, die sogenannten B Bereiche), gefolgt von Obwalden (5 %) und Schwyz (rund 4 %), die beide von grossen Moorflächen geprägt sind.
Abb. 9: Fläche der Biotope von nationaler Bedeutung pro Kanton und Biotopinventar
Hochmoore
Flachmoore
Auen
IANB
TWW
Datenbasis: Biotopdaten BAFU,
Abb. 10: Flächenanteil der Biotopinventare pro Kanton
100 % = Kantonsfläche
Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023
Grösse und Vernetzung der Objekte
Für die biologische Funktionalität der Biotope als Lebensraum für Flora und Fauna sind die Grösse der Inventarflächen und deren Entfernung voneinander zentral. Die
Abb. 11: Anteil Biotopobjekte nach Grössenklassen
Lesebeispiel: 57 % aller nationalen Auengebiete sind über 30 ha gross.
einzelnen Objekte bedecken meist recht kleine Flächen –in der Regel weniger als 5 ha. Nur bei den Auen sind 57 % der Objekte über 30 ha gross (Abb. 11).
Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023
Hochmoore Flachmoore Auen IANB TWW
Abb. 12: Durchschnittliche Distanz der Objekte zum nächsten Objekt des gleichen Biotoptyps nach biogeografischen Regionen
Mittelland ML
Alpennordflanke NA
Alpensüdflanke SA
Westliche Zentralalpen wZA
Östliche Zentralalpen öZA
Mittel ganze Schweiz
Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023
Kurze Distanzen zwischen den Biotopen können ihre Kleinflächigkeit etwas kompensieren, weil dann die einzelnen Artenvorkommen vernetzt sind und sogenannte Metapopulationen bilden können. Während es von einer TWW zur nächsten je nach Region durchschnittlich 500 m bis 1500 m sind, liegen Moore mit 700 bis 3000 m weiter auseinander. Amphibienlaichgebiete liegen noch weiter entfernt und Auen weisen untereinander gar Distanzen von 2500 bis 8500 m auf (Abb. 12).
Biotope auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche 62 % der Biotope von nationaler Bedeutung liegen im landwirtschaftlich genutzten Gebiet der Schweiz (Abb. 13).
Besonders das Sömmerungsgebiet beherbergt einen grossen Teil der Biotopflächen. Dort ist die allgemeine Nutzungsintensität bis heute geringer als auf der eigentlichen «Landwirtschaftlichen Nutzfläche», was sich positiv auf das Vorkommen von schützenswerten Biotopen auswirkt. TWW und Flachmoore sind daher bis heute typische Landschaftselemente für extensiv genutzte Alpweiden.
Von den Gletschervorfeldern befinden sich alle Objekte im Sömmerungsgebiet, weshalb der Anteil bei den Auen hier insgesamt hoch ausfällt. Bei der Verteilung der Amphibienlaichgebiete ist es umgekehrt. Diese liegen vor allem in
den tieferen Lagen der landwirtschaftlichen Nutzfläche, wo sich auch die Verbreitungsschwerpunkte der meisten gefährdeten Amphibienarten befinden.
Biotope und Wald Etwa die Hälfte der Fläche der Amphibienlaichgebiete, Auen und Hochmoore ist mit Gehölzen bestockt (Wald und Gebüschwald gemäss Swisstopo, Abb. 14). Viele Amphibienarten überwintern im Wald, weshalb der Schutzperimeter auch diesen Lebensraum mit einbezieht. Auen bestehen nicht nur aus Kies- und Ruderalflächen sowie den Gewässern, sondern zu einem grossen Teil aus Auenwald. Zu den Hochmooren gehören nicht nur die offenen und dauerhaft wassergesättigten Bereiche, sondern auch die umliegenden Moorwälder. TWW-Wytweiden im Jura sind besonders vielfältige und artenreiche Landschaften.
In den anderen Biotoptypen sind zu grosse Gehölzanteile dagegen weniger erwünscht. In Flachmooren und TWW bedeutet das Einwachsen der Flächen mit Büschen und Bäumen in der Regel ein Vollzugsdefizit. Ein zu hoher Anteil Gehölze in Hochmooren deutet darauf hin, dass die hydrologischen Verhältnisse nicht optimal sind, weil in den eigentlich nassen Hochmooren keine dichten Gebüschoder Baumbestände aufkommen können.
Abb. 13: Fläche der Biotopinventare nach Landnutzung
Amphibienlaichgebiete (IANB), Hochmoore und Auen enthalten viele Flächen, die nicht von der Landwirtschaft genutzt werden. Dies sind vor allem Gewässer und Wald. Aber auch in Flachmooren und TWW hat es Gehölze, ungenutzte Ruderalflächen sowie alpine Gras- und Felsfluren. Landwirtschaftliche Nutzfläche LN = Felder und Grünland unterhalb der Sömmerungslinie. Ausserhalb der LN liegen Wald, Gewässer, Sömmerungsgebiet und wenige weitere Lebensräume (z. B. Felsfluren, Pärke, Siedlungsraum).
Ausserhalb Landwirtschaft
Sömmerungsgebiet
Fläche in Hektaren
Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023; Verschnitt mit Daten zur Landwirtschaftlichen Nutzfläche des BLW, 2019
Abb. 14: Anteil Wald (inkl. Gebüschwald) pro Biotopinventar (Fläche)
Landwirtschaftliche Nutzfläche LN
Hinweis: Auen haben insgesamt einen Waldanteil von 29 %, die tiefergelegenen Auen für sich (ohne alpine Schwemmebenen und Gletschervorfelder) enthalten dagegen einen Waldanteil von 52 %.
Kein Wald Wald
Anteil in Prozent
Hochmoore
Flachmoore
Auen IANB
Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023; Vektordaten Swisstopo (Wald und Gebüschwald), 2021
TWW
Biotope in Agglomerationen Rund 15 % aller nationalen Biotope liegen teilweise in Agglomerationen (Hunziker 2020). Allerdings befinden sich nur 4,7 % der Objekte und 2,7 % der Inventarfläche in den Kernstädten (Kerngemeinde einer Agglomeration gemäss BFS 2014). Amphibienlaichgebiete sind am häufigsten in den Städten zu finden (9,4 % der Inventarobjekte, 8,1 % der Fläche).
Vor allem «Satelliten-Städte» (Nebenkerne gemäss BFS 2014, gekennzeichnet durch Pendlerströme in «grössere» Städte, z. B. Le Locle) enthalten mit 5,5 % der Stadtfläche relativ viele Inventarflächen. In grösseren Städten (Hauptkerne) machen dagegen die nationalen Biotope nur noch 3 % der Stadtfläche aus.
Biotope von nationaler Bedeutung sind die Kerngebiete eines nationalen Netzes von Lebensräumen und Vernetzungsgebieten mit hohem ökologischen Wert. Dieses Netz ist für die Wohlfahrt des Landes genauso unverzichtbar wie die «technische Infrastruktur» (z. B. Strassen, Eisenbahnlinien, Strom- und Wasserleitungen).
Eine vielfältige Biodiversität ist die Grundlage für das Wohlbefinden und die langfristige ökonomische Sicherheit der Menschen. Biotope von nationaler Bedeutung erbringen als intakte Lebensräume von hoher ökologischer Qualität besonders viele und wertvolle Ökosystemleistungen. Hier einige Beispiele (s. auch IPBES 2019):
Tourismus, Erholung: Vielfältige Auen, wilde Moore oder farbig blühende Trockenwiesen stellen Höhepunkte für alle Erholungssuchenden dar (Abb. 15).
Schutz vor Naturgefahren: Auengebiete und Moore bremsen den Wasserabfluss und schützen so vor Hochwassern.
Kohlenstoffspeicherung: In der organischen Substanz der Moore ist Kohlenstoff gespeichert, welcher bei deren Zerstörung freigesetzt wird.
Sicherheit: Mit ihren vielen seltenen Arten dienen die Biotope als Reservoir für künftige Nutzungen von Pflanzen und Tieren, für medizinische Zwecke oder technische Erfindungen.
Abb. 15: Biotope sind Landschaftsperlen und laden zur Erholung ein Düdinger Möser FR

Foto: Jacques Studer
In Biotopen von nationaler Bedeutung findet sich eine riesige Vielfalt an Arten: Insgesamt sind mehr als 17 000 Arten nachgewiesen (Auswertung basierend auf Daten von InfoSpecies, Stand 2023). Darunter sind Lebensraumspezialisten ganz verschiedener Artengruppen – vom Pirol (Oriolus oriolus) über die Gelbbauchunke (Bombina variegata variegata) und die Honigader-Bergzikade (Cicadetta cantilatrix) bis hin zum unscheinbaren Sumpf-Herzblatt (Parnassia palustris). Je nach Standort und Lebensraumtyp weist jedes Objekt sein ganz eigenes Artenspektrum auf.
Die nationalen Biotope bedecken lediglich 2,27 % der Landesfläche, beherbergen aber 84 % aller National Prioritären Arten (Tab. 1). Dies zeigt, dass sie besonders für spezialisierte Arten von grosser Bedeutung sind, welche auf diese selten gewordenen Lebensräume angewiesen sind. Für sie stellen die nationalen Biotope Rückzugsräume dar, von wo aus diese Arten neu entstehende, revitalisierte oder verwaiste Lebensräume wiederbesiedeln können. Fundmeldungen
Tab. 1: Anzahl der nachgewiesenen National Prioritären Arten (NPA; BAFU 2023) in den Biotopen von nationaler Bedeutung Flora, Fauna und Kryptogame (= Moose, Flechten und Pilze). Auswertung basierend auf Daten von InfoSpecies, Stand 2023. Die nationale Priorität beruht auf Angaben des Gefährdungszustandes sowie der internationalen Verantwortung.
Datenbasis: InfoSpecies, 16.3.2023
Die Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz WBS erfasst seit 2011 Veränderungen in den Biotopen von nationaler Bedeutung (Bergamini et al. 2019). Sie wurde vom BAFU initiiert und an der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL in enger Zusammenarbeit mit dem BAFU entwickelt. Ihr Hauptziel ist es festzustellen, ob sich die Biotope von nationaler Bedeutung gemäss den Schutzzielen entwickeln und in ihrer Fläche und Qualität erhalten bleiben.
Bei den Felderhebungen werden in einer geografisch und ökologisch repräsentativen Zufallsstichprobe detaillierte Daten zur Vegetation (in Mooren, Auen und TWW) und zu Vorkommen von Fröschen, Kröten und Molchen (in Amphibienlaichgebieten) erhoben. Ein Sechstel der Objekte von nationaler Bedeutung ist in der Stichprobe vertreten. Jeder Erhebungszyklus dauert sechs Jahre. Bei der Analyse von Luftbildern werden Veränderungen in sämtlichen Objekten von nationaler Bedeutung dokumentiert.
Allgemein wurde in der Tendenz eine Verschlechterung der ökologischen Qualität der nationalen Biotope festgestellt:
• Hochmoore wurden in den letzten 20 Jahren nährstoffreicher und trockener.
• Flachmoore sind ebenfalls trockener geworden. Die Bedeckung mit Gehölzen nahm zu, und der Anteil an typischen Moorarten ist gesunken.
• Eine Zunahme von Gehölzen stellte man auch in den Trockenwiesen und -weiden fest, insbesondere an der Alpensüdflanke. Je nach Region wurden die Lebensräume zudem nährstoffreicher, insbesondere auch in höheren Lagen.
• In den Amphibienlaichgebieten haben die Objekte im Durchschnitt mindestens eine Amphibienart verloren. Die Bestände der stark gefährdeten Arten Gelbbauchunke, Kreuzkröte und Geburtshelferkröte nehmen weiterhin deutlich ab.
• Bei den Auen sind gesicherte Trends aus methodischen Gründen noch nicht feststellbar.
Die negativen Entwicklungen überwiegen, doch können regional auch einzelne positive Veränderungen beobachtet werden:
• In den Hochmooren des Mittellands nahm die Gehölzdeckung ab.
• Der Anteil an Arten der Roten Liste blieb in Hoch- und Flachmooren konstant.
• Der Rückgang bestimmter Amphibienarten hat sich in den letzten 15 Jahren verlangsamt oder wurde sogar gestoppt.
Folgende sind zurzeit die wichtigsten Beeinträchtigungen von Biotopen (ergriffene Massnahmen und Pflege siehe Kap. 2.5):
Grösse und Isolation: Viele Objekte sind sehr klein und isoliert; genetische Verarmung und Populationsschwankungen gefährden die dort lebenden Populationen. Diese Objekte können ihre Funktion als Ausbreitungszentren für charakteristische Arten nicht mehr wahrnehmen.
Besonders gut ersichtlich ist dies bei den Amphibienlaichgebieten (Abb. 16). Pro Objekt ging innerhalb von etwa 20 Jahren im Schnitt eine Art verloren, obwohl in knapp der Hälfte der Objekte die Lebensraumqualität als gut bewertet wird. Die meisten Verluste fanden vor 2005 statt, seither hat sich die Lage für viele Arten stabilisiert, ausser für die Geburtshelferkröte und die Kreuzkröte, deren Bestände weiterhin zurückgehen. Der Grund für die Abnahme liegt vermutlich im Verlust der Metapopulationsstruktur (Smith und Green 2005). Jede Subpopulation einer Metapopulation hängt vom Austausch mit benachbarten Subpopulationen ab (Hanski 1994). Die meisten Subpopulationen sind zu klein, um langfristig ohne das Netzwerk
Abb. 16: Das IANB-Objekt Bildweiher (SG9)
Es steht beispielhaft für zahlreiche Objekte, die in Siedlungen und Industriezonen ehemals wertvolle, heute aber isolierte grüne Inseln bilden.

Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2021; Karte © swisstopo
zu überleben. Wird das Netz durch Lebensraumverlust ausgedünnt, bricht diese Struktur auf. Dies kann erklären, wieso Arten aus Objekten verschwinden, die scheinbar gute Lebensräume bereitstellen.
Wassermangel: Insbesondere die Moore und Amphibienlaichgebiete leiden unter Wassermangel – sei es wegen ausbleibender Regenfälle, wegen Wasserentnahmen oder wegen Drainagen. Die charakteristischen Moorarten überleben nur, wenn sie ausreichend Wasser zur Verfügung haben. Dies ist gemäss WBS-Resultaten nur noch in einem Bruchteil der Moore der Fall. Auch Auen werden durch Wassermangel beeinträchtigt, weil sie nicht mehr episodisch überflutet werden, der Grundwasserspiegel zu stark abgesenkt wurde oder wenn in Zukunft kein Schmelzwasser mehr zur Verfügung steht, weil die Gletscher verschwunden sind.
Nährstoffeinträge und Pflanzenschutzmittel: Das Nährstoffniveau in vielen Biotopen nimmt zu, weshalb die charakteristischen Arten zugunsten von verbreiteten Arten abnehmen (Charmillot et al. 2021; Strebel und Bühler 2015). Die schleichende Anreicherung von Nährstoffen (Eutrophierung) ist die Folge des Stickstoffeintrages aus Landwirtschaft, Verkehr und Haushalt über die Luft. Selbst abgelegene und intakte Moore im Alpenraum sind davon
Abb. 17: Wasserstandsschwankungen und Artenvielfalt
betroffen. Zu hohe Nährstoffeinträge können aber auch durch eine zu intensive Beweidung oder Bewässerung in und um das Biotop entstehen. Zudem gefährdet der Eintrag von Pflanzenschutzmitteln in benachbarte Flächen die Biodiversität in den naturnahen Lebensräumen.
Verschwinden von Lebensraumstrukturen: Nach wie vor werden mehr Lebensraumstrukturen wie Einzelbäume, Hecken und Steinhaufen beseitigt als neu angelegt, um die Bewirtschaftung rationeller zu gestalten (Guntern et al. 2020).
Dies ist heute vermehrt auch in Berggebieten zu beobachten. Steinmauern wiederum werden oft nicht mehr unterhalten und verschwinden so mit der Zeit von selbst.
Verschwinden temporärer Gewässer: Nicht nur Lebensraumstrukturen verschwinden, auch Tümpel werden in unserer aufgeräumten Normallandschaft immer seltener. Besonders häufig fehlen die temporär wasserführenden Fortpflanzungsgewässer der spätlaichenden Arten, welche heute am stärksten gefährdet sind (Schmidt et al. 2023).
Trocknen Gewässer im Herbst nicht aus, werden sie im Frühling gemieden oder sie weisen gefrässige Libellenlarven aus dem Vorjahr auf. Führen sie im Frühling zu früh Wasser, sind bereits grosse, konkurrenzstarke Larven oder Molche als Fressfeinde der Kaulquappen im Gewässer (Abb. 17). Unter
Je länger ein Stillgewässer Wasser führt, umso grösser ist das Prädationsrisiko. Im Weiher links ist die Artenvielfalt an Amphibien daher gering.
Konkurrenzschwache Arten oder solche, deren Larven im Verlauf der Evolution kein Feindvermeidungsverhalten entwickelt haben, können sich nur in jährlich austrocknenden Tümpeln (rechts) erfolgreich fortpflanzen.
Prädatoren





Amphibienlarven








Prädation
Grafik: Funke Lettershop AG














Austrocknungsrisiko
der durch den Klimawandel verstärkten Trockenheit im Sommer sind die passenden Wasserstandsschwankungen oft kaum mehr natürlicherweise zu erreichen.
Künstliche Ablassweiher ermöglichen eine gezielte Wasserführung zur Förderung der Amphibien der temporären Gewässer, also genau derjenigen Arten, die am meisten aus den IANB-Objekten verschwunden sind (Bergamini et al. 2019a).
Invasive gebietsfremde Arten: Vor allem in Auen, aber auch in allen anderen Biotopen breiten sich invasive gebietsfremde Arten aus. Dazu gehören unter anderen der Japanische Knöterich (Reynoutria japonica), das Einjährige Berufkraut (Erigeron annuus), der Schmetterlingsflieder (Buddleja davidii) oder exotische Cotoneaster-Arten.
Verbuschung und Vergandung: Nach wie vor sind viele Flachmoore und TWW durch Nutzungsaufgabe oder Unternutzung gefährdet (Abb. 18). Die Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz zeigte, dass in den letzten zehn Jahren in gut 10 % aller TWW-Objekte und seit 25 Jahren in rund 4 % der Flachmoore die Gehölzdeckung um mehr als 5 % zugenommen hat. Mit der zunehmenden technischen Entwicklung in der Landwirtschaft sind neue Wege zu finden, um abgelegene und schwierig zu bewirtschaftende Flächen mit weniger Arbeitsstunden offenzuhalten.
Kernstück der fünf Biotopschutzverordnungen ist die «ungeschmälerte Erhaltung», was Fläche und Qualität betrifft. Die Vollzugshilfen informieren die Akteure auf Stufe Kanton über die geeignete Umsetzung.
Umsetzung durch die Kantone
Die Biotopverordnungen des Bundes beauftragen die Kantone, die Objekte von nationaler Bedeutung umzusetzen. Als «Umsetzung» gilt die Konkretisierung der nationalen Gesetzgebung mit allgemein verbindlichen rechtlichen oder planerischen Instrumenten. Die Kantone treffen rechtlich verbindliche Massnahmen, welche die ungeschmälerte Erhaltung des Objektes langfristig gewährleisten. Sie sind grundsätzlich frei, ihre eigenen

Instrumente einzusetzen; wichtig ist, dass sie zur Zielerreichung geeignet sind. Die Umsetzung besteht aus vier Elementen:
1. Grundeigentümerverbindlicher Schutz mit parzellenscharfer Abgrenzung (bei IANB-Objekten Bereich A)
2. Sicherstellung von zielgerichteten Pflege- und Unterhaltsmassnahmen
3. Ausscheidung von ökologisch ausreichenden Pufferzonen
4. Sanierung von beeinträchtigten Objekten
Grundeigentümerverbindlicher Schutz
Ein für die Parzellenbesitzer verbindlicher Schutz kann über folgende Instrumente erreicht werden: Kantonaler Richtplan und Schutz aufgrund kantonalen Rechts in Form von Verordnung, Dekret oder Regierungsratsbeschluss oder einer rechtlich verbindlichen Schutzzone im Rahmen der Nutzungsplanung (Abb. 19).
Sicherstellung der Pflege- und Unterhaltsmassnahmen
Der Unterhalt von Flachmooren und TWW wird meist mit Bewirtschaftungsverträgen gemäss Natur- und Heimatschutzgesetz NHG geregelt. Dies sind Vereinbarungen zwischen den Verantwortlichen für die Bewirtschaftung und dem Kanton. Sie ergänzen die Schutzziele, die Nutzungsbedingungen und die Beiträge, welche gemäss der Direktzahlungsverordnung DZV bezahlt werden.






Zu den Schutzbeschlüssen gehören Pflegepläne, sie umschreiben die Massnahmen für den Unterhalt und die Regeneration der Biotope. Der Unterhalt von Biotopen im Wald kann über Sonderwaldreservate geregelt werden.
Ökologisch ausreichende Pufferzonen
Eine ökologisch ausreichende Pufferzone enthält folgende Elemente:
• Nährstoffpufferzonen: Sie schützen die Biotope vor der Einschwemmung von Nährstoffen, insbesondere von Düngern. In Nährstoffpufferzonen ist eine extensive Bewirtschaftung vorzusehen (Abb. 20).
• Hydrologische Pufferzone: Moore, aber auch andere feuchte Biotope wie Auen oder Amphibienlaichgebiete, sind auf eine natürliche Wasserversorgung angewiesen. Wird diese gestört, dann trocknen sie aus. Die hydrologische Pufferzone gewährleistet die Wasserversorgung. Hier sind Eingriffe in den Wasserhaushalt zu vermeiden.
• Störungspufferzone: Durch geeignete Massnahmen soll die Flora und Fauna des Biotopes vor Störungen (z. B. Lärm, Licht, Haustiere) geschützt werden. Zudem soll biotopspezifischen Tieren und Pflanzen der Zugang zu benachbarten Lebensräumen (z. B. Bäume, Waldrand, Gewässer), auf die sie für ihre Entwicklung angewiesen sind, ermöglicht werden. Die Störungspufferzone wird auch «biologische» Pufferzone genannt (BUWAL 2001).


• Morphodynamische Pufferzone: Sie betrifft nur Auen. Es handelt sich dabei um eine an das Auengebiet angrenzende Fläche, in der folgende Ereignisse geduldet werden: Ufererosion, Überflutungen, Erdrutsche und Geschiebeablagerungen.
Am stärksten fortgeschritten ist heute die Ausscheidung von Nährstoffpufferzonen: für 66 % der Objekte wurden die Nährstoffpufferzonen ausgeschieden oder es werden keine benötigt (28 % der Objekte haben ausgeschiedene Nährstoffpufferzonen, 38 % benötigen keine [BAFU 2022]).
Sanierung beeinträchtigter Biotope
Viele Biotope sind nicht mehr in einem Zustand, in dem sie ihre ökologische Funktion genügend erfüllen können. Nur 40 % der Objekte weisen nach Ansicht der Kantone keinen Sanierungsbedarf auf (BAFU 2022). Der Zustand der restlichen Objekte ist entweder nicht bekannt oder die Objekte weisen eine mittlere bis schlechte Qualität auf. Dies deckt sich mit den aktuellen Erkenntnissen der Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz (WBS), wonach knapp die Hälfte der Objekte zu überprüfen, respektive vermutlich sanierungsbedürftig sind. Bei den Hochmooren ist der Anteil Objekte in gutem Zustand am tiefsten.





Das zugehörige Reglement legt für Schutzzone B eine «naturnahe forstliche Bewirtschaftung» als Nutzungsziel fest und untersagt namentlich das «Einbringen standortfremder, nicht einheimischer Baum- und Straucharten». Für die Zone C ist eine extensive landwirtschaftliche Nutzung vorgeschrieben, die zusammen mit den allfälligen Ertragsausfallsentschädigungen mit den Bewirtschaftenden vertraglich zu regeln ist. Schutz-
Schutzzonen
A Hochmoor
B Wald
C Pufferzone

Arbeiten zur Sanierung der Biotope haben in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen (Abb. 21). Verschiedene Leitfäden und Checklisten geben Hilfestellungen. Die WBS hat aufgezeigt, dass die Sanierung von Biotopen im Mittelland den Negativtrend zum Teil brechen konnte. So nahm in den Hochmooren des Mittellands die Gehölzdeckung ab, was auf einen erfolgreichen Unterhalt und Sanierungen zurückzuführen ist (Bergamini et al. 2019).
Das Vorkommen von Rote-Liste-Arten in Hoch- und Flachmooren hat nicht abgenommen und der Rückgang bestimmter häufiger Amphibienarten hat sich in den letzten 15 Jahren verlangsamt oder wurde lokal sogar gestoppt. Diese positiven Entwicklungen sind den Massnahmen von Bund, Kantonen und weiteren Akteuren zu verdanken.
Stand der Umsetzung
Der Bund erhebt den Umsetzungsstand regelmässig mittels eines Fragebogens über alle Biotopinventare. 2021 fand diese Umfrage zum vierten Mal statt (BAFU 2022).
Erst in rund einem Viertel aller Objekte ist die Umsetzung vollständig abgeschlossen (grundeigentümerverbindlicher Schutz, Unterhalt vertraglich geregelt, Pufferzonen ausgeschieden und die Qualität ist erhalten). Bei den Amphibienlaichgebieten beträgt dieser Wert 44 %, beim TWW-Inventar (dem jüngsten Bundesinventar) 11 %. Auch der Stand der vier Umsetzungselemente unterscheidet sich zwischen und innerhalb der Inventare (Abb. 22). Um Qualitätsverluste und damit zusätzliche Sanierungsmassnahmen in den Biotopen zu verhindern, ist ein resolutes Handeln jetzt notwendig. Die Massnahmen zum Schutz und Unterhalt der Biotope von nationaler Bedeutung sind weiterhin dringend und zu verstärken.
Immerhin gibt es zwischen 2018 (letzte Umfrage) und 2021 bei Schutz, Unterhalt und Qualität der Objekte leichte Verbesserungen. Die schon ab 2017 mit den Sofortmassnahmen verstärkten Mittel zeigen erste Wirkungen. Die Schritte gehen zwar in die richtige Richtung, doch sind sie (noch) klein, das Tempo zu bescheiden. Der Schutz und die Erhaltung der ökologischen Qualität der nationalen Biotope wird nur gelingen, wenn die Kantone ihre Verantwortung wahrnehmen und auch entsprechende personelle Ressourcen zur Verfügung stellen. Die vollständige und zügige Umsetzung des seit langem bestehenden gesetzlichen Auftrags bedingt denn auch den Willen, Schutz,
Abb. 20: Nährstoffpufferzone um das Hochmoor La Mosse d’en Bas in La Verrerie FR
Im Abstand von 10 bis 30 m um das Biotop wird nicht gedüngt. Auf Pflanzenschutzmittel wird ebenfalls verzichtet.

Foto: Gaby Volkart/atena
Unterhalt und die Sanierung der Objekte entsprechend hoch zu gewichten.
Abgeltung durch den Bund
Da viele schützenswerte Biotope Kulturbiotope sind, benötigen sie stetige Pflege und Unterhalt. Rund die Hälfte der Biotope benötigt zusätzlich Sanierungsmassnahmen (Umfrage zum Stand Umsetzung, BAFU 2022). Unterhalt und Aufwertungen werden über die Programmvereinbarungen im Rahmen des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) finanziert. Leistungen und Abgeltungen sind im «Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich»
Abb. 21: Sanierung der Düdinger Möser FR

Abb. 22: Umsetzungsstand der nationalen Biotopinventare Anteil Objekte (%) mit grundeigentümerverbindlichem Schutz, geregeltem Unterhalt, ausgeschiedenen Pufferzonen und guter Qualität. Pufferzonen: Die Angaben sind nicht einheitlich, in der Regel sind Nährstoffpufferzonen gemeint. In Klammern: Anzahl Objekte pro Inventar. Aufgeführt sind nur diejenigen Objekte, für welche die gesamte Fläche betroffen ist.
Schutz
Unterhalt
(563)
(1365)
(346) IANB (940)
Pufferzonen
Qualität
Total Objekte pro Inventar
Anteil Objekte in %
Quelle: Kantonsumfrage, 2021; BAFU, 2022
beschrieben (BAFU 2023 Aktualisierung alle 4 Jahre). Die Kantone organisieren den Schutz, die Pflege und Sanierungen.
Die jährlich wiederkehrenden Kosten für den gesetzeskonformen Schutz und Unterhalt der nationalen Biotope betragen gemäss den vorliegenden Berechnungen weit über 100 Mio. Franken (Martin et al. 2017). Die nach dem derzeitigen Wissensstand bezifferbaren Sanierungskosten werden auf rund 1,6 Mrd. Franken geschätzt. Dabei stehen die Wiedervernässung von degradierten Hoch- und Flachmooren sowie die Revitalisierung der Auen im Vordergrund.
Das für die Biodiversität eingesetzte Geld fördert nicht nur unsere Naturwerte, sondern erhöht auch die Wertschöpfung für das lokale Gewerbe sowie die Standortattraktivität einer Region und wirkt so der Abwanderung aus dem ländlichen Raum entgegen (BAFU 2019b). Die Bundesmittel für den Naturschutz fliessen in erster Linie in die Land- und Bauwirtschaft. Davon profitieren vor allem
die Randregionen, in denen ein Grossteil der Massnahmen für die Biodiversität umgesetzt wird.
Zahlreiche Akteure
Für die Erhaltung der Biotope und ihrer Qualitäten sind neben dem Bund und den Kantonen vor allem auch Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen (NGO), die Land- und Forstwirtschaft sowie private Grundbesitzerinnen und -besitzer beteiligt. Nur ein Zusammenspiel der Sektoralpolitiken der Schweiz ermöglicht langfristig den Erhalt der Biotope von nationaler Bedeutung.
Waldwirtschaft und Biotopschutz als Partner
Wo nationale Biotope innerhalb des Waldareals liegen oder durch die forstwirtschaftliche Nutzung tangiert werden, erarbeiten die kantonalen Forstbehörden und die Fachstellen Naturschutz gemeinsam die Schutzmassnahmen. Ein Waldreservat mit forstlichem Massnahmenplan ist ein gutes Instrument, um Synergien zu nutzen: Biotopschutzziele werden in die Zielsetzung von Waldreservaten integriert oder Waldreservatsziele (z. B. die Förderung seltener Waldgesellschaften) in die Biotopschutzziele.
Besonderheit TWW-Vorranggebiete
In TWW-Vorranggebieten (Trockenwiesenverordnung, Art. 5) kommt der Förderung und Aufwertung der Objekte sowie deren Vernetzung eine besondere Bedeutung zu. In Vorranggebieten werden Schutz und Förderung gezielt über eine grössere Fläche geplant, um so den Wert der einzelnen TWW-Objekte zu steigern. Sie ergänzen so den üblichen Objektschutz. Die Ziele und Massnahmen für ein Vorranggebiet werden in einem Konzept festgelegt. Dabei stellen Vorranggebiete per Definition Lebensräume von hohem ökologischem Wert für Pflanzen- und Tierarten von Trockenwiesen und -weiden dar. Sie umfassen ein Objekt oder mehrere nahe beieinander liegende Objekte sowie angrenzende natürliche oder naturnahe Lebensräume und Strukturelemente.
Ausnahme IANB-Wanderobjekte
Eine Ausnahme bei der Umsetzung bilden die IANBWanderobjekte. Das sind Amphibienlaichgebiete in aktiven Materialabbaustellen. Sie sind nicht als zu schützende Fläche definiert, sondern bezeichnen punktförmig Standorte, in deren Umgebung die zur Erreichung der Schutzziele nötigen Voraussetzungen zu schaffen oder zu erhalten sind. Es geht hier in erster Linie um Massnahmen zugunsten der Amphibien in Form von verbindlichen Vereinbarungen oder Auflagen zwischen dem Kanton und den Abbaubetreibern.

3.1 Merkmale des Biotoptyps
Im ständig nassen Boden der Hochmoore herrscht Sauerstoffmangel. Dies führt zur weitgehenden Abwesenheit von Bakterien, Würmern und anderen Organismen. Abgestorbenes Pflanzenmaterial wird deshalb nur teilweise zersetzt und häuft sich in Form von Torf an. Über die Jahrtausende bilden sich so sehr langsam (ca. 1 mm pro Jahr) mehrere Meter mächtige Torfkörper.
Weil die Oberfläche des Lebensraums über den Grundwasserspiegel hinausgewachsen ist, sind Hochmoore vollständig von Regenwasser abhängig. Sie gleichen riesigen Schwämmen in der Landschaft, die sich mit Regenwasser vollsaugen und das Wasser in sich speichern. Verantwortlich dafür sind Torfmoose, welche die karge Vegetation dominieren, eine enorme Wasserspeicherkapazität besitzen und ihre Umgebung versauern lassen.
Hochmoore sind extrem arm an Nährstoffen, weil die im Torf gespeicherten Nährstoffe für Pflanzen nicht verfügbar sind. Die Nährstoffzufuhr erfolgt ausschliesslich über die Niederschläge.
Verteilung der Hochmoore von nationaler Bedeutung
Moore speichern grosse Mengen an organischem Kohlenstoff. Sie sind daher klimawirksam. Entwässerte Moore werden dagegen zu CO2-Quellen: Die Treibhausgasemissionen aus entwässerten, landwirtschaftlich genutzten Mooren betragen 5 % der globalen anthropogenen Treibhausgasemissionen und verdienen somit grosse Beachtung (Joosten 2015).
Übergangsmoore sind Übergangsstadien vom Flach- zum Hochmoor. Die Hochmoorvegetation, die angrenzenden, oft torfhaltigen Landwirtschaftsböden sowie die häufig räumlich unmittelbar anschliessenden Flachmoore bilden einen sogenannten Moorkomplex, in welchem alle Teile in einer hydrologischen Beziehung zueinander stehen. Alle Massnahmen im unmittelbaren Umfeld von Hochmooren wirken sich somit auf den ganzen Moorkomplex aus.

Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023
Die grössten noch existierenden Hochmoorkomplexe der Schweiz liegen bei Les Ponts-de-Martel NE und bei Rothenthurm SZ/ZG. Doch auch diese Flächen wurden grösstenteils entwässert, teilweise werden sie extensiv landoder forstwirtschaftlich genutzt.
Bultenvegetation (Oxycocco-Sphagnetea)
Torfmoose bilden erhöhte Kuppen, die Bulten. Zusammen mit den Schlenken (s. unten) bilden sie die für Hochmoore typischen Bult-Schlenken-Komplexe, welche in der Schweiz recht selten zu finden sind. Neben den Torfmoosen wachsen hier typische Hochmoorpflanzen wie die Rosmarinheide (Andromeda polifolia), die Gemeine Moosbeere ( Vaccinium oxycoccos), der Rundblättrige Sonnentau (Drosera rotundifolia) und das Scheiden-Wollgras (Eriophorum vaginatum).
Foto: Bulte (Torfhügel) mit Lebensraumspezialisten. © Philippe Grosve rnier/LIN’eco
Schlenkenvegetation (Rhynchosporion albae)
Diese Senken sind im Bult-SchlenkenKomplex das Gegenstück zu den Bulten (s. oben). Sie sind fast immer mit Wasser gefüllt und beherbergen wenige spezialisierte Pflanzenarten wie die Schlamm-Segge (Carex limosa) und die Blumenbinse (Scheuchzeria palustris), aber auch den langblättrigen Sonnentau (Drosera anglica) und das Moos Scorpidium scorpioides
Foto: Langblättriger Sonnentau (Drosera anglica) © Ariel Bergamini/WSL
Bergföhrenhochmoor (Pino mugo-Sphagnetum)
Diese Hochmoorflächen sind charakterisiert durch Torfmoose, Bergföhren und Zwerg-sträucher. Gegen das Moorzentrum hin lichtet sich der Bergföhrenbestand immer mehr aus und die Föhren werden immer kleinwüchsiger. Dies ist eine relativ häufige Hochmooreinheit in der Schweiz.
Foto: Salwidili LU. © Regina Jöhl/oekoskop






Rüllengesellschaft, Übergangsmoor (Caricion lasiocarpae)
Ist in natürlichen Entwässerungsrinnen zu finden, die überschüssiges Moorwasser aus dem Hochmoor abführen. Typische Pflanzenarten der «Rüllenvegetation» sind die Schnabel-Segge (Carex rostrata), der Fieberklee (Menyanthes trifoliata) und das Blutauge (Potentilla palustris).
Foto: Blutauge (Potentilla palustris).
© Ariel Bergamini/WSL
Birken- und Fichtenmoor (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Bazzanio-Piccetum)
Auf Hochmooren stockende Birken oder Fichten dringen meist weniger weit ins Hochmoorzentrum vor als Bergföhren. Typisch sind auch hier die dominanten Torfmoose und Zwergsträucher. Diese Hochmooreinheit gedeiht häufig in austrocknenden Flächen.
Foto: Müschenegg FR.
© Philippe Grosvernier/LIN’eco
Hochmoormischvegetation
Diese Vegetationseinheit überwiegt in sekundären Hochmooren. Sie umfasst kleinflächige, nicht in Einzelflächen kartierbare Mosaike der oben beschriebenen Einheiten. Häufig wächst auch ein Gemisch aus Hochmoorvegetation und hochmoorfremder Vegetation mit viel Rasenbinse ( Trichophorum cespitosum)
Foto: Sörenberg LU.
© Philippe Grosvernier/LIN’eco
Nationale Bedeutung
Die Hochmoore der Schweiz wurden als erste Biotope bereits zwischen 1978 und 1982 inventarisiert. Ein Hochmoor fand Aufnahme ins Inventar, wenn es folgende Kriterien erfüllte (Grünig et al. 1986):
• Die Deckung der Torfmoose (alle Arten der Gattung Sphagnum) musste mehr als 5 % betragen. Zusätzlich musste eine der vier hochmoorspezifischen Pflanzenarten (Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum, Vaccinium oxycoccus) oder drei von 17 anderen hochmoorbewohnenden Pflanzenarten vorkommen (Betula nana, Calluna vulgaris, Carex limosa, Carex paupercula, Carex pauciflora, Drosera anglica, Drosera intermedia, Empetrum nigrum, Lycopodiella inundata, Melampyrum pratense, Pinus mugo, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, Trichophorum cespitosum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idea).
• Die zusammenhängende Fläche mit dominierender Moorvegetation (> 50 % Moorarten) musste mindestens 625 m2 betragen.
Es werden zwei Hochmoortypen unterschieden: Als prim är gelten Hochmoore, die nicht genutzt oder fast intakt sind. Vom Menschen beeinflusste, oder teilweise genutzte Hochmoore gelten als sekundär. Im Inventar wurden künstlich entwässerte oder gedüngte Hochmoore als sekundär, nur trittbelastete Hochmoore in der Regel als primär eingestuft.
Zusätzlich wurde das Hochmoorumfeld erfasst. Dieses beinhaltet die an die Hochmoore angrenzenden Flächen, welche hydrologisch direkt mit dem Hochmoor verbunden sind und dazu dienen, das Hochmoor vor Fremdeinflüssen abzuschirmen (im Hochmoorumfeld hat es vor allem
Flachmoore und degradierte Torfböden, auf denen Landwirtschaft betrieben wird oder Wald aufwächst).
Nach Annahme der Rothenthurm-Initiative 1987 schlug der Bundesrat vor, die Objekte dieses Inventars in die Bundesverordnung der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung aufzunehmen, was mit dem Beschluss vom 21. Januar 1991 vollzogen wurde.
Bei den Schweizer Hochmooren handelt es sich oft nur noch um Hochmoorreste, die früher mindestens teilweise abgetorft und anschliessend sich selbst überlassen wurden. Die Vegetation dieser gestörten Standorte enthält teilweise typische Hochmoorarten, lässt sich aber stellenweise nur schwer kategorisieren. Die Standorte haben dennoch für den Artenschutz eine nicht zu unterschätzende Bedeutung.
Das Hochmoorinventar der Schweiz unterscheidet sechs verschiedene Hochmooreinheiten, die durch typische Pflanzengesellschaften charakterisiert sind. In von Menschen kaum beeinflussten primären Hochmooren sind diese Typen klar sichtbar.
Nutzung
Als nährstoffarme und trittempfindliche Lebensräume sollten Hochmoore nicht genutzt werden. Im Gegensatz zu Flachmooren ist in der Praxis auch auf eine Beweidung möglichst zu verzichten, da das Torfmoos den Tritt und die Verdichtung nicht erträgt und viele charakteristische Hochmoorarten extrem empfindlich auf Nährstoffeintrag reagieren.
Sind Hochmoore zu trocken, verbuschen sie. Aus diesem Grund werden einige Objekte regelmässig entbuscht und manchmal geschnitten (v. a. Übergangsmoore).
Tab. 2: Anzahl Objekte und Fläche im Bundesinventar der Hochmoore
Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023
Im Bundesinventar der Hochmoore, das auch die Übergangsmoore von nationaler Bedeutung einschliesst, sind 551 Objekte aufgelistet (Tab. 2). Von allen fünf nationalen Biotopinventaren ist es bei weitem das flächenmässig kleinste Inventar: Hoch- und Übergangsmoore bedecken nur noch 1567 ha. Die grösste Zahl an noch bestehenden Hochmooren findet man auf der Alpennordflanke (s. Schweizer Karte S. 27 ), wunderschöne Flächen gibt es aber zum Beispiel auch im Oberengadin. In den ehemals moorreichen Regionen Jura und Mittelland wurden viele Hochmoore zerstört, man findet aber immer noch wertvolle Restflächen.
Nur wenige hochspezialisierte Pflanzen, Tiere und Pilze finden sich im nährstoffarmen und sauren Milieu der Hochmoore zurecht (Abb. 23). So kommt zum Beispiel der Rundblättrige Sonnentau (Drosera rotundifolia) zu seinen Nährstoffen, indem er mit seinen klebrigen Fangblättern Insekten festhält und verdaut.
Weil dieser Lebensraum sehr selten geworden ist, sind auch viele Hochmoorarten bedroht. Die bekanntesten und als Torfproduzent wohl wichtigsten Pflanzen der Hochmoore sind die Torfmoose (Sphagnum spp.). In der Schweiz sind 33 Arten bekannt, viele davon sind auf Hochmoore angewiesen (Küchler et al. 2018). Gemäss der Wirkungskontrolle
Abb. 23: Charakteristische Arten der Hochmoore
Rundblättriger Sonnentau (Drosera rotundifolia)

Kleinfrüchtige Moosbeere (Vaccinium microcarpum)

Foto: Ariel Bergamini/WSL
Biotopschutz Schweiz bedecken Torfmoose heute im Schnitt nur noch 43 % der Hochmoorfläche. In gesund wachsenden Hochmooren wäre eine Deckung von über 80 % zu erwarten.
Auch bei den Tieren gibt es spezialisierte Hochmoor-Bewohner:
Die Raupe des Hochmoor-Gelblings (Colias palaeno) ernährt sich zum Beispiel exklusiv von den Blättern der Rauschbeere (Vaccinium uliginosum), die fast ausschliesslich in Hochmooren vorkommt. Zudem benötigt der Falter nektarreiche Blüten im Umfeld für seine Ernährung (v. a. Korbblütler und Kardengewächse). Da dieses Lebensraummosaik immer seltener wird, ist der Tagfalter heute regional gefährdet.
Relativ häufig vorkommende national prioritäre Arten in Hochmooren sind die Kleine Moosjungfer (Leucorrhinia dubia), die Alpen-Mosaikjungfer (Aeshna caerulea), der Hochmoor-Perlmutterfalter (Boloria aquilionaris), die Arktische Smaragdlibelle (Somatochlora arctica) oder das Braune Torfmoos (Sphagnum fuscum).
Unterirdisches Holz
Im 17. Jahrhundert herrschte in der Schweiz Brennholzmangel. Die verbliebenen Wälder waren durch jahrhundertelange Beweidung und Energienutzung degradiert. Es galt, den Rohstoff- und Energiebedarf einer rasch wachsenden Bevölkerung und des aufkommenden Gewerbes zu decken. Damit gewannen die Torflager der Hochmoore
Hochmoor-Gelbling (Colias palaeno), National prioritär

Foto: Philippe Grosvernier/LIN’eco
Torfmoose (Sphagnum sp.)

Foto: Philippe Grosvernier/LIN’eco
erstmals Bedeutung als Energieressource. In einer Beschreibung der mächtigen Torflager des Amtshauses Rüti im Zürcher Oberland empfahl der Zürcher Stadtarzt Johann Jakob Scheuchzer 1712, das «unterirdische Holz» auszubeuten – so wie dies in den moorreichen Gebieten Hollands und Norddeutschlands schon seit längerer Zeit praktiziert wurde.
In der Folge wurden zahlreiche Hochmoore vollständig abgetorft. Notzeiten brachten jeweils eine Intensivierung des Abbaus, letztmals während des Zweiten Weltkriegs. 2,5 Millionen Tonnen Torf wurden in den Kriegsjahren verbrannt (BUWAL 2002). Bei der für hiesige Hochmoore durchschnittlichen Torfmächtigkeit von etwa zwei Metern entspricht dies einer Fläche von 1000 Hektaren oder rund zwei Dritteln der Gesamtfläche der heutigen Hochmoore von nationaler Bedeutung.
In praktisch jedem Hochmoor des Mittellandes und des Juras wurde zeitweise Torf gestochen (Abb. 24). Ein Grossteil der heutigen Objekte von nationaler Bedeutung ist davon gezeichnet. Vielfach enthalten sie bloss noch Überreste von einst grossflächigen Hochmooren. Die Juraebene östlich von La Brévine NE zum Beispiel war früher ein einziges Hochmoor. Übrig geblieben sind vier kleinflächige Relikte, die im Inventar der Hochmoore von nationaler Bedeutung das Objekt Marais de la Châtagne NE bilden.

Gräben und Drainageröhren
Als Relikte der Naturlandschaft und infolge der von Volk und Ständen 1987 angenommenen Rothenthurm-Initiative darf in Hochmooren heute kein Torf mehr abgebaut werden. In fast allen Hochmooren existieren allerdings bis heute noch Gräben und Drainageröhren, die in den letzten Jahrhunderten angelegt wurden und die sich noch immer negativ auf die Lebensbedingungen in den Mooren auswirken.
Die Austrocknung beeinträchtigt die Vegetation nicht nur direkt, sondern auch indirekt. Trockenere Verhältnisse führen dazu, dass die obere Torfschicht mineralisiert wird. Dadurch werden Nährstoffe freigesetzt und es kommt zu einer Eigendüngung der Moore. Dies fördert wiederum die Ansiedlung und das Wachstum von Büschen und Bäumen, die ihrerseits die Verdunstung erhöhen können, was zu einem weiter sinkenden Wasserspiegel und weiterer Austrocknung führt.
Rund 70 % der verbliebenen Schweizer Hochmoore sind vom Menschen stark beeinflusst. Oft sind deshalb umfassende Regenerationen nötig, um den Lebensraum zu erhalten.
Abb. 24: Halbindustrieller Torfabbau in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Torfabbau und Trockung des Torfes in Ponts-de-Martel NE und in La Chaux, Tramelan BE Fotos:

Immer trockener und nährstoffreicher
Trotz fast uneingeschränktem Schutz der Moorbiotope durch die Bundesverfassung werden Hochmoore immer trockener – das für die Moore existenzielle Wasser wird immer knapper. Die Gehölzdeckung hat zugenommen – eine Folge des Wassermangels. Die Hochmoore verbuschten zwischen 1985 bis 2015 vor allem im Jura und den Zentralalpen zwischen 0,2 % bis 0,5 % pro Jahr (Bergamini et al. 2019a). Sie werden tendenziell auch nährstoffreicher, angereichert durch Stickstoff aus der Luft.
Die negative Entwicklung der Moore ist deutlich sichtbar, doch können auch positive Veränderungen beobachtet werden. So nahm in den Hochmooren des Mittellandes die Gehölzdeckung ab – als Resultat zahlreicher Regenerationsmassnahmen und Entbuschungsaktionen.
3.5 Blick in die Zukunft
Hochmoore spielen für den Wasserhaushalt der Landschaft eine oft unterschätzte Rolle. Gerade in Gebieten mit viel Niederschlag dämpfen sie den schnellen Abfluss von Starkregen nach Trockenzeiten. So wirken sie vorbeugend gegen Überschwemmungen. Etwas geringer ist das Speichervermögen von Flachmooren. Hochmoore reinigen zudem bei anhaltendem Regen das durchfliessende Wasser und speichern grosse Mengen an organischem Kohlenstoff. Sie sind daher klimarelevant.
In austrocknenden Hochmooren wird der Torf zersetzt und sie emittieren CO2, anstatt das Treibhausgas zu binden (Joosten 2015). Die Wiederherstellung der Funktion der Moore als Torfbildner hat daher hohe Priorität. Damit die Hochmoore wieder vermehrt zu Kohlenstoffspeichern werden, müssen die Wasserstände erhöht und stabilisiert werden. Dazu werden bestehende Graben- und Drainagesysteme deaktiviert. Dies erfolgt durch den Bau von Dämmen und die Verfüllung der Gräben mit dem Ziel, den Wasserspiegel möglichst nahe an die Oberfläche zu bringen.
Mit solchen Massnahmen konnte in den beiden letzten Jahrzehnten die fortschreitende Zerstörung der Moore in der Schweiz nicht gestoppt, aber doch verzögert werden.
Erste erfolgreiche Regenerationsprojekte zeigen wie wichtig es ist, die hydrologischen Verhältnisse für die Moore wiederherzustellen (s. Beispiele gelungener Sanierungen von Hochmooren, S. 34; Küchler et al. 2018).
Beispiele gelungener Sanierungen von Hochmooren
Gefällte Bäume und Spundwände gegen Wasserabfluss
Bei der Regeneration eines sekundären Hochmoors in Mauntschas Tridas, St. Moritz GR wurden von 2017–2019 im Gebiet gekippte oder gefällte Bäume in Schlenken gelegt. Dort war nämlich der Torf erodiert, oder er war durch frühere Nutzungen (Loipe) zersetzt worden. Seither besiedeln Moose und andere Pflanzen allmählich die Baumstämme, sodass mit der Zeit wieder eine geschlossene Moos- und Vegetationsdecke entsteht.


Am unteren Ende des Moorgebiets wurde mit Hilfe von Spundwänden das Wasser gestaut, damit das Moorwasser nicht mehr ungehindert aus dem Gebiet ablaufen kann.

Beim Hochmoor Tourbière de la Gruère (Saignelégier, JU) handelt es sich um eines der grössten zusammenhängenden Torfmoore der Schweiz. Derzeit läuft ein grosses Revitalisierungsprojekt, um die Entwässerungsgräben aus dem 17. Jahrhundert zu beseitigen und die Hydrologie des Gebiets wiederherzustellen. Die erste Etappe der Arbeiten fand 2018 statt. Je nach Beschaffenheit des Geländes wurden Dämme errichtet oder die Gräben mit vor Ort angefallenem Torf aufgefüllt. Der Wald wurde zurückgedrängt. Infolge der bisherigen Massnahmen konnten die Torfmoose als Hauptakteure der Kohlenstoffbindung und der Vitalität der Hochmoore den Lebensraum an vielen Stellen wieder besiedeln.























































swisstopo, NPOC, swisstopo





est un portail d'accès aux informations géolocalisées, données et services qui sont mis à disposition par l'administration fédérale Malgré la grande attention quʼelles portent à la justesse des informations diffusées sur ce site, les autorités fédérales ne peuvent endosser aucune fiabilité et à lʼintégralité de ces informations. Droits d'auteur: autorités de la Confédération suisse. http://www.disclaimer.admin.ch/informations_juridiques.html

4.1 Merkmale des Biotoptyps
Flachmoore – auch Niedermoore genannt – entstehen bei der Verlandung von Seen, durch die Rodung von vernässten Wäldern oder einfach an Stellen, wo ständig Wasser an der Bodenoberfläche verfügbar ist. Flachmoore werden traditionell als Weiden oder Streuwiesen genutzt. Im Gegensatz zu den Hochmooren ist in Flachmooren eine extensive Nutzung – Mahd oder Beweidung – meist notwendig, soll eine Wiederbewaldung verhindert werden.
Flachmoore werden durch Oberflächen-, Boden- und Niederschlagswasser nass gehalten. Hangwasser, Grundwasser, temporäre Überflutungen bringen Nährstoffe ins System. Die Vegetation ist daher produktiver und vielfältiger als in Hochmooren. Flachmoore sind aber dennoch viel nährstoffarmer als intensiv genutztes Grünund Ackerland und dienen so zahlreichen spezialisierten Tier- und Pflanzenarten als Lebensraum.
Das Wasserspeichervermögen von Flachmooren ist etwas geringer als dasjenige von Hochmooren. Da Flachmoore in der Schweiz aber eine viel grössere Gesamtfläche als
Verteilung der Flachmoore von nationaler Bedeutung
Hochmoore aufweisen, ist ihr Wasserspeichervermögen ebenfalls von grosser Bedeutung.
Nationale Bedeutung
Die Flachmoore der Schweiz wurden zwischen 1986 und 1989 nach einheitlichen, noch heute gültigen Kriterien im Massstab 1 : 25 000 kartiert. Die Minimalkriterien für die Aufnahme lauten:
Es sind mindestens zehn Flachmoorarten auf einer Fläche von 20 m2 vorhanden oder die Deckung der Flachmoorarten ist grösser als die Deckung der übrigen Arten.
• Ein Objekt muss mindestens ein Teilobjekt von 1 ha enthalten (mind. 0,5 ha oberhalb der Waldgrenze), die restlichen Teilobjekte müssen mindestens 0,25 ha gross sein.
Jede zusammenhängende Moorfläche gilt als Teilobjekt. Teilobjekte, die weniger als 100 Meter auseinander liegen, werden zu einem Objekt zusammengefasst.

Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023
Flachmoore sind in ihrem Aussehen sehr heterogen. Unter dem Einfluss mehr oder weniger ausgeprägter Bodenfeuchtigkeit, Bodenbeschaffenheit, Topografie, Geologie und Bewirtschaftungsformen bilden sich sehr unterschiedliche Flachmooreinheiten. Diese sind durch lebensraumtypische Pflanzengesellschaften charakterisiert.
Schilfröhricht (Phragmition)
Schilfröhrichte sind ein Hauptbestandteil der Verlandungszonen von Gewässern. Die dichten Schilfhalmbestände lassen nur wenig Licht durch und bilden dicke Streuauflagen, so dass hier nur sehr wenige Lebensraumspezialisten unter den Pflanzen gedeihen. Die Schilfröhrichte sind für viele Vögel und Insekten ein wichtiger Lebensraum.
Foto: Sugiez FR
© Monika Martin/oekoskop
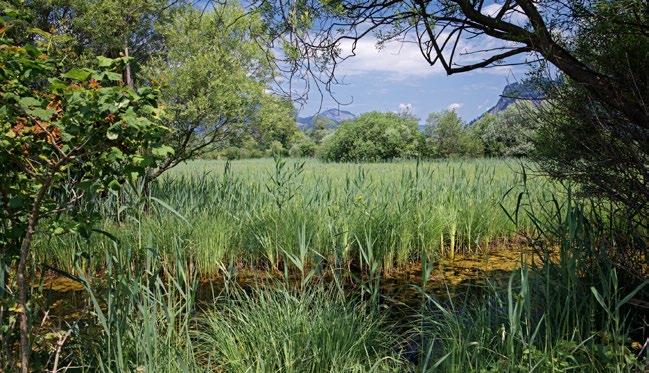
Grossseggenried (Magnocaricion)
Grossseggenrieder sind eine weitere, die Verlandungszone von Seen und Weihern prägende Vegetationseinheit. Der Name sagt es: Sie werden von grossen horstigen Seggen dominiert und sind ebenfalls relativ artenarm.
Foto: Murten FR
© Monika Martin/oekoskop

Kalkige oder saure Kleinseggenrieder
Die Kleinseggenrieder der Alpen und Voralpen (basisches Kleinseggenried –Caricion davallianae; saures Kleinseggenried – Caricion nigrae) enthalten oft das von weitem sichtbare Wollgras. Vor allem die basischen Kleinseggenrieder sind reich an blühenden Kräutern und bilden deshalb besonders günstige Lebensräume für Insekten.
Foto: Jaun FR
© Gaby Volkart/atena



Pfeifengraswiese (Molinion) mit randlicher Spierstaudenflur (Filipendulion) Pfeifengraswiesen sind nährstoffreichere Nasswiesen, welche auf eine regelmässige Nutzung angewiesen sind. Das Schnittgut wurde traditionell als Einstreu für das Vieh genutzt. Nasse Gräben oder nährstoffreichere Randbereiche enthalten Hochstaudenflure mit Mädesüss (Spierstaude, Filipendula ulmaria).
Foto: Gros Mont FR © Gaby Volkart/atena
Sumpfdotterblumen-Wiesen (Calthion) An noch nährstoffreicheren Standorten finden wir Nasswiesen, sogenannte Sumpfdotterblumenwiesen, welche aber auch oft Trollblumen und viele Orchideen enthalten. Nasswiesen sind auf einen regel-mässigen Schnitt oder eine Beweidung angewiesen.
Foto: Entlebuch LU © Monika Martin/oekoskop
Abb. 25: Viele Flachmoore von nationaler Bedeutung werden sehr extensiv beweidet (hier in Val-de-Charmey FR)

Für jedes Teilobjekt schätzen Expertinnen und Experten die Deckung der einzelnen Vegetationseinheiten. Nichtmoorflächen innerhalb der Flachmoore werden abgegrenzt, wenn sie grösser als 0,25 ha sind. Kleinere Nichtmoorflächen innerhalb der Biotope schliesst man nicht aus.
Die kartierten Flachmoore werden in einem Bewertungsverfahren taxiert, welches auf der Flächengrösse und den vorkommenden Vegetationseinheiten beruht. Objekte, welche in dieser Bewertung eine gewisse Punktzahl erreichen, erhalten nationale Bedeutung und werden in die Flachmoorverordnung aufgenommen.
Viele Flachmoore entstanden durch die menschliche Nutzung als Streu- oder Weideland. Sie sind auf eine regelmässige Bewirtschaftung angewiesen, da sonst viele Flächen verbuschen und verwalden. Heute ist der Unterhalt von rund 85 % der Flachmoore mittels Vereinbarungen oder anderer Instrumente geregelt (BAFU 2022). Neben der Entwässerung sind die Nutzungsintensivierung, aber auch die Nutzungsaufgabe die Hauptbedrohungen für diese Lebensräume.
Kleinseggenriede sollen spät (meist erst nach dem 1. September) geschnitten werden. Dadurch können auch spät blühende Arten noch versamen. Der Lebensraum darf keinesfalls gedüngt werden. Jede Düngung bewirkt einen oft drastischen Rückgang der Artenvielfalt.
Extensiv beweidete, nicht gedüngte Flachmoore zeichnen sich durch einen grossen Artenreichtum aus (Abb. 25). Eine zu lange Beweidung mit zu vielen und zu schweren Tieren führt aber zu einem Artenrückgang (Schädigung durch Nährstoffeintrag und Tritt). Trittempfindliche Vegetationstypen müssen laut Direktzahlungsverordnung (DZV Art. 29) ausgezäunt werden. Im Gegensatz zur Nutzung als Streuwiese bringt die extensive Beweidung mehr Struktur in den Lebensraum, was für viele Insekten und Spinnen ein Vorteil ist.
Tab. 3: Anzahl Objekte und Flächen im Bundesinventar der Flachmoore Charakteristische Pflanzengemeinschaften (gerundete Angaben basierend auf den Kartierdaten BAFU)
Pflanzengesellschaft
Objekte Fläche [ha]
(Calthion) und Spierstaudenflur (Filipendulion)
Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023
Das Bundesinventar der Flachmoore enthält 1335 Objekte mit einer Gesamtfläche von 22 501 Hektaren (20-mal mehr Fläche als bei den Hochmooren). Tabelle 4 zeigt die Flächenanteile der verschiedenen Lebensraumtypen.
Die meisten Flachmoore liegen auf der Alpennordflanke. Das Mittelland enthält wenige Flachmoore, wobei das östliche Mittelland eine noch deutlich höhere Dichte an Flachmooren aufweist als das westliche Mittelland. Sehr wenige Flachmoore findet man im Wallis, dem Tessin und dem Kanton Jura (s. Schweizer Karte S. 37 ).
4.3 Artenvielfalt
Während Hochmoore aus wenigen, aber meist seltenen Arten und Pflanzengesellschaften bestehen, sind Flachmoore botanisch und zoologisch vielfältiger. Regelmässig (alle 1–3 Jahre) geschnittene Streuwiesen gehören gar zu den artenreichsten Biotopen Mitteleuropas.
Mehrere Libellenarten haben in Flachmooren ihre Verbreitungsschwerpunkte. Sie nutzen die unterschiedlichen Kleingewässertypen als Brutstätte. Weitere charakteristische Insekten in den Flachmooren sind die Moor-Bläulinge (Phengaris spp.). Die Räupchen dieser Tagfalter-Arten ernähren sich von speziellen Moorpflanzen (z. B. Sanguisorba officinalis), und für ihre spätere Entwicklung sind sie auf
Abb. 26: Charakteristische Arten der Flachmoore
Mehlprimel (Primula farinosa) mit Goldener Acht (Colias hyale)


bestimmte Ameisen angewiesen, welche nur in Mooren vorkommen. Deshalb werden sie auch Ameisenbläulinge genannt. Alle drei Moorbläuling-Arten sind heute selten und stark gefährdet (Status Rote Liste: EN).
In den Flachmooren kommen ausgesprochen viele verschiedene National Prioritäre Arten (NPA) vor. Häufige NPA in Flachmooren sind die Sumpfschrecke (Stethophyma grossum) (Abb. 26), die Sibirische Schwertlilie (Iris sibirica) sowie der Lungen-Enzian (Gentiana pneumonanthe). Andere NPA sind nur noch selten anzutreffen, so z. B. der Kiebitz ( Vanellus vanellus) und die oben erwähnten Moorbläulinge.
Gewässerkorrektionen und Meliorationen Flachmoore bedeckten im frühen Mittelalter ca. 6 % der aktuellen Landesfläche (250 000 ha). Die wirtschaftliche und sozialgeschichtliche Blütezeit war die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die ersten Eisenbahnen hatten billigen Weizen aus Osteuropa oder Übersee ins Land gebracht. Getreideanbau wurde unrentabel, viele Ackerbauern stellten auf Viehwirtschaft um. Stroh als Einstreu in den Ställen wurde damit zur Mangelware. Mit den Streuwiesen fand man einen geeigneten Ersatz für das Stroh. Es lohnte sich sogar, Futterwiesen zu vernässen und in Streueland zu verwandeln.


Andererseits verschwanden im 19. Jahrhundert viele ausgedehnte natürliche Flachmoore des Mittellandes infolge von Gewässerkorrektionen. In grossen Meliorationswerken wurden die Flüsse eingedämmt und begradigt, die Talebenen entwässert und in Kulturland umgewandelt. Als Beispiel sei hier die erste Juragewässerkorrektion 1869–1888 erwähnt. Damals wurden im Grossen Moos zwischen Bieler-, Neuenburger- und Murtensee rund 400 km2 Moorfläche trockengelegt. Das Grosse Moos ist heute eines der wichtigsten Gemüseanbaugebiete der Schweiz und beherbergt nur noch wenige Flachmoore an den Seeufern.
Im 20. Jahrhundert fiel dann der grösste Teil der Streuwiesen der Nutzungsintensivierung in der Landwirtschaft zum Opfer. Für Riedstreue besteht heute kaum noch Bedarf. In praktisch allen verbliebenen Flachmooren existieren Gräben und Drainageröhren, die in den letzten Jahrhunderten oder Jahrzehnten angelegt wurden und die sich noch immer negativ auf die Lebensbedingungen in den Mooren auswirken.
Entwicklung der Qualität
Flachmoore werden – wie die Hochmoore – immer trockener (Bergamini et al. 2019 und 2022). Die Bedeckung mit Gehölzen nimmt zu (Abb. 27) und der Anteil charakteristischer Moorarten nimmt ab, insbesondere in basischen Kleinseggenriedern und Röhrichten. Dies konnte mit Erhebungen von Kalkseggenrieden verschiedener Höhenlagen zwischen 1995/1997 und 2005/2006 belegt werden: Spezialisierte Gefässpflanzen haben in 10 Jahren
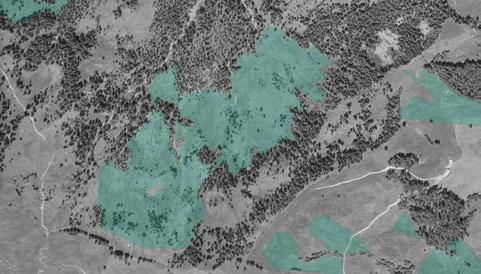
um 9,4 % und spezialisierte Moose gar um 14,9 % abgenommen (Bergamini et al. 2008).
Die abnehmende Qualität der Moore wurde auch im Rahmen der letzten «Erfolgskontrolle Moorschutz» festgestellt (1997 bis 2006; Klaus 2007): Auch damals war ein Viertel der Moore deutlich trockener geworden, in einem Viertel hatte die Nährstoffversorgung deutlich zugenommen, in einem Drittel der Moore wuchsen wesentlich mehr Gehölzpflanzen und in 15 % aller Moore war der Moorcharakter entscheidend gesunken. Die Fläche der Moore hatte in der Beobachtungszeit zwar nur geringfügig abgenommen; die nichttorfbildenden Flachmoore (insb. Sumpfdotterblumenwiesen) haben aber auf Kosten der torfbildenden Flachmoore (z. B. Kleinseggenrieder) zugenommen, was einem deutlichen Qualitätsverlust gleichkommt.
Mit verschiedenen Massnahmen konnte in den beiden letzten Jahrzehnten das Verschwinden der charakteristischen Flora und Fauna in Schweizer Flachmooren nicht gestoppt, aber doch gebremst werden. So wurde vielerorts mit Bewirtschaftungsverträgen eine standortgerechte Nutzung vereinbart. Zusammen mit der Sanierung der hydrologischen Verhältnisse konnten so die Überlebenschancen für die Flora und Fauna von Flachmooren verbessert werden.

Unentbehrliche Pufferzonen
Wie auch bei anderen Biotopen müssen mögliche negative Einflüsse aus der Umgebung von Mooren verhindert werden. So schreiben die Hoch- und die Flachmoorverordnung vor, dass um die Moorbiotope ökologisch ausreichende Pufferzonen auszuscheiden sind. Diese besteht aus den drei Komponenten Nährstoffpufferzone, hydrologische Pufferzone und Störungs-Pufferzone. Zurzeit fehlt noch bei rund 22 % der Flachmoore und gut 16 % der Hochmoore die Festlegung von Nährstoffpufferzonen (BAFU 2022).
Moore sind auf einen Wasserüberschuss aus ihrer Umgebung angewiesen. Bei fast allen Schweizer Mooren ist dieser Wassereintrag oder deren Wasserhaushalt (vgl. auch Kap. 3 Hoch- und Übergangsmoore) mehr oder weniger stark beeinträchtigt (Drainagen, Quell- und Wasserfassungen, Strassen, Bahndämme und andere Bauten). Es sind deshalb Massnahmen notwendig, welche die Wasserressourcen der Moore schützen. Anzusetzen sind diese Massnahmen im Wasser-Einzugsgebiet des Moores.
Im Rahmen des Projektes «Espace Marais» wurden methodische Grundlagen geschaffen, um hydrologische Einzugsgebiete für einzelne Moorobjekte zu definieren. Diese werden anhand von GIS-Berechnungen und -Modellierungen inkl. gutachterliche Beurteilung erstellt. Neben dem zentralen hydrologisch zusammenhängenden Moorkomplex unterscheiden sie verschiedene Arten von hydrologischem Einzugsgebiet (Abb. 28):
• Einzugsgebiet Moorkomplex (Hangwasser)
• Einzugsgebiet Bach als Wasserlieferant
• Einzugsgebiet Bach als Erosionsgefahr für die Moorflächen (randlicher Bach)
• Sensitiver Saum
In diesen Gebieten kann jede Änderung des Wasserregimes die Wasserversorgung gefährden, welche für die Erhaltung der Moore erforderlich ist. Projekte in Einzugsgebieten von Mooren müssen deshalb gründlich untersucht werden, bevor sie genehmigt werden können. Es gilt eine Umkehr der Beweislast: Es obliegt nun dem Urheber eines Projekts (Strassenbau, Entwässerung usw.) nachzuweisen, dass dieses Projekt keine Auswirkungen auf den Wasserhaushalt des Moores haben wird. Die Kantone, die
für den Schutz der Moore zuständig sind, verfügen damit über ein Instrument, um die Einhaltung der Hoch- resp. Flachmoorverordnung (Art. 5 Abs. 1 lit. e und Abs. 2 lit. g) sicherzustellen: «Die Kantone sorgen insbesondere dafür, dass der Gebietswasserhaushalt erhalten und, soweit es der Moorregeneration dient, verbessert wird.»
Einzelne Kantone wenden diese neue Methode bereits an. So hat beispielsweise der Kanton Bern die Vorsorgeperimeter zu den hydrologischen Pufferzonen bestimmen lassen und 2019 im Sachplan Biodiversität behördenverbindlich festgeschrieben.
Abb. 28: Gliederung der hydrologischen Pufferzone beim Rotmoos (BE) Die hydrologischen Einzugsgebiete der Bäche (violett und dunkelgrün), des Moorkomplexes (grasgrün) und des sensitiven Saumes (beige) sind bezeichnet.
Moorkomplex
Hydrologische Pufferzonen Flächentyp
Einzugsgebiet Moorkomplex
Sensitiver Saum
Einzugsgebiet Bach mit Wasserspeisung Moorkomplex
Einzugsgebiet Bach mit Erosionsgefahr Moorkomplex
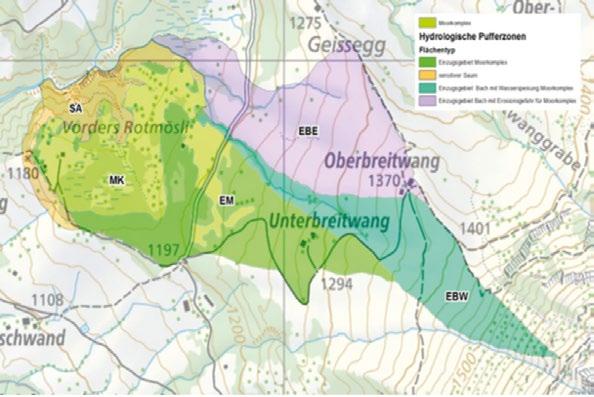
Karte: geo7
Beispiele gelungener Sanierungen von Flachmooren
Das Flachmoor Grossried (Luzein, GR) mit seinem Graben- und Drainagenetz vor und nach der Renaturierung 2018
Das Flachmoor liegt im Alpgebiet auf 1725 m ü. M. und wurde in den 1940er-Jahren im Rahmen der Anbauschlacht mit einem grossen Netz an unterirdischen Drainageleitungen und Gräben entwässert, umgebrochen und angesät. Inzwischen ist das Drainagenetz stark sanierungsbedürftig. Bei nassen Verhältnissen kommt es zu Überstauungen. Anstelle einer Sanierung der Drainageleitungen wurden der Moorabfluss und einige Drainageleitungen und Gräben eingestaut. Die Moorvegetation wird durch den höheren Wasserstand grossflächig profitieren. Ein kleiner Teich und mehrere kleinere Wasserflächen sind entstanden. Die im Gebiet vorkommende Alpen-Mosaikjungfer (Aeshna carulea) kann sie nutzen. Um den Verlust der Alpweide zu kompensieren, wurden verschiedene Auflichtungen von Waldweiden realisiert.




5.1 Merkmale des Biotoptyps
Natürliche Auen sind dynamische Biotope. Sie bilden sich in den vom Wasser geprägten Uferbereichen von Fliessgewässern und Seen. Dort ist der Wasserstand starken saisonalen und jährlichen Schwankungen unterworfen –periodisch oder episodisch wird der ganze Bereich überflutet. Das Wasser transportiert Geschiebe, Totholz und Nährstoffe und lässt vielfältige Strukturen entstehen.
In das nationale Aueninventar wurden zwei verschiedene Kategorien von Auen aufgenommen: Bis 1800 m ü. M. die tiefergelegenen Auen (Flussauen, Deltas und Seeufer), in höheren Lagen die alpinen Auen (Alpine Schwemmebenen und Gletschervorfelder, Abb. 29).
Durch die Dynamik des Gewässers entsteht auf kleinem Raum ein Mosaik ganz verschiedener Lebensräume wie Kies- und Sandbänke, Hochstaudenflure und Auenwälder (s. Lebensraumtypen – Auen S. 48). So bilden die Auen attraktive Landschaften und haben eine hohe Erholungswirkung für Menschen.
Auen erbringen eine Vielzahl von Ökosystemleistungen. Dazu gehört der Hochwasserschutz: Auen absorbieren und speichern Wasser während Überschwemmungen. Dies reduziert den Hochwasserspiegel und minimiert Hochwasserschäden in flussnahen Gebieten. Vielfältige Auen sind zudem oft Orte der Erholung für Menschen. Sie wirken auch wie natürliche Filter, indem sie Schadstoffe aus dem Oberflächenwasser entfernen.
Nationale Bedeutung
Eine Auenfläche zeichnet sich vor allem durch das Potenzial aus, von einem Gewässer überflutet zu werden. Bei einer Momentaufnahme wie der Inventarisierung können gewisse Teilgebiete aber völlig trocken liegen. Es wurden daher Geländekammern im Einflussgebiet von Gewässern aufgenommen, die folgende minimale Voraussetzungen erfüllen: Tiefergelegene Auen (unterhalb von 1800 m ü. M.): Mindestens 2 ha Auenvegetation an natürlichen oder naturnahen Gewässern oder 5 ha an korrigierten Gewässern.
• Alpine Auen (oberhalb von 1800 m ü. M.): Mindestens 0,25 ha grosser, von Eis und Schmelzwasser oder Gewässern geprägter Auenbereich sowie biologische und geomorphologische Grenzkriterien.
Verteilung der Auen von nationaler Bedeutung
Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023

Die typischen Auenlebensräume sind auf das ständige, periodische oder episodische Zusammenspiel mit dem Gewässer spezialisiert. Auch Laichgebiete für Amphibien und Flachmoorvegetation sind Teil dieser Lebensräume. So liegen viele nationale Amphibienlaichgebiete (17 % der Auenfläche) und Flachmoore (5 % der Auenfläche) in Auen.
Sedimentbänke
Nicht oder wenig bewachsene Sedimente (Kies, Geröll, Steine, Sand, Schluff oder Ton), die bei tiefem Wasserstand trocken liegen. Bei längerer überschwemmungsfreier Zeit stellt sich eine Pioniervegetation ein. Diese kann vom nächsten Hochwasser schnell wieder beseitigt werden. Wichtiger Lebensraum für kiesbrütende Vögel (Flussuferläufer, Flussregenpfeifer).
Foto: Auengebiet Tschingel BE © Jan Ryser/BAFU

Auenflächen mit Krautvegetation
Auf regelmässig durch Hochwasser verjüngten Sedimentbänken und Terrassen entstehen Pionier-Krautflure, Trittvegetation, Hochstaudenflure und Annuellenvegetation. Die Artenvielfalt ist meist sehr hoch, da viele der durch Luft und Wasser herangetragenen Samen dank schwacher Konkurrenz zur Keimung kommen. Junge Weiden, Erlen und Pappeln können die Pionier-Krautflure begleiten.
Foto: Allondon bei Dardagny GE © Jan Ryser/BAFU
Flachmoore tiefer und hoher Lagen
In ständig feuchten Senken und verlandenden Nebenarmen, die vor der direkten Gewässerdynamik meist geschützt sind, entstehen Flachmoorflächen. Hier können auf kleinem Raum viele spezialisierte Flachmoorarten vorkommen, z. B. in der seltenen alpinen Schwemmflur (Caricion bicolori)
Foto: Kleinhöchstettenau, Rubigen BE © Markus Bolliger/BAFU


Die wenigen nationalen Trockenwiesen und -weiden in Auen (knapp 1 % der Auenfläche) zeigen das breite Spektrum an Umwelt bedingungen auf kleinem Raum. Auen enthalten neben dem Gewässer selbst folgende Lebensraumtypen:



Weichholzaue
Die Weichholzauen sind die ersten Gehölzformationen am Gewässerrand oder auf Kiesinseln. Sie bestehen aus Weichholzarten wie Weiden, Erlen oder Pappeln (z. B. Silberweiden-Auenwälder, Erlen-Bruchwälder oder GrauerlenWälder). Auch spezielle Arten wie der Sanddorn (Hippophaë rhamnoides) oder die Deutsche Tamariske (Myricaria germanica) gehören in diesen Lebensraum.
Foto: Senseauen bei Sodbach BE © Stephan Lussi/BAFU
Hartholzaue
In den vom Gewässer am weitesten entfernten Flächen und auf den höheren Flussterrassen wachsen Hartholzauen. Sie stehen unter dem Einfluss von Grundwasser sowie von aussergewöhnlichen Hoch-wassern. Der Wassereinfluss bremst die Entwicklung zum normalen Wald (Klimax-wald). Die Hartholzauen werden von Esche, BergUlme und Spitzahorn bestimmt. Auch Föhren und Eichen sind hier zu finden.
Foto: Giriz, Koblenz AG © Jan Ryser/BAFU
Glazialflächen
Auf Moränenschutt- und Felsflächen gedeihen spezialisierte Pionierarten, die an karge Bedingungen angepasst sind. Die Vegetationsdeckung nimmt mit einsetzender Bodenbildung zu. Weidenoder Grünerlenbestände können lokal landschaftsprägend sein. Sie bilden eine wichtige Nahrungsgrundlage für Raufusshühner oder dienen der Deckung für Gämse oder Rothirsche.
Foto: Vorfeld des Geltengletschers BE © Stephan Lussi/BAFU
Da die Grenzen der Auengebiete häufig fliessend und manchmal unklar sind, wurden klare Hangkanten oder auch Wege oder Strassen als Abgrenzung für die Auengebiete genutzt. So kommt in Auen häufig auch nicht auentypische Vegetation vor. Gerade in schluchtartigen Situationen sind die meist naturnahen Hangwälder oft bis hoch über das Gewässer hinaus als Teil des Auenlebensraumkomplexes in die Objekte integriert.
Lebensraummosaik
Im Tages-, Wochen- und Jahresverlauf schwankt der Wasserstand in Flüssen und Seen. Er ist natürlicherweise abhängig vom Niederschlag oder der Schneeschmelze. Durch dieses sogenannte saisonale Abflussregime werden verschiedene Bereiche einer Aue mehr oder weniger benetzt oder stehen gar Stunden oder auch Wochen unter Wasser. Grössere Hochwasser, die wenige Male jährlich oder als extreme Ereignisse nur selten vorkommen, sind hingegen in der Lage, den Lebensraum umzugestalten. In gewissen Teilen wird die aufgewachsene Vegetation ganz zerstört. Ein neuer Flusslauf entsteht. Pionierpflanzen keimen auf den neu entstandenen Kiesbänken (Abb. 30). Erst das Wechselspiel von natürlicher Vegetationsentwicklung und dem abrupten Zurücksetzen dieser Entwicklung ermöglicht eine artenreiche und zum Teil hochspezialisierte Flora und Fauna.
Tab. 4: Entwicklungszeit und Bestandesdauer der häufigsten Auenformationen
Formation Entwicklungszeit (in Jahren) Bestandesdauer (in Jahren)
Kiesbänke – <1
Pionierkrautflure 1 1–3
Weidengebüsche und -mäntel 3–5 5–10
Weichholzaue ≥10 30–50
Hartholzaue >30 50–100
Quelle: Roulier et al. 2007
Abb. 29: Die Auen von nationaler Bedeutung werden in fünf Typen unterteilt
Flussauen
Flussauen sind der häufigste und dynamischste Auentyp in tieferen Lagen. Die Vegetation besteht aus einem Mosaik von Pioniergesellschaften, Gebüschen und Auenwäldern. Komplett natürliche Systeme sind heute sehr selten. Vielerorts schränken Verbauungen die Dynamik ein. Ist dies der Fall, fehlt hinter dem Hochwasserdamm die regelmässige Verjüngung. Die Auenvegetation kann sich hier nur bei entsprechend hohen Grundwasserständen halten. Foto: Gastereholz BE.

Deltas
Deltas liegen an der Mündung von Fliessgewässern in einen See. Die Wasserströmung wird hier zusammen mit dem mitgeführten Geschiebe abgebremst. Durch Materialablagerungen bilden sich Bänke, die sich langsam in den See hinein vergrössern. Nur wenige Deltas von kleinen Flussläufen sind noch intakt. Die Vegetation zeigt einen Übergang vom dynamisch-fliessenden zum stillen Charakter. Auenwälder mischen sich mit Pioniervegetation und Mooren. Foto: Bolle di Magadino TI.

Seeufer
Seeufer sind durch die regelmässige Überflutung und den schwankenden Grundwasserstand geprägt. Die mechanische Dynamik beschränkt sich stellenweise auf den Wellenschlag. Auch in den Seeauen sind Auen- und Moorvegetation miteinander verzahnt. Die grössten Seeauen der Schweiz befinden sich an den Ufern der drei Jurarandseen. Foto: Le Chablais FR.

Gletschervorfelder
Gletschervorfelder weisen zwei verschiedene Bereiche auf: Sie sind entweder vom Eis geformt (glaziale Prägung) oder vom Gletscherbach gestaltet (fluviale Dynamik). Die täglichen Hochwasser während der Sommermonate, die charakteristische Trübung des Wassers (Gletschermilch) und der Geschiebetransport sind bedingt durch die Nähe des Gletschers. Diesem Milieu sind in der Regel nur Pionierpflanzen gewachsen. Foto: Kanderfirn BE.

Alpine Schwemmebenen
Alpine Schwemmebenen sind flache Gebiete oberhalb 1800 m, welche von Überflutung und flächiger Sedimentumlagerung geprägt sind. Alpine Schwemmebenen sind sehr dynamisch: Durch Überschwemmung, Sedimentation, Abtrag und Gerinneverlagerung können die Standortvoraussetzungen rasch und dramatisch ändern. Die stabileren Zonen werden oft auch als Alpweiden genutzt. Foto: Plaun la Greina GR.

Je nach Umgebungsfaktoren läuft die Entwicklung unterschiedlich schnell ab (Tab. 4). Gerade in tieferen Lagen können hohe Grundwasserstände diese stark verlangsamen. In Höhenlagen oder bei besonderen topografischen Verhältnissen können Teile der Vegetationszonierung natürlicherweise fehlen (Abb. 32).
Nutzung und Revitalisierung Natürliche Auen sind nicht auf eine Nutzung durch den Menschen angewiesen. Die natürliche Dynamik des Wassers und des mittransportierten Geschiebes erhält und formt die Auenlebensräume.
Heute ist diese natürliche Dynamik vielerorts durch Verbauungen der Gewässer, Nutzung des Wassers oder Entnahme von Geschiebe und Totholz eingeschränkt oder verschwunden. Wo möglich sollten solche Eingriffe entlang
der Gewässer zugunsten der Auen rückgebaut bzw. gemildert oder unterlassen werden. Häufig lassen sich auch Kompromisse finden, die eine grösstmögliche Dynamik in kontrolliertem Rahmen zulassen.
Viele Auengebiete beinhalten grossflächig Wald. Hier werden Instrumente der Forstwirtschaft zum Schutz und Unterhalt eingesetzt. Wenn die Dynamik des Gewässers genügend spielt, können Naturwaldreservate oder Sonderwaldreservate ausgeschieden werden. Forstlicher Unterhalt ist vor allem dort notwendig, wo die natürliche Dynamik mittel- bis langfristig nicht wiederhergestellt werden kann und die Sukzession deshalb durch künstliche Eingriffe zurückgesetzt werden soll. 2021 wurden 11 % der Auen vorwiegend durch forstliche Instrumente unterhalten (BAFU 2022).
Abb. 30: Wirkung der Hochwasser auf die Auenfunktionen
Kolmationshorizont: Undurchlässige Schicht, die durch Absetzen von Feinmaterial im Flussbett in Zeiten tiefer Abflüsse entsteht. Diese wird bei Hochwasser aufgerissen, was zu einer erneuten Durchlässigkeit führt.

Neubildung Kiesbank
Verlagerung Teilgerinne
Ufererosion (Erhalt gehölzfreie Breite)
Aufreissen Deckschicht (Durchlässigkeit)
(Durchlässigkeit)
Das Bundesinventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung umfasst 326 Objekte mit einer Gesamtfläche von 27 844 Hektaren (Schweizer Karte S. 47, Tab. 5). Sie bedecken rund 0,67 % der Landesfläche. Die Dichte der Auenobjekte ist in den Westlichen Zentralalpen am höchsten und im Jura am tiefsten (Abb. 31). Weil die
Abb. 31: Anteil Auen in den biogeografischen Regionen
Gletschervorfelder gross sind, besteht die Hälfte der Auenfläche aus alpinen Auen.
Im Jura gibt es aufgrund der von Kalkgestein geprägten Geologie natürlicherweise wenig Auen. Im Mittelland sind Auen aufgrund der Landnutzung eher selten geworden. Dennoch liegen an den grossen Mittellandflüssen noch grosse Rest-Auenflächen.
Tab. 5: Anzahl Objekte und Fläche im Bundesinventar der Auen Nationale Objekte nach Auentypen
Anteil in Prozent
Alpennordflankewestl.ZentralalpenwZA
Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023
AlpensüdflankeSAöstl.ZentralalpenöZA
Abb. 32: Vegetationszonierung in einer Flussaue
Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023
Spitzenhochwasser
Grafik: Funke Lettershop AG nach
Infolge der natürlichen Dynamik beherbergen Auen sehr spezialisierte Pflanzen- und Tierarten. Die grosse Vielfalt an Lebensraumtypen in einer Aue führt dazu, dass eine Reihe von Arten mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen gleich nebeneinander vorkommen kann. Auf den Sand- und Kiesbänken brütet der Flussregenpfeifer (Charadrius dubius, Abb. 33); etwas weiter hinten ruft aus einer kleinen Pfütze die Gelbbauchunke (Bombina variegata). Als im Auenwald verborgener Schmetterling kann mit viel Glück der Grosse Eisvogel (Limenitis populi) beobachtet werden.
Auch in den Auen finden sich viele National Prioritäre Arten. Dazu gehören der Eisvogel (Alcedo atthis), der Kiesbank-Grashüpfer (Chorthippus pullus), die Zierliche Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis) und die Deutsche Tamariske (Myricaria germanica)
Früher säumten Auen fast alle Gewässer im Mittelland sowie der breiteren Täler der Alpen und des Juras. Dort bildeten sie in den Ebenen und auf den Talböden grosse Lebensraumkomplexe.
Der Mensch ist seit Jahrhunderten bestrebt, die dynamischen Prozesse, die der Auenbildung zugrunde liegen, stark einzuschränken. Ziel waren der Schutz vor Hochwasser und
Charakteristische Arten in Auen


die Gewinnung von neuem Kulturland zur Ernährung der wachsenden Bevölkerung. Die Umgestaltung der Gewässerlandschaft erreichte im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt. Müller-Wenk et al. (2003) schätzen, dass die Auenfläche unterhalb von 1800 m ü. M. bis zum Jahr 1900 bereits um 55 % abgenommen hat. Seither ist die Fläche der Auen nochmals um 36 % zurück gegangen (Lachat et al. 2010). Zwischen 1900 und 2000 ist der grösste Rückgang im Alpenraum festzustellen, wo die Gewässerkorrektionen relativ spät eingesetzt haben (Tab. 6).
Seit 1992 stehen die wertvollsten verbleibenden tiefergelegenen Auen unter nationalem Schutz. Diese erste Serie des Aueninventars wurde seither in mehreren Etappen ergänzt: 2001 folgten die alpinen Auen (über 1800 m ü. M., alpine Schwemmebenen und Gletschervorfelder), 2003 und 2017 weitere systematische Ergänzungen.
Rund ein Viertel der Fläche des Bundesinventars liegt an korrigierten Gewässern. Dies gefährdet die Qualität der Auenflächen: Verändertes Abflussregime durch Wasserkraftnutzung, Gewässerbegradigungen und -verbauungen beeinträchtigen oder behindern die natürliche Regeneration der Auenlebensräume (Abb. 34).


Tab. 6: Rückgang der Auen unterhalb von 1800 m ü. M. zwischen 1900 und 2010 nach biogeografischen Regionen
Biogeografische Region
um 1900 (ha)
um 2010 (ha)
Quelle: Lachat et al. 2010
Abb. 34: Einwachsende Aue
Neirivue FR 1930, 1974 und 2020. Auen verlieren ihre Kiesbänke und Pionierfluren wegen mangelnder Dynamik des Gewässers. Die Saane wurde Mitte des 20. Jahrhunderts kanalisiert. Der Bau eines Staudamms im flussaufwärts gelegenen Lessoc (1969–1973) hat zudem die Gewässerdynamik so stark vermindert, dass die Kiesbänke zugewachsen sind.



Synergien nutzen
Viele Gewässer sind in einem naturfernen Zustand und können Ökosystemleistungen nur noch sehr eingeschränkt oder gar nicht erbringen. Die Gewässerschutzpolitik des Bundes hat daher seit 2011 zum Ziel, Flüsse, Bäche und Seeufer wieder aufzuwerten. Dies soll mit folgenden Massnahmen geschehen: Ausreichender Gewässerraum, Revitalisierungen und Reduktion der negativen Auswirkungen der Wasserkraftnutzung (Fischgängigkeit, Schwall-Sunk, Geschiebe). Im Rahmen dieser Generationenaufgabe sollen auch Auenflächen revitalisiert werden. Ziel in Auen muss sein, die natürlichen Prozesse wiederherzustellen oder zumindest mehr Naturnähe zu erreichen, indem genügend Raum für Dynamik, ein guter Geschiebehaushalt und eine ausreichende Wasserführung bereitgestellt werden. Bei Erneuerungen von Wasserkraft-Konzessionen sollen die spezifischen Ansprüche von Auen analysiert und insbesondere bei der Festlegung angemessener Restwassermengen optimal berücksichtigt werden.
Sanierungen in den Auengebieten haben zwar ihren Preis, sind aber eine lohnende Investition. Denn Aufwertungsmassnahmen in Auen haben meist eine schnelle ökologische Wirkung (BAFU 2020). Sie bringen zudem einen unmittelbaren Attraktivitätsgewinn für Naherholung und Tourismus. Bei guter Besucherlenkung sind Auen als Erholungsgebiete im dicht besiedelten Mittelland sehr wertvoll für Natur und Mensch (s. Beispiele gelungener Sanierungen von Auen, S. 57 ). Beim naturnahen Hochwasserschutz gilt es, alle sich bietenden Synergien zu nutzen und optimal auszuschöpfen.
Einzugsgebiete einbeziehen Im Sinne eines integralen Gewässermanagements sind Auen im Kontext des gesamten hydrologischen Einzugsgebiets zu betrachten. Für die Erhaltung der auentypischen Arten ist die Vernetzung der Auen untereinander und mit dem Umfeld zu gewährleisten.
Um die genannten Aufgaben erfüllen zu können, ist grosses Augenmerk auf eine gute Zusammenarbeit der beteiligten Partner zu legen. Verschiedene Sanierungsmassnahmen bedingen partizipative Prozesse und eine besonders gute Öffentlichkeitsarbeit.
Beispiele gelungener Sanierungen und Neuschaffungen von Auen
Durch die Natur geschaffen
Die Bünzaue ist durch ein Hochwasser im Mai 1999 quasi über Nacht von selbst entstanden. Die Bünz trat über die Ufer und gestaltete ihr Tal zu einer Auenlandschaft mit hoher morphologischer Dynamik um. Kanton, Anrainergemeinden und Landeigentümerinnen und - eigentümer vereinbarten, dieses Auengebiet durch Landumlegung und Extensivierungen zu erhalten. Seither konnte es sich frei entwickeln und auch immer wieder von Hochwassern umgestaltet werden. Mit seinem Mosaik aus Kleinlebensräumen bietet die Bünzaue ideale Bedingungen für Laufkäfer und Heuschrecken. In einer Erhebung von 2009/2010 wurden 81 Laufkäferarten festgestellt, darunter der Grüngestreifte Grundkäfer (Omophron limbatum), der im Aargau letztmals 1950 nachgewiesen wurde. Ausserdem wurden 14 Heuschreckenarten gezählt, darunter die seltene Blauflügelige Sandschrecke (Sphingonotus caerulans).

Im Thurspitz wurden in den Jahren 2008 bis 2017 die letzten 5 km der Thur bis zur Mündung in den Rhein revitalisiert. Unterhalb von Eggrank wurden Uferverbauungen entfernt und ehemalige Altläufe reaktiviert. Während das Auengebiet für die Natur aufgewertet wurde, wurden die umliegenden Landwirtschaftsflächen besser vor Hochwasser geschützt und diverse Angebote für die Naherholung ausgebaut. In den nächsten Jahren wird sich die Thur eigendynamisch weiterentwickeln können und die Revitalisierung weiterführen.
ZH in den Jahren 2002 und 2016



Die Aue Rietheim liegt am Koblenzer Laufen, einem längeren freifliessenden Abschnitt des Rheins. Dank Landerwerb konnte das Gebiet «Chly Rhy» umfassend umgestaltet werden (Ausbaggerung eines Seitenarms, Entfernung von Pappelpflanzungen, Wiederherstellung von Inseln im Mündungsbereich und Anlegen von Grundwasserweihern). Zudem konnten angrenzende Landwirtschaftsflächen extensiviert werden. So kann das Wasser das Gebiet wieder durchfliessen und gestalten. Die Fläche steht wieder als Lebensraum und Vernetzungselement für diverse Auenarten zur Verfügung. Auch für Erholungssuchende wurden Wege und Beobachtungsorte gestaltet.
Revitalisierung inklusive Schaffung von Erholungsraum mit Besucherlenkung bei Rietheim, Zurzach AG



Spitzmäder SG, eingestaute Torfstichgräben.
© Beratungsstelle IANB
6.1 Merkmale des Biotoptyps
Amphibien gehören zu den am stärksten gefährdeten Artengruppen. Die meisten Arten sind für ihre Fortpflanzung auf Stillgewässer angewiesen, die wie kaum ein anderes Landschaftselement dem starken Landschaftswandel der letzten 150 Jahre zum Opfer gefallen sind. Das Inventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung (IANB) soll ein Netz der besten verbliebenen Standorte dieses entscheidenden Lebensraumelements für die Amphibien und damit deren langfristiges Überleben sichern.
Die Ansprüche an das Fortpflanzungsgewässer variieren allerdings enorm. Manche Arten nutzen bevorzugt flache, im Sommer austrocknende Tümpel, andere die Uferbereiche grosser Seen. Wieder andere setzen ihre Larven sogar in Bächen ab. Entsprechend divers sind die Amphibienlaichgebiete im Inventar (Abb. 35).
Nationale Bedeutung
Ein Objekt erlangt nationale Bedeutung, wenn es einen für die biogeografische Region festgelegten Schwellenwert erreicht. Vorkommen von stark gefährdeten Arten werden besonders gewichtet, sind aber nicht ausreichend
Verteilung der IANB-Objekte
Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023
für eine Aufnahme ins Inventar. Für die Berechnung des Schwellenwertes sind auch die Artenzahl und die Populationsgrösse der gefährdeten Arten entscheidend (Pellet et al. 2012). In den Alpen wurden auch artenarme Objekte, die eine wichtige Vernetzungsfunktion haben, ins Inventar aufgenommen.
Wie bei den anderen nationalen Inventaren sind die IANBObjekte räumlich verankert, meist mit einem festgelegten Schutzperimeter. In diesen ortsfesten Objekten bleibt die Lage der Fortpflanzungsgewässer über Jahrzehnte unverändert. Der Schutzperimeter ist häufig in zwei Bereiche unterteilt:
• Der Bereich A umfasst die Fortpflanzungsgewässer und die unmittelbaren Landlebensräume.
• Der Bereich B schützt Bereiche abseits der Fortpflanzungsgewässer, die für die Amphibien von Bedeutung sind (z. B. weiter entfernt liegende Landlebensräume wie Wald und Wanderkorridore). Zudem dient der Bereich B als Puffer vor schädlichen Einflüssen auf die Fortpflanzungslebensräume (Amphibienlaichgebiete-Verordnung AlgV, Ryser 2002).

Vor allem die Pionierarten unter den Amphibien wie die Kreuzkröte oder die Gelbbauchunke sind allerdings auf Lebensräume angewiesen, die eine starke räumliche und zeitliche Dynamik aufweisen. Solche Lebensräume finden sie heute fast nur noch in Abbaugebieten wie Kiesgruben. Daher sind rund 10 % der IANB-Objekte sogenannte Wanderobjekte: Der schutzwürdige Lebensraum ist in diesem Fall das Abbaugebiet. Da sich darin die Fortpflanzungsgewässer jedoch durch die Abbautätigkeit immer wieder verschieben und sogar die ganze Grube mit dem Abbau «mitwandert», bezeichnet eine Punktkoordinate den Abbaubetrieb, ohne dass ein fixer Schutzperimeter existiert (AlgV, Ryser 2002).
Laichgewässertypen
Amphibien haben zahlreiche Lebensräume besiedelt, die erst durch menschliche Aktivitäten entstanden sind und heute wertvolle Ersatzlebensräume bilden (Abb. 36). Die grossen Amphibienlebensräume fanden sich nämlich ursprünglich im Flutungsbereich der grossen Fliessgewässer und Seen des Mittellandes. Die Regulierung der Pegelstände führte zum Verlust dieser temporär gefluteten Lebensräume. Zudem fielen grossflächige Feuchtgebiete der Intensivierung der Landnutzung zum Opfer (Lachat et al. 2010). Weil ihre ursprünglichen Lebensräume nicht mehr existieren, mussten zahlreiche Arten auf Sekundärlebensräume ausweichen, die durch den Menschen geschaffen worden sind.
In den Abbaugebieten wie Kies- und Lehmgruben sowie Steinbrüchen haben viele Pionierarten genau die Bedingungen gefunden, die ihnen die regulierten Flüsse nicht mehr bieten: häufige und umfangreiche Materialumlagerungen, die den Bewuchs von Offenböden nachhaltig verhindern und temporär wasserführende, immer wieder neu entstehende flachgründige Tümpel ohne Fressfeinde für die Kaulquappen. Von den bekannten Vorkommen der Kreuzkröte befinden sich schweizweit 41 % in Abbaustellen, bei der Gelbbauchunke ist es ein Drittel. Knapp ein Fünftel der IANB-Objekte sind Materialabbaustellen.
Zu den artenreichsten IANB-Objekten zählen auch Waffenplätze der Armee: grossflächige, wenig intensiv genutzte Naturräume, in denen als relativ seltenes «Katastrophenereignis» das Befahren mit schweren Maschinen zu Bodenverdichtung und damit zur Entstehung von temporär wasserführenden Fortpflanzungsgewässern führt. In den Panzerpisten finden sich entsprechend Lebensräume für Pionierarten wie Kreuzkröte und Gelbbauchunke, in den oft extensiv genutzten Wiesen und Weiden mit Hecken und Waldstücken fühlen sich auch die Bewohner reiferer Lebensräume wie Kammmolch, Laubfrosch, Erdkröte und Grasfrosch wohl.
Viele Kiesabbaubetriebe wie auch die Waffenplatzverwaltungen sind aktiv bemüht, Amphibienlebensräume zu erhalten und zu fördern. Veränderte Anforderungen an Nutzung und Rekultivierung stellen aber Herausforderungen dar (vgl. Kap. 6.4).
Abb. 35: Amphibien nutzen ganz unterschiedliche Gewässertypen
Temporär wasserführendes Pioniergewässer in Stetten SH

Fotos: Beratungsstelle IANB
Temporäres Gewässer mit fortgeschrittener Vegetation in Eiken AG Permanentes Laichgewässer in Gunzgen und Boningen SO


Die früher vielfach vorhandenen Feuerweiher (Abb. 37) werden von einer Vielzahl von Arten wie Bergmolch, Feuersalamander, Grasfrosch und Erdkröte als Fortpflanzungsgewässer genutzt. Dabei müssen die Feuerweiher regelmässig ausgepumpt und entschlammt werden. Diese Pflege behagt vor allem der Geburtshelferkröte: Alle paar Jahre werden so die Fressfeinde der Kaulquappen abgepumpt und der Froschlurch findet danach perfekte Bedingungen für die eigene Fortpflanzung. Leider werden viele Feuerweiher heute nicht mehr benötigt und entweder aufgehoben oder nicht mehr gepflegt – was sie wertlos für die Geburtshelferkröte macht.
Vereinzelt finden sich auch ehemalige Fischzuchtanlagen im IANB (Abb. 37). Eine gut entwickelte Ufervegetation ermöglicht in seltenen Fällen die Koexistenz von Fischen und Amphibienlarven. Die Karpfenzucht, bei der zum Abfischen die Weiher abgelassen werden und bis zum Neubesatz mit Jungfischen trocken bleiben, schafft ähnlich den Feuerweihern in einem regelmässigen Turnus gute Fortpflanzungsbedingungen für die Amphibien.
Intensiv genutztes Weide- oder Ackerland kann in den B-Bereichen der IANB-Objekte enthalten sein. Meist werden solche wenig schutzwürdig erscheinende Lebensräume aufgenommen, wenn sie als Wanderkorridor vor Überbauung oder Fragmentierung bewahrt werden sollen. Sie können aber auch als Teil eines Nährstoffpuffers in den Randbereichen aufgenommen werden oder als
Landlebensraum für Arten wie der Kreuzkröte im Ackerland (Abb. 37; Schweizer 2014) oder der Geburtshelferkröte auf Weideland mit Mauslöchern dienen.
in Zahlen
Rund 14 000 Fortpflanzungsgewässer von Amphibien sind in der Schweiz bekannt. Das Inventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung IANB schützt die wertvollsten Gebiete als Verbreitungsschwerpunkte und Ausbreitungszentren der Amphibien in sämtlichen Regionen der Schweiz. Es umfasst insgesamt 929 Objekte mit einer Gesamtfläche von 21 671 ha (Tab. 7). Die IANB-Objekte von nationaler Bedeutung bedecken damit rund 0,52 % der Landesfläche.
Verschiedene geografische Regionen der Schweiz weisen eine unterschiedliche Anzahl Amphibienarten auf. In den Alpen sind Weiher aufgrund der Topografie seltener als im Mittelland, zudem ist die Fortpflanzungssaison in den Bergen für viele Arten zu kurz, so dass die Artenvielfalt mit zunehmender Höhenlage abnimmt. Im Mittelland, wo die meisten Arten vorkommen, ist die Dichte der IANB-Objekte am höchsten (s. Schweizer Karte S. 61). Überdurchschnittlich viele IANB-Objekte liegen im Tessin, weil viele der hier vorkommenden Arten stark gefährdet sind. Über ein Drittel der IANB-Flächen überlappt mit anderen nationalen Biotopinventaren, vor allem Auen und Flachmooren.
Abb. 36: Pionieramphibien brauchen Dynamik in Form von wiederkehrenden «katastrophalen» Ereignissen
Früher haben Hochwasserereignisse Flussauen umgestaltet und dynamische Laichgewässer geschaffen.
Heute bewirken Bagger in Kiesgruben … … oder Panzer auf Waffenplätzen diese Art der Dynamik.



Tab. 7: Anzahl Objekte und Fläche im Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete
Die Fläche der Wanderobjekte ist hier hochgerechnet (Radius von 53 m).
Typ
Ortsfeste Objekte (Bereiche A)
Ortsfeste Objekte (Bereiche B) –
Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023
Das IANB ist das einzige nationale Inventar, das nicht den Schutz eines bestimmten Lebensraums zum Ziel hat, sondern den Schutz einer Artengruppe (S. 66, Abb. 39). Ausser dem Grasfrosch, dem Bergmolch sowie dem WasserfroschKomplex gehören alle Amphibienarten zu den National Prioritären Arten.
Wie wichtig die nationalen Inventarobjekte für die jeweiligen Amphibienarten sind, zeigen die prozentualen Anteile der Arten, die in Inventarobjekten leben. Der stark gefährdete Italienische Laubfrosch kommt beispielsweise mit 80 % der Vorkommen fast ausschliesslich in Inventarflächen vor. Der weitverbreitete Grasfrosch kommt in nationalen Objekten und ausserhalb zwar mit gleicher
Wahrscheinlichkeit vor, doch sehr grosse Populationen finden sich doppelt so häufig innerhalb nationaler Objekte. Beim Alpenkammmolch kommen sehr grosse Populationen sogar ausschliesslich in nationalen Inventarobjekten vor. Diese sind somit wichtige Stützpunkte für die Ausbreitung der Arten.
Zentral sind grossflächige Lebensräume: Objekte von nationaler Bedeutung (Bereiche A und B) sind im Median ca. 12 ha gross. Eine langfristig überlebensfähige Population von Kreuzkröten benötigt zum Beispiel 10 bis 16 ha Ruderalfläche und Pionierweiher (Schmidt 2006). Eine langfristig überlebensfähige Erdkrötenpopulation in einer Flussaue benötigt rund 60 ha Landlebensraum mit viel Totholz (Indermaur und Schmidt 2011).
Entwicklung Artenvielfalt
In den Amphibienlaichgebieten sind viele der Zielarten verloren gegangen (Abb. 38). Durchschnittlich verlor ein Objekt innerhalb von 10 Jahren eine Amphibienart (Bergamini et al. 2019). Die Verluste betreffen besonders die Arten, die auf temporäre Gewässer angewiesen sind (z. B. Gelbbauchunke, Kreuzkröte), aber auch Kammmolch oder Teichmolch. Der Grund für diese Rückgänge liegt im Fehlen von Gewässern mit einem geeigneten Wasserstand zur geeigneten Zeit (Hydroperiode). Entweder führen Gewässer permanent Wasser und sind somit für diese
Abb. 37: Amphibienlebensräume mit engem Bezug zu Mensch und Nahrungsmittelproduktion
Feuerweiher im Emmental mit Vorkommen der Geburtshelferkröte

Naturnah bewirtschafteter Karpfenteich im Mittelland

Kreuzkröten leben unter anderem im Ackerland

Arten ungeeignet, oder die immer trockeneren Wetterverhältnisse im Frühling und Sommer lassen die Gewässer zu früh austrocknen.
Entwicklung der Lebensraumqualität
Die Pionierarten unter den Amphibien (Gelbbauchunke, Kreuzkröte, Geburtshelferkröte) benötigen nebst Gewässern in frühen Sukzessionsstadien mit temporärer Wasserführung auch grosse Flächen an Offenboden. Rückzugsorte für Trockenperioden wie Ast- oder Steinhaufen und Hecken dürfen ebenfalls nicht fehlen. In etwas älteren Gewässern pflanzen sich Molche, Laubfrösche und Springfrösche fort. Auch sie benötigen eine gute Besonnung und temporäre Wasserführung der Gewässer sowie gut strukturierte Landlebensräume.
Die Luftbildanalyse der WBS belegt, dass in den letzten rund 20 Jahren Gehölz- und Offenbodenflächen in den Objekten durchschnittlich abnahmen, während die Wasserfläche zunahm. Die Zunahme der Wasserfläche ist sicher positiv zu gewichten, während die Abnahme von Offenboden für die Pionierarten eine negative Entwicklung darstellt.
Die Generalisten unter den Amphibien (Erdkröte, Grasfrosch, Bergmolch) sind wenig anspruchsvoll in Bezug auf die Gewässer, solange sie fischfrei sind. Auch sie benötigen gut strukturierte Landlebensräume und im Wald viel liegendes Totholz. Diese Arten legen häufig grössere Distanzen zwischen den Landlebensräumen und Fortpflanzungsgewässern zurück. Ihre Wanderkorridore müssen daher im Schutzperimeter mitberücksichtigt werden.
Wenn Fische im Fortpflanzungsgewässer vorkommen, nehmen Amphibienpopulationen ab (Schmidt 2007). Die meisten Amphibiengewässer sind daher natürlicherweise fischfrei. Der künstliche Besatz mit Fischen, seien es Goldfische aus dem Aquarium oder Forellen in Bergseen, stellt daher eine grosse Beeinträchtigung der Amphibiengewässer dar.
In der Materialgewinnung gefährdet eine immer schnellere Dynamik von Abbau und Auffüllung die Amphibienlebensräume. In den letzten 20 Jahren nahm die ungenutzte, offene Fläche in Abbauperimetern im Schnitt um rund ein Drittel ab. Schlammweiher werden bald fast ganz aus den
Abb. 38: Entwicklung der Artenvielfalt in den nationalen Amphibienlaichgebieten von der Inventarisierung (vor 2001) bis zur Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz (WBS) (2011–2017)
Die Säule «AlgV» zeigt die durchschnittliche Artenvielfalt vor der Aufnahme eines Objekts ins Inventar (1980er-Jahre bis 2001). Die Säule WBS zeigt die durchschnittliche Artenvielfalt während der ersten Phase des WBS-Monitorings 2011–2017.
Quelle: WBS, Bergamini et al. 2019a 0 3 2 1 4 5 6 7
Alle Arten
Neuentdeckungen Bekannt
gefährdete Arten Arten temporärer Gewässer
Abb. 39: Amphibienarten der Schweiz inkl. Rote-Liste Status
Alpensalamander
Salamandra atra (LC – nicht gefährdet)

Kammmolch
Triturus cristatus (EN – stark gefährdet)

Erdkröte
Bufo bufo (LC – nicht gefährdet)

Italienischer Laubfrosch
Hyla intermedia (EN – stark gefährdet)

Ital. Springfrosch
Rana latastei (VU – verletzlich)

Feuersalamander
Salamandra salamandra (VU – verletzlich)

Teichmolch
Lissotriton vulgaris (EN – stark gefährdet)

Geburtshelferkröte
Alytes obstetricans (VU – verletzlich)

Wasserfrosch-Komplex
Pelophylax spp. (VU – verletzlich)

Springfrosch
Rana dalmatina (EN – stark gefährdet)

Bergmolch
Ichthyosaura alpestris (LC – nicht gefährdet)

Alpenkammmolch
Triturus carnifex (EN – stark gefährdet)

Gelbbauchunke
Bombina variegata (VU – verletzlich)

Europäischer Laubfrosch
Hyla arborea (VU – verletzlich)
Fadenmolch
Lissotriton helveticus (VU – verletzlich)

Kreuzkröte
Rana temporaria (LC – nicht gefährdet) 1

Epidalea calamita (EN – stark gefährdet)

Grasfrosch

Gruben verschwinden, da sie heute platzsparend durch Wasserkreisläufe ersetzt werden können und nur noch unerwünschtes «Leervolumen» darstellen. Die Rekultivierung erfolgt um ein bis zwei Jahre früher als noch um die Jahrtausendwende.
Auch standortfremde Amphibien sind problematisch. Alpenkammmolche, die ursprünglich nur auf der Alpensüdseite heimisch waren und auf der Alpennordseite ausgesetzt wurden, oder sich ausbreitende Seefrösche aus Osteuropa bedrohen die angestammten Arten durch Konkurrenz, Prädation oder als Reservoir von Krankheiten. Ihre Bekämpfung – wo überhaupt noch möglich – ist enorm zeit- und kostenintensiv.
6.5 Blick in die Zukunft
Die aufgeführten Beeinträchtigungen werden in den kommenden Jahren nicht abnehmen. Mit zahlreichen Massnahmen und teilweise neuen Instrumenten versucht der Amphibienschutz, die negativen Tendenzen aufzufangen. Ein Langzeitmonitoring hat gezeigt, dass es mittels massiver Neuschaffung von vernetztem Lebensraum gelingen kann, dass abnehmende Populationen wieder zunehmen: Dank der Schaffung von Hunderten von neuen Teichen und Tümpeln im Kanton Aargau konnten zwischen 1991 und 2019 rund 63 % der 43 untersuchten Metapopulationen vergrössert werden, weitere 14 % wurden stabilisiert (Moor et al. 2022).
info fauna – karch und das IANB-Beratungsteam haben aufgrund der Artvorkommen prioritäre Gebiete für den Amphibienschutz ausgewiesen, damit grosse Metapopulationen besser gefördert werden können (Pellet et al. 2020, Abb. 40).
Diese Grundlage zeigt wo das beste Kosten-Nutzenverhältnis für die Förderung der Amphibien möglich ist.
Gemeinsam handeln
Für die Pflege der Lebensräume in Abbaugebieten haben sich Begleitgruppen bewährt, bestehend aus Betreibern, Vertretern des Kantons und NGOs. Bei regelmässigen Treffen werden Massnahmen zur Artenförderung während des Abbaus festgelegt. So können konstant genügend Amphibienlebensräume im offenen Abbau bereitgestellt werden. Da schwere Maschinen bereits vor Ort sind, lassen sich Massnahmen unkompliziert und kostengünstig realisieren.
Beweidung zur Offenhaltung
Durch den zunehmenden Stickstoffeintrag aus der Luft wird die Pflege von Ruderalbiotopen aufwändiger und kostenintensiver. Der Unterhalt solcher Objekte in einem für Pionieramphibien idealen Zustand ist teuer. Viele Kantone experimentieren daher mit Beweidung durch anspruchslose Nutztierrassen zur Offenhaltung der Flächen (Abb. 41).
Vernetzung verbessern
Dass die Vernetzung zurzeit für den Erhalt der Amphibien nicht ausreicht, belegt der anhaltende Rückgang der meisten Arten in fast allen Regionen der Schweiz (Schmidt et al. 2023). Der Aufbau von einem Netzwerk von ökologisch qualitative wertvolle Flächen ist eine grosse Chance, die Amphibienpopulationen zu unterstützen.
Je grösser eine qualitativ wertvolle Fläche ist, umso grösser sind die Populationen. Das IANB-Beratungsteam hat daher die in IANB-Objekten vorkommenden Lebensräume kartiert und sie mit Daten zu den Amphibienvorkommen verbunden (Siffert et al. 2022). Die Arbeit liefert genauere Kenntnisse darüber, welche Flächen mit spezifischen Lebensräumen eine bestimmte Art für eine gewisse Populationsgrösse benötigt.
Abb. 40: Prioritäre Gebiete für den Amphibienschutz
Die Priorisierung basiert auf der Anzahl stark gefährdeter Arten pro km2 und der Anzahl sehr grosser Populationen der stark gefährdeten Arten.
Anzahl gefährdete Arten pro km2 1 2 3 4 5 6 7

So können künftig Minimalflächen und Optimalzustände der Lebensräume für die IANB-Arten definiert werden.
Neue Laichgebiete
Wichtig ist die Neuanlage weiterer Laichgebiete in der Nähe vorhandener Amphibienvorkommen. Im Idealfall weist das Laichgebiet mehrere Gewässer unterschiedlicher Hydroperioden auf sowie vielfältige Landlebensräume. Häufige Arten, wie Bergmolch, Grasfrosch und allenfalls Erdkröte, stellen sich meist schnell ein. Sind genügend temporäre Gewässer und Pionierlebensräume vorhanden, darf auch auf die Besiedlung durch stark gefährdete Arten wie Gelbbauchunke, Kammmolch oder den Laubfrosch gehofft werden.
Anschliessend braucht es einen gezielten und langfristig angelegten Unterhalt. Pionierlebensräume müssen regelmässig maschinell oder durch Beweidung in der Sukzession zurückgesetzt werden, temporäre Gewässer jährlich abgelassen und von aufkommender Vegetation befreit werden. Über die Jahre siedeln sich so im Idealfall genügend Amphibienarten an und bauen grosse Populationen auf, so dass das Laichgebiet nationalen Wert erhält (s. Beispiele gelungener Sanierungen von Amphibienlaichgebieten, S. 69).
Abb. 41: Beweidete Amphibienlaichgebiete
Verschiedene Nutztierrassen können für die Offenhaltung von Flächen verwendet werden, wobei bei der Beweidung nicht nur die Ansprüche der Amphibien berücksichtigt werden müssen, sondern auch die der Nutztiere selbst.


Beispiele gelungener Sanierungen und Neuschaffungen von Amphibienlaichgebieten
Ablassbare Weiher
Die Ruderalflächen und temporären Tümpel in der ehemaligen Kiesgrube Mettlen im Kanton Bern sind heute ein Paradies für Kreuzkröten und Gelbbauchunken. Die ausgediente Kiesgrube wurde wegen der riesigen KreuzkrötenVorkommen nach der Rekultivierung ins IANB aufgenommen. Lehm- und Betonweiher werden regelmässig abgelassen und maschinell neugestaltet, Galloway- und Hochland-Rinder beweiden die Flächen, damit sie offen und wenig bewachsen bleiben.

Das IANB-Objekt Spitzmäder im St. Galler Rheintal ist eine ehemalige Torfstichfläche, die nicht mehr genutzt wird und seit Ende der 1990er-Jahre als Naturschutzfläche vom Verein Pro Riet gepflegt wird. Die naturnahe Bewirtschaftung mit Einstau von Streueflächen im Sommerhalbjahr und dem Unterhalt der Torfstichflächen kam zwar für den Laubfrosch zu spät: dieser ist im Rheintal ausgestorben. Aber Kamm- und Teichmolch sowie die häufigen Amphibienarten und zahlreiche Insekten, Pflanzen, Vögel und Säugetiere profitieren von den Riedflächen.


7.1 Merkmale des Biotoptyps
Artenreiches Grünland auf mageren (nährstoffarmen) und trockenen oder wechseltrockenen Standorten ist meistens eine Folge der traditionellen landwirtschaftlichen Nutzung und ein wichtiges Kulturgut der Schweiz. Um die ganze Palette der verschiedenen Vegetationstypen abzubilden, musste für das Bundesinventar ein prägnanter Name gefunden werden: «Trockenwiesen- und weiden» – kurz TWW – vereint die aus ökologischer Sicht wertvollsten trocken-mageren Grünlandgesellschaften in einem Begriff.
Geologischer Untergrund, Bodeneigenschaften, Relief und Klima sind die wichtigsten natürlichen Standortfaktoren, welche das Vorkommen und die Ausprägung der Trockenwiesen und -weiden direkt beeinflussen. TWW zeichnen sich durch zeitweilige Trockenheit und v. a. durch Nährstoffarmut aus. Folgende Voraussetzungen begünstigen ihr Vorkommen: Sickerfähiger Untergrund, Südexposition, geringe Niederschläge sowie geringe Luftfeuchtigkeit (z. B. Föhnlagen, kontinental geprägtes Klima).
Nationale Bedeutung
Für die Erfassung im Bundesinventar der Trockenwiesen und -weiden wurde ein Kartierschlüssel entwickelt (Eggenberg et al. 2001). Dafür wurden regional angepasste Minimalflächen festgelegt: Im Mittelland gelten bis heute 30 Aren als minimale Flächengrösse, im Sömmerungsgebiet 200 Aren.
Auch heute prüfen Experten und Expertinnen mit dem sogenannten «Schwellenschlüssel», ob die Flächen die Kriterien für ein potenziell nationales TWW-Objekt erfüllen. Ein wichtiges Kriterium ist das Vorkommen von floristischen Zeigerarten:
• Pro 25 m2-Flächen mindestens 6 Indikatorarten von Trocken- oder Halbtrockenrasen, Rostseggenhalden, Blau- oder Borstgrasrasen oder die Fläche weist einen Deckungsanteil der Zeigerarten von mindestens 50 % auf. Artenreiche Ausprägungen der Fettwiesen (u. a. artenreiche Fromentalwiesen) sowie Feuchtwiesen werden im TWW-Inventar ebenfalls berücksichtigt, sofern sie genügend Trockenheitszeiger aufweisen.
Verteilung der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung
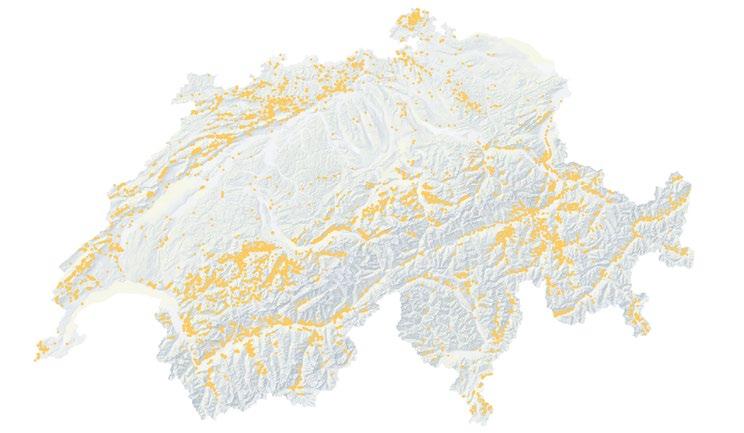
Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023
Im Inventar wurden 19 Vegetationsgruppen in über 350 verschiedenen Ausprägungen («Vegetationstypen») unterschieden.
Halbtrockenrasen (Mesobromion)
Schweizweit am meisten Inventarflächen sind Halbtrockenrasen mit Charakterarten wie Wiesen-Salbei (Salvia pratensis), Aufrechte Trespe (Bromus erectus), Feld-Thymian (Thymus serpyllum aggr.) oder Gemeines Sonnenröschen (Helianthemum nummularium)
Foto: Puidoux VD
© Gaby Volkart/atena

Trockenrasen (Xerobromion)
Echte Trockenrasen enthalten besonders viele schützenswerte Arten. Heute sind sie nur noch sehr selten auf flachgründigen Böden zu finden. Charakterarten sind unter anderem Gemeiner Natternkopf (Echium vulgare), Hügel-Waldmeister (Asperula cynanchicha) und die im Bild sichtbare Gemeine Kugelblume (Globularia bisnagarica)
Foto: Bei Genf
© Gaby Volkart/atena

Saumartiger Halbtrockenrasen (Origanetalia)
Weniger oft oder spät geschnittene TWW enthalten Saumarten wie den im Bild sichtbaren Purpur-Klee ( Trifolium rubens) oder das Laserkraut (Laserpitium latifolium und L. siler) oft auch den namensgebenden Echten Dost (Origanum vulgare)
Foto: Urnerboden UR
© Monika Martin/oekoskop




Rostseggenhalde (Caricion ferrugineae)
Die hoch gelegenen, steilen Rostseggenhalden dienten als Heulieferanten für die Berglandwirtschaft. Heute werden diese Flächen vor allem in der Innerschweiz und im Kanton Bern noch geschnitten. In der Westschweiz sind sie meist beweidet. Im Bild eine Wiese mit sehr viel Straussblütiger Glockenblume (Campanula thyrsoides)
Foto: Urserental UR © Guido Masé/oekoskop
Blaugrashalde (Seslerion)
Die auf flachgründigen Böden wachsenden Blaugrashalden sind oft sehr blütenreich. Im Foto sichtbar sind der Kalk-GlockenEnzian (Gentiana clusii), die Herzblättrige Kugelblume (Globularia cordifolia) und das namengebende Blaugras (Sesleria caerulea)
Foto: Oberhalb Bex VD © Monika Martin/oekoskop
Artenreicher Borstgrasrasen (Nardion)
Nur diejenigen Borstgrasrasen sind im nationalen TWW-Inventar, welche eine speziell grosse Artenvielfalt aufweisen. Das Foto zeigt ein Objekt mit viel Arnika (Arnica montana) und Mücken-Handwurz (Gymnadenia conopsea).
Foto: Rauft Gurtnellen UR © Monika Martin/oekoskop
Abb. 42: Flächenanteile der Vegetationsgruppen im TWW-Inventar
Südalpine Blaugrashalde (0,1 %)
Subkontinentaler Trockenrasen (0,3 %)
Goldschwingelhalde (0,5 %)
Trockene Saumgesellschaft (0,9 %)
Subatlantischer Trockenrasen (1,1 %)
Artenarmer Trockenrasen der tieferen Lagen (1,2 %)
Vegetationsgruppe
Steppenartiger Halbtrockenrasen (1,8 %)
Vegetationstyp nicht bestimmt (2,1 %)
Halbruderaler Trockenrasen (2,7 %)
Artenarmer Trockenrasen der höheren Lagen (2,9 %)
Borstgrasrasen (3,2 %)
Trockener Halbtrockenrasen (3,8 %)
Steppenartiger Trockenrasen (6 %)
Trockene, artenreiche Fettwiese (6,5 %)
Rostseggenhalde (7,7 %)
Buntschwingelhalde (10,2 %)
Echter Halbtrockenrasen (12 %)
Blaugrashalde (18,1 %)
Nährstoffreicher Halbtrockenrasen (18,9 %)
Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023 0 5 10 15 20 Anteil ( %) der Gesamtfläche im TWW-Inventar
Weil der Fokus auf den besonders gefährdeten, regelmässig bewirtschafteten TWW lag, wurden reine Felsstandorte (mit weniger als 25 % Vegetation) und fast geschlossene Waldbestände (Baumschicht über 50 %) sowie alpine Rasen nicht erfasst. Die Flächen dürfen max. 75 % Nicht-TWW-Fläche (Wald, Gebüsch, Feuchtstellen, Fels) enthalten.
Bei der Festlegung der nationalen Bedeutung eines Objekts kam nach der Kartierung eine umfassende Bewertungsmethodik zur Anwendung (Eggenberg et al. 2001). Es wurden nur die wertvollsten TWW ins Bundesinventar aufgenommen. Dabei handelt es sich z. B. um besonders grosse Objekte oder solche mit einer besonders wertvollen Vegetation und mit Strukturelementen. Das bedeutet: Neben den Objekten von nationaler Bedeutung gibt es weitere bekannte wertvolle magere Blumenwiesen; diese werden auf kantonaler oder kommunaler Ebene geschützt.
Vereinzelt wurden ganz besonders einzigartige Trockenstandorte identifiziert. Solche Spezialfälle werden «Singularitäten» genannt. Sie zeichnen sich durch besonders viele oder sehr spezielle gefährdete Arten oder durch besondere Nutzungsformen aus, oder sie stellen ein
charakteristisches Landschaftselement dar. Solche Flächen können als Singularität auch dann in das Inventar aufgenommen werden, wenn sie nicht alle Grundkriterien der Kartiermethode erfüllen.
Andere Vegetationsgruppen sind eher selten (Subatlantische Trockenrasen) oder kommen nur regional vor (Subkontinentale Trockenrasen, Goldschwingelhalden, Südalpine Blaugrashalden) (Abb. 42). TWW können sich nicht nur als offene Wiesen und Weiden präsentieren, sondern auch als lichter Wald, als Waldweide oder als mit Mooren vergesellschaftetes Lebensraummosaik.
In der kollinen (bis ca. 600 m ü. M.) und montanen Stufe (600–1200 m ü. M.) sind für die Differenzierung der Vegetation der Nährstoff- und Feuchtegradient entscheidend. Extrem trockene Steppen- und Trockenrasen liegen auf der einen, artenreiche Fettwiesen auf der anderen Seite der Skala. In der subalpinen und alpinen Stufe ist die Vegetation zudem stark vom Säuregehalt des Bodens abhängig, so dass Borstgrasrasen und Buntschwingelhalden auf sauren Silikatgesteinen den einen Pol bilden, und Blaugrasrasen auf Kalkgesteinen den anderen (Eggenberg et al. 2001).
Nutzung
Die 28 281 Hektaren TWW von nationaler Bedeutung werden von über 15 000 Landwirtschaftsbetrieben bewirtschaftet. Der grösste Teil wird beweidet (64 %); nur rund 24 % werden noch gemäht. Weitere 12 % der Fläche wurde als Brache (ungenutzte Flächen) erfasst (Abb. 43). In den letzten Jahrzehnten hat der grosse Arbeitsaufwand viele Landwirte dazu bewogen, ihre Trockenwiesen mit Rindern oder Schafen zu beweiden. In zahlreichen Regionen hat deshalb die Erhaltung der restlichen Mähwiesen mit ihrer ganz spezifischen Artenzusammensetzung erste Priorität.
Die Anforderungen an die Nutzung der Trockenwiesen und -weiden sind in der Vollzugshilfe und in verschiedenen Faktenblättern geregelt (Dipner, Volkart et al. 2010). Die wichtigsten Punkte sind: keine Düngung (auch nicht via Zufütterung), keine Bewässerung und kein Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln.
Trockenwiesen
Trockenwiesen werden je nach Standort ein- bis zweimal jährlich geschnitten und manchmal im Herbst noch mit Rindern beweidet (s. auch Dipner, Volkart et al. 2010 sowie Jöhl und Dipner 2019). In Wiesen haben relativ hochwachsende Pflanzen mit guter Schnittverträglichkeit die besten Überlebenschancen. So sind TWW-Schlüsselarten wie Wiesen-Salbei (Salvia pratensis), FlaumWiesenhafer (Helictotrichon pubescens), Saat-Esparsette (Onobrychis viciifolia) oder Knäuelblütige Glockenblume (Campanula glomerata) markant häufiger in Wiesen als in Weiden zu finden.
Eine besondere Wiesennutzung ist das sogenannte Ätzheu: Die Trockenwiese wird vor der Alpung des Viehs für eine kurze Frühlingsweide genutzt. Im späteren Sommer wird auf diesen Flächen dann das Ätzheu geschnitten. Die Ätzheunutzung erfolgt in der Regel später als ein normaler Heuschnitt.
Abb. 43: Verteilung der TWW-Fläche nach Nutzung
Total 28 281 ha
Pferdeweide (1,8 %)
Ziegenweide (0,2 %)
Schafweide (9,2 %)
Übrige Dauerweide (4,4 %)
Andere Nutzung (0,2 %)
Die wohl spektakulärste Form der Wiesennutzung ist das Wildheuen (Abb. 44). Die oft schwindelerregend hoch und steil gelegenen Mähwiesen im Sömmerungsgebiet werden als Wildheuplanggen bezeichnet. Rund 1000 ha Wildheu-Flächen sind im TWW-Inventar erfasst. Davon liegen die meisten in der Zentralschweiz sowie im Kanton Bern. Wegen der riskanten, anspruchsvollen und aufwändigen Mahd sind die Wildheuflächen besonders durch Nutzungsaufgabe gefährdet. Auf nicht mehr genutzten Wildheuplanggen nimmt die Artenvielfalt in der Regel ab.
Trockenweiden
Mähwiese oder Mähweide (20,7 %)
(4,1 %)
Ungenutzt, brach (12,5 %)
Rinderweide (47,5 %)
Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023
Rund zwei Drittel der TWW-Fläche wird als Weide genutzt. Am häufigsten ist eine Beweidung mit Rindern (Abb. 45). Diese eignen sich besonders gut, da sie weniger selektiv fressen als Schafe und Ziegen und das Grünland damit gleichmässiger abweiden.
Weiden stehen den Wiesen in Sachen Artenzahlen um nichts nach. Denn Tritt und Frass schaffen Lücken und Nischen, auf welche spezialisierte Tier- und Pflanzenarten angewiesen sind. Typische Trockenweidenpflanzen sind stachelig, haben Blattrosetten oder bilden Ausläufer, um sich vor dem Gefressenwerden zu schützen.


Viele Trockenweiden brillieren durch ihren Strukturreichtum. Dies gilt besonders für Waldweiden oder Kastanienselven im Tessin. Die langfristige Erhaltung dieser – auch landschaftlich interessanten – Vielfalt erfordert einen grossen Einsatz der Landwirte: Ohne regelmässige Weidepflege verunkrauten und verbuschen die meisten Extensivweiden relativ schnell ( Volkart et al. 2008).
Rund 10 % der TWW-Fläche wird mit Schafen beweidet. Eine gute Bewirtschaftung mit Schafen ist anspruchsvoll, da Schafe bestimmte Kräuter gezielt abfressen. Gräser können daher auf Schafweiden rasch überhandnehmen (Schiess-Bühler und Martin 2008). Schafe ermöglichen aber die Offenhaltung von TWW-Flächen auf flachgründigen Böden in Steillagen, wo Rinder zu schwer wären. Ziegen wiederum fressen gerne Gehölze, weshalb sie zur Beweidung verbuschender Flächen eingesetzt werden.
Für alle Tierarten gilt: Die Beweidung muss sehr extensiv sein. Weiden zu viele Tiere zu lange in der Fläche, zerstören sie die charakteristische Trockenweiden-Vegetation in wenigen Jahren (Perrenoud und Godat 2006, SchiessBühler und Martin 2008, Martin et al. 2007, 2008 und 2018a/b).
Das Bundesinventar der TWW von nationaler Bedeutung umfasst 3951 Objekte mit einer Gesamtfläche von 28 281 Hektaren (Tab. 8). Davon liegen 44 % auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN), 46 % im Sömmerungsgebiet und rund 10 % sind nicht-landwirtschaftlich genutzte Flächen. Die TWW-Objekte von nationaler Bedeutung bedecken 0,68 % der Landesfläche.
60 % der TWW-Fläche befindet sich in der subalpinen Höhenstufe ab ca. 1500 m ü. M. bis zur Waldgrenze. Die meisten Objekte liegen im Jura sowie in den Alpen (s. Schweizer Karte S. 73). Sie verteilen sich ungleich über die einzelnen Kantone. Spitzenreiter sind die vier Kantone Graubünden, Waadt, Wallis sowie Bern. Dies widerspiegelt unter anderem
Tab. 8: Bundesinventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung
Anzahl Objekte und Fläche ober- und unterhalb der Sömmerungslinie.
Typ
ausserhalb Sömmerungsgebiet
Datenbasis: Biotopdaten BAFU, 2023
Anzahl Objekte Fläche [ha] Flächenanteil CH %
die Grösse der Kantone sowie die günstigen naturräumlichen Voraussetzungen. Der Kanton Wallis besitzt aufgrund seiner klimatischen Bedingungen (kontinentales Klima mit geringen Niederschlägen und geringer Bewölkung, intensiver Sonneneinstrahlung und starken Temperaturschwankungen) besonders gute Voraussetzungen für die Entstehung von wertvollen TWW, so dass die Anzahl inventarisierter Flächen auf die besten TWW-Komplexe beschränkt wurde.
Trockenwiesen und -weiden gehören zu den artenreichsten Lebensräumen der Schweiz. Auf einer Fläche von nur einer Are können bis zu 100 verschiedene Pflanzenarten vorkommen. Auch ein Grossteil der einheimischen Schmetterlinge, Heuschrecken, Wildbienen und Schnecken kommt in TWW vor und ist teilweise sehr stark von diesen abhängig. Reptilien, Vögel und Säugetiere nutzen ebenfalls die klimatisch begünstigten, strukturreichen und extensiv genutzten Flächen.
In TWW leben viele National Prioritäre Arten (NPA). Einige häufige NPA in TWW sind der Apollo (Parnassius apollo), der Libellen-Schmetterlingshaft (Libelloides coccajus), die Zauneidechse (Lacerta agilis) sowie das Kleine Knabenkraut (Orchis morio) (Abb. 46).
Strukturen tragen massgeblich zum ökologischen Wert eines TWW-Objektes bei. Bei der Kartierung und der Bewertung
Abb. 47: Strukturreiche und damit ökologisch besonders wertvolle Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung
Oben: Lebensraummosaik in der Chestenweide am Rigi LU.
Unten: Wertvolle Dornbüsche in der Blauenweide BL.


werden sie daher als «Strukturelemente» innerhalb der Objekte sowie angrenzend als «Grenzelemente» einbezogen (Abb. 47). Hecken, Büsche, Waldränder, Trockenmauern, Einzelbäume, Felsblöcke, Quellaufstösse, Dolinen und viele
Abb. 46: Charakteristische Arten der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung
Zauneidechse (Lacerta agilis)

Rotflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda germanica)

Kleines Knabenkraut (Orchis morio)

Libellen-Schmetterlingshaft (Libelloides coccajus)

Abb. 48: Arten strukturreicher Trockenwiesen und -weiden
Die schwarze Mörtelbiene (Megachile parietina) ist in der Nordschweiz extrem selten geworden und oft auf TWWFlächen angewiesen. Sie nutzt Steine und Felsen für den Nesterbau.

Der Neuntöter (Lanius collurio) benutzt Dornsträucher als Nistplatz, Jagdwarte und «Vorratskammer» zum Aufspiessen der Nahrung. Seine Beute (v. a. Grossinsekten wie die Feldgrillle) findet er auf vegetationsfreien Stellen.

A. Trepte/blickwinkel
mehr weisen einen regionaltypischen Charakter auf und sind landschaftsprägend. Der Fauna bieten sie zusammen mit der Trockenvegetation das notwendige Lebensraummosaik (Abb. 48).
Die Rodungen vor allem im frühen Mittelalter öffneten das Waldkleid der Schweiz und schufen eine vielfältige Kulturlandschaft. Das Grünland wurde lange Zeit nur beweidet. Vor rund 200 Jahren kam die Stallhaltung und damit verbunden eine vermehrte Mähnutzung zur Gewinnung von Heu auf. Der Mist wurde hauptsächlich auf den Ackerflächen ausgebracht, die Wiesen blieben magere (nährstoffarme) Standorte.
Schätzungen gehen davon aus, dass magere Trockenstandorte um 1900 eine Fläche von 760 000 Hektaren bedeckten (Lachat et al. 2010). Im 20. Jahrhundert setzte ein starker Rückgang ein, insbesondere nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Flächenrückgang beträgt seit 1900 95 % (Lachat et al. 2010). War trockenes, artenreiches Wies- und Weideland in der Kulturlandschaft einst die
Struktur- und Grenzelemente nach Kategorien
• Gehölze: Einzelbäume, Büsche, Hecken, Waldränder
• Mineralische Strukturen: Steinhaufen und -mauern, Felsblöcke, offener Boden, Ruine, Stall
• Feuchtstrukturen: Quellaufstösse, Bäche, Vernässungen
Vegetationsstrukturen: Hochstaudenflure, Ruderalvegetation, ungenutzte Rasen
Regel, ist es heute zur Ausnahmeerscheinung geworden. Im Mittelland sowie auf der Alpensüdseite beträgt der Rückgang sogar geschätzte 99 %.
Was sind die Hauptgründe für diese sehr starke Abnahme?
Der Einsatz von Kunstdünger, Gülle und zugekauften Futtermitteln sowie die zunehmende Mechanisierung der Landwirtschaft (bessere Zugänglichkeit, Entfernung von Strukturen) verwandelten viele Trockenstandorte in produktiveres – aber auch artenarmeres Grünland. Auf der anderen Seite wurde die Nutzung sehr schwer zugänglicher und steiler Lagen aufgegeben. Dort wurde das trockene, artenreiche Grünland wieder zu Wald. Zudem gab es auch Verluste durch Überbauungen an gut besonnten Standorten in Siedlungsnähe und für Infrastrukturen (Abb. 49).
Ein Vergleich der kantonalen Magerwieseninventare aus den 1980er-Jahren mit dem Bundesinventar 2010 belegt, dass auch Ende des 20. Jahrhunderts noch zahlreiche weitere Flächen intensiviert oder überbaut wurden. Die Abnahme der Magerstandorte beträgt je nach Region zwischen 17 und 43 % der in den 1980er-Jahren erfassten kantonalen Inventarflächen (Eggenberg et al. 2008, ProSeco 2007).
Daten der WBS zeigen zudem, dass sich die ökologische Qualität der TWW seit 1995 verschlechtert hat. Der Lebensraum wurde nährstoffreicher, dichter und schattiger. Der Stickstoffeintrag über die Luft und eine vielerorts zunehmende Verbuschung mangels Weidepflege verändern die Pflanzenzusammensetzung (Bergamini et al. 2020).
7.5 Blick
Um den Negativtrend zu brechen und die ökologische Qualität der TWW zu bewahren, sind zusätzliche Anstrengungen nötig. Zahlreiche aktuelle Projekte streben die Trendwende an (s. Beispiele gelungener Sanierungen und Neuschaffungen TWW, S. 82–83).
Nicht bewirtschaftete TWW erhalten Brachen mit seltenen Arten benötigen nicht immer eine regelmässige Nutzung. In sehr hohen Lagen bleiben einige auch ohne Pflege erhalten, unterhalb der Baumgrenze ist aber eine extensive Bewirtschaftung essenziell, damit die Fläche nicht verwaldet. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft führt dazu, dass auf vielen TWW-Flächen keine traditionelle bäuerliche Nutzung mehr stattfindet. Alternativen bieten Landschaftspflege-Betriebe, Pflegeeinsätze von Jägern oder Forstbetrieben, Gruppeneinsätze mit Schulen, Zivildienstleistenden oder Freiwilligen, welche die Bewirtschaftung aufrechterhalten.
Auf verbuschten Trockenstandorten können Ziegen helfen: Sie fressen Gehölze und drängen diese zurück. Weitere exotisch anmutende Weidetiere kommen fallweise zum Einsatz, so Zwerg-Zebus, Schottische Hochlandrinder oder Yaks.
Neue Trockenwiesen und -weiden schaffen
An erster Stelle steht der Schutz noch bestehender, bisher nicht geschützter Trockenwiesen und -weiden:
artenreiche alpine Rasen, TWW hoher Lagen oder Restflächen im Mittelland. Neue TWW sind aber wichtige Ergänzungen im Netz der Trockenstandorte. Für die Neuschaffung von TWW eignen sich Rohböden (z. B. an Bahn- und Strassenböschungen), flachgründige, skelettreiche Böden sowie trockenwarme, lichte Wälder mit schon vorhandener Trockenvegetation. Durch Übertragung von Schnitt- oder Saatgut von nahe gelegenen TWW-Flächen können typische Arten eingebracht werden. Die farbigen Blumenwiesen mit einer reichen Fauna erfreuen Erholungssuchende sowie Touristinnen und Touristen.
Abb. 49: TWW-Verluste durch Überbauung am Südhang oberhalb von Tamins (GR) Aufgrund der standörtlichen Bedingungen ist anzunehmen, dass in den 1950er-Jahren überwiegend TWW-Vegetation vorhanden war. In Rot dargestellt ist der aktuelle Umriss des TWW-Objektes. Durch die Überbauungen ist ein Grossteil der ursprünglichen TWW-Vegetation verschwunden.


Beispiele gelungener Sanierungen und Neuschaffungen von TWW
Gemeinschaftliches Arbeiten und Landschaftspflegebetriebe
Auf vielen Weiden ist die Pflege gemeinschaftlich organisiert. Auf der Blauenweide (BL) helfen rund 40 Freiwillige einen Tag pro Jahr.

Die Naturschutzgruppe «Pro Biotop» besteht aus Personen aus Forst-, Landwirtschafts- und Gartenbauberufen. Sie entbuschen seit 2017 zahlreiche TWW. Diese Trockenwiese in Schiers GR wird heute vom Jagdverein gepflegt.

Betriebe, die auf die Pflege von extensiven Lebensräumen spezialisiert sind, unterhalten oft aufwändige Flächen, wie hier bei Twann BE.

Entbuschung und Neuschaffung: Ziegenweiden, lichte Wälder und nicht humusierte Böschungen



Im Thurauenwald bei Flaach (ZH) werden seit Mitte der 1990er-Jahre lichte Wälder angelegt. Aus benachbarten Objekten wird Schnittgut in die neuen lichten Wälder gebracht.
In den Kantonen GR und UR weidet seit 2018 eine Wanderziegenherde auf verbuschten TWW-Flächen (im Auftrag von Pro Natura). Die Ziegen haben sich hier bewährt, sie fressen mit Vorliebe an den Sträuchern.
In Glattfelden (ZH) wurden in den letzten Jahren im grösseren Stil Trockenwiesen neu angelegt. Hier eine nicht humusierte Böschung entlang einer neuen Umfahrungsstrasse, welche mit Schnittgut aus benachbarten TWW begrünt wurde.
Abegg J., Bonnard L. 2021: Ökologisch erforderliche Abflüsse in Auengebieten, Expertenbericht im Auftrag des BAFU, interne Version 2021, Zürich und Bern.
BAFU (Hrsg.) 2023: Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich 2025–2028. Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde an Gesuchsteller. Bundesamt für Umwelt, Bern, 249 S.
BAFU (Hrsg.) 2019a: Liste der National Prioritären Arten und Lebensräume. In der Schweiz zu fördernde prioritäre Arten und Lebensräume. Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Vollzug Nr. 1709: 99 S.
BAFU (Hrsg.) 2019b: Mittelfluss, Empfänger und Wirkung der Investitionen in Naturschutz und Waldbiodiversität. Kantonsbefragung. Schlussbericht. Bundesamt für Umwelt, Bern.
BAFU (Hrsg.) 2020: Bundesinventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung – Stand und Handlungsbedarf. Bundesamt für Umwelt, Bern.
BAFU (Hrsg.) 2022: Stand der Umsetzung der Biotopinventare von nationaler Bedeutung. Kantonsumfrage 2021. Bundesamt für Umwelt, Bern.
BAFU (Hrsg.) 2022: Die biogeographischen Regionen der Schweiz. 1. aktualisierte Ausgabe 2022. Erstausgabe 2001. Bundesamt f ü r Umwelt, Bern. Umwelt-Wissen Nr. 2214: 28 S.
BAFU (Hrsg.) 2023: Biodiversität in der Schweiz. Zustand und Entwicklung. Umwelt-Zustand 2306. 95 S.
BAFU und InfoSpecies (Hrsg.) 2023 Entwurf: Liste der National Prioritären Arten. Arten für die Erhaltung und Förderung in der Schweiz. Bundesamt für Umwelt, Bern.
BFS 2023: Arealstatistik (AREA), Siedlungsflächen erhoben 1985–2018).
Bergamini A., Ginzler C., Schmidt B.R., Bedolla A., Boch S., Ecker K., Graf U., Küchler H., Küchler M., Dosch O., Holderegger R. 2019a: Zustand und Entwicklung der Biotope von nationaler Bedeutung: Resultate 2011–2017 der Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz. WSL Ber. 85. 104 S.
Bergamini et al. 2022: Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz WBS: Auswertungen jährliche Indikatoren 2022.
Bergamini A., Ginzler C., Schmidt B.R., Bedolla A., Boch S., Ecker K., Graf U., Küchler H., Küchler M., Dosch O., Holderegger R. 2019b: Resultate der Wirkungskontrolle Biotopschutz – Kurzfassung. Hrsg.: Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern. 21 S.
Bergamini A., Ginzler C., Schmidt B.R., Bedolla A., Boch S., Ecker K., Graf U., Küchler H., Küchler M., Dosch O., Holderegger R. 2020: Wie verändern sich die Biotope von nationaler Bedeutung? Resultate aus der Ersterhebung der Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz. Natur & Landschaft: Inside (KBNL) 20(1): 12–16.
Bergamini A., Peintinger M., Fakheran S., Moradi H., Schmid B., Joshi J. 2008: Loss of habitat specialists despite conservation management in fen remnants 1995–2006, ScienceDirect, Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 11 (2009) 65–79.
BFS 2014: Raum mit städtischem Charakter 2012, Erläuterungsbericht. 40 S.
Boch S., Ginzler C., Holderegger R., Schmidt B.R., Bergamini A. 2022: Kerngebiete der Ökologischen Infrastruktur: Zustand und Entwicklung Hotspot 45, 8–9.
BUWAL 2002a: Handbuch Moorschutz in der Schweiz. 2 Ordner.
BUWAL 2001: Auen und Pufferzonen, Auendossier, Faktenblatt Nr. 4. 12 S.
Charmillot K., Hedinger C., Babbi, M., Widmer S., Dengler J. 2021: Vegetationsveränderungen in Kalkhalbtrockenrasen des Schweizer Juras über 40 Jahre. Tuexenia 41: 441–457. Göttingen 2021.
Dipner, M., Volkart, G. et al. 2010: Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung. Vollzugshilfe zur Trockenwiesenverordnung. Umwelt-Vollzug Nr. 1017, Bundesamt für Umwelt, Bern. 83 S.
Eggenberg, S., Dalang, T., Dipner, M., Mayer, C. 2001: Kartierung und Bewertung der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung. Technischer Bericht. Schriftenreihe Umwelt Nr. 325. Hrsg.: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bern. 252 S.
Eggenberg S., Volkart G., Hedinger C., Hofmann R. 2008: Referenzobjekte für die Dokumentation von Entwicklungstrends in TWW. Fallstudie zu ausgewählten TWW-Objekten (Referenzobjekten) mit drei zeitlichen Beobachtungsfenstern bzw. zwei Entwicklungstrends. Biotopinventarprogramm BAFU.
Gimmi U., Lachat T., Bürgi M. 2011: Reconstructing the collapse of wetland networks in the Swiss lowlands 1850–2000. Landscape Ecology 26: 1071–1083.
Grünig A. (ed.) 1994: Mires and Man. Mire Conservation in a Densely Populated Country – the Swiss Experience. 415 S.
Gr ünig A., Vetterli L., Wildi O. 1986: Die Hoch- und Übergangsmoore der Schweiz./Les hauts-marais et marais de transition de Suisse. Birmensdorf, Eidg. Forschungsanstalt WSL / Birmensdorf, Inst. fé déral de recherches WSL. Bericht 281/Rapport 281, 62 S./ 58 pp.
Guntern J., Pauli D., Klaus G. 2020: Biodiversitätsfördernde Strukturen im Landwirtschaftsgebiet. Bedeutung, Entwicklung und Stossrichtungen für die Förderung. Hrsg.: Forum Biodiversität Schweiz (SCNAT), Bern. 90 S.
Hanski I., Chris D. Thomas C. D. 1994: Metapopulation dynamics and conservation: A spatially explicit model applied to butterflies, Biological Conservation, Volume 68, Issue 2, 1994, Pages 167–180, ISSN 0006-3207, DOI: 10.1016/0006-3207(94)90348-4
Hunziker Ch. 2020: Biotopobjekte in Agglomerationen. Bericht Info Habitat im Auftrag des BAFU. 47 S.
IPBES 2018: Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger des Regionalen Assessments zur biologischen Vielfalt und Ökosystemleistungen in Europa und Zentralasien der Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. M. Fischer et al. (Hrsg.). IPBES-Sekretariat, Bonn, Deutschland. 48 S.
Indermaur L., Schmidt B. R. 2011: Quantitative recommendations for amphibian terrestrial habitat conservation derived from habitat selection behavior. Ecological Applications 21: 2548–2554.
Jöhl, R.; Dipner, M. 2019: Nutzungsempfehlungen für TWW-Brachen. Bericht im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU.
Joosten H. et al. 2015: MoorFutures. Integration of additional ecosystem services (including biodiversity) into carbon credits – standard, methodology and transferability to other regions, BfN-Skripten 407. Bundesamt für Naturschutz.
Klaus G. (Red.) 2007: Zustand und Entwicklung der Moore in der Schweiz. Ergebnisse der Erfolgskontrolle Moorschutz. Umwelt-Zustand Nr. 0730. Bundesamt für Umwelt, Bern. 97 S.
Küchler M., Küchler H., Bergamini A., Bedolla A., Ecker K., Feldmeyer-Christe E., Graf U., Holderegger R. 2018: Moore der Schweiz: Zustand, Entwicklung, Regeneration. Bern, Haupt: 258 S.
Lachat T., Blaser F., Bösch R., Bonnard L., Gimmi U., Grünig A., Roulier C., Sirena G., Stöcklin J., Volkart G. 2010: Verlust wertvoller Lebensräume. Pages 22–63. In T. Lachat, D. Pauli, Y. Gonseth, G. Klaus, C. Scheidegger, P. Vittoz, and T. Walter, editors. in: Wandel der Biodiversität in der Schweiz seit 1900. Ist die Talsohle erreicht? Zürich, Bristol-Stiftung, Bern, Stuttgart, Wien.
Lüscher B., Zumbach S. 2003: Geburtshelferkröten im Oberaargau. Naturhistorisches Museum, Bern.
Martin M., Jöhl R. et al. 2017, Aktualisierung 2021: Biotope von nationaler Bedeutung – Kosten der Biotopinventare. Expertenbericht zuhanden des Bundes, erstellt im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU. 2. Auflage, 2017.
Martin, M., Volkart, G., Jöhl, R., Hunziker, Ch. 2007: Schafe auf Trockenweiden. Fallstudie im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU.
Martin, M., Volkart, G., Jöhl, R. 2008: Bewirtschaftung von artenreichen Rinderweiden. Analyse der artenreichsten TWW-Rinderweiden: 9 Fallbeispiele. Fallstudie im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU.
Martin, M., Volkart G., Jöhl R., 2018a: Empfehlungen NHGWeideverträge. Bericht im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU.
Martin, M., Jöhl, R., Volkart, G. 2018b: Bewirtschaftung von artenreichen Ziegenweiden. Fallstudie im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU.
Moor H., Bergamini A., Vorburger C., Holderegger R., Bühler C., Egger S., Schmidt B. 2022: Bending the curve: Simple but massive conservation action leads to landscape-scale recovery of amphibians. PNAS, Vol. 119, No 42, 8p.
Müller-Wenk R., Huber F., Kuhn N., Peter A. 2004: Landnutzung in potenziellen Fliessgewässer-Auen – Artengefährdung und Ökobilanzen. Schriftenreihe Umwelt Nr. 361. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern.
Pellet J. 2015 : Analyse de l’évolution des communautés de batraciens dans les sites de reproduction d’importance nationale entre l’OBat (2001–2007) et le programme de suivi des effets de la protection des biotopes en Suisse WBS (2011–2014).
Pellet J., Ramseier P., Tobler U., Zumbach S. 2020: Ein letztes Bollwerk für die bedrohten Amphibien der Schweiz: prioritäre Amphibiengebiete. N+L Inside 1: 37–40.
Pellet, J., Borgula A., Ryser J., Zumbach S. 2012: Bewertung der Laichgebiete und Definition der Schwellenwerte. Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern.
Perrenoud, A., Godat, S. 2006: Trockenwiesen und -weiden: Weidepflege mit Ziegen. Faktenblatt. BAFU & AGRIDEA [Hrsg.], Bern und Lindau. 4 S.
ProSeco 2007: Inventarvergleiche. Bericht im Auftrag des BAFU. 63 S.
Roulier C., Rast S. et Hausammann A. 2007: Plan d’aménagement du Rhône PA-R3 – Outil prédictif du développement des milieux riverains. Service conseil Zones alluviales, Yverdon-les-Bains.
Ryser J, Borgula A, Fallot P, Kohli E, Zumbach S. 2002: Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung – Vollzugshilfe. Vollzug Umwelt. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern.
Schiess-Bühler, C., Martin, M. 2008: Trockenwiesen und -weiden: Schafe in Trockenweiden. Faktenblatt. BAFU & AGRIDEA [Hrsg.], Bern und Lindau. 8 S.
Schmidt B. R. 2006: Beurteilung der Machbarkeit und Anforderungen an eine Umsiedlung der Amphibien der Zurlindengrube ins Gebiet «Lachmatt» (Muttenz). Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (karch), Bern.
Schmidt B. R. 2007: Fische und Amphibien oder Fische vs. Amphibien?, Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (karch), Bern.
Schmidt, B.R., Mermod, M., Zumbach, S. 2023: Rote Liste der Amphibien – Gefährdete Arten der Schweiz. Umwelt-Vollzug. Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern, und info fauna, Neuenburg.
Schweizer E. 2014: Das Ackerbaugebiet – ein Lebensraum für die Kreuzkröte. Milan 3: 4–5.
Siffert O., Pellet J., Ramseier P., Tobler U., Zumbach S. 2022: Caractéristiques d’habitat et taille des populations de batraciens dans les sites d’importance nationale –Rapport final. Service conseil IBN.
Smith, M. A. and Green, D. M. 2005: Dispersal and the metapopulation paradigm in amphibian ecology and
conservation: are all amphibian populations metapopulations? /Ecography 28: 110 /128.
Strebel N., Bühler C. 2015: Recent shifts in plant species suggest opposing land-use changes in alpine pastures. Alpine Botany 125 (1): 1–9.
Volkart G., Godat S. 2008: Mit Nutzungsvielfalt zur Artenvielfalt; nicht zu intensiv aber auch nicht zu extensiv.; Hotspot zu Trockenwiesen und -weiden vom 18.9.2008, S. 8–9.
Übersicht Inventare
(BAFU Inventardaten 2023) Eine umfassendere Tabelle der Inventardaten ist auf der Publikationsseite www.bafu.admin.ch/uz-2404-d einsehbar.